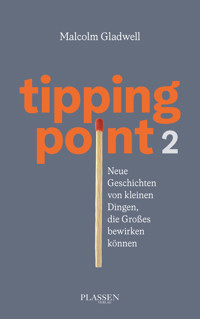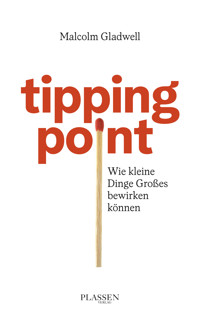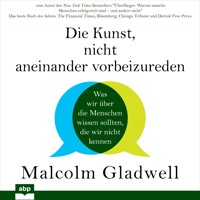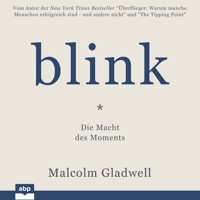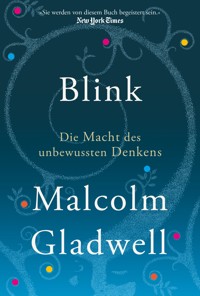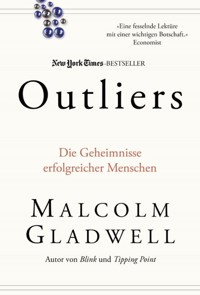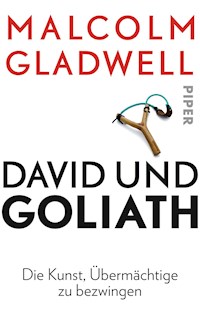11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Instrumente und Strategien, mit denen wir andere Menschen verstehen wollen, funktionieren nicht, schreibt Bestsellerautor Malcolm Gladwell. Und weil wir nicht wissen, wie wir mit Fremden reden sollen, kommt es immer wieder zu Missverständnissen, zu Krisen und Konflikten. Amanda Knox beteuert ihre Unschuld, von den italienischen Richtern wird sie dennoch wegen Mordes verurteilt. Anleger fallen auf Betrüger wie Bernie Madoff rein, die CIA lässt sich von Castros Spionen täuschen, und immer wieder deuten wir die Worte der anderen einfach falsch. Gladwell beschreibt diese dramatischen Fälle des Aneinandervorbeiredens und zeigt, warum unsere Zusammentreffen mit denen, die wir nicht kennen und die uns fremd sind, so oft scheitern. Wir reden an dem anderen vorbei, weil wir mit seinen Erwartungen und Empfindungen nicht vertraut sind. Gladwell gibt unserer Kommunikation einen Rahmen: Sein Buch ist eine kluge Analyse der psychologischen Faktoren, die unser Reden und Verhalten bestimmen. Und es ist ein Ratgeber in Zeiten, in denen überall Missverständnisse lauern, weil wir uns heute mehr denn je mit Menschen verständigen müssen, die uns nicht vertraut sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Malcolm Gladwell
Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden
Über dieses Buch
«Chamberlain ging von derselben Annahme aus, von der wir alle ausgehen, wenn wir Fremde verstehen wollen. Wir sind überzeugt, dass alles, was wir in einer persönlichen
Begegnung erfahren, besonders wertvoll ist. Wir kämen niemals auf den Gedanken, Babysitter für unsere Kinder anzuheuern, ohne sie vorher persönlich in Augenschein
genommen zu haben. Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter nicht blind ein, sondern laden sie zu stundenlangen Vorstellungsgesprächen ein. Genau wie Chamberlain wollen wir dem anderen in die Augen sehen, sein Verhalten begutachten und daraus unsere Schlüsse ziehen. Doch nichts von dem, was Chamberlain aus den persönlichen Begegnungen mitnahm, half ihm, Hitler besser zu verstehen. Im Gegenteil.»
«Gladwell ist nicht nur ein brillanter Erzähler. Er sieht, was diese Geschichten uns bedeuten, welche Lektionen sie enthalten.» The Guardian
«Gladwells Bandbreite ist atemberaubend.» The New York Times
Vita
Malcolm Gladwell, geboren 1963 in London, schreibt seit 1996 für den New Yorker. Für sein Porträt von Ron Popeil erhielt er 1999 einen National Magazine Award, 2005 führte ihn Time auf seiner Liste der «100 Most Influential People». Gladwell ist Autor der Bestseller «Tipping Point: Wie kleine Dinge Großes bewirken können (2000)», «Blink! Die Macht des Moments (2005)», «Überflieger: Warum manche Menschen erfolgreich sind – und andere nicht» (2009) und zuletzt «David und Goliath. Die Kunst, Übermächtige zu bezwingen» (2013) und verantwortet den Podcast «Revisionist History». Gladwell lebt in New York City.
Impressum
Die Originalausgabe erschien im September 2019 unter dem Titel «Talking to Strangers. What We Should Know About The People We Don't Know» bei Little, Brown and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Talking to Strangers» Copyright © 2019 by Malcolm Gladwell
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00603-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Graham Gladwell,
1934–2017
Vorbemerkung
Vor vielen Jahren, als meine Eltern aus Kanada kamen, um mich in New York City zu besuchen, brachte ich sie im Mercer Hotel unter. Es war ein freundlicher Streich. Das Mercer ist chic und exklusiv und ein Hotel für die Reichen und Schönen. Meine Eltern, vor allem mein Vater, bemerken solche Dinge nicht. Mein Vater sah nie fern, er ging nicht ins Kino und hörte keine Popmusik. Klatschzeitschriften nahm er überhaupt nicht wahr. Er hatte klar definierte Interessen: Mathematik, sein Garten und die Bibel.
Als ich meine Eltern zum Abendessen abholte, fragte ich sie, wie ihr Tag gewesen sei. «Wunderbar!», erwiderten sie. Offenbar hatten sie den ganzen Nachmittag über in der Lobby des Hotels gesessen und sich mit einem Herrn unterhalten. Das war typisch für meinen Vater, er sprach gern mit Fremden.
«Worüber habt ihr euch denn unterhalten?», fragte ich.
«Gartenarbeit», erwiderte mein Vater.
«Und wie hieß der Herr?»
«Keine Ahnung. Aber es sind dauernd Leute gekommen, um Fotos von ihm zu machen und ihn auf Zetteln unterschreiben zu lassen.»
Sollten Sie ein Hollywoodstar sein und sich daran erinnern, wie Sie sich vor ein paar Jahren in der Lobby des Mercer Hotels mit einem bärtigen Engländer unterhalten haben, dann schreiben Sie mir bitte.
Wenn nicht, dann können Sie aus dieser Geschichte etwas lernen: Manchmal sind die besten Gespräche zwischen Fremden diejenigen, die es den Fremden erlauben, Fremde zu bleiben.
Einleitung«Steigen Sie aus dem Wagen!»
1.
Im Juli 2015 fuhr eine junge Afroamerikanerin namens Sandra Bland aus ihrer Heimatstadt Chicago in eine Kleinstadt in der Nähe von Houston, Texas. Sie war zu einem Vorstellungsgespräch an der Prairie View University eingeladen worden, an der sie einige Jahre zuvor selbst studiert hatte. Sie war eine große und attraktive Frau mit der entsprechenden Persönlichkeit. Während ihrer Studienzeit hatte sie einer Verbindung angehört, in der Blaskapelle gespielt und Freiwilligenarbeit in einer Seniorengruppe geleistet. Auf YouTube hatte sie ihren eigenen Kanal «Sandy Speaks», und ihre Videos begann sie oft mit der Anrede «Guten Morgen, meine schönen Könige und Königinnen».
Ich bin gerade aufgestanden und lobe den Herrn, gepriesen sei sein Name. Ich danke ihm nicht nur, weil heute mein Geburtstag ist, sondern auch für meine Entwicklung und für alles, was er im vergangenen Jahr für mich getan hat. Ich schaue auf die 28 Jahre zurück, die ich auf dieser Erde bin, und auf alles, was er mir gezeigt hat. Und auch wenn ich ein paar Fehler gemacht habe und wenn ich einiges definitiv vergeigt habe, liebt er mich, und ihr, meine Könige und Königinnen da draußen, ihr sollt wissen, dass er euch auch liebt.
Bland bekam die Stelle an der Universität. Sie war überglücklich. Sie hatte vor, nebenher Politikwissenschaften zu studieren. Am 10. Juli fuhr sie vom Campus zum Supermarkt, und als sie auf die Umgehungsstraße bog, die um das Universitätsgelände herumführt, wurde sie von einer Polizeistreife angehalten. Der Beamte hieß Brian Encinia, er war hellhäutig, hatte kurze dunkle Haare und war dreißig Jahre alt. Er war freundlich, zumindest zu Beginn. Er klärte sie auf, dass sie beim Spurwechsel nicht geblinkt habe. Dann stellte er ihr einige Fragen, die sie beantwortete. Als Bland sich eine Zigarette anzündete, forderte Encinia sie auf, die Zigarette auszumachen.
Der folgende Wortwechsel wurde von der Videokamera auf seinem Armaturenbrett aufgezeichnet und in der einen oder anderen Form mehrere Million Mal auf YouTube angeklickt.
Bland: Ich sitze in meinem Auto, warum soll ich meine Zigarette ausmachen?
Encinia: Sie können jetzt aussteigen.
Bland: Ich muss nicht aussteigen.
Encinia: Steigen Sie aus.
Bland: Warum soll ich …
Encinia: Steigen Sie aus!
Bland: Nein, dazu haben Sie kein Recht. Nein, dazu haben Sie kein Recht.
Encinia: Steigen Sie aus.
Bland: Dazu haben Sie nicht das Recht. Sie haben nicht das Recht dazu.
Encinia: Ich habe das Recht. Steigen Sie aus, oder ich hole Sie raus.
Bland: Ich weigere mich, weiter mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie sich nicht ausweisen. Werde ich verhaftet, weil ich nicht geblinkt habe?
Encinia: Steigen Sie sofort aus, oder ich hole Sie raus.
Bland: Ich rufe meinen Anwalt an.
Das Gespräch zwischen Bland und Encinia zieht sich unangenehm in die Länge. Die Emotionen schaukeln sich hoch.
Encinia: Ich ziehe Sie jetzt aus dem Wagen. [Greift ins Wageninnere.]
Bland: Okay, Sie ziehen mich aus meinem Wagen? Okay, in Ordnung.
Encinia[ruft Verstärkung]: 2547.
Bland: Dann machen wir mal.
Encinia: Ja, wir machen mal. [Packt sie.]
Bland: Fassen Sie mich nicht an!
Encinia: Steigen Sie aus dem Wagen aus!
Bland: Fassen Sie mich nicht an! Fassen Sie mich nicht an! Ich bin nicht verhaftet! Sie haben nicht das Recht, mich aus dem Wagen zu holen!
Encinia: Sie sind verhaftet!
Bland: Sie verhaften mich? Wofür? Wofür? Wofür?
Encinia[in sein Funkgerät]: 2457 County FM 1098 [unhörbar]. Schicken Sie mir einen Streifenwagen. [Zu Bland:] Steigen Sie aus! Steigen Sie sofort aus!
Bland: Warum wollen Sie mich festnehmen? Sie wollen mir einen Strafzettel geben wegen …
Encinia: Steigen Sie aus, habe ich gesagt!
Bland: Warum wollen Sie mich festnehmen? Sie haben meine Autotür geöffnet …
Encinia: Dies ist ein polizeilicher Befehl! Ich ziehe Sie da raus!
Bland: Sie drohen mir damit, mich aus meinem eigenen Wagen zu ziehen?
Encinia: Steigen Sie aus!
Bland: Und dann werden Sie mich …
Encinia: Ich werde Sie betäuben. Steigen Sie aus! Sofort! [Zieht einen Elektroschocker und richtet ihn auf Bland.]
Bland: Wow. Wow. [Steigt aus.]
Encinia: Steigen Sie aus! Sofort! Steigen Sie aus dem Wagen!
Bland: Weil ich nicht geblinkt habe? Sie tun das, weil ich nicht geblinkt habe?
Bland wurde verhaftet und eingesperrt. Drei Tage später beging sie in ihrer Zelle Selbstmord.
2.
Der Fall Sandra Bland fiel in ein seltsames Zwischenspiel in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Dieses Zwischenspiel setzte im Spätsommer 2014 ein, als ein achtzehnjähriger schwarzer Jugendlicher namens Michael Brown in Ferguson, Missouri von einem Polizeibeamten erschossen wurde. Angeblich hatte Brown ein Päckchen Zigaretten aus einem Minisupermarkt gestohlen. In den folgenden Jahren wurden immer neue Fälle bekannt, in denen die Polizei mit Gewalt gegen Schwarze vorging. Im ganzen Land kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Eine neue Bürgerrechtsbewegung namens Black Lives Matter wurde geboren. Eine Zeitlang gab es in den Vereinigten Staaten kaum noch ein anderes Thema. Vielleicht erinnern Sie sich an einige der Namen, die damals in den Schlagzeilen waren. In Baltimore wurde ein junger Schwarzer namens Freddie Gray verhaftet, weil er ein Taschenmesser bei sich trug, und fiel dann im Streifenwagen ins Koma. In Minneapolis wurde ein junger Schwarzer namens Philando Castile in seinem Wagen von einer Polizeistreife angehalten; nachdem er dem Beamten seine Fahrzeugpapiere gegeben hatte, schoss dieser aus unerfindlichen Gründen sieben Mal auf ihn. In New York City wurde ein Schwarzer namens Eric Garner von mehreren Polizisten umringt, weil diese vermuteten, er verkaufe illegale Zigaretten, und erstickte im nachfolgenden Handgemenge. In Charleston, South Carolina, wurde ein Schwarzer namens Walter Scott angehalten, weil sein Rücklicht nicht funktionierte; er floh aus seinem Wagen und wurde von einem weißen Polizeibeamten hinterrücks erschossen. Scott wurde am 4. April 2015 getötet. Sandra Bland widmete ihm ein Video auf ihrem Kanal «Sandy Speaks»:
Guten Morgen, meine schönen Könige und Königinnen! … Ich bin keine Rassistin. Ich bin in Villa Park in Illinois aufgewachsen. Ich war die einzige Schwarze in unserer weißen Cheerleader-Gruppe. … Ihr Schwarzen, ihr werdet in dieser Welt keinen Erfolg haben, wenn ihr nicht lernt, mit Weißen zusammenzuarbeiten. Ihr Weißen da draußen, ihr müsst verstehen, dass wir Schwarzen tun, was wir können … aber wir können nicht anders, als wütend zu werden, wenn wir Situationen sehen, in denen ein schwarzes Leben ganz offensichtlich nichts zählt. Für diejenigen, die sich fragen, warum er weggelaufen ist, verdammt noch mal, in den Nachrichten haben wir in letzter Zeit doch gesehen, dass man sich den Bullen ergibt, und dass man trotzdem erschossen werden kann.
Drei Monate später war auch sie tot.
Dieses Buch ist ein Versuch, zu verstehen, was wirklich an jenem Tag auf der Umgehungsstraße einer Kleinstadt in Texas passiert ist.
Warum ein Buch über eine schiefgegangene Verkehrskontrolle? Weil die damalige Debatte über Polizeigewalt einen zutiefst unbefriedigenden Verlauf nahm. Die eine Seite führte eine Debatte über Rassismus und blickte aus olympischen Höhen auf diesen Fall. Die andere nahm jede Einzelheit unter die Lupe. Wer war dieser Polizeibeamte? Wie hat er sich genau verhalten? Die einen sahen vor lauter Wald die Bäume nicht und die anderen vor lauter Bäumen keinen Wald.
Auf ihre Weise hatte jede Seite recht. Vorurteile und Inkompetenz erklären vieles von dem, was in unserer Gesellschaft schiefgeht. Aber was kann man nach diesen Diagnosen schon tun, außer ein ernstes Gesicht aufzusetzen und Besserung zu geloben? Es gibt unqualifizierte Polizisten. Es gibt rassistische Polizisten. Konservative bevorzugen erstere Erklärung, Liberale letztere. Am Ende heben sich beide Seiten auf. Bis heute werden in den Vereinigten Staaten Menschen von Polizisten getötet, auch wenn diese Fälle keine Schlagzeilen mehr machen. Vermutlich hatten auch Sie längst vergessen, wer Sandra Bland war. Nach einer Anstandsfrist haben wir das Thema abgehakt und sind zum nächsten übergegangen.
Aber ich will nicht einfach zum nächsten Thema übergehen.
3.
Im 16. Jahrhundert wurden in Europa an die siebzig Kriege geführt. Die Dänen kämpften gegen die Schweden, die Polen gegen den Deutschherrenorden, die Osmanen gegen Venedig, die Spanier gegen die Franzosen und so weiter. Wenn es in diesem endlosen Blutvergießen ein Muster gab, dann waren es überwiegend Nachbarn, die einander bekriegten. Man bekriegte sich mit Menschen, die auf der anderen Seite der Grenze lebten und schon immer dort gelebt hatten. Oder mit Menschen im eigenen Land: Im Osmanischen Krieg des Jahres 1509 prallten sogar zwei Brüder aufeinander. In der gesamten Geschichte der Menschheit fanden nur die wenigsten Begegnungen – ob friedlich oder feindlich – zwischen Menschen statt, die sich nicht kannten. Die Menschen, die einander begegneten und bekämpften, hatten dieselben Götter, bauten dieselben Häuser, lebten in denselben Städten und führten ihre Kriege mit denselben Waffen und nach denselben Regeln.
Der blutigste Konflikt des 16. Jahrhunderts fällt allerdings aus der Reihe. Als der spanische Eroberer Hernán Cortés dem Aztekenherrscher Moctezuma Xocoyotzin gegenübertrat, wusste keine der beiden Seiten etwas von der anderen.
Cortés landete im Februar 1519 in Mexiko und machte sich auf den beschwerlichen Weg ins Landesinnere, in Richtung der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan. Als die Spanier Tenochtitlan erreichten, waren sie beeindruckt. Der Anblick war atemberaubend, an Größe und Reichtum übertraf die Stadt alles, was er und seine Männer aus Spanien kannten. Sie befand sich auf einer Insel, die über Brücken mit dem Festland verbunden und von Kanälen durchzogen war, und die mit breiten Prachtstraßen aufwartete, mit ausgeklügelten Aquädukten, florierenden Märkten, mit Tempeln, die mit weißem Stuck verkleidet waren, mit öffentlichen Parks und sogar mit einem Zoo. Tenochtitlan war blitzsauber, was für jemanden, der im Schmutz einer mittelalterlichen europäischen Stadt aufgewachsen war, ein wahres Wunder gewesen sein muss.
«Wir marschierten wie im Traum durch diese Herrlichkeiten», schrieb Bernal Díaz del Castillo, einer der Begleiter von Cortés:
Zum ersten Mal [sahen wir] die große Zahl der Städte und Dörfer, die mitten in den See gebaut waren, und die noch weitaus größere Zahl der Ortschaften an den Ufern und schließlich die sehr gepflegte, kerzengerade Straße, die in die Stadt Mexiko führte. Wir waren bass erstaunt über dieses Zauberreich, das fast so unwirklich erschien wie die Paläste in dem Ritterbuch des Amadis. Hoch und stolz ragten die gemauerten, steinernen Türme, Tempel und Häuser mitten aus dem Wasser. Einige unserer Männer meinten, das seien alles nur Traumgesichte.
Auf einer der Brücken wurden die Spanier von einer Abordnung aztekischer Granden in Empfang genommen und zu Moctezuma geführt. Moctezuma war ein Herrscher von beinahe surrealem Prunk, er wurde auf einer mit Gold und Silber bestickten und mit Blumen und Edelsteinen geschmückten Sänfte getragen. Einer seiner Hofleute ging vor ihm her und fegte den Boden. Cortés stieg von seinem Pferd, Moctezuma von seiner Sänfte. Als Spanier wollte Cortés Moctezuma umarmen, doch Moctezumas Begleiter hielten ihn zurück. Niemand durfte Moctezuma umarmen. Stattdessen verbeugten sich die beiden voreinander.
«Bist du es? Bist du Moctezuma?»
Und Moctezuma erwiderte: «Ja, ich bin es.»
Kein Europäer hatte je seinen Fuß nach Mexiko gesetzt. Kein Azteke war je einem Europäer begegnet. Cortés wusste nichts von den Azteken, er hatte nur von ihrer legendären Stadt gehört. Moctezuma wusste nichts von Cortés, außer dass er mutig in die aztekische Hauptstadt aufgebrochen war und sonderbare Waffen und große, geheimnisvolle Tiere mitbrachte – es waren Pferde –, wie sie die Azteken nie zuvor gesehen hatten.
Es ist kein Wunder, dass die Begegnung zwischen Cortés und Moctezuma die Historiker seit Jahrhunderten fasziniert. In diesem Moment vor 500 Jahren, als europäische Entdecker über das Meer segelten und kühne Expeditionen ins Unbekannte wagten, kam es zu einer ganz neuen Form der Begegnung. Cortés und Moctezuma mussten miteinander kommunizieren, obwohl sie nicht das Geringste voneinander wussten. Wie verlief dieses Gespräch? Jedenfalls nicht so, wie ich es eben beschrieben habe. Als Cortés fragte: «Bist du es? Bist du Moctezuma?», richtete er die Frage nicht direkt an den Herrscher der Azteken, denn Cortés sprach ja nur Spanisch. Aber er hatte zwei Dolmetscher dabei. Einer war eine Frau von der Golfküste namens Malinche, die neben verschiedenen Maya-Dialekten auch die Aztekensprache Nahuatl beherrschte. Der andere war der spanische Priester Gerónimo del Aguilar, der bei einer früheren Expedition in Yucatán Schiffbruch erlitten, bei den Mayas gelebt und ihre Sprache gelernt hatte. Cortés richtete die Frage also an Aguilar, der sie Malinche ins Maya übersetzte, und diese wiederum übersetzte das Maya für Moctezuma ins Nahuatl. Und als Moctezuma erwiderte: «Ja, ich bin es», nahm die Übersetzung den langen Umweg in umgekehrte Richtung. Moctezuma sprach in Nahuatl mit Malinche. Malinche übersetzte das Nahuatl für Aguilar ins Maya. Und Aguilar übersetzte das Maya für Cortés ins Spanische. Selbst eine so einfache und alltägliche Frage war plötzlich hoffnungslos kompliziert.
Cortés und seine Männer wurden in einem der Paläste Moctezumas einquartiert. Aguilar beschrieb den Palast später so: «Ungezählte Räume, Vorräume, prachtvolle Hallen, mit Betten aus großen Tuchen, Kissen aus Leder und Pflanzenfasern, gute Federdecken und wunderbare weiße Felle». Nachdem die Spanier gegessen hatten, kehrte Moctezuma zurück und hielt eine Ansprache. Sofort kam es zu Verwirrung. Die Spanier wollten in den Sätzen Moctezumas ein ganz erstaunliches Zugeständnis gehört haben. Er schien zu glauben, dass Cortés ein Gott sei und eine uralte Prophezeiung erfülle, die besagte, dass eines Tages ein Gott aus seinem Exil im Osten zurückkommen werde. Es schien, als wollte er sich Cortés daher unterwerfen. Man kann sich die Reaktion von Cortés vorstellen: Diese großartige Stadt gehörte nun ihm.
Aber was hatte Moctezuma wirklich gesagt? Nahuatl, die Sprache der Azteken, kannte einen Modus der Ehrerbietung. Herrscher wie Moctezuma verwendeten einen traditionellen Code, in dem sie ihren Status durch gewundene Gesten der Bescheidenheit zum Ausdruck brachten. Im klassischen Nahuatl ist das Wort für «Adelige» nahezu identisch mit dem Wort für «Kind», wie der Historiker Matthew Restall erklärt. Wenn ein Herrscher wie Moctezuma sich als klein und schwach beschreibt, dann ist das in Wirklichkeit nichts anderes als ein subtiler Hinweis auf sein Ansehen und seine Macht.[*]
«Eine solche Sprache lässt sich unmöglich korrekt übersetzen», schreibt Restall:
Die Sprecher sind oft gezwungen, das Gegenteil dessen zu sagen, was sie eigentlich meinen. Die wahre Bedeutung wird in ihre ehrerbietige Sprache eingebettet. Solche Feinheiten gehen in der Übersetzung verloren und werden durch mehrere Dolmetscher verzerrt. Deshalb war es nicht nur unwahrscheinlich, dass Moctezumas Rede korrekt wiedergegeben wurde, sondern sogar sehr wahrscheinlich, dass die Bedeutung in ihr Gegenteil verkehrt wurde. Das heißt, Moctezuma unterwarf sich nicht etwa, sondern er nahm vielmehr die Unterwerfung der Spanier an.
Vielleicht erinnern Sie sich noch aus dem Geschichtsunterricht, wie die Begegnung von Moctezuma und Cortés endete. Moctezuma wurde von Cortés als Geisel genommen und schließlich ermordet. Beide Seiten griffen zu den Waffen. Etwa 20 Millionen Azteken starben, einige durch die Waffen der Spanier, die allermeisten durch Seuchen, die diese eingeschleppt hatten. Tenochtitlan wurde zerstört. Mit dem Feldzug von Cortés nahm die katastrophale Ära der kolonialen Eroberungen ihren Anfang. Und es begann ein typisch modernes Muster der sozialen Interaktion. Heute kommen wir andauernd mit Menschen in Berührung, deren Annahmen, Sichtweisen und Kontexte so ganz anders sind als unsere. Das Bild für die moderne Welt sind nicht zwei Brüder, die im Streit um das Osmanische Reich aufeinandertreffen. Das Bild für unsere moderne Welt sind Cortés und Moctezuma, die darum ringen, sich auf Umwegen über mehrere Dolmetscher zu verständigen.
Dieses Buch handelt davon, warum wir so schlechte Dolmetscher sind.
Jedes der folgenden Kapitel nähert sich unseren Problemen mit Fremden aus einer anderen Richtung. Einige der Geschichten kennen Sie vielleicht aus den Nachrichten. Auf einer Verbindungsparty an der Stanford University lernt ein Student namens Brock Turner eine junge Frau kennen, und am Ende des Abends ist er in Polizeigewahrsam. An der Pennsylvania State University wird ein ehemaliger Assistenztrainer der Footballmannschaft, Jerry Sandusky, des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen bezichtigt, und der Rektor der Universität und zwei seiner führenden Mitarbeiter werden der Mitwisserschaft angeklagt. Sie werden einer Spionin begegnen, die jahrelang unerkannt in den obersten Führungsebenen des Pentagons aktiv war; lernen den Mann kennen, der den Hedgefondsmanager Bernie Madoff überführte; und erfahren mehr über den Justizirrtum im Fall der amerikanischen Austauschstudentin Amanda Knox und den Selbstmord von Sylvia Plath.
In jedem dieser Fälle verließen sich die Beteiligten auf ganz bestimmte Strategien, um die Worte und Absichten der anderen Seite zu übersetzen. Und in jedem dieser Fälle ging irgendetwas schief. In diesem Buch möchte ich diese Strategien erklären – analysieren, kritisieren, zu ihren Wurzeln vordringen und herausfinden, wie sie sich korrigieren lassen. Am Ende kehre ich zu Sandra Bland zurück, denn diese Begegnung auf dem Haltestreifen einer Umgehungsstraße in Texas hat etwas, das uns den Schlaf rauben sollte. Versetzen Sie sich in die Situation und stellen Sie sich vor, wie schwierig sie war. Sandra Bland war niemand, den Brian Encinia aus seinem Viertel kannte. Das wäre einfach gewesen: «Sandy! Wie geht’s? Pass einfach nächstes Mal ein bisschen besser auf.» Doch Bland kam aus Chicago und Encinia aus Texas, sie war eine Frau und er ein Mann, sie war schwarz, und er war weiß, sie war Bürgerin und er Polizeibeamter, sie war unbewaffnet und er bewaffnet. Sie waren Fremde. Wenn wir als Gesellschaft achtsamer wären – wenn wir bereit wären, uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir auf Fremde zugehen, und versuchen würden, sie zu verstehen –, dann hätte Sandra Blands Leben nicht in einer Gefängniszelle in Texas geendet.
Aber beginnen möchte ich mit zwei Fragen, zwei Rätseln, zu Fremden. Das erste ist eine Geschichte, die ein Mann namens Florentino Aspillaga vor Jahren einem CIA-Agenten in Deutschland erzählte.
Teil 1Spione und Diplomaten: Zwei Rätsel
Kapitel 1Fidel Castros Rache
1.
Florentino Aspillagas letzte Nachricht kam aus Bratislava, das damals noch zur Tschechoslowakei gehörte. Es war das Jahr 1987, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer. Aspillaga war Leiter eines Beratungsunternehmens namens Cuba Técnica, das angeblich irgendetwas mit Handel zu tun hatte. Das war allerdings nur die Fassade. In Wirklichkeit war Aspillaga ein hochrangiger Offizier des kubanischen Geheimdienstes.
Aspillagas Laufbahn als Geheimdienstoffizier begann 1985 mit einer handschriftlichen Empfehlung von Fidel Castro. Er hatte seinem Land in Moskau, Angola und Nicaragua gedient. Er war ein Held. In Bratislava unterstand ihm das gesamte kubanische Spionagenetzwerk der Region.
Aber irgendwann im Verlaufe seines Aufstiegs war bei ihm Ernüchterung eingetreten. Aspillaga hatte miterlebt, wie Castro in Angola zur Feier der kommunistischen Revolution im Land eine Rede hielt, und war enttäuscht von der Arroganz und Selbstverliebtheit des kubanischen Staatschefs. Als er 1986 nach Bratislava versetzt wurde, hatten sich seine Zweifel erhärtet.
Er plante seine Flucht für den 6. Juni 1987 – ein Insiderwitz. An einem 6. Juni war das kubanische Innenministerium gegründet worden, die allmächtige Institution, der sämtliche Spione des Landes unterstanden. Für die Geheimdienstmitarbeiter war der 6. Juni ein Feiertag, zu Ehren des Spionageapparats wurden Reden gehalten, Empfänge gegeben und Feste gefeiert. Aspillaga wollte, dass sein Verrat schmerzte.
In einem Park in der Innenstadt von Bratislava traf er sich mit seiner Freundin Marta. Es war ein Samstagnachmittag. Marta war Kubanerin, eine von Tausenden Gastarbeitern in tschechoslowakischen Fabriken. Wie alle Kubaner in ihrer Position hatte sie ihren Pass in der kubanischen Botschaft in Prag abgeben müssen. Aspillaga musste sie also über die Grenze schmuggeln. Sein Dienstwagen war ein Mazda. Er nahm das Ersatzrad aus dem Kofferraum, bohrte ein Luftloch in den Boden und wies sie an, sich in der Mulde zu verstecken.
Osteuropa befand sich hinter einem Eisernen Vorhang. Reisen zwischen Ost und West waren stark eingeschränkt. Aber Bratislava ist nur eine kurze Autofahrt von Wien entfernt, und Aspillaga war die Strecke schon oft gefahren. Er war an der Grenze bekannt und hatte einen Diplomatenausweis. Die Zöllner winkten ihn durch.
In Wien stellten er und Marta den Mazda ab, stiegen in ein Taxi und wurden in der Botschaft der Vereinigten Staaten vorstellig. Es war Samstagabend. Die leitenden Angestellten waren längst nach Hause gegangen. Aber Aspillaga musste nicht viel sagen, um das Interesse des Wachmanns zu wecken. Ich bin ein Mitarbeiter des kubanischen Geheimdienstes. Ich bin ein Geheimdienstoffizier.
In Spionagekreisen bezeichnet man einen Besuch wie den von Aspillaga in der Wiener Botschaft als «walk-in». Plötzlich steht ein Geheimdienstmitarbeiter eines Landes in der Tür des Geheimdienstes eines anderen Landes.
Florentino Aspillaga, genannt «der Kleine», war einer der großen Überläufer des Kalten Kriegs. Er wurde verhört, erhielt eine neue Identität und tauchte unter. Zweimal gelang es seinem alten Arbeitgeber, ihn aufzuspüren und einen Anschlag auf ihn zu verüben. Zweimal entkam er. Der Letzte, der Aspillaga gesehen hat, ist Brian Latell, langjähriger Leiter der Lateinamerika-Abteilung der CIA.
Den Hinweis erhielt Latell von Aspillagas Kontaktmann. In einem Restaurant in Coral Gables in der Nähe von Miami traf er sich mit diesem. Dort erhielt er Anweisungen, sich an einem anderen Ort einzufinden, der sich näher an Aspillagas aktuellem Versteck befand. Latell mietete sich ein Zimmer in einem anonymen Hotel und wartete.
«Er ist jünger als ich. Ich bin 75. Er muss inzwischen wohl Ende sechzig sein», erinnerte sich Latell. «Aber er hatte schlimme gesundheitliche Probleme. Es ist nicht einfach, als Überläufer mit einer neuen Identität zu leben.»
Aber trotz seines Zustands sah Latell, wie Aspillaga als junger Mann gewirkt haben musste: Er war charmant und risikofreudig und hatte eine Vorliebe für große emotionale Gesten. Mit einer Schachtel unter dem Arm betrat er das Hotelzimmer.
«Das sind meine Erinnerungen», erklärte er. «Die habe ich geschrieben, kurz nachdem ich übergelaufen bin. Nehmen Sie sie.»
Die Seiten in der Schachtel erzählten eine Geschichte, die keinen Sinn ergab.
2.
Nach seinem dramatischen Auftritt in der Botschaft in Wien wurde Aspillaga zum Verhör zu einem Stützpunkt der US-Armee in Deutschland geflogen. Bei seiner Ankunft hatte er eine Bitte. Er wollte den ehemaligen Leiter der CIA-Operationen auf Kuba sprechen. Damals waren die Büros der CIA in der Vertretung der Vereinigten Staaten in Havanna untergebracht, die unter Schweizer Fahne operierte: zehn Offiziere, sechs Wachleute. (Die kubanische Delegation in den Vereinigten Staaten hatte ein ähnliches Arrangement getroffen.) Aspillaga kannte den Leiter des Büros noch aus seinen Tagen in Havanna. Die Kubaner nannten ihn nur «el Alpinista – der Bergsteiger». Er hatte das Spionagenetz der Amerikaner auf Kuba geleitet.
Der Bergsteiger hatte in aller Welt für die CIA gearbeitet. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurden Akten gefunden, aus denen hervorging, dass der KGB und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR ihre Agenten zu Schulungen über den Bergsteiger geschickt hatten. Einmal hatten sowjetische Agenten versucht, ihn anzuwerben. Sie hatten buchstäblich Geldsäcke vor ihm auf den Tisch gelegt, aber er hatte sich nur über sie lustig gemacht. Der Bergsteiger war unbestechlich. Er sprach Spanisch wie ein Kubaner. Er war Aspillagas großes Vorbild. Aspillaga wollte ihn persönlich kennenlernen.
«Ich war im Ausland unterwegs, als ich die Nachricht erhielt, ich solle sofort nach Frankfurt kommen», erinnert sich der Bergsteiger. (Obwohl er längst nicht mehr bei der CIA ist, zieht er es bis heute vor, seinen wirklichen Namen nicht zu nennen.) «In den Frankfurter Büros verhörten wir Überläufer. Sie haben mir erzählt, dass da ein Knabe in Wien in die Botschaft spaziert ist. Dass er mit seiner Freundin im Kofferraum aus der Tschechoslowakei gekommen war und dass er mit mir sprechen wollte. Das klang alles irgendwie verrückt.»
Der Bergsteiger machte sich ohne zu zögern auf den Weg ins Vernehmungszentrum. «Als ich ankam, haben vier Beamte zusammen im Wohnzimmer gesessen», erinnert er sich. «Sie haben mir gesagt, Aspillaga sei im Schlafzimmer und schlafe mit seiner Freundin. So wie eigentlich die ganze Zeit seit ihrer Ankunft in dem sicheren Haus. Also bin ich rein und habe mich mit ihm unterhalten. Er war schlaksig und ziemlich schlecht gekleidet, wie es die Osteuropäer und Kubaner damals eben waren. Ein bisschen schmuddelig. Aber es war sofort klar, dass der Knabe hochintelligent war.»
Als der Bergsteiger das Schlafzimmer betrat, verriet er Aspillaga nicht, wer er war. Er war vorsichtig – er wusste schließlich nicht, was er von Aspillaga halten sollte. Aber Aspillaga brauchte nur ein paar Minuten, um dahinterzukommen, wer er war. Nach einer Schrecksekunde lachten die beiden, dann umarmten sie sich, wie man das in Kuba so machte.
«Wir haben fünf Minuten geplaudert, dann ging es ans Eingemachte. Wenn man solche Leute verhört, braucht man jemanden, der ihre Glaubwürdigkeit bestätigt», erklärt der Bergsteiger. «Also habe ich ihn geradeheraus gefragt, was er mir über den kubanischen Geheimdienst erzählen konnte.»
In diesem Moment zündete Aspillaga die Bombe – die Nachricht, die ihn hinter dem Eisernen Vorhang hervor und in die Botschaft von Wien geführt hatte: Die CIA unterhielt auf Kuba ein Netzwerk von Spionen, die mit ihren Berichten das Bild prägten, das die Vereinigten Staaten von ihrem Gegner hatten. Aspillaga nannte einen der Spione und fügte dann hinzu: «Das ist ein Doppelagent. Der arbeitet für uns.» Die Anwesenden waren geschockt. Sie hatten keine Ahnung gehabt. Aspillaga fuhr fort. Er nannte einen weiteren Agenten. «Auch ein Doppelagent.» Dann noch einen und noch einen. Er nannte Namen und Einzelheiten. Der Typ, den ihr in Antwerpen auf einem Schiff rekrutiert habt. Der kleine Dicke mit dem Schnauzer? Auch einer von unseren Leuten. Der Hinkende im Verteidigungsministerium? Ein Doppelagent. Er hörte gar nicht mehr auf und nannte Dutzende Namen – im Grunde die gesamte Liste der amerikanischen Spione auf Kuba. Alle arbeiteten sie für Havana und fütterten die CIA mit Informationen, die sich die Kubaner selbst ausgedacht hatten.
«Ich habe einfach nur dagesessen und mitgeschrieben», erzählt der Bergsteiger. «Ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Das haben wir so gelernt. Aber mir ist der Puls gerast.»
Aspillaga sprach über die Leute des Bergsteigers, die Spione, mit denen er während seiner Zeit als junger und ehrgeiziger Geheimdienstoffizier auf Kuba zusammengearbeitet hatte. Er war immer dafür gewesen, Quellen aggressiv zu bearbeiten und möglichst viele Informationen aus ihnen herauszuholen. «Wenn man im Vorzimmer des Präsidenten einen Agenten hat, aber nicht mit ihm sprechen kann, dann ist dieser Agent wertlos», erklärt der Bergsteiger. «Ich habe immer gedacht, sprechen wir mit den Leuten und holen was Wertvolles aus ihnen raus, statt sechs oder zwölf Monate zu warten, bis er endlich versetzt wird.» Doch er war einem Schwindel aufgesessen. «Ich muss zugeben, mir war Kuba so zuwider, dass es mir Spaß gemacht hat, sie hinters Licht zu führen», bekennt er kleinlaut. «Und dann hat sich herausgestellt, dass nicht sie die Geleimten waren, sondern wir. Das war schon ein herber Schlag.»
Der Bergsteiger stieg in eine Militärmaschine und flog zusammen mit Aspillaga zur Andrews Air Force Base vor den Toren von Washington, D.C., wo die «großen Tiere» der Lateinamerika-Abteilung saßen. «In der Kuba-Abteilung herrschte blankes Entsetzen. Die Leute konnten nicht glauben, dass sie den Kubanern jahrelang derart auf den Leim gegangen waren. Es war ein Schock.»
Aber es kam noch dicker. Als Fidel Castro erfuhr, dass Aspillaga die CIA über ihre Demütigung informiert hatte, beschloss er, noch ein wenig Salz in die Wunde zu streuen. Er versammelte die gesamte Mannschaft der vermeintlichen CIA-Agenten und veranstaltete mit ihnen einen Triumphzug durch ganz Kuba. Dann ließ er im kubanischen Fernsehen eine elfteilige Reihe mit dem Titel La Guerra de la CIA contra Cuba [Der Krieg der CIA gegen Kuba] ausstrahlen. Der kubanische Geheimdienst hatte alles gefilmt und aufgezeichnet, was die CIA in den vergangenen zehn Jahren auf Kuba unternommen hatte. Es war wie eine Reality-Show. Das Material war erstaunlich hochwertig, mit Nahaufnahmen und Kinoeinstellungen. Die ausgezeichnete Tonqualität ließ darauf schließen, dass die Kubaner im Voraus über jeden geheimen Treffpunkt informiert worden waren und ihre Techniker geschickt hatten, um den Raum professionell zu verkabeln.
Auf dem Bildschirm erschienen die Namen von CIA-Offizieren, die unter dicken Deckmänteln tätig waren. Genüsslich wurde jedes ach so raffinierte Gerät im Dienst der CIA vorgeführt: in Picknickkörben und Aktentaschen versteckte Funksender. Die Sendung zeigte Parkbänke, auf denen sich die CIA-Leute mit ihren Informanten getroffen hatten, und erklärte, wie die Amerikaner über verschiedenfarbige Hemden Geheimbotschaften an ihre Kontakte übermittelten. Eine lange Aufnahme zeigte einen CIA-Beamten, der Geld und Anweisungen in einen großen «Felsen» aus Plastik stopfte, und in einer anderen war ein Beamter zu sehen, der auf einem Schrottplatz in Pinar del Río Geheimdokumente für seine Agenten in einem Autowrack versteckte. In wieder einem anderen Mitschnitt war ein CIA-Beamter zu sehen, der am Straßenrand im hohen Gras nach einem Paket suchte, während seine Frau im Auto saß und nervös rauchte. Auch der Bergsteiger hatte einen Kurzauftritt in der Sendung. Sein Nachfolger kam jedoch noch viel schlechter weg. «In dem Dokumentarfilm hat es so ausgesehen, als wäre ihm überallhin ein Kameramann nachgelaufen», so der Bergsteiger.
Als der Leiter des FBI-Büros in Miami von der Dokumentarfilmserie erfuhr, rief er einen kubanischen Beamten an und bat ihn um ein Exemplar. Postwendend erhielt er ein Paket mit Videokassetten, dankenswerterweise mit Untertiteln versehen. Der fortschrittlichste Geheimdienst der Welt wurde vorgeführt.
3.
Genau das macht die Geschichte von Florentino Aspillaga so unverständlich. Es wäre eine Sache, wenn Kuba ein paar Amateure und Dilettanten aufs Kreuz gelegt hätte. Doch Kuba hatte die CIA hinters Licht geführt, eine Organisation, deren Hauptaufgabe darin besteht, Fremde zu verstehen.
Über jeden dieser Doppelagenten waren dicke Akten angelegt worden. Der Bergsteiger versichert, er habe jeden einzelnen sorgfältig überprüft. Es gab keine offensichtlichen Warnsignale. Wie alle Nachrichtendienste hat auch die CIA eine Abteilung für Spionageabwehr, deren Aufgabe darin besteht, in den eigenen Reihen nach Hinweisen auf Verrat zu suchen. Aber was hatte diese Abteilung gefunden? Nichts.[*]
Jahre später konnte Latell nur mit den Achseln zucken und anerkennen, dass die Kubaner wirklich gut waren. «Es war ausgezeichnete Arbeit», meinte er.
Fidel Castro persönlich hat die Doppelagenten ausgesucht, die er uns vor die Nase gesetzt hat. Er hatte ein ausgezeichnetes Händchen. Einige waren ausgebildete Schauspieler. Einer von ihnen hat unfassbar naiv gewirkt, aber er war ein durchtriebener und geschulter Geheimagent. Der Mann ist so ein Tollpatsch. Wie soll das ein Doppelagent sein? Aber Fidel hat das alles organisiert. Fidel ist der beste Schauspieler von allen.
Der Bergsteiger räumt ein, dass die Kuba-Abteilung der CIA schlampig arbeitete. Dieser Bereich der CIA sei Mittelmaß gewesen. Er habe zuvor in Europa gegen die Ostdeutschen spioniert, und da sei die CIA viel gründlicher vorgegangen.
Aber wie sah die Bilanz der CIA in der DDR aus? Genauso schlecht wie die der CIA in Kuba. Nach dem Fall der Berliner Mauer schrieb Markus Wolf, langjähriger Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung der DDR, in seinen Memoiren:
Wir waren tatsächlich in der beneidenswerten Lage, zu wissen, dass alle vermeintlichen CIA-Spione in der DDR in Wirklichkeit inoffizielle Mitarbeiter des MfS oder umgedrehte Doppelagenten waren. Nach der Wiedervereinigung wurde mir das von CIA-Mitarbeitern bestätigt.
Die vermeintlich so gründliche Osteuropa-Abteilung musste gar einen der schlimmsten Tiefschläge des gesamten Kalten Krieges einstecken. Aldrich Ames, Leiter der CIA-Abteilung Spionageabwehr UdSSR, war in Wirklichkeit ein sowjetischer Agent. Sein Verrat führte zur Festnahme und Hinrichtung ungezählter amerikanischer Spione in der Sowjetunion. Der Bergsteiger kannte ihn. Jeder, der in der CIA Rang und Namen hatte, kannte ihn. «Ich hatte keine allzu hohe Meinung von ihm», meint der Bergsteiger. «Er war ein fauler Säufer.» Aber weder er noch seine Kollegen kamen auf den Gedanken, dass der Mann ein Verräter sein könnte. «Für die alten Hasen war es einfach unvorstellbar, dass die andere Seite einen von uns abwerben könnte. Wir waren erschüttert, dass einer von uns einen solchen Verrat begehen konnte.»
Der Bergsteiger war einer der talentiertesten Agenten in einem der besten Nachrichtendienste der Welt. Doch er musste gleich dreimal erleben, wie die CIA gedemütigt und verraten wurde: von Fidel Castro, von den Ostdeutschen und von einem faulen Säufer. Wenn sich schon die CIA derart irren kann, wie steht es dann erst um uns Normalsterbliche?
Das ist das erste Rätsel: Warum sind wir nicht in der Lage, zu erkennen, wenn uns ein Fremder ins Gesicht lügt?
Kapitel 2Begegnungen mit dem Führer
1.
Am Abend des 28. August 1938 rief Neville Chamberlain seinen engsten Berater zu einem nächtlichen Strategiegespräch in seinen Amtssitz in der 10 Downing Street. Chamberlain war seit etwas mehr als einem Jahr Premierminister. Als ehemaliger Fabrikant war er ein zupackender Mensch, dessen Interesse und Stärke die Innenpolitik war. Nun stand er vor seiner ersten außenpolitischen Krise: Adolf Hitler drohte immer unverhohlener damit, das Sudetenland zu besetzen.
Wenn Hitler in die Tschechoslowakei einmarschierte, dann drohte ein neuer Weltkrieg, und den wollte Chamberlain um jeden Preis vermeiden. Doch Hitler hatte sich in den vorangegangenen Monaten bedeckt gehalten, die Absichten der Deutschen waren undurchsichtig, und der Rest Europas wurde zunehmend nervös. Chamberlain war entschlossen, die Blockade zu durchbrechen. Seinen Lösungsansatz, von dem er seine Berater in jener Nacht in Kenntnis setzte, taufte er Plan Z. Der Plan unterlag höchster Geheimhaltung. Chamberlain schrieb später, die Idee sei «so unkonventionell und kühn, dass es [Außenminister] Halifax die Sprache verschlug». Chamberlain wollte nach Deutschland fliegen und von Angesicht zu Angesicht mit Hitler sprechen.
So unglaublich das klingen mag, doch Ende der dreißiger Jahre, als Hitler die Welt in Richtung Abgrund zog, kannte ihn kaum einer der politischen Führer der Welt persönlich.[*] Er war ein Mysterium. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der sein Amt einen Monat nach Hitlers Machtergreifung angetreten hatte, war ihm nie begegnet, genauso wenig wie der sowjetische Diktator Josef Stalin. Winston Churchill, der Chamberlains Nachfolger werden sollte, hätte ihn 1932 beinahe getroffen, als er sich in München aufhielt und für sein Buch recherchierte. Zweimal waren die beiden zum Tee verabredet, doch beide Male hatte Hitler ihn versetzt.
Die einzigen Briten, die vor dem Krieg näheren Kontakt mit Hitler hatten, waren Adelige, die den Nationalsozialisten nahestanden und gelegentlich über den Ärmelkanal kamen, um Hitler die Ehre zu erweisen oder ihn auf Partys zu hofieren. («Wenn er gut aufgelegt war, konnte er sehr witzig sein», schrieb zum Beispiel Diana Mitford, eine Dame der feinen faschistischen Gesellschaft. «Wenn er in der richtigen Stimmung war, hatte er eine wunderbar drollige Art, Leute nachzuahmen.») Doch das waren gesellschaftliche Kontakte. Chamberlain wollte einen Krieg vermeiden, und er glaubte, es wäre kein Fehler, sich selbst ein Bild von Hitler zu verschaffen. War das ein Mann, mit dem man vernünftig verhandeln konnte? Dem man vertrauen konnte? Das wollte Chamberlain herausfinden.
Am Morgen des 14. September schickte der britische Botschafter in Berlin ein Telegramm an den deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop. Wäre Hitler zu einem Treffen bereit? Noch am selben Tag antwortete von Ribbentrop: Ja. Chamberlain war ein gewiefter Politiker und Selbstdarsteller und ließ die Nachricht an die Öffentlichkeit durchsickern. Er würde nach Deutschland fliegen, um zu sehen, ob Friedensverhandlungen möglich waren. Ganz Großbritannien jubelte. In Umfragen glaubten 70 Prozent, der Besuch sei «gut für den Frieden». Die Zeitungen standen hinter ihm. Ein Auslandskorrespondent in Berlin berichtete, er habe in einem Restaurant gegessen, als die Nachricht bekannt wurde; daraufhin hätten sich sämtliche Gäste erhoben, um auf den britischen Premier anzustoßen.
Am Morgen des 15. September brach Chamberlain in London auf. Er hatte noch nie in einem Flugzeug gesessen, doch er blieb ruhig, selbst als die Maschine in der Nähe von München in Turbulenzen geriet. Am Flughafen hatten sich Tausende Menschen versammelt, um ihn zu begrüßen. Eine Staffel von vierzehn Mercedes-Karossen brachte ihn zum Bahnhof, dann speiste er in Hitlers Salonwagen zu Mittag, während ihn der Zug nach Berchtesgaden brachte. Um fünf Uhr nachmittags traf er schließlich am Berghof ein, Hitler nahm ihn in Empfang und schüttelte ihm die Hand. In einem Brief an seine Schwester Ida schilderte Chamberlain später seinen ersten Eindruck:
Auf halber Treppe stand der Führer, ohne Hut und in einem khakifarbenen Wolljackett, um den Arm trug er eine rote Hakenkreuzbinde und auf der Brust das Eiserne Kreuz. Er trug eine schwarze Hose, wie wir sie zur Abendgarderobe tragen, und dazu schwarze Schnürschuhe aus Leder. Er hat braunes, nicht schwarzes Haar und blaue Augen, sein Ausdruck ist eher unangenehm, vor allem wenn er ruht, und insgesamt wirkt er alles andere als distinguiert. In der Menge würde man ihn nicht bemerken und für den Anstreicher halten, der er war.
Hitler führte Chamberlain in sein Arbeitszimmer, zusammen mit nur einem Dolmetscher. Das Gespräch verlief zeitweise hitzig: «Ich bin bereit, den Weltkrieg in Kauf zu nehmen!», soll Hitler einmal geschrien haben. Der Diktator ließ keinen Zweifel daran, dass er das Sudetenland besetzen würde und dass es ihm gleichgültig war, was die Welt davon hielt. Chamberlain wollte wissen, ob das alles sei, was Hitler wollte. Hitler sagte, das sei alles. Chamberlain sah Hitler lange und scharf an und kam zu dem Schluss, dass er ihm glauben konnte. Im Brief an seine Schwester schrieb er, er habe von Leuten aus dem Umfeld des Führers gehört, Hitler habe gesagt, er habe «mit einem Mann» gesprochen. Chamberlain weiter:
Ich hatte, wie es meine Absicht gewesen war, ein gewisses Vertrauen hergestellt. Trotz der Härte und Rücksichtslosigkeit, die ich in seinem Gesicht zu sehen meinte, hatte ich den Eindruck, dass dies ein Mann war, auf den man sich verlassen könnte, wenn er sein Wort gegeben hatte.
Am nächsten Morgen flog Chamberlain nach England zurück. Auf dem Rollfeld von Heston Airport gab er eine kurze Erklärung ab. «Gestern Nachmittag hatte ich ein langes Gespräch mit Herrn Hitler. Ich bin überzeugt, dass nun jeder von uns den Standpunkt des anderen versteht.» Man werde sich wieder treffen, diesmal etwas näher an England – «um einem alten Mann eine weitere derart lange Reise zu ersparen», wie Chamberlain sagte. Die Anwesenden «lachten und jubelten».
2.
Chamberlains Verhandlungen mit Hitler gelten heute als eine der größten Dummheiten des Zweiten Weltkriegs. Chamberlain ließ sich von Hitler einwickeln. Er ließ sich am Verhandlungstisch übertölpeln. Er deutete Hitlers Absichten falsch und versäumte es, ihn darauf hinzuweisen, dass ein Wortbruch gravierende Folgen haben würde. Die Geschichte hat es nicht gut gemeint mit Neville Chamberlain.
Doch hinter aller Kritik bleibt eine große Frage: Chamberlain flog noch zweimal nach Deutschland. Er verbrachte viele Stunden mit Hitler, die beiden Männer sprachen, stritten, aßen zusammen und gingen spazieren. Chamberlain war der einzige Regierungschef der Alliierten, der mehr Zeit mit Hitler verbrachte. Er beobachtete das Verhalten seines Gegenübers genauestens. «Bei unserem Gespräch schien Hitlers Äußeres und sein Benehmen auf Sturmwarnung hinzudeuten», sagte Chamberlain seiner Schwester Hilda nach seiner nächsten Deutschlandreise. Doch dann «hat er mir den doppelten Handschlag gegeben, den er sich für besonders freundliche Gesten vorbehält». Wieder in London, teilte er seinen Ministern mit, er habe im Reichskanzler «kein Anzeichen des Wahnsinns, aber viele der Erregung» gesehen. Hitler sei nicht verrückt. Er sei vernünftig und entschlossen: «Er hat sich genau überlegt, was er will, und ist entschlossen, es zu bekommen; über einen bestimmten Punkt hinaus wird er keinen Widerstand dulden.»
Chamberlain ging von derselben Annahme aus, von der wir alle ausgehen, wenn wir Fremde verstehen wollen. Wir sind überzeugt, dass alles, was wir in einer persönlichen Begegnung erfahren, besonders wertvoll ist. Wir kämen niemals auf den Gedanken, Babysitter für unsere Kinder anzuheuern, ohne sie vorher persönlich in Augenschein genommen zu haben. Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter nicht blind ein, sondern laden sie zu stundenlangen Vorstellungsgesprächen ein. Genau wie Chamberlain wollen wir dem anderen in die Augen sehen, sein Verhalten begutachten und daraus unsere Schlüsse ziehen. Er hat mir den doppelten Handschlag gegeben. Doch nichts von dem, was Chamberlain aus den persönlichen Begegnungen mitnahm, half ihm, Hitler besser zu verstehen. Im Gegenteil.
War Chamberlain naiv? Mag sein. Er war außenpolitisch unbeleckt. Einer seiner Kritiker verglich ihn später mit einem Pfarrer, der zum ersten Mal in eine Kneipe kommt und nicht unterscheiden kann, «ob er eine gesellige Zusammenkunft vor sich hat oder eine wüste Schlägerei».
Doch Chamberlain war nicht allein. Dem späteren Außenminister Lord Halifax erging es ähnlich. Halifax stammte aus einer Adelsfamilie, er war in Eton zur Schule gegangen und hatte an der Eliteuniversität Oxford studiert. Zwischen den beiden Weltkriegen war er Vizekönig von Indien gewesen und hatte mit Mahatma Gandhi verhandelt. Er war alles, was Chamberlain nicht war: weltgewandt, erfahren, charmant, ein Intellektueller und gleichzeitig so fromm, dass Churchill ihm den Spitznamen «Holy Fox» verpasste.
Halifax war im Herbst 1937 nach Berlin geflogen und hatte den Führer in Berchtesgaden getroffen. Bis dahin war er der Einzige aus der britischen Führungsriege gewesen, der persönlichen Kontakt zu Hitler gehabt hatte. Ihr Treffen war kein leeres diplomatisches Geplänkel gewesen. Es hatte damit begonnen, dass Halifax Hitler für einen Butler hielt und ihm beinahe seinen Mantel gereicht hätte. Dann war Hitler fünf Stunden lang Hitler: Er schmollte, tobte, schweifte ab und klagte an. Er ließ sich darüber aus, wie sehr er die Presse hasste, und ereiferte sich über das Übel des Kommunismus. Halifax erduldete es «mit einer Mischung aus Staunen, Abscheu und Mitgefühl», wie ein britischer Diplomat schrieb. Er hielt sich fünf Tage lang in Deutschland auf und sprach mit den beiden führenden Ministern Hermann Göring und Joseph Goebbels. Er nahm an einem Empfang der britischen Botschaft teil, auf dem er eine Reihe deutscher Politiker und Unternehmer kennenlernte. Wieder zu Hause, erklärte Halifax, es sei sinnvoll, mit der deutschen Führung in Kontakt zu treten. Daran gebe es keinen Zweifel. Dafür sind Diplomaten schließlich da. In der persönlichen Begegnung hatte er sich einen Eindruck von Hitlers rücksichtsloser und launischer Art verschaffen können. Aber zu welchem Schluss kam Halifax? Dass Hitler keinen Krieg wollte und dass er für Friedensverhandlungen offen war. Niemand hätte Halifax für naiv gehalten, doch nach dem Treffen mit Hitler war er derselben Täuschung erlegen wie nach ihm Chamberlain.
Der britische Diplomat, der mehr mit Hitler zu tun hatte als jeder andere, war der Botschafter Nevile Henderson. Er traf ihn mehrfach und besuchte seine Kundgebungen. Hitler hatte sogar einen Spitznamen für Henderson: Er bezeichnete ihn als den «Diplomaten mit Nelke im Knopfloch», weil der elegante Henderson immer eine Blume am Revers trug. Nachdem er Anfang September 1938 den berüchtigten Nürnberger Reichsparteitag besucht hatte, schrieb er in einer Meldung nach London, Hitler sei ihm krank erschienen und «könnte die Schwelle zum Wahnsinn überschritten haben». Man kann Henderson nicht vorwerfen, dass er auf Hitler hereingefallen wäre. Doch vermutete er deshalb unehrenwerte Absichten gegenüber der Tschechoslowakei? Nein. Er war überzeugt, «Hitler hasst den Krieg so sehr wie jeder andere auch». Auch Henderson täuschte sich in ihm.[*]
Chamberlain und Halifax waren auf andere Weise blind als die CIA im ersten Rätsel. Im Falle der CIA waren im Grunde intelligente und gewissenhafte Menschen nicht in der Lage, zu erkennen, dass sie getäuscht wurden. Im Falle von Hitler ließen sich dagegen einige Menschen täuschen und andere nicht. Das Rätsel ist, warum sich genau diejenigen Menschen täuschen ließen, von denen man es nicht erwarten würde, nicht aber diejenigen, von denen man es erwarten würde.
Winston Churchill zweifelte beispielsweise keine Sekunde lang, dass Hitler ein heuchlerischer Verbrecher war. In seinen Augen war Chamberlains Besuch «das Dümmste, was er je gemacht hat». Aber er kannte Hitler nur aus der Zeitung. Auch Duff Cooper, einer von Chamberlains Ministern, ging Hitler nicht auf den Leim. Mit Entsetzen lauschte er Chamberlains Bericht von seiner Unterredung mit dem Führer. Später trat er aus Protest zurück. Aber auch Cooper war Hitler nie begegnet. Nur ein einziger britischer Diplomat, nämlich Halifax’ Amtsvorgänger Anthony Eden, war Hitler persönlich begegnet und erkannte in ihm den, der er war. Und die anderen? Diejenigen, die mit ihrer Meinung zu Hitler recht behielten, waren ihm nie persönlich begegnet. Und diejenigen, die sich in ihm täuschten, hatten sich stundenlang mit ihm unterhalten.
Das könnte natürlich bloßer Zufall sein. Vielleicht hatten Chamberlain und seine Mitarbeiter ihre Gründe, ihre Wunschvorstellung von Hitler zu sehen und nichts auf ihren persönlichen Eindruck zu geben. Wenn nur dieses rätselhafte Muster nicht überall auftreten würde.
3.
Der Haftrichter war ein grauhaariger Mann mittleren Alters, und mit seinem Dialekt konnte er seine Herkunft aus Brooklyn nicht verleugnen. Nennen wir ihn Solomon. Seit über einem Jahrzehnt stand er im Dienst der Justiz des Bundesstaates New York. Er wirkte nicht arrogant oder einschüchternd, sondern war im Gegenteil ein nachdenklicher und erstaunlich liebenswürdiger Mann.
Es war ein Donnerstag, und an Donnerstagen wurden in der Regel besonders viele Angeklagte vorgeführt. Die meisten waren in den vergangenen 24 Stunden festgenommen worden, weil ihnen ein Vergehen zur Last gelegt wurde. Sie hatten eine schlaflose Nacht in der Untersuchungshaft verbracht und wurden nun einer nach dem anderen in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie nahmen zu Solomons Linker auf einer Bank hinter einer Abtrennung Platz. Wenn ein Fall aufgerufen wurde, reichte ihm ein Gerichtsdiener eine Mappe, die er überflog. Der Angeklagte stand direkt vor Solomon, der Verteidiger auf der einen, der Staatsanwalt auf der anderen Seite. Die beiden Juristen redeten, und Solomon hörte zu. Dann entschied er, ob der Angeklagte eine Kaution hinterlegen musste, und wenn ja, wie viel. Verdient dieser wildfremde Mensch die Freiheit?
Am schwierigsten, so sagte er später, seien Fälle, in die Kinder involviert waren. Ein Sechzehnjähriger stand vor ihm und wurde grausiger Verbrechen angeklagt. Und er wusste, wenn er die Kaution zu hoch ansetzte, dann würde das Kind im «Käfig» landen, im berüchtigten Gefängnis von Rikers Island, «wo hinter jeder Ecke ein Aufstand lauert», wie er es ausdrückte.[*] Noch schwieriger wurde es, wenn er aufblickte und im Saal die Mutter des Angeklagten sitzen sah. «Solche Fälle habe ich täglich», sagte er. Seit einiger Zeit meditierte er. Das erleichtere die Dinge.
Tagein, tagaus stand Solomon vor demselben Problem, das Neville Chamberlain und die britischen Diplomaten im Herbst 1938 beschäftigte: Er sollte über den Charakter eines fremden Menschen urteilen. Und genau wie Chamberlain nimmt das Strafrecht an, dass sich dazu Richter und Angeklagte am besten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.
Am Nachmittag stand zum Beispiel ein älterer Mann mit schütterem Haar vor Solomon. Der Mann trug Jeans und ein weißes Hemd und sprach nur Spanisch. Er war wegen eines «Vorfalls» mit dem Enkel seiner Freundin verhaftet worden; der Kleine war zu seinem Vater gelaufen und hatte den Mann beschuldigt. Der Staatsanwalt forderte eine Kaution von 100000 Dollar – eine Summe, die dieser Mann unmöglich aufbringen konnte. Wenn Solomon dem Staatsanwalt zustimmte, käme der Mann ins Gefängnis.
Andererseits stritt er alles ab. Er hatte zwei Vorstrafen, doch die Fälle lagen weit zurück, und beide Male hatte es sich um kleinere Vergehen gehandelt. Er war Mechaniker, und wenn er ins Gefängnis kam, wäre er seinen Job los. Mit dem Einkommen zahlte er den Unterhalt für seine Exfrau und ihren fünfzehnjährigen Sohn. Also musste sich Solomon Gedanken um den Jungen machen, der auf die Zahlungen des Vaters angewiesen war. Außerdem wusste er natürlich, dass Sechsjährige keine verlässlichen Zeugen waren. Solomon hatte keine Möglichkeit, einzuschätzen, ob es sich um ein Missverständnis handelte oder um einen Teil eines unheilvollen Musters. Die Entscheidung, ob er diesen Mann auf freien Fuß setzen oder bis zur Verhandlung hinter Gitter bringen sollte, war im Grunde unmöglich zu treffen. Er blickte dem Mann in die Augen und versuchte, sich einen Eindruck davon zu machen, wer er wirklich war. War das hilfreich? Oder sind Richter in demselben Rätsel gefangen wie Neville Chamberlain?
4.
Die beste Antwort auf diese Frage liefert eine Untersuchung, die von einem Wirtschaftswissenschaftler der Universität Harvard, drei Informatikern und einem Kautionsexperten der Universität Chicago durchgeführt wurde. Die Wissenschaftler – der Einfachheit halber verwende ich nur den Namen des beteiligten Wirtschaftswissenschaftlers, Sendhil Mullainathan – führten ein Experiment in New York City durch. Sie sichteten die Akten von 554689 Angeklagten, die zwischen 2008 und 2013 dem Haftrichter vorgeführt worden waren, und stellten fest, dass die Richter etwas mehr als 400000 dieser Angeklagten gegen eine Kaution freiließen.
Dann entwickelte Mullainathan ein Computerprogramm, fütterte es mit derselben Information, die die Staatsanwaltschaft den Richtern vorgelegt hatte (zum Beispiel Alter und Vorstrafen der Angeklagten), und ließ den Computer aus diesen 554689 Personen 400000 auswählen, die gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt werden sollten. Mensch gegen Maschine: Wer traf die besseren Entscheidungen? Wessen Kandidaten begingen weniger Straftaten, wenn sie nicht in Untersuchungshaft kamen, wessen Kandidaten erschienen eher zum ersten Gerichtstermin? Zwischen den Ergebnissen lagen Welten. Die Angeklagten, die der Computer auf Kaution freigelassen hätte, begingen in der Zeit vor dem Prozess mit einer um 25 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit eine Straftat als die 400000 Angeklagten, die von den New Yorker Richtern gegen Kaution freigelassen wurden. 25 Prozent. Die Maschine war den menschlichen Richtern haushoch überlegen.[*]
Um Ihnen nur einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was Mullainathans Programm leistete: Es stufte 1 Prozent der Angeklagten als «besonders gefährdet» ein, also als Personen, die auf jeden Fall in Untersuchungshaft genommen werden sollten. Nach den Berechnungen der Maschine würde mehr als die Hälfte dieser Angeklagten eine weitere Straftat begehen, wenn man sie gegen eine Kaution gehen ließe. Als Richter über dieselbe Gruppe von Angeklagten entschieden, ließen sie 48,5 Prozent davon auf Kaution frei! «Viele der Angeklagten, die das Programm als ‹besonders gefährdet› einstufte, wurden von den Richtern als ‹kaum gefährdet› eingestuft», schrieb Mullainathan in einem besonders vernichtenden Abschnitt seines Berichts. «Diese Untersuchung lässt darauf schließen, dass Richter nicht nur die Schwelle für eine Untersuchungshaft zu hoch ansetzen, sondern dass sie die Angeklagten falsch einschätzen … Die wenigen Angeklagten, die sie inhaftieren lassen, stammen aus der gesamten prognostizierten Risikoverteilung.» Mit anderen Worten: Die Richter entschieden absolut willkürlich.
Wahrscheinlich verwundert Sie das genauso wie mich. Haftrichter treffen ihre Entscheidungen aufgrund von dreierlei Informationen: Sie haben die Akte des Angeklagten – Alter, Wohnort, Arbeitsplatz, Vorstrafen, was bei der letzten Kaution passierte. Sie haben die Aussage des Staatsanwalts und des Verteidigers, die sie im Gerichtssaal selbst hören. Und sie haben ihren persönlichen Eindruck von dem Menschen, der da vor ihnen steht.
Mullainathans Computer sieht dagegen die Angeklagten nicht, und er hört nicht, was im Gerichtssaal gesagt wird. Er hat nur die Akte des Angeklagten. Er verfügt also nur über einen Bruchteil der Informationen, die der Richter erhält, und trotzdem entscheidet er besser.
In meinem zweiten Buch Blink! habe ich ein Orchester beschrieben, das bessere Musiker einstellte, wenn es die Bewerber hinter einem Schirm vorspielen ließ. Die Verantwortlichen trafen bessere Personalentscheidungen, wenn sie weniger Informationen zur Verfügung hatten. Das lag daran, dass der optische Eindruck weitgehend irrelevant ist. Um zu entscheiden, ob jemand gut Geige spielt, muss man nicht wissen, ob er oder sie groß oder klein, hübsch oder hässlich, schwarz oder weiß ist. Im Gegenteil, mit diesen Informationen kommen Vorurteile ins Spiel, die das Urteil erschweren.
Aber man sollte doch meinen, dass diese Informationen für einen Richter, der über die Kaution zu entscheiden hat, sehr wohl eine Rolle spielen. An besagtem Donnerstag wurde Solomon ein junger Mann in kurzen Hosen und grauem T-Shirt vorgeführt, der einen anderen Mann angegriffen und später mit dessen gestohlener Kreditkarte ein Auto gekauft haben sollte. Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass der Angeklagte nach zwei früheren Verhaftungen nicht zu Gerichtsterminen erschienen war – ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Aber: Warum war der Mann nicht vor Gericht erschienen? Hatte man ihm ein falsches Datum genannt? Hätte er seinen Job verloren, wenn er an diesem Tag den Gerichtstermin wahrgenommen hätte? War sein Kind im Krankenhaus? Das behauptete zumindest die Verteidigerin: Ihr Mandant habe eine gute Entschuldigung. Auf diese Information kann nur der Richter zugreifen, nicht der Computer. Sollte das nicht helfen?
Solomon sagte außerdem, besonders schwierig seien für ihn Fälle von psychischen Erkrankungen in Zusammenhang mit Gewalt. Für Richter sei das ein ganz besonderer Albtraum. «Sie lassen jemanden frei, der nimmt seine Medikamente nicht mehr ein und begeht ein grausiges Verbrechen»: