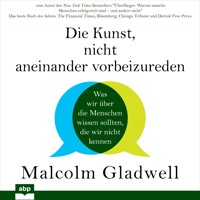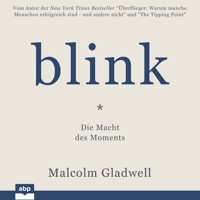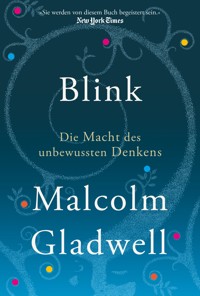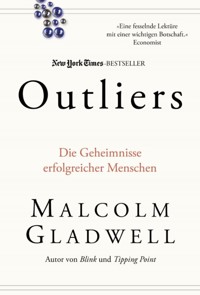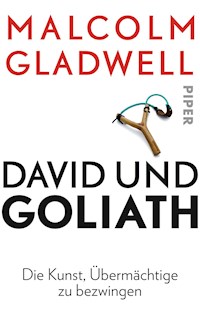
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»David und Goliath« erzählt von gewöhnlichen Menschen, die sich Riesen entgegenstellen. Gegen erdrückende Mächte können auch scheinbar unterlegene Gegner siegen. Ob listige Krieger, geschickte Sportler oder geniale Softwareingenieure: Gladwell zeigt mit einer Fülle von Beispielen und in dem von ihm gewohnten originell-argumentierenden wie sorgfältig begründeten Stil, dass Triumph keine Frage der Größe, sondern der inneren Haltung ist. Lehrreich und spannend!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für A. L. und S. F., einen echten Underdog
Die englischsprachige Originalausgabe
David and Goliath: Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants
erschien 2013 bei Little, Brown and Company Copyright © 2013 by Malcolm Gladwell
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
© 2013. Alle deutschsprachigen Rechte bei Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: hauser lacour, Frankfurt; Tina Michl
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
EinleitungIm Tal von Elah
2
3
4
Teil 1
Die Stärken der Schwachen
(und die Schwächen der Starken)
Kapitel 1
1
2
3
4
5
6
Kapitel 2
1
2
3
4
5
6
Kapitel 3
1
2
3
4
5
6
7
Teil 2
Die Theorie der wünschenswerten Schwierigkeiten
Kapitel 4
1
2
3
4
5
6
Kapitel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kapitel 6
1
2
3
4
5
6
7
Teil lll
Die Grenzen der Macht
Kapitel 7
1
2
3
4
5
6
Kapitel 8
1
2
3
4
5
6
7
Kapitel 9
1
2
3
Dank
Anmerkungen
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
EinleitungIm Tal von Elah
Der Herr aber sagte zu Samuel:
Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das,
worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.
1. Samuel 16,7
Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?
Goliath[1]
Im Herzen des antiken Palästina liegt eine Region namens Schephela, eine Hügellandschaft, die die Judäische Berge im Osten mit der weiten Tiefebene der Mittelmeerküste verbindet. Es ist eine Gegend von atemberaubender Schönheit, in der Wein und Weizen angebaut werden und Maulbeer- und Terebinthenwälder wachsen. Außerdem sind sie von großer strategischer Bedeutung.
In den vergangenen Jahrtausenden wurde die Region immer wieder heftig umkämpft, denn durch die Täler der Schephela erhalten die Küstenbewohner Zugang zu den Städten Hebron, Bethlehem und Jerusalem in den Judäischen Bergen. Das wichtigste Tal ist Aijalon im Norden, doch das geschichtsträchtigste ist Elah. Hier stellte sich Saladin im 12. Jahrhundert den Kreuzfahrern entgegen, hier erhoben sich knapp anderthalb Jahrtausende zuvor die Makkabäer gegen die Seleukiden, und hier traf zu Zeiten des Alten Testaments das junge Königreich Israel auf das Heer der Philister.
Die Philister waren von Kreta gekommen. Sie waren ein Volk von Seefahrern, das sich an der Küste Palästinas niedergelassen hatte. Die Israeliten lebten in den Bergen unter der Herrschaft von König Saul. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung wandten sich die Philister nach Osten und zogen das gewundene ElahTal hinauf. Ihr Ziel war es, eine Hügelkette in der Nähe von Bethlehem einzunehmen und so einen Keil in Sauls Königreich zu treiben. Die Philister waren gefürchtete Krieger und kamen als erklärte Feinde der Israeliten. In Sorge rief König Saul seine Krieger zusammen und eilte von den Bergen herab, um sich den Eindringlingen entgegenzustellen.
Die Philister schlugen ihr Lager am Südhang des ElahTals auf, die Israeliten sammelten sich auf der Nordseite. Nun standen sich die Armeen nur durch den Fluss getrennt gegenüber und warteten. Ein Angriff hätte bedeutet, den Hang hinunter und auf der anderen Talseite ohne jede Deckung den feindlichen Hang hinaufzustürmen. Keines der beiden Heere wagte den ersten Schritt – bis die Philister ihren stärksten Krieger ins Tal schickten, um die Israeliten herauszufordern und mit einem Zweikampf den Stillstand zu überwinden.
Der Mann war ein Riese. Er war über 2 Meter groß, trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer und war mit einem Schwert, einem Spieß und einem Wurfspeer bewaffnet. Vor ihm ging ein Mann her, der seinen Schild trug. Der Hüne baute sich vor den Israeliten auf und rief: »Wählt euch doch einen Mann aus! Er soll zu mir herunterkommen. Wenn er mich im Kampf erschlagen kann, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen.«
Die Israeliten erstarrten. Wer sollte diesen furchterregenden Gegner bezwingen? Schließlich trat ein Hirtenjunge vor, der aus Bethlehem gekommen war, um seinen Brüdern in Sauls Heer Proviant zu bringen. Saul stellte sich dem Jungen in den Weg: »Du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen; du bist zu jung, er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend.« Doch der Hirtenjunge ließ sich nicht beirren. Er hatte schon gefährlichere Gegner bezwungen: »Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul.« Saul blieb keine andere Wahl. Er gab nach, und der Hirtenjunge lief ins Tal hinunter, wo der Riese schon auf ihn wartete. Als der seinen Gegner kommen sah, rief er ihm entgegen: »Komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben.« Damit begann einer der berühmtesten Kämpfe der Geschichte. Der Riese hieß Goliath, der Hirtenjunge David.
2
In diesem Buch geht es um gewöhnliche Menschen, die sich Riesen entgegenstellen. Mit »Riesen« meine ich übermächtige Gegner jeder Art, von Armeen und furchteinflößenden Kriegern bis hin zu Behinderungen, Schicksalsschlägen und Unterdrückung. Jedes Kapitel erzählt die Geschichte von bekannten oder unbekannten, gewöhnlichen oder genialen Menschen, die vor einer übermächtigen Herausforderung standen und mit dieser umgehen mussten. Dabei mussten sie sich fragen: Soll ich mich an die Spielregeln halten? Oder soll ich meinem Bauchgefühl folgen? Soll ich ausharren oder aufgeben? Soll ich zurückschlagen?
In diesen Geschichten möchte ich zwei Gedanken nachgehen. Der erste ist, dass vieles von dem, was uns als Gesellschaft wertvoll ist, aus ähnlich einseitigen Auseinandersetzungen hervorgeht: Der Akt des Widerstands gegen unüberwindlich erscheinende Hindernisse bringt Größe und Schönheit hervor. Und der zweite Gedanke ist, dass wir diese Auseinandersetzungen ganz grundsätzlich falsch verstehen. Zum einen, weil Riesen nicht das sind, was sie scheinen, und sich hinter ihrer vermeintlichen Stärke in Wirklichkeit oft eine Schwäche verbirgt. Und zum anderen, weil uns das Gefühl, am kürzeren Hebel zu sitzen, in ungeahnter Weise verändern kann: Es öffnet Türen, schafft Freiräume, zeigt Wege auf und macht Dinge möglich, die andernfalls vielleicht unmöglich gewesen wären. Wir brauchen eine bessere Anleitung für unsere Kämpfe mit Riesen, und es gibt keinen besseren Ausgangspunkt für unsere Reise als das epische Duell, das David und Goliath vor 3000 Jahren im Tal von Elah austrugen.
Als Goliath die Israeliten herausforderte, verlangte er einen Zweikampf. Das war in der Antike gängige Praxis. Um Blutvergießen in einer offenen Feldschlacht zu vermeiden, wählten beide Seiten einen Krieger aus, der sie vertreten sollte. Der römische Historiker Quintus Claudius Quadrigus berichtet beispielsweise von einer Schlacht zwischen Römern und Galliern im vierten vorchristlichen Jahrhundert, in der ein gallischer Hüne seine römischen Gegner verhöhnte. »Dies empörte einen gewissen Titus Manlius, einen jungen Mann aus edelster Familie«, schrieb Quadrigus. Titus forderte den Gallier zum Zweikampf heraus:
»Er trat vor und wollte nicht zulassen, dass ein Gallier die Ehre der Römer in derart schändlicher Weise in den Dreck zog. Bewaffnet mit einem Legionärsschild und einem spanischen Schwert trat er auf den Gallier zu. Während die beiden Männer auf der Brücke über den Anio aufeinanderprallten, sahen die Soldaten an beiden Ufern des Flusses in großer Anspannung zu. Der Gallier lauerte hinter seinem Schild auf den Angriff, während sich Manlius weniger auf sein Geschick als auf seinen Mut verließ, mit seinem Schild auf den Schild des Galliers einschlug, dass dieser den Halt verlor. Während der Gallier versuchte, sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, schlug Manlius ein weiteres Mal mit seinem Schild gegen den Schild des Galliers und zwang diesen zurückzuweichen. So schlüpfte er unter der Klinge des Galliers hindurch und stieß ihm sein spanisches Schwert in die Brust … Nachdem Manlius ihn getötet hatte, schlug er dem Gallier den Kopf ab, riss ihm die Zunge heraus und legte sie sich, blutbeschmiert, wie sie war, um den Hals.«
Genau das erwartete Goliath: einen ebenbürtigen Krieger, der sich ihm im Kampf Mann gegen Mann stellte. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass der Kampf nicht nach den althergebrachten Regeln verlaufen könnte, weshalb er sich nur für den Nahkampf gerüstet hatte. Um seinen Körper vor Schlägen zu schützen, trug er einen Panzer aus Hunderten Bronzeplättchen, die sich wie Fischschuppen über Brust und Arme legten und hinunter bis zu den Knien reichte. Allein dieser Panzer muss mehr als 50 Kilogramm gewogen haben. Außerdem trug Goliath bronzene Beinschienen, die Schienbeine und Füße schützten, sowie einen schweren Helm aus demselben Metall. Er hatte drei Waffen, die speziell für den Nahkampf ausgelegt waren: In der einen Hand hielt er einen bronzenen Spieß, der jeden Schild und selbst eine Metallrüstung durchschlagen konnte. Am Gürtel trug er ein Schwert. Und als erste Wahl hatte er einen Wurfspeer mit einem »Schaft … so dick wie ein Weberbaum«. Dank einem raffinierten, aus einem Strick und Gewichten bestehenden Mechanismus konnte Goliath diesen Speer mit großer Kraft und Präzision schleudern. Der Historiker Moshe Garsiel schreibt: »Die Israeliten fürchteten, dass der starke Goliath mit diesem außergewöhnlichen Speer mit seinem mächtigen Schaft und seiner langen und schweren Eisenspitze jeden Bronzeschild und jeden Bronzepanzer durchschlagen würde.«[2] Verstehen Sie jetzt, warum keiner der Israeliten den Mumm hatte, es mit Goliath aufzunehmen?
Bis David vortritt. Saul will ihm sein Schwert und seine Rüstung mitgeben, damit er wenigstens den Hauch einer Chance hat. Doch David lehnt dankend ab: »Ich kann in diesen Sachen nicht gehen, ich bin nicht daran gewöhnt.« Stattdessen bückt er sich, liest fünf glatte Flusskiesel vom Boden auf und steckt sie in seine Hirtentasche. Dann geht er mit seinem Hirtenstab hinunter ins Tal. Als Goliath den Jungen auf sich zukommen sieht, ist er beleidigt. Er hat erwartet, sich mit einem erfahrenen Kämpen zu messen. Stattdessen sieht er einen jungen Hirten, einen Mann aus dem niedersten aller Stände, der offenbar mit seinem Stab gegen Goliath antreten will. »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?«, ruft er dem Jungen entgegen.
Was dann passiert, ist Legende. David nimmt einen Stein aus der Tasche, schießt ihn mit seiner Schleuder ab und trifft den Riesen an der Stirn. Goliath sinkt betäubt zu Boden. David läuft zu ihm hin, nimmt das Schwert des Riesen und schlägt ihm den Kopf ab. »Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie«, heißt es in der Bibel. Wie durch ein Wunder und völlig wider Erwarten entscheidet der Schwächere den Kampf für sich. Mit dieser Moral wurde die Geschichte über die Jahrtausende hinweg immer wieder erzählt, und so gingen
»David und Goliath« als Redewendung in unsere Sprache ein: Als Metapher für einen unmöglich geglaubten Sieg. Diese Interpretation hat jedoch einen Haken: Sie ist falsch.
3
Schon die Armeen der Antike kannten drei Waffengattungen: Die Kavallerie mit ihren berittenen Kriegern und Streitwagen; die Infanterie aus Fußsoldaten mit Schwertern, Schilden und Rüstungen; und schließlich die Waffengattung, die man heute als Artillerie bezeichnen würde und die damals aus Bogenschützen und vor allem Kriegern mit Steinschleudern bestand. Die Schleuder war oft ein Ledertäschchen, an dessen Seiten jeweils ein langer Strick befestigt war. Die Schleuderer legten einen Stein in das Täschchen, wirbelten die Schleuder immer schneller und in immer größeren Kreisen herum und ließen dann ein Ende los, woraufhin der Stein herausflog. Schleudern erfordert großes Geschick und viel Erfahrung. In geübten Händen war die Schleuder eine tödliche Waffe. Bilder aus dem Mittelalter zeigen, wie Schützen mit ihrer Schleuder fliegende Vögel vom Himmel holen. Irische Schleuderer waren angeblich in der Lage, jede Münze, die sie sehen konnten, auch zu treffen. Und im »Buch der Richter« des Alten Testaments heißt es, Schleuderer konnten »einen Stein haargenau schleudern, ohne je das Ziel zu verfehlen«. Ein erfahrener Schütze konnte einen Menschen auf eine Entfernung von 200 Metern töten oder schwer verletzen.[3] Die Römer hatten spezielle Zangen, um die Steine aus dem Körper eines armen getroffenen Soldaten zu entfernen. Stellen Sie sich vor, ein Baseballprofi wirft Ihnen aus nächster Nähe und mit voller Wucht einen Ball an den Kopf – genau das drohte einem Soldaten im Angesicht eines Schleuderers. Mit dem kleinen Unterschied, dass es sich nicht um einen Ball aus Kork handelte, sondern um einen Stein. Der Historiker Baruch Halpern behauptet, die Schleuder sei in der antiken Kriegsführung derart wichtig gewesen, dass sich die drei Waffengattungen die Waage hielten – ähnlich wie im Spiel Schere, Stein, Papier. Mit ihren langen Spießen und ihrer Rüstung konnten es die Infanteristen mit der Kavallerie aufnehmen. Diese wiederum war der Artillerie überlegen, da die Reiter aufgrund ihrer Schnelligkeit ein schlechtes Ziel boten. Und die Schleuderer waren wiederum eine tödliche Gefahr für die Fußsoldaten, denn ein großer, unbeholfener Soldat, der unter seiner Rüstung schwankte, war ein leichtes Ziel für die Schützen, die ihre Geschosse aus hundert Metern Entfernung abschossen. »Das war auch der Grund, weshalb während des Peloponnesischen Kriegs die Expedition der Athener in Sizilien scheiterte«[4], schreibt Halpern. »Thukydides schildert ausführlich, wie die schwere Infanterie der Athener in den Bergen von der leichten Infanterie der Einheimischen dezimiert wurde, die vor allem Schleudern einsetzten.«
Goliath gehört der schweren Infanterie an und erwartet einen Zweikampf mit einem ebenbürtigen Krieger. Wenn er ausruft: »Komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben«, dann ist der entscheidende Teil »komm nur her zu mir«. Er meint damit, komm her, damit wir einen Nahkampf austragen. Als Saul versucht, David seine schwere Rüstung anzulegen und ihm sein Schwert in die Hand zu drücken, geht er von derselben Annahme aus. Er erwartet, dass David gegen Goliath kämpft wie Titus Manlius gegen seinen gallischen Herausforderer.
David denkt jedoch gar nicht daran, sich dem Ritual des Zweikampfs zu unterwerfen. Als er Saul davon erzählt, wie er als Hirte Bären und Löwen tötet, geht es ihm nicht nur darum, seinen Mut zu belegen. Er will Saul klar machen, dass er Goliath mit denselben Mitteln bekämpfen will wie die wilden Tiere: aus der Ferne und mit Geschossen.
Er rennt auf Goliath zu, denn ohne Panzer ist er schnell und wendig. Er legt einen Stein in seine Schleuder, wirbelt sie herum, bis sie sechs oder sieben Umdrehungen pro Sekunde erreicht, und zielt auf Goliaths Stirn – die verwundbarste Stelle des Riesen. Eitan Hirsch, Ballistikexperte der israelischen Streitkräfte, berechnete unlängst, dass ein normal großer Stein, der aus einer Entfernung von 35 Metern geschleudert wurde, mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern auf Goliaths Stirn aufgetroffen sein muss – genug, um ihn zu töten oder ihm zumindest das Bewusstsein zu rauben. Die Wucht des Aufpralls entspricht in etwa der einer Kugel, die aus einer modernen Handfeuerwaffe abgefeuert wird. »Der Stein legte die Entfernung in weniger als einer Sekunde zurück«, [5]schreibt Hirsch. »In dieser Zeit konnte sich Goliath unmöglich schützen, und vom Fleck bewegen konnte er sich ohnehin nicht.«
Was sollte Goliath denn tun? Er trägt einen mehr als 50 Kilogramm schweren Panzer und hat sich auf einen Nahkampf eingestellt, bei dem er unbeweglich stehen bleiben, Schläge mit seiner Rüstung abwehren und mit seinem Spieß zustoßen kann. Als David auf ihn zuläuft, verspürt er vermutlich erst Verachtung und dann Verwunderung, ehe ihm ein Schrecken durch alle Glieder fährt und ihm klar wird, dass dieser Kampf einen unerwarteten Verlauf nehmen wird.
»Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast«, verkündet David. »Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft; denn es ist ein Krieg des Herrn und er wird euch in unsere Gewalt geben.« Zweimal erwähnt David das Schwert und den Speer Goliaths, als wolle er besonders betonen, dass er eine ganz andere Strategie verfolgt. Dann holt er einen Stein aus der Tasche, und in diesem Moment hält vermutlich keiner der Zuschauer zu beiden Seiten des Tals seinen Sieg für unwahrscheinlich. David ist ein Schleuderer, und Artillerie schlägt Infanterie.
»Mit seinem Schwert hatte Goliath ungefähr genauso gute Chancen gegen David wie gegen einen Gegner mit einer automatischen Pistole«, schreibt der Historiker Robert Dohrenwend.[6]
4
Warum werden die Ereignisse dieses Tages im ElahTal bis heute so gründlich missverstanden? Zum einen zeigt der Zweikampf, dass wir völlig falsche Vorstellungen davon haben, was Macht bedeutet. König Saul hält David für chancenlos, weil David klein ist und Goliath groß.
Für Saul ist Macht eine Frage der physischen Stärke. Er sieht nicht, dass Macht auch andere Formen annehmen kann, oder dass David gegen die Spielregeln verstoßen und Stärke durch Schnelligkeit oder ein Überraschungsmoment wettmachen könnte. Doch Saul ist nicht der einzige, der diesen Fehler macht. Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, dass wir diesem Fehler bis heute erliegen, und dass dies Auswirkungen auf den verschiedensten Gebieten hat, angefangen von der Kindererziehung bis zur Verbrechensbekämpfung.
Daneben begehen wir jedoch einen zweiten Fehler. Saul und die Israeliten meinen zu wissen, wer Goliath ist. Sie sehen seine schiere physische Größe und schließen daraus auf seine Fähigkeiten. Aber in Wirklichkeit nehmen sie ihn gar nicht wahr. Bei genauerem Hinsehen verhält sich Goliath sonderbar. Er gilt als unbezwingbarer Krieger, doch irgendetwas scheint nicht mit ihm zu stimmen. Als er ins Tal kommt, trägt ein Diener seinen Schild vor ihm her. Im Altertum begleiteten die Schildknappen in der Regel nur die Bogenschützen in die Schlacht, denn während diese ihre Pfeile abschossen, hatten sie keine Hand frei, um ihren Schild selbst zu halten. Warum braucht Goliath, der einen Schwertkampf fordert, einen Diener, der ihm den Schild wie einem Bogenschützen trägt? Und warum fordert er David auf, zu ihm zu kommen? Warum kann er nicht selbst zu David gehen? Die biblische Erzählung betont, dass Goliath sich deutlich schwerfälliger bewegt als David – eine merkwürdige Beschreibung für einen vermeintlich unbezwingbaren Helden. Und warum reagiert er nicht viel eher, als er David ohne Schild und Rüstung den Hang herunterlaufen sieht? Er scheint gar nicht zu bemerken, was um ihn herum vorgeht. Und schließlich diese seltsame Bemerkung über den Hirtenstab: »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?« Wieso »mit Stecken?« David hat doch nur einen einzigen Stock!
Auf der Suche nach einer Erklärung für diese sonderbaren Verhaltensweisen haben Mediziner spekuliert, dass Goliath unter einer schweren Krankheit gelitten haben könnte: Er wirkt ganz wie jemand, der unter Akromegalie leidet.[7] Ursache dieser Erkrankung ist ein gutartiger Tumor an der Hirnanhangdrüse. Dieser Tumor ist keine Seltenheit und bewirkt eine Überproduktion des Wachstumshormons, was zu »Gigantismus« führen kann. Das würde zumindest Goliaths ungewöhnliche Größe erklären. (Robert Wadlow, der größte Mensch der Welt, litt übrigens ebenfalls unter Akromegalie. Bei seinem Tod maß er über 2,70 Meter und schien nicht mit dem Wachsen aufhören zu wollen.) Der Tumor an der Hirnanhangdrüse kann so groß werden, dass er auf den Sehnerv drückt. Daher leiden Menschen mit Akromegalie oft unter starken Sehbehinderungen oder sehen doppelt. Warum muss er von einem Begleiter ins Tal geführt werden? Weil er selbst kaum sehen kann. Warum bewegt er sich so schwerfällig? Weil er seine Umgebung nur verschwommen wahrnimmt. Warum braucht er so lange, um zu verstehen, dass sich David nicht an die Spielregeln hält? Weil er David gar nicht sieht, bis dieser schon fast vor ihm steht. »Komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben«, ruft er, und weist damit auf seine Verwundbarkeit hin: Du musst zu mir kommen, denn ich kann dich nicht sehen. Und dann der unerklärliche Ausruf: »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?« David hat nur einen Stab, doch Goliath sieht offenbar zwei.
Was die Israeliten von ihrem fernen Hügel aus sehen, ist ein furchteinflößender Hüne. Doch in Wirklichkeit ist Goliaths Größe ein Hinweis auf seine größte Schwäche. Das ist eine wichtige Lektion für unsere Kämpfe mit allen möglichen Riesen. Die Starken und Mächtigen sind oft nicht das, was sie zu sein scheinen.
Als David auf Goliath zustürmt, wird er von seinem Mut und seinem Glauben getragen. Ehe Goliath versteht, was passiert, liegt er auch schon am Boden – zu groß, zu langsam und zu kurzsichtig, um zu erkennen, wann sich das Blatt gewendet hat. Lange Zeit haben wir diese Geschichte falsch verstanden. Es wird Zeit, sie richtig zu erzählen.
Teil 1
Die Stärken der Schwachen
(und die Schwächen der Starken)
Mancher stellt sich reich und hat doch nichts,ein anderer stellt sich arm und hat großen Besitz.
Sprüche 13,7
Kapitel 1
Es war irgendwie total schräg. Mein Vater hatte noch nie im Leben Basketball gespielt.
Vivek Ranadivé[8]
1
Als Vivek Ranadivé beschloss, die Basketballmannschaft seiner Tochter Anjali zu trainieren, nahm er sich zwei Dinge vor. Erstens wollte er nie laut werden. Das Team bestand vor allem aus Mädchen im Alter von zwölf Jahren, und Zwölfjährige, das wusste er aus Erfahrung, mögen es überhaupt nicht, wenn man sie anschreit. Er würde sich am Spielfeldrand genauso verhalten wie in seiner Softwarefirma: Er würde ruhig und leise sprechen und die Mädchen von seinen Vorschlägen überzeugen, indem er an ihre Vernunft und ihren gesunden Menschenverstand appellierte.
Sein zweiter Vorsatz war nicht weniger wichtig. Ranadivé verstand nämlich nicht, wie Amerikaner Basketball spielten. Er kam aus Mumbai und war mit Fußball und Cricket groß geworden. Als er zum ersten Mal ein Basketballspiel sah, kam es ihm völlig hirnlos vor. Mannschaft A machte einen Punkt und lief sofort zurück in ihre Hälfte des Spielfelds. Dann warfen sich die Spieler von Mannschaft B den Ball zu und dribbelten gemächlich in die gegnerische Hälfte, wo Mannschaft A bereits geduldig wartete. So ging es hin und her.
Ein Basketballfeld ist 28 Meter lang. Die meiste Zeit verteidigte eine Mannschaft jedoch nur ein Viertel davon und überließ den ganzen Rest des Spielfelds dem Gegner. Hin und wieder wagte sie sich weiter vor, um den Gegner am Spielaufbau zu hindern, doch diese sogenannte PressingPhase war meist nach wenigen Minuten schon wieder vorüber. In der Welt des Basketball schien es eine unausgesprochene Abmachung zu geben, wie das Spiel zu spielen sei, doch diese Abmachung war nach Ansicht von Ranadivé daran schuld, dass der Abstand zwischen guten und schlechten Mannschaften immer größer wurde. Gute Mannschaften hatten große Spieler, die gut dribbeln und werfen und die sorgfältig aufgebauten Spielzüge in der gegnerischen Hälfte mit einem erfolgreichen Korbwurf abschließen konnten. Aber warum gaben ihnen die schlechteren Mannschaften den Platz, ihre Fähigkeiten auszuspielen?
Ranadivé sah sich die Mädchen in seinem Team an. Morgan und Julia waren gute Spielerinnen. Aber Nicky, Angela, Dani, Holly, Annika und seine Tochter Anjali hatten nie zuvor Basketball gespielt. Sie waren klein. Sie konnten nicht werfen. Sie waren keine Dribbelkünstlerinnen. Sie standen nicht jeden Abend auf dem Schulhof herum und warfen auf Körbe. Die meisten waren, wie Ranadivé sagt, »kleine blonde Mädchen« aus Menlo Park und Redwood City, dem Herzen von Silicon Valley. Sie waren die Töchter von Stubenhockern und Programmierern. Sie arbeiteten an naturwissenschaftlichen Unterrichtsprojekten, lasen dicke und komplizierte Bücher und träumten davon, später einmal Meeresbiologinnen zu werden. Ranadivé war klar, wenn diese Mädchen auf konventionelle Art und Weise spielen würden und widerstandslos zusahen, wie ihre Gegnerinnen unter ihren Korb dribbelten, dann hatten sie nicht die geringste Chance gegen Mädchen, für die Basketball eine echte Leidenschaft war. Ranadivé war im Alter von 17 Jahren und mit 50 Dollar in der Tasche in die Vereinigten Staaten gekommen. Er war ein Mann, der nicht gern verlor. Sein zweiter Vorsatz war daher, dass seine Mannschaft in jedem Spiel und über die gesamte Spielzeit hinweg Pressing spielen würde. Sein Team wurde so erfolgreich, dass sie sich für die Endrunde der Landesmeisterschaften qualifizierte. »Es war irgendwie total schräg«, sagt seine Tochter Anjali Ranadivé. »Mein Vater hatte noch nie im Leben Basketball gespielt.«
2
Stellen Sie sich vor, wir addieren alle Kriege, die in den vergangenen zwei Jahrhunderten zwischen sehr großen und sehr kleinen Ländern geführt wurden. Nehmen wir an, dass eine Seite mindestens zehnmal so viele Einwohner und Waffen haben muss wie die andere. Was meinen Sie: Wie oft gewinnt die zahlenmäßig überlegene Seite? Die meisten von uns würden vermutlich auf fast 100 Prozent tippen. Die tatsächliche Zahl wird Sie vielleicht überraschen: Als der Politikwissenschaftler Ivan ArreguínToft nachrechnete, stellte er fest, dass es nur 71,5 Prozent waren.[9] In knapp einem Drittel der Fälle behält das schwächere Land die Oberhand.
ArreguínToft stellte die Frage ein wenig anders. Was passiert in Kriegen zwischen starken und schwachen Ländern, in denen sich die schwache Seite auf Davids Strategie beruft und sich weigert, den Krieg nach den Regeln der stärkeren Seite zu kämpfen, sondern mit einer unkonventionellen Guerrillataktik? In diesem Fall steigt der Anteil von einem auf fast zwei Drittel. Oder um es konkreter zu machen: Die Vereinigten Staaten sind zehnmal so groß wie Kanada. Wenn die Vereinigten Staaten und Kanada Krieg führen würden und Kanada sich für eine unkonventionellen Strategie entscheiden würde, dann sollten Sie auf Kanada wetten.
Der Sieg eines Underdogs erscheint uns ausgesprochen unwahrscheinlich. Genau deshalb hat die Geschichte von David und Goliath die Menschen über Jahrtausende hinweg bewegt. Doch der Politikwissenschaftler Ivan ArreguínToft betont, dass Underdogs immer wieder als Sieger vom Feld gehen. Warum sind wir dann jedesmal so erstaunt, wenn ein David einen Goliath besiegt? Warum nehmen wir automatisch an, dass kleinere, ärmere oder weniger gebildete Menschen automatisch im Nachteil sind?
Einer der siegreichen Underdogs, mit denen sich ArreguínLoft beschäftigte, war Thomas Edward Lawrence, besser bekannte unter dem Namen »Lawrence von Arabien«. T. E. Lawrence war einer der Anführer der arabischen Revolte gegen die Armee des Osmanischen Reichs, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs die arabische Halbinsel besetzte.
Die Briten unterstützten den arabischen Aufstand, und der erste Brennpunkt war die Stadt Medina, Endstation einer langen Eisenbahnlinie, die die Türken von Damaskus durch die Wüste Hedschas hatten bauen lassen.
Doch Lawrence musste nur einen einzigen Blick auf seinen zusammengewürfelten Haufen von Beduinenkriegern werfen, um zu wissen, dass ein Angriff auf Medina von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Aber warum sollte er die Stadt überhaupt einnehmen? Die Türken saßen in Medina fest, »in der Defensive und unbeweglich«. Es waren so viele, und sie benötigten so viel Lebensmittel, Wasser und Benzin, dass sie kaum zu einer größeren Operation in der Wüste in der Lage waren. Statt die Türken da anzugreifen, wo sie am stärksten waren, wollte Lawrence sie also da packen, wo sie Schwächen hatten: entlang der ungeschützten Bahnstrecke, die ihre Nabelschnur nach Damaskus war. Statt sich also auf Medina zu konzentrieren, wollte er den Krieg über ein möglichst großes Gebiet ausdehnen.
Es war eine schwere Aufgabe. Die Türken hatten ein modernes Heer aufgeboten. Die Beduinen unter dem Befehl von Lawrence waren dagegen keine Soldaten. Sie waren Nomaden. Sir Reginald Wingate, einer der britischen Befehlshaber der Region, beschrieb sie als »wüsten Haufen, von denen die meisten noch nie auch nur ein Gewehr in der Hand gehalten haben«. Doch die Männer waren zäh und beweglich. Ein typischer Beduinenkrieger hatte ein Gewehr, hundert Schuss Munition, zwanzig Kilogramm Mehl und einen halben Liter Trinkwasser, und weil sie wussten, wie sie unterwegs Wasser finden konnten, legten sie damit selbst im Sommer pro Tag 175 Kilometer in der Wüste zurück. »Unsere Trümpfe waren Schnelligkeit und Zeit, nicht Schlagkraft«, erinnerte sich Lawrence. »Unsere wichtigste Ressource waren Stammesangehörige, die nichts von formaler Kriegsführung verstanden und deren Stärken Beweglichkeit, Ausdauer, Intelligenz, Landeskenntnis und Mut waren.« Moritz von Sachsen, ein General des 18. Jahrhunderts, tat den bekannten Ausspruch, die Kriegskunst brauche keine Arme, sondern Beine. Lawrence’ Truppen bestanden nur aus Beinen. Am 24. März 1917 sprengten seine Soldaten beispielsweise die Eisenbahnlinie an 60 Stellen und zerschnitten die Telegrafenleitung bei Buair. Am Tag darauf sabotierten sie bei Abu alNaam eine Lokomotive und sprengten die Linie an 25 Stellen. Am 27. März sprengten sie die Strecke an 15 Stellen und zerschnitten die Telegrafenleitung bei Istabl Antar. Zwei Tage später überfielen sie eine kleine türkische Garnison und brachten einen Zug zum Entgleisen. Am 31. März kehrten sie nach Buair zurück, um dort die Eisenbahnlinie zu sabotieren. Am 3. April sprengten sie die Strecke bei Hedscha an elf Stellen. Am 4. und 5. April überfielen sie in der Nähe von Wadi Daidschi einen Zug und am 6. April führten sie zwei Überfälle durch.
Lawrence’ Meisterstück war jedoch der Angriff auf die Hafenstadt Akaba im heutigen Jordanien. Die Türken erwarteten einen Angriff von den britischen Schiffen, die im westlich gelegenen Golf von Akaba patrouillierten. Stattdessen beschloss Lawrence, die Stadt von Osten, von der Wüste her, anzugreifen, da sie auf dieser Seite ungeschützt war. Dazu führte er seine Männer auf einen verwegenen, 1000 Kilometer langen Ritt von Hedscha nach Norden in die Wüste von Syrien und von dort zurück nach Akaba. Es war Sommer, die Region gehört zu den unwirtlichsten des Nahen Ostens, und Lawrence unternahm unterwegs einen Abstecher nach Damaskus, um die Türken auf eine falsche Fährte zu führen. In Die Sieben Säulen der Weisheit schreibt Lawrence:
»In diesem Jahr wimmelte es im Tal nur so vor Hornvipern, Puffottern, Kobras und schwarzen Schlangen. Wir konnten nach Einbruch der Dunkelheit nur unter Mühen Wasser schöpfen, da sich die Schlangen, die in den Tümpeln schwammen, in dichten Trauben an den Ufern scharten. Zweimal schlängelten sich Puffottern in den aufmerksamen Ring unseres Debattierund Kaffeekreises. Drei Männer starben an den Folgen von Schlangenbissen, vier überlebten nach großen Schmerzen, Angst und starken Schwellungen. Die Behandlungsmethode der Howeitat bestand darin, das gebissene Körperteil mit Schlangenhaut abzubinden und dem Leidenden aus dem Koran vorzulesen, bis er starb.«[10]
Als sie endlich in Akaba ankamen, töteten die wenigen Hundert Männer in einem Angriff rund 1200 Türken, während sie selbst nur zwei Opfer zu beklagen hatten. Die Türken waren einfach davon ausgegangen, dass niemand verrückt genug war, von der Wüste her anzugreifen.
Sir Reginald Wingate bezeichnete Lawrence’ Männer als »wüsten Haufen«. In seinen Augen waren die Türken in jeder Hinsicht im Vorteil. Natürlich ist es eine Stärke, über viele Soldaten, Waffen und Ressourcen zu verfügen. Doch es macht unbeweglich und zwingt zur Defensive. Beweglichkeit, Ausdauer, Intelligenz, Landeskenntnis und Mut, wie sie Lawrence’ Männer mitbrachten, machten jedoch das Unmögliche möglich – eine Strategie, die so gewagt war, dass die Türken sie von vornherein ausgeschlossen hatten. Natürlich hat es seine Vorteile, über materielle Ressourcen zu verfügen, doch es hat andere Vorteile, nicht über sie zu verfügen. Und wenn Underdogs so häufig die Oberhand behalten, dann liegt das daran, dass ihre Stärken denen der vermeintlich Mächtigen in jeder Hinsicht ebenbürtig sind. Lawrence von Arabien hatte das erkannt – genau wie Vivek Ranadivé mit seinem bunten Haufen von Mädchen aus Silicon Valley.
Aus unerfindlichen Gründen fällt es uns schwer, diese Lektion zu schlucken. Wir haben sehr eingeschränkte Vorstellungen davon, was Stärken sind und was nicht; wir halten Eigenschaften für Stärken, die gar keine sind, und übersehen auf der anderen Seite tatsächliche Stärken. Im ersten Teil dieses Buchs sehen wir uns daher an, welche Folgen dieses Missverständnis hat. Warum nehmen wir beim Anblick eines Riesen automatisch an, dass er die Schlacht gewinnen wird? Was müssen wir tun, um zu erkennen, dass diese herkömmliche Sicht falsch sein könnte – wie David, Lawrence von Arabien, oder Vivek Randivé mit seinen Streberinnen aus Silicon Valley?
3
Vivek Ranadivés Basketballmannschaft spielte für Redwood City in der Liga der Siebt- und Achtklässler. Die Mädchen trainierten in Paye’s Place, einer Halle im nahe gelegenen San Carlos. Da Ranadivé noch nie Basketball gespielt hatte, holte er sich ein paar Experten zur Unterstützung. Der erste war Roger Craig, ein ehemaliger Footballspieler, der in Ranadivés Softwarefirma angestellt war.[11] Dieser wiederum holte seine Tochter Rometra, die in der Basketballmannschaft ihrer Universität gespielt hatte. Rometra war eine hervorragende Manndeckerin, deren Aufgabe es gewesen war, die Spitzenstürmerinnen der gegnerischen Mannschaft auszuschalten. Die Mädchen liebten Rometra. »Sie war immer so etwas wie meine große Schwester«, erinnert sich Anjali Ranadivé. »Es war toll, sie dabei zu haben.«
Die Strategie von Redwood City basierte auf zwei Zeitlimits, die jede Mannschaft beachten muss, um einen Angriff auszuführen. Das erste betrifft den Einwurf. Wenn eine Mannschaft einen Punkt erzielt, wirft eine Spielerin der anderen Mannschaft den Ball von der Grundlinie unter dem eigenen Korb ein und hat fünf Sekunden Zeit, ihn zu einer Mitspielerin zu passen. Braucht sie länger, bekommt die andere Mannschaft den Ball. In der Regel ist das kein Problem, denn die gegnerische Mannschaft stört die andere nicht beim Einwurf, sondern läuft nach einem Punktgewinn unter ihren Korb zurück und formiert dort die Deckung. Anders Redwood City. Jede Spielerin deckte ihre Gegenspielerin aggressiv. Beim Pressing stellen sich die Verteidiger normalerweise hinter die Angreifer, um sie zu stören, sobald sie einen Pass angenommen haben. Doch die Mädchen aus Redwood spielten eine aggressivere und riskantere Strategie. Sie stellen sich vor ihre Gegnerinnen, um den Pass abzufangen. Die Einwerferin deckten sie dagegen nicht. Warum auch? Damit hatte die Mannschaft immer eine Spielerin frei, die als zweite Verteidigerin die gefährlichste Angreiferin des Gegners decken konnte.
»Denken Sie an Football«, sagt Ranadivé. »Der Quarterback kann mit dem Ball laufen. Er hat das gesamte Feld, aber es ist trotzdem verdammt schwierig, einen Pass an den Mann zu bringen.« Beim Basketball ist das noch schwieriger. Das Spielfeld ist kleiner, die Mannschaften spielen gegen das FünfSekundenLimit und der Ball ist größer und schwerer. Redwoods Gegnerinnen schafften es oft nicht, den Einwurf innerhalb von fünf Sekunden abzuschließen. Oder die Einwerferin verlor die Nerven, weil ihr die Zeit davonlief, und warf den Ball einfach ins Feld. Oder ihr Pass wurde von den Spielerinnen von Redwood abgefangen. Ranadivés Mädchen waren überall.
Das zweite Zeitlimit verlangt, dass die angreifende Mannschaft den Ball innerhalb von zehn Sekunden in die gegnerische Hälfte bringt. Wenn es ihren Gegnerinnen gelang, die Hürde des ersten Zeitlimits zu nehmen und den Einwurf rechtzeitig abzuschließen, versuchten die Mädchen von Redwood City, sie zur Überschreitung des zweiten Zeitlimits zu zwingen. Sie stürzten sich auf das Mädchen, das den Einwurf angenommen hatte, und störten es. Dafür war Anjali zuständig. Sie rannte auf das ballführende Mädchen zu und breitete die Arme aus. Manchmal gelang es ihr, den Ball zu erbeuten. Manchmal spielte die Gegnerin überhastet ab, oder sie konnte überhaupt nicht passen, die Zeit lief ab und der Pfiff ertönte.
»Am Anfang hatte niemand eine Ahnung, wie man verteidigt«, erzählt Anjali. »Deswegen hat uns mein Papa das ganze Spiel über immer wieder gesagt: ›deine Aufgabe ist es, dieses Mädchen zu decken und aufzupassen, dass sie beim Einwurf den Ball nicht bekommt.‹ Es ist das Genialste überhaupt, wenn du jemandem den Ball wegschnappst. Wir haben aggressiv gedeckt und viele Bälle gewonnen. Das hat die anderen nervös gemacht. Viele Mannschaften waren viel besser als wir, sie haben schon lange zusammengespielt, aber wir haben gegen sie gewonnen.«
Die Mädchen von Redwood City führten 4:0, 6:0, 8:0 oder 12:0. Einmal führten sie sogar 25:0. Weil sie den Ball unter dem Korb der Gegner erbeuteten, waren sie selten auf Distanzwürfe angewiesen, die viel Übung erfordern. Sie punkteten mit Korblegern. Zu einem der wenigen Spiele, die Redwood City in dieser Saison verlor, erschienen nur vier Spielerinnen. Sie spielten trotzdem Pressing. Warum auch nicht? Am Ende verloren sie mit drei Punkten Rückstand.
»Mit dieser Defensive konnten wir unsere Schwächen wettmachen«, erinnert sich Rometra Craig. »Das war der Ausgleich dafür, dass wir keine guten Distanzwerferinnen hatten und dass wir nicht die größten Spielerinnen hatten, denn mit der aggressiven Verteidigung haben wir Pässe abgefangen und mit Korblegern gepunktet. Ich habe den Mädchen nichts vorgemacht und ihnen gesagt: ›Wir sind nicht die beste Mannschaft.‹ Aber sie haben ihre Aufgabe verstanden.« Für Rometra rissen sich die Mädchen die Beine aus. »Sie waren super«, sagt sie.
Lawrence von Arabien griff die Osmanische Armee da an, wo sie verwundbar war – an den entlegenen Außenposten entlang der Eisenbahnlinie – und nicht da, wo sie stark war, in Medina. Redwood City griff beim Einwurf an, dem Punkt des Spiels, an dem eine starke Mannschaft genauso verwundbar ist wie eine schwache. David ließ sich nicht auf einen Nahkampf mit Goliath ein, den er sicher verloren hätte, sondern hielt Abstand und nutzte das gesamte Tal als Schlachtfeld. Genau wie die Mädchen von Redwood City: Sie verteidigten die gesamten 28 Meter des Spielfelds. Beim Pressing geht es nicht um Arme, sondern um Beine, und die fehlende Technik wird durch Einsatz wettgemacht. Es ist Basketball für Spielerinnen, »die nichts von formaler Kriegsführung verstanden und deren Stärken Beweglichkeit, Ausdauer, Intelligenz, Landeskenntnis und Mut waren«.
»Diese Strategie ist verdammt anstrengend«, meint Roger Craig. Er und Ranadivé sitzen im Konferenzzimmer von Ranadivés Softwarefirma und erinnern sich an ihre Traumsaison. Ranadivé steht an der Tafel und zeichnet ein Diagramm des Pressings seiner Mannschaft. Craig sitzt am Tisch.
»Meine Mädchen mussten ausdauernder sein als die anderen«, erzählt Ranadivé.
»Wir mussten sie dazu bringen, das ganze Spiel über zu laufen«, nickt Craig.
»Wir haben unsere Strategie vom Fußball übernommen«, erklärt Ranadivé. »Wir haben Lauftraining gemacht. In dieser kurzen Zeit konnte ich ihnen keine Technik antrainieren, deswegen mussten wir dafür sorgen, dass sie fit waren und das Spiel in groben Zügen verstanden haben. Deswegen war die richtige Einstellung so wichtig, denn irgendwann wird man müde.«
Ranadivé spricht das Wort »müde« mit Anerkennung in der Stimme aus. Sein Vater war Pilot, der von der indischen Regierung eingesperrt wurde, weil er hartnäckig auf die Sicherheitsmängel der indischen Verkehrsflugzeuge hinwies. Ranadivé studierte am Massachusetts Institute of Technology, nachdem er einen Dokumentarfilm über die Eliteuniversität gesehen hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass das genau die richtige Hochschule für ihn war. Das war in den 1970er-Jahren, als indische Auslandsstudenten nur mit Genehmigung Devisen tauschen durften. Also kampierte Ranadivé vor dem Büro des Präsidenten der indischen Zentralbank, bis er die Genehmigung hatte. Ranadivé ist ein schlanker und feingliedriger Mann, der mit seinen gelassenen Bewegungen den Eindruck erweckt, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Doch man sollte dies nicht mit Lässigkeit verwechseln: Die Ranadivés sind unermüdlich.
Er wendet sich Craig zu. »Was war noch mal unser Schlachtruf?«
Die beiden Männer denken einen Moment lang nach, dann rufen sie fröhlich und einstimmig: »One, two, three, ATTITUDE!«
Auf die Einstellung kam es an. Die Philosophie der Mannschaft bestand in der Bereitschaft, mehr zu tun als alle anderen.
»Als ein paar neue Mädchen dazugekommen sind, habe ich ihnen beim ersten Training gezeigt, was wir machen. Und ich habe ihnen gesagt: ›Es ist alles eine Frage der Einstellung.‹ Bei einer hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie die Sache mit der Einstellung vielleicht nicht versteht. Dann haben wir unseren Schlachtruf geübt, und sie hat gesagt: ›Es heißt nicht One, two, three, ATTITUDE!, Es heißt One, two, three, attitude, HA!‹«
Ranadivé und Craig lachen laut.
4
Im Januar 1971 traten die Rams, die Basketballmannschaft der Fordham University, gegen die Minutemen der University of Massachusetts an. Das Spiel fand im berüchtigten »Cage«, der Halle der University of Massachusetts, statt, in der die Minutemen seit Dezember 1969 kein einziges Spiel mehr verloren hatten. Der Star der Minutemen war kein Geringerer als Julius Erving, der legendäre Dr. J., der als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen sollte. Die Minutemen waren eine Ausnahmemannschaft. Die Rams waren dagegen ein zusammengewürfelter Haufen von Jungs aus Brooklyn und der Bronx. Ihr Center hatte sich in der ersten Woche der Saison eine Knieverletzung zugezogen, und ihr größter Spieler kam auf 1,95 Meter. Ihr wichtigster Stürmer war Charlie Yelverton mit 1,88 Meter. Doch vom Anpfiff weg begannen die Rams mit aggressivem Pressing und ließen keinen Moment lang nach. »Nachdem wir mit 13:6 in Führung gegangen waren, war Krieg«, erinnerte sich der damalige RamsTrainer Digger Phelps. »Das waren zähe Jungs aus der Stadt. Wir haben über die gesamte Länge des Spielfelds gespielt. Wir haben gewusst, dass die anderen früher oder später einknicken würden.« Phelps schickte einen unermüdlichen irischen oder italienischen Knaben aus der Bronx nach dem anderen aufs Feld, um Erving zu decken, und einer nach dem anderen wurden diese Jungs nach Fouls vom Platz gestellt. Keiner konnte Erving das Wasser reichen. Aber das machte nichts. Die Rams gewannen mit 87:79.