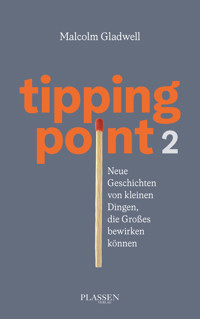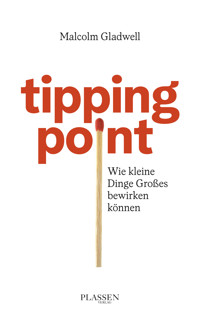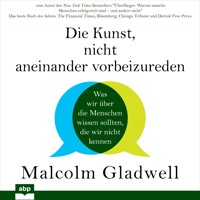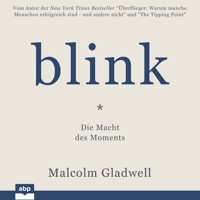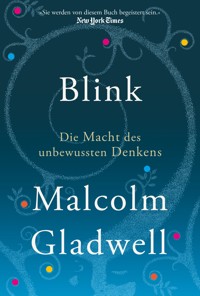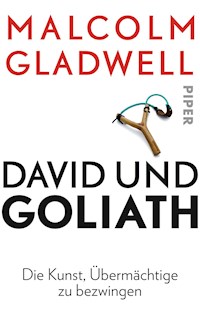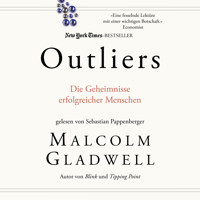
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In diesem beeindruckenden Buch nimmt uns Malcolm Gladwell mit auf eine intellektuelle Reise durch die Welt der »Outliers« – der Ausreißer – der Besten und Klügsten, der Berühmtesten und Erfolgreichsten. Außergewöhnliche Personen, die in ihren Fachgebieten so überlegen sind, dass sie ihre eigenen Erfolgskategorien definieren. Er stellt die Frage: Was macht diese hochbegabten Personen anders? Seiner Ansicht nach achten wir zu sehr darauf, wie erfolgreiche Menschen sich verhalten, und zu wenig darauf, woher sie kommen. Um wirklich zu erfahren, was sie ausmacht, müssen wir ihre Kultur, ihre Familie, ihre Generation und die besonderen Erfahrungen ihrer Erziehung berücksichtigen. Die Geschichte des Erfolgs ist komplexer und viel interessanter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Nebenbei erklärt er die Geheimnisse von Software-Milliardären, was es braucht, um ein guter Fußballspieler zu sein, warum Asiaten gut in Mathematik sind und was die Beatles zur größten Rockband machte. Brillant und unterhaltsam, ist Outliers ein bahnbrechendes Werk, das gleichzeitig begeistern und erleuchten wird.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Outliers
Malcolm Gladwell
Newyork Time-BESTSELLER
Outliers
Die Geheimnisse erfolgreicher Menschen
Malcolm Gladwell
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2026
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
© an der deutschen Übersetzung: Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main / New York
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2008 bei Little, Brown and Company unter dem Titel Outliers. The Story of Success. © 2008 by Malcolm Gladwell. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Jürgen Neubauer
Korrektorat: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt in Anlehnung an das Original
Umschlagabbildung: shutterstock/tomertu
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-520-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-409-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
EINLEITUNG: DAS GEHEIMNIS VON ROSETO
TEIL 1: CHANCE
KAPITEL 1: DER MATTHÄUS-EFFEKT
KAPITEL 2: DIE 10 000-STUNDEN-REGEL
KAPITEL 3: DAS PROBLEM MIT DEN GENIES, TEIL 1
KAPITEL 4: DAS PROBLEM MIT DEN GENIES, TEIL 2
KAPITEL 5: DIE DREI LEKTIONEN DES JOE FLOM
TEIL 2: ERBE
KAPITEL 6: HARLAN, KENTUCKY
KAPITEL 7: FLUGZEUGABSTÜRZE UND KULTUR
KAPITEL 8: REISFELDER UND MATHEMATIK
KAPITEL 9: MARITAS HANDEL
EPILOG: EINE GESCHICHTE AUS JAMAIKA
ANMERKUNGEN
DANKSAGUNGEN
Für Daisy
EINLEITUNG
DAS GEHEIMNIS VON ROSETO
»Die Leute sind an Altersschwäche gestorben. Das war’s.«
Aus|rei|ßer, der; -s, -:
(ugs.) jmd., der aus dem Haus weggelaufen ist, bes. ein Kind.
In der Statistik spricht man von einem »Ausreißer«, wenn ein Messwert oder Befund nicht in eine erwartete Messreihe passt oder allgemein nicht den Erwartungen entspricht.
Über|flie|ger, der; -s, -: jmd., der begabter, tüchtiger ist als der Durchschnitt.
1.
Roseto Valfortore liegt in der italienischen Provinz Foggia, rund 200 Kilometer südöstlich von Rom, in den Ausläufern der Apenninen. Es ist ein typisch mittelalterliches Dorf mit einem großen Platz im Zentrum. An der Stirnseite dieses Platzes steht der Palazzo Marchesale, der Palast der Familie Saggese, die einst große Ländereien in der Region besaß. Durch einen Torbogen an der Seite des Palazzos gelangt man zur Chiesa della Madonna del Carmine, der Kirche Unserer Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Verwinkelte, gepflasterte Gassen und Treppen ziehen sich die Hänge hinauf, gesäumt von zweigeschossigen Häuschen mit roten Ziegeldächern.
Jahrhundertelang arbeiteten die paesani von Roseto in den Marmorsteinbrüchen der umliegenden Hügel oder bestellten ihre Felder auf den Terrassen der Tiefebene. Jeden Morgen gingen sie zu Fuß die sieben oder acht Kilometer den Berg hinab ins Tal und jeden Abend gingen sie den langen Weg bergauf wieder zurück. Es war ein beschwerliches Leben. Die wenigsten der Dorfbewohner konnten lesen und schreiben, sie lebten in bitterer Armut und konnten sich kaum Hoffnung auf wirtschaftlich rosigere Zeiten machen. Doch dann verbreitete sich Ende des 19. Jahrhunderts in Roseto die Nachricht vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten jenseits des Atlantiks.
Im Januar 1882 brachen elf Rosetani – zehn Männer und ein Junge – nach New York auf. Die erste Nacht in der Neuen Welt verbrachten sie auf dem Fußboden einer Taverne in der Mulberry Street in Manhattans Little Italy. Von dort zogen sie nach Westen weiter und fanden schließlich Arbeit in einem Schiefersteinbruch in Bangor, einer rund 150 Kilometer westlich von New York gelegenen Kleinstadt in Pennsylvania. Im Jahr darauf verließen 15 weitere Männer Roseto in Richtung Amerika, und einige von ihnen stießen zu ihren Landsleuten in den Steinbrüchen von Bangor. In ihren Briefen malten die Auswanderer den Daheimgebliebenen die Verheißungen der Neuen Welt in schillernden Farben aus, und schon bald packte in Roseto eine Gruppe nach der anderen die Koffer und brach nach Pennsylvania auf. Aus dem Strom der Auswanderer wurde ein reißender Fluss. Allein im Jahr 1894 beantragten 1200 Bürger von Roseto einen Reisepass, um nach Amerika zu emigrieren, und ganze Straßenzüge des alten Dorfes blieben entvölkert zurück.
In Pennsylvania kauften die Rosetani Land an einem geröllübersäten Hügel, der mit Bangor durch einen abschüssigen, steinigen Feldweg verbunden war. Dort bauten sie zweigeschossige Häuschen mit schwarzen Schieferdächern, die sich entlang von verwinkelten, gepflasterten Gassen den Hang hinaufzogen. Sie errichteten eine Kirche und weihten sie auf den Namen Unsere Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Die Hauptstraße, an der die Kirche stand, nannten sie Garibaldi Avenue, nach dem Helden der italienischen Einigungsbewegung. Anfangs hieß ihr Dorf New Italy, doch schon bald tauften sie es in Roseto um, was nahelag, denn die meisten seiner Einwohner kamen aus derselben italienischen Ortschaft.
Im Jahr 1896 übernahm ein tatkräftiger junger Pfarrer namens Pasquale de Nisco die Kirchengemeinde. De Nisco gründete katholische Vereine und organisierte Gemeindefeste. Er ermunterte die Dorfbewohner, Äcker anzulegen und in den Gärten hinter ihren Häusern Zwiebeln, Bohnen, Kartoffeln und Melonen anzubauen und Obstbäume zu pflanzen. Er verteilte sogar das Saatgut. Allmählich erwachte der Ort zum Leben. In ihren Hinterhöfen hielten die Rosetani Schweine, und auf den Hängen bauten sie Wein an. Sie errichteten Schulen und ein Kloster und legten einen Friedhof und einen Park an. Entlang der Hauptstraße wurden kleine Läden, Bäckereien, Restaurants und Bars eröffnet. Es entstand ein halbes Dutzend Textilmanufakturen, in denen Hemden und Blusen hergestellt wurden. Die Einwohner des Nachbarorts Bangor waren überwiegend Einwanderer aus Wales und England, der nächste Ort war mehrheitlich deutsch, und da die Beziehungen zwischen Engländern, Deutschen und Italienern damals eher unterkühlt waren, blieb Roseto fest in italienischer Hand. Die wenigen auswärtigen Besucher, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Hauptstraße entlanggingen, hörten nur Italienisch, oder genauer gesagt den Dialekt, der in der Gegend um Foggia gesprochen wurde. Das Roseto in Pennsylvania war eine eigene kleine Welt und existierte in weitgehender Abgeschiedenheit vom Rest der amerikanischen Gesellschaft. Dies hätte sich auch kaum geändert, wenn da nicht ein Mann namens Stewart Wolf gewesen wäre.
Wolf war Arzt mit Spezialgebiet Verdauung und unterrichtete Medizin an der University of Oklahoma. Seine Sommerferien verbrachte er auf einem Bauernhof in Pennsylvania, ganz in der Nähe von Roseto. Das hat allerdings nicht allzu viel zu sagen, denn der italienische Ort war derart isoliert vom Rest der Welt, dass man in der Nachbargemeinde leben und trotzdem nichts über Roseto wissen konnte. »In den Sommerferien – es muss Ende der Fünfzigerjahre gewesen sein – bin ich einmal von einer Ärztevereinigung aus dem Bezirk zu einem Vortrag eingeladen worden«, erinnerte sich Wolf Jahre später in einem Interview. »Nach dem Vortrag hat mich einer der Ärzte zum Essen eingeladen. Bei einem Glas Bier hat er mir erzählt, ›Ich praktiziere seit 17 Jahren in dieser Gegend. Meine Patienten kommen aus der ganzen Region, aber in Roseto habe ich kaum jemanden unter 65 mit einer Herzerkrankung.‹«
Wolf war überrascht. Man schrieb die Fünfzigerjahre, cholesterinsenkende Mittel und Vorbeugungsmaßnahmen gegen Herzerkrankungen waren weit und breit noch nicht in Sicht. In den Vereinigten Staaten waren Herzinfarkte eine Volkskrankheit und die häufigste Todesursache für Männer unter 65 Jahren. Für einen Arzt war es damals nahezu unmöglich, nicht mit Herzkrankheiten zu tun zu haben.
Wolf beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Er fand Unterstützung bei seinen Studenten und Kollegen in Oklahoma. Sie sammelten Totenscheine der Bewohner von Roseto und gingen so weit in die Vergangenheit zurück, wie sie konnten. Sie werteten die Archive in den Arztpraxen aus und rekonstruierten mithilfe der Krankenakten Familienstammbäume. »Wir haben 1961 mit unserer Arbeit angefangen und zunächst eine grobe Voruntersuchung durchgeführt«, berichtete Wolf. »Der Bürgermeister hat uns versprochen, ›Ich schicke Ihnen meine Schwestern, die sollen Ihnen helfen.‹ Er hatte vier Schwestern. Für unsere Untersuchungen hat er uns den Sitzungsraum des Gemeinderats angeboten. Ich habe ihn gefragt, wo denn dann der Gemeinderat seine Sitzungen abhält, aber er hat nur geantwortet: ›Die verschieben wir dann eben.‹ Seine Schwestern haben uns mit Essen versorgt. Wir haben kleine Kabinen aufgebaut, um Blut abzunehmen und EKGs zu erstellen. Beim ersten Mal waren wir vier Wochen da. Danach habe ich mich mit dem Gemeinderat unterhalten. Er hat uns über den Sommer die Schule zur Verfügung gestellt, und wir haben die gesamte Bevölkerung von Roseto zu den Tests eingeladen.«
Die Ergebnisse waren erstaunlich. In Roseto war kaum jemand unter 55 Jahren an Herzinfarkt gestorben oder wies auch nur Anzeichen einer Herzerkrankung auf. Bei Männern über 65 Jahren lag die Zahl der Todesfälle durch Herzerkrankungen um 50 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Genauer gesagt, war die Todesrate bei sämtlichen untersuchten Krankheiten in Roseto um 30 bis 35 Prozent niedriger als im Rest der Vereinigten Staaten.
Wolf holte sich Unterstützung bei einem Freund namens John Bruhn, einem Soziologen der University of Oklahoma. »Wir haben Medizin- und Soziologiestudenten angeheuert, die in Roseto von Tür zu Tür gegangen sind und jeden Einwohner über 21 befragt haben«, erinnert sich Bruhn. Das war vor mehr als 50 Jahren, doch Bruhn klingt noch immer erstaunt, wenn er die Ergebnisse beschreibt. »Wir haben keine Selbstmorde, keinen Alkoholismus, keine Drogenabhängigkeit und kaum Verbrechen gefunden. Niemand hat Sozialhilfe bezogen. Niemand hatte Magengeschwüre. Die Leute sind an Altersschwäche gestorben. Das war’s.«
Mediziner wie Wolf haben einen Namen für Ortschaften wie Roseto, die aus der Alltagserfahrung herausfallen und auf die normale Regeln nicht zuzutreffen scheinen. Sie sprechen von Ausreißern.
2.
Wolf nahm zunächst an, die Rosetani hätten möglicherweise einige Ernährungsgewohnheiten aus der Alten Welt mitgebracht und seien deshalb gesünder als die übrigen US-Amerikaner. Doch er erkannte sehr schnell, dass dies nicht der Fall war. Die Rosetani kochten mit Schweineschmalz und nicht mit dem sehr viel gesünderen Olivenöl, das ihre Landsleute in der alten Heimat verwendeten. In Italien bestand die Pizza aus einem dünnen Teig, der mit Salz und Öl bestrichen und gelegentlich mit einigen Tomaten, Sardellen oder Zwiebeln belegt wurde. In Pennsylvania war die Grundlage der Pizza dagegen ein dicker Brotteig, der mit Wurst, Salami, Schinken und oft sogar mit hartgekochten Eiern belegt wurde. Süßes Gebäck wie biscotti und taralli, das es in der alten Heimat nur an Weihnachten und Ostern gab, wurde in Pennsylvania das ganze Jahr über gegessen. Als Wolf die Essgewohnheiten in Roseto von Ernährungsexperten analysieren ließ, stellte sich heraus, dass die Einwohner sage und schreibe 41 Prozent ihrer Kalorien in Form von Fett zu sich nahmen. Und natürlich stand in Roseto niemand vor Sonnenaufgang auf, um Yoga zu praktizieren oder zehn Kilometer zu joggen. Die Rosetani waren starke Raucher, und viele hatten mit Übergewicht zu kämpfen.
Wenn die Ergebnisse nicht durch Ernährungsgewohnheiten und Sport zu erklären waren, stellte sich die Frage, ob die außergewöhnliche Gesundheit vielleicht auf die Gene zurückzuführen war. Die Einwohner von Roseto stammten fast durchweg aus derselben Region in Italien, und Wolf überlegte, ob sie vielleicht aus besonders zähem Holz geschnitzt und deshalb vor Krankheiten geschützt waren. Also suchte er nach Verwandten der Rosetani, die in anderen Teilen der Vereinigten Staaten lebten, um zu untersuchen, ob sie die bemerkenswerte Gesundheit ihrer Vettern in Pennsylvania teilten. Die Antwort war Nein.
Also sah er sich die Region um Roseto an. Vielleicht gab es ja irgendetwas in den Hügeln von Pennsylvania, das sich besonders positiv auf ihre Gesundheit auswirkte. Die nächstgelegenen Ortschaften waren Bangor im Tal und Nazareth in einigen Kilometern Entfernung. Beide Ortschaften waren etwa genauso groß wie Roseto und wurden wie die italienische Enklave von fleißigen europäischen Einwanderern bewohnt. Wolf analysierte die Krankenakten in beiden Ortschaften und stellte fest, dass in Bangor und Nazareth dreimal so viele Männer über 65 an Herzerkrankungen starben wie in Roseto. Auch das war also eine Sackgasse.
Allmählich sah Wolf ein, dass das Geheimnis von Roseto weder Sport noch Ernährung noch die Gene oder die gesunde Umwelt waren. Es musste also an Roseto selbst liegen. Bei ihren Aufenthalten im Ort erkannten Wolf und Bruhn den Grund. Sie beobachteten, wie die Rosetani sich gegenseitig Besuche abstatteten, sich auf der Straße auf Italienisch unterhielten oder sich in ihre Gärten zum Grillen einluden. Sie lernten die komplizierten Verwandtschaftsbeziehungen kennen, die den gesamten Ort durchzogen. Sie sahen, dass oft drei Generationen unter einem Dach zusammenlebten und dass die Großeltern großen Respekt genossen. Sie besuchten die Messe in der Kirche Unserer Jungfrau Maria vom Berg Karmel und erkannten die gemeinschaftsbildende und befriedende Rolle der Kirche. Sie zählten sage und schreibe 22 verschiedene Vereine, und das bei knapp 2000 Einwohnern. Sie erkannten den besonderen egalitären Geist der Gemeinschaft, der die Reichen davon abhielt, ihren Erfolg zur Schau zu stellen, und den Gescheiterten half, ihren Misserfolg zu verbergen.
Die Rosetani hatten die paesani-Kultur von Süditalien in den Osten von Pennsylvania mitgebracht und auf diese Weise eine robuste Sozialstruktur geschaffen, die sie vor den Belastungen der modernen Welt schützte. Es war der Ort, aus dem sie kamen, der ihre Gesundheit ausmachte, und die Welt, die sie sich in ihrem kleinen Dorf in den Bergen geschaffen hatten.
»Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Roseto. Ich habe gesehen, wie drei Generationen beim Essen zusammengesessen haben, die ganzen Bäckereien, die Leute, die auf der Straße spazieren gegangen sind und vor ihren Häusern gesessen und sich unterhalten haben. Ich habe die Nähereien gesehen, in denen die Frauen tagsüber gearbeitet haben, während die Männer in den Schiefersteinbrüchen waren«, beschreibt Bruhn. »Es war ein magischer Ort.«
Sie können sich vermutlich vorstellen, auf welche Skepsis Bruhn und Wolf stießen, als sie der medizinischen Fachwelt ihre Erkenntnisse präsentierten. Sie hielten Vorträge auf Konferenzen, auf denen ihre Kollegen gewaltige Datenmengen in komplizierten Grafiken zusammenstellten und hochspezifische genetische und physiologische Prozesse beschrieben, während sie über die geheimnisvollen gesundheitlichen Auswirkungen von Unterhaltungen auf der Straße und vom Zusammenleben dreier Generationen unter einem Dach sprachen. Damals ging man davon aus, dass eine hohe Lebenserwartung vor allem damit zusammenhing, wer man war – mit anderen Worten, mit den Genen. Unsere Gesundheit hing außerdem von unseren persönlichen Entscheidungen ab – was wir essen, wie viel Sport wir treiben und welche medizinische Versorgung wir erhalten. Niemand ging davon aus, dass Gesundheit etwas mit der Gemeinschaft zu tun haben könnte, in der wir leben.
Wolf und Bruhn mussten die Fachwelt davon überzeugen, Gesundheit und Herzinfarkte in einem völlig neuen Licht zu sehen: Sie mussten ihren Kollegen klarmachen, dass sie nicht verstehen konnten, warum jemand gesund war, wenn sie dessen persönliche Entscheidungen und Handlungen aus dem Zusammenhang herausgelöst betrachteten. Mediziner mussten lernen, über den Einzelnen hinauszublicken. Sie mussten die Kultur, die Familien, die Freunde und das soziale Umfeld der Menschen verstehen. Sie mussten erkennen, dass die Werte der Welt, in der wir leben, und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, entscheidende Auswirkungen darauf haben, wer wir sind. Mit seiner Arbeit in Roseto hat Stewart Wolf unser Gesundheitsverständnis revolutioniert. Mit diesem Buch möchte ich dasselbe für unser Erfolgsverständnis erreichen.
TEIL 1
CHANCE
KAPITEL 1
DER MATTHÄUS-EFFEKT
»Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird in Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.«
Matthäus 25.29
1.
An einem warmen Frühlingstag im Mai 2007 trafen die Mannschaften der Medicine Hat Tigers und der Vancouver Giants im Endspiel um den Memorial Cup, die kanadischen Jugendmeisterschaften im Eishockey, in Vancouver aufeinander. Die Tigers und die Giants waren die besten Mannschaften der Canadian Hockey League, der besten Jugendeishockeyliga der Welt. Hier liefen die künftigen Stars auf: siebzehn-, achtzehn- und neunzehnjährige Jungen, die schon auf Kufen standen, kaum dass sie Laufen gelernt hatten.
Das Spiel wurde vom staatlichen kanadischen Fernsehen übertragen. In der Innenstadt von Vancouver flatterten die Fahnen des Memorial Cup an den Masten der Straßenlaternen. Das Stadion war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Auf dem Eis wurde ein roter Teppich ausgerollt, und ein Ansager verlas die Liste der Ehrengäste, angefangen bei Gordon Campbell, dem Ministerpräsidenten des kanadischen Bundesstaates British Columbia. Dann betrat unter tosendem Beifall die Eishockeylegende Gordie Howe das Rund. »Meine Damen und Herren!«, rief der Stadionsprecher:
»Mister Eishockey!«
In den nächsten 60 Minuten boten die beiden Teams eine leidenschaftliche und offensive Partie. Zu Anfang des zweiten Drittels ging Vancouver durch einen Rebound von Mario Bliznak in Führung. Kurz vor Ende des Drittels glich Medicine Hat aus, als Darren Helm, Torschützenkönig der Mannschaft, den Puck an Vancouvers Torhüter Tyson Sexsmith vorbeischlenzte. In den Schlusssekunden des letzten Drittels, nachdem Medicine Hat seinen Torhüter vom Eis genommen und einen weiteren Feldspieler gebracht hatte, erzielte Vancouver schließlich den entscheidenden Treffer zum Sieg.
Nach dem Spiel drängten sich die Spieler, ihre Familien und Sportreporter aus dem ganzen Land in der Umkleidekabine des siegreichen Teams. Die Luft war erfüllt von Zigarrenqualm und dem Geruch von Sekt und verschwitzten Trikots. An der Wand hing ein Spruchband mit der Aufschrift »Nimm den Kampf an!«. Inmitten des Gedränges stand Giants-Trainer Don Haly mit feuchten Augen. »Ich bin so stolz auf die Jungs«, sagte er. »Schauen Sie sich nur um. Jeder Einzelne von denen hat heute alles gegeben.«
Das kanadische Eishockey ist extrem leistungsorientiert. Tausende Jungen treten noch vor ihrer Einschulung einer Mannschaft bei. Von Anfang an gibt es für jede Altersgruppe eine eigene Liga, und in jeder dieser Ligen werden die Spieler beobachtet, begutachtet und bewertet. Die talentiertesten werden ausgesucht und für die nächste Liga trainiert. Die besten Jugendlichen spielen in der Major Junior A-League, der Spitze der Pyramide. Und wenn eine Mannschaft aus dieser Liga im Endspiel um den Memorial Cup antritt, dann heißt das, dass sie ganz oben an der Spitze der Pyramide steht.
In den meisten Sportarten werden die späteren Stars auf diese Weise herausgefiltert. So entdecken beispielsweise Fußballvereine in Europa und Lateinamerika ihre Spieler, und so werden Olympiateilnehmer ermittelt. Das Auswahlverfahren im Sport unterscheidet sich damit kaum von der Art und Weise, wie die klassische Musik ihre späteren Virtuosen, das Ballett seine Ballerinas und unser Bildungssystem die künftigen Wissenschaftler und Intellektuellen entdeckt.
Einen Platz in einer Mannschaft der Major Junior A-League kann man sich nicht kaufen. Es ist völlig gleichgültig, wer Ihr Vater, Ihre Mutter oder Ihre Großeltern sein mögen oder welches Unternehmen Ihrer Familie gehört. Es spielt auch keinerlei Rolle, ob Sie in der abgelegensten Ecke der nördlichsten kanadischen Provinz leben. Wenn Sie das Zeug zum Star haben, werden Sie von einem engmaschigen Netz von Eishockeyscouts und Talentsuchern eingefangen, und wenn Sie Ihr Talent weiterentwickeln wollen, dann wird das System Sie belohnen. Erfolg im Eishockey ist allein eine Frage der individuellen Leistung, wobei beide Worte zu betonen sind: Spieler werden aufgrund ihrer eigenen Leistung beurteilt, nicht aufgrund der Leistung anderer, und aufgrund ihrer Fähigkeiten, nicht aufgrund willkürlicher Kriterien.
Oder?
2.
In diesem Buch geht es um Ausreißer und Überflieger: Männer und Frauen, die Außergewöhnliches erreichen. In den folgenden Kapiteln werde ich Ihnen verschiedene dieser beeindruckenden Menschen vorstellen: Genies, Ausnahmeunternehmer, Musikstars und Softwareentwickler. Wir werden einem berühmten Rechtsanwalt sein Geheimnis entreißen, uns ansehen, was die besten Flugkapitäne von Bruchpiloten unterscheidet, und versuchen zu verstehen, warum Asiaten so gut in Mathematik sind. Und bei dieser Analyse der außergewöhnlichen Menschen unter uns – der Fähigsten, Talentiertesten und Ehrgeizigsten – werde ich zeigen, warum unsere Vorstellungen davon, was einen Menschen erfolgreich macht, grundsätzlich falsch sind.
Wie lautet die Frage, die wir uns über erfolgreiche Menschen stellen? Meistens wollen wir wissen, wie sie sind – welche Persönlichkeit sie mitbringen, wie intelligent sie sind, wie sie leben oder welches Talent sie bei ihrer Geburt mitbekommen haben. Wir gehen davon aus, dass diese persönlichen Eigenschaften uns erklären können, wie es diese Menschen nach oben geschafft haben.
Die Autobiografien der Milliardäre, Unternehmer, Popstars und Celebrities, die Jahr für Jahr erscheinen, erzählen immer wieder dieselbe Geschichte: Unser Held erblickt in bescheidenen Verhältnissen das Licht der Welt, doch dank seines Talents und seines Mutes bahnt er sich den Weg zur Größe. In der Bibel wird Josef von seinen Brüdern verstoßen und in die Sklaverei verkauft, doch aufgrund seiner Genialität und Klugheit steigt er zur rechten Hand des Pharaos auf. In den Romanen, die der amerikanische Autor Horatio Alger Ende des 19. Jahrhunderts schrieb, entkommen junge Männer dank einer Mischung aus Mut und Eigeninitiative der Armut und werden sagenhaft reich. »Ich denke, es ist ein Nachteil«, sagte Jeb Bush einmal über sein Schicksal, als Sohn und Bruder von US-Präsidenten und Enkel eines wohlhabenden Wall-Street-Bankers und eines US-Senators geboren worden zu sein. Im Wahlkampf um das Amt des Gouverneurs von Florida stellte er sich gern als »Selfmademan« dar. Dass die meisten Wähler bei dieser Selbstbeschreibung nicht einmal mit der Wimper zuckten, zeugt davon, wie sehr wir Erfolg als Produkt der individuellen Leistung sehen.
Bei der Enthüllung einer Statue von Benjamin Franklin, einem der großen Helden der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, forderte Robert Winthrop vor einigen Jahren die versammelten Menschen auf: »Heben Sie den Blick und betrachten Sie das Bild eines Mannes, der aus dem Nichts aufstieg, der weder Eltern noch Gönnern etwas zu verdanken hatte, der in seiner Kindheit nicht in den Genuss einer Schulbildung kam, wie sie uns allen heute hundertfach offensteht, der in seiner Jugend mit niedersten Arbeiten sein Geld verdiente und der am Ende vor Königen stand und sich einen Namen gemacht hat, den die Welt nicht vergessen wird.«
In diesem Buch will ich Ihnen zeigen, warum sich Erfolg nicht in dieser Weise als Ergebnis persönlicher Anstrengungen erklären lässt. Niemand kommt aus dem Nichts. Jeder von uns steht in der Schuld von Eltern und Förderern. Die Menschen, die vor Könige treten, mögen vielleicht nach außen hin den Eindruck erwecken, sie hätten dies allein sich selbst zu verdanken. Doch in Wirklichkeit kamen sie alle in den Genuss verborgener Vorteile, außergewöhnlicher Chancen und eines kulturellen Umfeldes, die es ihnen ermöglichten, anders zu lernen und zu arbeiten als andere Menschen und die Welt anders zu verstehen. Es spielt eine entscheidende Rolle, wo und wann wir aufwachsen. Unsere Kultur und das Erbe, das frühere Generationen an uns weitergeben, wirken sich in ungeahnter Art und Weise auf unseren Erfolg aus. Es reicht mit anderen Worten nicht aus zu fragen, wie erfolgreiche Menschen sind. Nur wenn wir fragen, woher sie kommen, können wir verstehen, warum manche Menschen erfolgreich werden und andere nicht.
Biologen sprechen oft von der »Ökologie« eines Organismus: Die größte Eiche in einem Wald ist nicht nur deshalb die größte, weil sie aus der kräftigsten Eichel stammt, sondern sie ist es auch deshalb, weil ihr kein anderer Baum die Sonne genommen hat, weil die Erde tief und nährstoffreich ist, weil kein Hase den Schößling gemümmelt und kein Forstarbeiter den jungen Baum vorzeitig gefällt hat. Jeder weiß, dass erfolgreiche Menschen aus einem kräftigen Keim stammen. Doch wissen wir genug über die Sonne, die sie gewärmt hat, die Erde, in der sie Wurzeln geschlagen haben, und die Hasen und Holzfäller, denen sie durch Zufall entgangen sind? In diesem Buch geht es nicht um große Bäume, sondern um Wälder. Eishockey ist ein guter Anfangspunkt, denn die Erklärung dafür, wer es nach oben schafft und wer nicht, ist erheblich komplizierter, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Sie ist sogar ausgesprochen seltsam.
3.
Nehmen wir einmal den Kader der Medicine Hat Tigers im Jahr 2007 unter die Lupe. Schauen Sie sich die Liste auf Seite 24 genau an und sehen Sie, ob Ihnen etwas auffällt.
Haben Sie es entdeckt? Machen Sie sich nichts daraus, wenn Ihnen nichts auffällt. Es hat Jahre gedauert, bis es irgendjemand in der Eishockeywelt bemerkte. Erst Mitte der Achtzigerjahre machte ein kanadischer Psychologe namens Roger Barnsley auf das Phänomen des relativen Alters aufmerksam.
Gemeinsam mit seiner Frau Paula und seinen beiden Söhnen besuchte Barnsley ein Spiel der Lethbridge Broncos aus Alberta, einer Mannschaft, die wie die Medicine Hat Tigers und die Vancouver Giants in der Major Junior A-League spielte. Paula Barnsley las das Programm, in dem eine Aufstellung wie die obige abgedruckt war.
»Roger«, sagte sie, »weißt du, wann diese jungen Männer geboren wurden?«
»Klar«, antwortete er. »Die Jungs sind zwischen 16 und 20, also müssen sie Ende der Sechzigerjahre zur Welt gekommen sein.«
»Nein, nein«, erwiderte Paula. »Ich meine, in welchem Monat?«
»Ich habe zuerst gedacht, sie ist verrückt«, erinnert sich Barnsley. »Doch dann habe ich mir die Liste angesehen, und mir ist sofort ins Auge gestochen, was sie meint. Aus unerfindlichen Gründen hatten die meisten Spieler im Januar, Februar und März Geburtstag.«
Gleich am Abend nach dem Spiel suchte Barnsley so viele Geburtsdaten von Eishockeyprofis zusammen, wie er finden konnte. Das Muster bestätigte sich. Gemeinsam mit einem Kollegen namens A. H. Thompson sammelten Roger und Paula Barnsley daraufhin die Geburtsdaten sämtlicher Spieler der Ontario Junior Hockey League. Auch hier dasselbe Muster. Im Januar waren mehr Spieler zur Welt gekommen als in jedem anderen Monat. Auf Platz zwei lag Februar und auf Platz drei März. Im Januar waren fünfeinhalbmal so viele Spieler der Ontario Junior Hockey League geboren worden wie im November. Er suchte die Daten für die Auswahlmannschaften der Elf- und Dreizehnjährigen zusammen. Dasselbe Bild. Er sah sich Spieler der Profiliga an. Auch hier dasselbe Muster. Je mehr er suchte, desto sicherer war sich Barnsley, dass es sich nicht um einen Zufall handeln konnte, sondern dass er einem ehernen Gesetz des kanadischen Eishockeys auf der Spur war: In jeder beliebigen Auswahlgruppe der besten Eishockeyspieler waren 40 Prozent zwischen Januar und März zur Welt gekommen, 30 Prozent zwischen April und Juni, 20 Prozent zwischen Juli und September und 10 Prozent zwischen Oktober und Dezember.
Nr.
Name
Position
Links-/ Rechts- händer
Größe
Gewicht
Geburtsdatum
Geburtsort
9
Brennan Bosch
Mittelfeld
R
1,72
78
14. Febr. 1988
Martensville, Saskat- chewan
11
Scott Wasden
Mittelfeld
R
1,85
85
4. Jan. 1988
Westbank, British Columbia
12
Colton Grant
Stürmer
L
1,75
80
20. März 1989
Standard, Alberta
14
Darren Helm
Stürmer
L
1,83
82
21. Jan. 1987
St. Andrews, Manitoba
15
Derek Dorsett
Stürmer
L
1,80
81
20. Dez. 1986
Kindersley, Saskatche- wan
16
Daine Todd
Mittelfeld
R
1,77
78
10. Jan. 1987
Red Deer, Alberta
17
Tyler Swystun
Stürmer
R
1,80
84
15. Jan. 1988
Cochran, Alberta
19
Matt Lowry
Mittelfeld
R
1,83
84
2. März 1988
Neepawa, Manitoba
20
Kevin Undershute
Stürmer
L
1,83
81
12. Apr. 1987
Medicine Hat, Alberta
21
Jerrid Sauer
Stürmer
R
1,77
89
12. Sept. 1987
Medicine Hat, Alberta
22
Tyler Ennis
Mittelfeld
L
1,75
72
6.Okt. 1989
Edmonton, Alberta
23
Jordan Hickmott
Mittelfeld
R
1,83
83
11. Apr. 1990
Mission, British Columbia
25
Jakub Rumpel
Stürmer
R
1,72
75
27. Jan. 1987
Hrnciarovce, Slowakien
28
Bretton Cameron
Mittelfeld
R
1,80
76
26. Jan. 1989
Didsbury, Alberta
36
Chris Stevens
Stürmer
L
1,77
75
20. Aug. 1986
Dawson Creek, British Columbia
3
Gord Baldwin
Verteidiger
L
1,95
93
1. März 1987
Winnipeg, Manitoba
4
David Schlemko
Verteidiger
L
1,85
74
7. Mai 1987
Edmonton, Alberta
5
Trever Glass
Verteidiger
L
1,83
86
22. Jan. 1988
Cochran, Alberta
10
Kris Russell
Verteidiger
L
1,77
80
2. Mai 1987
Caroline, Alberta
18
Michael Sauer
Verteidiger
R
1,90
93
7. Aug. 1987
Sartell, Minnesota
24
Mark Isherwood
Verteidiger
R
1,83
83
31. Jan. 1989
Abbotsford, British Columbia
27
Shayne Brown
Verteidiger
L
1,85
90
20. Febr. 1989
Stony Plain, Alberta
29
Jordan Bendfeld
Verteidiger
R
1,90
104
9. Febr. 1988
Leduc, Alberta
31
Ryan Holfeld
Torhüter
L
1,80
75
29. Juni 1989
LeRoy, Saskatchewan
33
Matt Keetley
Torhüter
R
1,87
86
27. Apr. 1986
Medicine Hat, Alberta
»In meiner gesamten Laufbahn als Psychologe bin ich nie einer derart auffälligen Verteilung begegnet«, erklärte Barnsley.
»Man muss kein Statistiker sein, um das zu erkennen. Ein Blick genügt.«
Sehen wir uns einmal den Kader von Medicine Hat an. Fällt es Ihnen jetzt auf? Von 25 Spielern haben 17 in den Monaten Januar, Februar, März oder April Geburtstag.
Hier ist der Radiokommentar zu den ersten beiden Toren des Memorial-Cup-Endspiels, mit einem kleinen Unterschied: Ich habe die Namen durch die Geburtstage ersetzt. Es klingt plötzlich nicht mehr nach dem Endspiel einer kanadischen Jugendeishockeyliga. Es klingt eher nach einem geheimnisvollen Ritual von Jungen, die unter den Sternzeichen Steinbock, Wassermann und Fische zur Welt kommen:
11. März fährt hinter dem Tor der Tigers vorbei, lässt den Puck für 4. Januar liegen, der passt auf 22. Januar, der legt zurück auf 12. März – Schuss aufs Tor! Aber der Puck geht direkt auf den Torhüter der Tigers, 27. April. Der Abpraller kommt zu 6. März von den Giants, und der hält einfach drauf! Der Puck ist drin! Tigers-Verteidiger 9. Februar und 14. Februar versuchen noch zu retten, 10. Januar kann nur noch hilflos zuschauen. Tor!!
Und jetzt auf der Gegenseite:
21. Januar, bester Torschütze der Tigers, prescht über rechts durch. Er bremst, umspielt Giants-Verteidiger 15. Februar und passt auf seinen Teamkollegen 20. Dezember – hey, was macht der denn da? Der schüttelt den anstürmenden Verteidiger 17. Mai ab und spielt einen Querpass zurück auf 21. Januar. Der schießt! Giants-Verteidiger 12. März will den Schuss blocken, Torhüter 19. März springt, doch der Puck rutscht unter ihm durch – und ist drin! Tigers-Teamkollege 2. Mai springt 21. Januar vor Freude auf den Rücken.
4.
Dieses Phänomen hat eine ganz simple Erklärung. Es hat weder mit Astrologie zu tun noch damit, dass die ersten drei Monate des Jahres irgendetwas Magisches an sich hätten. Es liegt einfach daran, dass der Stichtag zur Zulassung für eine Altersgruppe im Eishockey der 1. Januar ist. Ein Junge, der am 2. Januar zehn Jahre alt wird, spielt in einer Mannschaft mit Jungen, die dieses Alter erst ein gutes Jahr später erreichen – und im vorpubertären Alter machen zwölf Monate einen erheblichen körperlichen Reifeunterschied aus.
In Kanada, dem eishockeyverrücktesten Land der Welt, stellen Trainer schon die neun- und zehnjährigen Jungen zu Auswahlmannschaften zusammen. Und natürlich wirken dabei die Jungen, die größer, besser koordiniert, körperlich reifer und die entscheidenden Monate älter sind, als seien sie die talentierteren Spieler.
Was passiert mit einem Spieler, der in eine Auswahlmannschaft kommt? Sein Training und seine Mitspieler sind besser. Jetzt absolviert er pro Saison zwischen 50 und 75 Spiele und nicht nur 20 wie die Jungen, die in der »Hausliga« bleiben. Außerdem trainiert er doppelt oder dreimal so viel. Anfangs besteht sein Vorteil weniger darin, dass er besser spielt, sondern darin, dass er ein paar Monate älter ist. Doch wenn er 13 oder 14 Jahre alt ist, spielt er dank des besseren Trainings und der zusätzlichen Spielpraxis tatsächlich besser, und die Wahrscheinlichkeit ist erheblich größer, dass er in die Major Junior B-League und von dort in die Profi-Ligen kommt.1
Barnsley argumentiert, zu dieser verzerrten Altersverteilung komme es dann, wenn die folgenden drei Faktoren gegeben seien: Auswahl, Differenzierung und Förderung. Wenn schon frühzeitig eine Entscheidung darüber getroffen wird, wer ein guter Spieler ist und wer nicht, wenn die »Talentierten von den »Untalentierten« getrennt werden und die »Talentierten« schließlich eine bessere Behandlung erfahren, dann hat am Ende eine kleine Gruppe von nahe am Stichtag geborenen Kindern einen erheblichen Vorteil gegenüber allen anderen.
In den Vereinigten Staaten fallen Auswahl, Differenzierung und Förderung im Basketball und American Football nicht ganz so extrem aus. Daher bekommen in diesen Sportarten körperlich weniger weit entwickelte Kinder dieselben Möglichkeiten wie ihre etwas älteren Klassenkameraden, Spielpraxis zu erwerben.2 Im Baseball ist dies dagegen sehr wohl der Fall. Stichtag für außerschulische Baseball-Ligen in den Vereinigten Staaten ist der 31. Juli, weshalb mehr Profispieler im August geboren werden als in irgendeinem anderen Monat. (Die Zahlen sind eindrucksvoll: Im Jahr 2005 feierten 505 Profi-Baseballer ihren Geburtstag im August und nur 313 im Juli.)
Der europäische Fußball ist ähnlich organisiert wie das kanadische Eishockey und das amerikanische Baseball, weshalb es auch hier zu einer stark verzerrten Verteilung der Geburtstage kommt. In England ist der Stichtag der 1. September, weshalb bei einer Stichprobe in den Neunzigerjahren 288 Profifußballer der Premier League zwischen September und November geboren worden waren und nur 136 Spieler zwischen Juni und August. Im internationalen Fußball war der Stichtag lange der 1. August, weshalb bei einer der letzten Jugendweltmeisterschaften 135 Spieler in den drei Monaten nach dem 1. August zur Welt gekommen waren und in den Monaten Mai, Juni und Juli nur 22. Vor einigen Jahren wurde der Stichtag im internationalen Jugendfußball auf den 1. Januar verlegt. Sehen wir uns die tschechische Jugendnationalmannschaft an, die im Jahr 2007 im Endspiel der Weltmeisterschaft stand:
Nr.
Name
Geburtsdatum
Position
1
Marcel Gecov
1. Jan. 1988
Mittelfeld
2
Ludek Frydrych
3. Jan. 1987
Torhüter
3
Petr Janda
5. Jan. 1987
Mittelfeld
4
Jakub Dohnalek
12. Jan. 1988
Verteidiger
5
Jakub Mares
26. Jan. 1987
Mittelfeld
6
Michal Held
27. Jan. 1987
Verteidiger
7
Marek Strestik
1. Febr. 1987
Stürmer
8
Jiri Valenta
14. Febr. 1988
Mittelfeld
9
Jan Simunek
20. Febr. 1987
Verteidiger
10
Tomas Oklestek
21. Febr. 1987
Mittelfeld
11
Lubos Kalouda
21. Febr. 1987
Mittelfeld
12
Radek Petr
24. Febr. 1987
Torhüter
13
Ondrej Mazuch
15. März 1989
Verteidiger
14
Ondrej Kudela
26. März 1987
Mittelfeld
15
Marek Suchy
29. März 1988
Verteidiger
16
Martin Fenin
16. April 1987
Stürmer
17
Tomas Pekhart
26. Mai 1989
Stürmer
18
Lukas Kuban
22. Juni 1987
Verteidiger
19
Tomas Cihlar
24. Juni 1987
Verteidiger
20
Tomas Frystak
18. Aug. 1987
Torhüter
21
Tomas Micola
16. Sept. 1988
Mittelfeld
Bei den Auswahlspielen hätten die tschechischen Trainer auch gleich alle in der zweiten Jahreshälfte geborenen Spieler nach Hause schicken können.
Profifußball und -eishockey betreffen natürlich nur eine kleine Gruppe von Auserwählten. Doch wir begegnen denselben Verzerrungen in sehr viel wichtigeren Bereichen, zum Beispiel in der Schulbildung. Eltern, deren Kinder am Jahresende geboren wurden, denken oft darüber nach, diese ein Jahr später einzuschulen, damit sie nicht mit Kindern mithalten müssen, die ein gutes Jahr älter sind. Die meisten Eltern scheinen jedoch davon auszugehen, dass sich ein kleiner Nachteil, den ein jüngeres Kind in der Vorschule hat, im Laufe der Jahre schon ausgleichen wird. Das ist jedoch nicht der Fall. Es ist wie beim Eishockey: Der kleine Ausgangsvorteil, den ein älteres Kind gegenüber einem jüngeren mitbringt, wird eher noch größer. Kinder bleiben über Jahre hinweg in denselben Mustern von Leistung und Schulversagen, Förderung und Frustration gefangen.
Unlängst haben die beiden Wirtschaftswissenschaftlerinnen Kelly Bedard und Elizabeth Dhuey den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen im internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftstest TIMSS (der alle vier Jahre durchgeführt wird) und dem Geburtsmonat untersucht. Bei einem Vergleich von Viertklässlern stellten sie fest, dass die ältesten Kinder zwischen vier und zwölf Prozentpunkte mehr erzielten als die jüngsten. Das ist ein ganz erheblicher Unterschied. Von zwei gleich intelligenten Kindern, von denen eines zu Beginn und das andere zum Ende seines Jahrgangs geboren wurde, erreicht das ältere zwischen 80 und 100 Prozent und das jüngere zwischen 60 und 80. Das kann bedeuten, dass sich das ältere Kind für ein Förderprogramm qualifiziert und das jüngere nicht.
»Es ist wie im Sport«, erklärte Dhuey. »Wir differenzieren die Kinder schon früh nach ihren Fähigkeiten. Für fortgeschrittene Leser und Rechner haben wir spezielle Klassen. Deswegen verwechseln die Lehrer schon in der ersten und zweiten Klasse Wissen mit Reife. Die älteren Kinder kommen in die Förderklassen, wo sie mehr lernen. Weil sie mehr gelernt haben, sind sie im nächsten Jahr wieder besser; und im nächsten Jahr passiert dasselbe, und ihr Vorsprung wird noch größer. Das einzige Land, in dem das nicht passiert, ist Dänemark. Dort wird vor dem zehnten Lebensjahr keine Differenzierung vorgenommen.« In Dänemark lässt man sich also mit Auswahlentscheidungen Zeit, bis sich die Altersunterschiede weitgehend ausgeglichen haben.
Dhuey und Bedard wiederholten ihre Untersuchung an Universitäten. Dabei fanden sie heraus, dass die jüngste Gruppe des jeweiligen Jahrgangs gegenüber der ältesten um etwa 11,6 Prozent unterrepräsentiert war. Der ursprüngliche Reifeunterschied verschwindet also nicht etwa mit der Zeit, sondern er bleibt erhalten. Für Tausende Schüler kann dieser anfängliche Unterschied bedeuten, ob sie zur Universität gehen und damit eine echte Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg haben oder nicht.3
»Das ist doch lächerlich«, meint Dhuey. »Unsere willkürliche Festlegung von Stichtagen hat gravierende Auswirkungen, aber das scheint niemanden zu interessieren.«
5.
Denken wir kurz darüber nach, was wir aus der Geschichte über Eishockey und Geburtsmonate über Erfolg lernen können. Sie verrät uns, dass unsere Annahme, die Besten und Klügsten setzten sich dank ihrer besonderen Fähigkeiten mühelos an die Spitze, so nicht stimmen kann. Ohne Frage haben die Eishockeyspieler, die schließlich einen Platz in einer Profimannschaft bekommen, mehr Talent als Sie und ich. Doch sie beginnen auch mit einem erheblichen Vorsprung und mit einer Chance, die sie sich nicht selbst erarbeiten mussten. Und diese Chance war ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Der Soziologe Robert Merton nannte dieses Phänomen den »Matthäus-Effekt«, nach einem Vers aus dem Matthäus-Evangelium des Neuen Testaments: »Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird in Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.« Mit anderen Worten erhalten diejenigen, die bereits Erfolg haben, mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Chancen, die ihnen neue Erfolge ermöglichen. Die Reichen profitieren am meisten von Steuererleichterungen. In den Schulen bekommen die besten Schüler die meiste Aufmerksamkeit und den besten Unterricht. Und im Eishockey erhalten die körperlich am weitesten entwickelten neun- und zehnjährigen Jungen das beste Training und die meiste Spielpraxis. Erfolg ist das Resultat dessen, was Soziologen als »sich akkumulierenden Vorteil« bezeichnen. Der spätere Eishockeyprofi ist zu Beginn seiner Karriere vielleicht ein klein wenig besser als die gleichaltrigen Kinder. Dieser kleine Vorsprung eröffnet ihm jedoch eine Chance, die diesen Unterschied vergrößert. Damit erhält das Kind wiederum neue Möglichkeiten, die den Abstand weiter vergrößern – und so weiter, bis sich der Spieler in einen wirklichen Überflieger verwandelt hat. Doch er hat nicht als Überflieger angefangen. Am Anfang war er lediglich ein bisschen besser.
Die zweite Schlussfolgerung aus dem Beispiel Eishockey ist, dass die Auswahlsysteme, mit denen wir zwischen Talentierten und weniger Talentierten differenzieren, nicht besonders effektiv sind. Wir glauben, wenn wir so früh wie möglich mit Auswahlprogrammen und Begabtenförderung beginnen, könnten wir sicherstellen, dass uns kein Talent durch die Lappen geht. Aber sehen wir uns noch einmal den Kader der tschechischen Nationalmannschaft an: Aus den Monaten Juli, Oktober, November und Dezember ist kein einziger Spieler vertreten und aus den Monaten August und September lediglich jeweils einer. Spieler, die in der zweiten Jahreshälfte zur Welt kamen, wurden frustriert, übersehen oder gänzlich aus dem Sport gedrängt. Damit wurde die Hälfte aller potenziellen Fußballtalente Tschechiens vergeudet.
Was also tun, wenn Sie ein sportlicher junger Tscheche sind und das Pech haben, in der zweiten Jahreshälfte zur Welt gekommen zu sein? Fußball kommt jedenfalls nicht infrage. Vielleicht können Sie in einer Sportart unterkommen, für die sich die Tschechen begeistern, dem Eishockey. Aber Moment mal. (Vermutlich ahnen Sie schon, was jetzt kommt.) Sehen wir uns den Kader der tschechischen Jugendnationalmannschaft an, die bei der Weltmeisterschaft des Jahres 2007 den fünften Platz belegte:
Nr.
Nr. Name
Geburtsdatum
Position
1
David Kveton
3. Jan. 1988
Stürmer
2
Jiri Suchy
3. Jan. 1988
Verteidiger
3
Michael Kolarz
12. Jan. 1987
Verteidiger
4
Jakub Vojta
8. Febr. 1987
Verteidiger
5
Jakub Kindl
10. Febr. 1987
Verteidiger
6
Michael Frolik
17. Febr. 1989
Stürmer
7
Martin Hanzal
20. Febr. 1987
Stürmer
8
Tomas Svoboda
24. Febr. 1987
Stürmer
9
Jakub Cerny
5. März 1987
Stürmer
10
Tomas Kudelka
10. März 1987
Verteidiger
11
Jaroslav Barton
26. März 1987
Verteidiger
12
H. O. Pozivil
22. April 1987
Verteidiger
13
Daniel Rakos
25. Mai 1987
Stürmer
14
David Kuchejda
2. Juni 1987
Stürmer
15
Vladimir Sobotka
2. Juli 1987
Stürmer
16
Jakub Kovar
19. Juli 1988
Torhüter
17
Lukas Vantuch
20. Juli 1987
Stürmer
18
Jakub Voracek
15. Aug. 1989
Stürmer
19
Tomas Pospisil
25. Aug. 1987
Stürmer
20
Ondrej Pavelec
31. Aug. 1987
Torhüter
21
Tomas Kana
29. Nov. 1987
Stürmer
22
Michal Repik
31. Dez. 1988
Stürmer
Wer in den letzten vier Monaten des Jahres geboren wurde, kann also auch Eishockey getrost abhaken.
Sehen Sie, was unser Erfolgsverständnis bewirkt? Weil wir meinen, Erfolg sei ausschließlich das Ergebnis persönlicher Leistung, versäumen wir es, andere auf dem Weg nach oben zu unterstützen. Wir stellen Regeln auf, mit denen wir Leistung verhindern. Wir schreiben bestimmte Menschen vorzeitig ab. Wir zollen den Erfolgreichen übertriebene Bewunderung und den Erfolglosen übertriebene Verachtung. Vor allem aber handeln wir zu passiv. Wir sind uns nicht bewusst, wie groß der Einfluss ist, den wir – die Gesellschaft – darauf haben, wer Erfolg hat und wer nicht.
Wenn wir wollen, könnten wir uns eingestehen, wie wichtig willkürlich festgelegte Stichtage sind. Wir könnten beispielsweise zwei oder drei nach Geburtsmonaten differenzierte Eishockeyligen einrichten. Die Spieler könnten sich getrennt voneinander entwickeln und später in Auswahlmannschaften zusammengebracht werden. Wenn alle tschechischen und kanadischen Sportler, die am Jahresende geboren wurden, eine faire Chance bekämen, dann hätten die jeweiligen Nationalmannschaften plötzlich die Wahl unter der doppelten Anzahl von Spielern.
In den Schulen könnten wir ähnlich verfahren. Grundschulen und Mittelstufen könnten getrennte Klassen für die von Januar bis April, die von Mai bis August und die von September bis Dezember Geborenen einrichten. Auf diese Weise könnten Kinder mit gleich alten und gleich reifen Mitschülern lernen und konkurrieren. Das würde zwar möglicherweise einen geringfügig größeren Verwaltungsaufwand bedeuten, doch die Kosten wären mehr oder weniger dieselben, und diejenigen, die heute ohne eigenes Verschulden vom Schulsystem stark benachteiligt werden, bekämen eine faire Chance. Anders gesagt können wir den Erfolg selbst in die Hand nehmen – nicht nur im Sport, sondern auch in anderen, wichtigeren Bereichen. Doch wir tun es nicht. Und warum? Weil wir uns an der Vorstellung festhalten, dass Erfolg das Resultat individueller Leistung ist, auf die weder die Umwelt, in der wir aufwachsen, noch die Regeln, die wir als Gesellschaft aufstellen, einen Einfluss haben.
6.
Vor dem Memorial-Cup-Endspiel steht Gord Wasden, der Vater eines Spielers von Medicine Hat, an der Bande und erzählt von seinem Sohn Scott. Er trägt eine Mütze und ein schwarzes T-Shirt mit dem Wappen von Medicine Hat. »Als er vier Jahre alt war, hat sein kleiner Bruder noch im Laufwägelchen gestanden. Er hat ihm einen Schläger in die Hand gedrückt, und sie haben von morgens bis abends in der Küche Hockey gespielt. Von klein auf war Scott ein Eishockeynarr. In der Minor-League war er immer in der Auswahlmannschaft. In der Peewee-League, in der Bantam-League, er war immer in der Auswahl.« Wasden ist nervös: Sein Sohn steht vor dem wichtigsten Spiel seines Lebens. »Er hat immer hart arbeiten müssen, für alles, was er erreicht hat. Ich bin sehr stolz auf ihn.«
Das sind also die Zutaten des Erfolgs: Leidenschaft, Talent, Fleiß. Aber da gibt es noch einen anderen Faktor. Wann hatte Wasden zum ersten Mal das Gefühl, dass sein Sohn etwas Besonderes war?
»Wissen Sie, er war immer recht groß für sein Alter. Er war stark und hatte schon früh raus, wie man Tore schießt. Er war immer der Auffälligste in seiner Gruppe, er war immer Kapitän.«
Recht groß für sein Alter? Natürlich. Scott Wasden wurde am
4. Januar geboren, drei Tage nach dem perfekten Geburtstag für einen Profispieler. Scott hatte Glück. Läge der Stichtag im kanadischen Eishockey einen Monat später, hätte er das Endspiel vermutlich von der Tribüne aus verfolgt.