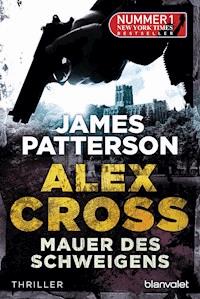Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Prolog
Erster Teil - Niemand wird dich je so lieben wie ich − 1993
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Copyright
Buch
Nie vergeben, nie vergessen! Als ein Heckenschütze seine Frau Maria vor seinen Augen tötete, stand der Profiler Alex Cross erst am Anfang seine Karriere. Doch während all der Jahre seines Erfolgs hat er eins nie vergessen: Dieser Mörder wurde nie gefunden!
Noch heute, Alex Cross hat Polizei und FBI verlassen und sich mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht, um sich intensiver um seine Kinder kümmern zu können, verfolgen ihn diese Erinnerungen. Doch sein Leben scheint endlich in ruhigen Bahnen angelangt zu sein, sogar eine neue Liebesbeziehung steht am Horizont. Da werden die alten Wunden brutal wieder aufgerissen: Cross’ früherer Partner John Sampson bittet ihn um einen Gefallen. In Georgetown, einem Stadtteil von Washington, D.C., treibt ein Serienvergewaltiger sein Unwesen. Dessen brutale Vorgehensweise erinnert Sampson nicht nur an einen alten Fall, den sie beide einmal zusammen bearbeitet haben. Er führt auch direkt zu Marias Tod.
Cross war schon oft in Gefahr. Manchmal fürchtete er nur um sein Leben, oft genug auch um seinen Verstand. Doch noch nie ging ihm ein Fall derart nahe, noch nie war es so ungeheuer wichtig, Erfolg zu haben − um jeden Preis! Denn diesmal zielt der Mörder mitten ins Cross’ Herz… und deswegen geht er jetzt durch die Hölle!
Autor
James Patterson, geboren 1949, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Inzwischen erreicht auch jeder Roman seiner neuen packenden Thrillerserie um Lieutenant Lindsay Boxer und den »Club der Ermittlerinnen« regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.jamespatterson.com
Außerdem sind von James Patterson lieferbar:DIE ALEX-CROSS-ROMANE: Stunde der Rache (7; 35892) ̅̅̄̅̅− Mauer des Schweigens (8; 35988) − Vor aller Augen (9; 36167) − ̅̅̅̅Und erlöse uns von dem Bösen (10; 36232) - Ave Maria (11; 36406)
DER CLUB DER ERMITTLERINNEN: Der 1. Mord (36075) − Die 2. Chance (36392) − Der 3. Grad (36627) - Die 4. Frau (36756) Die 5. Plage (geb. Ausgabe, Limes Verlag, 2527)
Dieses Buch ist der Palm Beach Day School,ihrem Leiter Jack Thompson sowieShirley gewidmet.
Prolog
Wie heißen Sie, Sir?
THOMPSON: Ich bin Dr. Thompson vom Berkshires Medical Center. Wie viele Schüsse haben Sie gehört?
CROSS: Viele Schüsse.
THOMPSON: Wie heißen Sie, Sir?
CROSS: Alex Cross.
THOMPSON: Haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Irgendwelche Schmerzen?
CROSS: Schmerzen im Unterleib. Fühlt sich an, als würde da Flüssigkeit hin und her schwappen. Kurzatmigkeit.
THOMPSON: Ist Ihnen bewusst, dass man auf Sie geschossen hat?
CROSS: Ja. Zweimal. Ist er tot? Der Schlachter? Michael Sullivan?
THOMPSON: Ich weiß nicht. Es gibt etliche Tote. Okay, Leute, ich brauche eine Sauerstoffmaske. Zwei Infusionsschläuche, großer Durchmesser. Zwei Liter Salzlösung. Sofort! Mr Cross, wir versuchen, Sie unverzüglich in ein Krankenhaus zu schaffen. Halten Sie durch. Können Sie mich verstehen? Hören Sie mich?
CROSS: Meine Kinder … sagen Sie Ihnen, dass ich sie liebe.
Erster Teil
Niemand wird dich je so lieben wie ich − 1993
1
»Ich bin schwanger, Alex.«
Ich sehe diesen Abend in allen Einzelheiten vor mir. Immer noch, nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren, nach allem, was geschehen ist, nach all diesen schrecklichen Mördern, den aufgeklärten und manchmal auch nicht aufgeklärten Morden.
Ich stand in dem abgedunkelten Schlafzimmer, die Arme von hinten sanft um die Hüften meiner Frau Maria geschlungen, das Kinn auf ihrer Schulter liegend. Damals war ich einunddreißig, und ich war so glücklich wie nie zuvor in meinem gesamten Leben.
Nichts war auch nur annähernd dem vergleichbar, was wir gemeinsam hatten: Maria, Damon, Jannie und ich.
Das war im Herbst 1993, heute kommt es mir vor, als sei es eine Million Jahre her.
Es war außerdem zwei Uhr nachts, und unser Baby Jannie hatte einen fürchterlichen Kruppanfall. Die arme Kleine war fast die ganze Nacht schon wach, wie so oft in den vergangenen Nächten, wie so oft während ihres noch jungen Lebens. Maria wiegte Jannie sanft in den Armen und summte dazu »You Are So Beautiful«, ich hatte meine Arme um Maria geschlungen und wiegte sie.
Ich war als Erster aufgestanden, aber es war mir nicht gelungen, Jannie wieder in den Schlaf zu wiegen. Nach vielleicht einer Stunde war Maria dazugekommen und hatte mir das Baby abgenommen. Wir mussten beide am nächsten Morgen arbeiten. Ich saß gerade an einem Mordfall.
»Du bist schwanger?«, nuschelte ich, den Mund an Marias Schulter gelegt.
»Kein guter Zeitpunkt, hmm, Alex? Siehst du noch mehr Kruppanfälle auf dich zukommen? Schnuller? Noch mehr volle Windeln? Nächte wie diese?«
»Das hier macht mir wirklich nicht gerade Spaß. So spät − oder so früh, keine Ahnung − noch auf zu sein. Aber ich finde unser Leben wundervoll, Maria. Und ich finde es wundervoll, dass wir noch ein Baby bekommen.«
Ich hielt Maria fest und schaltete das Spieluhr-Mobile ein, das über Janelles Stubenwagen hing. Wir wiegten uns zu den Klängen von »Someone to Watch Over Me« auf der Stelle hin und her.
Dann schenkte sie mir dieses wunderschöne, teils schüchterne, teils naive Lächeln, in das ich mich vielleicht schon am Abend unserer ersten Begegnung verliebt hatte. Das war in der Notaufnahme des St. Anthony Hospital gewesen. Maria hatte ein jugendliches Bandenmitglied mitgebracht, einen ihrer Klienten, der bei einer Schießerei verletzt worden war. Sie war eine engagierte Sozialarbeiterin und wollte ihn beschützen - vor allem deshalb, weil ich ein gefürchteter Detective bei der Mordkommission war und sie der Polizei nicht gerade großes Vertrauen entgegenbrachte. Aber das tat ich ja auch nicht.
Ich umfasste Maria noch ein bisschen fester. »Ich bin glücklich. Das weißt du. Ich bin froh, dass du schwanger bist. Komm, lass uns feiern. Ich besorge uns ein bisschen Sekt.«
»Die Papa-Rolle gefällt dir, stimmt’s?«
»Stimmt. Weiß auch nicht genau, wieso, aber sie gefällt mir.«
»Schreiende Babys mitten in der Nacht gefallen dir also?«
»Das geht vorbei. Hab ich nicht Recht, Janelle? Junges Fräulein, ich rede mit dir.«
Maria wandte ihren Blick von dem kreischenden Baby ab und drückte mir einen süßen Kuss auf die Lippen. Sie hatte einen weichen Mund, immer einladend, immer sexy. Ich war verrückt nach ihren Küssen − jederzeit, überall.
Schließlich wand sie sich aus meinen Armen. »Leg dich wieder ins Bett, Alex. Wir müssen ja nicht beide auf sein. Schlaf ein bisschen für mich mit.«
Erst jetzt fiel mir hier im Kinderzimmer etwas auf, und ich musste lachen.
»Worüber lachst du denn?« Maria lächelte.
Ich zeigte es ihr. Drei Äpfel, jeder war einmal von einem Kindergebiss angebissen worden. Sie lagen nun auf den Schößen von drei Plüschtieren, genauer gesagt von drei Dinosauriern in unterschiedlichen Farben. Das hatte der kleine Damon also gespielt. Unser kleiner Junge hatte eine Weile bei seiner Schwester Jannie gesessen.
Als ich bei der Tür angelangt war, zeigte Maria mir noch einmal ihr naives Lächeln. Und zwinkerte mir zu. Sie flüsterte mir zu, und die Worte werde ich niemals vergessen: »Ich liebe dich, Alex. Niemand wird dich je so lieben wie ich.«
2
Sechzig Kilometer nördlich von Washington D.C., in Baltimore, ignorierten zweigroßspurige, langhaarige Profikiller Mitte bis Ende zwanzig das Schild mit der Aufschrift Nur für Mitglieder und betraten selbstgefällig den St. Francis Social Club in der South High Street, nicht weit vom Hafen entfernt. Beide Männer waren schwer bewaffnet und grinsten wie ein Paar Stand-Up-Comedians.
An diesem Abend befanden sich siebenundzwanzig Capos und Soldaten im Club. Sie spielten Karten, tranken Grappa und Espresso und sahen im Fernsehen die Bullets gegen die Knicks verlieren. Schlagartig wurde es still im Raum, und die Spannung stieg.
Niemand kommt so einfach in den Club von St. Francis of Assisi, schon gar nicht ohne Einladung und bewaffnet.
Einer der Eindringlinge, ein Mann namens Michael Sullivan, bedachte die Anwesenden von der Tür her mit einem gelassenen Salut. Komische Geschichte, dachte Sullivan. Wie diese gnadenlosen, harten Jungs hier auf einem Haufen hocken und über das Leben sinnieren. Sein Partner, Jimmy »Hats« Galati, ließ seine Blicke unter dem Rand eines mitgenommenen schwarzen Filzhutes − so ähnlich wie der von Squiggy in der Sitcom Laverne & Shirley − hervor durch den Raum gleiten. Der Club wirkte ziemlich konventionell − normale Stühle, Kartentische, behelfsmäßige Bar, verwanzte Holztäfelung.
»Kein Empfangskommitee? Keine Blaskapelle?«, fragte Sullivan, der Konfrontationen in jeder Form liebte, verbale genau so wie körperliche. Er und Jimmy Hats gegen alle anderen, so war es immer gewesen, schon seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr, als sie aus ihrem Zuhause in Brooklyn geflüchtet waren.
»Wer, zum Teufel, seid ihr?«, wollte ein einfacher Soldat wissen, während er sich von einem der wackeligen Kartentische erhob. Er war knapp einen Meter neunzig groß, besaß kohlrabenschwarze Haare und mochte an die hundert Kilogramm wiegen. Offensichtlich stemmte er regelmäßig Hanteln.
»Das da ist der Schlachter von Sligo. Schon mal was von ihm gehört?«, fragte Jimmy Hats. »Wir kommen aus New York. Schon mal was von New York gehört?«
3
Der geschniegelte Mafia-Soldat zeigte keine Reaktion, aber ein älterer Mann in einem schwarzen Anzug mit bis an den Kragen zugeknöpftem weißen Hemd hob die Hand, als wäre er der Papst, und sagte langsam, mit starkem Akzent und jedes Wort einzeln betonend: »Wem verdanken wir diese Ehre? Natürlich haben wir schon vom Schlachter gehört. Warum seid ihr hierher nach Baltimore gekommen? Was können wir für euch tun?«
»Wir sind nur auf der Durchreise«, wandte sich Michael Sullivan an den alten Mann. »Müssen in D.C. einen kleinen Job für Mr Maggione erledigen. Haben die Herren vielleicht schon einmal von Mr Maggione gehört?«
Überall im Raum wurde genickt. Der Tonfall der ganzen Unterredung legte nahe, dass es sich um ernsthafte Angelegenheiten handelte. John Maggione war das Oberhaupt der New Yorker Familie, die weite Teile der Ostküste bis hinunter nach Atlanta beherrschte.
Jeder im Raum wusste, wer John Maggione war, und auch, dass es sich bei dem Schlachter um seinen skrupellosesten Auftragskiller handelte. Angeblich traktierte er seine Opfer mit Schlachtermessern, Skalpellen und Hämmern. Ein Journalist der Newsday hatte einen seiner Morde mit den folgenden Worten geschildert: »Kein menschliches Wesen könnte so etwas anrichten.« Der Schlachter war in Mafiakreisen genauso gefürchtet wie bei der Polizei. Daher waren die Anwesenden auch verwundert darüber, dass der Killer so jung war und mit seinen langen, blonden Haaren und den auffallend blauen Augen eher wie ein Filmstar aussah.
»Wo bleibt dann der Respekt? Ich bekomme das Wort zwar oft zu hören, aber hier in diesem Club ist nichts davon zu spüren«, sagte Jimmy »Hats«, dem, genau wie dem Schlachter selbst, der Ruf vorauseilte, regelmäßig Hände und Füße zu amputieren.
Der Soldat, der vorhin aufgestanden war, griff plötzlich und ohne Vorwarnung an, der Arm des Schlachters schoss pfeilschnell nach vorne. Er schnitt dem Mann erst die Nasenspitze und dann eines seiner Ohrläppchen ab. Der Soldat griff sich mit beiden Händen an die verwundeten Stellen und wich so schnell zurück, dass er das Gleichgewicht verlor und krachend auf dem Holzfußboden aufschlug.
Der Schlachter war schnell und offensichtlich tatsächlich so geschickt im Umgang mit dem Messer, wie alle behaupteten. Er war wie einer der Totschläger damals aus Sizilien, und genau so hatte er auch das Spiel mit dem Messer gelernt: von einem der alten Soldaten in Brooklyn. Das Amputieren und das Knochenzermalmen hatte er sich wie selbstverständlich angeeignet. Für ihn war das so etwas wie sein Markenzeichen, Symbol seiner Skrupellosigkeit.
Jimmy Hats hatte jetzt eine Pistole gezogen, eine Halbautomatik, Kaliber vierundvierzig. Hats trug den Beinamen »Jimmy, der Beschützer« und hielt dem Schlachter den Rücken frei. Immer.
Jetzt ging Michael Sullivan mit langsamen Schritten im Raum umher. Er trat ein paar Kartentische um, schaltete den Fernseher ab und zog den Stecker aus der Espressomaschine. Jeder rechnete damit, dass gleich jemand sterben musste. Aber wieso? Wieso hatte John Maggione ihnen diesen Wahnsinnigen auf den Hals gehetzt?
»Ich sehe, dass ein paar von euch auf eine kleine Showeinlage warten«, sagte er. »Ich sehe es euren Blicken an, ich kann es riechen. Tja, verflucht noch mal, ich will niemanden enttäuschen.«
Urplötzlich kniete Sullivan nieder und stach auf den verwundet am Boden liegenden Mafia-Soldaten ein. Er stach dem Mann in den Hals, dann ins Gesicht und in die Brust, so lange, bis der Körper sich nicht mehr rührte. Die Stiche waren nicht zu zählen gewesen, aber es mussten mindestens ein Dutzend gewesen sein, wahrscheinlich mehr.
Dann geschah das Seltsamste. Sullivan stand auf und verbeugte sich über der Leiche. Als wäre das alles für ihn nichts weiter gewesen als eine große Show, eine Zirkusnummer.
Schließlich wandte der Schlachter den Anwesenden den Rücken zu und ging unbekümmert in Richtung Tür. Keine Angst vor nichts und niemandem. Über die Schulter rief er zurück: »War nett, Sie kennen gelernt zu haben, meine Herren. Das nächste Mal zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, wenn schon nicht für mich und Mr Jimmy Hats, dann wenigstens für Mr Maggione.«
Jimmy Hats schickte ein Grinsen in den Raum und tippte sich mit dem Finger an den Filzhut. »Oh ja, er ist wirklich so gut«, sagte er. »Aber wisst ihr was? Mit der Kettensäge ist er noch viel besser.«
4
Fast während der gesamten Fahrt lachten sich der Schlachter und Jimmy Hats über ihren Besuch im Social Club von St. Francis of Assisi schlapp. Sie waren auf dem I-95 unterwegs, hinunter nach Washington, wo sie in den nächsten ein, zwei Tagen einen ziemlich kniffeligen Job zu erledigen hatten. Mr Maggione hatte einen Zwischenstopp in Baltimore angeordnet, um dort einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Don hatte den Verdacht, dass die Capos vor Ort ihm die eine oder andere Einnahme unterschlagen hatten. Der Schlachter war sich ziemlich sicher, dass er seinen Auftrag zufriedenstellend erledigt hatte.
Das gehörte zu seinem immer größer werdenden Ruf: Er war nicht nur ein guter Killer, er kam auch ebenso zuverlässig wie der Herzinfarkt eines dicken Mannes, der sich von Spiegeleiern und Speck ernährt.
Sie erreichten D.C. und fuhren die Touristen-Route entlang, vorbei am Washington Monument und etlichen anderen, ach so sehenswerten Bauwerken. »My country’tis of V«, sang Jimmy Hats in bemerkenswert falschen Tönen.
Sullivan stieß ein schnaubendes Lachen aus. »Du bist ja so’n Spezialist, James, mein Kleiner. Wo, zum Teufel, hast du denn das gelernt? My country’tis of V?«
»Schule der Kirchengemeinde St. Patrick’s, Brooklyn, New York, da, wo sie mir das ABC und das Einmaleins beigebracht haben und wo ich außerdem ein durchgeknalltes Arschloch namens Michael Sean Sullivan kennen gelernt habe.«
Zwanzig Minuten später reihten sie sich in die spätabendliche Prozession junger Menschen ein, die sich die M-Street in Georgetown entlangwälzte. Ein Haufen tumber, träger College-Deppen und mittendrin er und Jimmy, zwei brillante Profikiller, dachte Sullivan. Also, wer hatte das bessere Leben? Wer hatte es geschafft und wer nicht?
»Wärst du eigentlich gerne aufs College gegangen?«, wollte er von Hats wissen.
»Wär mit dem miesen Einkommen einfach nicht klargekommen. Hab mit achtzehn schon fünfundsiebzigtausend im Jahr gemacht. Und außerdem: Ich liebe meine Arbeit!«
Sie blieben im Charlie Malone’s hängen, einer bei Washingtons Studenten beliebten Kneipe, auch wenn Sullivan beim besten Willen nicht wusste, warum. Weder der Schlachter noch Jimmy Hats waren weiter als bis zur Highschool gekommen, aber kaum hatten sie das Lokal betreten, hatte Sullivan schon ein lockeres Gespräch mit zwei Studentinnen begonnen, die höchstens zwanzig Jahre alt waren, wahrscheinlich noch nicht einmal. Sullivan las viel, und an das meiste konnte er sich auch erinnern, sodass er praktisch mit jedem Menschen eine Unterhaltung anfangen konnte. Am heutigen Abend umfasste sein Repertoire die vor Kurzem in Somalia ums Leben gekommenen US-amerikanischen Soldaten, ein paar neue, angesagte Kinofilme und sogar ein wenig romantische Poesie, Blake und Yeats, was den College-Damen zu imponieren schien.
Michael Sullivan war nicht nur charmant, sondern auch noch gut aussehend, und das war ihm durchaus bewusst − schlank und doch angenehm muskulös, eins fünfundachtzig groß, dazu halblange, blonde Haare und ein Lächeln, mit dem er jeden Menschen blenden konnte, wenn er wollte.
Also war es auch keine große Überraschung, dass die zwanzigjährige Marianne Riley aus Burkittsville, Maryland, ihm keine allzu schüchternen Blicke zuwarf und ihn auf eine Art und Weise berührte, wie es unverblümte junge Mädchen manchmal tun.
Sullivan beugte sich dicht zu dem Mädchen, das nach Wildblumen duftete. »Marianne, Marianne … ich kannte mal so ein Lied. Calypso-Melodie. Kennst du das auch? ›Marianne, Marianne‹?«
»Vor meiner Zeit«, erwiderte das Mädchen, aber dann zwinkerte sie ihm zu. Sie hatte wundervolle grüne Augen, volle, rote Lippen und ein unglaublich süßes, kariertes Schleifchen im Haar. Von Anfang an war Sullivan sich in einem Punkt absolut sicher gewesen − Marianne wollte ihn bloß ein bisschen anheizen, aber ranlassen würde sie ihn nicht, und das war für ihn vollkommen in Ordnung. Er spielte ja auch gerne seine Spielchen.
»Ich verstehe. Und Mr Yeats, Mr Blake und Mr James Joyce, die waren also nicht vor deiner Zeit?«, fragte er neckisch. Sein gewinnendes Lächeln leuchtete mit voller Kraft. Dann nahm er Mariannes Hand und hauchte ihr einen Kuss darauf. Er zog sie von ihrem Barhocker herunter und tanzte mit ihr ein paar enge Figuren zu dem Stones-Titel, der aus der Musikbox drang.
»Wo soll das denn hinführen?«, fragte sie. »Was glaubst du denn, wo das hinführen soll?«
»Du wirst schon sehen. Nur keine Sorge. Vertrau mir.«
Sie lachte, kniff ihm in die Wange und lachte noch ein bisschen mehr. »Wie könnte ich diesen mörderischen Blicken widerstehen?«
5
Marianne dachte, dass sie diesem niedlichen Typen aus New York eigentlich gar nicht widerstehen wollte. Außerdem war sie in dieser Kneipe in der M-Street sicher. Was sollte hier schon passieren? Schlimmstenfalls spielte die Musikbox einen Titel der New Kids on the Block.
»Ich steh nicht so gern im Scheinwerferlicht«, sagte er gerade und lenkte sie in den hinteren Teil der Kneipe.
»Du hältst dich wohl für einen zweiten Tom Cruise, stimmt’s? Dieses Lächeln, funktioniert das eigentlich jedes Mal? Kriegst du damit immer das, was du willst?«, fragte sie.
Aber sie lächelte ebenfalls, forderte ihn heraus, spornte ihn zu Höchstleistungen an.
»Ich weiß nicht, M.M. Manchmal funktioniert es ganz gut, schätze ich.«
Sie standen in dem abgedunkelten Flur im hinteren Teil der Bar, er küsste sie, und der Kuss erfüllte Mariannes sämtliche Hoffnungen, er war irgendwie sogar süß. Auf jeden Fall sehr viel zärtlicher, als sie erwartet hatte. Er versuchte nicht, sie gleichzeitig irgendwo anzufassen, auch wenn sie vielleicht gar nichts dagegen gehabt hätte, aber so war es besser.
»Huuuiii.« Sie stieß schnaubend den Atem aus und fächelte sich mit der Hand Luft zu. Das sollte ein Scherz sein, auch wenn es nur teilweise scherzhaft gemeint war.
»Es ist wirklich ein bisschen warm hier drin, nicht wahr?«, sagte Sullivan und entlockte der College-Studentin damit ein weiteres Lächeln. »Ein bisschen eng, findest du nicht auch?«
»Tut mir leid, aber ich gehe auf gar keinen Fall mit dir irgendwohin. Wir haben ja nicht mal ein Date.«
»Verstehe«, erwiderte er. »Habe ich auch nicht mit gerechnet. Nicht mal einen Gedanken habe ich daran verschwendet.«
»Natürlich nicht. Dazu bist du viel zu sehr Kavalier.«
Er küsste sie noch einmal, und dieser Kuss war tiefer. Es gefiel Marianne, dass er nicht so leicht klein beigab. Auch, wenn es keine Rolle spielte … sie würde auf keinen Fall mit ihm irgendwo hingehen. Das machte sie grundsätzlich nicht, niemals … also, zumindest bis jetzt nicht.
»Du kannst wirklich gut küssen«, sagte sie. »Das muss man dir lassen.«
»Du hältst dich auch ganz wacker«, erwiderte er. »Um ehrlich zu sein, du bist eine tolle Küsserin. Das war der beste Kuss meines Lebens«, fuhr er in neckischem Ton fort.
Sullivan ließ sich mit dem Rücken gegen eine Tür fallen, und sie stolperten unvermittelt in die Herrentoilette. Dann stellte sich Jimmy Hats von außen vor die Tür. Er hielt dem Schlachter immer den Rücken frei.
»Nein, nein, nein«, sagte Marianne, musste aber dennoch lachen. Die Herrentoilette? Das war echt witzig. Verrückt, aber witzig. Genau das, was man auf dem College eben so macht.
»Du glaubst wirklich, dass du mit allem davonkommst, stimmt’s?«, sagte sie.
»Meine Antwort lautet ja. Ich mache eigentlich immer das, was ich will, Marianne.«
Plötzlich zückte er ein Skalpell, hielt ihr die blitzende, rasiermesserscharfe Klinge dicht vor die Kehle, und von einem Augenblick auf den anderen war alles anders. »Und du hast Recht, wir haben kein Date. Also, ich will kein Wort hören, Marianne, sonst war es dein letztes auf dieser Welt, das schwöre ich.«
6
»An diesem Skalpell klebt schon Blut«, sagte der Schlachter mit einem heiseren Flüstern, das dazu gedacht war, ihr wahnsinnige Angst einzujagen. »Kannst du es sehen?«
Dann berührte er seine Jeans im Schritt. »Diese Klinge hier wird dir nicht ganz so wehtun.« Er fuchtelte ihr mit dem Skalpell vor den Augen herum. »Aber diese hier umso mehr. Entstellt dein hübsches Gesicht für den Rest deines Lebens. Das ist kein Scherz, College-Mädchen.«
Er zog den Reißverschluss seiner Jeans auf und legte Marianne Riley das Skalpell an die Kehle, ohne sie zu verletzen. Er hob ihren Rock hoch und zerrte ihr blaues Höschen beiseite.
Dann sagte er: »Ich will dir nicht wehtun. Das spürst du doch, oder?«
Sie brachte kaum ein Wort heraus. »Ich weiß nicht.«
»Ich gebe dir mein Wort, Marianne.«
Dann schob er sich in das College-Mädchen, langsam, um ihr nicht durch einen plötzlichen Stoß wehzutun. Er wusste, dass er eigentlich so schnell wie möglich machen musste, aber er wollte ihr strammes Inneres nicht verlassen. Zur Hölle, ich werde Marianne, Marianne nie mehr wiedersehen.
Zumindest war sie schlau genug, nicht zu schreien oder sich mit den Knien oder Fingernägeln zu wehren. Als er fertig war, zeigte er ihr ein paar Fotos, die er immer bei sich trug. Nur um ihr klarzumachen, in welcher Situation sie sich befand. Hundertprozentig klar.
»Ich habe diese Aufnahmen persönlich gemacht. Schau sie dir genau an, Marianne. Du darfst mit niemandem über den heutigen Abend sprechen. Mit absolut niemandem, ganz besonders nicht mit der Polizei. Hast du verstanden?«
Sie nickte, ohne ihn anzuschauen.
»Du musst es aussprechen, meine Kleine. Und du musst mich dabei anschauen, so schmerzhaft es auch sein mag.«
»Verstanden«, sagte sie. »Ich spreche mit niemandem darüber, niemals.«
»Schau mich an.«
Ihr Blick begegnete seinem, und die Verwandlung war verblüffend. Er sah Angst und Hass, und das gefiel ihm. Der Grund dafür war eine lange Geschichte, die Geschichte einer Kindheit in Brooklyn, eine Vater-Sohn-Geschichte, die er lieber für sich behalten wollte.
»Braves Mädchen. Es klingt seltsam, aber ich mag dich. Was ich sagen will, ich spüre eine gewisse Zuneigung zu dir. Auf Wiedersehen, Marianne, Marianne.«
Bevor er die Toilette verließ, durchsuchte er ihre Handtasche und nahm ihre Brieftasche heraus. »Als Versicherung«, sagte er. »Sprich mit niemandem darüber.«
Dann machte der Schlachter die Tür auf und verschwand. Marianne Riley ließ sich am ganzen Körper zitternd auf den Fußboden in der Toilette sinken. Sie würde das, was soeben geschehen war, niemals vergessen, vor allem nicht diese grässlichen Fotos.
7
»Wer ist denn da so früh am Morgen schon wach? Ach, du meine Güte, nun sieh dir das mal an. Ist das etwa Damon Cross? Und entdecke ich da auch noch Janelle Cross?«
Wie jeden Werktag war Nana Mama pünktlich um halb sieben zur Stelle, um sich um die Kinder zu kümmern. Als sie zur Küchentür hereinstürmte, fütterte ich gerade Damon mit Haferbrei, während Maria Jannie ein Bäuerchen entlockte. Jannie weinte schon wieder. Armes, kleines, krankes Mädchen.
»Genau die gleichen Kinder, die mitten in der Nacht schon wach waren«, erzählte ich meiner Großmutter, während ich einen randvollen Löffel Brei in die ungefähre Richtung von Damons zuckendem Mündchen dirigierte.
»Damon kann das schon selbst«, sagte Nana schnaufend und stellte ihre Tasche auf der Küchentheke ab.
Es sah ganz danach aus, als hätte sie warme Brötchen und - war das denn möglich? − selbst gemachte Pfirsichmarmelade mitgebracht. Und außerdem das übliche Büchersortiment für den Tag: Blueberries for Sal, The Gift of the Magi, Goodnight Moon.
Ich sagte zu Damon: »Nana meint, du könntest schon selber essen, Kumpel. Verheimlichst du mir vielleicht etwas?«
»Damon, nimm den Löffel«, sagte sie.
Natürlich gehorchte er. Niemand stellt sich gegen Nana Mama.
»Verflucht sollst du sein«, sagte ich und nahm mir ein Brötchen. Gepriesen sei der Herr, ein warmes Brötchen! Dann breitete sich langsam der köstliche Geschmack des Himmels auf Erden in meinem Mund aus. »Gebenedeit seist du, oh altehrwürdige Frau. Gebenedeit seist du!«
Maria meinte: »Alex hört zur Zeit nicht besonders gut, Nana. Er hat zu viel mit seinen ständigen Mordermittlungen zu tun. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass Damon selber essen kann. Meistens wenigstens. Wenn er nicht gerade die Wände oder die Decke füttert.«
Nana nickte. »Er kann immer selber essen. Es sei denn, er will hungrig bleiben. Willst du hungrig bleiben, Damon? Nein, natürlich willst du das nicht, mein Kleiner.«
Maria fing an, ihre Sachen zusammenzupacken. Gestern hatte sie noch bis nach Mitternacht in der Küche gesessen und gearbeitet. Sie war bei der Stadt als Sozialarbeiterin angestellt und erstickte in Arbeit. Sie nahm sich einen violetten Schal vom Haken an der Hintertür und dazu ihren Lieblingshut, der zu ihrer überwiegend schwarzen und blauen Kleidung passte.
»Ich hab dich lieb, Damon Cross.« Sie flog auf unseren Jungen zu und küsste ihn. »Und dich hab ich auch lieb, Jannie Cross. Trotz heute Nacht.« Sie gab Jannie ein paar Küsschen auf beide Wangen.
Dann schnappte sie sich Nana und küsste sie. »Und dich hab ich auch lieb.«
Nana strahlte, als hätte man sie soeben mit Jesus persönlich bekannt gemacht oder mit Maria. »Ich hab dich auch lieb, Maria. Du bist ein wahres Wunder.«
»Ich bin gar nicht da«, sagte ich von meinem Horchposten an der Küchentür her.
»Ach, das wissen wir«, meinte Nana.
Auch ich musste, bevor ich zur Arbeit ging, alle Anwesenden umarmen, küssen und Liebeserklärungen abgeben. Kann sein, dass das kitschig ist, aber es tut gut und ist außerdem eine hübsche Provokation für alle diejenigen, die glauben, dass in einer umtriebigen und stressgeplagten Familie kein Platz für Spaß und Liebe sei. Bei uns gab es eine ganze Menge davon.
»Tschüs, wir haben euch lieb, tschüs, wir haben euch lieb«, sangen Maria und ich im Chor, während wir gemeinsam zur Tür hinausgingen.
8
Wie an jedem Morgen, brachte ich auch heute Maria zu ihrem Arbeitsplatz in der Sozialbausiedlung Potomac Gardens. Von dort waren es höchstens fünfzehn, zwanzig Minuten bis zur Fourth Street, und so waren wir wenigstens noch ein bisschen zu zweit.
Wir saßen in dem schwarzen Porsche, dem letzten sichtbaren Zeugnis meiner drei Berufsjahre als gut verdienender, privat praktizierender Psychologe, bevor ich einen Vollzeit-Job bei der Polizeibehörde von D.C. angenommen hatte. Maria besaß einen weißen Toyota Corolla, den ich nicht besonders gut leiden konnte. Im Gegensatz zu ihr.
Als wir an diesem Morgen durch die G-Street fuhren, hatte ich das Gefühl, als sei sie mit ihren Gedanken weit weg.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich sie.
Sie lachte und zwinkerte mir zu.
»Bisschen müde. Eigentlich geht es mir sogar ziemlich gut, den Umständen entsprechend. Ich habe gerade an einen Fall gedacht, den ich gestern als Vertretung für Maria Pugatch übernommen habe. Eine Studentin der George Washington University. Sie ist in einer Kneipe in der M-Street vergewaltigt worden.«
Ich zog die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. »Von einem Kommilitonen?«
»Sie behauptet, nein, aber viel mehr will sie nicht sagen.« Ich zog die Augenbrauen in die Höhe. »Heißt das, dass sie den Vergewaltiger kennt? Ein Professor vielleicht?«
»Das Mädchen sagt kategorisch nein, Alex. Sie schwört Stein und Bein, dass sie ihn nicht kennt.«
»Und glaubst du ihr?«
»Ich denke, schon. Aber ich bin eben auch sehr leichtgläubig und vertrauensselig. Sie macht so einen netten Eindruck.«
Ich wollte meine Nase nicht zu tief in Marias berufliche Angelegenheiten stecken. Das galt auch umgekehrt. Zumindest versuchten wir es.
»Soll ich vielleicht irgendetwas unternehmen?«, fragte ich.
Maria schüttelte den Kopf. »Du hast genug zu tun. Ich unterhalte mich heute noch einmal mit der jungen Frau − Marianne. Hoffentlich kann ich sie dazu bringen, sich ein wenig zu öffnen.«
Ein paar Minuten später blieb ich vor der Sozialbausiedlung Potomac Gardens in der G-Street, zwischen Thirteenth Street und Pennsylvania Avenue, stehen. Maria hatte sich freiwillig hierher versetzen lassen und hatte dafür einen deutlich bequemeren und sichereren Job in Georgetown sausen lassen. Ich glaube, sie hat es deshalb gemacht, weil sie die ersten achtzehn Jahre ihres Lebens, bis zu ihrem Umzug nach Villanova, hier in Potomac Gardens gewohnt hat.
»Kuss«, sagte Maria. »Ich brauche jetzt einen Kuss. Einen schönen. Keinen Schmatz auf die Backe. Auf die Lippen.«
Ich beugte mich zu ihr und küsste sie − und dann küsste ich sie noch einmal. Wir knutschten noch ein bisschen auf dem Beifahrersitz, und ich musste unwillkürlich denken, wie sehr ich sie liebte und wie glücklich ich mich schätzen konnte, dass ich sie hatte. Und was das Ganze noch besser machte: Ich wusste, dass Maria genau dasselbe für mich empfand.
»Muss los«, sagte sie schließlich und wand sich aus dem Wagen.
Dann beugte sie sich noch einmal ins Wageninnere. »Kann sein, dass ich nicht so aussehe, aber ich bin glücklich. Ich bin so glücklich.«
Dann kam wieder dieses kleine Zwinkern.
Ich sah Maria nach, wie sie die steile Steintreppe zu dem Wohnblock mit ihrem Büro hinaufstieg. Es war schrecklich, sie weggehen zu sehen, und so ging es mir praktisch jeden Morgen.
Ob sie sich wohl umdrehen und nachschauen würde, ob ich schon weg war? Dann geschah es − sie sah mich, lächelte und winkte mir wie wahnsinnig zu, zumindest wie wahnsinnig verliebt. Dann verschwand sie im Haus.
Es war fast jeden Morgen das Gleiche, aber ich konnte einfach nie genug davon bekommen. Vor allem nicht von ihrem Augenzwinkern. Niemand wird dich je so lieben wie ich.
Ich hatte nicht den geringsten Zweifel daran.
9
Ich war zu dieser Zeit ein ziemlich erfolgreicher Detective − immer unterwegs, immer eingespannt, immer unterrichtet. Daher wurden mir auch immer mehr schwierige, prestigeträchtige Fälle übertragen. Der neueste gehörte jedoch leider nicht dazu.
Nach allem, was man im Bereich der Polizeidirektion von Washington wusste, hatte die italienische Mafia noch nie größere Operationen in D.C. durchgeführt, vermutlich aufgrund irgendwelcher Abmachungen mit gewissen Institutionen wie zum Beispiel dem FBI oder der CIA. Vor Kurzem jedoch hatten sich die fünf Familien in New York getroffen und beschlossen, ihr Geschäftsfeld auf Washington, Baltimore und Teile Virginias auszuweiten.
Kein Wunder, dass die örtlichen Gangsterbosse diese Entwicklung nur mäßig begeistert zur Kenntnis nahmen, besonders die Asiaten, die den Kokain- und Heroinhandel kontrollierten.
Vor einer Woche hatte ein chinesischer Drogenbaron namens Jiang An-Lo zwei italienische Abgesandte exekutiert. Keine weise Entscheidung. Es wurde berichtet, dass die Familie in New York einen erstklassigen Profikiller entsandt hatte, vielleicht sogar ein Team von Profikillern, die sich um Jiang kümmern sollten.
Das alles hatte ich während einer einstündigen Einsatzbesprechung im Polizeipräsidium erfahren. Jetzt waren John Sampson und ich unterwegs zu Jiang An-Los Geschäftssitz, der sich in einer Doppelhaushälfte an der Ecke Eighteenth und M-Street im Nordosten der Stadt befand. Wir waren als eines von zwei Überwachungsteams für den heutigen Vormittag eingeteilt worden. Wir tauften den Einsatz »Operation Drecksack-Bewachung«.
Wir stellten unseren Wagen zwischen der Nineteenth und der Twentieth Street ab und begannen mit der Arbeit. An Jiang An-Los Haus blätterte die gelbe Fassadenfarbe ab, es wirkte von außen ziemlich heruntergekommen. Überall im Vorgarten lag Abfall herum, als hätte man eine Müll-Piñata platzen lassen. Die meisten Fensteröffnungen waren mit Sperrholz oder Blech zugenagelt worden. Und doch … Jiang An-Lo war eine große Nummer im Drogengeschäft.
Es wurde bereits wärmer, und eine Menge Leute waren auf den Bürgersteigen unterwegs oder trafen sich in kleinen Gruppen auf den Veranden der Nachbarschaft.
»Was macht Jiangs Bande noch mal? Ecstasy? Heroin?«, wollte Sampson wissen.
»Und Angel Dust. Sie vertreiben es an der gesamten Ostküste - D.C., Philly, Atlanta, New York. War bis jetzt ein einträgliches Geschäft, darum wollen die Italiener sich ja beteiligen. Was hältst du davon, dass Louis French ins FBI abberufen wurde?«
»Kenne ich nicht. Aber er ist ja ernannt worden, also muss er der Falsche für den Job sein.«
Ich lachte. Sampsons Spruch enthielt einen wahren Kern. Dann lehnten wir uns in unsere Sitze und warteten auf ein paar Mafiakiller, die es auf Jiang An-Lo abgesehen hatten. Falls unsere Informationen zutreffend waren.
»Wissen wir irgendetwas über den Killer?«, wollte Sampson wissen.
»Soll angeblich Ire sein«, sagte ich und blickte John an. Ich wollte sehen, wie er darauf reagierte.
Sampson erwiderte meinen Blick. »Der für die Mafia arbeitet? Wie kann denn so was passieren?«
»Der Kerl soll wirklich gut sein. Und wahnsinnig. Man nennt ihn den Schlachter.«
In der Zwischenzeit hatte ein alter Mann mit krummem Rücken angefangen, die M-Street zu überqueren. Dabei schaute er sich immer wieder nach links und rechts um und zog bedächtig an seiner Zigarette. In der Straßenmitte begegnete er einem dürren Weißen mit einer Aluminiumkrücke, und die beiden Versehrten nickten einander feierlich zu.
»Hier wohnen wirklich Typen«, sagte Sampson lächelnd. »So sehen wir in ein paar Jahren aus.«
»Kann sein. Wenn wir Glück haben.«
Dann fasste Jiang An-Lo den Entschluss, sich zum ersten Mal an diesem Tag der Öffentlichkeit zu präsentieren.
10
Jiang war groß gewachsen und wirkte beinahe ausgemergelt. Ein zotteliger, schwarzer Ziegenbart von gut und gerne fünfzehn Zentimetern Länge zierte sein spitzes Kinn.
Der Drogenbaron stand in dem Ruf, gerissen, kampflustig und bösartig zu sein, und das oftmals unnötigerweise, als ob er das Ganze als ein einziges, großes, gefährliches Spiel betrachtete. Er war auf den Straßen von Shanghai groß geworden, war dann nach Hongkong und von dort nach Bagdad gegangen und schließlich in Washington gelandet, wo er wie ein neuzeitlicher, chinesischer Kriegsherr etliche Viertel unter Kontrolle hatte.
Ich ließ den Blick die M-Street hinauf- und hinuntergleiten und suchte nach Anzeichen für irgendwelche Unannehmlichkeiten. Jiang war in Begleitung von zwei Leibwächtern, die beide sehr angespannt wirkten. War er vielleicht gewarnt worden? Und wenn ja, von wem? Jemand aus dem Polizeiapparat, der auf seiner Gehaltsliste stand? Das war keineswegs auszuschließen.
Außerdem fragte ich mich, wie gut dieser irische Killer sein mochte.
»Haben die Leibwächter uns schon entdeckt?«, wollte Sampson wissen.
»Davon gehe ich aus, John. Wir sind ja in erster Linie zur Abschreckung da.«
»Der Killer hat uns auch gesehen?«
»Falls er schon da ist. Falls er was taugt. Wenn ein Killer da ist, dann hat er uns wahrscheinlich auch gesehen.«
Als Jiang An-Lo ungefähr die halbe Strecke zu einem schwarz glänzenden, am Straßenrand abgestellten Mercedes zurückgelegt hatte, bog ein anderes Auto, ein Buick LeSabre, auf die M-Street ein. Es beschleunigte mit röhrendem Motor, die Reifen scheuerten quietschend am Bordstein entlang.
Jiangs Leibwächter wandten sich blitzartig um, dem heranrasenden Auto zu. Sie hatten ihre Waffen gezückt. Sampson und ich stießen die Türen unseres Autos auf. »Zur Abschreckung, dass ich nicht lache«, knurrte er.
Jiang zögerte nur einen kurzen Moment. Dann eilte er mit langen, staksigen Schritten, fast so, als trüge er einen knöchellangen Rock, wieder auf das Doppelhaus zu, aus dem er soeben gekommen war. Er hatte sich wahrscheinlich völlig zu Recht überlegt, dass sein Leben auch dann in Gefahr wäre, wenn er den Mercedes noch rechtzeitig erreichte.
Aber wir hatten uns alle getäuscht. Jiang, die Leibwächter, Sampson und ich.
Die Schüsse wurden hinter dem Drogenhändler abgegeben, am anderen Ende der Straße.
Drei laut krachende Schüsse aus einem langen Gewehr.
Jiang sackte zu Boden und blieb regungslos auf dem Bürgersteig liegen. Ein dicker Blutstrahl sprudelte ihm aus der Schläfe, ich bezweifelte stark, dass er noch am Leben war.
Ich drehte mich blitzschnell um und blickte auf das Dach eines Sandsteingebäudes auf der anderen Straßenseite, das mit den Dächern benachbarter Häuser verbunden war.
Dort sah ich einen blonden Mann, und er machte etwas ausgesprochen Seltsames: Er verbeugte sich in unsere Richtung. Ich konnte es nicht glauben. Eine Verbeugung?
Dann duckte er sich hinter eine Backsteinbrüstung und war und blieb verschwunden.
Sampson und ich rannten über die M-Street und in das Gebäude. Wir jagten die Treppe hinauf, vier Stockwerke im Laufschritt. Auf dem Dach angekommen, war der Schütze verschwunden. Weit und breit niemand zu sehen.
War das der irische Killer gewesen? Der Schlachter? Der Mafiaattentäter aus New York?
Wer, zum Teufel, sollte es sonst gewesen sein?
Ich konnte es immer noch nicht glauben. Nicht genug damit, dass er Jiang An-Lo ohne jede Mühe erledigt hatte. Er hatte sich nach diesem Kunststück auch noch verbeugt.
Die englische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Cross (Alex-Cross 12)« bei Little, Brown & Co., New York.
1. Auflage
Taschenbuchausgabe März 2008 bei Blanvalet,einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 2006 by James Patterson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Regine KirtschigMD · Herstellung: Heidrun NawrotSatz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN: 978-3-641-06271-2
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de