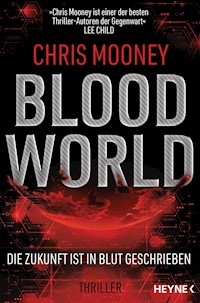
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Es ist nichts Geringeres als eine medizinische Sensation: Durch die Entdeckung eines neuen Wundermittels kann der Alterungsprozess des Menschen aufgehalten werden! Wer das Medikament regelmäßig nimmt bleibt nicht nur ewig jung, er ist auch schöner und stärker als »normale« Menschen. Doch die neue Wunderdroge hat einen Haken: Man braucht dazu das Blut von Menschen, deren DNA eine besondere Sequenz aufweist. Oft werden diese »Träger« entführt und in Blutfarmen gefangen gehalten. Schon ihr ganzes Leben lang hat LAPD-Officer Ellie Battista diesen Praktiken den Kampf angesagt, doch dann bekommt sie es mit einem Gegner zu tun, der sie tief in die dunkelsten Abgründe der Blutkartelle lockt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Ähnliche
Das Buch
Wer wäre nicht gerne wieder so jung, schön, fit und gesund wie früher? Ein neues Serum, gewonnen aus dem Blut von Menschen mit einem ganz bestimmten DNS-Profil, verspricht genau das – wenn man es sich leisten kann. Denn die Transfusionen, die alternden Filmsternchen und reichen Playboys zu einer zweiten Jugend verhelfen, sind illegal, und die Verbrecherkartelle, die Menschen entführen und sie in sogenannten Blutfarmen regelmäßig zur Ader lassen, verdienen Millionen. Das Spitzenprodukt heißt Pandora, doch das Syndikat, das es anbietet, operiert so tief im Untergrund, dass die Polizei mit herkömmlichen Methoden keine Chance hat. Daher beschließt das FBI, die junge Polizistin Ellie Battista undercover in die Blutwelt einzuschleusen. Doch Ellie hat ihre eigenen Gründe, in der Blutwelt zu ermitteln, und je tiefer sie in die dunkle Unterwelt von Los Angeles eintaucht, desto größer wird die Gefahr, dass dieses Geheimnis sie das Leben kosten könnte …
Der Autor
Chris Mooney wurde 1969 in Massachusetts geboren und unterrichtet Kreatives Schreiben in Harvard. Seine Krimis sind nationale und internationale Bestseller und wurden in achtundzwanzig Sprachen übersetzt. Mit Blood World legt er nun sein Science-Fiction-Debüt vor. Chris Mooney lebt mit seiner Familie in der Nähe von Boston.
Mehr über Chris Mooney und seine Werke erfahren Sie auf:
CHRIS MOONEY
BLOOD WORLD
DIE ZUKUNFT IST IN BLUT GESCHRIEBEN
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Urban Hofstetter
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe: BLOOD WORLD
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 08/2021
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2020 by Chris Mooney
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (pluie_r, Vit-Mar)
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-26557-1V001
www.diezukunft.de
Für Jackson, das größte Geschenk
ERSTER TEIL
Dein Reich komme
1
Als Ellie Battista mit dem Streifenwagen auf die Montclair, eine ruhige Straße in Brentwood, einbog, bemerkte sie einen kräftigen Mann, der mit seiner verspiegelten Sonnenbrille und dem schwarzen Anzug wie ein Agent des Secret Service aussah. Er führte einen Jungen in Privatschuluniform zu einem Chevy Suburban mit getönten Scheiben, der am oberen Ende der Auffahrt eines großen modernen Bungalows stand. Der Typ, der ihnen die hintere Tür aufhielt, war noch kräftiger und größer als sein Partner. Vor allem machte Ellie stutzig, dass die beiden Männer sich umschauten, als lauerte irgendwo in der Nähe ein Scharfschütze, und das in diesem Viertel von Los Angeles, wo man höchstens Gefahr lief, neben jemandem zu wohnen, der seine Strafzettel nicht bezahlt hatte.
Ellie war mittlerweile nahe genug, um den nervösen Gesichtsausdruck des Jungen zu bemerken. Sie schaltete das Blaulicht an, verzichtete aber auf die Sirene. Ihr Partner blickte von seinem Smartphone auf. Als er sie die Auffahrt hinaufrasen sah, verdrehte er die Augen.
»Nein«, sagte Danny. »Nicht schon wieder.«
»Entspann dich, Pops, und überlass alles mir.«
Ellie stellte den Streifenwagen quer, damit das SUV nicht entkommen konnte – zumindest nicht über die Auffahrt. Sie konnte den Fahrer nicht sehen, da die Scheiben des Chevys fast schwarz waren, aber wenn jemand hinter dem Lenkrad saß, würde er vielleicht versuchen, quer über den Rasen davonzubrettern.
Seufzend öffnete Danny sein Pistolenholster. »Du erledigst den ganzen Papierkram – und das Mittagessen geht auf dich.«
»Wo?«
»In Jimmy J’s Taco Truck.«
»Hast du dir da nicht eine Lebensmittelvergiftung geholt?«
»Ich glaube, das war ein Magen-Darm-Infekt.«
»Auch nicht viel besser.«
»Das ist der Deal. Ja oder nein?«
Sie öffnete die Tür. »Es ist dein Begräbnis.«
Mit ihren 1,77 Meter war Ellie groß für eine Frau. Der Mann an der Wagentür maß ungefähr zwei Meter und wog wahrscheinlich an die drei Zentner. Ellie fand, dass er wie Vanillepudding in einem billigen Anzug aussah. Er hatte eine winzige Stupsnase und für einen Mann seiner Größe auffallend kleine Hände, doch Ellie bezweifelte nicht, dass er sie damit wie eine Fliege erschlagen könnte.
Inzwischen hatte der Fahrer die Fenster gesenkt. Offensichtlich wusste er, was von ihm erwartet wurde, denn er hatte die Hände oben auf das Lenkrad gelegt.
»Ausweise und Waffenscheine«, sagte Ellie.
Der Vanillepudding seufzte. »Allein in dieser Woche sind wir schon dreimal von Ihren Kollegen aufgehalten worden. Sie behindern uns erheblich in unserer Arbeit.«
Ellie blickte zum Fahrer. »Stellen Sie bitte den Motor ab, Sir, und steigen Sie aus.« An alle drei gewandt fügte sie hinzu: »Legen Sie die Hände auf das Wagendach, wo ich sie sehen kann.«
Danny filzte die Männer. Während er ihre Waffenscheine und Pistolen einsammelte, musterte Ellie den Jungen durch die Gläser ihrer Sonnenbrille. Er sah aus, als wäre er zwischen elf und dreizehn Jahre alt, hatte ein verschwitztes, teigiges Gesicht, strähnige blonde Haare und dunkle Ringe unter den Augen. Er schluckte immer wieder nervös, und sein Blick zuckte über den Boden vor ihm, als hielte er nach versteckten Minen Ausschau.
Ein Träger, dachte Ellie. Bei so vielen Bewachern musste er einer sein. Wenn dieser Junge das Gen hatte, war er eine Menge Geld wert. In der Blutwelt galt die Faustregel: je jünger der Träger, desto wirksamer das Blut. Und daran bemaß sich der Preis der jeweiligen Person. Das Blut diskriminierte niemanden. Egal ob Junge oder Mädchen, schwarz oder weiß, geistig behindert oder ein potenzieller Mensa-Kandidat, ein einziges Kind konnte im Verlauf seines Lebens mehrere Millionen Dollar einbringen. Sofern es nicht um des schnellen Profits willen leer gesaugt und entsorgt wurde. Was heutzutage – zumindest in Kalifornien, wo jeder so rasch wie möglich reich werden wollte – der Normalfall zu sein schien.
»Wie heißt du?«, fragte Ellie.
»Christopher.«
»Christopher – und wie weiter?«
»Christopher Palmer.«
»Schön, dich kennenzulernen. Kennst du diese Männer?«
Der Junge nickte. Er trug Slipper und eine dunkelgraue Hose, dazu ein weißes Hemd mit roter Krawatte sowie ein marineblaues Jackett mit einem Schulwappen auf dem Kragen. Ein Privatschulkind, wohlhabend.
»Du musst es bitte laut aussprechen«, sagte Ellie.
»Ich kenne sie.«
»Droht dir Gefahr?«
»In welcher Hinsicht?«
»Egal in welcher. Bist du ein Träger?«
Vanillepudding, der mit den Händen auf dem Dach des SUV dastand, blickte über die Schulter. »Antworte nicht darauf, Christopher.« Zu Ellie sagte er: »Hören Sie, der Junge kommt zu spät zur Schule. Wir müssen ihn vor zwölf dort abliefern. Er hat heute eine wichtige Prüfung, die er auf keinen Fall versäumen darf.«
»Ich bin mit meiner Befragung noch nicht fertig.«
»Bei allem gebotenen Respekt, Officer, was Sie da treiben – und damit meine ich das ganze LAPD –, ist pure Schikane.«
»Verstehe ich Sie richtig, Sir, dass Sie nicht mit uns kooperieren wollen?«
»Was halten Sie davon, unsere Ausweise und Waffenscheine mitsamt den Pistolen an sich zu nehmen und uns zu überprüfen, während sie uns zur Schule hinterherfahren? Wir setzen ihn ab, und dann können Sie uns so lange mit Ihren Fragen löchern, wie Sie wollen. Ich nenne Ihnen auch die Telefonnummern seiner Eltern. Dann können Sie sie von unterwegs anrufen und sichergehen, dass alles in Ordnung ist.«
»Geben Sie sie mir.«
Die Eltern hießen Cynthia und Francis Palmer. Nachdem Ellie ihre Nummern notiert hatte, zeigte sie den Zettel dem Jungen. »Sind das die Telefonnummern deiner Eltern?«
»Ja«, erwiderte er. »Darf ich mich bitte ins Auto setzen? Es ist wirklich heiß hier draußen.«
Ellie öffnete die Tür für ihn. Dann wandte sie sich wieder zu Vanillepudding um. »Sie fahren voraus.«
Danny setzte sich ans Steuer, sodass Ellie den Laptop im Streifenwagen bedienen konnte. Sie checkte die Ausweise und Waffenscheine der mit Steroiden vollgepumpten Miet-Cops und fragte sich, ob gerade in diesem Moment eine oder mehrere Personen den Jungen beobachteten und einen Entführungsplan ausheckten. Sie bezweifelte zwar, dass auf dem Schulweg irgendetwas geschehen würde, doch in der Schule selbst sah das anders aus. Im letzten Monat hatten mehrere mit Sturmgewehren bewaffnete Männer eine noble private Highschool in Van Nuys gestürmt. Sie hatten zwei Teenager entführen wollen, die das Blutgen trugen. Außer den Männern waren auch zwei Schüler und sechs Angestellte der Highschool getötet worden. Nun diskutierten die Lehrer im ganzen Staat darüber, ob sie sich bewaffnen sollten.
Mit den Leibwächtern und ihren Waffenscheinen war alles in Ordnung. Ellie wählte die Nummern, die sie von Vanillepudding erhalten hatte, der seinem Führerschein zufolge eigentlich Trevor Daley hieß. Sie bekam die Mutter des Jungen ans Telefon, doch die bestand darauf, erst Ellies Identität zu überprüfen, bevor sie ihr irgendwelche Fragen beantwortete.
Ellie konnte es ihr nicht verdenken. Die Familien von Trägern mussten ständig damit rechnen, dass sich irgendjemand ihnen gegenüber als Polizist oder FBI-Agent ausgab. Heutzutage konnte man buchstäblich niemandem mehr trauen.
Als die Mutter fünfzehn Minuten später zurückrief, wirkte sie deutlich entspannter. Ellie stellte ihr eine Reihe persönlicher Fragen und verglich die Antworten mit den Informationen auf dem Bildschirm des Laptops. Auch hier gab es nichts zu beanstanden.
Die St. Devon’s Academy ähnelte eher einem Hochsicherheitsgefängnis als einer Privatschule. Die eleganten modernen Unterrichtsgebäude standen hinter hohen, mit Stacheldraht bestückten Betonmauern. Mittlerweile waren die meisten Schulen von Zäunen oder Mauern umgeben, doch eine Bildungseinrichtung mit einem eigenen Wachturm hatte Ellie noch nie gesehen. Der Anblick des Wächters, der mit einem vollautomatischen Gewehr über ein paar Kindern thronte, die Fußball spielten oder einfach nur rumhingen und so taten, als wäre das alles ganz normal, bedrückte sie.
Wenn es um Träger ging, galten für Polizisten die gleichen Kontrollen wie für gewöhnliche Bürger. Ellie und Danny mussten mehrere Minuten warten, während zwei Männer mit Gewehren immer wieder ihre Ausweise überprüften. Formulare wurden unterschrieben und Fingerabdrücke eingescannt. Schließlich ging das Tor auf, und Danny parkte vor dem Hauptgebäude, das ebenfalls von zwei Bewaffneten bewacht wurde. Ein paar weitere waren an verschiedenen Kontrollpunkten stationiert oder patrouillierten auf dem Gelände und dem Parkplatz.
Vanillepudding kam hinter ihnen zum Stehen. Ellie stieg aus und fragte den Jungen erneut, ob er sich sicher fühle. Er bestätigte das und ging zum Vordereingang, wo er eine Hand auf den tragbaren Fingerabdruckscanner legte, den ihm einer der Wächter entgegenhielt.
»Gefällt Ihnen Ihr Job?«, fragte Vanillepudding.
»Wer mag schon seinen Job?«, entgegnete sie.
Vanillepudding lächelte. Er hatte winzige Babyzähne. »Ich frage, weil meine Firma viele junge Mädchen beschützt. Die würden sich in Gesellschaft einer Frau wohler fühlen.« Er griff in seine Jacke und zog eine Visitenkarte heraus. »Wenn Sie mehr verdienen und eine ordentliche Krankenversicherung haben möchten, rufen Sie mich an.«
Ellie dankte ihm und händigte ihm die Ausweispapiere und Waffen aus. Dann kehrte sie zum Streifenwagen zurück.
»Kannst du mir mal sagen, was dieser Personenkontrollzirkus sollte?«, fragte Danny, während sie davonfuhren.
Ellie zuckte die Achseln. »Wir haben etwas bemerkt und sind stehen geblieben.«
»Wir?«
»Der Junge sah völlig verängstigt aus. Da habe ich beschlossen, mal nachzusehen.«
Danny warf ihr einen Seitenblick zu. Sie wusste, dass er ihr nicht glaubte, und natürlich hatte er damit recht.
Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitete Ellie als Streifenpolizistin beim LAPD, ihr eigentliches Ziel war jedoch die neu gegründete Kommission für Blutverbrechen. Dort sah sie ihre Zukunft. Doch das Auswahlverfahren war extrem hart. Nur die Besten und Klügsten wurden aufgenommen. Ellie hielt sich für einigermaßen intelligent und wusste, dass sie hart arbeiten und im Allgemeinen gut mit Menschen umgehen konnte. Gegen sie sprach allerdings, dass die Blutkommission selbst von niederrangigen Datenanalytikern mindestens zwei Jahre Ermittlungserfahrung verlangte, und die konnte sie nicht vorweisen.
Das war der Grund für ihren Personenkontrollzirkus, wie Danny es nannte. Je mehr Informationen sie über die Blutwelt einholte, desto aussichtsreicher würde ihre erneute Bewerbung bei der KBV sein.
Außerdem hatte Ellie noch einen anderen, persönlicheren Grund, von dem sie weder Danny noch sonst irgendwem erzählen wollte.
Zum Glück wechselte er das Thema. »Hast du je darüber nachgedacht, wie es ist?«
»Ein Träger zu sein?«
»Nein, sich eine Infusion verabreichen zu lassen.«
Ellie zuckte die Achseln. »Ich wüsste nicht, wozu.«
»Das sagst du jetzt noch, weil du jung bist und gut aussiehst. Wie alt bist du noch mal? Vierundzwanzig?«
»Sechsundzwanzig, und damit zwei Jahrzehnte jünger als du, Opa.«
»Ja, warte nur, bis du in die mittleren Jahre kommst. Wenn dein Körper anfängt, sich ohne deine Erlaubnis zu verändern. Alles wird faltig, sackt ab und tut weh. Es ist höllisch deprimierend.« Danny seufzte. »Du weißt, dass das Ganze eine riesige Verschwörung der Regierung ist, oder?«
Ellie schnaubte und rutschte auf ihrem Sitz herum.
»Nein«, sagte er. »Schau mich nicht so an. Ich bin kein Aluhut. Trägerblut gibt es sehr wohl. Das ist eine Tatsache. Es enthält dieses Enzym namens eNAMPT, das Zellen dazu bringt, unglaubliche Energiemengen zu produzieren. Es bewirkt, dass Träger alterslos aussehen und scheinbar jede Krankheit überwinden können. Ich meine, das ist medizinisch nachgewiesen, oder nicht?«
Ellie seufzte. »Ja.«
»Okay, und wir wissen auch, dass eine Transfusion mit Trägerblut allein weder Falten glättet noch Muskeln aufbaut oder sonst irgendeinen wundersamen Effekt hat. Deshalb haben damals Wissenschaftler und Biohacker angefangen, mit Mixturen aus Trägerblut und anderen Medikamenten zu experimentieren. Und sie haben auch eine entdeckt, die gewirkt hat – diese Chemo-Pille, die inzwischen vom Markt genommen wurde, weil sie krebserregend sein soll. Sie hieß Vira-irgendwas.«
»Viramab.«
Danny schnippte mit den Fingern. »Genau. Als Nächstes pilgern die Megareichen in all die ganzheitlichen Zentren, die an der West- und Ostküste wie Pilze aus dem Boden schießen. Sie zahlen mucho dinero, um diese mit Viramab vermischten Trägertransfusionen zu bekommen. Und siehe da: Dieser Mist funktioniert tatsächlich.«
Alles, was Danny bislang gesagt hatte, stimmte zu hundert Prozent. Aber jetzt wird’s gleich wahnwitzig, dachte Ellie.
»Das geht ungefähr ein Jahr lang so«, fuhr er fort. »Und dann macht die Regierung aus heiterem Himmel alles dicht, weil die Leute, die diese Transfusionen bekommen haben, angeblich daran sterben.«
»Angeblich?«, fragte Ellie lachend. Doch dann merkte sie, dass er es todernst meinte. »Diese Leute sind wirklich gestorben, Danny. Die großen Nachrichtenseiten waren voll davon. Nach einer Weile ist ihr Immunsystem zusammengebrochen …«
»Das ist es, was uns die Regierung einreden will.«
»Und du? Meinst du etwa, dass all die berühmten Schauspieler und Industriemagnaten aus der ganzen Welt in Wahrheit von der CIA ausgeschaltet worden sind? Sag mir bitte nicht, dass du an so etwas glaubst.«
»Ich spreche von den Illuminaten.«
»Okay, jetzt reicht’s aber.«
»Hast du letzte Woche in der Times den Artikel über Senator Baker aus Ohio gelesen? Er litt an einer beginnenden Demenz, richtig? Die Leute wollten, dass er zurücktritt. Und jetzt sind die Symptome plötzlich verschwunden …«
»Laut einer anonymen Quelle«, entgegnete Ellie. »Es gibt keine eindeutigen Beweise …«
»Ich bitte dich. Vergleich doch einfach mal die Vorher-Nachher-Bilder. Ihm wurde todsicher Trägerblut gespritzt. Irgendwer hat das Präparat perfektioniert und verabreicht es jetzt an die Reichen und Mächtigen. Vielleicht steckt ein illegaler Produzent dahinter, vielleicht aber auch ein großer Pharmakonzern. Wer weiß? Auf jeden Fall gelten die Gesetze und gesellschaftlichen Normen nur für einfache Leute wie dich und mich. Die wohlhabende Elite hat keinerlei Schwierigkeiten, an dieses Zeug zu kommen. Diese Menschen werden länger leben und sich fortpflanzen, und früher oder später werden sie eine neue Weltordnung schaffen.«
Danny hatte durchaus recht. Das mit der neuen Weltordnung war natürlich Blödsinn, aber es stimmte, dass die privilegierte Elite an Dinge herankam, zu denen die normalen Menschen keinen Zugang hatten. Ellie machte sich keine Illusionen darüber, wie es in der Welt lief, besonders wenn es um Verbrechen ging: Derjenige mit den besten politischen Verbindungen und den smartesten Anwälten hatte das Glück auf seiner Seite. Aber was das Trägerblut und den richtigen chemischen Cocktail betraf – sofern es so etwas überhaupt gab –, war vieles noch unbekannt, da die Forschung auf diesem Gebiet verboten und in den Untergrund abgewandert war. Das Blut der jüngeren Träger war »frischer« und damit – so glaubte man – wirkungsvoller und haltbarer, weswegen nicht nur in Kalifornien, sondern im ganzen Land immer mehr Kinder entführt, eingesperrt und zu einem Leben als goldene Gänse verdammt wurden.
Zumindest nahm man das an. Doch da bisher noch niemand eine dieser berüchtigten »Blutfarmen« gesehen hatte, wie die Medien sie nannten, ließ sich nicht mit Gewissheit sagen, ob sie tatsächlich existierten. Zwei große Kartelle teilten die Blutwelt in L.A. unter sich auf, wobei das Power X der Armenier strukturierter wirkte als das Kartell der Mexikaner, die die Träger mit Vorliebe einfach auszusaugen und zu entsorgen schienen.
»Das Blut, das ich am liebsten versuchen würde«, sagte Danny, »ist Pandora.«
Du und der ganze Rest der Welt, dachte Ellie.
»Lebt wohl, Falten und Bauch. Hallo, glattere und festere Haut, dichtere Haare, stärkere Muskeln und weniger Körperfett. Aber das ist noch nicht alles! Wenn Sie jetzt bestellen, legen wir kostenlos noch die intensivsten Orgasmen obendrauf, die je irgendwer erlebt hat.«
»Wenn Pandora wirklich existiert«, sagte Ellie.
»Die Blutkommission geht davon aus.«
»Aber es gibt keinen Beweis. Es ist noch nie nachgewiesen worden, und man hat auch noch keinen erwischt, der es sich injiziert hat. Soweit wir wissen, könnte man genauso gut an die Existenz von Einhörnern glauben.«
»Jetzt sagst du schon wieder wir.« Danny verdrehte die Augen und grinste. »Das ist der Grund für deine ständigen Personenkontrollen, nicht wahr? Du ermittelst ein bisschen auf eigene Faust, weil du auf etwas Großes zu stoßen hoffst, womit du dir einen Platz in der Bluteinheit sichern kannst.«
Ellie lächelte. »Wie süß. Du bist ja ein richtiger Sherlock Holmes.«
»Daraus wird nichts.«
»Nein, ich glaube auch nicht, dass du das Zeug zu einer guten Spürnase hast.«
»Ich meine deine Stelle bei der Blutkommission.«
Ellie schnürte es die Kehle zu. »Wieso sagst du so etwas? Das ist echt gemein.«
»Weil es die Wahrheit ist. Es geht nicht darum, wie gut oder talentiert du bist, sondern wen du kennst und wem du einen bläst. Und du scheinst mir nicht zu den Leuten zu gehören, die …«
»Danny, pass auf!«
Der vordere Einparksensor des Streifenwagens schlug Alarm. Während das Fahrzeug automatisch abbremste, behielt Ellie den schwarzen Labrador Retriever im Auge, der auf die Straße gerannt war. Anstatt wegzulaufen, blieb er stehen und blickte ihnen mit wedelndem Schwanz entgegen.
Danny wich nach rechts aus. Der Labrador rührte sich nicht. Ellie hörte und spürte, wie die linke Ecke der Stoßstange mit dem Hund kollidierte, und stieß einen leisen Schrei aus. Das Jaulen des Tieres ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren.
Noch bevor der Wagen komplett zum Stillstand kam, stieg Ellie aus und kniete sich neben die Hündin. Danny blinzelte schockiert und blieb hinter dem Lenkrad sitzen. Ellie wusste, dass er an seinen Berner Sennenhund Mickey dachte, der ihm während der letzten Monate seiner Ehe als Einziger Zuneigung entgegengebracht hatte. Dieses Tier war, wie er Ellie mehr als einmal erklärt hatte, sein Rettungsanker gewesen.
»Danny!«
Er stieß die Tür auf und streifte beim Aussteigen mit dem Bauch am Lenkrad. Die Hündin lag keuchend und zitternd auf der Seite, die Augen gegen die Sonne geschlossen. Danny sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden.
»Soweit ich es feststellen kann, hat sie sich nichts gebrochen, und ich entdecke auch keine Risswunden«, sagte Ellie. Das Labradorweibchen wedelte zustimmend mit dem Schwanz. Als Ellie ihr den weichen rosa Bauch streichelte, hörte sie damit auf. »Wahrscheinlich hast du Sasha mit der Stoßstange nur einen Klaps verpasst.«
Danny ließ den angehaltenen Atem entweichen. »Sasha?«
»Laut ihrer Hundemarke heißt sie so.«
An ihrem Halsband befanden sich mehrere Anhänger. Ellie konzentrierte sich auf die Marke, die wie ein roter Hydrant geformt war. Auf der Vorderseite war der Name SASHA eingraviert, zusammen mit einer Telefonnummer und einer Adresse ganz in der Nähe.
Ellie hielt die Marke an den Rändern fest. »Schau dir das mal an«, sagte sie und drehte das Plättchen um, damit Danny die Worte lesen konnte, die jemand mit einem schwarzen Filzstift unter einen blutigen Fingerabdruck geschrieben hatte:
Helft uns.
2
Ellie steckte das Hundehalsband in einen Beweismittelbeutel, für den Fall, dass sie es hier mit einem Verbrechen zu tun hatten. Wovon sie fest ausging. Für eine andere Erklärung war das Ganze viel zu bizarr. Anschließend hievte sie den Hund auf den Rücksitz. Sasha wedelte mit dem Schwanz. Anscheinend hatte sie den Zusammenstoß bereits vergessen. Ellie nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Sie funkte die Zentrale an und klappte den Laptop auf, während Danny zu der auf der Hundemarke eingravierten Adresse fuhr.
Bleeker Street 123 war ein im mediterranen Stil errichtetes Haus, wie man es in den wohlhabenden Vierteln von Los Angeles häufig sah: mit einem flachen roten Ziegeldach, Stuckfassaden, gewölbten Fenstern und schmiedeeisernen Balkonbalustraden. Im Garten, der – zweifellos dank zahlreicher billiger ausländischer Arbeitskräfte – tadellos in Schuss war, stand ein Brunnen.
Um die Vorderseite des Gebäudes wand sich eine Auffahrt. Als Danny parkte, rief Ellie ein paar Hintergrundinformationen über die aktuellen Eigentümer des Hauses auf. Sie zeigte Danny auf dem Bildschirm des Laptops die Führerscheinfotos.
Louis Vargas war neunundfünfzig, was man seinem Gesicht auch überdeutlich ansah: Er hatte dunkle Ringe unter den Augen und schlaffe faltige Haut. Sophia Vargas, die fünfzehn Jahre jünger war als er, hätte dagegen problemlos auch als Ende dreißig durchgehen können: Sie hatte einen makellosen Teint, schwarze Haare und schöne dunkle Augen. Zu keinem der beiden existierten Einträge im Strafregister. Keine Strafzettel, Gesetzesübertretungen oder Gerichtsvorladungen. Keine Kinder. Und keine Meldung über einen vermissten Hund.
Danny ließ den Motor laufen. Bevor er ausstieg, drehte er noch die Klimaanlage voll auf, da sie den Hund fürs Erste hinten im Auto lassen würden. Ellie setzte ihre Sonnenbrille auf, eine Ray-Ban Caravans, und folgte Danny zur Vordertür, die aus massiver Eiche bestand. Er betätigte die Klingel.
Niemand antwortete. Er versuchte es noch einmal. Wieder nichts. Danny wollte gerade klopfen, als sie irgendwo hinter dem Haus ein Plätschern hörten.
»Lass uns mal nachsehen«, sagte Danny.
Ellie nickte.
Während sie die Eingangsstufen wieder hinunterstiegen, besprachen sie ihr weiteres Vorgehen. Ellie ging links um das Haus herum, Danny rechts.
Der Zaun, eine Spezialanfertigung aus Rotholzbrettern mit dazu passendem Durchgangstor, war organisch in das umgebende Strauchwerk eingepasst. Durch die Bretter konnte Ellie in den hinteren Garten sehen. Die Oberfläche des Swimmingpools war von der Person, die bis gerade eben darin geschwommen war, immer noch leicht gekräuselt: ein braun gebrannter, spindeldürrer Junge, der nicht älter als sechzehn sein konnte. Er machte einen auf Surfer, seine langen blonden Haare waren zu einem albernen Dutt hochgebunden.
Der Junge setzte sich auf den Rand einer Sonnenliege, beugte sich vor und tippte etwas in sein Handy. Abgesehen von ihm schien der Garten leer zu sein. Ellie machte das Tor auf und ging unter einem Vordach an der Rückseite des Hauses auf einem Kiesweg entlang. Hinter den bodentiefen Fenstern war ein Großteil des Erdgeschosses zu sehen. Auf dem Esstisch in der angrenzenden Küche stand eine Kühlbox mit offenem Deckel. Ellie sah niemanden im Haus und gab Danny ein Zeichen, dass die Luft rein war. Er ging, die Hand auf der Neunmillimeter in seinem Hüftholster, zur anderen Seite des Gartens hinüber und blieb ungefähr zwanzig Meter von dem Jungen entfernt stehen.
In diesem Moment blickte der Junge auf.
Er sah Ellie, aber nicht Danny.
Der Anblick einer einzelnen Polizistin genügte, um ihn erstarren zu lassen. Sein Blick glitt über den Pool zu der Liege auf der gegenüberliegenden Seite des Gartens. Ihre Rückenlehne befand sich in aufrechter Position, und sie war auf den Zaun ausgerichtet. Ellie konnte nicht erkennen, wer darauf saß; sie sah lediglich einen schlanken gebräunten Frauenarm, der schlaff über eine Seite hing. Von den Fingern tropfte Blut.
Ellie zückte ihre Pistole und wollte hinübergehen, doch Danny bedeutete ihr mit einem Wink stehen zu bleiben. »Bleib bei ihm, und halt die Augen offen.« Dann schaute er den Jungen an. »Und du bewegst deinen Hintern nicht von der Stelle.«
Mit diesen Worten marschierte er, sorgsam darauf bedacht, den Rasen nicht zu zertrampeln, um den Pool herum und ließ den Blick durch den Garten schweifen. Ellie bezog Position an einer Ecke des Pools, von wo sie gleichzeitig den Jungen, das Innere des Hauses und Danny im Auge behalten konnte.
»Mrs. Vargas?«, rief Danny.
Die Frau gab keine Antwort. Ellie sah, dass sie sich auch nicht bewegte, und richtete den Blick wieder aufs Haus. Das Wohnzimmer und die angrenzende Küche waren – soweit sie es feststellen konnte – immer noch leer. Sie dachte an die beiden Wörter auf der Hundemarke – Helft uns – und fragte sich, wer sich wohl in dem Haus aufhielt. Und ob sie beobachtet wurde.
Danny ging inzwischen mit schnelleren Schritten über den Rasen. Ellie glaubte, den Arm der Frau zucken zu sehen.
»Mrs. Vargas?«, rief Danny erneut. »LAPD.«
Als die Frau immer noch keine Antwort gab, wurde Ellie nervös und ging weiter in den Garten hinein, um sie auf der Sonnenliege besser sehen zu können.
Während ihrer kurzen Zeit als Streifenpolizistin hatte Ellie bereits viel verrücktes Zeug erlebt, doch was sie nun sah, übertraf alles: Sophia Vargas – die Frau sah genauso aus wie auf ihrem Führerscheinfoto – trug Ohrhörer. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Mund stand offen, und ihre rechte Hand bewegte sich permanent in ihrem engen schwarzen Bikinihöschen auf und ab, als wollte sie einen Geist aus seiner Flasche rubbeln.
Als Dannys Schatten über ihr Gesicht glitt, schlug sie die Augen auf. Sie sah die blaue Uniform und schluckte – nicht aus Scham, sondern vor Wonne.
»Warten Sie«, sagte sie zu ihm. »Ich bin fast fertig.«
Ellie war wie vom Donner gerührt. Sie erkannte die frische Einstichstelle einer Nadel in Sophia Vargas’ Armbeuge. Die Wunde blutete noch von einer offensichtlich gerade erfolgten Infusion.
»Ma’am«, sagte Danny. »Hören Sie bitte mit dem Masturbieren auf.«
Sophia Vargas schenkte ihm keine Beachtung und bewegte die Finger noch schneller, um den Höhepunkt zu erreichen. Nicht einmal als Danny sich hinunterbeugte und ihr die Hörer aus den Ohren nahm, wurde sie langsamer. Ellie hatte gehört, dass einer der Effekte der Blutbehandlung ein gesteigerter Sexualtrieb in den ersten Stunden nach der Transfusion war. Doch so etwas hatte sie noch nie gesehen.
Sophia Vargas drückte den Rücken durch. Ihre Beine wurden steif, und sie schrie ihre Lust heraus.
Dannys Gesicht wurde rot wie eine Tomate, und er musste sich erst einmal räuspern, bevor er sprechen konnte. »Was ist mit Ihrem Arm geschehen?«
Anstatt zu antworten, sank die Frau atemlos auf die Liege zurück.
Ellie warf erneut einen Blick auf das Haus – das Erdgeschoss wirkte nach wie vor leer –, dann schaute sie zu dem Jungen zurück, der mit den Unterarmen auf den Knien dasaß und sich benahm, als wäre das, was gerade im Garten geschah, nicht weiter bemerkenswert. Als verstünde er nicht, was das Getue solle. Er war zu jung, um ganz allein eine Transfusion zu verabreichen. Hatte er jemandem assistiert? Verbarg sich diese Person – vielleicht waren es sogar mehrere – in diesem Moment im Inneren des Hauses?
Ellie hatte noch nie von einer Blutbehandlung gehört, die in einem Privathaus vorgenommen worden war. Andererseits befanden sie sich in Los Angeles, wo man jederzeit alles bekommen konnte, wenn man imstande war, den entsprechenden Preis zu bezahlen.
»Was ist mit Ihrem Arm passiert, Mrs. Vargas?«, fragte Danny erneut.
»Ich habe Blut gespendet«, sagte die Frau zwischen zwei Atemzügen. »Heute Morgen.«
»Wo?«
Sie leckte sich die Lippen und lächelte. »In einer dieser mobilen Stationen vom Roten Kreuz.«
Schwachsinn, hätte Ellie am liebsten gerufen. Was bezweckte Danny mit diesem Frage-Antwort-Spiel? Er hatte mehr als genug Indizien, um die Frau wegen Verdachts auf eine Trägerbluttransfusion festzunehmen.
Die Schiebetür flog knallend auf. Ellie drehte sich um und sah einen Mann mit freiem Oberkörper herauskommen. Er war groß und muskelbepackt. Seine Brust und die Arme waren mit schlecht gestochenen bunten Tätowierungen bedeckt. Er sah aus, als hätte sich eine ganze Farbpalette über ihn ergossen. Das größte und eigenartigste Tattoo befand sich auf seiner linken Schulter: Es stellte einen Lebkuchenmann dar, der ein blutiges Messer zwischen seinen haifischartigen Zähnen hielt. Die Haut dieses neu hinzugekommenen Mannes war so hell, dass er nicht braun werden konnte. Er hatte Sommersprossen und rotblonde Haare, die militärisch kurz geschnitten waren.
Trotz seines einschüchternden Äußeren fühlte Ellie sich nicht von ihm bedroht. Seine Hände waren leer, und sie sah auch in den Taschen seiner Shorts keine Waffe. Er lächelte, wenn auch ohne jede Freundlichkeit.
»Stimmt etwas nicht, Officers?«, fragte der Lebkuchenmann. Er klang ganz gelassen, als würde er ein paar Partygäste begrüßen. Dann bog er, ohne eine Antwort abzuwarten, nach rechts ab und hielt auf den Grill zu.
Ellie suchte sie aus der Ferne nach Waffen ab.
Danny meldete sich zu Wort: »Sir, ich befehle Ihnen, sofort stehen zu bleiben und …«
Der Lebkuchenmann machte einen Satz vorwärts und packte den Griff an der Abdeckung des Grills. Gleichzeitig langte der Junge, der die ganze Zeit mürrisch seine Füße angestarrt hatte, hinter sich in einen Stoffbeutel.
»Stopp, Hände hoch!«, rief Ellie, während er eine Uzi herauszog. Die Maschinenpistole sah in seiner schmalen Hand viel zu groß aus.
»Runter!«, schrie Ellie und nahm die Schussposition ein, die man ihr während der Ausbildung beigebracht hatte. Doch dies hier war keine Übungsrunde, sondern real, und ihre Karriere und ihr Leben hingen davon ab, was sie als Nächstes tun würde. »Leg sofort das Gewehr auf den Boden!«
Doch der Junge hörte nicht auf sie, und der Lebkuchenmann hatte inzwischen den breiten Deckel des Grills aufgeklappt. Darunter kam eine AR-15 zum Vorschein. Zwei Ziele, beide bewaffnet, an unterschiedlichen Enden des Gartens, und dazwischen eine Zivilistin und ihr Partner. Das waren keine guten Voraussetzungen.
Sie feuerte einen Warnschuss auf den Jungen ab, wobei sie bewusst hoch über seinen Kopf zielte.
»Lass die Waffe fallen!«, schrie sie. »Zwing mich nicht dazu …«
Doch ihr Appell stieß auf taube Ohren. Der Junge hatte die Maschinenpistole bereits in Anschlag gebracht und entsichert.
Ellie ließ sich hinter einer hüfthohen Mauer aus blaugrauen Steinen zu Boden fallen. Die ersten Projektile prallten von ihrer Deckung ab, die nächsten Schüsse zerfetzten den Rasen hinter ihr. Sie saß in der Falle und wusste, dass sie etwas unternehmen musste. Jetzt hieß es alles oder nichts. Ellie befand sich in einem Feuergefecht, ihrem ersten. Sie musste sowohl den Jungen als auch den Lebkuchenmann ausschalten. Eine andere Wahl hatte sie nicht. Sie sprach ein rasches Gebet, in dem sie Gott darum bat, sie zu beschützen, und sprang mit ihrer Waffe in der Hand auf. Ein Kugelhagel bestrich den Garten, und sie sah, wie mehrere Geschosse Dannys Brust zerfetzten.
3
Sebastian vermied jeden persönlichen Kontakt mit seinen Blutkunden. Wenn er erfolgreich bleiben wollte, musste er seine Identität geheim halten. Und außerdem hatte er für so etwas Angestellte. Dennoch hätte er nichts dagegen gehabt, der schönen Italienerin im Behandlungsraum Nummer 3 kurz Hallo zu sagen. Sie war eine Schauspielerin, die er als Jugendlicher sehr gemocht hatte, hieß Isabella Flores und war der Star einer ganzen Reihe von der Kritik verrissener, jedoch ungeheuer erfolgreicher Actionstreifen gewesen, in denen sie eine Dämonenjägerin namens Mistress Knight verkörperte, die des Nachts herumhetzte und Seelen einfing, denen irgendwie die Flucht aus der Hölle gelungen war. Die altmodische .357 Magnum, die sie zu diesem Zweck trug, war mit Patronen geladen, die Luzifer höchstpersönlich herstellte. Sie hatte in den ersten neun Filmen die Hauptrolle gespielt, bevor sie die eine Todsünde beging, die Hollywood unter gar keinen Umständen vergab. Sie war alt geworden.
In ihrem Wikipedia-Profil hieß es, sie wäre fünfzig, und tatsächlich hätte man sie sogar für Ende vierzig halten können. Doch Sebastian hatte herausgefunden, dass sie in Wahrheit zweiundsechzig war. Nach allem, was er sehen konnte, hatte sie nichts an sich machen lassen. Sie füllte das schwarze Krankenhaushemd und die dazu passende Hose sehr ansprechend aus, hatte immer noch dichte schwarze Haare, ein straffes Kinn, volle Lippen und die funkelnden grünen Augen, die ihr mehrere Jahre in Folge den Titel der schönsten Was-auch-immer eingebracht hatten. Sogar noch, als sie zweiundvierzig war – oder um korrekt zu sein: vierundfünfzig.
Sebastian stand auf der anderen Seite des Einwegspiegels. Er trank seinen Kaffee und sah dabei zu, wie diese Frau, die ihm in seiner Jugend unzählige Male als Masturbationsfantasie gedient hatte, im Behandlungsraum auf und ab lief. Normalerweise beobachtete er seine Kunden nicht so gründlich. Und tatsächlich hatte er dafür eigentlich auch keine Zeit, da er an vielen anderen Orten wesentlich dringender benötigt wurde. Der wahre Grund, weshalb er sie beobachtete, war, dass sie ihn an eine Frau erinnerte, mit der er vor langer Zeit zusammen gewesen war und an die er immer noch voller Zuneigung dachte. Vielleicht mit zu viel Zuneigung, wie er sich selbst eingestand. Ava Martinez. Sie war die große Liebe seines Lebens gewesen.
Und war es immer noch.
Dr. Maya Dawson, seine Geschäftspartnerin und Eigentümerin des Dermatologie- und Laserzentrums, in dem sie sich befanden, betrat die geheime Kammer neben ihrem Büro. Ihr Gesichtsausdruck war wie immer ernst. Er erinnerte ihn an den der katholischen Nonnen aus seiner Jugend, die allesamt mürrisch dreinblickende, humorlose Frauen gewesen waren. Allerdings trug Maya im Unterschied zu den Bräuten Christi Geschäftskleidung von Armani. Was er an dieser zierlichen Frau mittleren Alters mit ihren braunen Augen und der mütterlich wirkenden Bobfrisur besonders schätzte, war ihre gelassene Art. Maya gehörte zu jenen Personen, die für alle Probleme eine Lösung parat hatten. Nichts schien sie aus der Ruhe zu bringen.
Doch irgendetwas hatte sie an diesem Morgen erschüttert. Er sah es an ihrem Gesichtsausdruck und der Art, wie sie die Hände hinter dem Rücken verschränkte und das Kreuz durchdrückte, als machte sie sich auf einen Streit gefasst.
»Gut«, sagte sie. »Du bist noch da.«
Zu den Transfusionsterminen ließ Sebastian sich immer blicken. Schließlich zahlten seine Kunden einen irrwitzig hohen Preis für sein Produkt, und er wollte sichergehen, dass alles glattlief. Allerdings vor allem aus Gewohnheit und nicht, weil es wirklich nötig gewesen wäre. Da er ein straffes Regiment führte und außerdem eine gute Hand für die Auswahl des richtigen Personals hatte, kam es nur selten zu Problemen.
Sebastian nickte zu Isabella Flores hinüber. »Wieso ist sie nicht sediert?«
»Das ist sie«, erwiderte Dawson müde. »So ist sie, wenn sie sediert ist.«
Das überraschte Sebastian. Wenn Kunden vor dem Morgengrauen von zu Hause abgeholt wurden, bekamen sie ein Anästhetikum gespritzt. Sobald sie weggetreten waren, wurden sie in einen Lieferwagen gesteckt und hierher verfrachtet, wo man sie aus der Betäubung holte und vor der Behandlung mit Frühstück versorgte. Die Transfusion selbst dauerte fast einen ganzen Tag. Anschließend übernachteten sie in der Einrichtung und wurden vom Personal auf Nebenwirkungen überwacht. Sobald Dawson sie entließ, wurden sie erneut sediert, in den Lieferwagen gepackt und nach Hause gefahren. Und wenn sie in ihren eigenen Betten erwachten, hatten sie nicht die geringste Ahnung, wo sie gewesen waren. Telefone und andere elektronische Geräte der Kunden blieben bei ihnen zu Hause, und sie bekamen am Morgen vor der Transfusion spezielle Kleidung gestellt. Denn Sebastian machte sich immer Sorgen, dass sich ein verdeckter Ermittler der Polizei oder des FBI als Kunde ausgeben und in einem Gürtel, einem Knopf oder einer Schuhsohle eine versteckte Kamera, ein Mikrofon oder ein Ortungsgerät einschleusen könnte. Seinen Hauptkonkurrenten, den Armeniern, war so etwas schon häufiger passiert.
Eigentlich hätte Isabella Flores in diesem Moment wie die anderen beiden Klienten des heutigen Tages sich entspannt oder im Halbschlaf auf dem Operationsstuhl fläzen und geistesabwesend in den Fernseher starren oder Musik hören müssen, während sie auf den Beginn ihrer Transfusion wartete. Doch sie wirkte aufgedreht und lief hektisch auf und ab.
»Sie will sich die Transfusion erst verabreichen lassen, wenn sie sich mit der Person unterhalten hat, die hier das Sagen hat«, erklärte Dawson. »Demjenigen, der dieses Unternehmen leitet – dem Gangster und nicht dem Doktor.«
»Dem Gangster?«
»So hat sie es ausgedrückt.«
»Wieso?«
»Weil sie eine Schauspielerin und verrückt ist.« Dawson setzte seufzend die Brille ab und rieb sich den Nasenrücken. »Wie willst du damit umgehen?«
»Ich werde mit ihr reden.«
Dawson schaute ihn überrascht an. »Du sprichst doch nie mit den Kunden.«
»Das ist ihre erste Transfusion. Sie ist wahrscheinlich nur nervös.«
»Oder sie ist eine von diesen elenden Narzisstinnen, die glauben, dass sich die Welt ausschließlich um sie dreht.«
»Das vermutlich auch.«
Dawson schüttelte den Kopf. »Na, dann viel Spaß.«
Während sich Maya mit klappernden Absätzen entfernte, nahm Sebastian vor der Konsole Platz und betrachtete Isabella Flores erneut durch den Einwegspiegel. Es dauerte einen Moment, bis er den Schalter für die Gegensprechanlage gefunden hatte. Er musste sich keine Mühe geben, seine Stimme zu verstellen, dafür sorgte schon das Mikrofon.
»Guten Morgen, Miss Flores.«
Isabella Flores zuckte zusammen und sah zu dem Deckenlautsprecher direkt über ihr hinauf.
»Können Sie mich gut hören?«, fragte Sebastian. »Oder soll ich lauter machen?«
Die Frau trat mit durchgedrücktem Rücken und gestrafften Schultern direkt vor den Spiegel. Sie sah aus, als hätte sie vor, in einen Boxring zu steigen und ihren Kontrahenten mit einem einzigen Schlag auszuknocken. Sebastian bemerkte eine Spur von Angst in ihrer Haltung – die Unsicherheit eines Menschen, der früher mal unfassbar berühmt gewesen war und dessen Werke inzwischen nur noch im Schnäppchenregal gefunden werden konnten.
»Sagen Sie mir, was Sie beunruhigt, Miss Flores.«
»Sind Sie hier der Verantwortliche?«
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Wie können Sie es wagen, mich hier drinnen wie eine Gefangene einzusperren? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin und wie viel ich Ihnen bezahlt habe?« Sie starrte den Spiegel an und verlangte eine Antwort.
Sebastian hielt es für das Beste, sie so schnell wie möglich in die Schranken zu weisen. Grinsend nahm er das kleine Mikro in die Hand und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Ich habe immer wieder den gleichen Traum«, sagte er. »Er beginnt damit, dass ich am Kopfende einer stattlichen Festtafel sitze, verstehen Sie? Vor mir stehen sämtliche Speisen und alkoholischen Getränke, die ich mir nur wünschen kann, und um den …«
»Ihr Traum interessiert mich einen Scheiß. Ich will …«
»Was Sie wollen, ist nebensächlich, Miss Flores. Wichtig ist nur, was ich möchte. Und ich will, dass Sie aufhören, sich wie ein verzogenes Kind aufzuführen. Eine Frau wie Sie sollte eigentlich wissen, wie man sich benimmt.« Sebastian machte eine kurze Pause und stellte befriedigt fest, dass ihr Blick nicht mehr ganz so streitlustig wirkte. »Ich war gerade dabei, Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Eine wichtige Geschichte. Darf ich fortfahren?«
Sie schwieg – auch wenn ihre bebenden Nasenflügel verrieten, dass sie liebend gern etwas erwidert hätte.
»Okay, dann wieder zurück zu meinem Traum. Die Festtafel ist wie gesagt reich mit Essen und Alkohol gedeckt, und um mich herum stehen, ich weiß nicht, ungefähr ein Dutzend Stühle, und auf denen sitzen tote Menschen. Ich spreche nicht von geschminkten und gut ausgeleuchteten Hollywood-Toten, sondern von echten Leichen. Verwesendes Fleisch, abgerissene Arme und Beine und fehlende Augen – das komplette Programm. Ich erkenne keinen Einzigen von ihnen oder von den anderen, die hinter ihnen sitzen, weil ihre Gesichter – nun, Sie wissen schon – verschwunden sind. Aber bei ein paar kann ich mir aufgrund der Kleidung, die sie tragen, vorstellen, wer sie sind. Ich erinnere mich nicht an ihre Namen oder wieso ich sie getötet habe, aber ich weiß noch, was sie anhatten, als sie starben. Bin ich deswegen verrückt?«
Isabella Flores antwortete nicht. Seine Geschichte, an der nichts erfunden war, hatte sie so sehr von ihrer Selbstbefangenheit abgelenkt, dass er sich nun ihrer ganzen Aufmerksamkeit gewiss sein konnte. »Und wissen Sie, was das andere Verrückte an diesem Traum ist?«, fragte er. »Dass alles voller Fliegen und Maden ist. Die Körper, das Essen. Ich weiß, dass es in dem Raum höllisch stinken muss, aber ich rieche nichts, weil es ein Traum ist. Kennen Sie das?«
»Ob ich was kenne?«
»Den Geruch einer Leiche?«
Sie schluckte empört. »Wieso stellen Sie mir so eine scheußliche Frage?«
»Ich war schon oft von Leichen umgeben, und es ist der allerschlimmste Gestank auf der Welt. Er trifft Sie wie ein Fausthieb in die Magengrube. Das Einzige, was Sie in so einer Situation wollen, ist davonlaufen und sich irgendwo übergeben. Aber in dem Traum esse ich einfach weiter, als wäre es keine große Sache.« Sebastian lachte leise. »Aber das Verrückteste an der Sache kommt erst, wenn ich aufwache. Denn dann bin ich jedes Mal so hungrig, dass ich den ganzen Kühlschrank leer essen möchte. Ganz schön irre, oder?«
Ihr Blick huschte zur Seite, in Richtung Tür.
»O nein«, sagte er. »Das hier ist nicht irgendein schrottiger Film, in dem Sie fliehen können. Niemand wird Sie retten. Das hier ist echt, und es passiert wirklich. Daher müssen Sie sich konzentrieren und meine Frage beantworten.«
»Welche Frage?«
»Über den Traum. Was bedeutet er Ihrer Meinung nach?«
»Ich bin keine Psychiaterin.«
»Sie scheinen eine kluge Frau zu sein. Sie haben doch sicher eine Vermutung.«
»Ich weiß nicht«, sagte sie mit sanfterer, weniger feindseliger Stimme. Nun war sie bereit, sich auf sein Spiel einzulassen.
»Aber Sie sind schlau genug, um zu verstehen, dass es nicht in Ihrem besten Interesse ist, mich und meine Leute so unhöflich und undankbar zu behandeln. Sie sind als mein Gast hier. Wenn ich wollte, könnte sich Sie verhungern oder ganz einfach verschwinden lassen. Natürlich würde es eine Untersuchung geben, aber Tatsache ist, dass dabei nichts herauskommen würde, da niemand weiß, wo Sie sich gerade befinden. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will?«
Ihre Unterlippe zitterte. »Ja.«
»Wollen Sie sonst noch etwas sagen?«
Sie nickte verhalten. »Ich möchte mich für mein Benehmen entschuldigen.«
»Wir verbuchen es einfach als Furcht vor der Transfusion. Es ist Ihre erste, richtig?«
»Ja. Woher weiß ich, dass ich wirklich Pandora und nicht irgendein … Imitat oder etwas ganz anderes bekomme?«
»Sind Sie deswegen so nervös, Miss Flores?«
»Deshalb und wegen ein paar anderer Fragen, die ich habe.«
Sebastian beschloss, weiter auf sie einzugehen. Er hatte noch viel Zeit bis zu seinem nächsten Termin in Pacific Palisades, wo er jemandem ein Haus zeigen würde. Offiziell arbeitete er als Makler.
»Was halten Sie davon, wenn Sie sich hinsetzen und ich Ihnen alle Fragen beantworte, bis Sie vollkommen zufrieden sind? Wollen wir es so machen?«
»Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen.«
»Aber das ist doch selbstverständlich.«
Sie nahm sichtlich eingeschüchtert auf der Seite des Operationsstuhls Platz und umklammerte die Kante der Sitzfläche mit beiden Händen. Ihre Arme zitterten ein bisschen, ihre Fingerknöchel traten weiß hervor.
»Also, Sie haben nach Pandora gefragt – oder genauer gesagt, wie Sie sicher sein können, dass Sie das echte Mittel verabreicht bekommen«, wiederholte Sebastian. »Das ist eine sehr gute Frage, die wir häufig zu hören bekommen. Die Antwort lautet, dass Sie es nicht sicher wissen können. Aus Gründen, die ich Ihnen nicht weiter erklären muss, gibt es keine offizielle Freigabe der FDA oder irgendetwas in der Art.«
»Dann muss ich Ihnen also einfach glauben.«
»Ja.«
»Die Medikamente, mit denen Sie Ihr Trägerblut versetzen …«
»Sind alle legal und völlig sicher.«
»Und welche sind es?«
Das würden Sie wirklich zu gerne wissen, oder?, dachte Sebastian mit einem Grinsen. Die Leute wären überrascht, wenn sie erführen, dass sein Erfolgsrezept aus einem handelsüblichen Diabetesmittel und einem Generikum bestand, das die Abstoßung von Spenderorganen verhinderte. Aus diesen beiden Präparaten und noch einer Spezialzutat. Um zu verhindern, dass staatliche Überwachungsstellen Verdacht schöpften, ließ Sebastian die Medikamente aus Kanada und anderen Ländern einschmuggeln.
»Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was in meinen Körper injiziert wird«, sagte sie.
»Sie müssen sich unser Unternehmen wie Coca Cola vorstellen. Die geben ihre geheime Formel auch nicht aus der Hand.«
»Das ist keine Antwort.«
»Stimmt, aber eine andere bekommen Sie nicht. Ich versichere Ihnen, dass die Medikamente sicher sind und so gut wie keine Nebenwirkungen haben.«
Er sah, dass seine Worte sie nicht beruhigten.
»Sie müssen es nicht tun«, sagte Sebastian. »Wenn Sie Ihre Meinung ändern, wozu Sie natürlich jedes Recht haben, werde ich Ihnen Ihr Geld zurückzahlen. Aber wenn Sie einmal Nein sagen, dann bleibt es dabei. Das ist die Regel. Wir werden Sie kein zweites Mal einladen. Und Sie haben wirklich ganz schön lange auf diesen Termin gewartet.«
»Beinahe zwei Jahre«, sagte sie leicht entrüstet. Ihre Einstellung wunderte ihn nicht. Viele berühmte und einflussreiche Frauen glaubten, sie hätten ein Recht darauf, sofort behandelt zu werden, anstatt sich zusammen mit dem gemeinen Volk hinten einreihen zu müssen.
»Würden Sie gerne gehen, Miss Flores? Wenn ja, sagen Sie es mir bitte jetzt, damit ich die entsprechenden Schritte einleiten kann.«
»Und was sind die Nebenwirkungen?«
»Wurden Sie darüber denn nicht aufgeklärt?«
»Doch. Ich möchte es nur gern noch einmal hören, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Keineswegs. Die Transfusion wird ungefähr vier Stunden dauern. Während dieser Zeit werden Sie höchstwahrscheinlich Hitzewallungen und vielleicht auch Kältegefühle empfinden, wie man sie von einer schweren Grippe kennt. Ihre Vitalwerte werden natürlich überwacht, und es wird die ganze Zeit jemand hier sein und auf Sie aufpassen. Wenn alles vorbei ist, werden Sie sich müde und erschöpft fühlen. Sie werden heute Nacht als mein Gast hierbleiben und nach einer Untersuchung morgen früh entlassen werden, wenn aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht.«
»Was ist mit Blutmalen?«
»Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen«, sagte Sebastian. »Bei keinem einzigen meiner Kunden haben sich welche gebildet.« Es stimmte. Blutmale – winzige rote Wundstellen, die sich in wabenartigen Mustern überall auf dem Körper ausbreiteten, vor allem auf dem Gesicht und der Brust sowie im Inneren des Mundes, den Nebenhöhlen und dem Anus – waren ein eindeutiger Hinweis auf eine schwere und tödliche Autoimmunerkrankung gewesen. Ausgelöst von einem Chemotherapeutikum, das inzwischen vom Markt genommen worden war. Die Thrombozytenzahl der ersten Blutsucher hatte sich in Folge der Transfusion so stark verringert, dass sie Gefahr liefen zu verbluten. Deswegen mussten sie sich – ironischerweise – massiven Chemotherapien unterziehen.
Den meisten von ihnen war es dennoch nicht gelungen, dem Tod zu entrinnen.
Sebastian trank einen Schluck Kaffee. »Was Sie in den nächsten Tagen erleben werden, bezeichnen die meisten meiner Kunden als Wiedergeburt. Es wird Ihnen vorkommen, als wären Ihre Sinne neu gestartet worden. Farben und Geschmack werden Sie außerordentlich intensiv wahrnehmen. Das Gleiche gilt für Geräusche und Berührungen. Sind Sie verheiratet?«
»Um Gottes willen, nein.«
»Treffen Sie sich mit jemandem? Leben Sie in einer festen Beziehung? Ich frage nur, weil die meisten meiner Kunden während des ersten Monats von zum Teil massiv gesteigerter sexueller Erregung berichten. Wir sagen das vorab, damit sie ihre Partner darüber informieren können. Alleinstehenden raten wir dringend, während dieser Zeit von sexuellen Handlungen abzusehen, die sie später bereuen könnten. Damit kommen wir zu den körperlichen Vorzügen – straffere Haut, festere Muskeln, dichtere Haare und mehr Energie. All das werden Sie nach ungefähr fünfzehn Tagen an sich feststellen. Sie werden auch besser schlafen. Vieles davon hängt natürlich von Ihrem persönlichen Lebenswandel ab – Ihrer sportlichen Betätigung, der Ernährung und so weiter. Rauchen Sie?«
»Nein.«
»Sehr gut. Wie sieht es mit Alkohol aus?«
»Hier und da mal ein Glas Wein.«
»Daran ist nichts auszusetzen. Wir empfehlen unseren Kunden, ein gesundes und aktives Leben zu führen, um das Maximum aus Pandora herauszuholen. Wenn Sie das tun – und angesichts Ihres guten körperlichen Zustands sehe ich da kein Problem –, können Sie die nächste Behandlung in ungefähr fünf oder sechs Monaten bekommen. Wenn Sie in der Zwischenzeit mit dem Rauchen anfangen, flaschenweise Wein trinken oder krank werden, raten wir zu vierteljährlichen Transfusionen.«
»Und wenn ich mich gegen weitere Transfusionen entscheide?«
»Dann werden Sie Entzugserscheinungen haben. Es wird sich wie die schlimmste Grippe aller Zeiten anfühlen. Nichts Lebensbedrohliches, aber extrem unangenehm. Haben Sie noch irgendwelche anderen Fragen?«
»Das Blut, das ich bekomme …?«
»Ist das Beste, das es auf dem Markt gibt«, erwiderte er. »Deswegen haben wir so eine lange Warteliste. Wir zapfen das Blut am Morgen vor der Transfusion, damit es ganz frisch ist. Es enthält keinerlei Chemikalien oder Konservierungsstoffe.«
»Ich würde gern etwas über die – Sie wissen schon – die Spender erfahren.«
»Was möchten Sie über sie wissen?«
»Behandeln Sie sie gut?«
Sebastian war davon ausgegangen, dass ihre Nervosität von ihrer Furcht vor dem Tod herrührte oder ihrer Angst, zu einer alten Frau zu werden, die nicht mehr länger für ihre jugendliche Strahlkraft, Schönheit und sexuelle Ausstrahlung bewundert wurde. Oder dass sie, wie Maya vermutet hatte, eine waschechte Narzisstin war. Was er nicht bei ihr vermutet hatte, waren Gewissensbisse.
»Die Person, die Ihnen dieses Blut gibt«, sagte er, »tut das freiwillig. Hand aufs Herz.«
»Aber behandeln Sie sie gut?«
»Nein«, entgegnete er. »Ich behandle sie sehr gut.«
Sie blickte beschämt zu Boden. »Ich will mein Leben behalten«, sagte sie.
Sebastian ahnte, dass sie noch mehr zu sagen hatte, und so war es auch.
»Ich habe nämlich ein wirklich großartiges Leben. Nächsten Monat werde ich durch Ägypten reisen – ich kann es gar nicht erwarten, die Pyramiden zu sehen –, und dann kehre ich wieder nach Frankreich zurück, wo ich, so Gott will, einen wesentlich jüngeren Mann kennenlernen werde, der die Gesellschaft einer viel älteren, aber hoffentlich immer noch sehr vitalen Frau genießen will.«
»Dieser Mann wird sich sehr glücklich schätzen können, Miss Flores.«
»Ich bin extrem oberflächlich. Das ist der einzige Vorteil daran, wenn man älter wird: dass man weiß, wer und was man wirklich ist. Und weil ich so oberflächlich bin, vermisse ich es, jung und schön zu sein. Ich liebe junge und schöne Dinge. Macht mich das zu einer furchtbaren Person?«
»Nein«, sagte Sebastian. »Das macht Sie zu einem Menschen.«
Am späteren Vormittag dachte er, ohne genau zu wissen, warum, immer noch über Ava nach. Er hatte sie seit rund zwölf Jahren nicht mehr gesehen, doch während er nun eine knochige Blondine mit blauen Augen namens Celine Marcus durch ein Strandhaus in Pacific Palisades führte, stand ihm immer wieder Avas Zuhause vor Augen, das in Hollywood Hills West hoch über dem Sunset Boulevard thronte. Er fragte sich, ob sie immer noch dort wohnte.
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis war er häufig dorthin gefahren – erst nur nachts und dann, als er mutiger wurde, auch tagsüber. Er entdeckte Stellen, an denen er sie unbehelligt mit einem Fernglas ausspähen konnte, und beobachtete sie stundenlang, während sie sich im Haus aufhielt, im Garten arbeitete oder sich im Pool vergnügte. Manchmal folgte er ihr, wenn sie Erledigungen machte, zu denen sie oft ihre Tochter mitnahm. Er näherte sich ihr nie, denn was hätte das bringen sollen? Während er im Gefängnis gewesen war, hatte sie geheiratet und ein Kind bekommen. Sie hatte ohne ihn weitergemacht.
Fünf Jahre lang hatte er ihr hinterherspioniert und das Bedürfnis gehabt, sich selbst für etwas zu bestrafen, das ihm genommen worden war – was, wie er später begriff, erklärte, wieso er sich von einem starken Trinker zu einem ausgewachsenen Alkoholiker entwickelt hatte. Bis sein Kindheitsfreund Frank intervenierte. Er überredete Sebastian zu einem neunzigtägigen Entzug und brachte ihn zu den Anonymen Alkoholikern. Frank wusste, wie besessen Sebastian von Ava war, und irgendwann gestand er es auch dem Mann, der bei den Anonymen Alkoholikern sein Sponsor war. Die beiden erklärten ihm, dass er sich, auch ohne einen Tropfen zu trinken, wie ein Alkoholiker verhalte, und dass er nur Fortschritte machen könne, indem er seine Vergangenheit – seine Gefängnisstrafe und das Leben, das er verloren hatte – ein für alle Mal begrub. Was bedeutete, dass er auch Ava hinter sich lassen musste.
Und das tat er.
Zumindest hatte Sebastian das geglaubt. Doch weshalb ging sie ihm dann nun durch den Kopf? Wieso dachte er an das letzte Mal zurück, als er sie gesehen hatte? Nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern durch ein Fernglas – was er niemandem, nicht einmal Frank erzählt hatte, da er wusste, dass er dann wie ein übler Perverser gewirkt hätte, auch wenn er sie niemals beim Entkleiden beobachtet hatte. Das wäre falsch gewesen. Es war ihm niemals um Sex gegangen. Er hatte sie beobachtet, weil …
»Ich liebe es, wie das Sonnenlicht das Zimmer erfüllt«, sagte Celine Marcus. Ihr Stimme hallte in dem riesigen kühlen Raum wider. Die derzeitigen Eigentümer hatten sich gezwungen gesehen, ihr gesamtes Mobiliar auf einen Schlag zu verkaufen. »So schön und so friedlich.«
»Absolut.«
Celine wandte sich zu den Panoramafenstern um, die auf den mit dichtem Rasen bewachsenen Garten samt Pool und eigenem Spa-Bereich sowie die großzügig bemessene Essecke auf der überdachten Terrasse hinausblickten. Sebastians Gedanken kehrten derweil wieder zu der Nacht zurück, in der er Ava zum letzten Mal gesehen hatte. Er hatte beobachtet, wie sie sich fürs Bett fertig machte und mit vom Duschen feuchten Haaren aus dem Badezimmer kam. Sie trug graue Männershorts und ein dazu passendes Trägeroberteil. Ihre kolumbianische Haut war sonnengebräunt, ihre sinnlichen Kurven muskelgestählt. Sie legte sich auf das übergroße Doppelbett, das oft leer war, da ihr Mann, irgend so ein Hedgefond-Trottel, die meisten Abende ausging, um Klienten bei Laune zu halten – und Sebastian dachte: Ich sollte dort neben ihr liegen. Er hätte sein Leben mit ihr verbracht, wenn der Richter ihn nicht ins Gefängnis geschickt hätte, weil er jemanden totgeschlagen hatte – auch wenn es Notwehr und ein Unfall gewesen war.
»Diese Architektur«, sagte Celine, »ist wunderschön.«
Während der ersten beiden Monate hatte Ava ihn jeden Samstag besucht, doch dann hatte sie einen schweren Autounfall gehabt, bei dem sie sich ein Bein brach und am Rückgrat verletzte, und war nicht mehr gekommen. Das Gefängnis erlaubte ihm keine Telefonate, außer um seinen Anwalt zu kontaktieren, und er durfte auch keine E-Mails schreiben, aber die gute alte Post war gestattet, und so schickte sie ihm Briefe – zuerst mehrseitige und dann, am Ende des vierten Monats, nur noch kurze und unverbindliche Informationen über die wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben, wie man sie auch aus Pflichtgefühl einer weit entfernt lebenden Tante oder Cousine zukommen lassen würde. Als er die ersten fünf Monate seiner lebenslänglichen Haftstrafe abgesessen hatte, kamen die Briefe bloß noch tröpfchenweise und blieben schließlich ganz aus. Und sie besuchte ihn auch nicht mehr.
Seine Mutter sah dagegen jeden Samstag nach ihm. Irgendwann konnte sie die Fahrt jedoch nicht mehr auf sich nehmen, da ihr Knochenkrebs zu weit fortgeschritten war. Von da an chauffierte Frank sie. Und als seine Mutter ihn gar nicht mehr besuchen konnte, kam Frank allein. Frank war es auch, der ihm erzählte, dass Ava mit einem anderen Mann zusammengezogen war. Dass sie geheiratet hatte. Dass sie schwanger war.
Sein Handy vibrierte. Er hatte eine Textnachricht erhalten.
Sie war von Frank und bestand aus drei Wörtern: Ruf schnellstmöglich zurück.
»Würden Sie mich bitte einen Moment entschuldigen, Mrs. Marcus?«
Sebastian ging durch die Vordertür hinaus. Während er sich das Handy ans Ohr hielt, hörte er in der Ferne Wellen rauschen. Frank hob sofort ab.
»Was ist los?«, fragte Sebastian.
»Nicht was, sondern wer. Dein Stiefsohn.«
Sebastian stellten sich die Nackenhaare auf. Er mochte es nicht, wenn Frank – oder sonst irgendwer – diesen Begriff gebrauchte. Paul war nicht sein Stiefsohn – nicht in rechtlicher Hinsicht. Er war bloß mit Trixie mitgekommen, als sie bei ihm einzog … Herrje, wie lange war das inzwischen her? Sebastian wurde bewusst, dass seitdem zweiundzwanzig Jahre vergangen waren. Paul war damals zwei gewesen und hatte noch Windeln getragen. Trixie und er hatten nie geheiratet, sondern einfach nur bis zu dem Tag, als sie starb, zusammengelebt. Demnächst würde sich ihr Tod zum ersten Mal jähren, jener Zeitpunkt, als Trixie ihn mit ihrem inzwischen vierundzwanzigjährigen Sohn voller hässlicher Tattoos, unangemessener Wut und unverhältnismäßig aufgeblähtem Selbstbewusstsein im Stich gelassen hatte.
»Wie schlimm ist es?«
»Wenn ich es dir erzählt habe«, sagte Frank, »wirst du seinen Grabstein bestellen wollen.«
4
Ellie sagte zu dem Sanitäter, sie glaube, sich jeden Moment übergeben zu müssen.
»Kein Problem«, erwiderte er. Sein Name war Brad. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein, Anfang bis Mitte zwanzig, und er hatte ein jungenhaftes, fast engelsgleiches Gesicht. Er ließ seine perfekten weißen Zähne zu einem Lächeln aufblitzen und reichte ihr eine große Spucktüte. »Übelkeit ist ein ganz normales Symptom nach einem Adrenalinabfall, wie Sie ihn gerade erlitten haben.«
Genau wie Tränen, nahm sie an. Ellie sagte ihm nicht, wie sehr sie sich wünschte, dass er aus dem Ambulanzwagen ausstieg und die Tür hinter sich schloss, damit sie zusammenbrechen und sich die Augen ausweinen konnte.
Doch sie würde nicht heulen – konnte nicht heulen. Eine Frau, die im Dienst beim Flennen erwischt wurde, würde sofort als schwach und unzuverlässig abgestempelt werden – sogar wenn sie weinte, weil gerade ihr Partner ermordet worden war. Denken Sie immer daran, nur in Ihrer Freizeit zu trauern, hatte eine beim LAPD bekannte Ermittlerin sie einmal gewarnt. Wenn Sie weinen oder überhaupt irgendeine Emotion erkennen lassen, werden die Jungs Sie nie wieder mit den gleichen Augen betrachten. Sie werden automatisch davon ausgehen, dass Sie nicht durchhalten, wenn es hart auf hart kommt.
Bislang hatte sie sich während der quälenden Prozeduren, die auf die Schießerei folgten, zusammengerissen und ihren Vorgesetzten gefasst über alle Einzelheiten ins Bild gesetzt.
Ihr Stimme war nicht ein einziges Mal gebrochen, nicht einmal als sie den beiden Ermittlern des »Erschießungskommandos« gegenüber eine offizielle Stellungnahme abgeben musste. Sie protestierte nicht, als sie ihre Pistole eintüteten und als Beweismittel sicherten oder eine Blutprobe von ihr verlangten, um zu überprüfen, ob sie unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss gestanden hatte, als sie die Waffe abfeuerte.
Doch nun hatte sie das Gefühl, sich an den Rändern aufzulösen.
Brad checkte noch einmal ihren Blutdruck. »Immer noch ein bisschen niedrig, aber nicht schlimm«, stellte er fest. »Auch das ist nach allem, was Sie durchgemacht haben, völlig normal.«
Plötzlich schwang die Hecktür auf, und ein heißer Luftschwall voll schriller Geräusche drang herein – eine Kakophonie aus laut knisternden Polizeifunkgeräten und Stimmen, die einander zu übertönen versuchten. Außerdem hörte Ellie einen Helikopter, möglicherweise auch mehrere, die irgendwo über ihnen schwebten.
Ein Streifenbeamter, den sie nicht kannte, bedeutete ihr auszusteigen. »Der Commissioner ist hier und will Sie sehen.«
»Eins noch, bevor Sie gehen«, sagte Brad. »Ihr Blutdruck und Ihr Puls können jederzeit absacken. Wenn Sie sich benommen fühlen, setzen Sie sich also bitte sofort hin. Es kann nämlich durchaus passieren, dass Sie das Bewusstsein verlieren.«
Ellie dankte ihm und stieg aus. Überrascht nahm sie zur Kenntnis, wie sehr sich die Umgebung während der zwei Stunden, die sie isoliert im Rettungswagen gesessen hatte, verändert hatte. Sie sah Dutzende Streifenwagen mit blinkenden Blaulichtern und Menschen – größtenteils Reporter, wie sie vermutete –, die sich hinter Absperrungen drängten. Am Himmel knatterten die Hubschrauber der Nachrichtensender. Sie machten Luftaufnahmen vom Garten hinterm Haus und dem Chaos auf den umgebenden Straßen. An der Vordertür war ein Streifenpolizist postiert. Seine einzige Aufgabe bestand darin, die Namen aller zu notieren, die das Haus betraten. Ellie entdeckte noch zwei weitere Beamte, die mit einem Klemmbrett in den Händen am Zaun standen und die Zugangstore bewachten. Auch wenn diese Maßnahmen völlig übertrieben wirkten, war es immer besser, das Chaos so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten – und gegenüber einer Jury schriftlich belegen zu können, dass man sich bei der Sicherung des Tatorts keine Schlampereien geleistet hatte.
In aller Regel hielten sich Commissioner von Tatorten fern und konzentrierten sich stattdessen auf die wirklich wichtige Arbeit: Sie kümmerten sich um die Bürokratie, hielten Kontakt zu den Politikern und bemühten sich, ein möglichst gutes Bild im Fernsehen abzugeben. Im Grunde waren sie keine Cops, sondern Verwaltungsbeamte, und wo immer sie auftauchten, folgten ihnen die Medien auf dem Fuß.
Aber es gab Ausnahmen, zum Beispiel Polizistenmorde, oder wenn ein Verbrechen großes öffentliches Interesse erregte, das der Presse angemessen vermittelt werden musste. Auf den Vorfall in Brentwood traf beides zu: ein Cop, der im Zusammenhang mit einem Blutverbrechen in einer der sichersten und teuersten Wohngegenden in Los Angeles getötet worden war – so etwas hatte es definitiv noch nie gegeben. Kein Wunder also, dass der Commissioner hier war.
Kelly war leicht zu entdecken, ein zwei Meter großer Berg von einem Mann, der auf der Grasfläche neben dem Haus – dort, wo Danny den Garten betreten hatte – auf und ab tigerte. Als Ellie sich ihm näherte, bemerkte sie, dass er ein Telefon ans Ohr presste. Er trug einen sandfarbenen Anzug mit schicker Krawatte und eine rahmenlose Brille, deren Gläser seine durchdringenden blauen Augen vergrößerten.
Sie war dem Commissioner nie persönlich begegnet, hatte aber gehört, er sei ehrlich und hart und dulde kein leeres Geschwätz. In seiner Zeit als Deputy Chief hatte er wegen seines Talents, korrupte Cops aufzuspüren, den Spitznamen »der Rattenfänger« verpasst bekommen.
Kelly erklärte seinem Gesprächspartner, dass er das Telefonat beenden müsse, und legte auf.
»Erzählen Sie mir Schritt für Schritt, was passiert ist«, sagte er. Dann hielt er inne, als dächte er noch mal über seine Worte nach, und musterte sie kurz von Kopf bis Fuß. »Fühlen Sie sich dazu in der Lage?«
»Ja.«
»Gut.«
Sein Tonfall gab Ellie das Gefühl, eine Art Test bestanden zu haben.
»Haben wir hier schon irgendwelche Fortschritte gemacht, Sir?«
»Wir haben einen Fahndungsaufruf für den Wagen und den Schützen rausgegeben und ein paar Helikopter in der Luft, die ihn suchen, aber bislang ohne Ergebnis.«





























