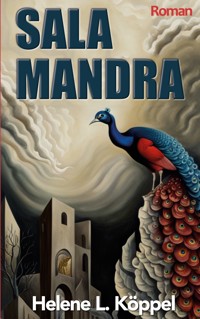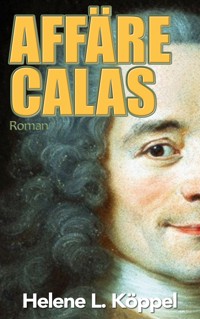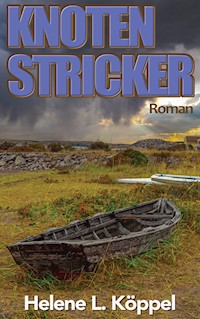6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Und die Wespen stachen, ganz wie es mir mein Anwalt prophezeit hatte ... Ein einsam gelegenes Hotel in den Pyrenäen. Irritiert beobachtet die Nürnbergerin Steffi Conrad, wie ein Mann mitten in der Nacht das Hotel verlässt. Auf seinen Schultern eine junge, leblos wirkende Frau in einem rosa Kleid. Als Steffi sich am nächsten Tag auf die Suche nach ihr macht, gerät sie in einen Sog aus Lügen und Täuschung, der sie selbst in höchste Gefahr bringt. Ein fesselnder Thriller, der bis in das zerstörte Berlin von 1945 zurückreicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frühling 1946 (für Cordelia)
»… Aus dem Reich der Kröte steige ich empor, unterm Dach noch Plutons Röte und des Totenführers Flöte grässlich noch im Ohr.
Sah in Gorgos Auge eisenharten Glanz, ausgesprühte Lügenlauge hört’ ich flüstern, dass sie tauge mich zu töten ganz …«
Elisabeth Langgässer, aus »Frühling 1946 (für Cordelia)
(Ein Dankeschön an die Familien Hoffmann und Grüttner für die Überlassung der Nutzungsrechte an dem Gedichtauszug »Frühling 1946 (für Cordelia) von Elisabeth Langgässer.)
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1: DER TAG DES SCHABBATS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
TEIL 2: BLUT. ROTE. ROSEN.
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
TEIL 3: DAS BLAUE BUCH
Aufzeichnungen
Sechster Juni 1944 (Obersalzberg)
Achter Juni 1944 (Obersalzberg)
Neunter Juni 1944 (Obersalzberg)
Zehnter Juni 1944 (Obersalzberg)
Zehnter Juni 1944 (Obersalzberg)
Elfter Juni 1944 (Obersalzberg)
Zwölfter Juni 1944 (Obersalzberg)
Dreizehnter Juni 1944 (Obersalzberg)
Zweiundzwanzigster Juni 1944 (Obersalzberg)
Dreiundzwanzigster Juni 1944 (Obersalzberg)
Neunundzwanzigster Juni 1944 (Obersalzberg)
Siebter Juli 1944 (Obersalzberg)
Dreizehnter Juli 1944 (Obersalzberg)
Vierzehnter Juli 1944 (Obersalzberg)
Zwanzigster Juli 1944 (Obersalzberg)
Einundzwanzigster Juli 1944 (Obersalzberg)
Zweiundzwanzigster Juli 1944 (Obersalzberg)
Dreißigster Juli 1944 (Obersalzberg)
Siebenundzwanzigster September 1944 (Obersalzberg)
Fünfzehnter Oktober 1944 (Obersalzberg)
Vierundzwanzigster Oktober 1944 (Obersalzberg)
Achter November 1944 (München)
Zweiundzwanzigster November 1944 (Berlin)
Dreiundzwanzigster November 1944 (Berlin)
Siebter Dezember 1944 (Obersalzberg)
Anno Domini 1945
Dritter Januar 1945 (Obersalzberg)
Neunter Januar 1945 (Obersalzberg)
Sechzehnter Januar 1945 (Obersalzberg)
Erster Februar 1945 (Berlin)
Dritter Februar 1945 (Berlin)
Fünfter und Sechster Februar 1945 (Berlin)
Siebter Februar 1945 (Berlin)
Zehnter Februar 1945 (München)
Neunter März 1945 (München)
Fünfzehnter März 1945 (Berlin - im Führerbunker)
Neunzehnter März 1945 (Berlin)
Siebenundzwanzigster März 1945 (Berlin)
Neunundzwanzigster März 1945 (Berlin)
Vierter April 1945 (Berlin)
Fünfter April 1945 (Berlin)
Kapitel 35
Fünfzehnter April 1945 (Berlin)
Achtzehnter April 1945 (Berlin)
Neunzehnter April 1945 (Berlin)
Einundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Einundzwanzigster April 1945, (Berlin)
Zweiundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Dreiundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Kapitel 36
Vierundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Sechsundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Kapitel 37
Achtundzwanzigster/ Neunundzwanzigster April 1945 (Berlin)
Kapitel 38
Pauline Wolf, meine Flucht aus Berlin
Pauline Wolf, mein Aufenthalt in Spanien
Kapitel 39
Pauline Wolf, meine Flucht zurück über die Pyrenäen
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
TEIL 1
DER TAG DES SCHABBATS
1
Stefanie Conrad, Saint-Bertrand-de-Comminges
Dächer im Regen, Saint-Bertrand-de-Comminges
»Schlag dir die Frankreichreise aus dem Kopf, Schatz«, riet mir Theo beim Packen seines Aktenkoffers – mit einer Dringlichkeit, die mich erschreckte. »Bleib hier. Oder geh hinauf nach St. Peter Ording, wo dich jeder kennt und man aufeinander achtgibt.«
Die Bitte meines Mannes stürzte mich in einen Konflikt, denn ich hatte mit meiner Freundin Mareike für Frankreich längst alles festgemacht. »Allmächt’, Theo!« Ich funkelte ihn ärgerlich an und versuchte zwei Haare von seinem anthrazitfarbenen Anzug zu entfernen. »Du selbst fliegst erneut für Monate nach Shanghai, und ich soll die ganze Zeit über in Deutschland bleiben? Außerdem war ich in Frankreich nie in Gefahr!«
»Lass das, bitte!« Theo drückte meinen Arm beiseite; er hasste es, wenn man an ihm herumzupfte. »Nie in Gefahr? Bestimmte Leute vergessen nie ein Gesicht!«
Ich wusste natürlich, worauf er anspielte, aber um zu diskutieren fehlte die Zeit. Daher antwortete ich nicht, lehnte mich nur an den Türrahmen und beobachtete ihn. Er sah wirklich bekümmert aus, grau im Gesicht, müde. Offenbar hatte er wieder bis spät in die Nacht hinein gearbeitet.
»Ich appelliere nochmals an deine Vernunft, Steffi«, fuhr er fort, gewissenhaft seine Papiere ordnend. »Bleib im Land. Wenn ich zurückkomme, spätestens im Herbst, fliegen wir wie ausgemacht nach New York und lassen es uns dort gutgehen.«
Gewohnt, seit Jahren selbst die Maßstäbe zu setzen, mit denen ich meinen Alltag einrichtete, lag es mir auf der Zunge zu fragen, wie man es sich ausgerechnet in New York gutgehen lassen konnte, aber da klingelte bereits der Chauffeur.
Unsere langjährige Haushälterin Drita, die in meine Frankreichpläne eingeweiht war und den Wortwechsel mitbekommen hatte, warf mir einen verschwörerischen Blick zu. Sie öffnete die Eingangstür, packte selbst mit an und schleppte den kleineren der zwei schwarzen Hartschalen-Trolleys die Freitreppe hinunter.
Theo sah nervös auf seine Armbanduhr. Er besaß ein mittelgroßes Werk in Nürnberg, IT-Branche im Aufwind, und nun zwangen ihn zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten außergewöhnliche Umstände, seine fixe Jahresplanung über den Haufen zu werfen. Akut war der Geschäftsführer seines Zweigwerkes in Shanghai erkrankt, und das ausgerechnet zur Expo 2010, der Weltausstellung.
»Es ist ja noch gar nicht sicher, dass wir nach Frankreich fahren«, log ich meinen Mann an, eine Spur zu hastig, worauf er in gespielter oder auch aufrichtiger Verzweiflung die Augen verdrehte.
Draußen, auf dem Treppenabsatz, zog er mich eng zu sich heran. Er küsste mich auf Mund und Nase – unser Abschiedsritual – nahm dann jedoch wortlos sein Handgepäck auf und eilte Drita und dem Chauffeur hinterher.
Ich beugte mich über die steinerne Brüstung der Veranda. Tauben gurrten. Von weitem schepperte und klapperte die Müllabfuhr. Durch das fette, grünschattige Rosskastaniengewirr – die Kerzen wollten in diesem Jahr einfach nicht aufblühen – beobachtete ich, wie sich Theo mit einem Händedruck von Drita verabschiedete. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich vermisste meinen Mann schon jetzt. Den Wagenschlag bereits geöffnet, drehte er sich noch einmal nach mir um. Sein Blick glitt prüfend über mein Gesicht. Dann jedoch lächelte er breit und rief mir fröhlich zu: »So pass’ wenigstens gut auf dich auf, Steffi!«
Was hatte Theo da gesagt? Ich atmete tief durch, schickte ihm eine Kusshand hinterher und freute mich über den Freibrief, den er mir gerade ausgestellt hatte: Frankreich! Und ja, Theo, versprochen! Ich würde selbstredend auf mich aufpassen. Pass du nur ebenfalls auf dich auf!
Theos Übervorsicht, meine Frankreichpläne betreffend, hatte ihren Grund. Vor fünf Jahren war meine beste Freundin Sandrine in Paris ermordet worden, und mein Mann und ich waren gewissermaßen Zeugen des Verbrechens gewesen, weil wir am Telefon alles mitangehört hatten. Nach diesem Erlebnis war unsere bis dahin »heile Welt« aus den Fugen geraten und Theo hatte offenbar noch immer damit zu kämpfen.
Gleichwohl ist er weder furchtsam noch feige. Er setzt sich durch, in nahezu jeder Situation. Ungeschminkt würde ich ihn als einen charmanten Worcaholic mit begnadetem Gedächtnis beschreiben, als integer, fürsorglich und sozial eingestellt. Manchmal spricht er mir zu laut, zu dozierend. Manchmal wälzt er eigene Fehler auf andere ab: Steffi, wohin hast du bloß wieder die Financial Times gelegt! Und an sesselfaulen Winterabenden, wenn er Geschäftsberichte studiert und ich lese, bringt er es fertig, mich bei jedem harmlosen Knacken des Gebälks oder der Scheite im Kamin vorwurfsvoll anzusehen. Aber auch das meint er nie böse, und er reizt mich damit eher zum Lachen. Dass mein Mann bereits achtundfünfzig ist und damit zwanzig Jahre älter als ich, sieht man ihm übrigens kaum an. Er hält sein Gewicht seit Jahren, worum ich ihn, ehrlich gesagt, beneide. Ich selbst kämpfe ständig gegen jedes Kilo an. Für Theos verwitwete Mutter Dora bin ich leider ein rotes Tuch. Ihrer inneren Natur folgend, lässt sie sich noch immer nicht von der Behauptung abbringen, dass Theo »etwas Geeigneteres« als mich verdient hätte. (Theos erste Frau Anne, eine geborene »von …«, starb vor zwölf Jahren; die beiden Söhne wurden von Dora und später im Internat erzogen.) Dora Conrad hat ihr vernichtendes Urteil über mich, mit dem sie vor unserer Hochzeit halb Nürnberg aufschreckte, tatsächlich nie zurückgenommen. Sie bleibt sich treu. Treu bis in die eisgrauen Haarspitzen. Ein Wesenszug, der auch Theo nicht fremd ist, obwohl die zwei eher selten einer Meinung sind.
Treue. Das Stichwort, das mich derzeit umtreibt – und das ebenfalls aus gutem Grund. Wie steht es mit Theos ehelicher Treue?
Hier in Nürnberg, wo in unseren Kreisen (Dora!) noch immer protestantischer Anstand angesagt ist, betrügt er mich vermutlich nicht. Was jedoch ihr Lieblingssohn (mein Theodor gibt sich nicht mit kleinen Fischen ab!) seit einiger Zeit in Shanghai treibt und wie sich die dortigen Kreise zusammensetzen, entzieht sich wohl auch Doras Kenntnis. Ich selbst begleitete Theo nur einmal nach China; das war 2007 – also ganze zwei Jahre vor der merkwürdigen Andeutung, die auf der letzten Weihnachtsfeier im Nürnberger Hauptwerk fiel: Theo und Miss Zangh, hieß es, seine neue chinesische Sekretärin. Ein Hammer! Zwischen Glühwein und Lebkuchen war mir noch ein dezent überlegenes Lächeln gelungen; doch beim Neujahrsempfang, als die mitleidig-schadenfrohen Blicke der Nürnberger Sekretärinnen erneut meinen Hals wie mit Ruten peitschten, war mir angst und bang geworden. Die Liebe wittert Gefahr. Nachgehakt habe ich dennoch nicht. Bloß nicht dranrühren, es könnte ja stimmen. Ich gebe zu, ich bin zwar wie Theo und Dora eher resolut, aber mitunter stecke ich den Kopf in den Sand.
Meine Schulfreundin Mareike, mit der ich bald verreisen möchte, ist freiberufliche Fotojournalistin. Nachdem unser heißgeliebtes Café Kröll endgültig seine Türen geschlossen hatte, trafen wir uns – eine Handvoll Ehemalige des Sigena-Gymnasiums – einmal im Monat zwanglos im Sausalitos. Hier erfuhr ich von ihrem Plan, auf Tucholskys Spuren zu wandeln und eine Foto-Reportage über interessante Pyrenäenorte zu machen.
»Wirst du authentisch reisen, das heißt, mit dem Esel?«, hatte ich spöttisch nachgefragt.
»Bist du verrückt, Steffi! Kein müder Reiter steigt auf einen Esel, wenn er ein Pferd hat, heißt es in Portugal.« Mareike grinste und schob sich das Haar hinter die Ohren. »Ich fahre mit dem Auto. Hast nicht Lust, mitzukommen? Du sprichst doch fließend französisch, könntest mir bei der Recherche behilflich sein.«
Ich hob die Schultern. »Würde mich reizen. Seit fünf Jahren war ich nicht mehr in Frankreich.«
»Ehrlich? Du bist nach Sandrines Tod nie mehr ...? Ich dachte, sie hätte dir ihren Besitz vererbt?«
»Hat sie auch. In Castelnaudary, südlich von Toulouse. Nachbarn versorgen das Haus. Ich hab’s bislang nicht übers Herz gebracht, es zu verkaufen.«
»Hat eigentlich die Polizei noch was herausgefunden, seinerzeit?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nichts. Der Mörder läuft frei herum. Aber ... wie ernst ist denn dein Angebot?«
»Du meinst die Pyrenäenreise? Völlig ernst – wenn wir ›auf getrennten Pferden reiten‹. Ich habe für Frankreich vierzehn Tage eingeplant, dann fahre ich weiter nach Portugal. Privat.«
»Das hab ich mir schon gedacht! Wie heißt er gleich wieder? Verflixt, ich kann mir seinen Namen nicht merken!«
»Ximeno! Er hat mich zum 70. Geburtstag seiner Mutter eingeladen. Vielleicht macht er mir ja einen Antrag. Was meinst du? Hab ich eine Chance?« Sie drehte eitel den schönen Kopf mit dem langen, glatten Goldhaar.
Ich hob skeptisch die Brauen, worauf sie mich in die Rippen boxte.
Vier Wochen nach Theos Abflug – die Kastanien hatten zwischenzeitlich doch noch geblüht – sollte die Tucholsky-Reise endlich losgehen. Ich packte nur das Notwendigste in meinen GTI, zwei Taschen mit überwiegend sportlicher Kleidung, meine Wanderschuhe, die Nordic-Walking-Stöcke, aber auch für alle Fälle meine Strandsachen.
Endlich! 11. Juni 2010 – der Abfahrtstag: Zirrusartige Wolken am blauen Himmel, böiger Wind. Rechts und links der Autobahn Klatschmohn und leuchtendgelber Senf. Dazwischen die reinste Hölle: Baustelle über Baustelle auf der A 5 bis Mühlhausen.
Am Abend machten wir Zwischenstation in Pérouges, einem pittoresken Bergnest nahe Lyon, umschlossen von wehrhaften Mauern und Türmen. Mittelalter pur. Steinhäuser im Fischgrätmuster, finstere Arkadengänge, enge Gassen, die auf lauschige Plätze führten. Sehenswert – aber zugleich ein höllisches Pflasterparadies, wenn man, wie einige andere Touristen, die falschen Schuhe trug!
Obwohl das Wetter auch hier zu wünschen übrig ließ, steckten wir unsere Nasen in nahezu jeden verwunschenen Winkel. Als jedoch Mareike ein zweites Mal in die Magdalenenkirche eilte, weil sie mit der Belichtung einer bestimmten Aufnahme unzufrieden war, setzte ich mich erschöpft auf die Terrasse einer benachbarten Schänke, um dort auf sie zu warten. Über meinem Kopf baumelten eidottergelbe Maiskolben, die das mittelalterliche Europa gar nicht gekannt hatte. Ich bestellte mir Galettes, eine hiesige Spezialität, und trank dazu Cidre, der wie in der Bretagne in großen Tassen serviert wurde.
»Wussten Sie, dass man bei uns schon Kino-Filme gedreht hat, Madame?«, fragte mich das schwarz gekleidete Mädchen, das mich bediente. Sie trug eine weiße Haube auf dem Kopf und Holzschuhe an den Füßen.
»Filme? Welche denn?« Das mit Sahne und Kirschsoße garnierte Gebäck ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Nun, Die Drei Musketiere!«
»Einer für alle – alle für einen?«
Sie nickte lachend. »Sämtliche Kulissen waren echt, Madame, selbst unsere alte Ulme konnte man auf der Leinwand bewundern.« Sie deutete auf den Platz hinter meinem Rücken.
Ich drehte mich um und studierte den ausladenden Baum, dessen Äste von schweren Balken gestützt wurden. »Tatsächlich! Jetzt, wo Sie sie mich darauf aufmerksam machen, Mademoiselle ...«, sagte ich höflich, worauf die Kleine zufrieden lächelte.
Mareikes Wangen glühten, als sie mir gegenüber Platz nahm. »Die Madonna von Pérouges ist im Kasten, endlich!« Sie reichte mir die schwere Spiegelreflex-Kamera über den Tisch. Ich lachte auf, als ich die Aufnahme betrachtete. »Dieses mürrische Gesicht ist doch wirklich einzigartig! Was der wohl über die Leber gelaufen ist?«
Mareike zwinkerte mir zu. »Sieh dir mal das Söhnchen näher an. Pinocchio lässt grüßen!«
Wir lachten so herzhaft über den Anblick des verschmitzten Kleinen mit der ulkigen Nase, dass sich die anderen Gäste nach uns umdrehten.
Bereits um halb acht saßen wir am nächsten Morgen im Frühstücksraum eines kleinen Hotels, das ein Stück unterhalb von Pérouges lag. Der Wind gebärdete sich heute noch launischer als gestern. Durch die hohen Glasfenster konnte man sehen, wie er die Sonnenschirme, die zusammengeklappt auf der Terrasse standen, abwechselnd schüttelte und aufplusterte. Wir hatten uns warm angezogen. Mareike trug eine blau-grün-karierte Flanellbluse zur Jeans, ich meinen schwarzen Kashmir-Wohlfühl-Pullover.
»Und? Wie geht es heute weiter?«, fragte ich, während ich mir an der Kaffeetasse die Hände wärmte. »Hast du schon gepackt?«
»Klar!« Mareike schob mir die Landkarte zu. Sie beugte sich über den Tisch und deutete auf einen Punkt. »Hier, das nächste Ziel! Saint-Bertrand, eine Zwischenstation für Jakobspilger, die sich über den Pyrenäenweg nach Compostela aufgemacht haben.«
»Saint-Bertrand de Comminges? Hm ...« Während ich ein Stück Baguette mit Butter und Aprikosenmarmelade bestrich, studierte ich beiläufig die Karte. »Zuerst Richtung Toulouse, dann Abfahrt Saint-Gaudens ... Lange Fahrt für ein Pilgerziel und das bei diesem Wetter!«
»Saint-Bertrand muss sein, Steffi, nicht nur wegen Tucholsky. Es handelt sich um die alte Siedlung des römischen Feldherrn Pompeius. Heute steht da eine gotische Kathedrale, die es allerdings faustdick hinter ihren Mauern hat. Lass dich überraschen. Im Tal gibt es noch weitere Sehenswürdigkeiten: Ein Totenkirchlein, das unter Basilika firmiert, sowie eine Höhle mit absonderlich verstümmelten Handabdrücken an den Wänden. Dort soll Ende des 18. Jahrhunderts ein Menschenfresser gelebt haben.«
»Dass du mir in Theos Beisein bloß nicht den Kannibalen erwähnst!«, warnte ich sie grinsend, »sonst war das definitiv die letzte Frankreichreise für mich.«
»Keine Sorge. Aber du wirst in den nächsten Tagen einiges zu lernen haben, Madame Conrad!«
»Ich befürchte es. Also, dann fang mal mit deinem Menschenfresser an ...«
Mareike, die nicht nur eine Vorliebe für Gruselgeschichten hatte, sondern sichtlich auch für Schoko-Croissants, wischte sich mit der Serviette über den Mund. »Das Ungeheuer hieß Blaize Ferrage und überfiel mit Vorliebe junge Mädchen, die mit ihren Milchkannen unterwegs waren. Es müssen mehr als achtzig gewesen sein, die der Kerl in seine Höhle verschleppte, misshandelte und verspeiste. Er war ein ausgesprochener Feinschmecker. Männer fraß er nur, wenn nichts anderes aufzutreiben war.«
Ich schüttelte den Kopf über Mareikes schrägen Humor, lachte und erhob mich. »Ich denke, wir müssen los!«
Nach vier Stunden anstrengender Fahrt erreichten wir Toulouse, wo wir am ausgemachten Treffpunkt eine kurze Pause einlegten.
Eine Stunde später waren wir in Saint-Gaudens und kurz darauf lagen sie vor uns in ihrer ganzen Pracht, die Pyrenäen: Die Maladetta Gruppe und der Pic du Midi de Bigorre, grandios aufgereiht und in jeder nur denkbaren Farbschattierung zwischen grün, blau und grau. Die meisten Grate waren noch jungfräulich weiß überzuckert. Mit einem Mal freute ich mich unbändig auf die vor mir liegenden Wochen, und ich fasste den Entschluss, mich mit Theo und seiner Dame aus dem Reich der Mitte (Miss Zangh!) erst wieder nach meiner Rückkehr zu beschäftigen. Am besten, ich vergaß die Sache ganz .
Das einsam gelegene Höhendorf Saint-Bertrand-de-Comminges war, wie Pérouges, durch hohe mittelalterliche Mauern geschützt. Rumpelnd und holpernd stießen wir über etliche Kehren auf die Porte Este, wo Lackreste und tiefe Schrammen im Gestein von den unrühmlichen Versuchen anderer Autofahrer zeugten, dieses Nadelöhr mit Würde zu passieren. Wir parkten auf dem kleinen Platz, schräg gegenüber dem einzigen Hotel.
»Allmächt’!«, stöhnte ich, als ich ausstieg, »sieh dich nur um, Mareike. Hier ist tatsächlich die Zeit stehengeblieben!«
»Excusez-moi, Mesdames, unsere Treppe ist etwas gewöhnungsbedürftig«, entschuldigte sich Madame Aurélie, die Hotelbesitzerin, als sie uns die unterschiedlich hohen und unter dem Gewicht unserer Taschen ächzenden Stufen in den ersten Stock hinaufgeleitete.
Ein langer düsterer Flur. Jeder Schritt brachte auch hier die alten Dielenbretter zum Knarzen, daran änderte selbst der rote Läufer nichts, mit dem sie ausgelegt waren. Abenteuerlich, mit einem Wort. Mareike grinste bis über beide Ohren. Die Türen quietschten. Dunkles Mobiliar von vorgestern. Kronleuchter. Tapeten im Paisley-Muster. Schabracken über den Fenstern. Weiße, duftige Gardinen. Eigentlich alles tipptopp, auch die Badezimmer. Zum jeweiligen Zimmerschlüssel händigte uns Madame Aurélie (rotblond, fröhlich, etwa im selben Alter wie wir) einen Schlüssel für den Nebeneingang aus. Der Empfang, so hieß es, sei nach zweiundzwanzig Uhr nicht mehr besetzt.
Wir bezogen die Zimmer 10 und 12 – die 11 war vergeben – und verabredeten uns auf fünfzehn Uhr. Mareike brannte darauf, die Kathedrale zu fotografieren.
Ich packte nur das Nötigste aus, entledigte mich meiner Sneakers und warf mich aufs Bett. Ich bin eine geübte, schnelle Autofahrerin, doch diese Strecke hatte mich geschafft. Und jetzt war es wie immer: schloss ich die Augen, saß ich erneut im Auto und fuhr und fuhr. Ich hasse diesen Zustand, der mich an Seekrankheit erinnert. Ich war gerade eingedöst, als mich laute Stimmen weckten. Zuerst dachte ich, ich hätte den Wortwechsel nur geträumt, denn er war auf Deutsch geführt worden. Doch als der Streit weiterging, setzte ich mich auf und lauschte. Eine kräftige Männer- und eine junge, ziemlich aufgebrachte Frauenstimme.
»O weh! Bitte nicht! Neeiin!«, rief die Frau.
»Isa, du verdammte Lügnerin«, brüllte der Mann. Dann ein Krachen genau hinter mir. Jemand schien einen Gegenstand an die Wand geworfen zu haben. Die Frau heulte auf. »Ich bin nicht Isa!« Der Mann schrie etwas, das sich wie »letzte Warnung« anhörte, worauf die Frau erneut kreischte.
Jetzt reichte es mir. Ich kniete mich aufs Bett, schlug dreimal mit der Faust gegen die Wand und rief auf Deutsch »Ruhe, verdammt!«
Jähe Stille. Dann ein unterdrücktes Schluchzen und die barsche Ermahnung, endlich den Mund zu halten.
Natürlich war ich jetzt glockenhell wach. Wirklich ärgerlich. Ich sah auf meine Armbanduhr. Eine halbe Stunde noch bis zu unserem Treffen. Ich erhob mich, trat auf Socken ans Fenster und öffnete es. Ein betörender Duft stieg mir in die Nase. Ich beugte mich hinaus. Die ganze Hausfront war mit giftigem Blauregen bewachsen, was ich beim Betreten des Hotels gar nicht bemerkt hatte. Aufmerksam betrachtete ich die Kathedrale auf der gegenüberliegenden Anhöhe. Steingraue Gotik. Der Karreeturm, von einer Schar schwarzer Bergdohlen umflattert, schien noch älter zu sein. Vermutlich romanisch. Seine ungewöhnliche hölzerne Dachhaube verlieh dem Gotteshaus das Flair einer alten Trutzburg.
Auf dem Parkplatz stand jetzt ein drittes Auto, ein schwarzer Benz. Getönte Scheiben und – ich kniff die Augen zusammen – ein deutsches Kennzeichen? Der Wagen des Paares von nebenan, das sich hier, am Ende der Welt, wüst – und auf Deutsch! – gestritten hatte? Ich packte meine eigene Kamera aus und zoomte. Tatsächlich: »B« für Berlin. Unleserlich allerdings die Nummernfolge. Das Kennzeichen war total verschmutzt.
Pünktlich um fünfzehn Uhr machte ich mich über die knarzende Treppe wieder auf den Weg nach unten. Ich trat vor die Tür. Im Ort herrschte geradezu verschlafene Ruhe. Niemand ließ sich blicken. Außer den Dohlen, die noch immer den Turm umkreisten, strichen nur ein paar gelangweilte Katzen umher.
Es soll ja nachweislich Orte mit mystischer Atmosphäre geben. Thuret und Orcival, in der Auvergne liegend, gehören für mich dazu, sowie die Kathedrale Notre Dame de Marceille, in der Nähe von Limoux. Aber eben auch dieses Saint-Bertrand! Ich spürte es bis in die Knochen. Allein würde ich es hier keine drei Tage aushalten.
Skeptisch sah ich zu den Bergen hinüber, über die sich fortwährendes Wolkengeröll schob. Der böige Wind vom Vormittag hatte zwar nachgelassen, dafür war es merklich kühler geworden.
Als Mareike kam, beichtete sie mir, dass der Akku ihrer Kamera noch nicht fertig aufgeladen sei. Also bestellten wir Kaffee und setzten uns, weil wir bereits die Outdoor-Jacken trugen, ins Freie, auf weiße Plastikstühle.
Allmählich wachte das öde Wallfahrernest auf. Zuerst begann irgendwo ein Schmied zu hämmern, dann wurde an einem benachbarten Andenkenladen die Markise ausgerollt; ein junger Mann schob einen klapprigen Ständer mit Ansichtskarten auf den Gehweg; eine Frau begann, den alten schmiedeeisernen Brunnen mit leuchtend-roten Geranien zu bepflanzen.
»Affenkälte«, brummte ich und zog die Ärmel meines Pullovers übers Handgelenk. »Wir hätten auf den Zimmern bleiben sollen.«
Mareike, die Nase im Reiseführer, zuckte die Schultern. »Sei nicht so empfindlich. Das Aufladen dauert höchstens noch eine halbe Stunde. Wusstest du, dass hier Herodes Antipas in Verbannung lebte?«
»Der Herodes, der Johannes den Täufer köpfen ließ?« Ich fuhr mit dem Zeigefinger über meine Kehle. »Der soll hier in Frankreich gelebt haben?«
»Samt seiner Frau Herodias und dieser Schlampe Salome. Wusste ich auch nicht. Flavius Josephus behauptet dies. Und diese Herodias … Pass auf, Steffi, was hier steht: Herodias wurde im Mittelalter gleichgesetzt mit Diana, der heidnischen Königin der Nachtgespenster.« Mareike strahlte. Sie war gut drauf. Vor zwei Jahren war das noch ganz anders gewesen.
Ich lachte. »Nachtgespenster? Kein Wunder, dass dieses Saint-Bertrand eine so merkwürdige Ausstrahlung besitzt.« Ich sah mich um. »Irgendwie gruselig. Fühlst du das nicht auch?«
»Ja, ja. Durch und durch. Lass uns vor der Abfahrt bloß nicht die Ausgrabungen vergessen. Reste eines römischen Forums … Übrigens, hast du vorhin auch diesen Streit gehört? Waren das Deutsche?«
»Ja. Irgendwas knallte gegen meine Wand.« Ich warf einen Blick nach oben, wo der Wind die Trauben des Blauregens zum Schwingen brachte. Ich zählte die Fenster ab. Das der Streithähne war geschlossen. »Ein Liebesdrama wahrscheinlich.«
Madame Aurélie kam mit Milchkaffee und präsentierte uns Madeleines, goldgelbe Teigfinger, »selbstgebacken«, wie sie sagte – eine Aufmerksamkeit des Hauses. Wir dankten und griffen ungeniert zu.
Die Hotelbesitzerin zog ihre Strickjacke fester um den Körper und setzte sich zu uns. Mit Blick auf die Kathedrale erzählte sie uns vom Heiligen Bertrand, dem Erbauer. »Der gotische Teil geht allerdings auf seinen Nachfolger zurück, den späteren Papst Clemens V.« Dann lachte sie schelmisch und wies uns auf eine geheimnisvolle Inschrift über dem Eingangsportal hin, die mit den Drei Königen aus dem Morgenland zu tun hätte. »Sie ist allerdings stark verwittert, kaum noch lesbar. Mehr verrate ich Ihnen im Augenblick nicht.« Sie erhob sich.
»Erwarten Sie eigentlich noch weitere Gäste für dieses Wochenende?«, fragte ich wie nebenbei. (Insgeheim hoffte ich, sie würde uns etwas über die Deutschen erzählen.)
»Mais oui!«, Aurélie nickte. »Zwei junge Männer haben sich angemeldet. Sie kommen zu einem Vorkonzert, das heute Abend unten im Tal gegeben wird. In der kleinen Kirche Saint-Just. Einundzwanzig Uhr«, sagte sie und sah uns fragend an. »Der Eintritt ist frei. Haben Sie vielleicht Interesse?«
Saint-Just? Das Kirchlein, von dem Mareike erzählt hatte? Ich liebte Konzerte und warf meinerseits einen fragenden Blick auf meine Freundin. Doch Mareike – ich wusste es bereits! – erwartete am Abend einen Anruf aus Portugal.
»Hand aufs Herz, ma chère«, frotzelte ich, als wir wieder unter uns waren, »dir graut vor dem Totenkirchlein in der Nacht, nachdem du dich mit deinen Schauergeschichten selbst hochgeschaukelt hast.«
»Elende Spottdrossel! Na warte, gleich treibt es dir einen Schauer über den Rücken!« Sie suchte im Reiseführer nach einer Stelle, wo es um »das abscheuliche Treiben der Herodias« ging, wie sie sagte. »Und noch um das Jahr 1900«, las sie mir vor, »haben sich Gruppen von acht bis zehn Mädchen, die in den Bergen umherstreiften, jedes unbekannten jungen Mannes bemächtigt, auf den sie zufällig trafen, um ihn ...«, nun legte sie den Daumen zwischen die Buchseiten und grinste unverschämt, »nun, sie haben ihn für bestimmte Zwecke missbraucht. Du verstehst? A-mou-rö-se Zwecke würde man damals dazu gesagt haben!«
Ich stieß einen spitzen Schrei aus und meinte, nun sei ja wohl geklärt, weshalb Tucholsky die beschwerliche Eselsreise durch die Pyrenäen auf sich genommen hätte.
Gutgelaunt stiegen wir zur Kathedrale hinauf. Bereits der Kreuzgang des rechter Hand liegenden ehemaligen Klosters war beeindruckend. Seine Südseite ging auf das Bergtal zu, das von Nebelschwaden überzogen war. Mareike fotografierte die herrlichen Kapitelle, ein jedes vom nächsten verschieden. »Nach allem, was ich inzwischen über diesen Ort gelesen habe«, sagte sie, stehen wir hier auf den Überresten eines mächtigen Jupiter- oder Merkur-Tempels der Römer. Das ist so spannend! Findest du nicht auch?«
Vor dem Eintritt in die Kathedrale studierten wir die verwitterte Inschrift auf dem Tympanon … Wie uns Madame Aurélie später anhand des Fotos erklärte, ging es dabei um die »wahren« Geschenke der Heiligen Drei Könige: Far, Miron und Aspron: »Weißes Mehl – zum Kuchenbacken«, wie Aurélie schmunzelnd übersetzte, »die obligatorische Myrrhe – und byzantinische Schüsselmünzen aus dem 11. Jahrhundert.«
Mareike zückte lachend ihren Kugelschreiber: »Die Heiligen Drei Könige und Münzen aus dem 11. Jahrhundert? Jesses, Maria, ein rückgreifender Anachronismus!« (Sie war hin und weg.)
Das Innere der Kathedrale stellte so gut wie alles in den Schatten, was ich bislang in Kirchen gesehen hatte, und das lag nicht etwa am ausgestopften Krokodil, das an einer der dunklen Steinwände hing, nicht an der imposanten Orgel, der Cagoten-Schandtür oder dem blankgewetzten Antlitz eines Grünen Mannes (heidnischen Ursprungs), sondern am Renaissance-Chorgestühl der ehemaligen Kanoniker: Inmitten der Kathedrale aus Stein befand sich eine zweite aus Holz, einzig für die hohe Geistlichkeit geschaffen. Dass diese sich dort gelangweilt hätte, stand indes außer Frage. Das dunkle, warm schimmernde Gestühl war meisterlich geschnitzt und wimmelte geradezu von Emblemen und Figuren. Geflügelte Drachen, zungenbleckende Kopffüßler, Affen, die sich um Bischofsstäbe stritten, Palmen und Schlingpflanzen, sonderbare Vogelmänner, grinsende Chinesen und Inder – allesamt Allegorien von Tod, Sünde und Gerechtigkeit, wie es im Reiseführer hieß.
Dass sich jedoch ausgerechnet hier oben, in der pastoralen Abgeschiedenheit, die verkrampfte Leib- und Sexualfeindlichkeit der katholischen Kirche explosionsartig ins Gegenteil verkehrte, verblüffte uns. Unvermittelt ragten einem die Details entgegen: nackte Hinterteile, wolllüstige Münder, weit gespreizte Vulven, ja, selbst kopulierende Paare entdeckten wir unter den Doppelsitzen des Gestühls.
Wie fette Hammel hingen grau-schwarze Wolken am Himmel und der Regen prasselte herunter, als wir die Kathedrale wieder verließen. Wir zogen die Kapuzen über den Kopf und hasteten den Kirchplatz hinab, wobei ich um ein Haar auf dem rutschigen Kopfsteinpflaster ausgeglitten wäre.
Im Hotel erfuhren wir, dass das vom Reiseführer empfohlene Restaurant Chez Simone geschlossen hatte und es derzeit auch kein anderes Restaurant im Ort gab. Madame Aurélie verwies bedauernd auf die Vorsaison hier in den Bergen und empfahl uns ein Lokal »mit gehobenem Ambiente«, wie sie sagte, unten im Tal. »Nur zehn Minuten mit dem Auto!« Mit diesen Worten drückte sie uns einen bereits kopierten Wegeplan in die Hand.
Wir duschten, zogen uns um und fuhren mit Mareikes Wagen los. Inzwischen regnete es nicht mehr – es schüttete, was das Zeug hielt! Doch selbst das konnte unserer aufgekratzten Laune nichts anhaben. »I can see clearly now, the rain is gone«, sangen wir lautstark bei der Abfahrt ins Tal. «I can see all obstacles in my way …«
2
Stefanie Conrad, Mühle von Aveux
Das Restaurant »mit gehobenem Ambiente« entpuppte sich als eine ehemalige Mühle, malerisch am Rande von Aveux und an einem rauschenden Gebirgsbach gelegen. Der Chef selbst, mit hoher Kochmütze, begrüßte uns und wies uns einen Tisch zu. Abgeschirmtes Licht, schimmernde Tischwäsche und die vielen Kerzen verliehen dem Gastraum eine warme, behagliche Note. Im Nebenzimmer, die Tür stand ein Stück offen, flackerte ein Kaminfeuer und eine kleine Gesellschaft sang Happy birthday auf Französisch.
Allmählich füllte sich das Lokal. Unter den Neuankömmlingen nahmen am Tisch neben uns die beiden Musiker Platz, die uns Madame Aurélie angekündigt hatte. Wir kamen miteinander ins Gespräch. Sie bestellten sich aus Zeitgründen jedoch nur eine Suppe und waren bald wieder fort.
Das Restaurant gefiel uns in jeder Hinsicht: Freundliches, aufmerksames Personal und ein »Dinner, das fünf Sterne verdient hätte«, wie Mareike meinte, die im Überschwang ihre schwere Kamera auspackte und die Vorspeisen fotografierte. Damit zog sie natürlich alle Blicke auf sich – und meinen Spott, zumal ich nahe am Verhungern war: »Glaubst du ernsthaft, wir gehen als Restaurantkritikerinnen durch und sie erlassen uns die Rechnung?«
»Ach, egal! Lass es uns einfach genießen!«, sagte sie selig, packte ihre Kamera zurück und prostete mir zu. Doch als der zweite Gang aufgetragen wurde, war es mit ihrer Seligkeit vorbei. Ihr Handy läutete. »Ximeno«, hauchte sie nach einem Blick auf das Display und lief hinaus.
Perfektes Timing! Es dauerte und dauerte. Ich befürchtete schon, ihre Wildterrine würde kalt werden und wollte gerade nach ihr Ausschau halten, als sie zurückkam: Aschfahl im Gesicht, die hellblauen Augen tränenfeucht. Sie ließ sich auf den Stuhl fallen und schob ihren Teller beiseite.
»Was ist los?«
»Ximeno ist verunglückt«, stieß sie hervor. »Er liegt in einer Klinik in Lissabon. Innere Verletzungen. Es ist offenbar sehr, sehr ernst. Seine Schwester hat mich von seinem Handy aus angerufen. Ich muss ... es tut mir leid, Steffi, aber wir müssen unsere Reise abbrechen. Ich fahre gleich los, in dreizehn, vierzehn Stunden könnte ich bei ihm sein. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn er … du weißt schon, Steffi.«
Ich legte beruhigend meine Hände auf ihre zitternden. »Und warum nimmst du nicht den Flieger?«
»Ein Flugzeug? Daran hab ich ... gar nicht gedacht.«
»Das geht doch viel schneller, als wenn du in deinem aufgeregten Zustand die lange Strecke mit dem Wagen fährst, noch dazu mitten in der Nacht!«
Ich bat die Chefin des Hauses an den Tisch, erklärte ihr den Notfall.
Madame verstand und eilte zur Rezeption, um mit dem Aéroport in Toulouse zu telefonieren. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam. »Ihr Flug ist reserviert, Madame. Air Portugal. Er geht in zweieinhalb Stunden. Um 1.30 Uhr sind Sie in Lissabon.«
Sie reichte Mareike einen Zettel, auf dem der kürzeste Weg zum Flughafen Toulouse-Blagnac aufgezeichnet war. »Sehen Sie, hier ist Aveux, wo wir uns befinden. Sie fahren nach Saint-Gaudens, dann auf die A 64, und später nehmen Sie die A 624 in Richtung Blagnac ... Es ist ganz leicht.«
Mareike drängte nur mit Mühe die Tränen zurück. Sie nickte dankbar und steckte den Zettel ein.
Ich sah auf die Armbanduhr. Die Zeit reichte locker aus, um den Flug zu erreichen – allerdings nicht, um ihr Gepäck aus dem Hotel zu holen. Doch nachdem sich der Portugalkoffer, wie Mareike sagte, noch immer in ihrem Wagen befand, war dies auch gar nicht nötig. Wasch- und Schminkzeug konnte sie in Lissabon kaufen.
»Ich parke also mein Auto am Flughafen, doch wie kommst du ins Hotel zurück, Steffi?«
»Ganz einfach: Ich nehme mir ein Taxi.«
»Macht es dir auch wirklich nichts aus?«
»Nein, nein! Sorg dich nicht um mich. Gib mir deinen Hotelschlüssel. Ich bezahle morgen früh die Zimmer, packe deine Sachen zu mir ins Auto und bringe sie nach Castelnaudary in Sandrines Haus. Dort können wir uns später wieder treffen. Und lass mich auf jeden Fall bald wissen, wie es Ximeno geht! … Warte!« Ich kramte in meiner Handtasche. »Da nimm! Ein leichtes Beruhigungsmittel, pflanzlich. Vielleicht kannst du im Flugzeug ein bisschen schlafen!«
Der Wind hatte noch einmal aufgefrischt. Hart schlug uns der Regen ins Gesicht, während die Dunkelheit und das diesige Wetter die Berge ringsum verschluckten. Als ich draußen auf dem Parkplatz Mareike umarmte, aktivierte der Bewegungsmelder eine der Außenlampen, und der Lichtschein fiel auf das Gesicht einer jungen Frau, die mit ihrem Begleiter unter dem überdachten Eingang stand und rauchte. Ich kann nicht sagen, woran es lag, dass ich für den Bruchteil einer Sekunde glaubte, die junge Frau flehe mich um Hilfe an …
»Fahr’ bitte vorsichtig bei diesem Mistwetter«, bat ich Mareike – leicht irritiert – und schob sie in den Wagen, »und ruf mich an oder schick mir eine SMS, wenn du am Flughafen angekommen bist, ja?«
»Versprochen.«
»Und solltest du den Flieger verpassen, man weiß ja nie, so reg’ dich bitte nicht auf. Nimm einfach den nächsten. Du bist auf jeden Fall spätestens morgen früh in Lissabon.«
Eine hastige Kusshand durchs Fenster und schon schoss sie die Ausfahrt zur Straße hinauf.
Ich winkte ihr hinterher, bis sie um die Kurve verschwand. Dabei entdeckte ich den schwarzen Mercedes vom Hotel. Ich vermutete zumindest, dass er es war. Dinierten die Berliner hier?
Den Kopf eingezogen, lief ich ins Lokal zurück – direkt an den beiden Rauchern vorbei, allerdings ohne dass mir an der jungen Frau noch etwas aufgefallen wäre.
Obwohl mir der Hunger vergangen war, tauschte man mir unaufgefordert die kalte Forelle gegen eine warme aus. Ich aß gerade, als das Raucher-Pärchen zurückkam. Unauffällig beobachtete ich die beiden, spekulierte, ob es sich vielleicht um die Streithähne aus dem Hotel handelte. Der Mann sah zudem geradezu verboten gut aus. Er war in den Vierzigern, auffällig groß, schlank, braungebrannt. Zwei markante Falten zogen sich um die Mundwinkel. Das aschblonde Haar trug er streichholzkurz geschnitten. Seine Kleidung war sportlich-zwanglos.
Das zierliche Mädchen mit der asymmetrisch geschnittenen Frisur, das ihm nun gegenüber saß – Freundin? Geliebte? Tochter? – fröstelte sichtlich. Kein Wunder, so lange wie die beiden vor der Tür geraucht hatten. Im Gegensatz zu ihrem Begleiter war sie fast festlich gekleidet. Ganz in pink. Ein kragenloses, halsfernes Oberteil, kurze, angeschnittene Ärmel – und ein sogenannter Ballonrock, oberhalb der Knie gerafft. Originell, jedoch viel zu luftig für diesen kühlen Abend.
Ich war mir bald ganz sicher, dass es sich um meine Zimmernachbarn handelte, denn dass die beiden auch jetzt noch miteinander stritten, war kaum zu übersehen. Der Mann redete in einem fort leise auf sie ein, während sie ständig den Kopf schüttelte und ihn irgendwie verbittert ansah.
Ich schenkte mir vom Wein nach und konzentrierte mich auf meine Forelle ... Mareike tat mir leid. Ihr blieb offenbar nichts erspart. Vor drei Jahren war ihr kleiner Sohn Denis an Leukämie gestorben und ihr Mann hatte daraufhin fluchtartig das Weite gesucht. Mit diesem doppelten Schicksalsschlag war sie lange nicht fertig geworden. Und nun Ximeno, der Portugiese. Sie hatte ihn im letzten Sommer kennengelernt. Beruflich erfolgreicher Bauingenieur – privat erfolgreich geschieden. Ob er mit dem Auto verunglückt war?
Im Nebenzimmer wurde jetzt lauter gesungen. Ständig huschte jemand raus und rein.
Während ich mein Eis d'Artagnan löffelte, warf ich erneut den einen oder anderen verstohlenen Blick auf das streitlustige Pärchen. Es war fast wie ein Zwang.
Die ersten Gäste zahlten. Ich bestellte noch einen Espresso und einen Cognac als Absacker – ich würde ja mit dem Taxi fahren – und zwang mich, die hübschen Bilder zu betrachten, die im Lokal hingen. Doch als mein Blick erneut auf dem Profil der jungen Frau hängenblieb, und ich gerade überlegte, ob es sich wirklich um die Geliebte jenes Mannes handelte – und ob Miss Zangh genauso jung war wie sie! –, drehte sie mit einem Mal den Kopf in meine Richtung. Und wieder passierte es: Als sich unsere Blicke trafen, nahm ich erneut ein ängstliches Flehen wahr. Welcher Teufel mich daraufhin ritt, dass ich ihr ein Zeichen machte, indem ich mit dem Kopf in Richtung Toilettenausgang wies, weiß ich nicht.
Sie stutzte jäh ... ihre Schultern versteiften sich. Und nun riss ihr Begleiter den Kopf herum.
Was soll ich weiter sagen? Der Kerl war ein arroganter Kotzbrocken!
Ich trank mit winzigen Schlucken und steigendem Widerwillen meinen Espresso, den ich versehentlich überzuckert hatte. Dann erhob ich mich, um die Toilette aufzusuchen. Im Vorraum wartete ich. Doch das Mädchen kam nicht. Ich gab ihr weitere fünf Minuten, dann kehrte ich zurück und steuerte dabei dreist den Tisch der beiden an.
»Excusez moi, Monsieur-dames«, entschuldigte ich mich – ich benutzte mit voller Absicht die französische Sprache –, »Sie sind nicht zufällig Gäste des Hotels in Saint-Bertrand?«
Der Schönling wich vor mir zurück. Das Mädchen indes nickte spontan und lächelte dabei gequält. Während ich kurz schilderte, was meiner Freundin zugestoßen war, nahm ich die junge Frau unauffällig unter die Lupe: Eine zarte Wasserrose in Pink, mit verweinten Augen, zitternder Oberlippe – und auffällig blauen Flecken an den Armen! Das gefiel mir ganz und gar nicht. Vielleicht suchte sie tatsächlich Hilfe … Wie ich es mir auf der Toilette zurechtgelegt hatte, bat ich die beiden, mich doch zum Hotel mitzunehmen, falls sie im Laufe der nächsten Stunde dorthin zurückkehrten. Das Mädchen sah fragend auf den Mann, der mich nun wirklich sehr gelangweilt betrachtete und dann eiskalt abfertigte: »Nehmen Sie sich ein Taxi, Madame, und belästigen Sie uns nicht weiter!«, sagte er.
»Pas de problème, Monsieur!« Ich machte auf dem Absatz kehrt und setzte mich zu meinem Cognac an den Tisch. Nun zitterten meine Hände – vor Wut. Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich mich überhaupt eingemischt hatte. Eines wusste ich jetzt jedoch genau: Der Kerl war Deutscher. Sein Akzent hatte ihn verraten. Wie es um das Mädchen bestellt war, konnte ich nicht sagen, sie hatte ja kein Wort gesprochen. Kurz darauf bat der Mann um die Rechnung, zahlte, und die beiden verließen in jenem Augenblick das Lokal, als Mareike anrief, um mir ihre Ankunft am Flughafen mitzuteilen.
Das Taxi schlängelte sich gekonnt durchs enge Stadttor, was mir, leicht alkoholisiert wie ich war, wie ein Wunder vorkam. Am Hotel brannte eine einsame Außenlaterne. Sonst war alles dunkel. Vorsaison.
Beim Aussteigen warf ich einen neugierigen Blick auf den ebenfalls schlecht beleuchteten Parkplatz. Dort stand unverändert mein GTI und daneben war ein Renault mit französischem Kennzeichen abgestellt, vermutlich das Auto der beiden Musiker. Der Berliner Benz fehlte.
Ich benutzte den Nebeneingang und beschloss spontan, als ich nach oben stieg, in Mareikes Zimmer zu schlafen, das näher an der knarzenden Treppe lag. Vielleicht würde ich die Gäste von Zimmer 11 hören, wenn sie zurückkamen.
Ich holte meinen Schlafanzug, das Waschzeug und die Kamera aus meinem Zimmer und schloss mich in Mareikes Zimmer ein. Ich löschte alle Lichter und stellte mich im Schlafanzug ans offenstehende Fenster – die Kamera griffbereit. Vielleicht gelang es mir – so mein verrückter Plan –, ein Bild von den beiden zu schießen, das man dann vergrößern konnte.
Ich war überspannt und aufgeregt – was aber weniger am Wein und am Cognac lag, als an der arroganten Art dieses Mannes.
Die Zeit schleppte sich dahin. Draußen, auf dem vor Nässe glänzenden Kirchplatz, strichen erneut Katzen umher, eine dunkle und eine weißgefleckte – wo doch bekanntlich nachts alle Katzen grau waren. Ich musste grinsen.
Nichts, absolut nichts tat sich … Irgendwann gab ich gefrustet meinen Ausguck auf und legte mich ins Bett. Doch meine Füße waren jetzt die reinsten Eisklumpen und ich konnte nicht einschlafen.
Ich machte Licht, zog Socken an und schnappte mir »den Tucholsky«, der auf Mareikes Beistelltischchen lag. Ich überflog den Klappentext, erinnerte mich, dass die Nazis seine Bücher verbrannt hatten und er im schwedischen Exil Suizid beging. Neugierig auf seine Reisebeschreibung von Saint-Bertrand blätterte ich bis zu der Stelle, wo er sich im Hotel (in diesem!) befand, und ich amüsierte mich köstlich, als ich las, dass es ihm hier seinerzeit wohl ähnlich ergangen war wie heute mir:
In einem fremden Hotelzimmer öffnet man das Fenster, schrieb er (stets um eine Pointe bemüht), und macht es wieder zu und geht hin und her. Die Bilder an den Wänden sind töricht, natürlich. Wenn man sich gewaschen hat, kann man pfeifen. Dann lege ich den Kopf an die Scheiben und mache ein dummes Gesicht. Die Nägel könnte ich mir auch mal schneiden. Was tue ich eigentlich hier ...?
Ja, was tat ich eigentlich hier? Hielt am Fenster nach Leuten Ausschau, die mich nichts angingen. Und morgen würde ich ein dummes Gesicht machen, wenn mir die Nase lief! Vermutlich war der flehentliche Blick der jungen Dame völlig harmlos. Es soll Menschen geben, die bereits mit einem ängstlichen Gesicht zur Welt kamen und auch solche, die ständig irgendwelche blauen Flecken an den Armen hatten. Ich las noch ein kurzes Kapitel und legte dann seufzend das Buch zur Seite.
Ich weiß nicht, wie lange ich schon geschlafen hatte, als mich ein Geräusch jäh aufschreckte. Eine Tür wurde zugedrückt, ein Schlüssel umgedreht. Schritte auf dem Flur. Die knarzende Treppe …Verließ da jemand mitten in der Nacht das Hotel? Schlich sich vielleicht das Mädchen davon? Wann waren die beiden überhaupt zurückgekommen? Ich hatte nichts gehört.
Ich warf einen Blick auf das Leuchtzifferblatt meiner Armbanduhr: 3:10 h! Zu früh zum Auschecken, für wen auch immer. Ich stürzte aus dem Bett, stellte mich seitlich hinter den Vorhang und verwünschte den Regen, der den schwachen Lichtkegel, den die Funzel von Straßenlaterne über den Parkplatz warf, zusätzlich verschleierte.
Oha! Der Benz war da. Brav stand er neben dem Renault. Da! Jetzt tat sich unten etwas. Die Tür des Seiteneingangs öffnete sich. Licht fiel auf die Straße. Ich beugte mich vorsichtig aus dem Fenster. Ein Schuh ... ein Bein. Oh, mein Gott, es war der Deutsche! Aber was schleppte er bloß auf seiner Schulter? Das war doch ... Mir stockte der Atem. Die Kleine! Das rosa Ballonröckchen, ganz verrutscht. Und die Arme hingen wie leblos herab.
Wie leblos? Meinte ich tot? Was dachte ich denn da! Meine Kopfhaut begann heftig zu jucken. Ich hörte meinen keuchenden Atem. Sollte ich die Polizei rufen? Laut schreien? Theo behauptete immer, ich hätte eine durchdringende Stimme, wie Oskar Mazerath. Aber hatte ich mich nicht schon genug blamiert, im Lokal?
Kaum dass der Mann mit einer Hand die rechte hintere Seitentür seines Wagens geöffnet hatte, nahm er die Frau von der Schulter und schob sie, mit der anderen Hand ihren Kopf stützend – da konnte sie doch nicht tot sein oder? –, auf den Rücksitz. Dann richtete er sich auf, schien aber mit ihr zu reden. Gestikulierte sogar mit beiden Händen.
Ich zählte bis zehn (eine Marotte von mir). Ich war bei fünfzehn angelangt, als er der Kleinen eine Kusshand zuwarf, die Autotür zudrückte, um den Mercedes herumlief und sich hinters Steuer setzte. Die Scheinwerfer sprangen auf.
Jetzt erst fiel mir meine Kamera ein, die noch immer griffbereit auf dem Fensterbrett lag. Ich aktivierte sie, schoss blindlings mehrere Bilder. Einfach drauflos. Ohne Blitz. Dabei konnte ich natürlich nicht auf meine Deckung achten. Was dann passierte, ging blitzschnell: Der Deutsche setzte zurück, um die Fahrtrichtung einzuschlagen, und mich blendeten plötzlich die Scheinwerfer seines Wagens! Erschrocken trat ich zur Seite. Mein Herz hämmerte. Hatte er mich entdeckt? Mit dem Fotoapparat in der Hand?
Der Mercedes fuhr weiter. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und sah ihm hinterher. Doch dann hielt er unvermittelt noch einmal an, ungefähr auf Höhe des Hoteleingangs und der Laterne. Was hatte der Kerl vor? Aussteigen und Rabatz machen? Atemlos beobachtete ich, wie sich das Seitenfenster an der Fahrerseite öffnete. Ein Arm kam zum Vorschein und – ein ausgestreckter linker Mittelfinger!
Ich schluckte. Als der Wagen verschwunden war, warf ich die Kamera aufs Bett, tastete mich im Dunkeln – ich fand den Lichtschalter nicht – zur Toilettentür vor. Auf dem Klo sitzend, dachte ich bei mir, dass nicht nur mein Verhalten grotesk gewesen war, auch diese Szene. Was hatte ich eigentlich gerade erlebt? Eine Slapstick-Komödie der beiden? Oder einen jener Thriller, in denen es um mehr als blaue Flecken ging oder aufgeklappte Plastik-Brustkörbe – nämlich um lebendiges Häuten, um bluttriefende Kehlen, um Zehen und Finger, die der Schere zum Opfer gefallen waren?
Der Schere? Na toll! Theos Kinderschreck, der Klassiker, aus dem Dora Conrad auch noch ihren beiden Enkelsöhnen begeistert vorgelesen hatte (man beachte die Namensähnlichkeit!):
Und vor allem, Konrad, hör! Lutsche nicht am Daumen mehr; denn der Schneider mit der Scher kommt sonst ganz geschwind daher, und die Daumen schneidet er - ab, als ob Papier es wär'...
Ab, als ob Papier es wär'... Ich erhob mich, knipste das Licht über dem Waschbecken an, wusch mir die Hände und schaute dabei in den Spiegel. Entsetzlich! Wie sah ich bloß aus! Bleich wie der Mond und meine vor dem Urlaub frisch getönten Haare standen wirr vom Kopf ab und leuchteten im Neonlicht ... na, wie wohl? Bluuutig!
Allmächt', dachte ich, die halbe Menschheit war verroht und die andere Hälfte drohte verrückt zu werden. Weh! Jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab …
Am nächsten Morgen, ich war tatsächlich noch einmal eingeschlafen, zählte ich mich ernsthaft zur zweiten, zur verrückten Menschheitshälfte, denn als ich aus dem Fenster sah, war der Mercedes wieder da. Allerdings hatte ihn der Kerl relativ schräg hingestellt, so dass das Nummernschild – der Regen musste doch inzwischen allen Schmutz abgewaschen haben? – von oben nicht zu sehen war. Absicht?
Trotzig schoss ich ein weiteres Bild von der Limousine, bevor ich mich auf mein eigenes Zimmer begab, um zu duschen. Draußen auf dem Gang roch es bereits nach Kaffee. Vor Zimmer 11 hielt ich einen Augenblick inne. Alles war still. Meine lieben Nachbarn schliefen wohl noch. Was hatten die beiden nur mitten in der Nacht getrieben?! Waren sie betrunken gewesen?
Völlig verblüfft war ich indes, als ich den Frühstücksraum betrat und der Berliner bereits dort saß, in der Nähe des ersten Fensters, die Nase hinter einer Ausgabe der Les Échos versteckt, dem französischen Pendant der Financial Times. (Wo hatte er die her, so früh am Morgen?)
Nach meiner nächtlichen Paparazzi-Orgie hätte ich am liebsten kehrtgemacht. Doch eine solche Blöße wollte ich mir nicht geben. »Bonjour, Monsieur«, ich nickte.
Er erwiderte meinen Gruß auf ähnlich knappe Weise, ohne die Zeitung zu senken, was mir ganz recht war. Ich setzte mich an einen Tisch, weit genug von ihm entfernt, und nahm mir vor, die Sache mit Humor zu tragen, ausgiebig zu frühstücken und dann nach Castelnaudary zu fahren. Als Aurélie den Kaffee und die heiße Milch brachte, erklärte ich ihr die Sache mit meiner Freundin, und noch während Madame am Unglück Anteil nahm, klingelte mein Handy. Mareike!
Ich lief hinaus ins Freie. Es regnete nicht mehr, die Luft war jedoch noch immer frisch und auf den umliegenden Gipfeln glänzte Neuschnee.
Endlich erfuhr ich, was sich zugetragen hatte: Ein Lastwagen mit Kühlaggregaten war auf der Autobahn umgekippt, gerade als Ximeno zum Überholen angesetzt hatte. Er war noch in der Nacht operiert worden. Milzriss und andere Verletzungen. Mareike würde vorläufig in Lissabon bleiben.
Bereits während unseres Gesprächs hatte ich mich wie zufällig dem schwarzen Mercedes genähert. Doch als ich meinen Vorsatz in die Tat umsetzen wollte, nämlich das Kennzeichen mit dem Handy zu fotografieren, stellte ich verdutzt fest, dass an der Stelle des Berliner Nummernschilds ein französisches prangte: Schwarzer Untergrund, weiße Zahlen. Doch diese Art von Kennzeichen gab es meines Wissens gar nicht mehr. Und wieso der Wechsel? Gestern deutsch, heute französisch? (Dass die beiden letzten Ziffern, in diesem Fall 66, auf das jeweilige Departement hinwiesen, wusste ich von früher.)
Ich hörte Stimmen. Drehte mich um, erschrak. Der Berliner stand unter der Tür und verabschiedete sich gerade von Madame Aurélie. Fuhr er denn ohne seine Freundin ab?
Ich tat, als hätte mich der Benz überhaupt nicht interessiert, lehnte mich seitlich an meinen GTI, quatschte einfach weiter ins Handy hinein, obwohl das Gespräch längst beendet war, lachte, schimpfte, gestikulierte.
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete ich, wie der Mann einen schwarzen Rucksack schulterte und eine Reisetasche aufnahm. Ich hörte, wie er Aurélie gute Geschäfte wünschte – und schon steuerte er auf seinen Wagen zu. Ich rührte mich nicht von der Stelle, telefonierte weiter ins Leere hinein, sah durch den Mann hindurch. Er war schon fast an mir vorüber, als er innehielt. Er stellte die Tasche ab, nahm den Rucksack von der Schulter, bückte sich und – ich traute meinen Augen kaum – studierte demonstrativ mein Nummernschild. Mein Nummernschild! Die Welt war auf den Kopf gestellt.
Jetzt reichte es mir. Ich sagte Tschüs, klappte das Handy zu, trat vor den Mann hin. »Soll ich Ihnen vielleicht Papier und Bleistift besorgen?«, fragte ich ihn auf Deutsch.
»Nicht nötig!« Er grinste unverschämt und schulterte wieder seinen Rucksack.
»Na, dann gute Reise«, sagte ich lapidar. »Und grüßen Sie herzlich Ihre hübsche Tochter von mir!«
Mit diesen Worten ließ ich ihn stehen. Ein wildes Lachen flog mich an, als er mir ein sehr unfeines Wort hinterherrief. An eine weiße Weste dieses Herrn glaubte ich nicht mehr. Ich drehte mich bewusst nicht um, als er mit quietschenden Reifen davonfuhr, ob mit oder ohne Stinkefinger, war mir egal. Ich fühlte mich wie befreit. Aber dennoch …
»Madame!«, sagte ich entschlossen zu Aurélie, die sich an der Rezeption zu schaffen machte, »darf ich Sie mal was fragen?«
»Mais oui! Soll ich Ihnen mit dem Gepäck Ihrer Freundin behilflich sein?«
»Nein, nein, danke«, wehrte ich ab. »Ich weiß zwar, dass es mich nichts angeht. Aber ich sorge mich um den Verbleib der jungen Frau, deren Begleiter gerade aufbrach. Ich habe die zwei in der Mühle von Aveux kennengelernt. Ist sie vor ihm abgereist?«
Aurélie nickte bekümmert. »Gewissermaßen«, flüsterte sie, »die Ärmste hatte heute Nacht eine Fehlgeburt. Ihr Mann musste sie ins Krankenhaus schaffen.«
Ich schluckte. Ungelogen, ich war betroffen.
Beim Frühstück ging mir so allerlei durch den Kopf. Dass ich derart überreagiert hatte, konnte nur mit der Affäre Calas zusammenhängen, wie ich den Fall meiner Freundin Sandrine nenne. Damals, als ich ihr in Frankreich beistand, hatte uns zeitweise eine schwarze Limousine mit getönten Fenstern verfolgt ... Hätte ich vielleicht doch auf Theo hören und daheim bleiben sollen, statt hier nach verdächtigen Schatten aus der Vergangenheit Ausschau zu halten?
Andererseits gab es in der aktuellen Affäre (Affäre B., wie Berlin?) noch immer eine Ungereimtheit: das Kennzeichen. Doch wer weiß, vielleicht tauschte es der Kerl gerade in diesem Augenblick wieder aus, grinsend, das neugierige Weib mit rotgetöntem Haar an der Nase herumgeführt zu haben.
Absurd! Steffi, wie kannst du nur so etwas denken! Der Berliner Typ mag ein Idiot sein, aber seine Frau, das arme Ding, liegt im Krankenhaus. Schluss jetzt mit den Affären. Schluss mit der Grübelei – und Schluss auch mit der Völlerei! Punkt.
Ich schob entschlossen das Körbchen mit den röschen Buttercroissants ans äußerste Ende des Tisches.
Um halb zehn ging ich nach oben, um zu packen. Auf dem Flur vor Zimmer 11 stand ein Staubsauger, die Tür war offen. Ich hielt inne. Eigentlich sollte es mir schon erlaubt sein, einen winzigen Blick ins Zimmer zu werfen, nachdem ich die halbe Nacht Miss Marple gespielt hatte. Eilig kramte ich in meiner Börse nach einem Geldschein.
Die Putzfrau freute sich und war sofort bereit, sich mit mir zu unterhalten. Während sie mir von ihren Söhnen erzählte, die im Jahr zuvor als Austauschschüler in Deutschland gewesen waren, und zwar in Göttingen, ließ ich meine Augen durchs Zimmer wandern. Nichts Auffälliges. Auf dem Tisch, von der Reinigungskraft bereits zusammengestellt, eine leere Champagnerflasche und zwei benutzte Gläser. Auf einem der beiden Rokoko-Nachtschränkchen ein blauer Zimmermannsbleistift mit Werbeaufdruck, mehrere zerknüllte Papiertaschentücher, ein Apfelbutzen. Die Betten waren zurückgeschlagen. Normal verknitterte Laken. Keine Flecken. Merkwürdig. Verlor man denn nicht Blut, wenn sich eine Fehlgeburt ankündigte? Und trank man Champagner, wenn man schwanger war?
Eine Stunde später verließ ich, wütend auf mich selbst, Saint-Bertrand de Comminges, ohne mir die Ausgrabungen angesehen zu haben oder gar Saint-Just, das Totenkirchlein im Tal, das sich Basilika nannte.
3
Isabelle Pagnol, irgendwo auf dem Land
Sie schlägt die Augen auf und sofort bricht wieder alles über sie herein: O.W. hat sie verschleppt. Aufs Land. Draußen gackern Hühner. Sie selbst befindet sich offenbar in einer alten Schule, denn diesen speziellen Geruch nach Kreide, Staub und Schülerschweiß kennt sie seit Jahren.
Erneut beginnt sie um Hilfe zu rufen. Immer fünfmal hintereinander. Dann legt sie eine Pause ein, um zu lauschen. Disziplin. Panik ist kontraproduktiv …
Dass O.W. nie vorhatte, mit ihnen ein zweites Mal in die Toskana zu fahren, ist ihr auf dem Parkplatz sofort klargeworden. Doch Kidnapping, Menschenraub, das zählte zu den Kapitalverbrechen! Wieso ging er ein solches Risiko ein? Obwohl ... erste Anzeichen, dass O.W. nicht der war, für den sie ihn hielten, hatte es bereits im letzten Sommer gegeben.
Da! Ein Geräusch. Ein Kratzen, Scharren?
Isabelle setzt sich auf. »Hilfe«, brüllt sie wieder. »Hiiilfe!« Fünfmal hintereinander. Dann lauscht sie: Nichts. Nur das blöde Gackern.
Das ist kein Witz mehr! O.W. kann sie doch hier nicht … verrecken lassen! Sie steht auf, schleppt sich mitsamt der Kette, ihrer Fußfessel, zum Tisch, trinkt fünf Schlucke aus der Wasserflasche, um sich zu beruhigen – nicht, weil sie Durst hat. Disziplin. Panik ist kontra … Warum nur haben sie sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen und weder Opa Sam noch den Propheten ernst genommen!
Der Prophet ... Über seine Rolle ist sich Isabelle nicht im Klaren. Letzte Woche beim Abschlussball, in der zweiten Tanzpause, hat er sie nach ihren Ferienplänen gefragt.
»Wir fahren wieder in die Toskana, Professor«, hat ihm Lara wahrheitsgemäß und sogar ohne rot zu werden geantwortet. Da ist Brissac mit einem Mal ganz blass geworden.
»In die … Toskana, aha«, hat er gesagt und sie dann beiseitegenommen: »Passt bitte auf euch auf, Mädchen, hütet euch vor Wölfen, die im Schafspelz zu euch kommen. Es würde eurem Großvater das Herz brechen, wenn euch etwas zustößt. Denkt ... denkt an eure Mutter.«
Isabelle seufzt. Merkwürdig ist sein Verhalten gewesen, wirklich äußerst merkwürdig. Und peinlich. Oberpeinlich, hat Lara später sogar gemeint. Denkt an eure Mutter, das kannten sie bereits. Doch hütet euch vor Wölfen im Schafspelz? Nun, es war Brissacs Art, blumig und zweideutig daherzureden, aber in diesem Fall hat er offenbar gewusst, dass sie in Gefahr schwebten. Er hat es gewusst, ja! Er hat es gewusst!
Isabelle verschließt die Flasche und setzt sich auf einen der wackligen Klappstühle. Sie wischt sich die Tränen ab, stützt die Ellbogen auf den Tisch, den Kopf in ihre Hände und schließt die brennenden Augen: Sie sieht ihn vor sich, den alten Mann. Das weiße schulterlange, oft ungepflegte Haar. Den dicken Leib. Die stets verknitterten Leinenanzüge. Die Pfeife im Mundwinkel – ja, sie glaubt geradezu sein asthmatisches Keuchen beim Treppensteigen zu hören. Sie haben Brissac schon gekannt, als sie noch zur Grundschule gingen. Er und Opa Sam sind Freunde gewesen, haben sich einmal im Vierteljahr in Saint-Gaudens im Café getroffen. Zum Schachspielen und Reden. Und ab und zu ist der Prophet auch zu ihnen nach Hause gekommen. Aber nur selten.
Wann haben diese regelmäßigen Treffen eigentlich aufgehört?
Isabelle zuckt verzweifelt die Achseln. Irgendwann im letzten Jahr muss es gewesen sein, denkt sie.
Irgendwann im letzten Jahr?
Da durchfährt es sie siedend heiß. Vermutlich nach dem Schüleraustausch in Deutschland. Nachdem O.W. in ihr Leben getreten war.
Hütet euch vor Wölfen im Schafspelz!
Merde! Die Warnung war zu spät gekommen. Sie saßen in der Klemme, und zwar … kolossal! Und was, wenn er Lara etwas … angetan hat?
Nur keine Panik, Isabelle! Nur keine Panik!