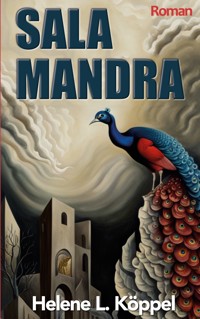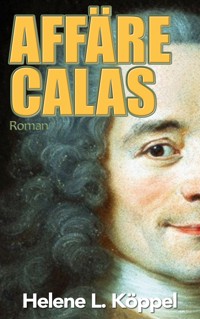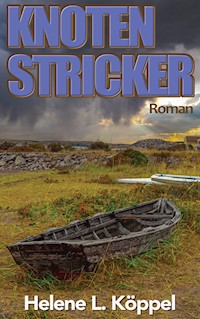
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Südfrankreich. Sommer. Der Geruch von Pinien. Doch die Idylle trügt: Von einer hochgelegenen Jagdhütte aus beobachtet jemand aufmerksam die Ankunft der Schriftstellerin Annrose Pfeifer. Als sie nichtsahnend mit ihrem Mann aus dem Wagen steigt, fällt ein Schuss - und Annrose, die noch soviel vorhat im Leben, muss mit ansehen, wie von einer Sekunde auf die andere ihre Welt zerbricht. Der Fall hält Kommissar Claret und die zuständige Staatsanwältin in Atem, denn es deutet einiges darauf hin, dass die Autorin der Toulouser Drogenmafia in die Quere kam. Doch dann gibt es noch einen weiteren beunruhigenden Verdacht. "Knotenstricker" ist ein pechschwarzer Psychothriller mit Südfrankreich- und Schwedenflair, in dem es um mehr geht, als um Plagiat, Rache und gestörte menschliche Wahrnehmung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface (Le Commissaire)
Nicht des Ruhmes wegen …
Die meisten Kriminalfälle, die ich als Kommissar mit meinem Team aufklären konnte, habe ich nach ihrem Abschluss rasch ad acta gelegt, um den Kopf für neue Fälle freizubekommen. Zugegeben: Nicht gänzlich frei, das nicht. Ein Ermittler muss immer auch seine alten Fälle abrufen können, um Vergleiche zu ziehen.
Beispiellos wird für mich jedoch der Fall der Schriftstellerin Annrose Pfeifer (alias Hannah Miller) bleiben, deren Leben im Sommer 2012 in eine schwere Krise geriet. Angst um diese Frau war das Gefühl, an das ich mich in der Zeit am stärksten erinnere, aber auch Angst um meine eigene Familie: Die Angst, der Täter könnte erneut zuschlagen.
Nach Abschluss des Falles setzte ich mich mit Hannah Miller noch einmal in Verbindung. »Sollte aus Ihrer Geschichte irgendwann ein Roman werden, Madame«, sagte ich zu ihr, »würde ich gerne den Anteil beisteuern, den ich vertreten kann. Nicht des Ruhmes wegen, nur der Vollständigkeit halber!«
Und so sind wir verblieben.
Maurice Claret, Commissaire de Police
Toulouse/Département Haute-Garonne
In Memoriam Robert
L’un part, l’autre reste …
(Der eine geht, der andere bleibt)
(Charlotte Gainsbourg, Chanson)
Inhaltsverzeichnis
EPISODE I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
EPISODE II
Zwei Jahre später ...
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
EPISODE I
Genf
1
__________
Die Autorin
Saarlouis/Genf, Donnerstag, 19. Juli 2012
Unbegreiflich eigentlich, dass es Tage gibt, an denen einfach alles schief läuft …
Zuerst war beim Einsteigen in den Zug ein kurzer heftiger Platzregen niedergegangen, der sich anhörte, als ob Millionen kleiner Glaskugeln auf das Dach des Waggons prasselten. Dann hatte sich Annrose Pfeifer, nass bis auf die Haut, mit ihrem Trolley durch die verstopften Gänge gequält, nur um kurz darauf festzustellen, dass ihr reservierter Sitzplatz bereits belegt war: Eine junge Mutter mit Kleinkind, beide ebenfalls sichtlich durchnässt, sah sie derart verzweifelt an, dass sie ihr bedeutete, sitzenzubleiben. Sie würde sowieso gleich umsteigen müssen, sagte sie, sie wolle nach Genf.
Aufatmend lehnte sie sich im benachbarten Gepäckabteil mit dem Rücken an die Wand und trocknete sich mit Papiertaschentüchern notdürftig Gesicht und Haar. Ihre Frisur war vermutlich im Eimer und ihr neuer, hellgrauer Businessanzug roch ganz sicher so muffig-feucht wie die Boucléjacke der älteren Dame neben ihr. Beunruhigend fand sie es auch, dass der Zug nicht pünktlich weiterfuhr. Sie hatte doch beim nächsten Zwischenstopp in Saarbrücken nur fünf Minuten Zeit zum Umsteigen. Und tatsächlich rauschte ihr der Anschlusszug vor der Nase weg, und sie musste fünfzig Minuten auf den nächsten warten. Damit rannte ihr aber auch die Zeit davon. Sie hätte auf Robert hören und einen früheren Zug nehmen sollen!
Schließlich, als wenn es mit den Pannen an diesem Tag noch nicht reichen würde, verstauchte sie sich, der Eile geschuldet, im Bahnhof Genf-Cornavin den linken Knöchel. Das jedoch fand sie nun fast schon wieder zum Lachen.
Leicht hinkend, die Kleidung klamm, verließ Annrose den Bahnhof durch den Haupteingang. Doch bereits unter dem Vordach blieb sie abrupt stehen. Verdammt, der Tag war tatsächlich wie verhext: Auch in Genf schüttete es wie aus Gießkannen.
Sie zog die Einladungskarte aus ihrer Umhängetasche: Hotel Warwick, Rue de Lausanne 14, 1201 Genève, Schweiz, Beginn 20 Uhr. Zimmer reserviert.
Ein Blick auf die Bahnhofsuhr, dann humpelte sie mitten durch den Regen zum Taxistand. Der erste Chauffeur, den sie fragte, deutete auf ein in der Nähe befindliches hohes Gebäude. »Das Warwick schaffen Sie besser zu Fuß«, meinte er.
Besser zu Fuß? Na, dann … Annrose überquerte todesmutig die stark befahrene Straße und ratterte kurz darauf mit ihrem Rollkoffer in die elegante Lobby des Hotels.
Auf dem Weg zur Rezeption kam ihr ein junger Mann in einer verwaschenen orangeroten Jeansjacke und mit geschultertem Rucksack entgegen. Sie wollte ausweichen und – was hatte sie erwartet, an einem Tag wie diesem? – natürlich wich er zur selben Seite aus! Der zweite Versuch, nun nach der anderen Richtung, scheiterte ebenfalls.
»Sorry«, japste sie, während ihr die Regentropfen in den Nacken liefen, »meine Schuld, bin in Eile!«
»Aber nein, meine Schuld«, sagte er lachend und ließ ihr den Vortritt.
Annrose trat an den Tresen und nannte ihren Namen. Während der Rezeptionist seelenruhig den PC befragte, nahm sie aus den Augenwinkeln heraus wahr, dass der junge Mann, mit dem sie beinahe kollidiert wäre, plötzlich schräg hinter ihr stand. Hatte er nicht schon eingecheckt? Irritiert drehte sie sich nach ihm um. »Ja, bitte?«
»Literatur-Agentur Valtus?«, fragte er, kaugummikauend. Er war nicht viel größer als sie, vielleicht einsfünfundsechzig, zierlich gebaut, dunkelhaarig, ein mediterraner Typ.
Sie nickte erleichtert. »Sie etwa auch?«
»Bien sûr! Dann sind wir wohl Kollegen. Können wir uns duzen? Ich bin Danilo. Danilo Plonsky. Schon von mir gelesen?«
Annrose stutzte, lachte aber dann, weil er ihr zuzwinkerte. »Leider nein!« Sie nahm ihr Zimmerkärtchen entgegen und stellte sich ihm ebenfalls namentlich vor.
Ein erschrockener Blick auf die Uhr, und sie stürmten gemeinsam in Richtung Aufzug.
»Welches Stockwerk?«, fragte er, die Hand bereits auf der Schalttafel mit den Knöpfen.
»Sechstes«, antwortete sie. »Hoffentlich dauert es nicht ewig … Mein Zug hatte ein Problem, und dann noch der verdammte Regen heute.«
»Mach dich nicht verrückt«, meinte er. »Wir verpassen höchstens das Champagnersüppchen. Wollen wir nachher zusammen zum Empfang gehen? Sagen wir, in dreißig Minuten? Schaffst du das zeitlich? Mit der … Frisur und so?«
Sie zögerte nicht eine Sekunde. »Aber ja!«, sagte sie dankbar. »Warten wir im Flur aufeinander?«
»Okay, bis dann …«
Danilo Plonsky bezog das Zimmer ihr schräg gegenüber.
Als sie eine halbe Stunde später gemeinsam den »Jura-Saal« betraten – Annrose im schwarzen Hosenanzug, das Haar geföhnt und locker hochgesteckt, Danilo Plonsky in derselben Jeans wie zuvor, aber mit weißem Mozarthemd –, war leise Musik und gedämpftes Stimmengemurmel zu hören. Jemand lachte pathetisch, und in irgendeiner Unterhaltung ging es um die Genfer Syrienkonferenz.
Chris Valtus zu entdecken, fiel Annrose leicht: Der Gastgeber überragte alle. Er war mindestens einsneunzig groß, von kräftiger Statur und tief gebräunt. Sein Haar trug er gegelt und streng zurückgekämmt. Wiedererkannt hätte sie Valtus aber auch sofort an seinem schwarzen Dali-Bärtchen. Sie hatte den Agenten vor zwei Jahren bei der Unterzeichnung ihres ersten Buchvertrages in Straßburg kennengelernt.
Plötzlich entdeckte er auch sie. Er ließ seinen Gesprächspartner stehen und kam mit ausgestreckten Armen auf sie zu.
»Ah, bon soir, Ännchen!«, rief er und küsste sie, wie in der Schweiz üblich, dreimal auf die Wangen. »Bienvenu, willkommen in Genf! Champagner?« Er schnippte mit den Fingern, worauf eine Bedienstete mit einem Serviertablett erschien. Dann begrüßte er ähnlich herzlich Danilo Plonsky, bevor er weitereilte, um andere Autoren willkommen zu heißen.
Doch nun gesellte sich Tonia zu ihnen, die Agentin, die Annrose betreute. Danilo Plonsky hatte ihr im Aufzug verraten, dass man sie »die Löwin« nannte. Annroses Eindruck war ein anderer: Mit ihrer Wuschelfrisur und dem rotbraunen Flatterkleid ähnelte Tonia verblüffend dem Rembrandt-Engel, der mit Jakob kämpft.
Die Agentin machte sie nach und nach mit den anderen Gästen bekannt: Keine großen Namen, eher ein Medley aus dem gesamten Bereich der Unterhaltungsliteratur.
»Man soll mit Lob ja bekanntlich sparsam sein«, raunte sie Annrose zwischendurch zu, »aber deine beiden Romane laufen noch immer unerhört gut. Und THIRD, das wird dir gefallen, ist seit gestern ebenfalls in trockenen Tüchern. Tolles Angebot, du wirst staunen! In diesem Zusammenhang: Der Boss will dich zukünftig selbst unter seine Fittiche nehmen, hat er gesagt.«
Bei aller Freude über die guten Nachrichten wurde Annrose flau im Magen. Mit plötzlichen Veränderungen hatte sie manchmal Probleme. »Ah ja? Ich bin gespannt«, sagte sie, was mehr als lahm klang, wie sie selbst feststellte. Tonia jedoch – der Engel! – schloss sie ein weiteres Mal herzlich in ihre schlanken Arme. Nun, diese Frau war tough, das musste man neidlos anerkennen, schlagfertig, souverän, witzig. Tja, und ganz bestimmt erfolgreich!
Beim Diner trat ein avantgardistischer Klavierspieler auf. Er trug Pepita wie ein Clown und mühte sich am Flügel mit The Book of Musik von John Cage ab. Annroses Tischnachbar zur Rechten war Ben, ein junger Fantasy-Autor, der ihr, nachdem das Eis gebrochen war, lang und breit die »einzigartige Welt« erklärte, die er für seine Roman-Reihe erschaffen hätte. Irgendwann, nachdem der Pianist einer Drei-Mann-Band Platz gemacht hatte, stand Ben auf. Er müsse mit Mama telefonieren, entschuldigte er sich, Papa sei schwer erkrankt. Annrose reichte ihm die Hand und wünschte ihm und seiner Familie alles Gute. Sie selbst hätte sich eher die Hand abgehackt, als das Fest vorzeitig zu verlassen, obwohl sie müde war. Während sie amüsiert beobachtete, wie die Löwin mit Chris Valtus Rock’n Roll tanzte, setzte sich Danilo Plonsky auf Bens Platz. Er hatte sein Weinglas mitgebracht, und sie bemerkte, dass seine Hand zitterte, als er das Glas abstellte.
»Verzeih, liebreizende Kollegin, aber ich tanze nicht«, sagte er, »im anderen Fall hätte ich dich natürlich gerne aufgefordert.«
Sie lachte. »Und ich hätte dir einen Korb gegeben.« Sie verwies auf ihren linken Knöchel, der inzwischen leicht angeschwollen war. »Bin im Bahnhof, beim Verlassen der Rolltreppe, umgeknickt«, sagte sie.
»Dann lass dir später einen Eisbeutel aufs Zimmer bringen«, riet ihr Danilo. Er rückte näher an sie heran. »Tonia sagt, du sitzt beruflich fest im Sattel?«, meinte er, irgendwie zusammenhanglos. »Kannst du bereits vom Schreiben leben?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wer kann das schon«, sagte sie und nippte an ihrem Weinglas, »ich arbeite drei Tage in der Woche in einem Teehaus. Die restliche Zeit schreibe ich. Mindestens vier Stunden am Tag, manchmal auch mehr.«
»Teehaus? Na, wenn das keine Inspirationsquelle ist«, meinte er grinsend. »Geile Idee übrigens, deine Romane mit englischen Ordnungszahlen zu betiteln. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Komisch allerdings …«
»Was ist komisch?«
»Nun, dass wir Agentur-Autoren uns offenbar gegenseitig ignorieren. Ich kenne deine Bücher nicht und du nicht meine. Hab vorhin auf dem Zimmer mal kurz gegoogelt. Klingt spannend, was du schreibst! Beantwortet aber meine Frage nicht: Warum lesen wir so selten die Werke unserer Kollegen? Platzneid?«
Annrose musste plötzlich an Paul Balthasar denken, was sie lange nicht mehr getan hatte … »Vielleicht Angst vor der Entdeckung, der oder die andere könnte besser sein als man selbst?«
Danilo zwinkerte ihr zu. »Oder trickreicher?«
Sie hob die Schultern. »Ich weiß nicht, wie du das meinst. Ich denke, jeder hält seine Arbeit erst einmal für das Nonplusultra.«
»Nun ja, bis die Verkaufszahlen oder die Rezensionen ihn eines Besseren belehren. Hast du zufällig ein Exemplar von FIRST auf dem Zimmer?«
»Denkst du an einen Büchertausch?«
Danilo nickte. »Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass ich sofort reinlese. Hab derzeit Konzentrationsprobleme … ist zum Haareraufen.«
»Ah, das wird schon wieder«, beruhigte sie ihn. »Probier es mal mit frischer Luft, Vitaminen und Magnesium … Aber Büchertausch finde ich okay. Erinnere mich vor der Abreise daran. Oder fährst du wie Ben bereits morgen früh heim?«
»Wo denkst du hin! Ich lass mir doch nicht den Vortrag über Seine Lordschaft Byron entgehen«, sagte Danilo grinsend. »Zu schaffen und im Schaffen tiefres Leben zu finden, darum dichten, formen wir.«
»Lord Byron? Der Dichter? Und weshalb der Spott?«
»Nun, kannst du dir vorstellen, dass es noch immer Menschen gibt, die Byron verehren? Die Griechen mal ausgenommen, die ihn als Nationalhelden schätzen, nachdem er sie in ihrem Freiheitskampf gegen die Türken unterstützte. Aber darüber hinaus?« Er bog sich plötzlich vor Lachen. »Bizarr, völlig bizarr! Wusstest du, dass Byron seine Halbschwester ›Goose‹ nannte und sie ihn ›Baby Byron‹? Nun, irgendwann hat er der dummen Gans ein Kind gemacht. Doch! Schau mich nicht so ungläubig an. Ist das nicht zum Lachen?«
»Hm, wenn du meinst …«
Da beugte er sich über den Tisch und zog eine angebrochene Bordeaux-Flasche zu sich heran, die er offenbar hinter dem Blumenschmuck gebunkert hatte.
»Trinkst du noch ein Glas mit mir, Ännchen?« Er spitzte den Mund zum Kuss.
»Annrose!«, betonte sie, »und ich bin verheiratet.« Sie reichte ihm dennoch ihr Glas.
Er schenkte ihr und sich ein, lehnte sich dann jedoch, mit dem Glas in der Hand, im Stuhl zurück. Er trank. Er trank schnell.
Dann drehte er sich wieder zu ihr um. »Verheiratet? Du bist wirklich verheiratet? Wie profan. Künstler heiraten doch nicht. Freie Liebe. Unglückliche Liebe!«
Annrose hob die Brauen. »Oh, ich verstehe. Um zum Dichter zu werden, muss der Mensch verliebt sein oder sich elend fühlen?«
Danilo stutzte, dann begann er zu kichern: »Hi, hi, du kennst Byron ja doch!«
Nun war es an Annrose, verdutzt zu sein. »War das eben von Byron?«
»War es!«
»Also verheiratet bin ich jedenfalls glücklich. Seit zwei Jahren schon. Hab’s bislang nicht bereut.«
»Schade«, meinte Danilo, »man schreibt wirklich verdammt viel besser, wenn man unglücklich ist.« Weil die Flasche leer war, schwankte er hinaus, um Nachschub zu holen, wie er sagte.
Aber dann kehrte er nicht mehr in den Saal zurück. Annrose war froh darüber und suchte eine halbe Stunde später ihr Zimmer auf.
Sie war kaum eingeschlafen, als es an ihrer Tür hämmerte. Danilo stand draußen. In Jeans und mit nacktem Oberkörper. Erst jetzt sah sie, wie zierlich er gebaut war. Das Mozarthemd mit den vielen Rüschen hatte seine Magerkeit verborgen.
»Was ist los?«, raunte sie durch den Türspalt.
»Lass mich rein. Meine Hände faulen mir gleich ab. Ich hab dir einen Eisbeutel besorgt«, sagte er fast vorwurfsvoll. Doch nachdem Annrose nicht zurückwich, reichte er ihr die blaue Kühlkompresse durch den Spalt. »Ich dachte, wir könnten auch gleich den Büchertausch vornehmen. Ich hab nämlich nichts mehr zu lesen. Oder hast du es vergessen?«
»Vergessen? Weißt du, wie spät es ist? Ich hab schon geschlafen! Aber danke für den Eisbeutel, warte einen Augenblick.«
Sie drückte vorsichtshalber die Tür zu (sie trug nur ein kurzes Sleepshirt mit albernen Teddybären drauf), und humpelte zum Kofferbock, wo ihr Trolley lag.
Als sie Danilo mit den Worten »ich signiere es dir morgen früh«, ihren Roman FIRST in die Hand drückte, zauberte er plötzlich mit einer ausholenden Handbewegung eines seiner Bücher hervor. Dabei schaltete sich der Bewegungsmelder im Flur ein, und das Licht fiel direkt auf Danilos linken Unterarm … Sie erschrak, ließ sich aber nichts anmerken. Nachdem sie ihm viel Vergnügen beim Lesen gewünscht hatte, wie man das zu später Stunde so tat, bedankte sie sich nochmals für die Kompresse und zog die Tür hastig wieder zu.
Am nächsten Morgen bemerkte sie, wie sich Danilo Plonsky beim Betreten des Frühstückraums suchend umschaute – und prompt nahm er wie selbstverständlich an ihrem Tisch Platz, ein charmantes Lächeln und ein gespielt geknicktes »Sorry« wegen der nächtlichen Störung inklusive.
»Für mein Verhalten gibt es nur eine Entschuldigung, geschätzte Kollegin«, sagte er. »Zuviel Wein! Kann ich es wieder gutmachen? Hast du irgendwelche Verpflichtungen in Genf? Ich meine, vor heute Abend?«
Sie zuckte die Achseln. »Eigentlich nicht. Ich wollte mir einiges ansehen …Warum?«
»Nun, die Sonne scheint. Wie bestellt, nach dem Regen gestern. Machen wir gemeinsam einen Stadtbummel? Wir könnten uns unter die Schönen und Reichen mischen, Schaufenster angucken oder auch nur unten am See gemütlich auf einer Bank sitzen und fachsimpeln, wenn du magst. Magst du? Sag ja!«
Sie seufzte. »Na gut, einverstanden. Weil du gerade von den Schönen und Reichen sprichst: Vorhin habe ich vom Fenster aus zwei rote Ferrari entdeckt und einen silbernen Lamborghini …«
Danilo lachte. »Darling, ich zeige dir nachher das Schaufenster von Tiffany, versprochen! Und, falls du es noch nicht weißt: Der Teufel trägt Prada.«
Sie grinste. »Der Teufel soll mich holen, wenn ich mir diesen Stadtbummel entgehen lasse!«
Als sie, den Jet d’eau im Blick, das Wahrzeichen von Genf, in Richtung See schlenderten, legte Danilo unvermittelt seinen Arm um ihre Schultern.
Rasch schüttelte sie ihn ab. »Sag mal, hast du keine Freundin? Wo wohnst du eigentlich?«
»In Toulouse«, antwortete er. »Bei einem Kumpel, und ich arbeite wie du, in einer Kneipe. Einem Café, das meinem Bruder gehört. Im historischen Zentrum der Stadt. Manchmal penne ich auch dort, wenn es spät wird. Eine Freundin hab ich derzeit nicht. Meine Ex ist seit Weihnachten weg. Hat es nur ein halbes Jahr mit mir ausgehalten. Künstlerpech …«
Als sie ihm einen zweifelnden Blick zuwarf – sie wusste nicht, woran es lag, dass sie nicht alles für bare Münze nahm, was er von sich gab –, verzog er wieder spöttisch den Mund.
»Du glaubst mir nicht? Nun, die gute Weihnachtsfee hat noch den Baum geschmückt, mit lauter bunten Schokobüchern, um mich zu verarschen, verstehst du, und dann … Adieu. Ach, vergiss es, lass uns den Tag genießen!«
Obwohl er Schriftsteller war, besaß Danilo Plonsky kein Sitzfleisch, zumindest nicht hier in Genf. Kaum, dass sie zehn Minuten am See auf einer Bank Platz genommen hatten, trieb es ihn schon weiter. Erneut kam er ihr seltsam nervös vor – und dass er bei diesem Prachtwetter wieder ein Hemd mit langen Ärmeln trug … Aber das ging sie schließlich nichts an.
Nach einem ausgedehnten Schaufensterbummel schlug er vor, sich auf die Suche nach dem Temple de la Madeleine zu machen, der auf dem Grund und Boden eines römischen Heiligtums stehen sollte. Calvin hätte hier einst gepredigt, meinte er und überraschte sie damit einmal mehr mit guter Allgemeinbildung. Doch als sie dort in der größten Mittagshitze ankamen, verzogen sie sich stattdessen mit jeweils drei Kugeln Eis in den Säulenschatten der Kathedrale Saint-Pierre, wo sie sich auf die oberste Treppenstufe setzten.
Kaum, dass sie Platz genommen hatten, hetzte neben ihnen, mit geraffter Soutane, ein Priester die Stufen hoch. Sie grüßten, doch er tat, als seien sie gar nicht vorhanden.
»Seltsam«, meinte Danilo.
»Was? Dass ein Priester in die Kirche rennt?«
»Nein, wie gut wir zwei zusammenpassen«, spottete er. »Wir schreiben Thriller. Wir arbeiten in der Gastronomie. Unsere Lieblings-Eissorten sind Vanille, Himbeer und Schoko. Zwei Autoren, die das Risiko scheuen. Ziemlich provinziell, meinst du nicht auch? Hast du eigentlich schon einen Titel für deinen dritten Roman? Oder ist das noch geheim?«
»Na, THIRD!«, antwortete sie lachend. Sie hatte sich noch immer nicht an seine sprunghafte Redeweise gewöhnt. »Bis aufs Feintuning ist mein Manuskript fertig. Und du, mit wem schlägst du dich derzeit herum? Mit einem weiteren entsprungenen Massenmörder?« Sie hatte am Morgen, vor dem Frühstück, nur einen kurzen Blick in seinen Roman werfen können, da war es bereits im Klappentext recht blutrünstig zur Sache gegangen.
Danilo schüttelte den Kopf. »Dieses Mal bewege ich mich auf besonders gefährlichem Terrain«, raunte er geheimnisvoll. »Der Stoff ist außergewöhnlich. Knapp zweihundert Seiten stehen schon. Chris drängt mich jedoch, und das belastet mich.«
»Wieso drängt er dich?«
»Er sagt, ein Verlag hätte angebissen. Einer der ganz Großen in Frankreich. Die Chance meines Lebens! Aus diesem Grund bin ich auch so nervös … Weißt du, mein Problem ist, ich kann nicht schnell schreiben. Ich brauche Zeit. Verdammt viel Zeit. Merde! Warum können die mir keine Zeit lassen! Es kann doch nur schlecht werden, wenn sie einen unter Druck setzen.«
»Warum erklärst du Chris dein Problem nicht?«
»Das tue ich ja seit Tagen!«
Er sprang jäh auf, schnappte sich die Pappbecher, um sie in einen der Papierkörbe zu werfen, die unterhalb der Treppe zwischen den alten Kastanienbäumen standen.
Annrose dachte an den Alkohol. Sie dachte auch an Drogen. Danilo tat ihr echt leid. »Möchtest du über dein ›gefährliches Terrain‹ reden?«, fragte sie, als er sich wieder neben sie setzte. Zu nah!
Er zuckte die Schultern. »Pourquois Pas …«, flüsterte er verschwörerisch in ihr Ohr, um sich danach wieder in Schweigen zu hüllen.
»Pourquois pas? Warum nicht? Was genau meinst du damit?«
Er grinste triumphierend. »Pourquois Pas ist der Name eines Forschungsschiffes, das für die französische Marine gebaut wurde. Vor zwei Jahren wurde dieses Schiff an die Absturzstelle des Air France Fluges 447 entsandt, irgendwo in der Nähe einer unbewohnten Inselgruppe. Dort sollte sie die Black Box bergen … Nun, um dieses Unglück dreht es sich. Aber nicht ausschließlich, die Rahmenhandlung ist eine andere.«
Annrose runzelte die Stirn. »Hört sich spannend an«, sagte sie. »Befanden sich Angehörige von Dir unter den Opfern? Bekannte?«
Danilo schüttelte den Kopf. »Aber nein. Mir wurde da eine Information zugespielt … Eine echt heiße Story. Mehr kann ich und mehr darf ich dir zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. Und selbst über das Wenige, das ich dir erzählt habe, bitte ich dich, zu schweigen. Wehe, du sagst ein Sterbenswörtchen!«
Gegen 19 Uhr fuhren die Gäste der Literaturagentur Valtus mit mehreren Taxis los. Ihr Ziel war die Villa Diodati, ein kleines Stück außerhalb von Genf, hoch oben im Ortsteil Cologny gelegen. Hier sollte der eigentliche Festakt stattfinden. Chris Valtus, im schwarzen Abendanzug mit gleichfarbigem Hemd und weinroter Seidenfliege, und Tonia in einem meerblauen Traum aus Taft, begrüßten ihre Gäste auf der Terrasse mit einem Blutorangen-Gin-Cocktail inclusive Minzblatt, einem »echten Frankenstein«, wie sie augenzwinkernd sagten.
Nach dem üblichen Small-Talk gesellte sich Annrose in ihrem schwarzen Etuikleid zu Danilo, der etwas abseits zwischen zwei Säulen an der Terrassenbrüstung lehnte und auf den Genfer See hinunterstarrte. Sie trat näher, dann hielt sie selbst den Atem an: Im späten Sonnenlicht glitzerte und gleißte das Wasser, und das Montblanc Massiv im Hintergrund leuchtete in kräftigem Altrosa.
»Atemberaubend schön«, sagte sie leise. Sie prostete ihm zu. »Aber was hat es mit diesem Drink auf sich? Ich weiß, wer Frankenstein ist, aber …«
»Dann warte es ab, meine Holde …«, meinte Danilo lächelnd. Als er mit ihr anstieß, war seine Hand ruhig … Nach ihrem Genf-Bummel hatte er sich auf sein Zimmer zurückgezogen, um zu schlafen, und tatsächlich sah er jetzt überraschend erholt aus. Er trug die weißen Loafer, die er sich in der Stadt gekauft hatte, dazu weiße Jeans und ein nachtblaues Hemd mit winzigen dunkelroten Tupfen. Die Ärmelaufschläge hatte er am Handgelenk lässig umgeschlagen.
Eine Glocke bat die Gäste in den Festsaal der Villa Diodati, wo schwere Lüster von der Decke hingen, Dichterbüsten auf halbhohen gusseisernen Jugendstilsäulen thronten, und der Tisch in der Mitte des Saals festlich gedeckt und mit prachtvollen Malerrosen geschmückt war. Die bodenlangen Fenster standen offen, eine leichte Brise bauschte die Gardinen.
Zum Diner gab es Steinbutt auf Limettencremesauce (eine Hommage an die Schwimmkünste Byrons, wie auf der Karte zu lesen war), danach Lamm mit gratiniertem Fenchel, wahlweise Rehmedaillons und zum Nachtisch Halbgefrorenes mit Zabaglione.
Es war schon kurz vor halb zehn, als Chris Valtus ans Rednerpult trat. Er strahlte in die Runde, räusperte sich und rückte seine Fliege zurecht. Dann begann er mit seinem Vortrag:
»Versetzen wir uns in den Sommer des Jahres 1816, ein Sommer, der später als ›Der schreckliche Sommer‹ in die Annalen eingehen wird. Und das aus nachvollziehbarem Grund: Im Jahr zuvor war der indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen – die größte Eruption seit dem Ausbruch des Taupo in Neuseeland vor etwa 25000 Jahren, mit Auswirkungen auch auf das nordamerikanische und europäische Wetter … Nun, zu diesem Zeitpunkt befinden sich der junge Lord Byron – George-Gordon Byron mit vollem Namen –, sein einundzwanzigjähriger Freund und Leibarzt John William Polidori, die zwanzigjährige Mary Godwin nebst ihrem späteren Ehemann Percy Shelley, sowie einige andere Freunde hier in Genf. Nicht enden wollender Regen und schwere Gewitter zwingen sie, sich ins Innere der Villa Diodati zurückzuziehen, die Lord Byron zuvor angemietet hat. Die Gruppe vertreibt sich die Zeit mit gutem Essen, sexuellen Ausschweifungen und stundenlangen Disputen über Gott und die Welt; sie beleuchten die Experimente Darwins und erörtern die Möglichkeit, künstliches Leben zu erschaffen. Künstliches Leben! Darwin hätte damals, so erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, in einer Glasdose ein Stückchen Maccaroni aufbewahrt, das irgendwann …«, er grinste und räusperte sich, »das irgendwann eine, äh, eine unwillkürliche Bewegung machte und …«
Der ganze Saal lachte, Chris Valtus jedoch am lautesten.
Nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, fuhr er fort: »Nun, schlussendlich lesen sich unsere … Bohèmiens, vermutlich aus Langeweile, gegenseitig deutsche Schauergeschichten vor. Da kommt Lord Byron auf eine geniale Idee: Jeder Anwesende soll am nächsten Abend eine eigene Schauergeschichte zum Besten geben … Er selbst erfindet eine, in der es um blutsaugende Vampire geht, und benutzt dazu ein Fragment seines Gedichtes ›Mazeppa‹.
Percy Shelley, der spätere Ehemann von Mary Godwin – auch der bisexuelle Byron war in Mary verliebt! – erzählt ein gar schreckliches Jugenderlebnis. Mary jedoch ist ehrgeizig. Sie will es den anderen zeigen: Ihre Geschichte soll den Freunden das Blut in den Adern gefrieren lassen!
In der Nacht kann sie nicht schlafen. Mit geschlossenen Augen sieht sie … das Stück Maccaroni vor sich liegen, ihr wisst schon …«
Wieder lachte alles.
»Endlich schläft sie ein. Ein wirrer Halbtraum bemächtigt sich ihrer: Ein Ungeheuer mit gelben, wässrigen Augen zieht die Vorhänge ihres Zimmers auseinander und starrt sie an …
Nun, meine geschätzten Autorinnen und Autoren, liebe Gäste, das gespenstische Bild ihrer Fantasie lässt sie auch am Morgen nicht los. Sie setzt sich an den Tisch und beginnt zu schreiben: Der künstliche Mensch Frankenstein entsteht. Et voilà!«
Valtus sah triumphierend in die Runde.
Annrose, die diese Geschichte nicht gekannt hatte, sah sich unauffällig um: Sie war nicht allein, nur einige wenige nickten sich wissend zu. Im Anschluss an den Vortrag informierte Valtus seine Gäste darüber, dass »Frankenstein« im Jahr 1818 von einem Londoner Verlag auf den Markt gebracht worden sei und zwar in einer Auflage von 500 Stück und zu einem Preis von 16 1/2 Schillingen.
»Damals ein halber Wochenlohn!«, warf Tonia aus dem Publikum ein, »der übliche Preis für Bücher in dieser Zeit.«
Valtus nickte zustimmend, schob das Haar hinter seine Ohren und fuhr fort: »Doch mit dem, was dann geschieht, hat niemand gerechnet: ›Frankenstein‹ erobert die Welt – trotz des hohen Preises!« Dann kam er noch einmal auf Byrons Vampire zu sprechen. »Sie konnten ›Frankenstein‹ nicht das Wasser reichen«, meinte er, »und verschwanden erst einmal in der Versenkung, bis Jahre später Polidori, der Freund und Leibarzt, die Blutsauger wieder zum Leben erweckte und Byrons Geschichte ausbaute. Mit der Figur des Captain Rutven, Edelmann und Blutsauger in einer Person, entsteht die erste Vampirgeschichte der Weltliteratur …«
Er griff zum Wasserglas, trank einen Schluck und zwirbelte anschließend sein Bärtchen. »Als Goethe Polidoris Vampirgeschichte las«, fuhr er fort, »nennt er sie vielsagend ›Byrons bestes Produkt‹.«
»Urheberrechtsverletzung!«, raunte Danilo ihr zu, worauf Annrose zum zweiten Mal an diesem Tag an Paul Balthasar dachte.
Es wurde eine lange Nacht droben in der herrlichen Villa Diodati, in der sie, wie seinerzeit Byron und Gefährten, heiße Diskussionen rund um die Literatur führten.
Danilo Plonsky verabschiedete sich als erster. »Tut mir leid«, flüsterte er Annrose zu, nachdem sich sein Smartphone gemeldet hatte, »eine unaufschiebbare Besprechung! Wir sehen uns morgen früh.«
Kurz vor Mitternacht zogen sich auch andere zurück. Ganze sechs Nachzügler traten gegen halb zwei den Heimweg ins Hotel an: Chris und Tonia – Arm in Arm mit einem arrivierten Autorenehepaar, das Historicals aus der Zeit der Französischen Revolution verfasste –, und Annrose an der Seite einer jungen Schweizerin, die Gay-Romane schrieb.
Während sie einen letzten wehmütigen Blick auf den jetzt dunklen See und die bunten Lichter von Genf warf, bedauerte Annrose, dass ihr Mann Robert nicht dabei gewesen war. Auch ihm hätte es in der Villa Diodati sehr gefallen.
Als das Großraumtaxi vorfuhr, das Tonia für sie alle bestellt hatte, stieß es beim Wenden ein Stück zurück, wobei die Schlusslichter auf eine Dreiergruppe hoher Tannen fielen. Plötzlich – es war wie ein Flash-back – glaubte sie Paul Balthasar zu erkennen, wie er gerade den Kopf beugte, um sich eine Zigarette anzuzünden. Ihr Herz hämmerte. Paul? Hier in Genf?
Das war doch nicht möglich!
2
__________
Die Autorin
Vier Jahre vorher …
Die Sache mit Paul Balthasar hatte an einem Donnerstag ihren Anfang genommen – genauer gesagt, am Donnerstag, den 19. Juni 2008.
Donnerstags war es im Teehaus von Saarlouis meist brechend voll. Warum das so war, weshalb ausgerechnet an diesem Wochentag bereits um die Mittagszeit – kein Chai vor drei? – die meisten Tische besetzt waren, wusste niemand. Es hatte sich eben im Laufe der Zeit so eingespielt.
Annrose, die früher, als Studentin, in einem kleinen Café gejobbt hatte, arbeitete auf Vermittlung ihrer Freundin Elodie seit einem guten Jahr hier, und sie hatte sogar mitgeholfen, die vormals dunkle Kneipe in einen Rausch der Farben zu verwandeln: Mangogelb, Magenta und Orange – drei Farbtöne, die sich auf den ersten Blick »bissen«, sich hier aber, im Zusammenspiel mit den schwarzen Tischen und Stühlen, den indischen Seidenvorhängen und dem breiten Vintage-Schrank perfekt ergänzten.
Gegen 18.30 Uhr kassierte sie bei ihrem letzten Gast ab. Sie suchte das Personalzimmer auf, entledigte sich des Saris und schlüpfte in ihre privaten Klamotten: Jeans und Longshirt. Schwarz. Annrose liebte Schwarz. Mit wenigen Strichen bürstete sie vor dem Spiegel ihr dunkles Haar und zog rasch die Lippen nach. Dann setzte sie die Sonnenbrille auf und schulterte ihren Rucksack. Beim Verlassen des Lokals – die Eingangstür stand der Hitze wegen offen – warf sie Elodie, die noch zu tun hatte, eine Kusshand zu. Leise klingelte das Feng-Shui-Windspiel hinter ihr her, als sie auf den Gehsteig trat, wo ihr stickig-warme Autoabgase in die Nase drangen.
Kurz darauf entsperrte sie das Bügelschloss ihres Trekkingrades, das am benachbarten Zaun angekettet war, und radelte los. Sie hatte es eilig, aber die Ampeln schienen sich gegen sie verschworen zu haben. Auf dem Parkplatz vor der Volkshochschule kettete sie das Rad wieder an, betrat das Gebäude, eilte die Treppe hoch und machte sich auf die Suche nach Raum 19, wo man sie schon erwartete: Der Kursleiter, ein großer Mann mit halblangen blonden Haaren und Dreitagebart stand unter der Tür und winkte sie herbei: Paul Balthasar.
»Sorry«, stöhnte sie, als sich in die erste Reihe setzte, »bin etwas knapp dran. Die Arbeit …«
Verstohlen wischte sie die feuchten Hände an ihrer Jeans ab. Der Tipp mit der Schreibwerkstatt war ebenfalls von Elodie gekommen, die testweise Annroses ersten Thriller gelesen und nicht wenig darin zu bekritteln gehabt hatte.
Paul Balthasar, wohl um die Vierzig, braungebrannt und sportlich, schien auch ein wenig nervös zu sein. Er hüstelte. Über die ausgefransten Jeans und die vergammelten Christuslatschen, die er trug, schmunzelte sie. Früher war sie eine Zeitlang auch so herumgelaufen, doch seit sie im Teehaus arbeitete, hatte sie sich umgestellt.
»Ich halte es in meinen Kursen immer so«, sagte Balthasar, nachdem sich alle vorgestellt hatten, »dass jeder neue Teilnehmer irgendwann seinen Einstand gibt, über den dann gesprochen werden kann. Fair, versteht sich! Hat jemand schon heute einen Text dabei?«
Annrose sah sich verstohlen um, und nachdem sich niemand meldete – einige sahen verlegen auf ihre Finger –, gab sie sich einen Ruck und hob die Hand. Balthasar nickte ihr aufmunternd zu.
Sie nahm die vorbereitete Leseprobe aus dem Rucksack, wischte sich auf dem Weg zum Stehpult mit dem Zeigefinger unauffällig den Schweiß von der Oberlippe, denn es war noch immer unerträglich heiß, und trat hinter das Pult. Ein kleines Räuspern, dann riss sie die Story an und begann zu lesen. Sie gab sich Mühe mit der Modulation und dem Rhythmus, betonte einzelne Silben stärker als andere, so wie sie es am Abend zuvor geübt hatte. Nach ihrem Gefühl las sie gut und auch nicht zu schnell. Als sie an die erste, mit Bleistift markierte Stelle kam, warf sie einen Blick auf die Uhr, die im Raum hing. Neun Minuten?
»Das reicht jetzt, glaube ich«, sagte sie. »Danke.«
Die Zuhörer klatschten verhalten. Paul Balthasar, der mit verschränkten Armen vor dem offenstehenden Fenster lehnte, dankte ihr und bat um Kritik. Niemand meldete sich. Da forderte er eine rotblonde Siebzehnjährige, deren Nasenflügel gepierct waren, auf: »Was war dein Eindruck, Lea? Nur Mut, Annrose beißt bestimmt nicht!«
Annrose lachte gezwungen.
Die Kleine seufzte. »Irgendwie fand ich das Ganze … schräg«, sagte sie, und zu Annrose gewandt: »Tut mir leid!«
Paul Balthasar rieb sich das Kinn. »Schräg? Aber nein. Ich fand es verdammt gelungen! Mitreißend, aufwühlend – und gekonnt vorgetragen, Châpeau! Was tust du eigentlich hier, Annrose? Wir sollten die Plätze tauschen!« Er strahlte sie an.
Annrose wehrte bescheiden ab und hüllte sich bis zum Ende der Stunde in Schweigen. Es war dumm gewesen, sich am ersten Abend gleich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ihr gefiel selbst, was sie geschrieben hatte.
Gleicher Ort, drei Wochen später, gegen halb neun abends:
Paul Balthasar holte Annrose auf der Treppe zum Ausgang ein. »Was ist los?«, raunte er ihr zu. »Du hast dich heute ja kaum an der Diskussion beteiligt! Bist du … verschnupft?«
Sie blieb stehen. »Aber nein, alles okay!«, sagte sie. »Ich fand die Stunde interessant. Es war nur nicht mein Thema. Ich meine … das Schreiben eines Romans nach einer wahren Geschichte.«
»Ich hätte es nicht vorziehen sollen, ich weiß, aber zwei der anderen hatten mich darum gebeten, und dann ist mir der Abend irgendwie entglitten«, entschuldigte sich Balthasar. »Interessant heute, zu erfahren, dass fast alle Angst vor dem Scheitern haben. Wie denkst du darüber?«
»Puh, wer hat die nicht? Aber sobald man sein Metier einigermaßen beherrscht, kriegt man das vielleicht in den Griff. Das hoffe ich jedenfalls. Deshalb hab ich mich ja für diesen Kurs angemeldet. Ich will dazulernen. Sicherer werden.«
»Na klar«, meinte Paul Balthasar leichthin. Er lächelte. »Trinken wir irgendwo was zusammen? Im Delphi? Da können wir ungestörter reden als hier.«
Annrose, die abends nur selten ausging, gab sich einen innerlichen Schubs: »Einverstanden, aber jeder zahlt für sich.«
Und weil Paul Balthasar zu Fuß unterwegs war, schob sie kurzerhand ihr Rad.
Das griechische Lokal befand sich im Keller der Bastion VI, einem restaurierten Abschnitt der ehemaligen Vauban-Festung. Man wies ihnen einen Tisch am Ende des Gewölbes zu. Sie bestellten jeder eine kleine Flasche Wasser und ein Glas Merlot. Der Kellner zündete die Kerzen an und reichte ihnen die Speisekarte.
Annrose seufzte. »Ehrlich gesagt, habe ich heute noch kaum was gegessen … Und du?«
Paul grinste. »Ehrlich gesagt«, wiederholte er, »ich sterbe vor Hunger!«
Annrose entschied sich für einen gegrillten Schafskäse mit Beilagen. Balthasar bestellte drei kleine Lammkoteletts mit grünen Bohnen. Als der Wein kam, stießen sie auf ihren zukünftigen Erfolg an. Die Gläser klingelten.
»Du hast bei deiner Vorstellung erzählt, dass du bereits ein kleines Sachbuch geschrieben hättest?«, sagte Paul, nachdem er konstatiert hatte, der Wein röche nach Johannisbeeren.
Annrose nickte. »Über die Merowinger. Ich hab mal ein paar Semester Mittelalterliche Geschichte studiert, dann aber abgebrochen.«
»Verlag?«
»Ein Kleinverlag, mit Betonung auf klein. Kleines Honorar, kleine Auflage. Keine Werbung.«
Paul wieherte. »Du brauchst mir nichts zu erzählen, ich kenne die Branche. Sie ist verrückt. Weiß der Himmel! Mündlich versprechen sie einem viel, und dann … Man darf sich nicht kaputtmachen lassen!«
»Entscheiden denn nicht zuletzt die Leser über den Erfolg eines Buches?«
»Schon, aber das können sie nur, wenn sie es auch finden! Auf den Stapeltischen beispielsweise. Steht es fernab in irgendeinem Regal, kräht kein Hahn danach!«
»Hm … Und wieviele Romane hast du schon auf dem Markt?« (Sie hatte sich längst im Internet erkundigt, aber das brauchte er nicht zu wissen.)
»Fünf«, sagte er, schulterzuckend, »kein Bestseller darunter, leider! Spannung, alles da … Nun, langfristig gehe ich mit einem Superplot schwanger. Ein Stoff, der sich von anderen Romanen gravierend abhebt. Aber das braucht Zeit, vermutlich Jahre …« Er zwinkerte ihr zu: »Paris wurde auch nicht an einem Tag aus dem Boden gestampft!«
»Stimmt. Immerhin hast du es schon weit gebracht, bist etabliert, hast die Unterstützung eines Großverlages. Das finde ich toll!«
Er zog die Mundwinkel nach unten. »Vermutlich nicht mehr lange.«
»Wie meinst du das?«
»Die Umsätze stagnieren. Erwartungen nicht erfüllt. Da lässt man dich beim nächsten Manuskript fallen wie heiße Maroni. Zumal der Trend in Richtung Amerikanische Bestseller geht. No risk – aber auch no fun. Gähnende Langeweile, vorhersehbare Geschichten, schlechter Abklatsch. Mainstream. Such dir was aus! Aber lass dich von meinen Erfahrungen nicht abschrecken.«
»Das tut mir leid. Und was rätst du mir?«
Er strich sich wieder über sein Kinn. »Nach wie vor das, was ich allen Teilnehmern in der letzten Stunde schriftlich mit auf den Weg geben werde: Erstens: Du musst brennen für deinen Text. Zweitens: Du darfst dich von niemandem aus der Bahn werfen lassen. Sieh nicht nach rechts, sieh nicht nach links, zieh dein Ding durch! Drittens: Denke beim Schreiben nicht ans Geld! Das verdirbt dir alles, glaube mir. Vor allem die Freude am Schreiben. Viertens: Was den Gegenspieler, den Antagonisten, betrifft, so merke dir unbedingt eines: Ganz bös ist keiner! Fünftens: Der erste Entwurf ist immer Scheiße! Das stammt nicht von mir, sondern von Hemingway. Also überarbeite dein Manuskript so lange, bis du wirklich zufrieden bist. Danach lies es dir laut vor, Kapitel für Kapitel. Sechstens: Lass dein Manuskript, bevor du es an eine Agentur oder einen Verlag schickst, mindestens ein Vierteljahr ruhen. Mach dir einen Vermerk im Terminkalender und schreib was anderes in dieser Zeit. Dann überarbeite es erneut, und schicke es los.«
Er griff in seine Umhängetasche und überreichte ihr sein schriftliches Konzept. »Hier, häng es dir über den PC!«
»Danke, wirklich gute Tipps!« Annrose legte ihr Handy auf die Kopie, damit sie sie später nicht vergaß. Nachdenklich wickelte sie sich eine Haarsträhne um die Spitze ihres Zeigefingers.
»Es schockiert mich dennoch, dass du nach fünf Romanen und deinem geballten Wissen keinen festeren Stand in diesem Verlag hast.«
Er grinste, legte die rechte Hand auf sein Herz und meinte: »Liegt auch an mir selbst. Ich kille schon mal meinen Helden auf der letzten Seite … Ein absolutes No-Go, schreib dir das als Punkt sieben auf die Liste! Der Leser – sofern es den Leser überhaupt gibt – verzeiht dir das angeblich nicht. Sagen die Agenten und die Verlage. Für mich kommt es immer auf die Story an.« Geringschätzig verzog er den Mund: »Nun ja, nach meinem Ableben wird es vermutlich einmal heißen: Er hätte vielleicht gekonnt, hätte er nur gewollt.«
Annrose stutzte. Das klang einerseits wie auswendig gelernt, andererseits aber auch verbittert. Befand sich Paul Balthasar auf einer Mitleidstour oder musste er sich nur mal bei jemandem auskotzen?
Unvermittelt lachte er auf. »Schau nicht so belämmert, Annrose. In jedem Job gibt es Gewinner und Verlierer. Ein tiefer Absturz kann einen Höhenflug nach sich ziehen, zum Ansporn werden, es den Ignoranten richtig zu zeigen!« Wieder lachte er einen Tick zu laut.
Sie gab die Haarsträhne frei und griff nach dem Weinglas.
»Gut, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Darauf sollten wir anstoßen. Aber du hast mich neugierig gemacht. Ich muss unbedingt was von dir lesen!« (Auch das hatte sie in der letzten Woche bereits getan, doch sein Schreibstil hatte sie nicht vom Hocker gerissen!) »Leitest du die Schreibwerkstatt, um dir was dazu zu verdienen? Oder was machst du sonst im Leben?«
»Wie sieht es bei dir aus?«, fragte er zurück, ohne auf sie einzugehen. »Hast du einen lukrativen Job? Oder wenigstens einen gutverdienenden Ehemann?«
»Weder noch. Ich hab irgendwann mein Studium geschmissen und arbeite jetzt im Teehaus. Kennst du es? Ganz nett. Dort gibt es natürlich auch Kaffee. Alles Bio!«
Er nickte. »Alles Bio, das ist gut. Und was du da verdienst, das reicht dir zum Leben?«
»Gerade so. Na ja, eigentlich nur, weil ich mir keine teuren Klamotten kaufe und auch keine Miete zahlen muss.«
Er sah sie überrascht an. »Ich fasse es nicht, du wohnst noch bei den Eltern!«
»Aber nein. Meine Eltern sind … seit … nun bald vier Jahren tot.«
Paul runzelte die Stirn. »Beide? Tut mir leid. Wie kam das? Ein Unfall?«
Annrose schluckte. »Dieser Tsunami in Thailand, am zweiten Weihnachtstag 2004. Auch mein Stiefbruder, seine Frau und ihre Zwillinge kamen dabei ums Leben. Die Mädchen waren erst zwei Jahre alt …«
»Merde! Das ist ja … furchtbar! Das tut mir so leid für dich!«
Annrose spürte, wie sie aus dem Tritt kam. Sie hatte wieder mit ihrer hohen Jungmädchenstimme gesprochen. Es war also noch immer nicht vorüber. »Unter den Opfern befand sich auch mein … Verlobter«, fügte sie tapfer hinzu, wie ihr das ihre Therapeutin empfohlen hatte. »Seine Leiche wurde nie gefunden. Die meines Stiefbruders hingegen … nun, sie hing hoch oben auf einer Palme …«, sie griff zum Wasserglas, trank wie eine Verdurstende. »Kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man seine komplette Familie identifizieren muss? Wenn man von einer Stunde auf die nächste zu niemandem mehr gehört?«
»Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt sagen soll«, er legte seine Hand auf ihre.
»Ist schon okay …« Annrose zog den Arm zurück und kramte in ihrem Rucksack nach der Packung mit den Papiertaschentüchern.
»Und wie hast du das Unglück überlebt? Schutzengel?«
Sie atmete tief durch, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich bin am ersten Weihnachtstag nach Hause geflogen, das heißt, ich war bereits wieder in Saarlouis, als das Wasser kam …«
Sie sah, wie Paul die Stirn runzelte. »Gab es für deine vorzeitige Abreise einen Grund? Eine Vorahnung?«
Annrose hielt den Atem an. Dann zog sie die mit der Therapeutin einstudierte Grenze: »Sei mir nicht böse, Paul, das wird mir jetzt zu privat.«
»Schon gut, wechseln wir das Thema …«
Der Schafskäse und die Lammkoteletts wurden serviert. Während des Essens erzählte Paul von der WG in Saarlouis, die er mit vier anderen teilte. Er fühle sich dort kreuzunglücklich, sagte er, vor allem fehle ihm die Ruhe zum Schreiben. Das mache ihn ganz kirre.
»O je, das glaube ich dir gern. In einer WG könnte ich auch nicht schreiben. Aber … nun, eventuell … also, ich suche schon seit längerem nach einer Untermieterin … oder einem Untermieter«, platzte es aus ihr heraus, und es war nicht einmal gelogen. »Das Jugendzimmer meines Bruders … inzwischen bin ich soweit, seine Sachen wegzuräumen. Außerdem ist meine Wohnung groß genug für zwei Parteien. Es gibt zwei Bäder und in die Küche würde noch ein weiterer Kühlschrank passen. Da käme man sich nicht so in die Quere, denn eigentlich … nun, eigentlich ist mir meine Privatsphäre heilig.«
Entsetzt über ihre Worte, die ihr aus einem ihr unerfindlichen Grund nur so herausgelaufen waren, rang Annrose nach Luft.
»Wie auch immer«, setzte sie rasch nach, nachdem Paul nur schweigend auf sein letztes Lammkotelett sah, »das war nur so eine Schnapsidee. So bin ich manchmal … und dann der Wein …«
Wie aufdringlich war das denn! Sie hätte sich ohrfeigen können!
Paul blickte endlich auf. »Danke für dein Vertrauen«, sagte er leise, »ich lasse mir die Sache durch den Kopf gehen. Aber um noch einmal auf deine Familie zurückzukommen. Darf ich dir einen Rat geben?«
Sie nickte mutig. »Na klar!«
»Schreib die Geschichte auf. Von A bis Zett. Das ist ein Stoff, auf den alle Verlage anspringen, auch wenn das Unglück schon eine Weile her ist. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.«
Annrose seufzte. »Aufgeschrieben habe ich sie längst, gewissermaßen als Therapie, um meine Gefühle zu sortieren, aber ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit. Niemals, auch nicht für viel Geld oder unter einem Pseudonym. Und jetzt weißt du, weshalb ich mich vorhin in der VS beim Thema Schreiben nach einer wahren Geschichte zurückgehalten habe.«
Paul schwieg. Er hatte Messer und Gabel abgelegt und massierte nachdenklich seine Schläfen.
»Ich dränge dich natürlich nicht«, sagte er nach einer Weile, »du musst das selbst wissen. Deine Story würde dich jedoch mit einem Schlag bekannt machen. Zumal sich unter den Toten auch dein Verlobter befand. Das ist Literatur, die unter die Haut geht. Romane, die aufs Herz zielen. Lebensbrüche und so weiter. Das lieben die Leute. Ähnlich verhält es sich mit meinem Superplot, von dem ich vorhin sprach. Also nur Mut! Oder geht es um Sex? Scheust du dich, darüber zu schreiben? Es könnte jemand lesen, der dich kennt?«
Annrose richtete sich auf und schob ihr Glas zurück.
»Aber nein, Paul«, sagte sie, jetzt, Gott sei Dank wieder mit ihrer normalen Stimme, »mit moralischen Vorbehalten hat meine Zurückhaltung nichts zu tun. Ich scheue mich nur, eine persönliche Verletzung preiszugeben. Da bin ich ehrlich.«
Am darauffolgenden Sonntag, drei Tage nach dem Gespräch im Delphi, kam Paul Balthasar am frühen Nachmittag ins Teehaus. Bei seinem Anblick begann Annroses Herz beunruhigend zu klopfen. Sofort ärgerte sie sich. Was war los mit ihr? Paul gefiel ihr doch gar nicht … Sie lächelte und hob kurz die Hand zum Gruß.
Er grüßte ähnlich knapp zurück, warf einen suchenden Blick über die Gäste und steuerte dann auf einen vielleicht zwanzigjährigen Jungen im kirschrotem Shirt und mit Ziegenbart zu, an dessen Tisch er sich setzte.
Annroses Herzschlag normalisierte sich wieder. Er war nicht ihretwegen gekommen!
»Hallo, Paul«, grüßte sie, als sie an den Tisch der beiden trat. »Schön, dich zu sehen! Was darf ich dir bringen? Ein Glas … Merlot?« Sie zwinkerte ihm zu, worauf er jungenhaft zurückgrinste.
»Besser einen Cappuccino und eine Brioche, ich hab noch nicht gefrühstückt.«
»Mir bitte auch noch einen Cappuccino«, sagte der andere. Er sah irgendwie verärgert aus, rollte das Computerjournal zusammen, in dem er gelesen hatte.
»Kommt sofort!« Annrose eilte zur Theke zurück.
»Zwei Cappucini«, raunte sie übermütig Elodie zu. »Einmal mit Bäumchen und einmal mit Herz, und – ja, und eine Brioche. Tisch Sieben.«
Elodie grinste. »Da schau an! Und wer kriegt was?«
»Das entscheide ich kurzfristig«, antwortete sie geheimnisvoll, bevor sie am Nebentisch ein älteres Paar abkassierte. Sie wusste auch nicht, was sie gerade umtrieb, eben war sie noch froh gewesen, dass Paul nicht ihretwegen gekommen war. Nun, vorsichtshalber würde sie die Tasse mit dem Herzchen dem Jungen servieren …
»Voilà – die Cappucini«, sagte Elodie, als Annrose zur Theke zurückkehrte. Sie deutete auf die Tassen. »Und vergiss nicht, ma belle: Jeder braucht mal eine Schulter zum Anlehnen!«
»Ausnahmen bestätigen die Regel«, antwortete Annrose, dann eilte sie mit dem Tablett in der Hand davon …
Es war nicht viel los, um diese Uhrzeit – Sonntag war kein Donnerstag! –, dennoch verbot sich Annrose, ständig zu Tisch Sieben hinüberzuschielen, an dem sich bald eine mehr als angeregte Unterhaltung entspann.
»Sag mal, zoffen die sich?«, fragte Elodie nach einiger Zeit leise.
»Keine Ahnung! Ich hör mir das mal aus der Nähe an …«
Annrose trat an den Tisch – und die zwei verstummten. Sie hatte gerade noch mitbekommen, dass es um Geld ging.
»Noch irgendwelche Wünsche?«, fragte sie.
»Nur die Rechnung«, zischte der Junge mit dem Ziegenbart. »Getrennt, bitte.«
Sie warf einen fragenden Blick auf Paul, der aussah, als habe er Zahnschmerzen. »Für mich noch ein Evian.«
Als sie ihm kurz darauf das Wasser servierte, war der andere schon weg. Ein Zwanzig-Euro-Schein lag neben seiner Tasse.
»Steck’s ein«, meinte Paul achselzuckend. »Der Rest ist vermutlich Trinkgeld. Tut mir leid, dass es etwas laut geworden ist. Kann ich mal mit dir reden?«
»Jetzt nicht«, antwortete sie irritiert. »Mein Chef ist gerade da, der sieht das nicht gern. Aber in einer halben Stunde habe ich Pause. Warte draußen auf mich, okay? Ich ziehe deine Rechnung von den zwanzig Euro ab. Das passt dann …«
Paul saß am Rande der benachbarten Grünanlage auf einer Bank, mitten in der prallen Sonne.
»Nicht zu heiß hier?«, fragte sie ihn, als sie sich leicht atemlos – sie hatte den Sari rasch gegen ihr Kleid getauscht – zu ihm setzte. »Was war denn los mit deinem Freund?«
Paul zuckte die Achseln. »Freund? Der Kerl ist der Sohn unseres Vermieters. Er hat mich gerade aus der WG geworfen. Mietrückstände, na ja, was soll ich dazu sagen …«
Annrose hielt für einen Moment die Luft an. »Das tut mir leid«, sagte sie leise, und dann, weil er so hartnäckig schwieg: »Mein … mein Angebot, also das steht natürlich noch. Zimmer mit eigenem Bad und Küchenbenutzung. Was könntest du denn monatlich zahlen, ohne dass es dich weiter in den Ruin treibt? Oder möchtest du dir das Zimmer erst mal ansehen?«
»Im Augenblick nicht, danke. Kurzfristig kann ich jederzeit bei einem Freund pennen. Außerdem hab ich einen neuen Job in Aussicht, bei dem ich allerdings manchmal auch abends arbeiten müsste. Ob der Kurs dann deswegen ausfällt, weiß ich noch nicht. Krieg ich den Job, dann nehme ich dein Angebot sehr gerne an. Ich sag Dir spätestens am Donnerstag Bescheid.«
»Okay«, sagte sie, nur minimal erleichtert. »Dann drücke ich dir die Daumen … Ich muss gleich wieder rein. War noch was?«
Er schüttelte den Kopf. »Hab mich nur bei dir entschuldigen wollen für den Auftritt vorhin …«
Zwei Wochen später zog Paul Balthasar bei ihr ein. Er hatte einen Job als Kurierfahrer für die Belieferung von Apotheken bekommen. Gut bezahlt, wie er meinte, und er legte ihr »als Vermieterin« zur Sicherheit den Arbeitsvertrag vor.
Annrose machte sich daraufhin im Internet schlau und setzte einen Mietvertrag für eine Untervermietung auf. Paul unterschrieb ihn blind. Gemeinsam verpackten sie die Sachen ihres Bruders in einige Umzugskartons und schafften diese in die Garage, wo neben Annroses Fahrrad noch immer der Wagen ihrer verstorbenen Eltern stand.
»Du fährst Rad und hast einen nahezu neuen Golf GTI in der Garage?«, fragte Paul überrascht.
»Spart mir Benzin und Parkplatzsuche. Für größere Strecken nehme ich natürlich den Wagen.« Sie verriet ihm nicht, dass sie den Golf seither kein einziges Mal benutzt hatte und sich dennoch scheute, ihn zu verkaufen. Ihr Stiefvater hatte seinen Wagen geliebt, und vielleicht würde sie ja bald wieder mit dem Fahren anfangen. Insgeheim jedoch beschlich sie das Gefühl, dass Paul es wohl gern gesehen hätte, wenn sie ihm neben dem zweiten Wohnungsschlüssel auch den Reserve-Autoschlüssel ausgehändigt hätte. Aber das zu tun, verkniff sie sich.
In den Wochen nach Pauls Einzug setzten sie sich am Wochenende oder am späten Abend, wenn er vom Dienst zurück war, manches Mal zusammen, um übers Schreiben zu reden. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Annrose auch, was es mit dem »Roten Hering« auf sich hatte. »Der Red Herring ist neben dem Cliffhanger die wichtigste Technik zum Aufbau eines Spannungsbogens in Thrillern«, erklärte ihr Paul. »Er ist so was Ähnliches wie der von Hitchcock geprägte Begriff MacGuffin.«
»Nie gehört«, sagte sie. »Böhmische Dörfer …«
»Du kannst das ja noch genauer im Netz nachlesen«, meinte Paul, »ich bin nicht mehr dazugekommen, das Thema in der Schreibwerkstatt zu vertiefen. Kurz gesagt: Mit MacGuffin bezeichnet man Personen oder Dinge, die für die eigentliche Handlung unwichtig sind, diese aber vorantreiben.«
»Kapiert. Und welche Aufgabe hat der Rote Hering?«
»Nun, der führt den Zuschauer von der Handlung weg, indem er Nebelkerzen wirft.«
»Also MacGuffin … vorantreiben. Und Red Herring … wegführen. Oder in die Irre führen, nicht wahr?«
»Genau. Denk an den Roman Sakrileg. Dan Brown hat sich den Bischof Aringarosa ausgedacht, der vom eigentlichen Antagonisten, also dem Gegenspieler, ablenkt.«
»Du hast recht, das stimmt!« Annrose lachte.
»Natürlich! Und jetzt pass auf: Der Name Aringarosa besteht aus zwei italienischen Wörtern: aringa und rosa. Auf deutsch: Hering und Rot. Roter Hering. Apropos, hast du Lust, heute noch mit mir Essen zu gehen? Mir knurrt der Magen.«
»Irgendwohin, wo es Fisch gibt?«
»Heilige Medora, muss ja nicht gerade Hering sein!«
»Und wer ist die Heilige Medora?«
Er zwinkerte ihr zu. »So hieß meine Mutter!«
Annrose glaubte ihm kein Wort, aber sie grinste. Längst gefiel es ihr, wieder jemanden in ihrer Nähe zu wissen, mit dem sie ab und zu reden und auch mal lachen konnte. Oder zusammen essen gehen. Sie hatte das Richtige getan. Elodie sagte es. Und ihre Therapeutin würde das bestätigen.
Der Herbst zog ins Land, und Annrose blickte einigermaßen zufrieden auf ihr Leben. Vor allem auf das als Autorin, nachdem Paul sie ermutigt hatte, auf ihre eigene Stimme zu hören, auf die innere Stimme, quasi als letzte Instanz. Seit sie sich daran hielt, entwickelte sie sich stetig weiter. Schreiben war zwar noch immer Schuften, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Manchmal war sie ganz euphorisch, wenn sie am Abend die Seiten noch einmal las, die sie tagsüber geschrieben hatte.
Über seine eigene Arbeit sprach Paul nicht, und über seine bereits erschienenen Romane wollte er gar nicht reden. »Gedruckt, gelesen, abgehakt!«, sagte er, als wenn ein Ghostwriter sie verfasst hätte und nicht er selbst. Aber er arbeitete fleißig, tippte ganze Nächte hindurch wie getrieben. Meist legte er sich schlafen, wenn Annrose schon wieder auf den Beinen war.
Privat blieben sie beide seltsam auf Distanz – bis zur Nacht vor dem Heiligen Abend. Elodie hatte eine feuchtfröhliche Weihnachtsparty gegeben, von der sie gegen halb drei in der Nacht, Arm in Arm, nach Hause schlenderten. Sie hatten viel getrunken und gelacht, und Paul, der den ganzen Abend über den Wortführer gespielt hatte, riss auch noch unterwegs komische Witze.
Als sie vor der Haustür nach ihrem Schlüssel suchte, zog Paul sie plötzlich an sich und küsste sie – punktgenau unter dem Mistelzweig, der, geschmückt mit einer roten Schleife, direkt über dem Eingang hing.
Als er sie wieder freigab, wies sie lachend nach oben. »Du weißt aber schon, was das bedeutet?«
Er sah sie verschmitzt an. »Besitzt du etwa eine Goldene Sichel?«, fragte er, und als sie verneinte, meinte er, das sei jetzt ein Druidenwitz gewesen.
Beim Hinaufsteigen in den zweiten Stock, fragte er sie, ob sie noch ein Glas Wein mit ihm trinken würde. Sie bejahte. Als sie wenig später mit den Gläsern und einer angebrochenen Flasche vom Vortag durch den Flur ging, stand Pauls Zimmertür weit offen. Die Stehlampe brannte. Und Paul saß in seinem Bett und sah sie an.
Annrose schluckte. Hatte er den Wein vergessen oder lief es darauf hinaus, dass sie ihn auf seinem Zimmer tranken? Sei’s drum, dachte sie bei sich, dem Mutigen gehört die Welt. Sie trat ein, stellte Flasche und Gläser auf den Tisch und schenkte ein. Dann knöpfte sie sich in gebotener Ruhe die schwarze Seidenbluse auf und stieg aus dem engen Rock. Als sie nackt war, wandte sie sich um. Sie trat auf ihn zu und reichte ihm sein Glas. »À la nôtre!«
Er stemmte sich hoch und nahm ihr das Glas ab. Seine Augen glitten über ihren Körper. »Seit wann bist du frivol?«, fragte er.
»Muss wohl am Mistelzweig liegen«, antwortete sie vage. Sie setzte sich zu ihm auf den Bettrand. Die Gläser klingelten.
»Ich habe kein Herz zu verschenken, erwarte auch keins als Gegengabe. Nur wer frei ist, liebt!«, meinte er lapidar, dann begann er langsam, sich ebenfalls zu entkleiden.
Es waren nicht die Worte, es war der Tonfall gewesen, der ihr einen Stich gab. Da war etwas an Paul, das ihr immer fremd bleiben würde. Sie trank wortlos ihr Glas leer und stellte es am Boden ab.
Paul reichte ihr seines. Annrose kuschelte sich in seine Armbeuge, lernte seinen männlichen Duft kennen, und plötzlich begehrte alles in ihr diesen Mann. Sie begann ihn zu streicheln, Brust, Bauch und wenig später auch weiter unten. Er schien es zu genießen, stöhnte leise. Reagierte. Doch plötzlich ergriff er ihre Hand und zog sie weg von seinem Glied. Es gehe nicht, sagte er, er habe zuviel Alkohol im Blut. Es tue ihm leid. Sie könne aber hier bleiben, wenn sie wolle …
Er knipste die Stehlampe aus, drehte ihr den Rücken zu, brummte etwas, das sich nach »gute Nacht« anhörte, und zog die Daunendecke bis über die Ohren.
Annrose war fassungslos … Keine Zärtlichkeit für sie? Nichts? Die Wut kochte in ihr hoch, richtete sich allerdings mehr auf sie selbst, statt auf ihn.
Stocksteif blieb sie liegen. Erst als Paul regelmäßig schnaufte und sie kalte Füße bekam, taumelte sie hinaus, um zu duschen.
Als sie später in ihrem eigenen Bett lag, gestand sie es sich ein: Es war nicht der Alkohol gewesen, dass dieser Abend so endete, sondern es lag daran, dass Paul sich nicht die Bohne für sie interessierte. Sie war für ihn nur ein weiterer guter Kumpel, einer, der ihm idealerweise ein möbliertes Zimmer mit eigenem Bad und Küchenbenutzung für ganz wenig Geld vermietete … Sie schluchzte auf. Und der Kuss unter der Mistel? Romantischer Stuss, über den sie mit sechsundzwanzig längst hinweg sein sollte!
Doch dann kam alles ganz anders. Am nächsten Morgen, Annrose schlief noch, schlüpfte er zu ihr unter die Decke. Er war nackt und bereit.
»Fröhliche Weihnachten, chérie!«, frotzelte er, »leider habe ich nur ein Kondom und kein Lametta gefunden, sonst hätte ich mich für dich ganz besonders herausgeputzt.«
Annrose schnappte nach Luft, kicherte. Paul begann, ihren Nacken zu küssen, sie zu streicheln. Sie dehnte sich in seinen Armen, stöhnte. Als er in sie eindrang, vergaß sie, was in der Nacht geschehen war. Paul war da, und nur das zählte. Er – und der Regen, der draußen an die Fensterscheiben prasselte … Paul kam schnell. Und genauso schnell verließ er sie an diesem Morgen wieder. Er murmelte eine Entschuldigung, sprang aus dem Bett und kurz darauf hörte sie, wie das Wasser gegen die Duschkabinenwände prasselte.
»Frohe Weihnachten, Idiotin!«, murmelte sie, dann biss sie die Zähne aufeinander bis es schmerzte.
»Schlaf weiter! Ein unaufschiebbarer Termin!«, rief er ihr vor dem Weggehen noch zu. Seine Stimme klang wie immer.
Sie hörte die Tür zuklappen. Danach war alles still in der Wohnung. Wie früher. Drinnen und draußen, denn der Regen hatte aufgehört.
Annrose suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Nach einer, die möglichst alles erklärte. Zum Schluss redete sie sich die Sache schön. Es war eben nicht leicht, mit jemandem unter einem Dach zu leben. Auch Elodie hatte bislang Pech mit den Männern gehabt. Zum anderen – sie verzog spöttisch den Mund –, nun, schließlich war Weihnachten und Paul wurde womöglich von seiner Mutter, der »Heiligen Medora«, zum Brunch erwartet?
Sie drehte sich auf die andere Seite. Im warmen Bett lag noch Pauls Geruch. Sie hatte nicht die geringste Lust, aufzustehen.
3
__________
Die Autorin
Genf, Hotel Warwick, Freitag, 20. Juli 2012
Als Annrose nach der Rückkehr von der Villa Diodati in ihrem Hotelbett lag, müde bis in die Knochen und leicht beschwipst, war an Schlaf dennoch nicht zu denken. Sie war ratlos … Hatte Paul wirklich dort oben unter den drei Tannen gestanden? Nach all der Zeit? Wenn ja, dann konnte er sie bereits tagsüber beobachtet haben. Sie und Danilo … Diese Vorstellung beunruhigte sie. Sie hatte einen trockenen Mund, machte noch einmal Licht, trank einen Schluck Wasser und schwor sich, so schnell keinen Alkohol mehr zu trinken. Um sich abzulenken, nahm sie die schmucke Sonderausgabe des »Frankenstein« in die Hand, die Chris Valtus jedem Gast zum Abschied geschenkt hatte. Mary Shelley meldete sich zu Beginn des Romans selbst zu Wort:
Die Herausgeber der »Meisternovellen« haben mich vor Veröffentlichung meines »Frankenstein« gebeten, ihnen einiges über dessen Entstehung zu berichten. Ich entspreche diesem Wunsche umso lieber, als mir dadurch Gelegenheit geboten ist, allgemein die so häufig an mich gerichtete Frage zu beantworten, wie ich als Frau dazukäme, einen so entsetzlichen Stoff zu erdenken und zu bearbeiten. Ich stelle mich ja allerdings nicht gern in den Vordergrund; aber da diese Erklärung mehr oder minder nur ein Anhang zu meinem Werke ist und ich mich nur auf das beschränken werde, was unbedingt mit meiner Autorschaft zusammenhängt, kann man mir kaum persönliche Eitelkeit zum Vorwurf machen.
Es ist meines Erachtens nichts Außerordentliches, daß ich, als Kind zweier literarischen Berühmtheiten, ziemlich früh im Leben am Schreiben Gefallen fand. Schon als ganz kleines Mädchen wußte ich mir keinen besseren Zeitvertreib als das »Geschichtenschreiben«. Bis ich allerdings noch ein schöneres Vergnügen fand, das Bauen von Luftschlössern, das Versenken in Wachträume, das Verfolgen von Gedankenreihen, die sich aus erfundenen Ereignissen ergaben. Meine Träume waren auf alle Fälle schöner und phantastischer als alles, was ich niederschrieb. Denn beim Schreiben folgte ich mehr den Spuren anderer, als daß ich meine eigenen Gedanken wiedergab. Ich machte mich selbst nie zur Heldin meiner Erzählungen …
Vor allem die beiden letzten Sätze gefielen Annrose, denn sie kamen ihr ehrlich vor. Die Tatsache, dass sie selbst einen Abend in der berühmten Villa verbracht hatte, erfüllte sie mit Stolz. Welche zeitgenössische Autorin konnte das schon von sich sagen!