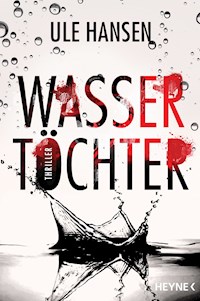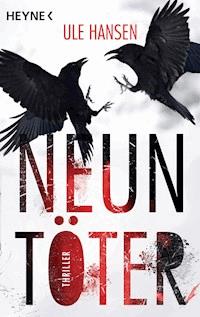9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Carow-Reihe
- Sprache: Deutsch
"Bitte helft mir! Er sagt, er reißt mich in Stücke." Das und noch Schlimmeres steht in einem von drei kryptischen Briefen, die der polnischen Polizei zugespielt werden. Die Briefe sind auf Deutsch verfasst, und so erbittet man Amtshilfe bei der Berliner Polizei. Ein Gutachten soll klären, ob hier jemand unter grausamsten Bedingungen gefangen gehalten wird oder ob diese Briefe nur ein übler Scherz sind. Der Fall landet auf dem Tisch von Emma Carow, die für ihre genialen Analysen bekannt ist. Bei dem Versuch, das Rätsel zu lösen, wird sie mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
»Bitte helft mir! Er sagt, er reißt mich in Stücke.« Das und noch Schlimmeres steht in einem von drei kryptischen Briefen, die der polnischen Polizei zugespielt werden. Die Briefe sind auf Deutsch verfasst, und so erbittet man Amtshilfe bei der Berliner Polizei. Ein Gutachten soll klären, ob hier jemand unter grausamsten Bedingungen gefangen gehalten wird oder ob diese Briefe nur ein übler Scherz sind. Der Fall landet auf dem Tisch von Emma Carow, die für ihre genialen Analysen bekannt ist. Bei dem Versuch, das Rätsel zu lösen, wird sie mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert.
Zum Autor
Ule Hansen ist das Pseudonym eines Berliner Autorenduos. Astrid Ule ist zudem Lektorin, Eric T. Hansen freier Journalist. Gemeinsam haben Sie bereits mehrere Dreh- und Sachbücher verfasst. Sie teilen eine Leidenschaft für nächtliche Gespräche bei gutem Whisky, exzentrische Halloweenpartys und ziellose Streifzüge durch die vergessenen Ecken der Stadt.
ULE HANSEN
BLUT
BUCHE
THRILLER
1
Emma Carow saß ihrem Vergewaltiger gegenüber und war die Ruhe selbst.
Sie konnte ihn riechen, obwohl gute drei Meter zwischen ihnen lagen. Den Klang seiner Stimme hören, obwohl er schwieg. Sie mied seinen Blick, aber sie wusste, er schaute sie an. Dennoch war sie ruhig. Ihre Hände zitterten nicht. Sie konnte frei atmen. Die ein, zwei Tropfen Schweiß auf der Stirn, die waren den Scheinwerfern geschuldet.
Sie wunderte sich über sich selbst. Wie konnte sie so gelassen sein?
Weil sie gut vorbereitet war? Sie wusste, was sie zu sagen hatte. Sie hatte es geprobt, hatte es aufgeschrieben und ausgesprochen. Immer wieder. Vor dem Spiegel. Im Auto, auf dem Weg hierher. In der Garderobe. Es hatte ihr nur noch nie jemand dabei gegenübergesessen.
Emma Carow saß unter einer Glaskuppel, die so aussehen sollte wie die, die den Reichstag krönte, nur kleiner. Um sie herum wuchs ein zylindrisches Stahlgerüst in die Höhe: der Gasometer in Schöneberg, Abschnitt 42. Ein Relikt aus den Zeiten, als das Erdgas noch überirdisch gelagert wurde. Damals umfing das stählerne Außenskelett einen flexiblen Innensilo, der je nach Bedarf aufgepumpt werden konnte. Vor dem Krieg war der Gasometer ein Symbol der allgegenwärtigen Industrie gewesen, die die Luft der Hauptstadt verpestete, heute war er ein nostalgisches Symbol für das, was Berlin schmerzlich fehlte: eben jene Industrie. In dieses Ding hatten die TV-Macher die Kuppelkulisse gesetzt, die sie umfing, Bombast im Kleinen. Fünf Gäste saßen neben Emma auf der roten Bühne. Hinter ihnen rot-gelbe Bühnendeko, vor ihnen Kameras. Und Zuschauer. Aufgereiht auf einer Tribüne. Sie erkannte keine Gesichter, die Lampen blendeten sie. Ihre Schwester war nicht darunter, das wusste sie. Sarah saß mit ihrem neuen Liebsten vor dem Fernseher. Emmas Kollegen wahrscheinlich auch.
Emma, dezent geschminkt, kreuzte die Beine in den hellen Wildlederstiefeln, dazu trug sie schwarze, enge Jeans und einen weißen Wollpulli, die Klamotten hatte Sarah ausgesucht: »Keine Widerrede.« Sie strich sich über die raspelkurzen blonden Haare und wunderte sich über sich selbst.
Neben ihr die Moderatorin.
Charlotte Langendorn. Breites Lächeln, einfach sympathisch, trotzdem seriös. Vertrauenswürdig. Sie hatte verstanden, was Emma zu sagen hatte, im Großen und Ganzen, sie hatten sich darüber unterhalten, damals schon, als Emma spontan in der Sendung angerufen hatte, zu der sie nun ins Studio eingeladen war, um die zehn Wochen war das jetzt her. Jung, die Langendorn, aber schon ein alter Hase, es war gut, so jemanden zur Seite zu haben. Dann die Pastorin, Feldwiese oder so. Über sie stand immer wieder mal was in der Zeitung – Frau mit großem Herzen, Pragmatikerin, in der Friedensbewegung aktiv. Der Strafrichter, Hoppe. Sie kannten sich. Der Promi natürlich, André Irgendwas. Hatte in irgendeiner TV-Show irgendein Lied über Frieden zwischen Mann und Frau gesungen, Frieden und Liebe oder so, das machte ihn zum Experten für Vergewaltigung.
Und Uwe Marquardt.
Ohne Mauer. Ohne Gitter. Ohne Handschellen. Frei saß er da, wie ein ganz normaler Mensch, ein Mensch, der lediglich die seltsame Angewohnheit hatte, Frauen wie sie drei Tage lang ans Bett zu fesseln und zu vergewaltigen.
Aber es war kein Problem. Überhaupt kein Problem. Denn sie hatte ihn überwunden. Oder war auf dem besten Weg dazu. Sie war stärker, sie war vorbereitet, sie wusste, was sie zu tun hatte, sie waren in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit hatte einer wie er keine Gewalt über sie. Nur im Dunkeln, nur mit Messer und Seil, nur damals, bevor sie Polizistin wurde, bevor sie eine Waffe hatte, bevor sie verstand, dass es Menschen wie ihn gibt auf dieser Welt – bevor sie begann, Menschen wie ihn zu studieren. So einer wie er, ein Feigling wie er, würde ihr vor den Augen anderer nichts antun.
Uwes Gesicht. Ganz nah, dieser inwärts gerichtete Blick, der Atem, der immer so laut war, die Härchen in seinen Nüstern, die glänzenden Stoppeln an seinem Hals, wohl noch schnell beim Friseur gewesen, seine vollen, drahtigen Haare, bestimmt geföhnt, seine Schläfen, der dünnste Part des menschlichen Schädels, da sollte man nicht mit dem Absatz gegentreten, seine ungewöhnlich hellen, wässrigen Augen, seine breiten Schultern unter dem karierten Hemd, seine Selbstzufriedenheit, sein Schwiegersohngrinsen, dieses penetrante Grinsen.
Wieso grinste er? Wusste er nicht, was jetzt kommen würde? Hatte er keine Angst davor, was sie jetzt sagen würde?
Die Langendorn redete, ans Publikum gewandt. Irgendwas lief vom Band, auf dem großen Monitor hinter ihnen, ein Einspieler: Jemand erzählte von einer Vergewaltigung. Eine junge Studentin, neunzehn, in Frankfurt am Main, will von einer Party aus einem Vorort nach Hause, es ist spät, die nächste S-Bahn fährt erst in zwei Stunden, da nimmt jemand sie im Auto mit, sie kennt ihn, ein Kommilitone, doch er fährt sie nicht nach Hause, er fährt in den Wald, zum Ferienhaus seiner Eltern, das muss sie sich ansehen, und außerdem braucht er dringend einen Kaffee, irgendwas sagt ihr, hier stimmt was nicht, aber es ist ihr peinlich, ihn zu konfrontieren, er war ja so nett und hat sie mitgenommen, man beschuldigt nicht irgendjemanden einfach nur so. Dann plötzlich ist dieses Jagdmesser in seiner Hand, plötzlich ist die Klinge an ihrem Hals. Über drei Tage hält er sie in der Hütte fest, vergewaltigt sie immer wieder, richtet sich mit ihr ein, als ob sie ein Paar wären, ein ganz besonderes Paar, dessen eine Hälfte winselnd und bettelnd ans blutgetränkte Bett gefesselt bleibt, bis der Vater des jungen Mannes unerwartet auftaucht und einen Krankenwagen ruft.
Emma hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie war sich kaum bewusst, dass der Einspieler ihre Geschichte erzählte.
Der Vergewaltiger heißt Uwe Marquardt. Sieben Jahre hat er in Haft verbracht. Jetzt ist er frei und, wie er sagt, geläutert: ein Mann, der gelernt hat, Frauen zu respektieren. Sie nicht als Beute, als Besitz, als Spielzeug zu betrachten, sondern als Menschen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben: Läuterung. Die lange Reise zu mir selbst. Das Buch verkauft sich gut, er hält Lesungen, gibt Interviews, wird von Stiftungen, Bildungseinrichtungen, Tagungen als Gastredner eingeladen. In dem Buch versichert er, dass er nur noch einen Wunsch habe, für den er alles tun würde: dass sein Opfer ihm verzeiht.
Heute sitzen sie sich zum ersten Mal öffentlich gegenüber, Täter und Opfer. Dieselbe Emma, die sich noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen konnte, dass irgendwer von ihrer Geschichte erfuhr, die dann hinnehmen musste, dass er sie vor aller Welt in seinem Buch ausbreitete, die sich rechtlichen Beistand geholt hat, die bereit war, vor Gericht zu gehen, um die Hinweise auf sie im Text schwärzen zu lassen – dieselbe Emma hat sich nun zur öffentlichen Person gemacht und damit auf all dies verzichtet, es würde keine Schwärzungen geben, sie würde das Buch nicht mehr anfechten, weil sie etwas Wichtiges zu sagen hatte, etwas, das wichtiger war als der Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte.
Dann war der Einspieler vorbei, und Langendorn wandte sich an sie. Sagte etwas. Eine Frage, vermutlich die gleiche wie in dem Einspieler: Können Sie diesem Mann je verzeihen? Ganz genau hatte Emma sie nicht verstanden, weil sie nicht darauf geachtet hatte. Die Frage war auch egal. Sie wusste, was sie zu sagen hatte. Als sie sicher war, dass die Kamera auf sie gerichtet war, sprach sie.
»Uwe Marquardt ist nicht geläutert. Er wird erneut vergewaltigen, er kann nicht anders.«
»Aber woher …«, versuchte es die Moderatorin.
»Ich bin vom Fach. Ich bin Fallanalystin«, sagte Emma. »Mein Spezialgebiet sind Serientäter. Ich analysiere Psychopathen und Soziopathen. Uwe Marquardt ist einer von ihnen. Er hat die Vergewaltigung nicht aus Neugier probiert, sie ist ihm nicht versehentlich passiert, er hat es getan, weil er Gewalt ausüben will, und er wird es wieder tun. In ihm steckt ein Serientäter, schlimmstenfalls ein Serienmörder.«
»… woher können Sie das wissen?«
»Das ist die Entwicklung, die wir bei seinesgleichen immer wieder beobachten. Es steckt in ihm und wird immer in ihm stecken. Er will noch immer vergewaltigen, kontrollieren, quälen und erniedrigen, er braucht das, die Macht über ein schwächeres Wesen. Das ist die einzige Emotion, die stark genug für ihn ist, um sie spüren zu können. Dagegen gibt es keine Therapie. Die Heilung von Psychopathen ist ein Mythos.« Der Moderatorin hatte es tatsächlich kurz die Sprache verschlagen, aber in der Pastorin regte sich Widerstand, das sah man ihr an. Emma fuhr fort: »Sicher, wir wollen alle daran glauben, dass ein Straftäter wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Bei vielen klappt das auch … Doch Psychopathen sind ab einem bestimmten Punkt nicht mehr resozialisierbar. Herrn Marquardts Buch, seine Reue, seine Beteuerungen – das ist Show, Spiel, Spaß, er manipuliert die Öffentlichkeit, damit er ungestört weiter vergewaltigen kann. Ich bin heute Abend nur aus diesem einen Grunde hier: Sie zu warnen. Glauben Sie ihm nicht. Egal was er sagt, egal wie sinnvoll und aufrichtig es klingt. Er will und er wird es wieder tun. Er bittet nicht um Vergebung, er bittet um Erlaubnis.« Emma wandte sich ans Publikum. »Und eines sollten Sie wissen, die Frauen unter Ihnen: Männer wie er werden nie aufhören, Frauen zu verfolgen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, lassen Sie sich nicht einwickeln, hoffen Sie nicht auf Besserung. Eine Straftat ist eine Straftat. Erstatten Sie Anzeige, wenn Ihnen Gewalt angetan wurde.«
Jeder wollte etwas entgegnen. Die Moderatorin, die Pastorin, der Richter, Uwe selbst, ihre Stimmen prasselten von allen Seiten auf sie ein. Sie kannte sie alle, jedes Argument, jeden Einwand, jedes Aber. Sie entkräftete sie alle, ruhig, besonnen und beharrlich, auch wenn ihr das Herz bis zum Hals klopfte. Sie war ein Profi, sie war Fallanalystin beim LKA, sie wusste, wovon sie sprach, sie war Emma Carow, und sie hatte keine Angst mehr.
Sie hatte ihn überwunden.
Sie konnte es selbst kaum glauben.
2
»Die Presse liebt Sie, Frau Carow.«
Emma saß in dem viel zu niedrigen, abgewetzten Teaksessel aus den 1960ern, umfasste die geschwungenen Armlehnen und lehnte sich vor. Nicht sicher, ob sie ihren höchsten Vorgesetzten richtig verstanden hatte. Auch wer dieser andere Mann war, der direkt neben ihm stand und sie knapp anlächelte, wusste sie nicht. Und diese Frau, eher Dame, nur unwesentlich älter als Emma selbst, die neben ihr in dem anderen Sessel saß, Beine übereinandergeschlagen. Und was diese Menschen am frühen Morgen von ihr wollten.
Die Dame hatte nur kurz aufgeblickt, als Emma den Raum betrat, aber es hatte gereicht, um Emma nachhaltig zu verunsichern. Gepflegt. Perfekt geschminkt. Brünettes Haar mit goldenen Strähnchen, zarter Goldschmuck, Rock und Blazer in Dunkelblau, Nylons, High Heels. Im Februar. In Berlin. Als Emma am Montagmorgen unerwartet einbestellt wurde, hatte sie in Panik das erste Outfit übergeworfen, von dem sie wusste, dass es einigermaßen anständig aussah: das von der Talkshow. Jetzt wünschte sie sich, sie hätte was Frisches angezogen. Sie wünschte sich Haare. Ihre letzte Frisur klebte auf irgendwelchen Panzertapestücken in der Asservatenkammer.
Die Büroeinrichtung des Polizeipräsidenten erinnerte entfernt an eine vergessene, verstaubte James-Bond-Kulisse. Die farblosen Lamellenvorhänge, der Kunstfaserteppich, auch der Polizeipräsident selbst, mit seinem Namensschild auf dem massiven Teakschreibtisch: Gab es tatsächlich Leute, die ihm gegenübersaßen, ohne zu wissen, dass er Falner hieß? Sie hätte lieber die Namen der anderen beiden erfahren, doch keiner machte Anstalten, sich vorzustellen.
Emma versuchte es mit höflichem Schweigen, aber offenbar erwartete Falner eine Antwort.
Sie gab ihr Bestes: »Wie bitte?«
»Nach Ihrem Auftritt am Freitag sind Sie doch ziemlich präsent in den Medien«, erläuterte Polizeipräsident Dr. Falner. Er hob eine Akte von seiner ansonsten sehr aufgeräumten Schreibtischplatte hoch und ließ sie wieder fallen. »Wenn ich alle Berichte über Sie zusammenzähle, ich meine, seit Ihrem allerersten Anruf bei dieser Talkshow im … wann war das?«
»Ende November«, half der Mann neben ihm aus.
»Im November. Dann komme ich auf fast ein Dutzend. Elf, um genau zu sein.«
»Ich habe mit niemand sonst von der Presse gesprochen«, stellte sie klar. »Die ganze Zeit nicht, bis gestern. Ich habe alle bis auf Langendorn abgelehnt.« Es beunruhigte sie schon ein wenig, dass der Polizeipräsident die genaue Zahl dieser Artikel kannte. Überhaupt, es beunruhigte sie, dass sie im Büro des Polizeipräsidenten saß.
Zum ersten Mal sprach der andere Herr sie an: »Dafür haben Sie aber einen starken Eindruck hinterlassen. Die Zuschauerquoten von Langendorn liegen normalerweise bei ein paar Zehntausend, am Freitag sprangen sie auf über eine Million.«
Emma antwortete nicht. Noch beunruhigender als die Tatsache, dass sie den Mann noch nie gesehen hatte, war die Tatsache, dass er die Einschaltquoten jener Talkshow kannte. Die kannte nicht mal sie.
Ein bisschen unangenehm war ihr die mediale Aufmerksamkeit schon. Es hatte gleich angefangen, nachdem sie damals in der Talkshow angerufen hatte. Sie hatte zufällig ferngeschaut, und da saß er seelenruhig in der Runde, Uwe Marquardt, redete von Läuterung und machte Werbung für sein Buch. Es war dieser Stuss, den er vor laufender Kamera von sich gab, der sie dazu gebracht hatte, zum Telefon zu greifen, und dann ging alles ganz schnell: Sie wurde live zugeschaltet, sagte ihre Meinung, und am Morgen danach hatte sie die Einladung ins Studio auf dem Tisch und diverse Interviewanfragen auf dem Anrufbeantworter. Sie ging auf nichts ein, überlegte sich ihren nächsten Schritt lange und beschloss schließlich, Langendorns Einladung doch anzunehmen, um zu Ende zu bringen, was sie angefangen hatte.
Abgesehen davon hatte sie nicht ein Wort mit irgendwelchen Journalisten gewechselt. Dass trotzdem Artikel über sie erschienen, konnte sie nicht verhindern. Und als sie vor drei Tagen den endgültigen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hatte, hatte sie genau gewusst, dass das den Chefs möglicherweise unangenehm aufstoßen würde, doch das war es ihr wert gewesen.
Jetzt war sie sich nicht mehr ganz so sicher.
Also griff Emma zu der einzigen Reaktion, die sie aus dem Effeff beherrschte: Trotz. »Ich habe nichts getan, wofür ich mich entschuldigen muss«, sagte sie und straffte sich, was nicht leicht war in dem Sessel.
Falner wechselte abrupt das Thema. Als ob er mit ihrer Antwort zufrieden sei. Oder nie zufrieden sein würde, egal was sie sagte. »Frau Carow, wissen Sie, was ein Antideutscher ist?«
Emma wusste, was ein Antideutscher ist. Sie wusste bloß nicht, wieso sie das gefragt wurde. »Das sind Linksradikale, die gegen alles sind, was deutsch ist.«
»Sie sprechen von den Antideutschen hierzulande. Es gibt sie aber auch in anderen Ländern. Zum Beispiel in Polen.«
Das war Emma neu.
»Frau Szymańska kann es sicher besser erklären als ich.«
»Kaja Szymańska.« Die Dame reichte Emma die manikürte Hand. Sie duftete nach Vanille. Emma schüttelte sie. Fester Händedruck, warmes Lächeln, knallharte Augen. »Angenehm.« Das war eine Lüge. Emma konnte diese Frau nicht einordnen. Und sie hatte sofort begriffen, dass es der Frau mit ihr genauso ging.
»Szymańska wie Schimanski?«, fragte Emma.
»Genau. Nur mit weiblicher Endung.«
»Aha.«
»Es gibt in Polen drei oder vier kleinere politisch motivierte Gruppen, die als antideutsch einzustufen sind«, erklärte die Dame. »Für die ist der Zweite Weltkrieg noch nicht vorbei. Sie geben den Deutschen die Schuld an allem, was in ihrer Welt schiefläuft.« Ihr Deutsch war fast perfekt, nur eine weiche, ungewohnte Melodie lag darin. Emma mochte den Klang. Die Männer auch, das sah sie. »Ihr Image ist furchterregender, als sie in Wirklichkeit sind, aber: Viele Menschen trauen ihnen Gewalttaten zu. Sogar im Extremfall Terrorakte zu planen und auszuführen, in der Hoffnung, so was wie einen neuen Krieg zwischen Deutschland und Polen anzuzetteln.«
»Wie bitte?«.
Die Dame lachte verlegen. »Es hört sich lächerlich an, ist es ja auch. Aber diese Gruppen – sie wollen Emotionen auf beiden Seiten der Grenze hochpeitschen. Wenn sie mit irgendeiner irreführenden Aktion erreichen können, dass die zwei Nationen sich öffentlich gegenseitig Vorwürfe machen, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Dann ist die Beziehung zwischen Deutschland und Polen bald wirklich gestört.«
Emma hatte keine Ahnung, worum es ging. Politik, Außenpolitik, damit kannte sie sich nicht aus. Ihre Welt waren Serienmörder, Serienvergewaltiger, Serientäter. Das mussten die doch wissen. Oder? Sie brauchte dringend einen Kaffee.
Präsident Falner hatte noch mehr Fragen: »Wissen Sie, wer Gudrun Schmalig ist?«
»Ich kenne den Namen.«
Wer nicht. Die nicht gerade öffentlichkeitsscheue Vizepräsidentin des Verbands der Heimatvertriebenen Schlesiens, von ihren Feinden als Rechtsextremistin tituliert, von ihren Fans als Streiterin für die Rechte der Enteigneten. Aber vor allem: eine echte Rampensau.
»Vorgestern bat uns Frau Schmalig offiziell um eine Stellungnahme in einer polizeilichen Sache«, sagte der andere Mann. Emma hatte keine Ahnung, wer »uns« war. »Fotokopien von bestimmten Briefen befinden sich in ihrem Besitz. Sie möchte wissen, warum die Polizei in dieser Sache bislang untätig gewesen ist.«
Emma wusste nichts von irgendwelchen Briefen.
»Unsere Stellungnahme hat sie noch nicht bekommen«, fuhr Herr Dr. Falner fort. »Aber sie hat uns schon gewarnt: Sie habe vor, diese Sache bei der nächsten Mitgliederversammlung des Verbands der Heimatvertriebenen Schlesiens anzusprechen. Am Freitag. Die Presse wird anwesend sein.«
»Liegt der Fall denn bei uns?« Emma wunderte sich. »Bei der OFA?« Das war die Operative Fallanalyse, die Abteilung des Berliner LKA, der sie angehörte.
»Nein. Es ist auch keine Sache der Berliner Polizei, sondern der polnischen Behörden. Frau Szymańska hier ist Chefermittlerin der Kommandantur Breslau, in der Woiwodschaft Niederschlesien …«
»… Dolnośląskie«, sagte Frau Szymańska und strich sich den Rock glatt.
»Tut mir leid, ich verstehe immer noch nicht …«
Herr Dr. Falner reichte Emma eine schmale Akte. »Es handelt sich um drei Schriftstücke, die in den letzten beiden Monaten bei der polnischen Polizei eingegangen sind«, sagte er. »Die Briefe sind in zwei verschiedenen Handschriften verfasst, dem Anschein nach von zwei Frauen. Diese behaupten, sie würden in Polen von einem Mann festgehalten und wiederholt vergewaltigt und missbraucht. Sie bitten die Polizei um Hilfe.«
Häh?
»Wie kommt die Polizei denn an die Briefe?«, fragte Emma zögernd. »Wenn die Frauen doch festgehalten …«
»Der Täter selbst hat die Briefe zur Post gebracht«, sagte Frau Szymańska. »Ordentlich frankiert, in drei Briefkästen in drei verschiedenen Ortschaften Westpolens abgeschickt.«
»Häh?«
Frau Szymańska lachte und strich sich eine goldene Strähne hinters Ohr. »Ehrlich gesagt, das war auch meine erste Reaktion, genau so: Häh? Unten auf jedem Brief steht die Aufforderung, die Polizei möge ihn auf ihrer Website veröffentlichen. Bei dem ersten Brief haben wir das nicht gemacht, wir hielten ihn für einen üblen Scherz. Doch als der zweite kam, dachten wir, sicherheitshalber sollten wir es ernst nehmen, und veröffentlichten dann auch den ersten Brief nachträglich. Aber …«
»Ich halte es immer noch für einen Scherz«, sagte Falner.
»Ich auch«, bestätigte Szymańska. »Ein Serienvergewaltiger, der Frauen tage-, wochenlang festhält, sie Briefe schreiben lässt und die dann auch noch abschickt? So was kommt meiner Erfahrung nach nicht vor.«
Emma nickte. »Und was hat all das mit der deutschen Polizei zu tun?«
»Die Briefe wurden auf Deutsch verfasst«, sagte der Unbekannte, der neben Falner stand. »Die angeblichen Opfer sind deutsche Frauen.«
Emma wollte noch einmal häh sagen, ließ es aber lieber. Sie schaute die Akte an, die sie in ihren Händen hielt. »Und ich soll …?«
»Nicht die Briefe sind unser Problem.« Der fremde Mann seufzte. »Unser Problem ist die gute Frau Schmalig. Irgendwer hat sie auf die Briefe aufmerksam gemacht. Sie stehen ja schon zwei Wochen online, jeder kann sie sehen, aber deutsche Journalisten gucken nicht so oft auf die Website der polnischen Behörden. Bisher. Jetzt ist Frau Schmalig überzeugt, dass, ich zitiere: irgendwelche Deutsche hassenden Polacken – Entschuldigen Sie, Frau Szymańska – unsere Frauen entführen und misshandeln, und sie will wissen, warum die deutsche Polizei nichts dagegen unternimmt.«
»Aber das ist nicht unsere Sache, es ist doch auf polnischem …«
»Das interessiert Frau Schmalig nicht«, sagte der zweite Mann. »Sie will einen Skandal. Sie will der Regierung Unfähigkeit und Verrat am Volk vorwerfen. Und das wird ihr auch gelingen. Es sei denn, Sie sagen ihr, die Briefe sind ein Scherz.«
»Ich?« Emma starrte auf die Akte in ihren Händen. »Ich soll …«
Alle blickten sie an.
»… die Briefe analysieren …«
Die Männer warteten.
»… ein Täterprofil erstellen …«
Sie warteten.
»… in dem steht, dass ein solcher Täter unwahrscheinlich ist …«
Sie warteten.
»… und es sich höchstwahrscheinlich um einen üblen Scherz handelt.«
Die Männer warfen sich einen Blick zu, Frau Szymańska nickte lächelnd.
»Natürlich nur, wenn es sich Ihrer Meinung nach tatsächlich um einen üblen Scherz handelt«, sagte der zweite Mann freundlich.
»Wir sind da ja selbst noch ein bisschen unsicher«, sagte Szymańska.
»Keine Leichen? Spuren? Anhaltspunkte?«, fragte Emma sie. »Gar nichts?«
Szymańska zuckte die Achseln. »Ich komme mit mehr oder weniger leeren Händen …«
»Frau Carow, noch mal zu dieser Talkshow«, ergriff der Falner das Wort, als sei ihm das gerade eingefallen. »Ich habe gewisse Vorbehalte gegenüber Beamten, die sich im Fernsehen profilieren und wie B-Promis benehmen. Sie betreten da eine Grauzone, egal wie oft Sie vergewaltigt wurden. Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps, und ich erwarte von Ihnen, dass Sie das ein bisschen im Auge behalten.«
Frau Szymańska schaute zu Boden. Die beiden Männer blickten Emma unverwandt in die Augen. Sie antwortete nicht – was hätte sie antworten sollen? –, und Herr Dr. Falner räusperte sich.
»Nun hat die Presse aber einen Narren an Ihnen gefressen. Die wissen auch, dass Sie eine ausgezeichnete Fallanalystin sind, obwohl keiner da draußen eine Ahnung hat, was das eigentlich ist. Wenn Sie in drei Tagen vor die Presse treten und klarstellen, dass die Briefe ein Scherz sind, wird dies am Freitag in der Zeitung stehen. Da wird auch die Mitgliederversammlung von Frau Schmalig stattfinden, und sie wird keine Möglichkeit mehr haben, aus den Briefen einen internationalen Skandal zu zimmern. Wir brauchen Ihr Fallprofil, sagen wir lieber Fallgutachten, am Donnerstagmorgen um neun. Ich will mich klar ausdrücken, Frau Carow: Ihr Gutachten muss deutlich machen, dass die Briefe substanzlos sind, von einer kleinen Gruppe Spinner verfasst, reine Fantasie, und dass nirgendwo irgendwelche deutschen Mädels in Gefahr sind. Ich freue mich auf Ihre Einsichten. Sie dürfen gehen.«
3
Es war immer noch nicht richtig hell draußen, so ein schmutzig-kaltes Februarzwielicht unter grauer Wolkendecke, als ob sich die Winternacht verzweifelt weigerte, dem Morgen endgültig zu weichen. Konnte gut sein, dass sie damit durchkam. Zwang sie ja auch keiner dazu hier in Berlin.
Emma hatte einen Parkplatz in der Keithstraße gefunden und stapfte zwischen den Haufen schwarzen, halb geschmolzenen Schnees Richtung Burg.
Die Burg: Fast einen ganzen Häuserblock nahm sie ein, drei Wohnhäuser breit, fünf Stockwerke hoch, ein Amtsgebäude von altertümlicher Wucht, aus schweren Quadern im 19. Jahrhundert errichtet, um einzuschüchtern, ganz klar, vor allem Leute, die vom rechten Wege abkommen wollten. Stärke sollte sie ausstrahlen, Stärke und Autorität, und falls da ein oder zwei ominöse Gerüchte kursierten, im Keller lagerten noch mittelalterliche Foltergeräte, umso besser.
LKA 1, Delikte am Menschen. Das war Emmas Arbeitgeber, und ganz hinten, ganz oben, im Dachgeschoss, die OFA, die Operative Fallanalyse, das war ihr Büro, das sie mit Sigmar, Felix und Matze teilte. Ein Erker mit Konferenztisch, drei Schreibtische, viel Platz, viele Fenster. Der Raum war hoch, weit und weiß. Die Fallanalysten hatten es gut in ihrem modernen Büro unterm Dach, das von den übrigen Bullen in der Burg, die mehrheitlich umgeben waren von den traditionellen Amtsstubenfarben Kotzgrün und Knochengelb, etwas abfällig die Puppenkiste genannt wurde. Wieso Puppenkiste? Ein Rätsel. Hing wohl mit den Eierköpfen zusammen, die hier arbeiteten. Was Eierköpfe genau mit Puppen zu tun hatten, wusste Emma nicht, Bullen sind halt keine Wortkünstler. Immerhin sagte niemand mehr Profiler, oder zumindest kaum noch, Emma hasste das Wort, Fallanalysten waren sie, Profiler war Fernsehdeutsch.
Das Büro war leer. Punkt acht war sie auf dem Polizeipräsidium gewesen, jetzt war es kurz vor neun, später als üblich, und sie war immer noch die Erste. Emma machte die Lichter an, die Kaffeemaschine, fuhr ihren Computer hoch, lüftete, hängte ihren feuchten Mantel auf, schloss das Fenster wieder, weil sie fror, und war immer noch allein. Sie brühte sich einen starken Kaffee auf gegen das Zwielicht da draußen. Setzte sich an ihren Schreibtisch und las.
ERLÄUTERUNG/A. SZYMAŃSKA/KOMMANDANTUR BRESLAU, WOIWODSCHAFT NIEDERSCHLESIEN (ÜBERSETZT AUS DEM POLNISCHEN)
Am 6. Januar sowie am 2. und 9. Februar ging je ein anonymer Brief bei den polizeilichen Behörden in Wrocław (Breslau) ein. Alle Umschläge waren handschriftlich adressiert; laut Handschriftenanalyse wurden diese Adressen von der Verfasserin der jeweiligen Briefe geschrieben. Keiner der Umschläge enthielt einen Absender. Die Briefe wurden in drei Ortschaften in Województwo Dolnośląskie (Distrikt Niederschlesien) jeweils etwa 100 Kilometer entfernt von Zgorzelec (Görlitz), an der deutschen Grenze, abgeschickt.
Auf den Umschlägen sowie an den Briefen selbst wurden DNA-Spuren und Fingerabdrücke festgestellt, die mutmaßlich von den Verfasserinnen der Briefe stammen. Bisher konnten diese nicht zugeordnet werden.
Eine Handschriftenanalyse ergab, dass es sich um insgesamt zwei Verfasser/innen handelt: Brief 1 wurde von Unbekannte 1 verfasst, Briefe 2 + 3 wurden von Unbekannte 2 verfasst.
Jeder Brief besteht aus einem Blatt handelsüblichen Druckerpapiers.
Jeder Brief wurde auf Deutsch verfasst.
Unter dem jeweiligen handgeschriebenen Text befindet sich zusätzlich ein polnischer Satz, der mit einem Tintenstrahldrucker hinzugesetzt wurde. Auf jedem Brief ist dieser Satz wortgleich. Uprasza się o niezwłoczne umieszczenie niniejszego listu w eksponowanym miejscu na waszej stronie internetowej. – Es wird darum gebeten, diesen Brief unverzüglich an prominenter Stelle auf Ihrer Website zu veröffentlichen.
Aus Rücksicht auf die Öffentlichkeit kam die polizeiliche Behörde bei Brief 1 der Forderung zunächst nicht nach. Inzwischen wurden alle drei Briefe auf der Website der polnischen Polizei veröffentlicht, zusammen mit einem Zeugenaufruf. Darauf erfolgte jedoch keinerlei Reaktion.
Emma legte die Seiten auf ihrem Schreibtisch ab – und sah, wie eine Männerhand sie aufnahm. Sigmar Anstätt. Er war gerade reingekommen.
»Ich habe von Ihrem T-T-Termin heute Morgen gehört. Sie sind eine ge-ge-gefragte Frau.«
»Das hat mit dieser Talkshow-Sache zu tun, peinlich, so was.«
»Finde ich nicht. Noch ein K-K-Kaffee?«
»O ja, gern.«
Sigmar: schlaksig, im schwarzen Rolli. Immer dieser schwarze Rolli. Wie viele davon er wohl hatte? An den Bart, den er sich neuerdings stehen ließ, konnte sich Emma einfach nicht gewöhnen. Autorität. Es ging um Autorität. Der Bart sollte ein Zeichen sein. Hätte er es nur gelassen. Zu durchsichtig. Also das Zeichen, nicht der Bart. Das Chefzimmer da hinten schien immer noch zu groß für ihn und der Schreibtisch auch, hier auf die Tischkante passte er besser. Auch wenn er es nicht zugab. Ein Chef gibt so was nicht zu. Sigmar aber stand es ins Gesicht geschrieben. Trotz Bart.
Und dann das Stottern. Als Sigmar die OFA-Abteilungsleitung als Elternzeitvertretung übertragen bekam, womit nun wirklich keiner gerechnet hatte, war Emma sicher gewesen, dass das bestimmt nachlassen würde – Chef der Berliner OFA, selbst vorübergehend, das war eine Respektsposition, das musste sich doch auf Sigmars Gemüt auswirken. Aber es kam umgekehrt: Das Stottern wurde schlimmer.
Emma griff zur nächsten Seite.
»Hallo, Promi«, sagte Matze, Fahrradhelm noch unterm Arm. Er grinste.
Emma stöhnte.
»Der Pach aus der MK 5 meint, du kriegst bald deine eigene TV-Show.«
»Hauptsache, ihr habt Spaß«, sagte Emma.
»Und ich soll dich von der Ceesay grüßen«, fuhr Matze, immer noch grinsend, fort. »Sie hat es im Präsidium erfahren und macht jetzt Werbung für dich. Sie will das Management für dich übernehmen.«
Jetzt jemand in die Fresse hauen. Aber nicht Matze. Matze könnte Emma nie in die Fresse hauen. Matze, der Jüngste in der Puppenkiste. Matze, der seit Neuestem immer sein Rennrad mit ins Büro schleppte, seit ihm das letzte direkt vor dem LKA geklaut worden war. Wer klaut ein Fahrrad direkt vor dem LKA-Gebäude? Wahrscheinlich ein Kollege – das perfekte Verbrechen. Matze, in der Fallanalyse noch etwas frisch, aber keiner konnte recherchieren wie er. Und Fortschritte machte er auch rasend schnell, er war so ehrgeizig wie smart, der Klügste von ihnen vielleicht, der schlaue kleine Bruder, jeden Monat eine neue Haarfarbe, eine so bescheuert wie die andere, diese Woche grün-blond, weil es gerade hip war, vegan zu essen und Gemüsegärten für Flüchtlinge anzulegen, egal, die Haare standen eh immer in alle Richtungen, und WhatsApp statt Facebook, Twitter statt Instagram oder umgekehrt, Emma wusste es nie, Matze aber sicher.
Während Sigmar die gelesenen Seiten von Emma aufnahm, nahm Matze die Seiten von Sigmar. Einträchtig saßen sie nebeneinander auf Felix’ Schreibtisch und lasen. Emma auch.
GRAFOLOGISCHES GUTACHTEN/DR. RALF JEREMIAS, DRESDEN, IM AUFTRAG DER POLIZEIDIREKTION ZGORZELEC (GÖRLITZ), POLEN.
Den Handschriften nach zu urteilen, wurde Brief 1 durchgehend von einem einzigen Verfasser, wahrscheinlich einer Frau (allein aufgrund der Handschrift kann das Geschlecht des/der Verfassers/in nicht hundertprozentig festgestellt werden, lediglich eine Wahrscheinlichkeit), in einer einzigen ununterbrochenen Sitzung niedergeschrieben.
Die Briefe 2 und 3 stammen von einem zweiten Verfasser, wahrscheinlich ebenfalls einer Frau, und sind ebenso, der Handschrift nach zu urteilen, ausschließlich von einer Person in einer einzigen ununterbrochenen Sitzung geschrieben worden.
Alle drei Briefe entstanden unter intensivem Stress – das geht aus Strichbeschaffenheit, Druckgebung und Bewegungsfluss der Handschrift hervor. Das Schreibtempo, die Unsicherheit und emotionale Erregung, die die Schrift verrät, legt die Vermutung nahe, dass die Briefe unter Zeitdruck entstanden, möglicherweise auch unter Beobachtung, vielleicht unter Bedrohung.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Briefe oder Teile davon diktiert oder abgeschrieben wurden. In dem Fall hätte die Verfasserin jene Sätze langsamer und bedächtiger notiert. Nach meiner Einschätzung stammt der gesamte Inhalt jeweils von den Verfassern/innen selbst: Im Wesentlichen schrieb sie, was sie schreiben wollte, nicht, was der Täter befahl.
Auffallend ist das Bemühen um Leserlichkeit in Brief 3, trotz des sinnlosen Inhalts. Es bleibt unklar, warum der/die Verfasser/in so großen Wert auf Leserlichkeit legte, aber keinen Wert auf eine verständliche Botschaft.
»Da ist sie ja, unser …« Felix kam zur Tür herein.
»Fick dich ins Knie«, sagte Emma.
»Wie bitte?« Felix grinste nicht. Er runzelte gekränkt die Stirn. So eine Begrüßung hatte er nicht erwartet. »Was ist denn jetzt schon wieder? Dass du so mit Kollegen umspringen musst … Manchmal bist du echt die Axt im Walde und kriegst es gar nicht mit.«
Felix, Arschloch vom Schreibtisch nebenan, kompaktes, leicht zu provozierendes Muskelpaket mit Machokomplex. Und unverschämt dazu. Schlechter Fallanalyst, aber guter Kollege. Wenn dir einer das Leben rettet, ist er offiziell ein guter Kollege. Genau das hatte Felix getan, im November, er war es gewesen, der sie auf ihrem eigenen Dachboden gefunden hatte. Kurz bevor es zu spät gewesen war. Jetzt war er ein guter Kollege. Und trotzdem ein Arschloch. Immer wieder versuchte Emma, wohl aus Dankbarkeit, das zu vergessen, doch dann sagte er so nebenbei an der Kaffeemaschine Sachen wie: »Du solltest mal in eine bessere Jeans investieren, in der sieht man deinen Arsch ja gar nicht.«
»Weißt du, ich bin vielleicht nicht der Netteste, das geb ich zu, aber ich geb mir Mühe, so was verdiene ich nicht.« Felix warf seine Jacke auf seinen Schreibtisch und stapfte zum Kaffeetisch, wo er grummelnd seine geliebte, vielfach geklebte Sherifftasse suchte. Lange würde die nicht mehr halten. Er warf sie einfach zu oft durch die Gegend.
Emma wusste nicht, was sie sagen sollte. »Ja, Felix, ich dachte, äh, ich meine …«
»Und weißt du, was am meisten schmerzt? Dass es von dir kommt, ausgerechnet von dir, einem echten Promi, dem Einzigen unter uns, der eine eigene TV-Show bekommt, und ich hatte mich wirklich darauf gefreut, dich im neuesten Playboy zu bewundern.«
Felix grinste. Emma zeigte ihm einen Vogel.
Die Briefe. Handgeschrieben, nein, hingekritzelt. Die Fotokopien verrieten, wie schmutzig, verschmiert die Originale waren: Dreck? Tränen? Blut?
Emma las.
du mieses Stück Dreck du willst eine Sexsklavin du hast dich an der Falschen vergriffen du kranker Arsch du kannst mich an den Stuhl ketten bis ich mich vollscheisse schlag mich soviel du willst du kannst mir die Beine vom Leib reissen ist mir doch scheiss-egal du machst mir keine Angst du bist ein Anfänger du willst den starken Mann markieren du weisst nicht was ein Mann ist du glaubst du kriegst mich klein du weisst gar nichts du kleiner Wixer Kackratte ich lache ich beiß dir den Schwanz ab ich scheiss auf dich und deinen Transenschwanz und du glaubst wirklich ich falle drauf rein dass du das hier den Bullen schickst und noel heißt du auch nicht oder glaubst du ich bin blöd? leck mich am Arsch mir doch scheissegal ob ich sterbe oder lebe glaubst du das kümmert mich dann weisst du gar nichts du kleiner Dreckswixer und selbst wenn du mich in die Luft zerreisst wirst du das immer sein du elendes
Emma atmete tief durch und griff nach dem nächsten Brief.
Bitte helft mir, er will mich töten, er sagt er reißt mich in Stücke, er sagt er wird diesen Brief an die Bullen schicken, aber ich weiß es nicht. Bitte bitte helft mir – er hat mir den Kessel gezeigt. Ich will nicht sterben. Er kettet mich die ganze Woche im Hundekäfig an und vergewaltigt mich und ich muss auf Knien bleiben ich spüre meine Beine nicht mehr. Er gibt mir nur Hundefutter, er sagt ich habe ihn verachtet und er bringt mir Respekt bei. – Aber ich kenne ihn doch gar nicht. Er vergewaltigt mich, weil er sagt ich verdiene nichts anderes, aber ich habe nichts falsch gemacht, ich habe ihn nicht ausgenutzt, ich bin kein weiblicher Parasit. Ich will nur nicht mehr hier knien an der Leine, ich kann nicht stehen, überall Scheiße, er sagt, wenn ich alles tue, lässt er mich frei. Aber ich habe den kessel gesehen, er will mich töten. Ich will nicht in den kessel. Bitte helft mir. Ich kann den ältesten Baum Polens sehen, ich bin direkt darunter, ihr müsst mich doch finden bitte helft mir – bitte sagt ihm dass ich ihn nicht verachte
Emma las.
Wauwau igittigitt wauwau neinneinein baffbaffbaff wauwau eieiei wau roff leckleckleck wauwau idiot wuffwuffwuff neinneinnein wauwauwau wau wau wau wauw
Sie drehte das Blatt um, bevor ihr wieder einfiel, dass es ja Fotokopien waren. Leer.
Das war alles.
4
»Bullshit.« Felix guckte in seine leere Sherifftasse. »Das ist Bullshit und sonst gar nichts. Kein Täter schreibt solche Briefe, er lässt sie auch nicht schreiben, das sind irgendwelche Spinner.«
»Tja, Fall gelöst, dann können wir ja alle nach Hause gehen, super!« Matze griff nach seinem Helm.
»Was macht euch da alle eigentlich so sicher?«, wollte Emma wissen.
»Na, Brief 3 zum Beispiel?« Felix. »Wenn ein Opfer Gelegenheit hat, mit der Polizei zu kommunizieren, schreibt es doch nicht so einen Unsinn.«
»Vielleicht glaubte sie nicht daran, dass der Täter den Brief auch abschickt.« Matze.
»Aber A-A-Anhaltspunkte, wo sie ist, hat sie ja schon genannt. Im zweiten Brief.«
»Du meinst diesen ältesten Baum, den sie sehen kann?«
»Ja, was war das?« Felix. »Wissen wir dazu mehr?«
Emma blätterte in der Akte. Sie las vor:»Als ältester Baum Polens gilt die Eibe von Henryków, auf etwa tausendzweihundertfünfzig Jahre geschätzt; sie steht neben dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Henryków Lubański, fünfunddreißig Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Zwei weitere Bäume haben den Ruf eines sehr hohen Alters: Die Bartek-Eiche, ehemals auf tausendzweihundert, heute sechshundertsiebzig Jahre geschätzt, steht zwischen Bartków und Zagnańsk, hundertsiebzig Kilometer von Warschau entfernt; die Raciborski-Eiben (Baumgruppe), auf je hundert Jahre geschätzt, stehen in Harbutowice, in der Nähe von Krakau. Die polizeilichen Behörden in diesen drei Ortschaften wurden alarmiert. Aus Brief 1 geht hervor, dass das Opfer den Täter möglicherweise in den Penis gebissen hat. Bei den Krankenhäusern in den Ortschaften, wo die Briefe abgeschickt wurden, sowie in denen, wo ein ›ältester Baum Polens‹ steht, wurde nach entsprechenden Verletzungen angefragt – ergebnislos. Abgesehen von den Briefen selbst gibt es keinerlei Hinweise, dass tatsächlich ein Verbrechen stattgefunden hat.«
Emma ließ das Papier sinken. »Ich frage mich, ob das Opfer weiß, dass er die Briefe tatsächlich an die Polizei schickt …«
Felix lachte: »Glaubst du, die Opfer haben Internet? Minibar und Zimmerservice vielleicht auch?«
»Der zweite Brief wurde auf der Website der Polizei veröffentlicht. Könnte ja sein, dass der Täter dem Opfer die Website dann zeigt.«
»Aber wozu?« Felix schüttelte den Kopf. »Was hat er davon?«
Auf diese Frage hatte Emma keine Antwort. Fragend blickte sie zu Matze.
»Es gibt schon so Angeber, die Briefe an die Polizei schicken, die liefern sich halt ein Katz-und-Maus-Spiel mit denen«, sagte der und rührte in seinem Tee. »Das macht die an, größenwahnsinnig sind die, glauben, keiner kann ihnen was.«
»Ach, das ist doch Hollywoodscheiß«, meinte Felix und lehnte sich so weit in seinem Stuhl zurück, dass er gerade nicht umkippte. »Kein Täter spielt freiwillig mit der Polizei – die wollen uns so fern bleiben wie möglich, damit sie in Ruhe weitermachen können, durch irgendwelche Spielchen machen sie es sich nur schwerer.«
»Aber es gab doch diesen Fall letztes Jahr in Hamburg«, setzte Emma nach, »wo ein Serienvergewaltiger an die Polizei schrieb. Er hat geradezu darum gebettelt, dass sie ihn finden. Er konnte seine eigenen Taten nicht mehr ertragen.«
»Und, haben sie ihn gefunden?«
»Nicht anhand des Briefes«, gab sie zu. »Er hat keine Hinweise darin hinterlassen, die zu ihm führen könnten, auch keine DNA oder Fingerabdrücke.«
»Na, dann wollte er wohl doch nicht gefasst werden.«
»Er wollte sein Gewissen beruhigen.«
»Das passiert vielen Serientätern«, sagte Sigmar. »Sie machen Phasen durch, in denen sie sich vor sich selbst ekeln. K-k-kein Wunder. Da suchen sie Vergebung. Aber insgesamt sind sie vor-vor-vorsichtig. Sie wollen nicht gefasst werden.«
»Was ist mit diesem … diesem …?«, murmelte Matze, drehte sich zum Computer, tippte. »Moment … hier. William Heirens. Serienmörder, drei Opfer, in Chicago, 1940-irgendwas.« Er konsultierte den Bildschirm: »Um Himmels willen, findet mich, bevor ich wieder töte, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Das schrieb er am Tatort an die Wand, mit Lippenstift.«
Matze war gut in Recherche.
Felix: »Hinterließ er Namen und Adresse? Wenn er wirklich gefasst werden wollte, hätte das was gebracht.«
Matze grinste. »Nein. Man hat ihn erst bei einem Einbruch erwischt, da kamen auch die Morde raus. Erstaunlich viele Serienmörder schicken Nachrichten an die Polizei, eigentlich.«
»Der Kodak … Zodak …«, überlegte Emma.
Matze tippte. »Der Zodiak-Mörder, bis heute nicht gefasst. Auch Amerika. Zahlreiche Briefe an die Polizei mit verschlüsselten Nachrichten.«
Sigmar: »Peter Kürten, Düsseldorf.«
Felix: »Der? Echt?«
Matze tippte, las vor: »Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. Mehrere Briefe. Eins seiner Opfer war nicht gefunden worden, keiner ahnte, dass er noch mal zugeschlagen hatte. Das hat ihn echt genervt. Er ging die Zeitungen durch, fand keine Meldung darüber, und endlich reichte es ihm, und er schrieb selber einen Brief an die Polizei, mit dem Leichenfundort. Es gibt mehr …«
Emma: »Matze, das reicht.«
Aber Matze war noch nicht fertig. »Sogar Jack the Ripper soll …«
»Es gibt aber-aber-aber«, unterbrach Sigmar, »ein paar entscheidende Unterschiede. In all diesen Beispielen stammen die Briefe vom Täter selbst. Ich kenne keinen Fall, in dem ein Opfer mit Einwilligung des Täters Briefe an die Polizei schrieb.«
»Ja, und warum auch?«, sagte Felix. »Es macht keinen Sinn.«
Matze suchte, scrollte, musste dann aufgeben: »Hm. Seltsam ist es schon. Zumindest finde ich nichts dergleichen. Das ist schon … anders.«
»Dazu kommt, dass es im Normalfall ein Bekennerbrief ist, und der wird an die Zeitungen geschickt.« Zei-Zei-Zeitungen. »Es geht dem Täter nicht um das berühmte Katz-und-Maus-Spiel, da hat Herr Schreiner schon recht, sondern um Aufmerksamkeit, um Selbstverherrlichung … Das will er aber normalerweise in der Zeitung lesen, wo die ganze Welt es mitbekommt, nicht auf einer läppischen Polizei-Website. Dieser Fall ist ein echtes Novum.«
»Sag ich doch.« Felix.
Sigmar fuhr fort: »Täter dieser Art, Vergewaltiger und Mörder, wollen Macht über ihre Opfer. Sie wollen sie erniedrigen, vernichten.« V-v-vernichten. »Wenn er mit diesen Briefen den Opfern eine Stimme gibt, stärkt er sie, gibt ihnen ihre Menschlichkeit zurück. Das ist doch das Letzte, was er will.«
»Tut er auch nicht.« Felix schnaubte. »Weil es keine Opfer gibt. Das sind Kids, die sich einen Spaß daraus machen, die Bullen an der Nase rumzuführen. Das erklärt auch den dritten Brief, diesen Wauwau-Scheiß. Drei, vier Loser, mindestens zwei Mädels dabei, die sich langweilen vor ihrer Playstation, neben ihrer kalten Pizza, die Bullen haben auf ihren ersten Scherzbrief nicht reagiert, sie schreiben den zweiten Brief schon mit weniger Begeisterung, ein letzter Versuch halt, eine Reaktion zu provozieren, und dann erscheint der Brief tatsächlich, wow, die Bullen beißen an, sie sind aufgeregt, aber ihnen gehen die Ideen aus, außerdem sind sie schon wieder mitten in Zombie Commando 4 – Knallt die Bitches ab!, und einer von ihnen kommt auf die Idee: Ey, wir tun so, als ob die Bitch im Hundekäfig durchgedreht ist, und schmiert wahllos Buchstaben hin und schickt den Brief weg, und schon ist ihr cooler Scherz mit den Bullen vorbei, die Luft ist raus, und sie bestellen noch eine Pizza.«
Stille.
»Und diese Idee mit den politischen Extremisten, diesen Antideutschen, die der Falner hatte?«, sagte Emma nach einer Weile.
»Na, dann antideutsche Kids, von mir aus. Aber keine Serienmörder. Kids.«
»Glaub ich nicht. Frauen scherzen anders.« Matze verzog das Gesicht.
»Muss nicht sein. Gruppendruck«, sagte Emma. »Apropos Pizza …«
Alle standen auf.
»Das Problem ist d-d-doch, die Briefe sind nicht wirklich Briefe. Sie tun so, sind es aber nicht.« Sigmar kam gerade erst in Fahrt.
»Könntest du das bitte näher erläutern?«, raunzte Felix.
Matze setzte sich wieder.
»Ein Brief ist eine Form von Kommunikation«, sagte Sigmar. »Und was heißt das? In der Linguistik gibt es ein Modell, nach dem Kommunikation aus drei Teilen bestehen muss: Sender, Botschaft und Empfänger. Wenn eines davon fehlt, entsteht keine Kommunikation: Wenn ein Liebender einen Liebesbrief schreibt, ihn aber nicht abschickt, gibt es Absender und Botschaft, aber keinen Empfänger, deshalb entsteht keine Kommunikation.« Li-Li-Linguistik, Kommu-Kommuni-Kommunikation.
»Wissenschaftler müsste man sein.« Felix stöhnte. »Man wird bezahlt, um auszusprechen, was jeder weiß.«
»Sigmar hat recht«, sagte Emma nachdenklich. »Die Briefe passen hinten und vorne nicht in das Modell. Der Absender ist unklar – ist es Opfer oder Täter? Auch die Botschaft ist unklar – Hilferuf? Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei? Selbstverherrlichung des Täters? Zu keinem Zweck sind die Briefe geeignet … Und der Wauwau-Brief ist nur noch Dada. Und wer ist der Empfänger: Polizei oder Öffentlichkeit? Mit wem kommuniziert er – oder sie – eigentlich?«
Matze: »Er hat einfach einen Knall.«
»Oder sie. Und es gibt gleich zwei davon – würden gleich zwei verwirrte Menschen solche Briefe schreiben?«
»Ihr habt euch gerade in die Ecke manövriert«, feixte Felix. »Ihr habt gerade technisch bewiesen, dass die Briefe unmöglich sind.«
»Nicht unmöglich …«, begann Sigmar.
»… nur eben nicht echt«, ergänzte Emma und seufzte. »Was war jetzt mit Pizza?«
5
»Du steckst in der Scheiße«, sagte Felix, noch auf der Treppe nach unten, bevor er und Emma die Eingangshalle des LKA erreichten.
»Wieso das denn?«
»Du sagst, der dritte Mann im Präsidium wurde dir nicht vorgestellt?«
»Ja, schon, aber …«
Diese geschwungenen Treppen ging man unwillkürlich anders herunter, mit Haltung. Emma hatte hier noch nie jemanden rennen sehen. Die hohe Eingangshalle des LKA 1 wirkte wie das Foyer eines Opernhauses, Neunzehntes-Jahrhundert-Kitsch, ganz anders als die ollen Büros dahinter. Der schönste Ort im Haus. Der Pförtner erwartete sie bereits. Die Pizza war angekommen. Nur der Thai noch nicht.
Während Sigmar der Meinung gewesen war, dass das Essen in der Kantine völlig ausreichend sei, hatte Matze gestöhnt, wenn er noch einmal Leipziger Allerlei mit Bratkartoffeln (ohne Speck) essen müsse, werde er den Koch zusammenschlagen. Der konnte keine Bratkartoffeln ohne Speck. So kamen sie überein, Essen zu bestellen, doch während Felix für Salamipizza extrascharf votierte, war Matze für den Thai am Nollendorfplatz gewesen, wegen des Pho Hanoi mit Tofu. Sigmar gab zu bedenken, dass der Thai Sashimi Sushi Lounge hieß, das schien ihm doch kein echter Thai zu sein, zumal Hanoi in Vietnam liege. Felix lachte und meinte, nichts sei mehr echt, in der Küche stünden grundsätzlich Inder, außer beim Inder, da stünden Türken, und so diskutierten sie weiter, während Emma dem Ergebnis vorgegriffen und zwei Salamipizzen vom Italiener an der Ecke und zwei vegetarische Gerichte vom Thai-Vietnamesen-Japaner bestellt hatte.
Nun waren Felix und Emma in der Eingangshalle angelangt, um das Essen entgegenzunehmen, doch der Thai war noch nicht da.
»Noch mal hoch und wieder runter?«
Felix lehnte sich an die Marmorwand unter dem Kandelaber und verschränkte die Arme. Offenbar nicht.
»Andersherum«, sagte er. »Hat der Falner einen Grund genannt, warum die polnischen Kollegen nicht ihren eigenen Profiler an das Gutachten gesetzt haben? Hast du ihn mal nach dem Dienstweg gefragt? Eine Bitte um Amtshilfe aus Polen geht eigentlich zunächst ans benachbarte LKA, Sachsen. Nicht Berlin.«
Emma wollte erklären, sie wären vielleicht durch die Talkshow auf sie gekommen, der Polizeipräsident hoffe auf den Effekt … ja, auf welchen Effekt eigentlich? Jetzt kam sie sich lächerlich vor.
»Ich schreibe ein Gutachten, das ist alles«, verteidigte sie sich. »Ich gebe meine Meinung ab, vielleicht gibt es eine Pressekonferenz … Was genau verstehst du unter Scheiße, in der ich angeblich stecke?«
»Weißt du, was dein Fehler ist?«
Emma stöhnte. Jetzt kam’s.
»Du bist zu gut. In der Fallanalyse.«
»Was soll daran ein Fehler sein?«
»Es blendet dich. Du glaubst, sie wollen dich, weil du gut bist. Du glaubst, es geht um einen Fall. In Wahrheit geht es um Politik. Es geht immer um Politik. Büropolitik, Machtpolitik, Karrierepolitik. Wenn du mal ein bisschen die Ohren aufsperren würdest, wüsstest du, dass die Chefetage niemals jemanden wie dich einbestellt, um dir unter Umgehung des Dienstwegs eine besondere Aufgabe anzuvertrauen. Niemals. Sorry, aber da hätten alle Alarmglocken bei dir losgehen müssen. Du hättest denen sagen müssen, tut mir ja so leid, ich würde gern helfen, aber meine Großmutter ist gestorben, ich muss zur Beerdigung, und die ist in Thailand. Irgendwas. Du hättest nie zusagen dürfen. Und noch was: Sigmar, der sitzt da, als wär nix, er ist unser Chef, er sollte dich vor so etwas in Schutz nehmen. Wenn die Brennemann noch da wäre, würde sie zum Präsidium marschieren und denen die Leviten lesen. Die hätte nie zugelassen, dass einer ihrer Mitarbeiter in so eine undurchsichtige Sache verwickelt wird.«
Der Thai war da.
Genervt stapfte sie die Treppen hoch, Thai in der einen Hand, lauwarme Pizza in der anderen. Felix mit den Getränken hinterher.
Mitten zwischen Erdgeschoss und erstem Stock, auf dieser prächtigen Treppe, hielt sie an und drehte sich mit großer Geste zu ihm um.
»Weißt du was? Du hast echt ein Problem. Du bist von deiner Karriere besessen und glaubst, alle anderen sind es auch. Du musst immer das Schlimmste annehmen … anstatt dass du einem mal ein bisschen Anerkennung gönnst.«
Jetzt musste er lachen. »Du glaubst, ich gönn dir keine Anerkennung?«
»Ja, weil du ein egozentrischer Arsch bist, alles, was du kannst, ist doofe Witze reißen …« Sie meinte jedes Wort, sie war wütend, und sein Lachen machte sie noch wütender.
»Jetzt hör mal gut zu«. Er setzte die Getränke ab. »Das, was du Freitag getan hast, hätte ich nie fertiggebracht.« Er schüttelte den Kopf. »Das war unglaublich mutig. Und nicht nur für eine Minute, sondern eine ganze Stunde lang. Du hast meine vollste Anerkennung. Hast du das echt nicht verstanden heute Morgen?«
Fast schüchtern sah er aus, als er zu ihr hochblickte. Zwei Kollegen kamen die Treppe runter, streiften ihn fast, er rührte sich nicht. Er sagte irgendwas, das sie nicht verstand, sie beugte sich zu ihm runter.
»Manchmal tut es mir leid«, sagte er.
»Was denn?«
»Dass ich dich nicht früher gerettet habe«, sagte er, trat zu ihr hoch und strich ihr über die kurzen Haare. »Dein Blond … dein Blond, das war wie Sonnenschein.«
Emma umklammerte Pizza und Thai fester. »Ja, äh, danke, aber warum … sagst du dann …?«
»Weil ich mir grad Sorgen um dich mache, Emma«, sagte er, zog sie zu sich und küsste sie flüchtig auf die Lippen. Grinste über ihren Gesichtsausdruck und brachte sein Argument zu Ende: »Du bist es nämlich nicht gewohnt, Glück zu haben.«
»Was?« Das war unfair. Emma wusste genau, was er da versuchte. Taktische Ablenkung, nur um die Auseinandersetzung zu gewinnen.
»Gib’s zu. Du bist mit Schmeichelei und billigen Versprechungen zu ködern, alles für ein bisschen Anerkennung …«
So ein Arschloch. Jetzt hatte er ihr auch noch bewiesen, dass er recht hatte.
»Halt mal«, sagte sie und drückte ihm spontan Thai und Pizza in die Hand. Dann hatte sie die Hände frei und scheuerte ihm eine.
Jetzt waren sie quitt.
»Danke«, sagte sie und nahm ihm die Tüten wieder ab.
Felix grinste und rieb sich die Wange. »Das ist die Emma, wie wir sie kennen und lieben. Komm, essen.« Er nahm die Getränke und sprang die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal.
6
»Wie findest du eigentlich diesen Hauke?«
»Der bringt mir Skittles mit«, sagte Emily begeistert. Sonst war es Emma, die immer was Süßes für sie dabeihatte. Überraschungseier meistens.
»Magst du Skittles lieber als Überraschungseier?«, fragte Emma.
Emily überlegte. Emma liebte es zuzusehen, wenn Emilys kleiner Kopf arbeitete. Das Mädchen wusste, wie wichtig die richtige Antwort war. Emma war ihre Lieblingstante, Hauke der neue Freund ihrer Mutter. Sie konnte sich keinen Fehler leisten. Emily: schon fast eins zwanzig groß, zierlich, blond, dunkelblaue Augen, lustig, unkompliziert, nicht doof, das perfekte Kind, die perfekte Nichte.
Emily fand die diplomatische Lösung: Ablenkung. »Das hat er mir auch geschenkt«, sagte sie. Sie zeigte auf ihren Hals. Emma war es schon aufgefallen, jetzt ging sie in die Hocke, um sich das näher anzusehen. Ein Halsband aus feinstem Draht, elastisch, enganliegend, sah aus wie ein zartes Tattoo rund um die Kehle. Irgendwas störte sie daran. Dieser Hauch von sexy. Teenies trugen so was. Oder vielleicht war sie doch einfach nur eifersüchtig.
»Ist dir das nicht zu … schwarz?«
»Aber du magst doch auch schwarz!«
Touché.
Es war schon dunkel, mit der Dunkelheit war es auch kälter geworden, sie schlenderten den Ku’damm entlang, im Schein der gelben Straßenlaternen und im weißen Licht der Schaufenster. Sie hatten schon drei Anproben hinter sich: H&M, TK Maxx und C&A. Emily bestand auf einer rosa Jacke und fand gleichzeitig alle rosa Jacken, die sie bis jetzt gefunden hatten, potthässlich. Die Frage, ob sie vielleicht einfach Rosa an sich nicht mochte, wies sie empört von sich. Langsam begriff Emma, dass das eine längere Angelegenheit werden konnte. Emily guckte sich nicht nur die Jacken an. Auch die Mäntel, Kleider, Schuhe und Haarspangen, die Spielzeuge, die Kunden, die Schoßhündchen, die Touristen, die Teenies, die vor Primark rumlungerten. Mann, heute wurde aber viel Russisch am Ku’damm gesprochen.
Jetzt blieb sie schon wieder stehen. Tauentzien, Ecke Marburger. Vor ihnen eine Menschentraube. Die Touristen, Teenies und Russen mussten einen Bogen machen. Emily stellte sich auf die Zehenspitzen. »Gibt’s da was geschenkt?«
Emma war es schon klar, was es da gab. Eben erst waren sie an einem Aufpasser vorbeigekommen – einem Kroaten oder Serben in Kunstlederjacke und Jogginghose, unterernährt, keine Einkaufstüte, kein Termin, stand nur lässig rum, der Blick über die Kreuzung schweifend, Handy in der Hand, ohne jemanden anzurufen, ohne seinen Posten zu verlassen. Sofort wusste sie: Er ist Teil einer Struktur. Weiter vorne, an der nächsten Ecke, würde noch einer stehen. Und gegenüber. Drei Aufpasser, das wäre typisch.
Erfolgreiche Kriminelle arbeiten in Strukturen. Bei jeder kriminellen Handlung ergibt sich irgendwann – wenn man es ernsthaft angeht zumindest – eine Struktur, die den optimalen Erfolg verspricht. Außen rum: drei Aufpasser, an bestimmten Ecken, mit klar abgegrenzten und perfekt eingeübten Aufgaben. Die halbe Miete, wenn man eine kriminelle Tat verstehen will, ob Betrug oder Serienmord: die Struktur erkennen. Wie ein Sudoku in echt. Das konnte Emma gut. Sie lebte dafür.
Aber als sie den zweiten Aufpasser entdeckte, schlug ihr Herz doch ein klein wenig schneller.
»Gucken wir uns das mal an«, sagte sie.
Sie ging hin. Sie drängelte sich vor, Emily fest an der Hand, neugierig, bis sie ihn sahen, um den sich alles drehte, da, mitten in der Menge, Rücken zur offenen Straße: schlaksig, Hakennase, eingesunkene Augen, brauner Parka, verwaschenes Sweatshirt darunter, vor ihm ein zerkratztes Tablett, darauf drei Streichholzschachteln, die ringsum mit Kreppband verstärkt waren. Und seine Hände: Er schob die Schachteln hin und her, ach, so schnell waren seine Hände gar nicht.
Der Hütchenspieler.
Um ihn herum Touristen. Bierbäuche, Wintermäntel und Daunenjacken, KaDeWe- und Idee-Tüten in der Hand, mollige Ehefrauen an der Seite, hibbelige Schüler auf Klassenfahrt. Blicke auf den Streichholzschachteln. Die Touristen konnten die Bewegungen mühelos verfolgen, sich leicht merken, unter welcher der dreien sich die Kugel befand.
Ganz vorn: ein großer Sachse, Einkaufstüten in der Hand, genervt davon, seiner Ehefrau beim Shoppen hinterherzutrotten, eine männlichere Aufgabe suchend.
Die anderen waren erst mal vorsichtig, der Sachse hatte den Mut, seinen Augen zu trauen, und setzte fünf Euro. Er zeigte auf die mittlere Schachtel, stolz, der abgemagerte Kroate hob die Schachtel hoch, und siehe da: Der Sachse hatte recht. Da lag die Kugel. Der Hütchenspieler rückte widerwillig den Fünfeuroeinsatz wieder raus und legte den Gewinn in gleicher Höhe obendrauf.
»Das wusste ich auch«, freute sich Emily, dass sie es mit einem Erwachsenen aufnehmen konnte, und hüpfte. »Emma, Emma, ich hatte recht, ich habe gewonnen! Ich will auch spielen! Ich kann das!«
Emma schulterte ihre Tasche und ging in die Hocke und flüsterte Emily ins Ohr: »Schau genau hin. Es ist ein Trick. Der dünne Mann dort ist ein böser Mann, er nimmt dem anderen Mann das Geld gleich wieder weg.«
»Aber er hat ihm doch das Geld gegeben.« Emily war verwirrt. Ihr Kopf dachte nur in eine Richtung – wenn ein Mann einem zweiten Mann Geld gibt, dann hat der zweite Mann das Geld. Basta.
»Ja, aber pass gut auf, wie es jetzt weitergeht. Der dünne Mann wird dem großen Mann sogar noch mal Geld geben. Und weißt du, warum?«
»Weil er ihn doch lieb hat?«, flüsterte Emily hoffnungsvoll.
Emma musste lachen. Das war gar nicht so verkehrt. »Nein, damit der große Mann glaubt, dass er immer gewinnen wird, und weiter spielt, um weiter zu gewinnen. Was ist mehr als zehn Euro?«
»Elf Euro?«
»Hundert Euro.«
Emilys Augen wurden groß. Sie blickte konzentriert auf den Hütchenspieler und dessen Opfer, das jetzt zwanzig Euro gewann, genau wie Tante Emma es vorhergesagt hatte. Der Sachse grinste jetzt, der Kroate spielte Enttäuschung.
Aber Emma wusste, hinter der gerunzelten Stirn war der Spieler stolz. Stolz auf sein Werk. Stolz darauf, dass er den Sachsen so leicht reinlegen konnte. Diese reichen Deutschen mit ihrem festen Einkommen und ihrem dreizehnten Monatsgehalt und ihrem bezahlten Urlaub – all das hatten sie, aber eins hatten sie nicht: genug Grips, um eines der ältesten Betrugsmanöver überhaupt zu durchschauen.
Das war der eigentliche Gewinn: die Genugtuung, das Gefühl, schlauer, besser und schneller zu sein als diese Fatzkes, die mehr Geld, mehr Ansehen und weniger Fantasie hatten.
»Siehst du den anderen Mann da? Mit dem Schnurrbart?«
Neben dem Touristen stand ein weiterer Kroate, ein dicker, Geldscheine in den Pfoten. Der Anreißer.
Außen drei Aufpasser. Innen der Hütchenspieler und der Anreißer. Die Struktur heute war mal wieder wie aus dem Bilderbuch.
»Das ist ein Freund von dem dünnen Mann«, flüsterte Emma. »Der Große hier weiß es nicht, aber die beiden arbeiten zusammen. Gleich wird er den Großen dazu anfeuern, mehr Geld auszugeben. Pass auf.«
Der Anreißer wedelte nun mit einem Fünfzigeuroschein. »Ich setze! Hier, fünfzig, fünfzig!« Der Sachse stand unter Druck. Wenn er nicht auch fünfzig setzte, gewann am Ende noch dieser andere. Also legte er einen Fünfziger auf das Tablett. Der Anreißer zog sich murrend zurück. Die Streichholzschachteln wurden gemischt. Die Hände waren immer noch langsam.
Emma bewunderte die Zurückhaltung des Spielers. Das erforderte echte Disziplin. Sie bewunderte auch seine Bescheidenheit: Er arbeitete nicht allein, sondern teilte seinen Gewinn mit den Aufpassern und dem Anreißer. Am Ende des Tages würde er nur einen Bruchteil von dem Fünfziger sehen, den er dem Sachsen gleich abnehmen würde. Trotzdem erlag er nicht der Versuchung, alleine zu arbeiten – das Risiko war zu hoch. Der Ku’damm wimmelte von Polizisten, die Aufpasser hatten alles im Blick, und der Anreißer hielt das Spiel am Laufen. Nein, nur nicht gierig werden, den Gewinn schön mit den anderen teilen, das Risiko gering halten, jede Investition in Risikominderung war eine gute Investition, das war der Weg zum Erfolg.
»Wo ist die Kugel?«, fragte Emma. Emily zeigte auf die linke Schachtel.
Recht hatte sie, aber Emma flüsterte: »Das ist die richtige Schachtel, aber die Kugel ist nicht drunter.«
»Dann ist sie rechts«, sagte Emily.
»Auch nicht«, flüsterte Emma.
»Dann in der Mitte.«
»Nein.«
»Häh?«
Der Sachse hatte die Kugel auch gesehen. Er zeigte auf die linke Schachtel. Der Hütchenspieler hob sie an. Darunter: keine Kugel.
Emily keuchte vor Überraschung. Sie konnte ihren Augen kaum glauben. Die anderen ebenso wenig – der Sachse, seine Frau, die anderen Passanten.
»Wo ist die Kugel?«, sagte Emily.
Der Sachse war frustriert. Der Anreißer legte einen Hunderter hin. Der Hütchenspieler mischte die Streichholzschachteln neu, schaute zum Sachsen, der aber hielt sich diesmal zurück. Der Anreißer zeigte auf die rechte Schachtel, die gleiche, auf die Emily, der Sachse und fünf andere zeigten: Darunter war die Kugel. Der Anreißer zog seinen Hunni Gewinn ein.
Jetzt lachte der Hütchenspieler den Sachsen breit an. »Du gucken – zuerst gucken, dann wetten.« Ja, der Mann kümmerte sich rührend um seine Kunden.
Die Schachteln flogen, dann blieben die Hände still. Der Sachse zeigte auf die mittlere Schachtel. Der Hütchenspieler sagte: »Zweihundert.«
Der Sachse zögerte. Der Anreißer hatte schon zweihundert in der Hand, bereit einzuspringen. Er zeigte ebenso auf die mittlere Schachtel. Was sollte schiefgehen? Der Sachse wand sich. Dann legte er noch einen Hunderter obendrauf.
»Ist die Kugel unter der mittleren Schachtel?«, flüsterte Emma.
»Ich hab’s gesehen, er wird gewinnen«, sagte Emily und nickte heftig.
Dann wurde die mittlere Schachtel endlich angehoben. Darunter: nichts.
»He!«, protestierte der Sachse, »die Kugel war darunter, das habe ich genau gesehen. He! Heb die anderen Schachteln hoch, du!«
Und das war’s. Das Brett war weg, die Streichholzschachteln waren weg, der Hütchenspieler war weg, der Anreißer war weg, rechts und links die Aufpasser waren weg. So schnell ging das. Der Sachse glaubte, den Dünnen noch sehen zu können, da hinten in der Menge irgendwo. »He, du, ich rufe die Polizei, he, komm zurück! Halt!«
Aber er irrte sich. Er sah ihn nicht.
Bewunderung. Diese flinken Hände, die nicht flink aussahen. Dieser abgewetzte Aufzug, der so dumm und billig daherkam und jeden neppte. Profis waren das. Die Anreißer, die Aufpasser, das war organisiert wie ein SEK-Einsatz, jede Eventualität war bedacht, jeder wusste genau, was wann zu tun war.
»Aber ich hab die Kugel doch ganz genau gesehen.« Emily runzelte die Stirn.
»Es war auch die richtige Schachtel«, sagte Emma. »Aber die Kugel war nicht mehr drunter. Die war in seiner Hand. Das nennt man Trickbetrug. Es ist verboten.«
»Warum hast du ihn dann nicht verhaftet?«
»Ich wollte, dass du siehst, was passiert, wenn du glaubst, du kannst gegen ihn gewinnen.«
Sie standen jetzt fast allein an der Ecke. Nur der Sachse und ein paar andere versuchten noch, die Polizei mit ihren Handys zu erreichen.
»Das verstehe ich nicht.«
»Hör mal zu.« Emma überlegte. »Wenn du denkst, du bist gerade ganz besonders schlau … dann bist du gerade am dümmsten, und du weißt es nicht. Genau dann legt der andere dich rein.«
Emily runzelte die Stirn, noch heftiger als vorher.
»Na, es ist wie mit dir und deiner Mutter. Als du letzte Woche die Zuckerdose aus Griechenland zerbrochen und die Scherben unters Sofa geschoben hast, da hast du geglaubt, dass deine Mutter nicht schlau genug ist, sie zu finden. Aber die ist schlauer als du. Sie findet immer alles. Du musst das bedenken – egal wie klug du bist, irgendwer ist immer schlauer als du.«