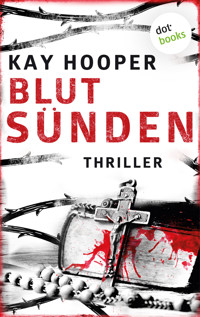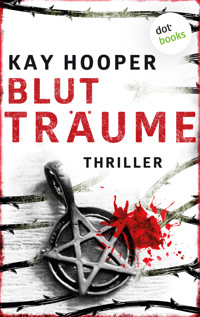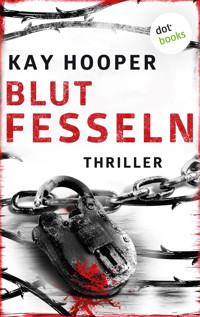
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Noah Bishop & HAVEN
- Sprache: Deutsch
Denn jede Jagd muss tödlich enden: Der abgründige Mystery-Thriller »Blutfesseln« der New-York-Times-Bestsellerautorin Kay Hooper als eBook bei dotbooks. Wenn dein Mörder dir näher ist, als du denkst … Ein Killer zieht seine blutige Spur durch drei amerikanische Bundesstaaten – ist er zu größenwahnsinnig, um sie zu verwischen, oder will er so seinen größten Feind in eine Falle locken? Agent Noah Bishop vom FBI muss alles auf eine Karte setzen, auch wenn dies bedeutet, eine junge Frau in tödliche Gefahr zu bringen: Hollis Templeton besitzt übersinnliche Kräfte, die sich mit ungeheurer Geschwindigkeit entwickeln. Aber werden diese ihr helfen, selbst die bösartigsten Angriffe ihres übermächtigen Gegners zu überleben – oder läuft Hollis Gefahr, von innen heraus zu verbrennen? »Ein packendes Abenteuer und Höhepunkt der Serie!« Fresh Fiction Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Blutfesseln« von New-York-Times-Bestsellerautorin Kay Hooper ist der abschließende Band ihrer actiongeladenen Blood-Trilogie. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn dein Mörder dir näher ist, als du denkst … Ein Killer zieht seine blutige Spur durch drei amerikanische Bundesstaaten – ist er zu größenwahnsinnig, um sie zu verwischen, oder will er so seinen größten Feind in eine Falle locken? Agent Noah Bishop vom FBI muss alles auf eine Karte setzen, auch wenn dies bedeutet, eine junge Frau in tödliche Gefahr zu bringen: Hollis Templeton besitzt übersinnliche Kräfte, die sich mit ungeheurer Geschwindigkeit entwickeln. Aber werden diese ihr helfen, selbst die bösartigsten Angriffe ihres übermächtigen Gegners zu überleben – oder läuft Hollis Gefahr, von innen heraus zu verbrennen?
»Ein packendes Abenteuer und Höhepunkt der Serie!« Fresh Fiction
Über die Autorin:
Kay Hooper, geboren 1958 in Kalifornien, wuchs in North Carolina auf und studierte später Literaturgeschichte. Noch während sie an der Universität war, begann sie zu schreiben. Nach ersten Erfolgen als Autorin von Liebesromanen entdeckte sie das Spannungsgenre für sich und eroberte unter anderem mit ihren paranormalen Thrillern über die geheime FBI-Einheit des Agenten Noah Bishop immer wieder die Bestsellerliste der New York Times. Neben dem Schreiben engagiert sich Kay Hooper für den Tierschutz.
Mehr Informationen über die Autorin finden sich auf ihrer Website: www.kayhooper.com
Bei dotbooks veröffentlichte Kay Hooper die Blood-Trilogie mit den Einzelbänden »Blutträume«, »Blutsünden« und »Blutfesseln«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Blood Ties« bei Bantam Books, New York.
Copyright der Originalausgabe © 2010 by Kay Hooper
Published by arrangement with Bantam Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc.
Copyright der deutschsprachigen Erstausgabe © 2014 by Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 1, 86159 Augsburg
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Seregram, Lum_yai I sweet, Odin M. Eidskrem
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-98690-178-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Blutfesseln« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kay Hooper
Blutfesseln
Die Blood-Trilogie: Noah Bishop & HAVEN 3Thriller
Aus dem Amerikanischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Prolog
Vor sechs Monaten: Oktober
Hör zu.
»Nein.«
Hör zu.
»Ich will nichts hören.« Starrköpfig hielt sie den Blick auf ihre bloßen Füße gerichtet. Die Zehennägel waren pink lackiert. Hier allerdings nicht. Hier waren sie grau, so wie alles andere auch.
Bis auf das Blut. Das Blut war immer rot.
Das hatte sie vergessen.
Du musst uns zuhören.
»Nein, muss ich nicht. Nicht mehr.«
Wir können dir helfen.
»Niemand kann mir helfen. Nicht bei dem, was ihr von mir verlangt. Das ist unmöglich.« Aus dem Augenwinkel sah sie das Blut in ihre Richtung sickern und wich dem Rinnsal unwillkürlich aus. Dann noch weiter. »Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich kann nie wieder zurück.«
Doch, das kannst du. Du musst.
»Ich hatte meinen Frieden gefunden. Warum habt ihr mich nicht dort gelassen?« Sie spürte etwas Festes, Hartes in ihrem Rücken und drückte sich dagegen, den Blick noch immer auf ihre Zehen gerichtet, auf das Blut, das langsam immer näher kam.
Weil es nicht vorbei ist.
»Es ist schon lange vorbei.« Nicht für dich. Nicht für sie.
Kapitel 1
Heute, 8. April, Tennessee
Obwohl die Muskeln in seinen Beinen brannten, lief Case Edgerton, voll auf seine Atmung konzentriert, den schmalen Pfad entlang.
Die letzte Meile war immer die härteste, vor allem bei seinem wöchentlichen Geländelauf. Auf der Bahn oder im nahe gelegenen Park war es einfacher. So wie hier, auf unebenem und unübersichtlichem Terrain zu trainieren, erforderte echte Konzentration.
Deshalb gefiel es ihm so.
Er sprang über einen morschen Baumstamm und musste sich gleich danach unter einem tief hängenden Ast wegducken. Anschließend ging es nur noch abwärts, was nicht so einfach war, wie es klang, da der Pfad sich in halsbrecherischen Serpentinen über diese letzte Meile hinabschlängelte. Gutes Training für das bevorstehende Rennen. Er wollte es unbedingt gewinnen, wie schon so viele im Laufe seines Abschlussjahres.
Und dann gab es da Kayla Vassey, die ein Faible für Läufer hatte, sehr flexibel war und ihn gerne belohnen würde. Vielleicht den ganzen Sommer lang. Hinterher würde sie sich nicht an ihn klammern. Sie würde viel zu sehr damit beschäftigt sein, die Läufer des nächsten Jahres zu taxieren, um für mehr als ein Abschiedswinken Zeit zu finden, wenn er im Herbst aufs College ging.
Unverbindlicher Sex. Genau wie er es mochte.
Beinahe wäre Case über eine vom Frühlingsregen frei gespülte Wurzel gestolpert und fluchte über seine Unachtsamkeit.
Konzentrier dich, du Idiot. Willst du das Rennen verlieren?
Das wollte er wirklich nicht.
Seine Beine brannten inzwischen wie Feuer, und seine Lunge fühlte sich an, als läge sie offen, doch er schonte sich nicht, legte sogar etwas an Tempo zu, als er um die letzte tückische Haarnadelkurve bog.
Wieder stolperte er, und diesmal ging er zu Boden.
Er versuchte über die Schulter abzurollen, um möglichst wenig abzubekommen, doch die Strecke war so uneben, dass er stattdessen mit einem Stöhnen auf den harten Boden krachte. Ihm blieb die Luft weg, und ein stechender Schmerz ließ ihn befürchten, er hätte sich etwas verstaucht oder gerissen.
Eine Weile hielt er sich vorsichtig und keuchend die Schulter, bevor er in der Lage war, sich aufzusetzen. Und erst da sah er, was ihn zu Fall gebracht hatte.
Ein Arm.
Ungläubig starrte er auf die Hand, die einem Mann zu gehören schien: eine überraschend saubere und intakte Hand, deren lange Finger ganz entspannt wirkten. Sein Blick wanderte einen gleichfalls unversehrten Unterarm hinauf und dann …
Und dann begann Case Edgerton zu kreischen wie ein kleines Mädchen.
»Sie sehen ja selbst, wieso ich Sie angefordert habe.« Sheriff Desmond Duncan klang nervös. »Wir befinden uns hier zwar am Rande von Serenade, doch es fällt noch in meinen Zuständigkeitsbereich. Und ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass das Sheriffdepartment von Pageant County noch nie mit so etwas zu tun hatte.« Er machte eine Pause, dann bekräftigte er: »Niemals.«
»Das überrascht mich nicht«, erwiderte sie etwas geistesabwesend.
Ausbildung und Erfahrung rieten Des Duncan, den Mund zu halten, damit sie sich auf den Tatort konzentrieren konnte, aber seine Neugier war stärker. Da er noch nie mit dem FBI zu tun gehabt hatte, wusste er nicht, was auf ihn zukommen würde, und wäre möglicherweise über jede Art von Agent überrascht gewesen. Über diese Frau war er es auf jeden Fall.
Erstens war sie zum Niederknien schön, hatte den Körper eines Pin-up-Girls und die Augen eines exotischen Engels. Und zweitens besaß sie die strahlendsten blauen Augen, die er je gesehen hatte. Trotzdem wirkte sie erstaunlich gelassen und war sich der Wirkung nicht bewusst, die sie auf jeden Mann in ihrer Umgebung hatte. Sie trug ausgeblichene Jeans, einen weiten Pullover und praktische, abgetragene Stiefel. Das lange schwarze Haar war im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden. Kein Make-up, soweit er erkennen konnte.
Bis auf ein Schlammbad hatte sie anscheinend alles unternommen, um ihr gutes Aussehen zu verschleiern, trotzdem musste Des sich bemühen, ein Stottern zu unterdrücken, wenn er mit ihr sprach. Er konnte sich nicht mal erinnern, ob sie ihm ihre Dienstmarke gezeigt hatte.
Dabei war er an die sechzig, Himmel noch mal.
Aus Angst, die falsche Frage zu stellen oder eine Frage falsch zu formulieren, sagte er zögernd: »Ich bin froh darüber, das hier in erfahrenere Hände zu legen, glauben Sie mir. Zuerst habe ich natürlich das State Bureau of Investigation angerufen, aber … Tja, nachdem die sich meine Geschichte angehört hatten, rieten sie mir, Ihr Büro anzurufen. Explizit Ihres, nicht einfach das FBI. Ehrlich gesagt, ich war etwas überrascht, dass sie meinten, ich solle Ihre Leute anrufen. Doch es klang wie eine gute Idee, also hab ich’s getan. Hatte nicht erwartet, dass gleich so viele Bundesagenten kommen würden, und ganz bestimmt nicht so schnell. Ist nicht ganz fünf Stunden her, dass ich um Unterstützung gebeten habe.«
»Wir waren in der Gegend«, erwiderte sie. »Ziemlich nahe. Gleich hinter den Bergen, in North Carolina.«
»Ein anderer Fall?«
»Ein noch nicht abgeschlossener. Läuft uns aber nicht davon. Daher passte es gut, uns den hier anzusehen.«
Duncan nickte, obwohl sie ihn nicht ansah. Sie kniete ein Stück von der Leiche entfernt ‒ oder dem, was von ihr übrig war ‒, den Blick unverwandt darauf gerichtet.
Er überlegte, was sie da wohl sah. Denn es hieß, die Agenten der Special Crimes Unit des FBI sähen einiges mehr als die meisten Polizisten, auch wenn sich das Was und Wie schwer in Worte fassen ließ.
Was Duncan sah, war eindeutig genug, wenn auch unglaublich grotesk, sodass er sich zwingen musste, wieder hinzusehen. Die Leiche lag neben dem öffentlichen Wander-und Crosslaufpfad, den die Leichtathletikmannschaft der Highschool und ein paar waghalsigere unter den Bürgern der Stadt benutzten. Eine verteufelt schwierige Strecke, wenn man schnell ging, von rennen ganz zu schweigen, was sie zu einem hervorragenden Übungsgelände machte, vorausgesetzt, man wusste, was man tat. Und zu einem möglicherweise tödlichen, wenn man das nicht wusste.
Das ganze Jahr über kam es hier zu zahlreichen Verstauchungen, Zerrungen und Knochenbrüchen, vor allem nach Regengüssen. Duncan brauchte allerdings kein Gerichtsmediziner oder Arzt zu sein, um zu erkennen, dass das hier nicht von einem Sturz beim Gehen oder Laufen verursacht worden war. Keinesfalls.
Das dichte Unterholz in diesem Teil des Waldes hatte es dem Mörder leicht gemacht, den größten Teil der Leiche zu verbergen. Mühsam hatten Duncans Deputys Stunden zuvor Büsche und Ranken entfernen müssen, um die Überreste freizulegen.
Das Gute daran war, dass es sich hier offensichtlich um einen Abladeplatz und nicht um den Tatort des Mordes handelte. Duncan mochte zwar nicht viel Erfahrung im Umgang mit grausigen Morden haben, doch ihm war ziemlich klar, dass die FBI-Agenten wenig begeistert gewesen wären, wenn man ihre Beweise angerührt hätte.
Beweise. Er fragte sich, ob es überhaupt nennenswerte Spuren gab. Seine eigenen Leute hatten kaum etwas gefunden. Fingerabdrücke wurden zwar schon durch das Identifizierungsprogramm geschickt, und falls sich auf diese Weise kein Name herausfinden ließ, wäre der nächste Schritt, wie Duncan annahm, ein Gebissabdruck.
Denn viel mehr gab es nicht, womit man den armen Kerl hätte identifizieren können.
Der linke Arm lag über den Weg gestreckt und war seltsam unversehrt, hatte nicht mal einen Kratzer. Insofern seltsam, als vom Ellbogen aufwärts die Verletzungen … extrem waren. Gewebe und Muskeln waren fast vollständig von den Knochen gelöst, nur hie und da hingen noch blutige Sehnenfetzen daran. Die meisten, wenn nicht alle inneren Organe waren verschwunden, die Augen ebenfalls, und die Kopfhaut war vom Schädel abgerissen worden.
Abgerissen. Himmel wie war das möglich? Wie konnte so etwas passieren?
»Schon eine Idee, wie das passiert sein könnte?«, fragte Duncan.
»Keine vernünftige jedenfalls«, erwiderte sie sachlich.
»Also bin ich nicht der Einzige, der an Unmögliches denkt, an Albtraumhaftes?« Er hörte die Erleichterung in seiner Stimme.
Sie wandte den Kopf und sah ihn an, stemmte sich hoch und trat von der Leiche weg. »Wir haben schon vor Langem gelernt, Worte wie unmöglich nicht leichtfertig zu verwenden.«
»Und Albtraum?«
»Auch das. ›Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio ...‹« Special Agent Miranda Bishop zuckte die Schultern. »Die SCU wurde gegründet, um sich mit diesem Mehr zu befassen. Wir haben schon eine Menge davon gesehen.«
»Das ist mir zu Ohren gekommen, Agent Bishop.«
Sie lächelte, und er spürte erneut eine vollkommen unprofessionelle und zutiefst männliche Reaktion auf wahrhaft atemberaubende Schönheit.
»Miranda, bitte. Um Missverständnisse zu vermeiden.«
»Ach? Wie das?«
»Weil«, ließ sich eine neue Stimme vernehmen, »Sie uns immer wieder mal von Bishop reden hören werden, womit wir jedoch Noah Bishop meinen, den Chef der Special Crimes Unit.«
»Meinen Ehemann«, erläuterte Miranda Bishop. »Alle nennen ihn Bishop. Daher nennen Sie mich bitte Miranda.« Sie wartete sein Nicken ab und richtete den Blick ihrer strahlend blauen Augen auf den anderen Agenten. »Irgendwas, Quentin?«
»Nichts Auffälliges.« Special Agent Quentin Hayes schüttelte den Kopf und zupfte stirnrunzelnd einen kleinen Zweig aus seinem etwas struppigen blonden Haar. »Allerdings habe ich selten ein Gebiet mit so dichtem Unterholz durchsucht, also könnte mir durchaus etwas entgangen sein.«
»Unser zuständiger Gerichtsmediziner«, warf Duncan ein, »hatte es bisher nur mit Unfalltoten zu tun, aber er sagte, er sei überzeugt, dass der Mann nicht hier vor Ort ermordet wurde.«
Miranda Bishop nickte. »Ihr Gerichtsmediziner hat recht. Wenn das Opfer hier ermordet worden wäre, müsste der Untergrund mit Blut getränkt sein. Dieser Mann war vor vierundzwanzig Stunden höchstwahrscheinlich noch am Leben und wurde irgendwann in den frühen Morgenstunden hier abgeladen.«
Duncan fragte nicht, wie sie zu diesem Schluss gekommen war; sein Gerichtsmediziner hatte das Gleiche geschätzt.
»Keine Anzeichen eines Kampfes«, fügte Quentin hinzu.
»Und falls das Opfer nicht unter Betäubungsmitteln stand, bewusstlos oder tot war, gehe ich davon aus, dass es sich gewehrt hätte.«
Duncan verzog das Gesicht. »Allerdings hoffe ich, dass er bereits tot war, als ihm … das … angetan wurde.«
»Das hoffen wir auch«, versicherte ihm Quentin. »Wenn wir wenigstens wüssten, wer das Opfer war, hätten wir einen Ansatzpunkt. Irgendwas zu den Fingerabdrücken, die Ihre Leute abgenommen haben?«
»Vor einer Stunde habe ich mich zuletzt erkundigt, da gab es noch nichts. Ich gehe zum Jeep und frage noch mal nach. Wie schon gesagt, der Handyempfang ist hier oben miserabel, und unsere tragbaren Funkgeräte sind ähnlich nutzlos. Unsere Polizeifahrzeuge haben spezielle Verstärkerantennen, um überhaupt ein Signal zu bekommen, und sogar das funktioniert oft nur unregelmäßig.«
»Danke, Sheriff.« Quentin sah dem älteren Mann nach, der vorsichtig den steilen Pfad zur Straße und zu den Autos hinunterging. Dann wandte er sich mit erhobenen Brauen Miranda zu.
»Ich weiß nicht«, sagte sie.
Quentin senkte die Stimme, obwohl die nächsten Deputys ‒ Duncans Chief Deputy Neil Scanion und seine Partnerin Nadine Twain ‒ einige Meter weit entfernt über eine Landkarte gebeugt standen. »Die Vorgehensweise ist ähnlich. Unmenschlich brutale Folter.«
Sie schob die Hände in die Vordertaschen ihrer Jeans und runzelte die Stirn. »Schon, doch das hier … übertrifft alles, was wir bisher gesehen haben.«
»Zumindest bei diesem Mörder«, murmelte Quentin.
Miranda nickte. »Vielleicht handelt es sich nur um eine Eskalation, um das übliche Er-wird-von-Mal-zu-Mal-Schlimmer, nur … bei dem hier kann ich den Grund nicht erkennen. Ob der Mann schon von Anfang an tot war, ist noch zweifelhaft, jedenfalls war er es garantiert längst, bevor sein Mörder mit ihm fertig war, und das war bei keinem der Opfer der Fall, die wir mit dieser Sache in Zusammenhang sehen. Wenn es um Folter ging, warum dann weitermachen, nachdem das Opfer tot ist?«
»Weil es ihm Spaß machte?«
»Himmel, ich hoffe nicht.«
»Geht mir genauso. Bin ich der Einzige, der bei diesem Mord ein verdammt schlechtes Gefühl hat?«
»Ich wünschte, es wäre so. Doch ich glaube, uns alle überkam hier und an den anderen Abladeplätzen ein Gefühl von etwas Unnatürlichem. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, was der Mörder benutzt hat, um die Leiche buchstäblich bis auf die Knochen freizulegen.«
Quentin blickte auf die Überreste. »An den Knochen konnte ich keine Spuren von Werkzeugen entdecken. Oder von Klauen oder Zähnen. Du?«
»Nein. Auch keine sichtbaren Anzeichen dafür, dass Chemikalien benutzt wurden, doch das wird uns erst die Forensik genau sagen können.«
»Wir schicken die Leiche ‒ oder was davon übrig ist ‒ zum bundesstaatlichen Gerichtsmediziner?«
»Ja. Duncan hat dem bereits zugestimmt. Er war sehr ehrlich, was den Technologiestandard hier in der Gegend betrifft.«
»Darüber, dass es hier keinerlei Technologie gibt? Wir waren ja schon an einigen entlegenen Orten, doch das hier würde ich geradezu weltabgeschieden nennen. Wie viele Einwohner mag Serenade haben? Ein paar Hundert, wenn es hoch kommt?«
»Fast dreitausend, wenn du alle mitzählst, die zwar jenseits der Stadtgrenze wohnen, Serenade aber trotzdem als Postanschrift verwenden.« Sie bemerkte, wie Quentin die Brauen hochzog, und fügte hinzu: »Hab ich auf dem Herflug überprüft.«
»Aha. Und ist dir auch aufgefallen, dass das einzige Motel der Stadt aussieht, als würde Norman Bates am Empfang sitzen?«
»Ist es. Allerdings kam es mir eher wie ein nichtssagendes Kleinstadtmotel vor.« Miranda zuckte mit den Schultern. »Und wir wissen beide, dass es darauf womöglich nicht ankommt. Falls dieses Opfer ins Muster passt, spielt der Fundort nur eine unwesentliche Rolle in dem Puzzle. Was zur Folge hätte, dass wir uns hier nicht lange aufhalten werden.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher.«
Sie sah ihn an, und ihre Augenbrauen wanderten nach oben.
»Nur so ein Gefühl«, erklärte er. »Wir sind hier nur etwa dreißig Meilen von der Lodge entfernt, Luftlinie, und dort sind über längere Zeit ziemlich unnatürliche Dinge geschehen.«
»Das hast du ja zusammen mit Diana erledigt«, bemerkte Miranda, indem, sie auf einen zurückliegenden Fall anspielte.
»Na ja, sagen wir mal, wir ‒ sie hauptsächlich ‒ haben einen Teil davon erledigt. Den schlimmsten Teil, hoffentlich. Das heißt aber nicht, dass wir alles geschafft haben.«
»Das war vor einem Jahr«, erinnerte sie ihn.
»Stimmt, auf den Monat genau. Teufel, beinahe auf den Tag. Was ich reichlich beunruhigend finde.«
Miranda Bishop hatte nicht die Angewohnheit, eine Ahnung oder ein ungutes Gefühl von jemandem in ihrer Umgebung außer Acht zu lassen, vor allem, wenn es sich um ein Mitglied ihres Teams handelte. »Okay. Aber bisher deutet nichts auf die Lodge hin. Keine Verbindung zu dem Ort oder jemandem von dort, nichts, was uns aufgefallen wäre.«
»Ich weiß. Mir wäre lieber, ich könnte behaupten, dass mich das beruhigt, tut es aber nicht.«
»Willst du zur Lodge fahren und dich dort umsehen?«
»Wenn einer fährt, sollte es jemand mit einem frischen Blick und ohne Vorbelastung sein«, antwortete Quentin so prompt, dass ihr klar wurde, diese Frage hatte ihn schon eine Weile beschäftigt. »Und am besten ein Medium, in Anbetracht des Alters und … der Natur dieses Ortes.«
»Du weißt genau, dass uns nur zwei zur Verfügung stehen. Diana sollte nicht fahren, wegen der Vorbelastung, und Hollis würde ich lieber hier in der Nähe behalten.«
Quentin sah sie fragend an. »Warum?«
Mirandas Stirnrunzeln war zurückgekehrt, doch diesmal ging ihr Blick in die Ferne oder ins Leere. Erst nach einer Weile antwortete sie: »Weil ihre Fähigkeiten … sich weiterentwickeln. Weil jeder Fall neue Fähigkeiten hervorzubringen scheint und die Stärke der bereits vorhandenen steigert. Und das schneller, als das bei paragnostischen Fähigkeiten bisher bekannt war. Was beispiellos ist.«
»Während der letzten Monate war sie einer Reihe ungewöhnlich intensiver Erlebnisse ausgesetzt«, meinte Quentin nachdenklich. »Eigentlich von Anfang an. Verdammt, der Auslöser, der sie aktiv werden ließ, war außergewöhnlicher und heftiger als alles, wovon ich je gehört habe.«
»Ja, sie ist eindeutig eine Überlebende«, erwiderte Miranda, die wieder an ein zurückliegendes Abenteuer denken musste.
»Aber?«
»Von einem Aber weiß ich nichts. Außer, dass das menschliche Gehirn wahrscheinlich mehr verkraften kann als die menschliche Psyche.«
Quentin ließ sich das durch den Kopf gehen. »Du glaubst, sie kommt mit all dem nicht ganz so leicht zurecht, wie es den Anschein hat. Auf gefühlsmäßiger Ebene.«
»Genau das meine ich. Daher möchte ich sie im Moment lieber in der Nähe haben. Bisher hat sich jeder dieser Abladeplätze als genau das erwiesen, ohne Anzeichen dafür, dass der Mörder noch in der Gegend ist. Jedes Mal haben wir Beweisstücke eingesammelt, ein paar Fragen gestellt, sind einigen Spuren nachgegangen, die sich als Sackgassen erwiesen, und sind dann weitergezogen.«
»Also … weniger Intensität, die in Hollis etwas Neues auslösen konnte?«
»So lautet die Theorie«, bestätigte Miranda. »Das lässt sich aber nicht unbegrenzt fortsetzen, aus offensichtlichen Gründen, und wir wissen beide, dass sich jede Situation in Sekundenschnelle verändern kann. Was im Laufe unserer Ermittlungen normalerweise auch geschieht. Doch abgesehen von der Möglichkeit, ihr Urlaub zu verordnen, was ihr bestimmt nicht passen würde und eher schaden könnte, ist es im Augenblick die beste Lösung, die uns einfiel.«
»Dir und Bishop?«
Miranda nickte. »Dadurch wird unser Problem nicht beseitigt ‒ wenn wir davon ausgehen, dass Hollis’ rasante paragnostische Entwicklung das Problem ist und nicht ihre eigene natürliche Entwicklung ‒, aber wir hoffen, dass es ihr wenigstens etwas Luft verschafft, um damit klarzukommen, wie sehr sich ihr Leben verändert hat. Dass es ihr mehr Zeit gibt, sich an das zu gewöhnen, was mit ihr passiert, ihr ermöglicht, an ihren ermittlungstechnischen wie paragnostischen Fertigkeiten zu arbeiten. Ihr eben einfach Zeit gibt, sich in ihrem Leben zurechtzufinden, ohne das Gefühl, eine Zielscheibe auf der Stirn zu tragen.«
»Wie es während der komplizierten Ermittlung in Sachen Samuel und seiner Kirche der Fall war.«
»Genau.«
»Okay.« Plötzlich und offensichtlich beunruhigt, blickte Quentin sich um. »Tolle Theorie, und ich hoffe, sie funktioniert. Um ihret- und unseretwillen. Doch mich beschleicht das Gefühl, diese seltsame und bisher ereignislose Ermittlung entwickelt anders. Sie wird noch ziemlich heftig werden. Denn sollten sie nicht inzwischen zurück sein?«
»Niemand hat uns gesagt, dass es hier Bären gibt«, flüsterte Special Agent Hollis Templeton leicht genervt.
Special Investigator Diana Brisco hielt den Blick auf ein ziemlich großes Exemplar von Schwarzbär gerichtet, der knappe zwanzig Meter von ihnen entfernt im Unterholz nach Futter suchte, und flüsterte zurück: »Jetzt ist ihre Jahreszeit, glaube ich. Frühling. Sie kommen aus dem Winterschlaf und beginnen mit der Futtersuche.«
»Wie reizend.«
»Normalerweise laufen sie vor Menschen davon.«
»Glaubst du das oder weißt du es?«
»Ich habe letztes Jahr sehr viel gelesen. Nachholbedarf. Ich erinnere mich, auch gelesen zu haben, dass sie auf Bäume klettern können und es bei einem Angriff keinen Sinn hat, sich tot zu stellen, wie das bei Grizzlys funktioniert.«
»Wenn mich ein Grizzly angreifen würde, müsste ich mich nicht mal tot stellen. Verdammt, und wenn dieser Bär hier angreift, auch nicht.« Hollis unterdrückte ein Stöhnen. »Also, was machen wir? Abwarten?«
»Könnte eine Weile dauern. Sieht so aus, als hätte er was zum Fressen gefunden.«
Hollis verfolgte die Bewegungen des Bären, kniff die Augen zusammen, um besser durch das dichte Gebüsch sehen zu können, und flüsterte: »Mist.«
Diana hatte es auch gesehen. Genau wie Hollis, hielt sie die Waffe im Anschlag, und obwohl sich ihre Erfahrung mit der Glock nur auf Schulung und Übungsschießen beschränkte, stellte sie mit leiser Überraschung fest, wie gut die Waffe ihr in der Hand lag. Zumindest war sie ihr vertraut. »Ich schlage vor, wir zielen beide auf den Baum da zu seiner Linken. Das sollte ihn zum Weglaufen bewegen …«
»Besser wär’s. Denn ich möchte ungern einen Bären erschießen, Diana.«
»Ich auch nicht. Fällt dir was Gescheiteres ein?«
»Nein. Verdammt.« Hollis hob ihre Waffe und zielte sorgfähig durch das Gewirr sprießender Blätter, die ihre einzige Deckung bildeten. »Auf drei. Eins … zwei … drei.«
Die beiden Schüsse erfolgten gleichzeitig, knallten hart und laut in der relativen Stille des Waldes, schlugen mit einem dumpfen Geräusch im Baum neben dem Bären ein und ließen Rindensplitter davonstieben.
Der Bär hatte entweder schon Erfahrung mit Waffen gemacht oder war vorsichtig genug, kein Risiko einzugehen. Zum Glück rannte er von ihnen weg und trampelte mit schwergewichtiger Anmut den Hang hinunter.
Die beiden Frauen richteten sich langsam auf, die Waffen noch im Anschlag, und lauschten angespannt, bis sie den durchs Unterholz pflügenden Bären nicht mehr sehen und hören konnten.
Beruhigt schob Diana die Waffe zurück ins Halfter an ihrer Hüfte. Da sie nicht mehr flüstern mussten, witzelte sie in normaler Lautstärke: »Das erste Mal, dass ich meine Waffe in einem Einsatzgebiet abfeuern muss, und dann wegen eines verdammten Bären. Quentin wird mich endlos damit aufziehen.«
»Kann schon sein.« Hollis steckte ebenfalls die Waffe weg. »Glaubst du, sie haben die Schüsse gehört? Oder die Echos?« Davon hatte es einige gegeben.
»In dieser Gegend? Keine Ahnung, noch dazu, wo unsere Suchmannschaften in unterschiedliche Richtung gegangen sind. Doch auch wenn es uns meilenweit vorkommt, können wir nicht mehr als ein paar Hundert Meter vom Ausgangspunkt entfernt sein. Wahrscheinlich sind die anderen inzwischen schon zurück.«
Obwohl sie es zuvor schon vergeblich versucht hatte, überprüfte Hollis erneut, ob ihr Handy Empfang hatte. Nichts. Sie seufzte und steckte das Handy in die Hülle, die sie an der anderen Gürtelseite trug. »Tja, da wir nicht feststellen können, ob die anderen die Schüsse gehört haben, wird eine von uns zurückgehen müssen.«
»Während die andere hierbleibt und dafür sorgt, dass der Bär nicht wiederkommt und … Beweise vernichtet?«
»Das wäre die den Umständen nach korrekte Vorgehensweise.«
»Na toll.«
Hollis merkte, dass sie beide keinen Schritt auf das zu gemacht hatten, was der Bär ihrer Ansicht nach entdeckt hatte. Sie besann sich darauf, dass sie die erfahrenere Agentin war als Diana, und daher de facto die leitende Ermittlerin. Vorsichtig ging sie um das schützende Gebüsch herum und auf die ein paar Meter entfernte Stelle zu.
Diana begleitete sie schweigend, beide auf der Hut, die Hand an der Waffe, bis sie ein Gestrüpp brauner Ranken beiseitezerren mussten, um ihren Verdacht bestätigt zu sehen.
Der Bär hatte menschliche Überreste gefunden.
Die Frauen wichen zurück und sahen sich an. Hollis fragte sich, ob ihr Gesicht auch so bleich war wie Dianas, hielt es jedoch für äußerst wahrscheinlich. Egal, wie oft sie sich schon menschliche Überreste nach einem gewaltsamen Tod hatte ansehen müssen, es wurde nicht leichter.
Ist wahrscheinlich auch gut so.
Sie wusste nicht, was schlimmer war ‒ frische Überreste zu finden oder solche, die schon lange genug den Unbilden der Witterung ausgesetzt waren und wie diese hier etliche Stadien der Verwesung durchlaufen hatten.
Bei dem Gestank drehte sich ihr der Magen um.
»Da hattest du ja das richtige Gespür«, meinte Diana. »Den Weg zu verlassen und diese Richtung einzuschlagen. Bis hierher. Denn sonst …«
»… kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand über die Leiche gestolpert wäre«, vervollständigte Hollis den Satz. »Weißt du, was das für Ranken sind?«
»Kudzu. Beginnt schon weiter unten am Hügel. Das Zeug überwuchert und erstickt alles, was ihm im Weg ist.«
Hollis nickte. »Trocknet im Winter aus, kommt dann aber im Frühling und Sommer umso stärker wieder. Die Ranken können im Jahr bis zu zwanzig Meter wachsen.« Sie schwieg und zwang sich, auf das hinunterzublicken, was von der anscheinend weiblichen Leiche übrig war. »Das hätte sie vor jedem verborgen, außer vor Raubtieren und kleineren Nagern.«
»Was die Frage aufwirft: Liegt sie zufällig hier oder gibt es einen Grund dafür?«
»Wohl wahr. Wenn sie zufällig hier gelandet ist, wird uns das nicht viel sagen. Aber wenn sie absichtlich hierhergebracht wurde …«
»Dann hätte man diese Leiche, um Gegensatz zu der auf dem viel besuchten Wanderweg, eigentlich nicht finden sollen.«
»Darauf würde ich tippen. Ob derselbe Mörder dafür verantwortlich ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt.«
Diana zog die Brauen hoch. »Ich weiß, dass ich als Ermittlerin noch ein Grünschnabel bin, aber wäre die Annahme, dass zur gleichen Zeit zwei Mörder in so einer entlegenen Gegend agieren, nicht ein bisschen weit hergeholt?«
»Ziemlich weit hergeholt. Doch zusätzlich dazu, dass wir nicht wissen, ob die beiden Opfer von derselben Person umgebracht wurden, wissen wir nicht mal, ob dieses hier überhaupt ermordet wurde. In so einer Gegend sind natürliche Todesfälle häufig.«
»Schon. Aber du glaubst nicht, dass hier irgendwas natürlich war.« Das war keine Frage.
Hollis zuckte mit den Schultern. »Solches Glück haben wir meistens nicht. Also gehen wir bis zum Beweis des Gegenteils von Mord aus.«
»Kapiert.«
Mit leicht gerunzelter Stirn blickte Hollis sich um und überlegte laut: »Der Mörder, dem wir seit über zwei Monaten auf der Spur sind, verteilt seine Leichen über den ganzen Südosten, daher können wir nicht genau feststellen, wo sein Standort ist. Vielleicht hier ganz in der Nähe, vielleicht auch nicht. Dem Profil nach hat er möglicherweise keine feste Basis und ist ständig unterwegs.«
»Was uns herzlich wenig Material liefert, mit dem wir arbeiten können.«
»Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Doch wenn es sich bei diesen beiden Leichen um seine Opfer handelt, wirft das ein neues Problem auf. Bis jetzt waren seine Abladeplätze über Hunderte von Meilen verstreut ‒ nicht Metern. Und wir haben zum ersten Mal zwei Opfer gefunden, die innerhalb einer Woche ermordet wurden, wie ich annehme. Der Mann auf dem Wanderweg erst vor Kurzem, und die Frau ein paar Tage, vielleicht eine Woche zuvor.«
Diana atmete rasch ein ‒ durch den Mund ‒ und langsam wieder aus. »Ich glaube dir aufs Wort, vor allem, da ich das Handbuch für Tatortermittler noch nicht mal halb durch habe.« Sie war eines der neuesten Teammitglieder der SCU, hatte erst vor knapp einem Jahr bei ihnen angefangen. »Und wie schon gesagt, das war eine super Ahnung, die dich hierhergeführt hat. Nur war es gar keine Ahnung, nicht wahr?«
»Nein.«
»Du hast sie gesehen?«
»Ganz flüchtig.« Hollis runzelte erneut die Stirn. »Allerdings war es seltsam. Meistens bleiben sie lange genug, um eine Unterhaltung anzufangen. Sie hat sich mir nur kurz gezeigt, und das auch nur von Weitem.«
»Aber sie hat uns hierhergeführt. Ihr wurde wahrscheinlich klar, dass ihre Leiche sonst nie gefunden würde.«
Hollis sah Diana an. »Du hast nichts gesehen? Niemanden?«
»Nein. Meist sehe ich sie nicht einfach so, hier auf unserer Seite, zumindest nicht ohne die Mithilfe eines Gewitters oder einer anderen äußeren Energiequelle. Normalerweise ist es für mich eine Sache des Willens, weißt du. Ich muss mich stark konzentrieren, mich fast in Trance versetzen. Oder es geschieht im Schlaf.«
Inzwischen war ihr das mehr zuwider als in den vergangenen Jahren, in denen sie sich ihrer paragnostischen Streifzüge nicht bewusst gewesen war. Das hatte an den vielen Medikamenten gelegen, die ihr von ihrem Vater und diversen Ärzten verabreicht worden waren, um ihre »Krankheit« in den Griff zu bekommen. Weder Elliot Brisco, noch einer dieser Ärzte hatte auch nur einen Augenblick lang in Betracht gezogen, dass sie in Wirklichkeit nicht krank war, sondern nur eine … Gabe besaß. Auch Diana war es nicht in den Sinn gekommen. Sie war vollkommen davon überzeugt gewesen, entweder psychisch labil oder im schlimmsten Fall verrückt zu sein.
Bis sie Quentin Hayes begegnete und sowohl von ihm als auch von den Mitarbeitern der SCU geschult und rückhaltlos ernst genommen wurde.
Zum ersten Mal in ihrem Leben kam sie sich nicht wie ein Monster vor.
»Diana?«
Mit einem Ruck kehrte sie in die Gegenwart zurück und murmelte: »Ich kann es nicht ausstehen, wenn es im Schlaf passiert. Ist ziemlich beunruhigend.«
»Kann ich mir vorstellen. Sogar sehr gut.«
»Ja, du hast mir nach unserem kleinen Experiment eigentlich nie so richtig verraten, was du von diesem Besuch in der grauen Zeit hieltest.« Das war die Bezeichnung, die Diana für einen Ort oder Zeitraum benutzte, der eine Art Schwebezustand zwischen der Welt der Geister und der Welt der Lebenden zu sein schien.
»Das war äußerst gruselig. Ich beneide dich nicht um die Fähigkeit, dorthin zu gelangen.« Obwohl selbst ein Medium, war Hollis dieser graue, leblose Zustand vollkommen fremd, was wiederum Bishops Ansicht bestätigte, dass jeder Paragnost einzigartig war.
»Mit Bishop oder Miranda hast du auch nicht darüber gesprochen, oder?«
Auf Hollis’ Gesicht erschien ein schiefes Lächeln. »Ich muss keine telepathischen Fähigkeiten besitzen, um zu wissen, dass die beiden sich meinetwegen … Gedanken machen. Sieht so aus, als wäre ich eine Art Freak, was Paragnosten betrifft, und sie fragen sich wohl, was im Laufe der Zeit mit mir geschieht. Keiner von beiden hat das je direkt gesagt, doch ich nehme an, die letzten Tests haben gezeigt, dass die Menge an elektrischer Aktivität in meinem Gehirn auch für einen Paragnosten äußerst groß ist. Ob sich das als gut oder schlecht erweist, muss sich erst noch zeigen.«
»Ich wünschte, du hättest mir das gesagt, bevor ich dich in die graue Zeit mitnahm.«
»Fang jetzt bloß nicht auch noch an, dir Sorgen zu machen. Mir geht es gut. Ich … lote nur meine Fähigkeiten aus. Lieber wüsste ich im Voraus, was ich tun kann, ehe eine weitere tödliche Situation entsteht, ganz ohne Vorwarnung, und sich noch eine Tür zu meiner paragnostischen Welt öffnet. Das wäre dann weniger beunruhigend.«
»Wenn du meinst.« Diana wirkte nicht sonderlich überzeugt, doch ein weiterer Blick auf die Überreste lenkte sie ab. »Werfen wir eine Münze, um zu entscheiden, wer hier bei ihr bleibt?«
»Nicht nötig, ich bleibe. Möglicherweise stattet sie mir noch einen Besuch ab, wenn ich alleine bin. Außerdem scheinst du ein wesentlich besseres Orientierungsvermögen zu haben, also wirst du dich weniger leicht verlaufen. Obendrein ist ja Quentin hier. Ihr beide habt eine ganz enge Verbindung, und normalerweise kannst du seine Nähe spüren, stimmt’s?«
Dianas Miene wurde etwas verschlossener, doch sie erwiderte bereitwillig: »Normalerweise. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, dass er entweder die Schüsse gehört oder etwas empfangen hat, denn ich glaube, er ist hierher unterwegs.«
»Na, dann geh ihm doch entgegen. Je kürzer ich hier auf einen Geist oder einen Bären warten muss, desto besser.«
»Verstanden.« Schon im Gehen, fügte Diana hinzu: »Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin so schnell wie möglich mit den anderen zurück.«
»Ich geh hier nicht weg.« Hollis wandte sich wieder den Überresten einer Frau zu, die viel zu jung gestorben war, falls es tatsächlich ihr Geist gewesen war, den sie gesehen hatte.
Allzu viel war von dem Körper nicht mehr übrig. Hollis kannte sich gut genug aus, um zu wissen, dass sowohl Maden als auch kleine Aasfresser den Großteil der Weichteile vertilgt hatten. Etwas Haut war noch da, und eine lange blonde Strähne, die an einem kleinen Stück Kopfhaut auf der Schädeldecke klebte.
Sie hatte sehr schöne Zähne, gerade und strahlend weiß.
Muss beim Kieferorthopäden ein Vermögen gekostet haben.
Vorsichtig kniete Hollis sich hin und redete sich ein, der Geruch sei gar nicht so penetrant, während sie konzentriert nach Beweisen suchte, nach Hinweisen darauf, wie die Frau gestorben war, und den Tatort begutachtete, wie man es ihr beigebracht hatte.
Der erste Fund überraschte sie, da sie ihn einerseits bisher übersehen hatte und es ihr andererseits unerwartet nachlässig vorkam, dass der Mörder ihn zurückgelassen hatte: Eine Plastikschlinge, mit der die zarten Handgelenke auf dem Rücken des Opfers gefesselt waren. Die Art von Schlinge, die Polizisten in letzter Zeit öfter bei Massenverhaftungen benutzten, oder wenn ihnen die Metallhandschellen ausgegangen waren.
Möglicherweise handelte es sich aber auch um Plastikoder Kabelbinder, wie man sie häufig in den Verpackungen von Mülltüten findet und auch in den Garten- und Handwerksabteilungen jedes Heimwerkermarktes.
Hollis schob diese Gedanken weg und widmete sich wieder der Untersuchung der Überreste. Der Bär, stellte sie fest, hatte mit den Pfoten daran … herumgeschubst, daher war es schwierig, die Position auszumachen, in der das Opfer hier abgelegt worden war. Im Moment lag die Frau mehr oder weniger mit dem Gesicht nach oben, Unterarme, Handgelenke und Hände hinter dem Rücken, die Beine verdreht, an den Oberschenkeln gespreizt, aber an Knöcheln und Füßen wieder zusammengeführt.
Keine Spur eines weiteren Kabelbinders, doch Hollis fragte sich, ob die Knöchel nicht genauso gefesselt gewesen waren wie die Handgelenke. Wahrscheinlich schon.
Wie ihr plötzlich auffiel, fehlte auch jegliches Anzeichen von Kleidung. Der Gedanke an eine junge Frau, eventuell schon tot oder noch am Leben, in Qualen und Todesangst, hier in einer Wildnis voller Dreck und Ranken, gefesselt und nackt, schnürte ihr die Kehle zu. So ungeheuer ausgeliefert, so völlig allein.
In Hollis stiegen Erinnerungen auf, die sie nur allzu gern vergessen hätte.
»Hey.«
Vor Schreck blieb ihr fast das Herz stehen. Sie blickte auf. »Wo zum Teufel kommst du denn her?«, fuhr sie ihn an und stellte zu ihrem Arger fest, dass ihre Stimme krächzte.
Kapitel 2
»Von Westen«, erwiderte Reese DeMarco sachlich. »Ich war mit der Durchsuchung meines Sektors fertig und auf dem Rückweg, als ich die Schüsse hörte.«
Logisch, dass er es war. Schlagartig fiel Hollis ein, dass DeMarco unter anderem auch telepathisch veranlagt war, daher stand sie betont langsam und umständlich auf und klopfte sich die Knie ihrer Jeans ab.
»Da war ein Bär«, erklärte sie knapp. »Wir haben ihn verscheucht. Diana ist losgegangen, um Bericht zu erstatten, während ich hier gewartet habe.«
»Aha.« Er blickte auf die Überreste, sein auf kalte Weise gut aussehendes Gesicht wie immer ausdruckslos. Er war so lässig gekleidet wie alle im SCU-Team: Jeans und weißes Hemd unter einer leichten Windjacke, doch die legere Aufmachung konnte das nahezu Militärische seiner Haltung und seiner Bewegungen nicht mildern, diesen offenkundigen Eindruck beträchtlicher Kraft und der Erfahrung, wie Ausbildung und Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen sind.
Hollis hatte das auch schon bei anderen Ex-Militärs gesehen, doch in DeMarcos aufrechter Haltung und Hypersensitivität seiner Umgebung gegenüber lag fast etwas … Übertriebenes. Er kam ihr zu wachsam vor, zu sehr bereit, schlagartig in Aktion zu treten. Er erinnerte sie an eine Waffe im Anschlag, und sie fragte sich, ob die nicht auch einen gefährlich leichten Abzug hatte.
Seine Aura konnte sie nur sehen, wenn er es ihr gestattete.
Was er nicht tat.
»Ich nehme an, der Bär hat diese Reste gefunden?«
Sie schob ihre seltsam wandernden Gedanken beiseite. Er ist ein Telepath, schon vergessen? Lass ihn nicht in deinen Kopf. Allerdings konnte sie ihn nicht mit einem Schutzschild daran hindern, falls er das vorhatte. Verdammt. »Ja.«
»Seid ihr beide deshalb so weit vom Weg abgekommen?«
»Nicht nur.«
Er richtete den Blick auf sie, bleiche blaue Augen musterten sie aufmerksam. »Du weißt, dass wir auf der gleichen Seite stehen, Hollis. Du brauchst dich mir gegenüber nicht so bedeckt zu halten. Ich versuche nicht, deine Gedanken zu lesen.«
Sie überlegte, ob es bedeutete, dass er ihre Gedanken nicht las ‒ oder sich einfach gar nicht bemühen musste, es zu tun. Ihn danach zu fragen, traute sie sich nicht. »War ich ausweichend? Tut mir leid. Diana und ich sind nicht dem Bären gefolgt, sondern einem Geist, der uns in dieses Gebiet geführt hat. Danach haben wir den Bären entdeckt. Und der hatte gerade gefunden, was noch von der Leiche übrig war.«
»Muss eine interessante Begegnung gewesen sein.«
»Könnte man so sagen.«
DeMarco wandte seine unterkühlte Aufmerksamkeit wieder den Überresten zu. »Wahrscheinlich weiblich, wahrscheinlich eher jung. Blond. Gute Zähne. Ihre Hände wurden auf dem Rücken gefesselt, und es gibt keine Kleidung, also höchst unwahrscheinlich, dass es sich um einen Unfalltod handelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ein sexueller Übergriff, doch ob das von vornherein beabsichtigt war, lässt sich unmöglich sagen. Weiter reichen meine forensischen Kenntnisse als Tatortermittler nicht.«
»Meine auch nicht. Nur scheint mir offensichtlich, dass sie hier schon länger lag als das männliche Opfer.«
»Ja. Der Bär war nicht der erste Aasfresser, der sie fand.«
Hollis empfand die Stille, die sich zwischen ihnen ausbreitete, als unangenehm und füllte sie daher mit so etwas wie lautem Denken. Das wurde für sie bei Ermittlungen schon zur Gewohnheit. Denn mit diesen ganzen Telepathen ringsherum, zum Kuckuck …
Außerdem fragte sie sich, ob er ihren Schlussfolgerungen zustimmen würde.
»Diese Leiche wurde ‒ wie viel ‒ gut fünfzig Meter vom nächsten Weg abgeladen?«
»Kommt hin.«
»An einem Ort wie diesem kommt so leicht niemand zu Fuß oder zu Pferd vorbei. Die Bäume und das Unterholz würden sogar jetzt, ohne die volle sommerliche Belaubung, alles verdecken.«
»Sobald er grün wird, sorgt der Kudzu dafür, dass alles hier Abgeladene schon aus einem halben Meter nicht mehr zu erkennen ist. Egal, aus welcher Richtung.«
Hollis nickte. »Die Stelle ist einigermaßen flach, doch der Hang darüber und darunter fällt steil ab. Hier kommt man nicht leicht hin. In Anbetracht des Geländes und der Fauna ist das Risiko einer Entdeckung gleich null. Oder wäre es gewesen, hätte man uns nicht so weit vom Weg abgebracht. Also …«
»Also sollte diese Leiche, im Gegensatz zu der anderen, nicht gefunden werden.« DeMarco überlegte einen Moment. »Ich frage mich, was das Bedeutsamere ist ‒ dass er gefunden werden sollte oder sie nicht.«
Darauf war Hollis bisher noch nicht gekommen. Sie setzte ihren Gedankengang laut fort. »Der Mörder ‒ angenommen natürlich, es handelt sich um denselben ‒ konnte nicht annehmen, dass wir in so weitem Umkreis suchen würden, nachdem wir die andere Leiche gefunden hatten.« Sie runzelte die Stirn. »Zwei Annahmen in einem Satz, das gefällt mir nicht.«
»Eine davon negativ«, gab DeMarco zu bedenken.
»Spielt das eine Rolle?«
»Vielleicht. Falsch ist die Annahme nicht, würde ich sagen. Aufgrund der Fundstelle der anderen Leiche hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass die Aufmerksamkeit der Polizei nicht dieser Gegend hier gilt. Und trotz unserer ausgedehnten Suche liegt sie weit außerhalb des Rasterfeldes. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, wieso einer von uns diese Leiche hätte finden sollen.«
»Falls der Mörder mit der Vorgehensweise der Polizei vertraut ist, gewiss nicht. Und falls es derselbe Mörder ist.« Sie hielt inne und fuhr dann fort: »Willst du damit andeuten, der Mann auf dem Wanderweg war als Ablenkung gedacht, um zu verhindern, dass man sie hier findet? Denn mir kommt es viel unwahrscheinlicher vor, dass wir sie gefunden hätten, wenn wir nicht schon hier gewesen wären und die Gegend nach Spuren in Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen durchkämmt hätten.«
»Vielleicht ist unser Mörder paranoid. Oder er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass wir diese Leiche finden.«
»Weil eine Verbindung zwischen ihnen besteht? Weil sie keine x-beliebige Fremde für ihn war?«
»Wäre möglich.«
»Warum hat er sich dann nichts Besseres einfallen lassen, um die Leiche zu beseitigen? Er hätte sie vergraben können.« Hollis war nicht ganz klar, wieso sie mit DeMarco stritt. Seine Überlegungen waren genauso vernünftig wie ihre.
»Aber nicht hier. Bei dem ganzen Granit bekommst du nur ein unbrauchbares, viel zu flaches Grab. Und wo kein Granit ist, würden die Wurzeln der Bäume es schwierig und zeitraubend machen, wenn nicht unmöglich, von Hand zu graben.«
»Bestimmt gibt es auch Stellen, an denen es einfacher ist.«
»Zugegeben. Doch vielleicht hatte er nicht genug Zeit. Möglicherweise musste er sich beeilen, die Leiche loszuwerden.«
»Gut. Aber …« Hollis spürte es, noch bevor sie etwas sah. Spannung, so urplötzlich und stark, als wäre die Luft elektrisch geladen. DeMarco drehte den Kopf, sah sie an, sah beinahe durch sie hindurch. Im Bruchteil einer Sekunde veränderten sich seine Augen, und seine Pupillen weiteten sich, als hätte man ihn ohne Vorwarnung in pechschwarze Finsternis gestürzt.
Zum ersten Mal seit Monaten konnte sie sehen, wie die Aura seinen Körper im Abstand von etwa zwei Handbreit umstrahlte, und sie glich keiner, die sie je gesehen hatte, war völlig anders als seine normale, hochenergetische orangerote Aura. In diesem Moment hatte sie die Farbe von tiefstem Indigoblau, durchzogen mit violetten und silbrigen Streifen.
Ihr blieb kaum Zeit, das zu erfassen, bevor er auf sie zu hechtete. Noch während er sie zu Boden riss, spürte sie etwas am Schulterstück ihrer Jacke zerren und hörte das deutliche, seltsam hohle Krachen eines Gewehrschusses.
Diana besaß einen beinahe unheimlichen Orientierungssinn, eine Begabung, die sie erst vor ungefähr einem Jahr entdeckt hatte, doch ihre körperliche Verfassung und Ausdauer ließen im Vergleich mit anderen Teammitgliedern noch beträchtlich zu wünschen übrig.
Das fand sie erniedrigend.
Ganz gleich, wie oft Quentin oder Miranda sie daran erinnerten, dass sie sich auf einer schwierigen Aufholjagd befand, nachdem sie nahezu ihr ganzes Erwachsenenleben in einem von Medikamenten verursachten, die Sinne vernebelnden Dämmerzustand verbracht hatte, gelang es ihr immer noch nicht, das Gefühl abzuschütteln, sie hätte inzwischen schon … weiter sein müssen. Zumindest körperlich kräftiger.
»Du bist kräftiger, als dir bewusst ist«, hatte Bishop erst vor ein paar Wochen gesagt.
Klar doch.
In Wahrheit war sie vollkommen teilnahmslos, unbeteiligt an allem durch ihr Leben gedriftet. Nur zu gerne hätte Diana geglaubt, dass alle Ärzte, die ihr ein Medikament und eine Therapie nach der anderen verschrieben, das nur mit den besten Absichten getan hätten und ehrlich überzeugt gewesen wären, sie litte an einer unbekannten geistigen Störung. Tatsächlich aber war sie davon überzeugt, dass ihr Vater Elliot Brisco ein reicher, mächtiger Mann war, der ganz einfach bekam, was er wollte.
Und er wollte die Kontrolle über das Leben seiner einzigen Tochter haben. Trotz der Behauptung, alles entspringe seiner Liebe und Sorge für sie, war Diana zu dem Schluss gekommen, dass er genauso sehr von dem Verlangen getrieben war, das zu beherrschen, was »ihm« gehörte, und von einer tief verwurzelten Angst vor allem, was er nicht verstand.
Zum Beispiel vor paragnostischen Fähigkeiten.
Diana versuchte, die schmerzliche Grübelei wegzuschieben, und wünschte, ihr Vater hätte in den letzten Monaten nicht auch noch seine Bemühungen verstärkt, sie erneut davon zu überzeugen, dass es ein Fehler war, zum FBI zu gehen. Vor allem zur SCU.
Ein Zufall war es gewiss nicht, fand sie, dass er gerade in dem Moment mehr Druck ausgeübt hatte, als sie ihren ersten Außeneinsatz bekam.
Bewusst oder nicht ‒ er verstand sich sehr gut darauf, ihr Selbstvertrauen zu unterminieren.
Denk nicht über ihn nach. Konzentrier dich auf deine Arbeit, verflixt noch mal.
Während sie sich zum Atemholen an den nächsten Baum lehnte, wurde ihr klar, dass es doch keine gute Idee gewesen war, die Abkürzung zu nehmen. Da sie der längeren Strecke voller Kurven und Biegungen eine direktere Route vorgezogen hatte, war sie häufig gezwungen, steil bergan zu klettern, um über einen Hügelkamm zu gelangen.
»Jammer nicht«, murmelte sie vor sich hin. »Du bist umgeben von Leuten, die nicht mal wissen, wie man aufgeben schreibt.« Diese Ermahnung nützte ihrem Selbstvertrauen zwar wenig, veranlasste sie aber, sich von dem stützenden Baum zu lösen und weiterzugehen.
Und bergauf.
Bereits nach wenigen Metern blieb sie kurz vor dem Hügelkamm stehen und lehnte sich erneut an einen Baum, diesmal jedoch nicht nur, weil ihre Beine brannten und ihr Herz hämmerte.
Quentin war in der Nähe.
Dieses Gefühl war … seltsam. Mehr noch als ein Wissen oder Bewusstsein, war es eine spürbare Verbindung, die sie eigentlich nicht erklären konnte ‒ und deren genauere Ergründung sie bisher vermieden hatte. Immer noch, nach all diesen Monaten, ertappte sie sich dabei, wie sie sich diesem starken inneren Sog widersetzte, entgegenstemmte und es sich nicht gestattete, von Quentin angezogen zu werden, obwohl alle anderen Sinne darauf beharrten.
Bishop hatte ihr erklärt, es käme daher, dass sie den größten Teil ihres Lebens unter der Kontrolle eines anderen gestanden hatte und daher zwangsläufig instinktiv um ihre Unabhängigkeit kämpfte, seit die Medikamente abgesetzt waren und der Einfluss ihres Vaters auf sie, sowohl gesetzlich als auch praktisch, erloschen war. Und jetzt kämpfte sie sogar gegen eine Verbindung, die keine Bedrohung ihrer Unabhängigkeit darstellte.
Das hatte er ihr eines Tages aus heiterem Himmel gesagt, während er ihr ein paar einfache Kampfsportgriffe zeigte, und Diana hatte leicht indigniert gedacht, er wolle sie nur ablenken, um die Oberhand im Match zu behalten ‒ bis sie sich später darüber Gedanken machte. Als Erstes wurde ihr klar, dass Bishop bei seinem Können wohl kaum Ablenkungsmanöver nötig hatte. Und dann erkannte sie, wie recht er mit allem hatte. Sie selbst hätte das Thema niemals angeschnitten. Das, was er gesagt hatte, war wirklich wichtig für sie.
Was zu ihm passte. Bishop war so, hatte Diana festgestellt. Er griff etwas auf, über das man nicht reden wollte, und brachte einen ganz nebenbei dazu, es doch zu tun.
Oder zumindest darüber nachzudenken. Über dieses Thema hatte sie nicht sprechen wollen, da reagierte sie sofort allergisch. Sie war noch nicht bereit, über ihren Vater und all den Ballast zu reden, den er ihr aufgehalst hatte. Jedenfalls nicht mit Bishop.
Und auch höchst selten und nur kurz mit Quentin.
Sie hatte fürchterliche Schuldgefühle deswegen, obwohl sie sich eigentlich ziemlich sicher war, dass er genau wusste, was in ihrem Kopf vorging. Denn Quentin hatte von ihr mit höchst untypischer Geduld keinerlei Zusage verlangt noch erbeten. Stattdessen hatte er ihr alle Zeit gelassen, die sie brauchte, um sowohl mit ihrem neuen Leben und den überraschenden Fähigkeiten zurechtzukommen, als auch mit einer Bindung an ihn, die nichts mit Beherrschung zu tun hatte.
Zumindest hielt sie das für den Grund, dass er nicht …
»Diana?«
Gott sei Dank ist er kein Telepath.
»Hi.« Erleichtert stellte sie fest, dass sie inzwischen wieder zu Atem gekommen war und nicht so erschöpft klang, wie sie war.
»Wir haben Schüsse gehört.«
Seine Waffe hatte er zwar nicht gezogen, doch man sah ihm die Anspannung an, während sein Blick misstrauisch die Umgebung absuchte.
»Hollis und ich hatten einen Zusammenstoß mit einem Bären.« Als er sie mit einem raschen Blick musterte, fügte sie hinzu: »Nicht im wörtlichen Sinn, aber wir mussten ihn verscheuchen. Er hatte etwas gefunden, Quentin. Eine weitere Leiche. Oder das, was von ihr übrig ist.«
»Mist. Ein Mordopfer?«
»Nehmen wir an.«
Er atmete kurz aus. »Okay. Miranda ist mit ein paar von Duncans Deputys hierher unterwegs. Sie sagte, Reese wäre schon bei Hollis, bevor wir sie erreichen.«
»Woher weiß sie …« Diana unterbrach sich, als es ihr klar wurde.
Quentin nickte. »Ich hab nie kapiert, wie Bishop und sie das machen, aber sie scheinen immer und zu jeder Zeit zu wissen, wo sich jeder von uns in Bezug zu ihnen und auch untereinander befindet.«
»Das ist irgendwie … verwirrend«, gestand Diana.
»Du wirst dich daran gewöhnen.« Er hielt inne, dachte kurz nach und fügte hinzu: »Oder auch nicht. Komm, gehen wir.«
»Du nimmst demnach an, dass ich den Weg dorthin zurück finde.«
»Ich weiß, dass du ihn findest.« Seine Stimme blieb sachlich. »Du bist so gut wie ein Kompass.«
»Meine einzige Begabung«, murmelte sie.
»Eine von vielen. Dein Vater hat gestern Abend wieder angerufen, stimmts?«
»Er ruft fast jeden Abend an.« Sie bemühte sich, es beiläufig klingen zu lassen. »Er ist verdammt hartnäckig. Also?«
»Also hör auf, dir dein Selbstvertrauen kaputt machen zu lassen. Diana, du bist mit deinen Fähigkeiten und Begabungen ein wertvolles Mitglied des Teams. Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber die SCU ist nicht gerade eine Mannschaft, der man so einfach beitreten kann, und man wird nur aufgenommen, wenn Bishop überzeugt ist, dass er oder sie etwas zu einer Ermittlung beitragen kann.«
»Ja, aber …«
»Kein Aber. Du hast es verdient. Okay?«
Nach einem kurzen Moment nickte sie. »Okay.« Sie drehte sich um und schlug den Rückweg ein, froh darüber, dass es hauptsächlich abwärts ging. »Glaubst du, wir haben es mit zwei Mördern zu tun?«, fragte sie über die Schulter.
»Das halte ich für unwahrscheinlich. Zwar sind auch schon seltsamere Dinge passiert ‒ vor allem, wenn wir in der Nähe waren ‒, aber alles spricht dagegen.«
»Das haben wir …« Der Knall eines Schusses unterbrach sie. Diana blieb abrupt stehen und wandte sich halb zu Quentin um. »Was zum Teufel war das?«
»Das war ein Gewehr. Und keiner von uns hat eines dabei.«
»Woher kam der Schuss? Zu viel Echo für mich, um das zu erkennen.«
»Ich glaube, er kam von der anderen Seite des Tals.«
»Ein Jäger?«
»Eher nicht.«
Diana brauchte keine Aufforderung, weiterzugehen oder sich zu beeilen.
»Bleib unten.«
Mit vollem Gewicht blieb DeMarco einen Moment lang auf Hollis liegen, bevor er sich mit der Waffe in der Hand zur Seite rollte, die Augen spähend zusammengekniffen, während er durch das Unterholz die Berghänge rings um das Tal absuchte. Seine andere Hand lag nur ein kleines Stück vom Schädel der ermordeten Frau entfernt.
»Entschuldigung«, sagte er kurz.
Vorsichtig betastete Hollis das kleine Loch im Schulterteil ihrer Jacke und gab ein zittriges Lachen von sich. »Entschuldigung? Dafür, dass du mir wahrscheinlich das Leben gerettet hast?«
»So schnell, wie bei dir alles heilt, lässt sich darüber streiten. Nein, ich wollte mich dafür entschuldigen, dich ohne Vorwarnung zu Boden geworfen zu haben.«
»Für eine Warnung war ja wohl keine Zeit. Hab schon verstanden, glaub mir.« Hollis war stolz darauf, dass ihre Stimme fast so ruhig war wie seine. Sie rollte sich auf den Bauch, blieb aber flach auf dem Boden liegen, während sie ihre Waffe zog. »Ich nehme an, dieser Schuss war kein Zufall.« Das war nicht als Frage gemeint.
Er antwortete trotzdem. »Wahrscheinlich. Das war ein leistungsstarkes Gewehr, und ich bezweifle, dass die Jäger in dieser Gegend solche benutzen.«
»Dann hat also jemand auf mich geschossen?«
»Auf einen von uns beiden. Oder er wollte uns aus der Fassung bringen.«
Hollis fragte sich, ob DeMarco sich je aus der Fassung bringen ließ. Irgendwie bezweifelte sie das.
»Ich sehe nichts«, stellte sie einen Augenblick später fest, während auch sie die Gegend mit Blicken absuchte ‒ oder zumindest versuchte, durch das Unterholz zu spähen. Wonach genau sie Ausschau hielt, war ihr allerdings nicht recht klar. »Wo wir gerade davon sprechen: Wie zum Teufel wusstest du, dass der Schuss fallen würde?«
Er antwortete nicht sofort, und als er es tat, war sein Ton fast gleichgültig. »Ich habe aus dem Augenwinkel etwas aufblitzen sehen. Einen Sonnenstrahl vielleicht, auf dem Gewehrlauf.«
Hollis hob den Blick zu dem seit Stunden bedeckten Himmel. »Aha. Schon gut, behalt deine militärischen Geheimnisse nur für dich. Mir macht es nichts aus, wenn mir gesagt wird, es ginge mich nichts an.« Ihren Worten zum Trotz klang ihre Stimme reichlich sarkastisch.
»Das ist kein militärisches Geheimnis, Hollis.«
In seinen gleichgültigen Ton hatte sich etwas eingeschlichen, das sie nicht identifizieren konnte, das ihr jedoch aus irgendeinem unerfindlichen Grund gefiel. »Nein?«
»Nein.« Er sah sie an, wandte den Blick aber wieder ab, während er hinzufügte: »Ich kann spüren, wenn eine Waffe auf mich oder etwas in meiner Nähe gerichtet wird.«
»Immer?«
»Soweit ich weiß, schon.«
»Ist das eine paragnostische Fähigkeit?«
Erneut zögerte er kurz, bevor er antwortete. »Bishop nennt es einen Primärsinn. Einen Urinstinkt. Waffen bedeuten eine tödliche Bedrohung: Ich kann solche Bedrohungen spüren. Ein Überlebensmechanismus.«
»Klingt nach einem ziemlich praktischen Mechanismus, vor allem in unserem Metier.«
»Das war er auch schon.«
»Spürst du noch immer eine Bedrohung?«
»Keine unmittelbare.«
»Soll heißen, das Gewehr zielt nicht mehr in unsere Richtung, doch der Schütze könnte nach wie vor … da sein, wo er war?«
»So ungefähr.«
»Dann können wir jetzt vielleicht wieder aufstehen?«
Er warf ihr einen weiteren Blick zu. »Ich könnte mich auch irren.«
»Tust du’s?«
Er antwortete nicht sofort, was sie überraschte. Von ihrer ersten Begegnung an hatte sie DeMarco als einen Mann voller Selbstvertrauen eingeschätzt. Fast ein bisschen zu viel Selbstvertrauen. Sie glaubte, er gehörte zu der Sorte, die jegliches Zögern als Schwäche auslegt.
Das war einer der Gründe, weshalb sie sich ihm gegenüber immer in die Defensive gedrängt fühlte, denn sie neigte zum Zögern. Gewaltig.
Sie beschloss, diesmal nicht zu zögern, und machte Anstalten aufzustehen. In dem Augenblick schoss DeMarcos Hand vor, packte sie am Handgelenk und hielt sie gerade noch rechtzeitig zurück.
Die Kugel traf den Baum direkt neben ihnen mit einem dumpfen Einschlag, Rinde spritzte davon, und das Echo wiederholte den Knall des Schusses, genau wie beim ersten.
Wäre Hollis tatsächlich aufgestanden, hätte der Schuss sie wahrscheinlich mitten in die Brust getroffen.
DeMarco ließ ihr Handgelenk los. »Jetzt können wir aufstehen.« Er erhob sich.
Hollis blieb noch einen Moment liegen und betrachtete die geröteten Striemen an ihrem Arm, wo er sie festgehalten hatte. Dann ergriff sie die ausgestreckte Hand und stand auf. Sie merkte, dass sie vollkommenes Vertrauen in DeMarcos Überzeugung hatte, der Schütze würde nicht noch mal schießen. Und sie fragte sich, wieso.
Fragte sich ernsthaft.
»Also galt der Angriff doch mir«, stellte sie fest, bemüht, ihre Stimme nicht zittern zu lassen, obwohl ihr Herz wie wild hämmerte. »Ich war das Ziel.«