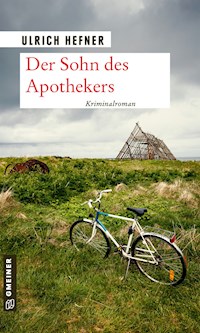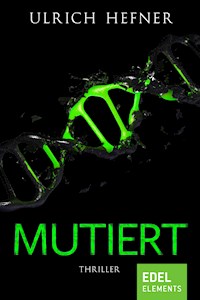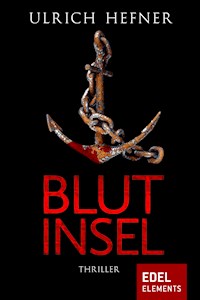
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine einsame Insel vor der Küste Maines, eine mysteriöse Mordserie und eine alte Legende ... Detective Cathy Ronsted und ihr Kollege Brian Stockwell werden auf die einsame Insel Hell's Kitchen im Golf von Maine gerufen, um eine mysteriöse Mordserie aufzuklären. Doch die Inselbewohner, verstrickt in Aberglauben und eine schuldhafte Vergangenheit, begegnen ihnen abweisend, ja feindlich. Während die Ermittlungen ins Stocken geraten, fliehen auf dem amerikanischen Festland, 300 Meilen entfernt, vier Schwerverbrecher aus einem Gefängnis. Sie hinterlassen eine Spur aus Blut und Gewalt, die schließlich nach Hell's Kitchen führt ... >>Gut recherchiert, äußerst spannend erzählt und mit absolutem Bestsellerpotenzial!<< Literaturmarkt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Eine einsame Insel vor der Küste Maines, eine mysteriöse Mordserie und eine alte Legende ...
Detective Cathy Ronsted und ihr Kollege Brian Stockwell werden auf die einsame Insel Hell’s Kitchen im Golf von Maine gerufen, um eine mysteriöse Mordserie aufzuklären. Doch die Inselbewohner, verstrickt in Aberglauben und eine schuldhafte Vergangenheit, begegnen ihnen abweisend, ja feindlich. Während die Ermittlungen ins Stocken geraten, fliehen auf dem amerikanischen Festland, 300 Meilen entfernt, vier Schwerverbrecher aus einem Gefängnis. Sie hinterlassen eine Spur aus Blut und Gewalt, die schließlich nach Hell’s Kitchen führt ...
>>Gut recherchiert, äußerst spannend erzählt und mit absolutem Bestsellerpotenzial!<< Literaturmarkt
Ulrich Hefner
Blutinsel
Thriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2013 by Ulrich Hefner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rightsreserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN:978-3-96215-023-5
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
… sei vorsichtig, denn du weißt nie, wer dein Nachbar ist …
… versunken im tiefen Ozean des Vergessens, rufen die Seelen der Geschundenen nach Rache, bis der einst kommen mag, der ihr Jammern vernimmt und sich ihrer Pein erbarmt, doch sein Rachedurst wird erbarmungslos sein, bis denn alle Schuld ist getilgt mit dem Blute der Verdammnis …
Jonathan Sinclair, der Ältere, im Jahre des Herrn 1916
für
Tim und Nico
Prolog
Southern Shoals, 19. April 1971, 04.10 Uhr (Montag)
Es war ein stürmischer Tag, der 19. April im Jahr 1971. Die Jonathan Sinclair war am Vorabend in Boston ausgelaufen und hatte Kurs nach Norden genommen. Mit zwölf Knoten durchpflügte das Küstenfrachtschiff der Boston Shipping Company die aufgewühlten Gewässer des Porpoise Basin. Kurz nach vier Uhr in der Frühe war das Inferno über das Schiff hereingebrochen. Heftige Westwinde türmten das Wasser des Atlantischen Ozeans zu hohen Wellen auf, und die Gischt nahm den Männern die Sicht. Das Wasser schoss über die Reling und durchnässte die Kleidung der Passagiere, die sich auf dem Vordeck eng zusammengekauert hatten und mit angsterfüllten Augen in die Dunkelheit spähten.
Die Jonathan Sinclair, benannt nach dem Vater des Schiffseigners, war ein kleines Frachtschiff mit 270 Bruttoregistertonnen und sechs Mann Besatzung, das vorwiegend zum Transport von Weizen nach Quebec oder Curchill in der Hudson Bai eingesetzt wurde, doch am heutigen Tag waren die Laderäume leer. Vierzig Passagiere drängten sich stattdessen auf dem Vordeck eng zusammen. Männer und Frauen, deren Leiber vor Angst und Kälte zitterten. Vierzig Auswanderer, Filipinos allesamt, unterwegs nach Hell’s Kitchen Island, um dort in der Fischfabrik der Atlantic Seafood Inc. ihren neuen Job anzutreten.
»Halten Sie Kurs, Manning!«, rief Kapitän Ronald Haywood seinem Steuermann durch das Brausen und Tosen des Sturms zu, während er mit dem Fernglas nach dem Leuchtfeuer von Fenners Rock Ausschau hielt. Das Schiff rollte und stampfte in der schweren See, und der Steuermann hatte Mühe, den Frachter auf Kurs zu halten. Querab rollten die schäumenden Wellen auf die Jonathan Sinclair zu, gierig griffen die spitzen Wellenkämme nach der Steuerbordseite des Schiffs, und die Gischt spritzte über die Brüstung.
»Halten Sie Kurs, um Gottes willen, halten Sie Kurs, Manning!«
Der Steuermann hielt das Ruder fest umklammert. Schweiß trat aus den Poren. Der Rudergänger sprang hinzu und unterstützte den Steuermann dabei, das reißende und zerrende Steuerrad zu fixieren.
»Sie zieht wie ein Büffel«, antwortete der Steuermann atemlos.
»Dort!«, rief der Kapitän und wies aus dem Fenster des Brückendecks in die Dunkelheit.
»Mister Manning, vier Strich Backbord voraus!«
»Aye, Kapitän«, gab Manning zurück und blickte auf den Kreiselkompass. Langsam ließ er das Steuerrad nach links gleiten, bevor er sich wieder mit der ganzen Kraft seines Körpers an die Holme klammerte.
»Kurs liegt an!«
Erneut traf eine tosende Welle die Steuerbordseite des Frachters, das Schiff rollte nach Backbord und Kapitän Haywood geriet ins Straucheln. Das Fernglas fiel zu Boden, als er sich an den Kartentisch klammerte.
»Halten Sie das Schiff auf Kurs!«, befahl Haywood. »Die Southern Shoals liegen nördlich von unserer Route, sobald wir die Südspitze der Insel umfahren und Goose Rock passiert haben, sind wir in Sicherheit. Dort ist das Gewässer ruhiger.«
Der Steuermann warf einen Blick durch die Glasscheibe hinaus auf das Vordeck. Obwohl die Scheibenwischer auf vollen Touren liefen, gab es draußen nur ein Gemisch aus Gischt, Schlieren und Dunkelheit zu sehen. Erneut zitterte das Schiff, als ein weiterer Brecher die Wandung an der Steuerbordseite traf, und der Rudergänger krallte sich noch fester ans Steuerrad. Er schickte ein Stoßgebet zum Himmel.
Der Wind blies heulend um die Kommandobrücke, und das Tosen des Sturms erfüllte die Nacht. Der Kapitän hielt sich am Kartentisch fest, der mit der Außenwand verschraubt war, die linke Hand hob er in die Höhe. »Still!«, rief er, den Sturm übertönend. »Still, hier stimmt etwas nicht!«
Das Gebet des Rudergängers erstarb, und auch der Steuermann lauschte stumm gegen das Getöse.
»Was?«, unterbrach er nach einem kurzen Augenblick das Schweigen.
Der Kapitän tastete sich am Tisch entlang und nahm das Sprachrohr von der Wand, das ihn direkt mit dem Maschinenraum verband. »Carrygan!«, brüllte er in den Trichter. »Carrygan, melden Sie sich!«
Doch der Maschinist schwieg.
»Was ist los, Kapitän?«, fragte der Rudergänger mit großen Augen.
»Hört ihr es nicht?«, versetzte Haywood. »Die Maschinen, die Maschinen sind ausgefallen.«
Der Steuermann blickte sich ängstlich um, plötzlich wurde das Vorschiff wie von einer Riesenfaust in die Höhe gehoben. Das Geräusch berstenden Stahles drang in das Ruderhaus. Und dann ertönte nach einem kurzen Augenblick unheilvoller Stille ein Heulen, es klang wie der Gesang eines verwundeten Wales. Gleichzeitig lief ein Zittern durch das Schiff, und der Vortrieb erstarb, so dass der Kapitän zu Boden geschleudert wurde.
»Wir haben … wir haben etwas gerammt!«, schrie der Rudergänger.
Der Kapitän raffte sich auf und stürzte zur Tür. Als er sie öffnete, erfasste ihn eine mit Gischt durchtränkte Böe. Im trüben Licht der Scheinwerfer erkannte er den Felsen, der an der Backbordseite in die Höhe ragte.
»Die Shoals, wir sind mitten in den Southern Shoals!«, rief er dem Steuermann zu.
»Aber das kann nicht sein, wir haben doch erst das Feuer von Fenners Rock passiert«, murmelte Kapitän Haywood, als sich das Schiff aufbäumte. Erneut traf eine Welle den Rumpf, und die Jonathan Sinclair rollte nach Backbord. Haywood hielt sich an der Reling fest, doch die Wucht der Welle war zu stark. Das metallische Stöhnen, als das scharfkantige Gestein die Wandung zerschnitt, war das letzte Geräusch, das er vernahm, bevor er den Halt verlor und in den schwarzen Schlund der tobenden See stürzte. Doch sie verschlang ihn nicht sogleich, sein Körper schlug hart auf dem kalten Gestein auf, und die Wucht des Aufpralls brach ihm das Rückgrat. Regungslos lag er auf dem Felsen, der hoch aus dem Meer aufragte. Zur Untätigkeit verdammt, musste er mit ansehen, wie sich das Heck der Jonathan Sinclair hoch aufreckte und das Schiff wie ein Pfeil in der Tiefe verschwand. Ein Stöhnen kam über seine Lippen. Wie durch einen Schleier sah er das Ende des Frachters, der durch die starke Unterströmung in dem Meeresgebirge der Southern Shoals, unmittelbar vor der Insel Hell’s Kitchen Island gelegen, in die Tiefe gezogen wurde und mit Mann und Maus versank. Als ein Brecher den Felsen traf und ihn mit sich riss, war es für ihn wie eine Erlösung.
Der Kapitän gehört zu seinem Schiff, war der letzte klare Gedanke, den er im Diesseits dachte, bevor ihn die eisige See verschlang und auf den Grund der Southern Shoals zu seinem kühlen Grab geleitete.
Die Jonathan Sinclair war nur drei Minuten, nachdem sie gegen die scharfkantigen Klippen von Feargalls End gestoßen war, in den Fluten des Atlantiks gesunken. Keiner überlebte das Unglück. Sechsundvierzig Menschen fanden am Morgen des 19. April im Jahre 1971 den Tod – und was das Meer sich geholt hatte, das gab es niemals wieder her … es sei denn …
Sechsunddreißig Jahre später …
Norwood, Massachusetts,
12. März 2007, 07.35 Uhr (Montag)
Der grüne Bus des Cedar Junction Department of Corrections fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit die Maine Street hinab. Norwood lag noch knapp eine Meile entfernt. Der Fahrer gähnte und rieb sich die Augen. Vor zwanzig Minuten war der Bus im Staatsgefängnis von Cedar Junction losgefahren, um einige Gefangene nach Boston in eine zahnmedizinische Klinik zur Behandlung zu bringen. Vier schwere Jungs, gefesselt an Armen und Beinen, zusammengekettet und fest mit dem Bus verbunden, lagen träge in den Sitzreihen und ließen gelangweilt die Landschaft an sich vorüberziehen. Zweihundert Jahre Knast wurden von den beiden Wachmännern bewacht, die in den hinteren Reihen des Busses Platz genommen hatten und, mit Schrotgewehren bewaffnet, argwöhnisch die Gefangenen beobachteten.
Die Männer in den gelben Overalls des Gefängnisses von Cedar Junction machten es sich ob der frühen Stunde so bequem, wie es nur möglich war.
»Hey Dan!«, rief Aufseher Bloomfield einem der Gefangenen zu. »Ich will deine Hände sehen, verdammt!«
Dan Lukovic, der Angesprochene, ein Mörder, der noch vierzig Jahre in Cedar Junction zu verbüßen hatte, war der gefährlichste unter den Insassen. Zwei erfolglose Ausbruchsversuche hatte er bereits hinter sich; bei einem hatte er einen Wachmann als Geisel genommen, bevor ihn der gezielte Schuss eines Scharfschützen außer Gefecht setzte. Ihm galt Aufseher Bloomfields besonderes Augenmerk.
Lukovic nahm seine Hände hinter dem Rücken hervor und reckte sie in die Höhe, soweit er durch die Fesseln konnte.
»Schon besser, und keine Tricks.«
»Schon gut, Officer Bloomfield«, antwortete Lukovic gedehnt. »Solange ich solche Schmerzen an der Backe habe, will ich nichts weiter als einen Zahnarzt.«
»Dann lass deine verdammten Hände dort, wo ich sie sehe«, fluchte Bloomfield.
»Ich freu’ mich schon auf die Tussis«, flüsterte Frank Duval, ein Räuber und Totschläger, seinem Nachbarn Wesley Tyler zu.
Der rümpfte nur die Nase. »Was hast du schon davon, du wirst sie nur von weitem sehen.«
»So lange, wie ich jetzt schon im Knast schmore, ist das fast so gut wie Sex.«
»Ruhe, da vorne!«, ermahnte Bloomfield die beiden Schwätzer.
Duval verzog seine Mundwinkel und grinste frech.
Sie hatten Walepole hinter sich gelassen. Der Busfahrer beschleunigte. Sie fuhren knapp an die sechzig Meilen, als er plötzlich laut aufschrie. »Was macht denn der Idiot?«
Noch bevor sich die Gefangenen aufrichten konnten, trat der Fahrer mit voller Wucht auf die Bremse. Plötzlich krachte es, und der Bus neigte sich bedrohlich zur Seite. Ein wildes Rufen und Geschrei durchlief das Gefährt. Der Fahrer riss die Hände vor das Gesicht, als der Bus hinab in den Graben schoss und auf die Seite kippte. Erneut krachte es laut, Glas splitterte, und das Metall ächzte von der Wucht des Aufpralls. Einer der Wachmänner wurde an den Gefangenen vorbeigeschleudert und prallte mit dem Kopf gegen einen der Sitze, bevor er zu Boden stürzte. Dann blieb der Bus auf der Seite liegen, Stille kehrte ein. Wesley Tyler fasste sich an den Kopf und spürte warme Feuchtigkeit in seinen Haaren.
Dan Lukovic war der Erste, der zu sich kam und die Situation erfasste. Der Wachmann war ihm direkt vor die Füße gefallen. Er beugte sich zu ihm hinab und zog die Pistole aus dem Halfter. Dann durchsuchte er die Taschen des Mannes, der ihm mit stumpfen, offenen Augen ins Gesicht blickte. Ein Freudenschrei kam über Lukovics Lippen, als seine Hände mit einem Schlüsselbund auftauchten.
»Was … was ist passiert?«, fragte Martin Simmrock, der vierte Gefangene, der wieder zu sich gekommen war. Er hörte das Klimpern der Schlüssel.
Stöhnend wankte Officer Bloomfield durch den auf der Seite liegenden Bus. »Bleibt sitzen, rührt euch nicht!«, befahl er mit gefährlicher Stimme. Sein Schrotgewehr zielte den Gang entlang. Plötzlich drehte sich Lukovic herum. Drei Schüsse krachten und schlugen in Bloomfields Oberkörper ein. Der Wachmann wurde wie von einer unsichtbaren Faust zu Boden gestreckt, das Schrotgewehr fiel ihm aus der Hand. Schon war Lukovic über ihm. Ein weiterer Schuss brach. Das Projektil traf den schwer verwundeten Wachmann oberhalb der Nasenwurzel. Ein letztes Stöhnen kam über seine Lippen, bevor er starb.
Lukovic lachte wie von Sinnen, dann warf er Simmrock den Schlüsselbund zu. »Heute ist unser Glückstag«, triumphierte er laut.
»Was ist mit den beiden anderen?«, fragte Duval.
Lukovic zeigte auf den Wachmann, dem er die Waffe aus dem Halfter genommen hatte. »Der ist alle, wahrscheinlich hat er sich das Genick gebrochen«, sagte er lakonisch. »Hätte sich wohl auch besser angeschnallt.«
Nachdem sich Simmrock befreit hatte, warf er Duval den Schlüsselbund zu.
»Der Fahrer macht es auch nicht mehr lange«, rief Lukovic den anderen zu. Dann stellte er sich auf den Fahrersitz und hangelte sich geschickt bis zur zerborstenen Frontscheibe, durch die er schließlich hinaus ins Freie stieg. »Ihr solltet euch beeilen«, forderte er die anderen auf, bevor er verschwand.
Duval beobachtete, wie Simmrock Lukovic folgte. Er beugte sich zu Tyler hinab und löste dessen Fesseln.
»Komm, mein alter Zellengenosse«, raunte Duval Tyler zu. »Die Freiheit winkt.«
»Ich habe nur noch ein paar Monate«, erwiderte Tyler und fasste sich erneut an den Hinterkopf. »Außerdem hat es mich erwischt. Wenn du verschwinden willst, dann lass dich nicht aufhalten. Geh, ich bleibe hier.«
Duval lächelte. »Ich lass dich doch nicht so einfach zurück, wir gehen gemeinsam oder wir bleiben beide hier.«
Tyler schüttelte den Kopf. »Du hast noch fünfzehn Jahre vor dir«, entgegnete er. »Ich werde in acht Monaten entlassen.«
Duval schüttelte den Kopf und zeigte auf den erschossenen Wachmann. »Wenn wir verschwinden, dann werden sie dir die Sache in die Schuhe schieben. Sie brauchen einen Schuldigen. Und du weißt, die nehmen jeden, den sie gerade kriegen können.«
Tyler richtete sich auf. Sein Kopf schmerzte. Draußen war das Geheul einer Sirene zu hören. Noch war das Signal weit entfernt, doch es näherte sich unaufhaltsam.
»Komm jetzt!«, drängte Duval.
Tyler überlegte kurz, schließlich nickte er.
»So eine gottverdammte Scheiße«, fluchte er, als er sich zusammen mit Duval durch die zerborstene Frontscheibe hangelte.
*
»Dan Lukovic, Martin Simmrock, Frank Duval und Wesley Tyler«, sagte der Offizier in der Uniform des Cedar Junction Department of Corrections. Walt Jenkins war der diensthabende Wachgruppenleiter in Cedar Junction und unmittelbar nach der Meldung des Unfalls an das örtliche Police Department über den Sachverhalt informiert worden.
»Lauter schwere Jungs«, antwortete der Sheriff.
»Drei davon«, versetzte Jenkins. »Es wundert mich, dass Tyler mit von der Partie ist. Er hatte nur noch acht Monate. Wie ist das passiert?«
Der Sheriff wies auf die abgesperrte Straße. Die Rotlichter der Streifenwagen zuckten in den morgendlichen Himmel. Polizisten des Norfolk Sheriff Departments zeichneten Spuren an und fotografierten die Unfallstelle. Rechts der Straße lag der grüne Bus unterhalb einer knapp drei Meter hohen Böschung, und auf der gegenüberliegenden Seite stand ein vollkommen zerbeulter Dodge Ram.
»Der Kerl mit dem Dodge kam aus dem Feldweg«, erklärte der Sheriff. »Er hat den Bus in voller Fahrt gerammt. Ist nur leicht verletzt, aber vollkommen stoned. Er sitzt bei uns in der Zelle. Ist ein Typ aus Walpole, ein Junkie. Wir kennen ihn und haben ihn schon ein paar Mal hopsgenommen.«
»Dann war das also ein Unfall«, überlegte Jenkins laut.
»Ein Unfall«, fuhr der Sheriff fort. »Aber das, was danach geschah, war kaltblütiger Mord. Einer der Wachmänner wurde von vier Kugeln getroffen. Eine Kugel haben sie ihm in den Kopf gejagt. Der Coroner meint, die Waffe wurde aus nächster Nähe abgefeuert. Wir haben die US-Marshalls in Boston verständigt. Müssten eigentlich schon längst hier sein«.
»Und die Gefangenen?«
»Die sind längst über alle Berge. Wir haben die Anwohner befragt. Sie sind einer nach dem anderen aus dem Bus gekrochen und haben das Weite gesucht. Der Erste soll ein hellhäutiger Glatzkopf gewesen sein, hielt eine Waffe in der Hand, da haben sich die Leute wieder in ihre Häuser verkrümelt. War wohl auch besser so.«
»Ein hellhäutiger Glatzkopf«, wiederholte Jenkins.
»So hat ihn der alte Mann aus dem Haus gegenüber beschrieben«, bestätigte der Sheriff.
»Das muss Lukovic gewesen sein. Ein ganz übler Bursche. Hat drei Menschenleben auf seinem Gewissen. Ihm würde ich zutrauen, dass er einen Wehrlosen einfach so hinrichtet.«
»Ihr zweiter Officer hat sich wohl beim Unfall das Genick gebrochen, und der Fahrer schwebt ebenfalls in Lebensgefahr. Die Fahndung läuft, wir warten noch auf einen Hubschrauber aus Boston.«
Jenkins schaute auf seine Armbanduhr. Der Sheriff bemerkte seinen Blick.
»Vierzig Minuten Vorsprung«, sagte er. »Sie haben sich getrennt. Die beiden Letzten, ein älterer Kerl mit grauen Haaren und ein junger, dunkelhaariger Typ mit auffallend dunklem Teint, sind zusammen in Richtung Süden geflüchtet. Der Jüngere hat den Älteren gestützt. Vielleicht kommen die beiden nicht weit, der Alte ist verletzt.«
»Das müssen Tyler und Duval gewesen sein«, erklärte Jenkins. »Sie sitzen seit ein paar Jahren in der gleichen Zelle. Die beiden sind wie Vater und Sohn. Wir müssen die Suche auf Lukovic und Simmrock konzentrieren. Wenn Lukovic im Besitz einer Waffe ist, dann hinterlässt er eine blutige Spur auf seiner Flucht. Der Kerl ist ein Psychopath. Und Simmrock ist nicht weniger gefährlich.«
Der Lärm eines Hubschraubers übertönte das Gespräch. Der Sheriff hielt seinen Hut fest, als der Jet Ranger mit dem Wappen des US-Marshall-Büros in der Nähe auf einer Wiese aufsetzte. Noch während der Rotor sich drehte, stieg ein dunkelhäutiger Riese mit der Figur eines Preisboxers aus. Die schwarzen Haare waren kurz geschnitten und erinnerten an die Frisur eines Marineinfanteristen. Der elegante Anzug saß perfekt, und die dunkle Krawatte lag korrekt in der Kragenmitte, als wäre sie mit einem Lot ausgerichtet worden. Ihm folgte das krasse Gegenteil: Den Kragen des Hemdes halb geöffnet und mit einem alten, abgewetzten dunkelgrauen Zweireiher bekleidet, stolperte ein untersetzter Mann mit schwammiger Figur seinem um einen halben Kopf größeren Kollegen hinterher. Vor Jenkins und dem Sheriff blieben die beiden stehen. Der Große streckte die Hand aus. »Mein Name ist Noah Fleischman, und das ist mein Kollege Rodger Donovan. Wir übernehmen ab jetzt. Weisen Sie uns bitte in die Lage ein, Sheriff!«
Donovan nickte stumm, kaute auf einem Kaugummi und präsentierte seinen Dienstausweis, der ihn als US-Marshall legitimierte.
»Gut, dass Sie endlich hier sind«, mischte sich Jenkins ein. »Das sind verdammt gefährliche Gewaltverbrecher, die jetzt in dieser Gegend unterwegs sind. Wir müssen uns vorsehen, sie sind zu allem fähig und außerdem bewaffnet. Die Presse wird uns zerreißen, wenn die Kerle durchdrehen.«
»Die Presse ist Ihr Problem«, entgegnete Noah Fleischman kühl. »Wir fangen sie nur wieder ein. Tot oder lebendig.«
1
The Village, Hell’s Kitchen Island, Maine,
12. März 2007, 16.35 Uhr (Montag)
Hell’s End, die einzige Bar in der einzigen Ortschaft von Hell’s Kitchen Island, hieß deshalb Hell’s End, weil sie tatsächlich am nördlichsten Ende von The Village lag. Dabei hatte die kleine Bar nicht das Geringste mit der Hölle zu tun, ganz im Gegenteil. Für die Bewohner von Hell’s Kitchen Island war sie so etwas wie eine Zuflucht, um zumindest für eine Weile dem kargen und windgepeitschten Leben auf der Insel vor der Küste von Maine zu entfliehen. Hier versammelten sich die Einwohner des Dorfes am Südufer des Hell’s Cove, um miteinander zu reden, ein paar Pint zu trinken und ihre abgeschlossene Gemeinschaft zu pflegen. Denn das Festland war beinahe zwanzig Meilen entfernt.
Hell’s Kitchen, inmitten des Golfs von Maine, war eine von beinahe fünfhundert Inseln, die sich um die Küste des Bundesstaates schmiegten, wie die Perlen einer Kette um den Hals einer wunderschönen Frau. Rund vier Dutzend Menschen lebten hier. Einige im Dorf, das den einfallslosen Namen The Village trug, andere auf den grasbewachsenen Hochebenen des Verdana Uplands oder der Steilküste am Western Peak. Früher, als die Atlantic Seafood Inc. noch existierte und frischer Meeresfisch in den großen und mittlerweile maroden Hallen am New Haven zerteilt, ausgenommen und filetiert wurde, lebten auf der Insel beinahe dreimal so viele Menschen wie heute. Doch das war Jahre her, und nur der verblasste, bläulich schimmernde Schriftzug an den verfallenen Mauern der Fabrikhallen erinnerte noch an die Zeit, als auf Hell’s Kitchen Island die Fangschiffe der nördlichen Atlantikflotte ihre Ladung löschten.
Neunundvierzig Bewohner waren in dem Melderegister der Insel im Village verzeichnet. Dazu kamen noch die vier Mönche, die das alte Kloster Saint Benedictus am Violent Beach im Norden bewohnten. Jedoch grasten beinahe dreitausend Schafe auf der Hochebene des Verdana Uplands. Zwei Familien beherrschten seit Generationen schon das Grasland im Osten bis zu den steilen Felsen des Northern Face. Die Breeds, auf Peterson Grange im Norden, waren sehr gläubige Menschen. Eine Großfamilie, die vor zweihundert Jahren aus England nach Amerika ausgewandert war und dem Quäkertum angehörte. Im Südosten lebten die Bratts, die auf der Sunlight Grange residierten und ebenfalls seit mehreren Generationen Schafe züchteten. Niemand wusste genau, wo der Ursprung der Familienfehde zwischen den beiden Schäferdynastien lag und wie lange die Feindschaft der Familien bereits andauerte, doch wusste jedermann auf dieser Insel, dass sich die Breeds und die Bratts nicht ausstehen konnten.
Zu den Stammgästen im Hell’s End gehörte Kenny Logan, der den einzigen Laden auf der Insel betrieb, in dem man von Lebensmitteln über Stoffe, Nadel und Faden bis hin zu Pastellfarben und Pinseln alles erwerben konnte, was rechtzeitig bestellt worden war. Als er sich gerade an der Theke zwischen den beiden Fischern Henry Phelps und William Evans niedergelassen hatte und sehnsüchtig auf sein Bier wartete, das Mia Honeywell, die Betreiberin der Bar, für ihn zapfte, flog die Tür auf. Ein Schwall Regen, durchsetzt vom eisigen Windhauch des seit Tagen tobenden Sturms, drang zusammen mit dem alten Joshua Breed in die mollige, warme Idylle aus dunklem Eichenholz. Joshua Breed schob mit seinen Stiefeln die Tür zu, nahm seinen Südwester ab und schüttelte das Wasser achtlos auf die hölzernen, dunklen Bohlen des Fußbodens.
»Hier sitzt er und hält Maulaffen feil, während die Rattenbrut der Bratts die gesamte Insel verwüstet«, polterte der alte Breed los, trat an den Tresen heran und warf dem verblüfft dreinschauenden Kenny Logan eine Kette vor die Füße.
Logan sprang erschrocken von seinem Stuhl auf und starrte auf die metallenen Glieder, von denen eines in der Mitte aufgesägt war.
»Was soll das, Josh!«, maßregelte Mia Honeywell den triefenden Gast.
»Seit Stunden bin ich auf der Suche nach ihm«, versetzte Joshua Breed und zielte mit seinem nassen Zeigefinger auf Logan, als wolle er ihn damit durchbohren. »Das ist ihr Werk. Nichts ist ihnen heilig, an allem vergreifen sie sich, diese Ratten und ihre dahergelaufenen Vagabunden.«
Kenny Logan, der vor zwei Jahren von den Bewohnern zum Master of the Island gewählt worden war, was in etwa dem Amt eines Bürgermeisters entsprach, bückte sich und hob die nasse und kalte Kette auf. Eingehend betrachtete er das aufgesägte Glied. »Ich habe dir schon ein paar Mal erklärt, dass die Schutzhütten auf dem Verdana Upland für alle Schäfer zugänglich sind. Für deine Jungs ebenso wie für die der Bratts. Du hast kein Recht, die Hütten mit einer Kette zu verschließen.«
»Ich habe die Hütte am Sandfort mit eigenen Händen wieder aufgebaut, nachdem sie der Wind im letzten Jahr umgerissen hat«, protestierte Joshua Breed lauthals. »Und da soll ich kein Recht haben, mein Eigentum zu schützen?«
Logan warf die Kette auf den Tresen. »Ich bin der Master auf der Insel, und ich alleine übe hier die Polizeigewalt in Vertretung des Portland Police Department aus. Du hast kein Recht, die Schutzhütten für dich alleine zu beanspruchen. Diese Hütten wurden vor mehr als hundert Jahren erbaut und stehen jedem Schäfer offen, der auf der Ebene seine Schafe hütet und vor dem Wetter Zuflucht sucht. So ist es festgeschrieben in den Verordnungen. Die Hütten und die Weiden sind frei und stehen allen zu. Wenn ich noch einmal erfahre, dass du vor den Eingang eine Kette legst, dann werde ich ein Ordnungsgeld gegen dich verhängen.«
»Und was ist mit meinem Stall und mit der Scheune am Poundrell Spring?«, widersprach Joshua Breed. »Gehört das auch jedem hier auf der Insel, obwohl ich sie im Schweiße meines Angesichts mit meinem eigenen Holz erbaut habe?«
»Das ist etwas anderes.«
»Die Rattenbrut ist dort eingedrungen und hat den gesamten Boden umgegraben. Soll ich das etwa auch dulden?«
»Ich sagte doch, das ist etwas anderes und war außerdem im letzten Jahr. Ich habe den Täter noch nicht ermitteln können, es ist nicht sicher, dass es Otis oder seine Männer waren.«
»Hier an diesem Ort der Sünde bei Braten und Bier wirst du ihn auch niemals finden. Es war diese Rattenbrut, wer denn sonst. Ich will …«
Logan hob abwehrend die Hände. »Ich sagte, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch bei den Bratts wurde eingebrochen und in die Henderson-Villa ebenfalls. Dennoch hast du kein Recht, die Schutzhütten abzusperren. Wenn du das noch einmal tust, dann wird es dich eine Kleinigkeit kosten.«
»Ha, du willst mir drohen, das kannst du nicht. Jedermann hat das Recht in diesem Land, sein Eigentum zu schützen. Und du kannst mir dieses Anrecht nicht nehmen.«
Logan schüttelte den Kopf. »Ich bin der Master der Insel und der Richter in Yarmouth wird dir schon zeigen, welches Recht ich habe.«
Joshua Breed trat einen Schritt vor und griff nach seiner Kette. »Und ich habe dich nicht gewählt, weil du zu weich bist«, zischte er, ehe er seinen Südwester wieder aufsetzte und eilends hinaus in den Sturm verschwand.
Mia stellte das Bierglas vor Kenny Logan auf den Tresen. »Dieser verbohrte alte Mann«, bemerkte sie. »Führt sich auf wie die Axt im Walde.«
»Was ist denn überhaupt in ihn gefahren?«, fragte William Evans.
Logan zuckte mit der Schulter. »Ich sage euch, wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich da einlasse, dann hätte ich mich nie zur Wahl gestellt. Gestern war Otis bei mir und beschwerte sich darüber, dass Josh die Schutzhütten auf dem Verdana Upland mit Ketten sichert, damit seine Jungs bei diesem Sauwetter draußen auf der Weide bleiben müssen. Ich habe ihm geraten, sie einfach aufzubrechen. Diese beiden Gipsköpfe werden sich wohl nie ändern.«
Henry Phelps grinste. »Die Breeds und die Bratts, die sind wie Feuer und Wasser. Und das wird immer so bleiben.«
Logan griff nach seinem Bier und nahm einen kräftigen Schluck. »Na ja«, seufzte er. »Wir können froh sein, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen. Aber komisch ist es schon. Ich möchte wirklich zu gerne wissen, wer damals in die Scheune und die Villa eingebrochen ist und warum er diese Löcher im Boden hinterließ.«
»Du hättest die Polizei aus Yarmouth holen sollen«, sagte Mia beiläufig, während sie ein gespültes Bierglas abtrocknete.
»Ich habe sie informiert, aber sie hatten kein Interesse«, entgegnete Logan. »Sie behaupteten, solange nichts weggekommen ist, liegt nur ein Hausfriedensbruch vor, und deswegen kommt kein Detective auf die Insel. Da muss schon bedeutend mehr passieren.«
Henry Phelps warf einen Dollar auf den Tresen und schaute auf die Uhr über den Spiegeln. »Es ist Zeit für mich«, sagte er.
»Was willst du tun?«, fragte Evans. »Dieser verdammte Sturm wird noch eine ganze Weile hier wüten, vor nächster Woche können wir nicht hinaus.« Wie zur Bestätigung erhellte ein Blitz die kleine Bar am Ende des Village. Der Donner grollte. »Im Radio wird in einer Stunde eine Krimilesung gesendet«, verabschiedete sich Phelps und warf seinen Mantel über. »Das will ich nicht versäumen. Ich liebe Krimis.«
Americana Motel, Old Orchad Beach, Maine,
12. März 2007, 17.40 Uhr (Montag)
Die Vorhänge in dem kleinen Apartment des Americana Motel in Old Orchad waren zugezogen und hielten das Licht der untergehenden Sonne draußen zurück. Die bedrückende Stille wurde durch die schweren Atemzüge von Wesley Tyler unterbrochen, der mit schmerzhaft verzerrtem Gesicht auf dem Bett lag und die Arme vor seinem muskulösen Bauch verschränkt hatte.
Tyler hatte bislang wenig Glück in seinem Leben. Er war kaum geboren, als sein Vater, der sich mehr schlecht als recht mit kleinen Diebereien und Einbrüchen über Wasser hielt, nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft von einer Polizeikugel getroffen wurde und mitten in einem Abfallcontainer zwischen matschigen Tomaten und verfaultem Obst sein Leben aushauchte. Kaum drei Jahre später, seine Mutter hatte ihm ein Dreirad zum Geburtstag geschenkt, wurde ihm eine abschüssige Straße zum Verhängnis, die ihn direkt unter die Hinterachse eines Kleinlasters führte. Mehrere Knochenbrüche, einen Milzriss und einen Schädelbruch trug er von der Begegnung mit dem harten Stahl des Lasters davon, doch zumindest hatte er überlebt. Schlimm erging es ihm, als seine Mutter einen wesentlich älteren Mann kennenlernte und nur ein paar Wochen später ehelichte, denn der neue Vater hielt nicht viel von ihm und ließ ihn seine Abneigung auch deutlich spüren. Die Schule war ein notwendiges Übel, und so trieb er sich die meiste Zeit am Hafen und in der Stadt herum, anstatt die Schulbank zu drücken. Als er acht Jahre alt war, lernte er seinen drei Jahre älteren Stiefbruder kennen, der nach dem Tod der leiblichen Mutter vom Stiefvater ins Haus geholt wurde.
Mehr als einmal lief Wesley Tyler von zu Hause weg, doch immer wieder wurde er von der Polizei nach Hause gebracht, wo ihn sein Stiefvater windelweich prügelte und seine Mutter tatenlos zusah. Nur sein neu gewonnener und anfänglich mit Verachtung gestrafter Stiefbruder hielt in dieser Zeit zu ihm. Trotz der Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelte, geriet Tyler auf die schiefe Bahn. Seine erste Haftstrafe saß er mit vierzehn in einer Besserungsanstalt ab, weil er bei einem nächtlichen Besuch in einem Supermarkt mit seinen Stiefeln in einem Sicherungsgitter eines Kellerschachtes hängen blieb und erst von den heraneilenden Polizeibeamten befreit werden konnte. Doch dabei sollte es nicht bleiben.
Am 19. Oktober 1987, Tyler war neunundzwanzig Jahre alt und hatte inzwischen sieben Jahre seines Lebens in verschiedenen Haftanstalten zugebracht, überfiel er in der Nähe von Duxbury nahe Boston zusammen mit mehreren Komplizen einen Goldtransport. Zunächst lief alles nach Plan, doch dann ging der Überfall gründlich schief. Zwei Wachmänner kamen dabei ums Leben, und an den Goldbarren im Wert von dreißig Millionen Dollar hatten er und seine Helfershelfer nur kurze Zeit Freude, denn zwei Wochen später klickten nahe Brunswick die Handschellen, und der Traum von einem Leben im Luxus irgendwo in der Karibik zerplatzte wie eine Seifenblase. Die Richter gingen nicht zimperlich mit ihm um. Zwei Tote und dreißig Millionen in Gold, die spurlos verschwunden waren, brachten ihm eine hohe Haftstrafe ein. Zwanzig Jahre verbrachte er im Zuchthaus von Cedar Junction, und nun, als er kurz vor seiner Entlassung stand, passierte dieser verdammte Unfall mit dem Gefängnisbus. Jetzt war er wieder vor der Polizei auf der Flucht, denn die anderen Mitgefangenen waren durchgedreht und hatten die Wachen einfach erschossen. Er wusste, dass ihm niemand geglaubt hätte, wäre er zurückgeblieben. Ein halbes Jahr, ein gottverdammtes halbes Jahr, und er hätte seine Strafe abgesessen und Cedar Junction als freier Mann verlassen können.
Diese infernalischen Schmerzen in seinem Bauch raubten ihm den Verstand. Wahrscheinlich waren mehrere Rippen gebrochen, und hätte Frank Duval, sein langjähriger Zellengenosse, ihn einfach an der Unfallstelle zurückgelassen, so würde er längst wieder in Cedar Junction sitzen und auf seinen neuen Prozess warten. Immerhin war er bei der Flucht und bei den Morden an den Wachmännern dabei gewesen. Und bei seiner Vergangenheit würde ihm niemand glauben, dass er unschuldig am Tod der Wachleute war.
Frank Duval war beinahe zwölf Jahre jünger als Tyler und stammte aus Boston, wo er geboren und auch aufgewachsen war, bis man ihn auf Nantucket Island nach einem Raub mit Todesfolge auf einen Geldboten verhaftete und nach Cedar Junction gesteckt hatte. Fünfundvierzig Jahre sollte er dort auf die Freiheit warten. Mit Tyler teilte er sich eine Zelle und der brummige, aber gutmütige Mann aus Maine wurde für ihn nach anfänglichen Startschwierigkeiten zu einem väterlichen Freund, der ihn vor den reißenden Wölfen im Knast bewahrte. Auch wenn Tyler nicht zu den durchgeknalltesten und gefährlichsten Knastis in Cedar Junction gehörte, so hatte er sich dennoch einen hohen Rang erdient, der ihn nahezu unantastbar machte. Und dabei war er nicht einmal brutal oder aggressiv, nein, im Gegenteil, Wesley Tyler war eher ein ruhiger und fügsamer Gefangener, der den Rest der Meute ignorierte und der sich aus allen Konflikten heraushielt. Vielleicht lag sein Standing innerhalb der Knastgesellschaft einfach nur daran, dass man hinter seinem Rücken munkelte, er sei noch immer im Besitz von dreißig Millionen in Gold. Duval hatte zweifellos von seinem väterlichen Freund im Knast profitiert. Auch er wurde von den unterschiedlichen Gruppen, die sich in dem Mikrokosmos hinter Gittern gebildet hatten, weitestgehend in Ruhe gelassen.
Freundschaft gepaart mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit waren es gewesen, die Frank Duval dazu veranlasst hatten, den schwer verletzten Kumpel nicht einfach in seinem Schicksal zurückzulassen. Gemeinsam hatten sie sich bis ans Ende von Walepole durchgeschlagen, wo sie in ein Ferienhaus einbrachen, das offenbar seit längerer Zeit nicht mehr genutzt worden war. Und diesmal stand Tyler entgegen seiner sonstigen Erfahrung das Glück zur Seite, denn neben reichlich passenden Klamotten fanden sie einen Führerschein mit einem Passbild, das Duval sehr ähnlich war, ein paar Dollar Münzgeld und die Schlüssel eines Ford Pinto, der mit halbvollem Tank in der Garage stand.
Unbehelligt waren sie bis nach Old Orchad Beach gefahren und hatten sich in das Motel eingemietet, in dem sie die Nacht und den darauffolgenden Tag verbrachten.
»Wenn es dir morgen nicht besser geht, dann werde ich irgendwo einen Arzt auftreiben«, sagte Duval, nachdem die schweren Atemzüge Tylers in ein rasselndes Stöhnen übergingen. Er saß am Fenster und spähte durch den schmalen Schlitz des Vorhangs hinaus auf den Parkplatz des Motels.
»Es geht schon«, stammelte Tyler. »Meine Rippen sind gebrochen, das schmerzt höllisch, aber ich werde es überleben.«
Duval erhob sich von seinem Stuhl und trat neben das Bett. Er schenkte ein Glas Wasser ein und nahm drei Aspirin aus der Packung, die er auf dem Weg in einer Drogerie besorgt hatte. Er wartete, bis sich die Tabletten im Wasser auflösten, beugte sich zu dem Verletzten hinab und hob vorsichtig seinen Kopf an.
»Was ist das?«, fragte Tyler.
»Gegen die Schmerzen«, antwortete Duval und hielt das Glas an Tylers Lippen.
U.S.-Marshall Service, District Headquarters, Boston,
12. März 2007, 17.55 Uhr (Montag)
An der Wand im Büro der US-Marshalls standen zwei hölzerne Stellwände, an denen Bilder, Notizen und Vergrößerungen von Aktenauszügen aus den Strafakten der Flüchtigen scheinbar chaotisch, jedoch für Rodger Donovan in einer eigenen, durchschaubaren Ordnung mit kleinen Reißnägeln festgemacht waren. Auf einem daneben stehenden Flipchart hatte er mit rotem Filzstift die Städte markiert, aus denen Lukovic, Simmrock, Duval und Tyler stammten.
Mittlerweile hatte er die Akten der Ausbrecher auf das Gründlichste studiert. Nur wenn man genau wusste, hinter wem man eigentlich her war, konnte man wissen, wo man nach seiner Zielperson suchen musste. Rodger Donovan war ein kühler und überlegter Pragmatiker, ganz im Gegensatz zu seinem impulsiven und zuweilen ungestümen dunkelhäutigen Kollegen Noah Fleischman, der die Akademie in Westpoint genossen und nach seiner Zeit als Armyoffizier den Posten des US-Marshalls angetreten hatte. Er selbst hingegen hatte sein halbes Leben in den neonbeleuchteten Büros des taktischen Planungsstabes der NSA am Computer mit der Auswertung von Daten zugebracht und nur in den Mittagspausen oder nach Feierabend das pulsierende Leben auf der Straße erlebt. Vielleicht waren sie genau wegen dieser Gegensätzlichkeit zu einem unschlagbaren Team zusammengewachsen.
»Sie haben sich getrennt«, murmelte Donovan. »Es gibt nichts, was die vier miteinander verbindet, außer dass sie zufällig im selben Bus saßen.«
Noah Fleischman betrachtete beiläufig das Foto von Wesley Tyler. »Er wäre in einem halben Jahr freigekommen«, murmelte er. »Was hat ihn dazu bewogen, sich an der Flucht zu beteiligen?«
»Es war keine geplante Flucht«, erklärte Donovan. »Durch den Unfall ergab sich die Gelegenheit. Ich nehme an, Tyler ist nur abgehauen, weil der Wachmann erschossen wurde. Ich denke, er hat sich ausgerechnet, dass er einen schlechten Stand hat, wenn er einfach im Bus zurückbleibt. Außerdem scheint er so etwas wie eine väterliche Beziehung zu Duval zu haben. Vielleicht hat Duval Tyler zur Flucht überredet.«
Die Tür wurde aufgestoßen und Carter betrat den Raum. Eilends ging er zu der Stellwand, an der eine große Landkarte des Distrikts hing, und steckte, nachdem er einige Sekunden gesucht hatte, eine rote Markierungsnadel in die Karte. Die Nadel steckte kaum zwei Zentimeter von der Stelle entfernt, an der sich der Unfall mit dem Bus ereignet hatte.
»Von einem Parkplatz in der Summer Street wurde ein Wagen gestohlen«, berichtete er und nahm seine Brille von der Nase. »Ein roter Mazda mit Bostoner Zulassung. Ich habe die Beschreibung und das Kennzeichen an die Straßensperren durchgegeben.«
Fleischman warf Tylers Bild auf den Schreibtisch und blickte auf die Uhr. »Das erste Lebenszeichen.«
»Hat jemand etwas gesehen, und wie lange fehlt der Wagen schon?«, fragte Donovan.
Carter setzte seine Lesebrille auf und nahm das Fax zur Hand. »Der Wagen gehört der Angestellten einer Firma in der Summer Street. Sie hat gearbeitet und den Diebstahl erst nach Feierabend bemerkt. Geparkt hatte sie ihn sechs Stunden zuvor.«
»Dann könnten die Kerle maximal sechs Stunden Vorsprung haben«, sagte Fleischman, erhob sich von seinem Stuhl und trat vor die Karte.
»Es wäre aufgefallen, wenn sie versucht hätten, eine Straßensperre zu passieren. Vier Mann im Wagen, da würde doch der dümmste Cop hellhörig.«
Donovan erhob sich und stupste Carter an der Schulter. »Wer sagt denn, dass sie noch zusammen sind? Ich bin mir sicher, dass sich Tyler und Duval abgesetzt haben.«
»Wie kommst du darauf?«
»Ich habe ihre Akten gelesen. Lukovic ist ein Psychopath und ein eiskalter Mörder, der als Geldeintreiber für eine örtliche Mafiagröße in Philadelphia gearbeitet hat. Und Simmrock ist ein durchgeknallter Junkie. Ich glaube nicht, dass sich Tyler mit ihnen einlässt. Und Duval hält sich mit Sicherheit an seinen großen Bruder. Ich bin felsenfest davon überzeugt, sie haben sich getrennt. Der alte Mann, der die Flüchtigen gesehen hat, sagte selbst, dass die beiden ersten Gefangenen in eine andere Richtung davonrannten als die beiden nachfolgenden.«
Fleischman trat vor die Stellwand und wies auf das Bild von Dan Lukovic. »Er wird versuchen, sich nach Philadelphia durchzuschlagen, dort hat er Freunde, die ihm weiterhelfen könnten.«
»Simmrock hat keine Wurzeln, er wird sich an Lukovics Fersen heften.«
Es klopfte an der Tür.
»Ja!«
Magret Mcpherson, die Sekretärin, die alle nur Macphie nannten, öffnete die Tür. »Sheriff Jenkins erwartet unseren Rückruf. Er will wissen, wie lange er die Straßensperren noch aufrechterhalten soll. Er sagt, die Kerle sind doch längst über alle Berge.«
»Klugscheißer«, entgegnete Carter.
»Danke, Macphie, ich rede mit ihm«, gab Donovan zurück. »Ich denke, Noah hat recht, wir konzentrieren uns auf Philadelphia. Lukovic wird früher oder später dort auftauchen. Die Chancen, dass sich Tyler selbst stellt, sind groß. Nach Einschätzung des Gefängnispsychologen ist er nicht gewalttätig.«
2
Verdana Upland, Hell’s Kitchen Island, Maine,
13. März 2007, 02.35 Uhr (Dienstag)
Seit sieben Tagen regnete und stürmte es beinahe ununterbrochen. Die Frühjahrsstürme in diesem Jahr waren die heftigsten und längsten, die Malcom Hurst je auf dieser Insel erlebt hatte, und dabei arbeitete er bereits seit unzähligen Jahren als Schafhirte bei den Bratts.
Dicht an dicht standen die Schafe mit ihrem triefenden Wollfell aneinandergereiht in der Koppel unweit der Northern-Trail-Schutzhütte, in der Malcom vor dem beginnenden Unwetter Schutz gesucht hatte. Die Herde war unruhig. Als es vor einer Stunde zu donnern begonnen hatte, trieb er die Schafe zusammen mit Puky und Chivas, den beiden English Shepherd-Hunden, in das Gatter. Normalerweise grasten die Schafe Tag und Nacht auf den Hochflächen des Verdana Uplands. Doch bei solch einem Unwetter war es an den steilen Klippen des Northern Trails sicherer, die Herde in die einfachen Gatter aus Rundbalken unweit der Schutzhütte zu sperren. Vor beinahe zehn Jahren war eine durch ein Unwetter in Panik geratene Herde über die Klippen in den Tod gestürzt. Beinahe zweihundert Schafe mussten die Bratts damals abschreiben. Seit diesem Tag gab es die Anweisung an die Hirten, die Tiere bei Unwetter in die Einfriedung zu treiben. Hurst hatte sich die gelbe Öljacke angezogen und den Südwester aufgesetzt, dennoch war er durchnässt bis auf die Haut, ehe er zu seiner Schutzhütte zurückkehrte. Der böige Wind wehte den salzigen Duft des Atlantiks über die Wiesen des Hochlandes, und ein greller Blitz erhellte die Nacht. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, befreite er sich von der nassen Kleidung. Es war lange her, als er das letzte Mal dermaßen getrieft hatte. Damals arbeitete er noch für die Atlantic Seafood Inc. und fuhr auf einem der Trawler hinaus in den Golf, wo es vor Fischen nur so wimmelte. Nach einer Woche harter Arbeit an Bord, mit aufgerissenen Händen und durchweichter Haut, waren sie nach Hell’s Kitchen zurückgekehrt, die Laderäume prall gefüllt mit Fisch. Egon Henderson, der Besitzer von Atlantic Seafood, bezahlte eher schlecht als recht, doch als die riesigen Fabrikschiffe die Häfen der großen Städte im Osten verließen und mit ihren Schleppnetzen die Fanggründe entlang der Ostküste bis hinauf an die Hudson Bai leerfischten, war die Zeit der Trawler vorbei. Henderson schloss seine Fischfabrik auf der Insel und verkaufte die Schiffe, ehe er kaum ein Jahr später starb. Malcom blieb auf der Insel, so wie die meisten, die für Henderson gearbeitet hatten. Schafwolle war damals sehr begehrt und Otis Bratt suchte Hirten und Wollscherer, die seine beinahe zweitausend Tiere zählende Herde hüteten. Malcom ließ sich nicht zweimal bitten. Zwar hatte er einen gehörigen Teil seines Geldes, das er im mühevollen Akkord bei Henderson und der Atlantic Seafood verdient hatte, gut verzinst angelegt, doch noch liefen die Verträge, und die Auszahlung ließ noch ein ganzes Jahr auf sich warten. Weniger als die Hälfte an Salär brachte der neue Job als Schäfer ein, dafür waren die Mahlzeiten frei, und er konnte auf der Insel bleiben, auf der er geboren und aufgewachsen war. Nun war er bald sechzig und dies sollte seine letzte Saison auf den Weiden des Verdana Uplands werden, ehe er sich endgültig zur Ruhe setzte.
Er entzündete das Feuer des kleinen Ofens, und als sich langsam eine mollige Wärme ausbreitete, setzte er sich auf das Feldbett und trocknete seine Haare mit einem Handtuch. Chivas warf ihm einen treuherzigen Blick zu, ehe er sich neben dem Ofen auf einer Decke niederließ.
»Dieses elende Sauwetter«, murmelte er. »Seit Tagen regnet und stürmt es. Es scheint, als hat uns die Sonne einfach vergessen, mein Guter.«
Chivas öffnete sein Maul und gähnte, während Puky mit lang ausgestreckten Gliedern vor der Tür lag und die Augen geschlossen hatte.
»Schlaf jetzt, mein Bester«, sagte er zu dem braun-weiß gefleckten Hund vor seinen Füßen. Er warf das Handtuch auf den Stuhl neben den Tisch und legte sich mit einem Seufzer auf das Feldbett. Er lag kaum eine Minute, als sich Puky aufrichtete und lauthals zu bellen begann. Mit seinen Pfoten schabte der schwarze Shepherd an der Tür. Auch Chivas sprang auf und huschte zur Tür, um lauthals zu bellen und zu knurren.
Hurst fuhr auf. »Was zum Teufel … was ist in euch gefahren?«
Er erhob sich, warf sich die Jacke über und griff nach dem Gewehr in der Ecke. Auf der Insel gab es nur wenige natürliche Feinde, die in der Lage waren, ein Lamm zu reißen. Ein paar Füchse, die bei Tender Hollow hausten, und einen Adler, der ab und zu über der Insel durch die Lüfte streifte. Aber die ausgewachsenen Schafe hatten nur den Metzger zu fürchten, der ab und zu ein paar Schafe zur Schlachtbank führte. Es gab weder Bären noch Luchse und auch keine Wölfe auf der Insel, dafür hatten die Bratts und auch die Breeds gesorgt. Der letzte Luchs war vor über einhundert Jahren geschossen worden.
Die Hunde vollführten ein Spektakel, bellten, knurrten und schabten an der Tür, als ob der Teufel höchstpersönlich draußen auf sie wartete.
»Beruhigt euch!«, befahl Hurst, doch die Tiere waren panisch vor Erregung. Ein grollender Donner erschütterte die Nacht. Malcom trat an das kleine Fenster neben der Tür und warf einen Blick hinaus in die Dunkelheit. Nichts als Finsternis war zu erkennen. Plötzlich zuckte ein Blitz vom Himmel und tauchte das Grasland in eine grelle Helligkeit. Er fuhr zusammen, als er die Gestalt erkannte, die keine drei Meter von der Hütte entfernt stand und auf die Tür starrte. Sein Atem stockte. Der Mann erschien groß wie ein Riese, trug einen dunklen Mantel und einen Südwester auf dem Kopf. In der Hand hielt er einen Haken, einen Stauerhaken, wie er an Bord eines Schiffes zum Verladen von Säcken verwendet wurde. Malcom fuhr der Schreck in die Glieder. Die Augen des Fremden schienen rot zu funkeln. Eine Gänsehaut lief über seinen Rücken, dann breitete sich die Dunkelheit der Nacht wieder aus, und ein Donnerschlag ließ die Hütte erzittern. In Windeseile verriegelte Hurst die Tür, lief zurück zu seinem Bett und holte die Taschenlampe. Als er durch das Fenster nach draußen leuchtete, war der unheimliche Fremde verschwunden, auch Chivas und Puky kamen langsam wieder zur Ruhe.
Malcom Hurst wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Gesicht war weiß wie Kalk. »Belfour, der Franzose, hilf mir Gott, er ist auf die Insel zurückgekehrt, weil ihn die unschuldigen Seelen nicht in Ruhe lassen«, murmelte er, ehe er den Tisch vor die Tür schob, sich auf das Bett setzte und das Gewehr fest an sich zog.
North Attleboro, Super 8 Motel, Maine,
13. März 2007, 07.25 Uhr (Dienstag)
Noah Fleischman zerbiss einen Fluch auf seinen Lippen. Der junge Kerl, der vor ihm hinter dem Tresen stand, machte ihn nervös. Ständig spielte er mit seinen Fingern, so als ob er sie keinen Moment stillhalten konnte.
»Ich hab es im Radio gehört«, erzählte der Portier des Super 8 Motels in North Attleboro. »Heute früh bin ich rausgegangen, da stand der rote Mazda hinter dem Haus. Mir fiel sofort auf, dass etwas nicht stimmte.«
Noah seufzte und steckte die Bilder der Gesuchten wieder zurück in seine Jackentasche. »Wie viele Gäste haben Sie derzeit?«
Der Portier wandte sich um und blickte auf das Schlüsselbrett. »Man zahlt hier im Voraus. Es haben alle ihre Schlüssel abgegeben, alle außer Mister Larkin aus 7b. Komisch ist nur, dass sein Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz steht.«
»Was für einen Wagen fuhr er denn?«, hakte Rodger Donovan nach.
»Einen grauen Buick, der stand direkt vor dem Apartment.«
Fleischman verdrehte seine Augen und trat ein Stück näher an den Tresen heran. »Lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen, die ganze Geschichte, aber plötzlich, wenn ich bitten darf!«
»Ich kann nicht viel …«
»Larkin, wann kam er, was tut er, wie sieht er aus?«, zischte Fleischman ungehalten.
»Ich … er … er kam gestern, so gegen sechs, wie jeden Montag«, stotterte der Portier. »Er steigt immer bei uns ab, wenn er seine Tour macht. Er trank ein Bier, dann ging er in sein Apartment. Normalerweise reist er ziemlich früh wieder ab. Er ist Schmuckhändler, wissen Sie. Heute Morgen, als ich die Rezeption öffnete, stand sein Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz, aber seinen Schlüssel hat er nicht abgegeben. Ich machte meine Runde und entdeckte den roten Mazda. Ich habe im Radio gehört, dass ein paar Schwerverbrecher aus Cedar Junction abgehauen und mit einem roten Mazda unterwegs sind. Dann rief ich sofort die Polizei.«
»Wie sieht Larkin aus?«
»Er ist klein, fast einen Kopf kleiner als ich, und hat eine Glatze«, erklärte der Portier.
»Haben Sie einen Blick in Larkins Zimmer geworfen?«
Der eingeschüchterte Portier schüttelte den Kopf. »Ich lass mir doch meine Birne nicht wegpusten.«
Fleischman zog seine Glock unter der Jacke hervor und überprüfte den Ladezustand.
»Willst du nicht warten, bis das Squadteam eintrifft?«, fragte Donovan.
»Wir gehen rein!«, entschied Fleischman. »Die Typen sind längst über alle Berge. Und wer hat überhaupt der Presse gesteckt, dass wir einen Mazda suchen? Ich sagte doch ausdrücklich, dass wir keine Meldung nach draußen geben.«
Donovan griff ebenfalls nach seiner Waffe. »Das kann nur der Sheriff aus Norwood gewesen sein«, erwiderte er.
»Sie bleiben hier!«, befahl Noah dem Portier, ehe sie die Rezeption verließen und sich dicht an der Wand in Richtung von Larkins Apartment schlichen. Vor der Tür verharrten sie einen Augenblick. Mit ihren Blicken verständigten sie sich, nachdem sich Donovan auf der gegenüberliegenden Seite postiert hatte. Leise zählte Fleischman von drei auf eins, bevor er mit dem Fuß gegen die Tür trat. Holz splitterte, das Schloss brach aus dem Türblatt und fiel zu Boden, ehe die Tür aufflog und gegen die Wand krachte. Sofort sprang Fleischman mit der Waffe im Anschlag ins Zimmer und stürmte nach links. Donovan folgte und schlug den Weg nach rechts ein.
»US-Marshall!«, brüllte Fleischman, doch als sein Blick auf das Bett fiel, verstummte er.
Der Mann war nackt bis auf die Unterhose. Seine Haut war bleich und hatte bereits einen bläulichen Schimmer angenommen. Ein Kissen lag quer über seinem Kopf.
Noah Fleischman wandte sich der offenen Tür zu, die zum Badezimmer führte. Kurz verschwand er darin, während Donovan an das Bett trat und das Kissen von dem Gesicht des Mannes entfernte. Er blickte in seine gebrochenen Augen.
»Ich sagte doch, die Kerle sind längst über alle Berge«, bemerkte Noah Fleischman, als er zurück in das Schlafzimmer kam.
»Das muss Larkin sein«, empfing ihn Donovan. »Die Kerle haben anscheinend alles mitgenommen, sogar seine Kleider.«
»Der Sheriff ist ein Arschloch. Ich werde ihm gehörig den Marsch blasen.«
Hell’s End Bar, Hell’s Kitchen Island, Maine,
13. März 2007, 21.35 Uhr (Dienstag)
»Und wenn ich es euch sage«, beteuerte Malcom Hurst. »Belfour, der Franzose, stand direkt vor mir, er war keine zehn Schritte entfernt. Er trug seinen schwarzen wallenden Mantel, seinen schwarzen Südwester und hielt einen Stauerhaken in seiner Hand. Und wenn ich es euch sage, seine Augen glühten wie Feuer. Ich schwöre es. Puky und Chivas sind beinahe wahnsinnig geworden.«
»Du bist wahnsinnig«, entgegnete Dan Boyd. »Belfour ist seit über zweihundert Jahren tot und längst verfault, wenn ihn nicht die Fische gefressen haben.«
»Er wurde nie gefasst und ist einfach verschwunden, wie ein Licht, das man einfach ausknipst«, fügte William Evans hinzu. »Er verschwand von der Bildfläche und wurde nie wieder gesehen.«
Henry Phelps nippte an seinem Bier. »Hat dir Otis eine Flasche von seinem selbstgemachten Brandy mitgegeben? Man sagt, der weckt sogar Tote auf.«
Gelächter breitete sich am Tresen aus. Hurst schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich habe nichts getrunken, Belfour ist aus der Hölle zurückgekehrt, und das Meer hat ihn einfach wieder ausgespuckt.«
Mia Honeywell stellte ein Bier vor Evans auf den Tresen. »Es ist kein Wunder bei diesem Wetter, dass hier langsam alle durchdrehen. Belfour hat die Freedom vor beinahe dreihundert Jahren versenkt. Aber das kommt davon, wenn der kalte Wind um eure Ohren pfeift, da friert langsam das Gehirn ein.«
»Wenn ich es dir sage«, widersprach Malcom Hurst. »Der Kerl stand vor der Hütte und wollte hinein. Wenn ich den Riegel nicht vorgeschoben hätte, dann würde ich jetzt nicht mehr leben.«
Mia lachte schnippisch, während sie mit einem feuchten Tuch die Bierränder vom Tresen wischte. »Was macht dich so sicher, dass es Belfour war? Es kann jeder hier gewesen sein, der dir einen Streich spielen wollte. Und du bist darauf hereingefallen. Und jetzt machst du dich selbst zum Affen.«
Die Anwesenden brachen in glucksendes Gelächter aus.
»Es war Belfour«, beharrte Hurst auf seiner Behauptung. »Er sah aus wie auf dem Bild, das in der Townhall hängt.«
Als die Tür zur Bar geöffnet wurde, fegte ein kalter Windstoß über die Männer am Tresen hinweg. Logan trat ein und schob die Tür wieder zu. Er entledigte sich seiner triefenden Jacke und rieb sich die kalten Hände, als er sich neben den anderen am Tresen niederließ.
»Mia, bring mir einen heißen Tee mit Rum!«, brummte er. »Dieses Scheißwetter, langsam gehen die Lebensmittel aus. Wenn wir nicht bald ans Festland kommen, dann wird es knapp. Ist Aiden hier?«
»Aiden liegt im Bett«, antwortete Mia und schaltete den Tauchsieder ein. »Er hat Grippe und fühlt sich nicht gut.«
»Kein Wunder, bei dem Wetter.«
William Evans rückte ein Stück näher. »Hast du schon gehört, Logan? Malcom ist in der Nacht am Northern Trail beinahe überfallen worden. Er glaubt, Belfour ist seinem Grab entstiegen, weil ihm die unschuldigen Seelen der Siedler keine Ruhe lassen.«
Logan grinste. »Hab schon gehört, Malcom. Du machst einigen auf der Insel Angst mit deinen Geschichten.«
Malcom Hurst hob abwehrend die Hand. »Das sind keine Geschichten.«
»Wenn uns jemand in den nächsten Tagen umbringt, dann ist es das Wetter und nicht dein erfundener Geist.«
Hurst erhob sich und trat ein Stück näher. »Ich würde gerne eure Gesichter sehen, wenn er hier durch die Tür käme. Mich jedenfalls bringt niemand mehr an den Northern Trail. Er war es sicher auch, der in die Scheune und die Villa eingebrochen ist und die Löcher in den Boden grub. Er sucht nach etwas, ohne das er nicht zur Ruhe kommt.«
Logan nippte an seinem heißen Tee. »So, er sucht also nach etwas. Und was meinst du, sucht er?«
Hurst fuhr sich mit der Zunge über seine Lippen. »Er sucht nach seinem Herzen, das ihm gestohlen wurde, denn nur dadurch ist er zu diesem herzlosen Piraten geworden, der harmlose Seeleute und Siedler abschlachtete. Und solange er sein Herz nicht gefunden hat, wird er auf dieser Insel herumspuken. Fragt den Admiral, er hat ihn im letzten Jahr am South Bench gesehen.«
Logan winkte ab. »Der Admiral hat schon oft Gespenster gesehen.«
»Und weiße Mäuse«, fügte Evans hinzu.
»Immer wenn er zu tief ins Glas geschaut hat, kommen die ungebetenen Besucher. Bald sind es rosafarbene Elefanten.«
Die Männer am Tresen brachen in lautes Gelächter aus und klopften sich auf die Schenkel.
»Ihr werdet schon sehen, wenn Belfour vor euch steht«, brummte Hurst, griff nach seinem Mantel, setzte seinen Hut auf und verschwand durch die Tür im Regen.
3
South Bench Lighthouse, Hell’s Kitchen Island, Maine,
13. März 2007, 23.20 Uhr (Dienstag)
Der Leuchtturm von South Bench stand im Südosten der Insel an der steilen Küste oberhalb der Southern Shoals und lag beinahe einhundert Meter über dem Meeresspiegel. South Bench war wohl der zugigste Ort, den es auf der Insel gab, denn beinahe das gesamte Jahr wehte der Wind vom Meer aus über das kleine Eiland. Der Leuchtturm war längst außer Betrieb gestellt, denn mittlerweile gab es GPS und Funknavigation, dennoch lebte Gabriel Jefferson zusammen mit seiner Frau Ava gerne an diesem Ort, an dem er beinahe sein gesamtes Leben zugebracht hatte.
Vor beinahe fünfzig Jahren war er zum Leuchtturmwärter auf Hell’s Kitchen Island ernannt worden, und er nahm seine Arbeit sehr ernst, denn die Untiefen und kantigen Felsen der Southern Shoals waren unzähligen Seefahrern zum Verhängnis geworden. Vor zehn Jahren war der Leuchtturm außer Dienst gestellt worden, aber Gabriel war geblieben. Nun war er vierundsiebzig und bezog eine schmale Rente, doch dafür hatte man ihm und Ava ein lebenslanges Wohnrecht im kleinen Häuschen neben dem Leuchtturm von South Bench eingeräumt, und Gabriel und Ava hatten beschlossen, an diesem Ort auch zu sterben.
Er hatte sich zusammen mit seiner Frau sein kleines Stückchen Erde unmittelbar am Abgrund liebevoll hergerichtet. Das kleine schmucke Holzhaus mit dem Schuppen in unmittelbarer Nähe zum Leuchtturm war in freundlichen, hellen Pastelltönen getüncht und ein kleiner Garten, in dem Ava Salate und Gemüse anbaute, war gegenüber dem Haus angelegt. Anfänglich waren noch ein paar versprengte Schafe in sein Reich eingedrungen und hatten sich an den frischen Kräutern gütlich getan, doch ein eilends errichteter, schmiedeeiserner Zaun hatte Schlimmeres verhindert. Im Village waren Ava und Gabriel nur selten zu sehen. Er war Leuchtturmwärter mit Leib und Seele gewesen, und er liebte es, die Einsamkeit an der unwirtlichen Steilküste am South Bench mit dem einzigen Wesen zu teilen, für das er jemals etwas empfand: mit Ava, die er bereits seit seiner Schulzeit kannte und die er schließlich in Freeport zum Altar führte, nachdem er in der Libanon-Krise als Soldat einer US-Marine-Division an der Operation Blue Bat teilgenommen hatte.
Ab und zu, wenn er Lebensmittel oder neues Material und Werkzeuge für seine Leidenschaft, der Schnitzerei, ergänzte, fuhr er mit seiner Indian Chief, Baujahr 1948, in das Dorf. Dort belud er seinen Beiwagen oder den selbst konstruierten Motorradanhänger und verschwand so schnell wieder, wie er gekommen war. So war es kein Wunder, dass er im Dorf den Ruf eines eigenbrötlerischen Sonderlings innehatte, doch das kümmerte ihn nicht. Er mochte die anderen Insulaner nicht, bis auf Joshua Breed, mit dem ihn eine entfernte Freundschaft verband.
Von ihm hatte er sich auch den Lastwagen geliehen, als er vor ein paar Jahren ein großes Holzkreuz, beinahe drei Meter hoch, direkt an der Steilküste errichtete, das in Richtung der Southern Shoals blickte und den vielen Seefahrern und Fischern gewidmet war, die in den unberechenbaren Untiefen ihren Tod gefunden hatten. Die Southern Shoals bezeichneten ein der Insel vorgelagertes Seegebirge, dessen einzelne Gipfel manchmal nur wenige Zentimeter aus dem Meer ragten und in dem zahlreiche Verwirbelungen und Tiefenströmungen das Wasser ständig in Bewegung hielten. Von der Steilküste aus betrachtet, erschien es beinahe bis zum Horizont wie das Brodeln und Sprudeln von siedendem Wasser in einem Topf. Und eben diese Strömungen waren es, die der Insel den Namen Hell’s Kitchen verliehen, denn hier kochte der Teufel höchstpersönlich eine brodelnde Suppe, die unzählige Seelen in die Tiefe gerissen hatte. Nur eine schmale, schiffbare Rinne zwischen den Shoals und der Nachbarinsel Elm Island im Südosten ermöglichte den Weg hinaus auf die offene See.
Ava schlief bereits tief und fest, als Gabriel weit nach Mitternacht zu Bett ging. Er hatte noch im Schuppen an einer neuen Skulptur für seinen Skulpturengarten gearbeitet. Die beinahe zwei Meter große Holzfigur eines Seemannes. Draußen tobte wie bereits in den letzten Tagen ein heftiger Sturm, und der windgepeitschte Regen prasselte beinahe waagrecht gegen die östliche Hauswand. Bevor er sich niederlegte, warf er noch einen Blick aus dem Fenster. In der schummrigen Dunkelheit erkannte er die helle Gischt der Wellen, die die felsigen Riffe unterhalb der Steilküste umspülten. Die leisen Atemzüge von Ava erfüllten den Raum. Er setzte sich auf das Bett, doch noch bevor er das Licht gelöscht hatte, hörte er draußen ein lautes Klopfen, zuerst ein einzelner Schlag, dann wiederholte es sich immer und immer wieder. Klopf … klopf … klopf …, es klang, als schlage eine Tür gegen die Hauswand. Hatte er vergessen, den Schuppen zu verriegeln? Hatte der heftige Wind womöglich die Tür aufgedrückt?
Mit einem Seufzer erhob er sich, warf seinen Ölmantel über und ging hinaus in die stürmische Nacht. Doch noch bevor er den Schuppen erreicht hatte, gefror ihm das Blut in den Adern.
Otter-Brook-Damm, Keene, New Hampshire,
13. März 2007, 21.50 Uhr (Dienstag)
Seit sieben Stunden hatten sie nichts mehr gegessen. Mitten in der Einöde hatten sie ihren Wagen zurücklassen müssen, nachdem ihnen der Sprit ausgegangen war. In der Dunkelheit waren sie dann quer durch den Wald gestapft, bis sie nahe der Sullivan Road auf eine kleine, unbewohnte Jagdhütte stießen. Wesley Tyler ging es schlecht. Frank Duval hatte ihn die meiste Zeit stützen müssen, doch Tyler hatte nicht aufgegeben und durchgehalten. Eine halbe Stunde hatten sie im Schatten eines mächtigen Baumes abgewartet und die Hütte beobachtet, die auf einer kleinen Lichtung stand und deren Silhouette sich aus dem Mondlicht schälte. Erst als sie sich sicher waren, dass niemand in der Nähe war, schlich sich Duval zur Tür, die mit zwei Bügelschlössern gesichert war. Das erste Schloss ergab sich bereits nach einer Minute, doch das andere, massivere, leistete erheblichen Widerstand. Duval musste sich mächtig anstrengen, bis er es mit einem Schraubenzieher, den sie im gestohlenen Wagen gefunden hatten, endlich aufhebeln konnte. Nachdem er die Hütte gründlich durchsucht hatte, holte er Tyler, der im Schatten des Baumes zurückgeblieben war und schwer atmend auf dem Boden kauerte.
»Komm! Du schaffst es.«
Tyler versuchte sich zu erheben, doch seine Beine knickten wieder ein. Duval ergriff ihn am Arm und zog ihn hoch. Er schwitzte, nachdem er ihn zur Hütte geschleppt hatte. In der Dunkelheit nahm er nur Umrisse wahr, aber die helle Couch in der Ecke hob sich gut vom dunklen Hintergrund ab. Tyler stöhnte laut auf, als er sich auf der Couch niederließ.
»Leg dich hin und ruh dich aus«, sagte Duval. »Ich schau mal, ob ich etwas zu essen finde.«
Tyler seufzte, als sich Duval den Schränken zuwandte. Auf einer Anrichte fand er eine Öllampe. Streichhölzer lagen daneben. Das Licht breitete sich gleichmäßig aus, als er das Streuglas über den brennenden Docht stülpte. Er öffnete eine Tür des Hängeschrankes und pfiff freudig überrascht durch die Zähne.
»Na, das ist wohl ein Glück, das Schicksal meint es gut mit uns«, rief er, als er die Konservendosen im Schrank entdeckte. In einer Schublade fand er einen Dosenöffner. Er ging hinüber zur Couch und stellte die offene Dose auf den Tisch.
»Roastbeef«, sagte er und hielt Tyler ein Stück Fleisch unter die Nase, das er mit dem Messer aufgespießt hatte.
Tyler öffnete seine Augen und schüttelte den Kopf. Ihm war nicht nach essen zumute.
»Du musst essen, wenn du wieder zu Kräften kommen willst.«
»Ich kann nicht!«, jammerte Tyler.