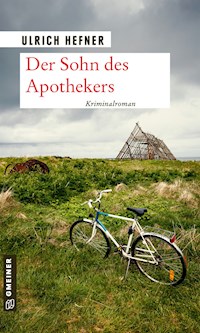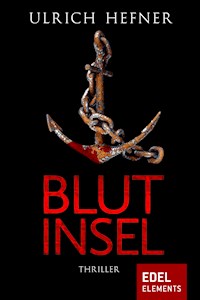Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Thriller um Macht, skrupellose Profitgier und ein unheimliches Virus, das die gesamte Menschheit bedroht Ein unbekannter tödlicher Virus breitet sich rasend schnell im Amazonasgebiet von Brasilien aus, und immer mehr Menschen müssen qualvoll innerlich verbluten. Fieberhaft suchen die Ärztin Lila Faro und der deutsche Epidemiologe Michael Sander nach dem Ursprung dieser unerklärlichen Krankheit. Derweil erschüttert eine grausame Mordserie eine nahe Großstadt. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Ereignissen? Und was hat das spurlose Verschwinden eines amerikanischen Studenten aus Miami damit zu tun?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ein atemberaubender Thriller um Macht, skrupellose Profitgier und ein unheimliches Virus, das die gesamte Menschheit bedroht
Ein unbekannter tödlicher Virus breitet sich rasend schnell im Amazonasgebiet von Brasilien aus, und immer mehr Menschen müssen qualvoll innerlich verbluten. Fieberhaft suchen die Ärztin Lila Faro und der deutsche Epidemiologe Michael Sander nach dem Ursprung dieser unerklärlichen Krankheit. Derweil erschüttert eine grausame Mordserie eine nahe Großstadt. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Ereignissen? Und was hat das spurlose Verschwinden eines amerikanischen Studenten aus Miami damit zu tun?
Ulrich Hefner
Mutiert
Thriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2013 by Ulrich Hefner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.
Konvertierung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-028-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
… der Mensch sollte nicht so vermessen sein und sich als Schöpfer aufspielen.
Es gibt nur einen Gott auf Erden, und
Prolog
Mai 2007,am Rio Jatapu, Amazonasgebiet, Brasilien
Das Langboot glitt beinahe geräuschlos durch die schwarzen Fluten des Rio Jatapu. Die Nacht hatte sich über den Dschungel gesenkt, doch die Temperaturen lagen noch immer bei annähernd fünfundzwanzig Grad. Die Luft war feucht.
Cardoso lag im Boot, schweißdurchtränkt sein fleckiges Hemd. Es schien, als hätten seine Eingeweide Feuer gefangen. Sein Atem ging flach, aber sein Herz raste.
Vor sieben Tagen war er mit einer kleinen Gruppe aufgebrochen, um nach gut gewachsenen Harthölzern Ausschau zu halten, die geeignet waren, als Stützbalken für einen Türstock zu dienen und Tonnen von Gestein abzustützen. Fast vierzig Kilometer hatten sie zurückgelegt, bis sie auf eine Gruppe bester Rosenhölzer stießen, die nur unweit des Ufers standen und ihre gefiederten Blätter im leichten Wind hin und her wiegten. Dann war ein gewaltiger Sturm über sie hereingebrochen, der drei Tage lang anhielt und mit heftigen Regenfällen über dem Amazonasgebiet tobte.
Zu siebt waren sie aufgebrochen. Vier Langboote, mit Proviant und Ausrüstung bestückt, hatten sich auf den Weg gemacht. Nun würde er alleine zurückkehren, keiner seiner Kameraden hatte überlebt. Unter Qualen waren sie gestorben. Mit letzter Kraft hatte sich Cardoso in eines der Boote geschleppt und die Leinen gekappt. Mit der Strömung hatte er sich treiben lassen, in der Hoffnung, er würde rechtzeitig auf Hilfe stoßen. Dann war er in eine tiefe Ohnmacht gesunken, aus der er erst wieder erwachte, nachdem sich die Dunkelheit über dem tropischen Regenwald ausgebreitet hatte.
Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war und wo er sich gerade befand. Er wusste noch nicht einmal, wie lange ihm noch blieb. Die Schreie einiger Brüllaffen hallten durch den Wald. Cardoso versuchte sich aufzurichten, doch er sank kraftlos zurück. Er schloss die Augen.
Das zunehmende Glucksen und Plätschern verriet ihm, dass er sich wohl in der Nähe der kleinen Stromschnellen befand. Corrupira konnte nicht mehr weit sein. Zwar gab es dort keine Krankenstation und noch nicht einmal einen Arzt, aber José, der Wirt der kleinen Bar Da Penico, würde ihm schon helfen können. Er spürte, wie das Boot langsam Fahrt aufnahm. Das Plätschern wurde zu einem Rauschen, und das Boot begann auf und ab zu schaukeln. Doch diese Stromschnellen bargen keine Gefahr, dazu waren sie nicht stark genug.
Gischt spritzte in das Boot und traf Cardoso im Gesicht. Das kalte Wasser tat gut auf seiner vom Fieber erhitzten Haut. Das Rauschen verebbte, und das Boot wurde langsamer. Erneut durchbrach der laute Schrei eines Brüllaffen die Stille. Langsam wurde es kühler, und das Leben im Wald erwachte. Cardoso griff sich an die Brust, das Brennen in seinem Körper wurde stärker, er schnappte nach Luft.
Dann stieß das Boot gegen das Ufer und verkeilte sich in der Krone eines umgestürzten Baumes.
*
Da Penico hatte José seine kleine Bar in dem gottverlassenen Ort Corrupira mitten in den dichten Wäldern des Amazonas genannt, was übersetzt einfach nur die Kanne hieß.
Corrupira war auf keiner Karte der Welt verzeichnet, und nur wenige wussten von der Existenz diesen kleinen Ortes, bestehend aus einfachen Hütten, einer Bar und einer getarnten Lagerhalle.
Gold und Holz, darum drehte sich in dem kleinen Ort alles. Doch man fand keine Mine in der Nähe; es gab keine Holzlager, keine beladenen Lastwagen brausten durch den Ort. Es gab noch nicht einmal eine befahrbare Straße in dem kleinen Dorf am Rio Jatapu, einem Zufluss des Rio Uatumá, knapp hundert Kilometer nordöstlich von Itacoatiara.
Es gab auch keinen Supermarkt, keine Kirche, keine Polizeistation und keinen Bürgermeister in dem Ort, den man Waldgeist nannte, denn der Ort war gänzlich illegal. Knapp siebzig Glücksritter bewohnten die Hütten, dazu kamen noch ein paar Prostituierte aus Manaus sowie José, der die Damen in seiner Bar beherbergte, für sie sorgte und am Ende noch ein paar Real nebenbei verdiente.
Überall im Amazonasgebiet konnte man auf solche Camps stoßen; überall versteckten sich illegale Holzfäller, Goldsucher oder Diamantenschürfer vor den Behörden, um in der unwirtlichen Wildnis ihr Glück zu finden und den Regenwald immer weiter zurückzudrängen, bis bald nichts mehr davon vorhanden war. Die illegale Brandrodung schlug unübersehbare Wunden in den Urwald, und jedes Jahr fielen beinahe 30000 Quadratkilometer dem heimlichen Treiben zum Opfer. Eine Fläche, nur ein knappes Drittel kleiner als die Schweiz.
Die tropischen Hölzer brachten noch immer sehr viel Geld auf dem Schwarzmarkt. Egal ob Palisander, Ipe oder Pau Brasil, die Nachfrage stieg in rasantem Tempo. Und mit ihr die Gefahr der Entdeckung, denn immer mehr Paras, wie die Polizisten in dieser Gegend genannt wurden, patrouillierten mit berittenen Streifen, Booten oder Hubschraubern und nutzten sogar modernste Satellitentechnik, um die illegalen Camps und Holzlager aufzuspüren. Der Schutz des Regenwaldes war inzwischen zu einer Aufgabe geworden, die in der ganzen Welt ernst genommen wurde. Entsprechend hoch war die Zahl der Polizisten geworden. Und lange schon reichte es nicht mehr, ein Viertel des erzielten Gewinnes an die Kommandanturen abzugeben, denn korrupte Polizisten wurden mittlerweile hart bestraft.
So waren die Glücksritter vorsichtig geworden, zogen sich tief in den Schutz des Regenwaldes zurück und nahmen lange Wege zu ihren Rodungsplätzen oder Minen auf sich. Doch selbst wenn ein Hubschrauber auf dem Patrouillenflug eine neue Rodung entdeckte, so gelang den Illegalen doch meist die Flucht, denn im Regenwald gab es keine Landeplätze, und bis zum Eintreffen der Bodentruppen hatten sich die Männer längst abgesetzt. Beweglichkeit war ihr Trumpf.
Bei Edelhölzern gingen sie mittlerweile gezielt vor und fällten nur einen oder zwei Bäume, so dass es aus der Luft kaum auffiel. Durch die verzweigten Flüsse schmuggelten sie dann im Schutze der Nacht ihre geheimen Flöße bis zu den Plätzen, wo sie zum Abtransport erwartet wurden. Das Gebiet des Waldes war trotz allem noch immer riesig, und selbst die gut organisierten Paras waren im Kampf gegen die bestens aufgestellten Schmugglerbanden oft überfordert. Wurden ein paar von ihnen erwischt, dann räumte man die Lager und zog über die Flüsse einfach weiter.
*
Es herrschte eine ausgelassene Stimmung in der Kanne. Die verstimmten Töne des alten Pianos drangen durch die Tür hinaus in die Nacht. Ein guter Tag war zu Ende gegangen, und die Männer hatten Grund zum Feiern. Anna tanzte zur Musik auf dem Tresen und ließ ihren Faltenrock wild durch die Luft flattern. Wenn die Männer gut verdient hatten, kam auch José auf seine Kosten. Zuerst wurde gefeiert, und hatten die Männer dann genug Tequila oder Bier intus, so zogen sie sich nacheinander mit Anna, Maria oder Conchita auf die Zimmer zurück. Josés Kasse klingelte immer.
Während José hinter dem Tresen stand und die Gläser füllte, warf er ab und an einen lüsternen Blick auf die rassige Tänzerin auf seinem Tresen, die sich nach und nach ihrer Kleider entledigte. Es war eine gute Idee gewesen, die Mädchen aus Manaus hierher zu holen. Eine lohnende Idee, für beide Seiten. Denn José war fair. Nicht mehr als ein Drittel ihrer Einnahmen mussten ihm die Mädchen für Kost und Logis abgeben. Wenn dann die Männer einmal wieder für Wochen das Camp verließen, konnten sie sogar umsonst bei ihm wohnen.
An diesem Abend machte sich José ernsthaft Sorgen, ob seine Vorräte an Alkohol und Bier ausreichten, bevor die Gäste müde würden. Vor allem die sieben Kanadier waren heute in Spendierlaune. Über zwanzigtausend Dollar hatte ihnen ihr Geschäft eingebracht. Mehr als das Doppelte wie sonst. Sie hatten wirklich Glück gehabt, als sie bei ihrer Tour auf den schier unerschöpflichen Bestand an gerade gewachsenen Rosenhölzern gestoßen waren. Sechzehn Meter ragten die Bäume auf.
»Noch eine Runde!«, rief einer der Kanadier lauthals. »Heute lassen wir uns nicht lumpen.«
Die meisten Bewohner des Camps stammten aus Brasilien, doch auch Amerikaner, Kanadier und ein paar Europäer hatten sich hierher gewagt, um mit dem Holzeinschlag ihr Glück zu suchen.
»Komme schon!«, antwortete José und zog drei weitere Flaschen Tequila aus dem Regal.
Die Kanadier saßen an einem runden Tisch. Conchita und Maria versüßten ihnen den Abend. Noch bevor José die Gläser erneut vollschenken konnte, flog die Tür auf. Krachend schlug sie gegen die Holzwand, so dass es staubte. Erschrocken ließ José die Tequilaflasche fallen. Die Köpfe der Anwesenden flogen herum, und das Klavier verstummte. Selbst Anna auf dem Tresen raffte ihre Kleidung zusammen und bedeckte ihre Blöße. Plötzlich herrschte eine Ruhe in der kleinen Bar, bei der man eine Stecknadel hätte fallen hören. Alle starrten gespannt zum Eingang.
Cardoso schwankte durch die Tür. Seine Haut schimmerte bläulich im Fieberglanz, und die Augen in seinem bleichen Gesicht traten aus ihren Höhlen hervor. Er fasste sich an den Hals und schnappte nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Hey, Cardoso!«, rief José. »Was ist los mit dir, und wo sind die anderen?«
Cardoso öffnete den Mund, es schien, als ob er antworten wollte, doch plötzlich ergoss sich ein Schwall dunklen Blutes auf den Boden. Cardoso stürzte. Sein Körper zuckte unkontrolliert, bevor er schließlich leblos liegen blieb. Noch immer lief ein kleines blutiges Rinnsal aus seinem Mund. Die Mädchen kreischten angsterfüllt, und die anwesenden Männer sprangen von ihren Plätzen auf.
José atmete tief ein. Nur langsam löste sich seine Starre. Er ging auf Cardoso zu, kniete sich nieder und drehte ihn auf den Rücken. Er beugte sich zu ihm herab und hielt sein Ohr an Cardosos Mund. Schließlich wandte er sich den Anwesenden zu.
»Er ist tot, verdammt«, sagte er fassungslos. »Er ist einfach gestorben.«
Eine Woche später – Liberty City in Miami, Florida, USA
Eine Dunstglocke lag schon seit Tagen über der Stadt und hielt die feuchte und schwüle Luft darunter gefangen. Die Temperaturen lagen bei dreißig Grad und die Luftfeuchtigkeit bei nahezu fünfundachtzig Prozent. Die Menschen mieden die vor Hitze flirrenden Straßen und hatten sich in ihre Häuser zurückgezogen. Vier Mal war in den letzten Tagen in Liberty City der Strom ausgefallen, weil sämtliche Klimageräte in diesem Viertel gleichzeitig auf Hochtouren liefen.
Gene Mcfaddin räkelte sich in seinem Bürostuhl im zweiten Stock des nicht mehr ganz neuen Geschäftshauses in der 65. Straße und hatte seine Füße auf den Schreibtisch gelegt. Die Rollläden und die Fenster waren geschlossen. Gene trug nur legere Shorts und ein Muskelshirt, doch obwohl der Ventilator auf voller Stufe lief, vermochte er es nicht, den Raum auch nur ein klein wenig abzukühlen. Aus dem Radio dudelten Hits aus den Achtzigern.
Gene hielt eine Wasserflasche in der Hand und döste vor sich hin. Als es an der Tür klopfte, fuhr er erschrocken auf. Die Flasche fiel polternd zu Boden und das restliche Wasser ergoss sich über den staubigen Teppich.
Es klopfte erneut.
»Ja, schon gut!«, brummte Gene nicht gerade freundlich und erhob sich. Durch die Glasscheibe der Tür konnte er den Schatten einer zierlichen Person erkennen. Er öffnete, und vor ihm stand eine junge Frau mit langen, schwarz gelockten Haaren.
»Sind Sie Mcfaddin?«
»Ja. Was kann ich für Sie tun?« Gene trat einen Schritt zur Seite und bat sie herein.
»Ich brauche einen Privatdetektiv«, antwortete die junge Frau.
Gene wies auf den einzigen Besucherstuhl und nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz. »Da sind Sie bei mir nicht ganz falsch. Aber mit wem habe ich die Ehre?«
»Sharon«, erwiderte sein Besuch. »Sharon Cruiz. Ich brauche Ihre Hilfe.«
Gene musterte die Frau mit dem lateinamerikanischen Einschlag. Sie hatte ein hübsches Gesicht und die schönsten, gebräunten Beine, die Gene seit Monaten gesehen hatte.
»Was ist Ihr Problem?«
»Ich weiß nicht, ob ich Sie mir überhaupt leisten kann«, begann Sharon Cruiz etwas unsicher. »Ich habe tausend Dollar gespart. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch tun soll.«
Er sah die Träne, die über ihre Wange lief und eine dunkle Spur aus Wimperntusche hinterließ. »Tausend Dollar, das ist ja auch eine Menge Geld.«
Sharon blickte zu Boden. »Mein Verlobter ist verschwunden«, sagte sie leise. »Seit zwei Wochen habe ich nichts mehr von ihm gehört. Peter ist zur Arbeit gegangen und am Abend einfach nicht zurückgekommen.«
»Peter, ist das Ihr Verlobter?«
Der Ventilator auf dem Schreibtisch stoppte plötzlich mit einem lauten Schlag. Der Propeller steckte fest. Gene beugte sich vor und klopfte mit der Faust gegen das Sicherungsgitter. Der Propeller befreite sich und lief surrend wieder an.
»Diese blöden Fünf-Dollar-Dinger taugen nichts«, nörgelte Gene.
Sharon nickte kurz. »Peter Harrison ist sein Name. Wir wohnen seit sechs Monaten zusammen. In Gladeview. Peter studiert Medienwissenschaften, und nebenbei jobbt er, damit ein wenig Geld hereinkommt. Wir können es nämlich brauchen. Ich bin schwanger.«
Gene griff nach einem Notizblock und schrieb den Namen des Vermissten auf. »Waren Sie schon bei der Polizei?«
Sharon schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Gene erhob sich, ging um den Schreibtisch und legte sanft den Arm um ihre Schultern.
»Sie haben gesagt, dass er sich aus dem Staub gemacht hat, weil ich schwanger bin. Sie können nicht nach ihm suchen, er ist erwachsen.«
»Hat die Polizei wenigstens in den Krankenhäusern nachgefragt oder geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem Verbrechen vorliegt?«
»Der Officer hat ein paar Anrufe geführt, und dann hat er mir gesagt, dass er mir nicht helfen kann.«
»Entschuldigung, ich frage das nur, weil ich nicht unnötig Ihr Geld verschwenden will, aber könnte es nicht tatsächlich sein, dass er wegen des Kindes …«
Sharon sprang auf und krallte ihre Fingernägel in Genes rechten Arm. »Er liebt mich, und er hat sich das Kind gewünscht. Er hat sogar schon das Kinderzimmer gestrichen.«
»Schon gut, aber wenn ich Ihnen helfen soll, dann muss ich alles wissen.«
Sharon setzte sich wieder und seufzte. »Also gut, was müssen Sie wissen, um ihn zu finden?«
Auch Gene hatte wieder hinter seinem Schreibtisch Platz genommen. »Zuerst einmal, wo er am Tag seines Verschwindens gewesen ist.«
Sharon zuckte mit der Schulter. »Ich weiß nicht, was er an diesem Tag gemacht hat. Er nimmt Gelegenheitsjobs an. Auf dem Bau, als Möbelpacker, er war auch schon mal Wachmann für ein paar Tage. Aber die Leute wollten, dass er auch nachts für sie arbeitet. Jean hat ihn um neun abgeholt.«
»Jean?«
»Jean Tarston«, antwortete Sharon. »Er ist Peters Freund aus vergangenen Tagen. Ich habe ihn immer vor ihm gewarnt.«
»Haben Sie schon mit Jean gesprochen?«, fragte Gene. »Das wäre doch wohl das Einfachste.«
»Ich habe es versucht, aber Jean ist ebenfalls verschwunden.« Sharon Cruiz tupfte sich mit einem Taschentuch über die Wangen.
»Also gut, Lady. Wenn ich die Sache übernehme, wie erreiche ich Sie?«
Sharon schob das Taschentuch zurück in ihre Handtasche. »Ich melde mich bei Ihnen, das ist einfacher.«
»Ein bisschen mehr brauche ich schon. Zumindest eine Handynummer, falls ich noch Fragen habe.«
Sharon griff nach einem Stift und einem Zettel auf Genes Schreibtisch, schrieb ihre Nummer darauf und schob sie ihm zu.
»Okay, aber etwas Zeit werde ich schon brauchen«, gab Gene zu bedenken und reichte ihr seine Visitenkarte. »Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie zu Hause schon alles nach einem möglichen Hinweis durchsucht haben?«
Sharon nickte.
»Dann kommen wir noch mal zurück zu seinem Freund. Wo hält er sich normalerweise auf, mit wem hat er Umgang, gibt es überhaupt irgendeine Spur?«
»Sie sind einfach weg, so als habe es sie nie gegeben.«
Erster Teil
Am langen Fluss
1
Etwa zur gleichen Zeit, 3000 Meilen entfernt …
Cuiabá, Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien
Capitão Carlos Zagallo von der Kriminalpolizei in Cuiabá schnippte sein Zigarillo in hohem Bogen ins Gras und rümpfte angewidert die Nase.
Leutnant Luiz Falcáo deckte die Überreste der Leiche wieder zu und erhob sich.
»Nummer neunzehn«, sagte er. »Eine kleine Person, ein Kind oder eine Frau, meint der Doktor.«
»Ein Wunder, dass man überhaupt noch etwas erkennen kann«, antwortete Zagallo und blickte sich um.
Die verkohlte Leiche lag abseits der Staatsstraße 351, etwa zehn Kilometer nordöstlich vom Stadtkern in einem kleinen Wäldchen, zu dem eine staubige Sandpiste führte.
»Man hat sie hierhergebracht und angezündet«, entgegnete Falcáo.
In der Ferne stand ein Streifenwagen der Verkehrspolizei. Ein Polizeifotograf des Servicio de Inteligéncia fotografierte unablässig die Umgebung, während sich zwei Männer in weißen Kitteln auf der Sandpiste an einer Reifenspur zu schaffen machten und diese mit Gips ausgossen.
»Ein schwarzer Kleinlastwagen«, murmelte Zagallo, »so wie vor einer Woche bei Várzea Grande. Wahrscheinlich der gleiche Wagen und wahrscheinlich auch der gleiche Täter. Ich will, dass wir dieses Schwein kriegen. Das lass ich mir in meinem Distrikt nicht länger bieten.«
»Im letzten Jahr gab es zweitausend Mordfälle in unserer Stadt«, antwortete Falcáo. »Warum liegt dir so viel an der Sache?«
Zagallo verzog das Gesicht. »Weil er uns provoziert. Er führt uns an der Nase herum und hält uns für blöd. Aber ich werde ihm zeigen, wer am Ende der Dumme ist.«
Die Mordserie hatte vor knapp sechs Wochen begonnen. Die erste Leiche war im Süden der Stadt Cuiabá auf einer wilden Müllkippe gefunden worden. Verkohlt bis zur Unkenntlichkeit. Es gab keine verwertbaren Spuren. Der Täter verwendete Benzin und Chemikalien, um auch eine ausreichende Hitze zu erreichen, damit nicht viel mehr als eine undefinierbare, schwarze Masse übrig blieb. Thermit wurde bei der Verbrennung der Leichen benutzt, so hatten die Chemiker der Servicio de Inteligéncia herausgefunden. Bis zu 2200 Grad Celsius erreichte das Material bei der exothermischen Reaktion.
Kein Körper widerstand diesen Temperaturen. Es blieb nicht viel übrig außer ein paar verkohlten Gliedmaßen. Damit wurde eine Identifizierung der Leichen anhand von Körpermerkmalen oder Fingerabdrücken unmöglich, und die Vermisstendateien der Polizeistationen in Brasilien quollen angesichts der hohen Verbrechensrate im Land über. Mann, Frau oder Kind, alles blieb pure Spekulation.
»Wir befragen alle Leute in dieser Gegend«, rief Zagallo entschlossen. »Irgendjemand wird den Wagen gesehen haben.«
Falcáo schaute sich um. »Wir werden eine Menge Leute dafür brauchen.«
Zagallo tat den Einwand seines Kollegen mit einer Handbewegung ab. »Ich rede mit dem Coronel. Wir werden die Männer bekommen, und dann drehen wir hier jeden Stein um.«
Ein weißer VW-Bus hielt hinter dem Streifenwagen. Zwei Männer stiegen aus. Sie waren vom Institut für Rechtsmedizin. »Können wir die Leiche mitnehmen?«, wandte sich einer der beiden an Zagallo.
»Packt alles ein und vergesst nichts. Ich will nicht, dass wie beim letzten Mal ein Arm zurückbleibt.«
Die Männer holten von der Ladefläche des Wagens eine stählerne Kiste und fluchten, als sie mit einer Schaufel die Leichenteile aufsammelten.
»In dieser Stadt gibt es einen Wahnsinnigen, und ich will ihn haben.« Zagallo beobachtete die Kollegen von der Rechtsmedizin.
»Ich möchte nur wissen, was der Kerl bezweckt«, überlegte Falcáo laut.
»Das ist doch klar. Er will uns unsere Arbeit erschweren.«
»Wir haben genügend Vermisste, die längst schon vergessen sind. Er könnte seine Leichen auch irgendwo vergraben, dann würden wir sie überhaupt nicht finden. Ich glaube, da steckt etwas anderes dahinter. Ihm geht es nicht nur darum, dass seine Opfer unerkannt bleiben.«
»Blödsinn«, widersprach Zagallo. »Er treibt sein Spiel mit uns, das ist alles.«
Dade Police Department in Miami, Florida
Gene Mcfaddin kannte mehr als die Hälfte der anwesenden Polizeibeamten, die auf der Wache Dienst versahen. Das Police Department von Dade County lag am Doral Boulevard. Elf Jahre hatte Gene Tag für Tag seinen Wagen auf dem großen Parkplatz hinter dem Präsidium geparkt, bevor er seinen Dienst quittieren musste. Bis zum Detective Sergeant hatte er es gebracht. Das war nun vier Jahre her. Als ihn Amy damals verließ, verlor er nicht nur seine Frau und seine Tochter, er verlor auch seinen Halt. Nacht für Nacht versuchte er seinen Schmerz mit Bourbon zu betäuben, und bald reichten ihm die Nächte nicht mehr. Er trank heimlich, im Archiv oder in der Toilette, überall hatte er seinen Flachmann dabei. Bald konnten die Pfefferminzbonbons, die er lutschte, seine Fahne nicht mehr verbergen. Die Kollegen schwiegen, und auch der Leutnant sagte nichts. Nur einmal erfuhr er, dass jeder in der Abteilung von seinem Alkoholproblem wusste. Damals sollte er Detective Cavallino als Streifenpartner zugeteilt werden, doch dieser lehnte vehement ab. »Mit dem Säufer bin ich da draußen aufgeschmissen«, hatte Cavallino zum Leutnant gesagt. Gene stand vor der Tür und hatte alles mit angehört. Doch er hatte nicht protestiert. Er ging auf die Toilette und trank seinen Flachmann in einem Zug leer. Anschließend hatte er sich für den Rest der Woche krankgemeldet.
In der darauffolgenden Woche wollte er zusammen mit Ryan einen Handtaschenräuber auf dem Doral Boulevard unweit des Parks verhaften. Als der junge Farbige einen Fluchtversuch unternahm, drehte Gene durch und prügelte ihn mitten auf der Straße vor etlichen Passanten krankenhausreif. Das war das Ende seiner Karriere. Der Commissioner hatte ihn kurz nach dem Vorfall auf der Dienststelle aufgesucht und ihm nahegelegt, seinen Dienst zu quittieren. Zwei Tage später gab Gene seine Dienstmarke ab, so kam er wenigstens einer Anklage wegen Polizeibrutalität zuvor. Der junge Farbige verzichtete auf eine Anzeige.
Seither schlug er sich als Privatdetektiv durchs Leben, überwachte Clubs, schützte Supermärkte vor Ladendieben oder lief sich für besorgte Ehefrauen die Füße wund. Es war nicht leicht, in Miami zu überleben, doch bislang hatte er es geschafft. Und auch seine Alkoholsucht hatte er bis auf wenige Wochenenden im Jahr einigermaßen in den Griff bekommen.
Gene betrat das Police Department durch die große Glastür und genoss die angenehme Kühle. Hinter einer schusssicheren Glasscheibe saß ein junger uniformierter Polizist.
»Mcfaddin«, sagte Gene in das kleine Mikrophon und warf seinen Detektivausweis in die Durchreiche. »Ich möchte zu Detective-Leutnant Ryan.«
Der Polizist warf einen prüfenden Blick auf den Ausweis und griff zum Telefon.
»Nehmen Sie Platz, Detective Leutnant Ryan holt Sie in wenigen Minuten ab«, antwortete der Polizist, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte.
Es dauerte drei Minuten, bis Ryan die Sicherheitsschleuse öffnete und ihn in Empfang nahm.
»Immer mehr neue Gesichter«, sagte Gene. »Bald kennt mich hier kein Mensch mehr.«
»Das zeigt uns nur, wie schnell die Zeit vergeht. Was führt dich nach so langer Zeit wieder einmal in die Höhle des Löwen?« Ryan sah ihn neugierig an.
»Ich suche jemanden.«
Ryan lachte. »Das tun wir hier alle, jeden Tag, hast du das vergessen?«
Sie fuhren mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock. Ryan teilte sich ein Büro mit einer jungen Kollegin. Nach seiner Beförderung zum Leutnant hatte er das Großraumbüro hinter sich gelassen. Ryans Kollegin blickte kurz auf, als die beiden das Büro betraten.
»Das ist Diana«, stellte Ryan seine Zimmergenossin vor.
Gene nickte der blonden Frau zu.
»Das ist Gene, er war ein Kollege, aber er hat es vorgezogen, das sinkende Schiff rechtzeitig zu verlassen. Er arbeitet jetzt auf eigene Rechnung.«
Diana nickte nur und widmete sich weiter ihren Akten.
Ryan schob Gene einen Stuhl zu, bevor er sich in seinen Sessel fallen ließ. »Wie lange ist dein letzter Besuch her, acht, nein, neun Monate«, überlegte Ryan laut.
»Zumindest stand damals dein Schreibtisch noch im zweiten Stock, nicht weit von den Zellen entfernt.«
»Mein Gott, ich habe mir die Beförderung redlich verdient«, antwortete Ryan. »Die Neuen kommen von der Akademie und haben alle studiert. Die fallen die Treppe hinauf, so schnell kann ich nicht einmal denken. Und die alten Hasen sterben langsam aus. Vorgestern ist Vargas in Pension gegangen. Jetzt gibt es nur noch Cavallino, Stern und Myers, alle anderen sind schon gegangen. Aber das interessiert dich bestimmt nicht mehr, weshalb bist du gekommen?«
»Ich sagte schon, ich suche nach jemandem.«
»Und ich soll dir helfen, ihn zu finden?«
»Du kannst mir zumindest dabei behilflich sein.«
»Und dann? Knallst du ihn ab, oder lässt sich seine Frau von ihm scheiden?«
»Schlimmer, viel schlimmer«, erwiderte Gene.
São Sebastião do Uatumã, Amazonasgebiet
Die Mittagshitze hatte sich wie ein undurchlässiges Tuch über die Region gesenkt. Der Regen hatte nachgelassen, und die tropische Luftfeuchtigkeit trieb den Polizisten der Naturschutzbehörde den Schweiß aus den Poren. Das Patrouillenboot der Militärpolizei war bereits seit Stunden auf dem Rio Uatumá in Richtung Norden unterwegs. Sie hielten Ausschau nach illegalen Camps von Holzfällern, die sich zuhauf hier in diesem Gebiet herumtrieben und ganze Teile des Urwaldes abholzten, um ihre geheime Fracht, oftmals als Flöße getarnt, auf dem Fluss an den Ort der Übergabe zu bringen. Dort wurden sie dann von skrupellosen Händlern erwartet, die für den Weitertransport auf der Straße sorgten.
Gerade in diesem Jahr hatten die Holzeinschläge wieder zugenommen, und die Satellitenauswertung ergab immer neue kahle Stellen im weiten Grün des Regenwaldes. Bauern nutzten das neu gewonnene Land zur Viehzucht, und illegale Holzhändler lieferten über verborgene Routen Edelhölzer direkt an die Küste, wo die Baumstämme mit gefälschten Zertifikaten als legale Fracht in den stählernen Bäuchen der Frachtschiffe verschwanden. Die Nachfrage nach Tropenholz war in letzter Zeit stark angestiegen und für Holzfäller und Händler ein einträgliches Geschäft geworden. Nicht selten waren die Polizisten der Policia Civil daran beteiligt. Die Korruption reichte bis in die Chefetagen der offiziellen Stellen, so dass inzwischen die Militärpolizei eingesetzt werden musste, um den illegalen Holzhandel wieder einzudämmen.
Vor einer Stunde hatte das Boot den Anleger in São Sebastião verlassen. Vorbei an den Mangrovenwäldern schipperten die Militärpolizisten weiter nordwärts. Immer breiter wurde der Fluss, und bald schon glich er einem See, umgeben von grünem Wald. Kormorane saßen in den Wipfeln der Bäume und ließen sich durch den Lärm des Bootsmotors nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum Balbina-Stausee führte ihre Route, wo noch vor wenigen Tagen ein heftiger Sturm getobt hatte. Einige Mohrenkaimane flüchteten vom sandigen Ufer ins Wasser, um sich vor dem tosenden und dampfenden olivgrünen Ungetüm in Sicherheit zu bringen. Kurz vor dem Zufluss des Rio Jatapu rief der Cabo, der Korporal an Bord des Bootes, dem Bootskommandanten ein paar aufgeregte Worte zu und zeigte mit der ausgestreckten Hand in Richtung der Flussmündung. Dieser nahm sofort sein Fernglas vor die Augen und wies den Steuermann an, Kurs auf den Rio Jatapu zu nehmen. Ein schmales, grün gestrichenes Langboot hatte sich mit dem Ausleger im Wurzelwerk einiger Mangroven verfangen.
Befehlsgewohnt brüllte der Kommandant seiner Besatzung Anweisungen zu, und gleich darauf positionierte sich einer der Soldaten hinter dem großen Zwillingsmaschinengewehr, das sich am Bug des Patrouillenbootes befand. Auch die anderen Besatzungsmitglieder, zwei weitere einfache Soldaten und ein Korporal, griffen zu ihren automatischen Waffen. Gefahr war im Verzug. Nicht oft wurden illegale Holzfäller erwischt, doch wenn man sie in die Enge getrieben hatte, schreckten sie selbst vor einem Feuergefecht mit dem Militär nicht zurück.
Der Steuermann drosselte die beiden Dieselmotoren und ließ das Patrouillenboot langsam auf die Flussmündung zutreiben. Das Schiff, ein amerikanisches Modell, das bereits 1966 im Vietnamkrieg zum Einsatz gekommen war, verfügte über einen stabilen Rumpf aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Am Bug und an den Seiten sorgten Keramikplatten für die Deckung der Mannschaft, und selbst der Bugturm mit den beiden Maschinengewehren bot gegen einfache Gewehrmunition ausreichend Schutz.
Der Kommandant visierte das hölzerne Langboot mit seinem Fernglas an, doch an Bord war keine Bewegung auszumachen. Hatte sich die Besatzung an Land begeben? Lauerten die Holzräuber hinter den dicken Stämmen der Mangroven auf ihre Chance? Oder hatten sie sich vielleicht schon längst aus dem Staub gemacht? Letzteres bezweifelte der Kommandant, denn in dieser Gegend war ein Boot viel zu wertvoll, um es einfach aufzugeben. Meter um Meter glitt das Patrouillenboot weiter auf das Langboot zu.
»Da ist jemand!«, rief der Kommandant. Im Boot hatte er einen menschlichen Körper ausgemacht. Die Soldaten zielten mit ihren Gewehren darauf, während der Cabo noch immer argwöhnisch die Umgebung im Auge behielt. Schließlich waren sie heran. Drei Personen lagen im Langboot, zwei Männer und eine Frau. Der Kommandant griff nach dem Mikrophon und forderte sie über Außenlautsprecher auf, sich zu erheben und die Hände über den Kopf zu nehmen. Die Worte waren kaum verhallt, als plötzlich ein riesiger Mohrenkaiman vor dem Langboot auftauchte. Einer der Soldaten erschrak und feuerte eine Salve aus seiner Maschinenpistole.
»Feuer einstellen!«, schrie der Kommandant. »Nicht schießen, ich glaube, die Leute dort drüben sind tot.«
Der Soldat nahm seine Maschinenpistole hoch und sah noch aus den Augenwinkeln, dass der Kaiman unter dem Langboot abtauchte.
»Zwei Mann ins Schlauchboot«, befahl der Kommandant.
Eilends erhoben sich zwei Soldaten und eilten zum Heck. Sie ließen das Schlauchboot ins Wasser und ruderten hinüber zum Langboot, während die Kameraden nach wie vor mit ihren Gewehren sicherten.
»Was glaubst du, sind das Holzfäller?«, fragte der Cabo seinen Kommandanten.
»Ich weiß es nicht, aber die Frau passt irgendwie nicht ins Bild.«
Die beiden Soldaten machten das Schlauchboot an einer Rudergabel des Langbootes fest, setzten über und beugten sich zu den Personen hinab. Schließlich richtete sich einer von ihnen auf. »Die Männer sind tot, aber die Frau lebt noch, sie ist sehr schwach«, rief er zum Patrouillenboot herüber.
»Was willst du tun?«, fragte der Cabo.
Der Kommandant überlegte. Schließlich nahm er das Mikrophon in die Hand. »Bringt die Frau an Bord!«, antwortete er.
»Und die Männer?«
»Wir bringen die Frau nach São Sebastião in die Krankenstation. Die Männer lassen wir zurück. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch etwas für die Frau tun wollen.«
Der Cabo nickte.
»Also los!«, brüllte er den Soldaten auf dem Langboot zu. »Worauf wartet ihr noch? Und beeilt euch gefälligst.«
Sieben Minuten später schob der Steuermann den Gashebel bis zum Anschlag vor. Das Patrouillenboot schoss, getrieben von den beiden 260 PS starken Motoren, in Richtung von São Sebastião davon.
Die Frau war schwach und fiebrig. Ihr Atem ging flach, und die Haut war mit einem kalten Schweißfilm bedeckt. Sie hatten sie am Heck des Bootes auf eine Trage gelegt und ihr zur Untersuchung die Kleider ausgezogen.
»Was ist mit ihr?«, fragte der Kommandant seinen Cabo, der sich gerade aufrichtete und das Stethoskop zurück in den medizinischen Notfallkoffer legte. Er hatte als Einziger an Bord eine Sanitäter-Ausbildung und zuckte ahnungslos mit der Schulter. »Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie wurde von einer Giftschlange gebissen, habe aber keine Bissstelle gefunden. Lange wird sie wohl nicht mehr durchhalten. Ihr Herz schlägt unregelmäßig.«
Der Kommandant nickte und wandte sich an den Steuermann. »Fahr so schnell du kannst«, schrie er ihm gegen den Motorenlärm zu.
Diesmal flogen die Kormorane aus den Baumwipfeln auf, als das Boot mit Vollgas vorbeidonnerte.
2
Liberty City in Miami, Florida
Gene saß in seinem Büro und spielte mit einem Bleistift. Nelly Furtado schmetterte ihren Hit »Promiscuos« auf Radio Love 94, und das Thermometer in seinem Zimmer war auf 29 Grad gestiegen.
Sein kurzer Ausflug ins Polizeirevier hatte einige interessante Aspekte zu Tage gefördert. Peter Harrison war ein unbeschriebenes Blatt. Ein braver Student der Medienwissenschaften an der Universität von Miami in Coral Gables, der sich in den Semesterferien mit Gelegenheitsjobs ein paar Dollar verdiente. Der Polizei war er vollkommen unbekannt, noch nicht einmal ein paar Verwarnungen wegen Falschparkens hatte er auf dem Kerbholz. Ganz im Gegensatz zu seinem Freund Jean Tarston, der ebenfalls verschwunden war. Peter war fünf Jahre jünger als Jean und hing an ihm, als wäre er sein Bruder. Kennengelernt hatten sie sich über das Basketballteam der Universität, doch Jean Tarston hatte das Studium geschmissen, die Mannschaft verlassen und sich mit allerlei Jobs über Wasser gehalten. Mehrfach war er in den letzten Jahren mit dem Gesetz aneinandergeraten. Schlägereien und Körperverletzungen verzeichnete seine Akte. Vor zwei Jahren verbüßte er eine sechsmonatige Haftstrafe im Big Pine Key Road Prison im Dade County. Er war mit ein paar Gramm Kokain bei einer Fahrzeugkontrolle erwischt worden. Doch da er zuvor noch nie mit Rauschgift in Erscheinung getreten war, hatte der Richter noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen und das Strafmaß gemindert. Dieser Jean schien ein ganz schönes Früchtchen zu sein.
Sharon hatte ihm erzählt, dass sie gegen die Freundschaft zwischen Peter und Jean gewesen war. Sie hatte Peter die Pistole auf die Brust gesetzt und gedroht, ihn zu verlassen, sollte er sich noch weiterhin mit Jean abgeben. Und tatsächlich hatte sich Peter in den letzten Monaten mehr und mehr zurückgezogen. Doch an dem Tag, als Peter verschwand, hatte Jean ihn abgeholt. Es hatte einen furchtbaren Streit zwischen ihr und Peter gegeben.
»Er braucht meine Hilfe bei einem Job«, hatte Peter geantwortet. »Ich bin in zwei Tagen wieder zurück.«
Aus diesen zwei Tagen waren nun beinahe drei Wochen geworden. Und Peter hatte seiner Verlobten nicht verraten, um was es bei dem Job ging, sondern nur versichert, dass es nichts Illegales sei. Aber konnte man sich auf diese Aussage verlassen?
Gene hatte gehofft, dass es einfacher sein würde, eine Spur von Peter Harrison zu finden. Doch überall, wo er bislang nach ihm gefragt hatte, zuckten die Angesprochenen nur mit der Schulter. In der Bar in Gladeview, in der Peter verkehrte, in dem Büro der Arbeitsvermittlung an der Ecke, wo sich Peter beinahe täglich nach Arbeit umsah, auf dem Campus und bei Freunden aus der Uni oder der Basketballmannschaft und auch bei der Polizei, nirgends konnte irgendjemand Gene bei der Suche nach Peter helfen. Es war tatsächlich so, als hätte ihn der Erdboden einfach verschlungen.
Nelly Furtados Song endete, und der Wetterbericht auf dem Sender warnte vor einem Gewitter, das sich bei Einbruch der Nacht über der Stadt zusammenbrauen würde. Er warf den Bleistift auf den Schreibtisch und griff zur Wasserflasche. Wenn er Peter finden wollte, dann musste er sich intensiv um seinen Freund Jean Tarston kümmern. Der wohnte in der Kellerwohnung eines schäbigen Mehrfamilienhauses am Hialeah Drive. Gene langte nach seinem Wagenschlüssel.
Die heiße Nachmittagssonne hielt die Stadt fest im Griff. Nur wenige Wagen waren auf den Straßen unterwegs. Er stieg in seinen dunkelgrünen Buick Le Sabre und drehte den Regler für die Klimaanlage auf achtzehn Grad. Dann fuhr er über die 17. Straße hinunter nach Brownsville und parkte an der Ecke zum Hialeah Drive gegenüber einem kleinen Laden. Vielleicht würde man ihm hier weiterhelfen können.
Cuiabá, Bundesstaat Mato Grosso
Die Polizei hatte das Armenviertel im Nordosten der Stadt entlang der Staatsstraße 351 abgeriegelt. Straßenzug um Straßenzug durchsuchte sie das Gebiet nach einem schwarzen Kleinlaster. Carlos Zagallo stand lässig an einen Polizeiwagen gelehnt und rauchte ein Zigarillo, während Leutnant Luiz Falcáo in der Nähe einen alten Mann aus den Favelas verhörte, der die meiste Zeit den Kopf schüttelte. Schließlich gab der junge Leutnant entnervt auf und schickte den alten Mann mit einer wütenden Geste zurück in die unübersichtliche Ansammlung von Hütten und einfachen Häusern aus Bruchsteinen.
Falcáo kam auf Zagallo zu.
»Ich weiß nicht, was das bringen soll«, sagte er genervt. »Die halten zusammen, da macht keiner den Mund auf. Selbst wenn sie etwas über die Sache wüssten, würden sie sich eher den Arm abhacken, bevor sie mit uns reden.«
Zagallo schnippte sein Zigarillo in hohem Bogen auf die staubige Straße. »Warte ab«, gab er nur zurück.
Zwei Polizisten brachten gerade einen gefesselten Gefangenen zum vergitterten Polizeibus, der nicht weit von ihnen stand und in den von Zeit zu Zeit Festgenommene verfrachtet wurden.
»Waffen, ein paar Gramm Rauschgift und ein paar Gesuchte, mehr wird uns die Razzia nicht bringen, Carlos. Der Einsatz kostet nur Zeit.«
»Was sollen wir sonst tun? Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte für gezielte Aktionen.«
»Hier lebt doch nur Abschaum.«
»Hier leben Menschen, Luiz«, widersprach Capitão Carlos Zagallo. »Menschen, die nicht so viel Glück hatten wie du oder ich. Sie schlagen sich durchs Leben, wie sie es seit eh und je gewohnt sind. Sie machen ihre kleinen Geschäfte, schmutzige Geschäfte, da magst du Recht haben, aber dazu brauchen sie Ruhe. Und genau diese Ruhe werden wir ihnen nehmen. Wir werden morgen wieder hier auftauchen. Und übermorgen ebenfalls, wenn es sein muss, dann jeden Tag in jeder verdammten Woche, die noch vor uns liegt. Und wir werden ihre kleinen Geschäfte stören. Wir werden die Banden daran hindern, ihre Schutzgelder zu kassieren, und wir werden die Nutten davon abhalten, auf die Straße zu gehen. Wir werden die miesen Händler daran hindern, ihre gestohlenen Waren an den Mann zu bringen, und wir werden jedem Einzelnen hier Tag um Tag auf die Füße treten, bis wir erfahren haben, was wir wissen wollen.«
»Du willst sie zermürben?«
»Ich will diesen irren Mörder fangen, der mir seine Leichen vor der Nase ablegt und über mich, über dich und über die ganze Polizei von Mato Grosso lacht.«
Falcáo griff in seine Jackentasche und holte eine Packung Kaugummi hervor. Er reichte es Zagallo, doch dieser schüttelte den Kopf.
»Und was willst du tun, wenn die Leute hier überhaupt nichts wissen«, fragte Falcáo schmatzend. »Willst du bis zum Ende des Jahres hierher kommen? Das wird dem Coronel bestimmt nicht gefallen.«
»Die Leute hier wissen besser als du und ich und die ganze Polizei von Mato Grosso zusammen, was in unserer Stadt läuft.«
Ein uniformierter Polizeioffizier näherte sich, blieb vor Zagallo stehen und salutierte. »Wir haben das Viertel durchsucht«, sagte er. »Sechzehn Festnahmen, vier Schrotflinten und eine Pistole haben wir beschlagnahmt. Außerdem haben wir ein halbes Kilo Cocablätter gefunden. Aber niemand weiß etwas von einem schwarzen Lastwagen.«
Zagallo zündete sich ein neues Zigarillo an und nickte. »Morgen kommen wir wieder.«
Nachdem Zagallo auf dem Beifahrersitz des Dienstwagens Platz genommen hatte, setzte sich Leutnant Falcáo hinter das Steuer.
»Und jetzt?«
Zagallo schnippte die Asche aus dem offenen Fenster.
»Jetzt fahren wir zurück in die Stadt und machen Feierabend. Schließlich haben wir morgen noch viel vor.«
Falcáo schüttelte den Kopf. »Ich wette zwanzig Real, dass diese Razzien umsonst sind. Sagen wir, bis zum nächsten Wochenende?«
Zagallo streckte Falcáo die Hand entgegen. »Abgemacht! Bis nächsten Freitag wissen wir mehr. Du wirst schon sehen.«
São Sebastião do Uatumã, Amazonasgebiet
Schiefergraue Wolken türmten sich über dem Urwald auf, und der Wind nahm stetig an Kraft zu. Das Patrouillenboot schoss mit beinahe 35 Knoten durch die Fluten des Rio Uatumá. Der Cabo kümmerte sich um die Frau, die von Fieberkrämpfen geschüttelt wurde. Ihr Zustand wurde von Minute zu Minute bedenklicher, doch der Cabo tat, was er konnte. Er hatte ein fiebersenkendes Mittel verabreicht, dennoch schien ihr ganzer Körper zu glühen.
»Was glaubst du, werden wir es rechtzeitig schaffen?«, fragte der Kommandant.
»Ich hoffe es.«
»Woher stammt sie wohl?«
»Sie ist eine Prostituierte, ich glaube, dass sie nicht aus dieser Gegend stammt. Wahrscheinlich aus irgendeiner Stadt entlang der Küste. Sie war hier wohl irgendwo in einem Camp.«
»Wieso kommst du darauf, dass sie eine Hure ist?«
Der Cabo schaute auf. »Was sollte sie denn sonst so weit entfernt von der nächsten Siedlung mitten im Nirgendwo. Ich glaube, dass die Männer im Boot Holzfäller waren, und wer weiß, ob sie nicht umgebracht worden sind. Wir hätten sie mitnehmen sollen.«
»Das hätte uns nur aufgehalten. Ich musste eine Entscheidung treffen und ich habe mich dafür entschieden, die Frau zu retten. Falls uns das überhaupt gelingt. Um die toten Männer im Boot können wir uns immer noch kümmern.«
Der Cabo nickte. »Sie ist schön und jung. Ich hoffe, dass sie überlebt.«
»Wie weit ist es noch?«, wandte sich der Kommandant an den Steuermann, der das Ortungssystem im Auge behielt. Hier am Rio Uatumá sahen sich die Ufer über viele Kilometer lang ähnlich, und man wusste nie, wo genau man sich befand, wenn man nicht mit moderner Technik ausgestattet war. Und selbst das Funkgerät an Bord des Patrouillenbootes war ebenso unzuverlässig wie das Wetter in diesen Breitengraden. Seit mehreren Minuten versuchte der Funker die Station in São Sebastião zu erreichen. Doch nur ein lautes Knistern drang aus dem Kopfhörer.
»In zwanzig Minuten sind wir in São Sebastião«, gab der Soldat am Ruder zurück. Der Kommandant warf einen nachdenklichen Blick auf die Frau. Der Cabo hatte ihr ein schmerzstillendes Mittel verabreicht, dennoch bäumte sich ihr Körper unter Schmerzen auf.
»Es ist ein Schlangenbiss, vielleicht eine Jararaca.«
»Sie braucht dringend ein Gegengift.«
»Ich hoffe nur, dass in der Krankenstation in São Sebastião ein Antivenin zur Verfügung steht, aber in dieser Gegend werden jährlich über tausend Menschen von Schlangen gebissen, deswegen bin ich überzeugt, dass man der Frau dort helfen kann.«
»Ich habe Kontakt«, schrie der Funker durch das Dröhnen der Motoren.
»Wir treffen in zwanzig Minuten am Anleger ein«, rief der Kommandant. »Sagen Sie, wir haben eine verletzte Frau an Bord, die vermutlich von einer Schlange gebissen wurde. Sie sollen einen Wagen schicken. Es muss schnell gehen, wir haben nicht mehr viel Zeit.«
Der Soldat am Funkgerät bestätigte die Anweisung mit einer Handbewegung.
Der Cabo wischte der Kranken mit einem kühlen Lappen über die Stirn. Seit ein paar Minuten lag sie nur noch still und bewegungslos auf der Trage. Offenbar wirkten die Medikamente. Er richtete sich auf, blickte zuerst auf seine Armbanduhr und dann in Richtung Bug. São Sebastião tauchte am Horizont auf. Es lag unter dunkelblauen Wolken.
Der Kommandant ging zum Steuermann und nahm das Fernglas, das neben dem Steuerrad an einem Haken hing. »Sie warten schon!«
Tatsächlich stand am Anleger ein blauer Kleinbus, davor zwei Männer in weißem Kittel.
Der Steuermann drosselte die Motoren und lenkte das Boot zum Ufer. Ein Soldat warf den wartenden Sanitätern die Leine zu, und nachdem das Boot am Anleger festgemacht hatte, wurde die Frau sofort an Land gebracht.
»Ich fahre mit ihr in die Krankenstation«, sagte der Cabo, nachdem die Soldaten die Trage im Bus befestigt hatten.
Der Kommandant nickte. »Wir warten hier auf dich.«
Noch bevor der Kleinbus das Hafengelände verließ, begann es heftig zu regnen.
3
Brownsville in Miami, Florida
Gene hatte noch eine ganze Weile im Wagen gesessen und das Haus beobachtet, bevor die Temperaturen unerträglich geworden waren. Doch niemand hatte sich blicken lassen. Das ganze Viertel wirkte wie ausgestorben. Selbst auf dem Hialeah Drive war nur spärlicher Verkehr. Der Laden an der Ecke war geöffnet, zumindest stand die Tür weit auf, und eine Gemüsetheke war neben dem Eingang aufgebaut.
Gene hatte Durst. Sein Gaumen war wie ausgetrocknet. Zielstrebig ging er auf das Geschäft zu. Drinnen war es angenehm kühl. Das Klimagerät in der Ecke lief auf vollen Touren. Gene ging zum Getränkekühlschrank und entnahm zwei eisgekühlte Sodawasser. Eine der Flaschen öffnete er sofort und nahm einen kräftigen Schluck.
Hinter dem Verkaufstresen saß eine alte Frau, die ihrem Aussehen nach wohl aus der Karibik stammte. Gene tippte auf Haiti; von dort waren vor ein paar Jahren viele Wirtschaftsflüchtlinge gekommen und hatten sich in Miami und Umgebung niedergelassen. Über dem Tresen hing allerlei Voodoo-Krimskrams: Hühnerkrallen, kleine Püppchen, Ketten und Traumfänger aus Hühnerfedern. Die alte Frau beobachtete Gene argwöhnisch, als er langsam auf die Ladentheke zuschlenderte.
»Ein heißer Tag heute«, begann er das Gespräch.
»Nicht heißer als gestern und auch nicht heißer als morgen«, erwiderte die Frau mit tiefer Stimme.
Gene warf einen Dollar auf den Tisch. »Trotzdem, bei dieser Hitze kann man ja nur trinken, bevor der Hals austrocknet wie die Wüste.«
Die Frau griff nach dem Dollar und verstaute ihn in ihrer Tasche. Der Platz erschien ihr wohl sicherer als die riesige, altertümliche Ladenkasse.
Gene wies auf den seltsamen Schmuck, der über dem Tresen baumelte. »Hilft das denn?«, fragte er und wies auf die Traumfänger.
»Wenn man daran glaubt«, antwortete die Frau abweisend. Gene gewann nicht den Eindruck, dass sie sich gerne unterhielt. Dennoch fragte er sie nach Jean Tarston.
»Ich kenne keinen Jean Tarston«, kam die Antwort. Für Genes Begriffe eine Spur zu schnell.
»Ungefähr meine Größe, weiß, rote Haare«, entgegnete Gene. »Wohnt gegenüber in dem gelben Haus. So viele rothaarige Iren gibt es hier in Brownsville nicht.«
Die Frau zögerte. Gene griff nach einem Zwanziger in seiner Hosentasche. »Heute schon mit Jackson Bekanntschaft gemacht?«
Die Frau schaute auf den Geldschein. »Grant oder Franklin waren bessere Präsidenten«, antwortete sie.
»Ich denke, Jackson und Hamilton tun es auch.« Gene kramte einen Zehner aus der Tasche. »Ich hoffe nur, dass dreißig Dollar mehr Wert sind als dieser Tand.«
Er blickte auf die Traumfänger.
»Such dir einen schönen aus.«
»Also, was ist mit Tarston?«
Die Frau griff nach den Geldscheinen und schob sie in die Tasche ihrer Schürze. »Kein guter Junge«, sagte sie. »Seine Aura ist von schwarzer Magie umgeben.«
»War er in der letzten Zeit hier?«
Die Frau zuckte mit der Schulter. »Habe ihn schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen.«
»Hat er Freunde hier im Viertel, eine Freundin?«
»War mal ein Junge bei ihm. Schwarze Haare, groß und kräftig. Hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Sah aus wie einer der Collegeboys aus den feineren Gegenden. Aber fragen Sie Jake, der war manchmal mit ihm zusammen.«
»Jake?«
»Wohnt auch drüben im Keller, nebenan. Aber ich habe nichts gesagt. Sie sind nicht der Erste, der nach ihm fragt.«
Gene schaute die Frau verwundert an. »Wer hat nach ihm gefragt?«
»War kein Bulle wie Sie, hatte einen Anzug an, der so viel kostet, dass wir mit dem Geld unser Dach reparieren könnten.«
»Ich bin kein Bulle«, antwortete Gene. »Wann war der Kerl hier?«
»Vor einer Woche etwa. Und ich erkenne einen Bullen, wenn er vor mir steht.«
Gene grinste. Er überlegte, was noch für ihn von Interesse sein konnte.
»Hat Tarston einen Wagen?«
»Er fährt eine alte Karre, einen ohne Dach. Er ist rot. Die Marke kenne ich nicht. Für Autos habe ich mich noch nie interessiert.«
Die Frau erhob sich und kam hinter dem Tresen vor. Sie griff nach einem Traumfänger, der aus roten Federn bestand. »Er wird dir Glück bringen«, sagte sie und reichte ihn Gene.
Offenbar hielt die Frau das Gespräch für beendet. Alles in allem ein wenig spärlich für dreißig Dollar, dachte sich Gene, als er zur Tür ging.
»Seien Sie vorsichtig, Mister«, rief ihm die Frau nach. »Der Kerl, der nach dem Rotschopf fragte, trug zwar einen Fünfhundert-Dollar-Anzug, aber er roch nach Schweiß wie ein Stinktier in einem Veilchenstrauß. Und außerdem trug er eine Kanone unter der Jacke.«
São Sebastião do Uatumã, Amazonasgebiet
São Sebastião do Uatumá war eine kleine Stadt. Knapp achttausend Einwohner zählte die Gemeinde, zumeist Caboclos – Mischlinge, die aus Ehen von Europäern mit Indios hervorgegangen waren und ihr Geld mit Landwirtschaft, Fischfang und Kautschukgewinnung verdienten. Ein paar kleinere Hotels waren auf Touristen aus, die Bootstouren auf dem Amazonas unternahmen. Ansonsten gab es hier nur einfache Häuser und Hütten. Eine kleine Krankenstation in der Nähe des Hafens wurde von Geldern der Entwicklungsprogramme des Internationalen Roten Kreuzes finanziert. Zwei Ärzte, eine Ärztin, ein paar Krankenschwestern aus der nahen Mission und drei Krankenpfleger arbeiteten dort und hatten sich auf zwei Jahre verpflichtet. Schlangenbisse und Tropenkrankheiten kamen hier häufig vor, außerdem gab es immer wieder Unfälle bei der Kautschukernte und beim Fischen.
Der Kleinbus brachte die Frau vom Patrouillenboot umgehend in die Krankenstation, auf der die Fahne des Roten Kreuzes wehte und wo es einen ausreichend ausgestatteten Operationssaal und eine kleine Quarantänestation mit eigener Stromversorgung gab. Der Regen war kurz und heftig, deshalb fuhren sie in die kleine Halle, in der sich der Zugang zur Notaufnahme befand. Die Pfleger legten die Bewusstlose auf eine fahrbare Krankenliege und brachten sie in das kleine, verwinkelte Gebäude, wo sie von einem der Ärzte in Empfang genommen wurde. Inzwischen trat Blut aus Nase und Mund.
»Was ist mit ihr passiert?«, fragte der junge, dunkelhaarige Arzt, an dessen Brust ein Namensschild mit der Aufschrift Alonso prangte. Während die Pfleger mit den Schultern zuckten, trat der Cabo aus ihrem Schatten.
»Das weiß ich nicht. Wir fanden sie vor zwei Stunden an der Mündung zum Rio Jatapu in einem Boot. Zwei Männer lagen ebenfalls dort, aber die waren schon tot. Wir konnten ihnen nicht mehr helfen. Vielleicht ist sie von einer Schlange gebissen worden.«
»Bringt sie in den Behandlungsraum!«, befahl Alonso. »Und bereitet vorsichtshalber das Serum vor.«
»Wissen Sie, wie sie heißt?«, wandte sich der Arzt wieder an den Cabo.
»Wir haben keine Papiere gefunden, und in der Nähe gibt es keine Siedlung. Wir glauben, dass sie von der Küste stammt, aus Recife vielleicht oder aus Salvador. Sie muss hier in einem Camp untergekommen sein.«
»Ein Camp, hier in der Gegend?«
»Am Rio Jatapu wahrscheinlich. Illegal, nehmen wir an.«
»Na gut, dann nennen wir sie einfach Maria«, sagte Alonso und griff zu seinem Stift. Am Empfangspult griff er nach einem Aufnahmebogen.
»Wenn man nicht alles selbst macht«, stöhnte der Arzt. »Wollen Sie warten?«
Der Cabo nickte.
*
»Ich habe euch das schon tausend Mal gesagt«, schrie Lila die Pfleger an, »solange wir nicht wissen, was die Patienten haben, kommen sie auf die Isolierstation. Und jetzt bringt sie rüber und hinterher duscht ihr euch und nehmt reichlich Desinfektionsmittel!«
»Aber Doktor Alonso sagte uns …«
»Es ist mir scheißegal, was er euch gesagt hat«, fuhr Lila die beiden Männer an. »Es gibt ganz klare Vorschriften, und wenn wir hier auch mitten im Urwald sind, dann gelten diese Vorschriften dennoch, oder wollt ihr euch einen anderen Job suchen?«
»Na … na … na«, tönte es über den Flur. »Was ist denn hier los?«
Der Chefarzt der Station, Doktor Williamson, kam aus seinem Büro. Er sah verschlafen aus.
»Diese hirnverbrannten Idioten haben eine fiebrige Patientin in den Behandlungsraum gelegt, ohne dass vorher eine Diagnose erstellt wurde«, berichtete Lila barsch.
»Doktor Alonso hat uns gesagt, dass wir sie ins Behandlungszimmer bringen sollen«, rechtfertigte sich einer der Pfleger noch einmal. »Sie hat wahrscheinlich einen Schlangenbiss. Wir sollen das Serum vorbereiten.«
»Na, da haben wir es doch, werte Kollegin«, sagte Williamson zynisch. »Oder wollen Sie die Fähigkeiten von Doktor Alonso in Zweifel ziehen? Er ist schon über ein Jahr hier und Sie erst zwei Monate. Sie müssen noch tüchtig dazulernen, Mädchen.«
Lila hasste den grauhaarigen, alten Mann. Seit über zehn Jahren war er schon hier in Brasilien als Arzt im Auftrag des Roten Kreuzes tätig, doch Lila hatte schon nach einem Monat erkannt, dass er unfähig war. Doktor Williamson stammte aus Schweden und galt in der Gegend als eine Art Wunderheiler bei den einfachen Menschen. Aber Lila, die eigentlich in São Paulo geboren und aufgewachsen war und in New York ihr Medizinstudium mit Auszeichnung bestanden hatte, wusste schnell, was sie von seinen Fähigkeiten zu halten hatte. Eine Flasche Cachaça zu öffnen, fiel ihm deutlich leichter, als einen Verband anzulegen. Und Alonso war ein Geck, ein pomadiger Affe, der hinter jedem einigermaßen ansehnlichen Rock in der Gegend her war und mit seinen Anzüglichkeiten auch bei Lila nicht hinter dem Berg hielt.
Lila Faro war eine attraktive und engagierte junge Frau, die Ärztin aus Überzeugung geworden war. Sie hatte sich freiwillig nach São Sebastião gemeldet, da sie nicht vorhatte, als Assistenzärztin in irgendeinem Krankenhaus in São Paulo zu versauern, sondern einen aktiven Beitrag zum Ausbau des Gesundheitswesens in Brasilien leisten wollte. Nun saß sie seit zwei Monaten im Hospital Santa Catarina fest und der einzige Mensch, mit dem sie reden konnte, war Pater Innocento, der unweit der Stadt eine kleine Mission leitete, in der er sich zusammen mit zwei Schwestern um behinderte Menschen kümmerte. Von Zeit zu Zeit besuchte er das Krankenhaus, doch das war nur ein schwacher Trost für Lila.
Sie wandte sich um und ging ohne ein weiteres Wort den Flur hinab. Auf dem Stuhl neben dem Empfangspult saß ein Offizier der Militärpolizei in Uniform. Als Lila in ihrem weißen Arztkittel an ihm vorüberging, erhob sich der Mann. »Wie geht es ihr?«, fragte er leise.
Lila blieb stehen und wandte sich um. »Sie meinen die Frau mit dem angeblichen Schlangenbiss?«
Der Polizeioffizier nickte.
»Doktor Alonso kümmert sich um sie.«
»Ich befürchte, dass sie nicht überleben wird«, fuhr der Offizier fort. »Sie ist sehr schwach. Das Fieber lässt sich nicht senken. Ich habe alles versucht.«
»Sind Sie Arzt?«
»Ich bin Korporal und Sanitäter auf einem Patrouillenboot der Militärpolizei. Wir fanden die Frau in einem Langboot an der Mündung zum Rio Jatapu. Ihre Begleiter waren bereits tot.«
»Haben Sie den Schlangenbiss diagnostiziert?«
Der Cabo zuckte die Schultern. »Ich nehme an, dass es ein Schlangenbiss ist, aber ich bin mir nicht sicher. Einige der Symptome sprechen dafür, andererseits habe ich für ihre Krämpfe keine Erklärung. Meistens werden die Menschen schwach, fiebrig und matt. Sie hatte aber krampfartige Schmerzen, die ich noch nie erlebt habe. Außerdem hatte ihr Blut eine eigenartige Farbe.«
»Sie hat geblutet?«
»Aus dem Mund«, bestätigte der Cabo. »Ich dachte mir, sie hat sich selbst gebissen.«
»Wie ist Ihr Name, Senhor?«
»Nennen Sie mich Cabo, das tun alle. Meinen richtigen Namen habe ich fast schon vergessen.«
»Also gut, Cabo, gehen Sie sofort zur Schwester«, sagte Lila besorgt. »Sie müssen duschen und sich desinfizieren.«
Der Cabo schaute überrascht.
»Wir sind hier im Dschungel«, erklärte Lila. »Wir müssen hier mit allem rechnen. Sobald Sie sich geduscht haben, möchte ich Sie untersuchen.«
Eine Schwester kam den Gang entlang.
»Schwester Marita!«, rief Lila die Frau zu sich. »Kommen Sie mit, Sie müssen mir helfen!«
4
Brás am Rio Jatapu, Amazonasgebiet
Die belgische Expeditionsgesellschaft war gegen Morgen, als die Sonne den Nebel vertrieben hatte, von Brás aufgebrochen, um dem verschlungenen Flusslauf des Rio Jatapu nach Süden zu folgen.
Die drei belgischen Naturforscher wurden von erfahrenen Ribeirinhos begleitet. Ureinwohnern, die schon seit Generationen am Fluss lebten und jeden Abschnitt dieses Flusslaufes wie ihre Westentasche kannten. Am Ende der Trockenzeit waren die ufernahen Schwemmgebiete an den Flüssen, Várzeas genannt, nahezu leergelaufen. Erst wenn die großen Ströme aus dem Westen im Oktober wieder Unmengen an Wasser dem mächtigen Amazonas zuführten, würde aus großen Teilen des Regenwaldes wieder ein einzigartiger großer See werden und das Leben in die Pflanzen zurückströmen. Und diese Zeit stand unmittelbar bevor, denn die ersten heftigen Stürme kündeten bereits vom Beginn der Regenzeit.
Die drei Langboote folgten den Schleifen des Rio Jatapu. Das nächste Ziel der Reise, São Sebastião, lag zwar nur knapp siebzig Kilometer Luftlinie entfernt, doch der Fluss schlängelte sich derart durch das Land, dass tatsächlich beinahe einhundertzwanzig Kilometer auf dem Wasser zurückzulegen waren.
Nur einmal verharrte die kleine Expedition auf dem strömungsarmen Wasserlauf, als ein paar Botos, graue Süßwasserdelfine, ihren Weg kreuzten. Beinahe zweihundert Fotos schossen die Belgier, ehe die Botos offenbar keine Lust mehr auf ein weiteres Fotoshooting verspürten und in die dunklen Fluten abtauchten. Einer der Ruderer hatte die Gelegenheit zum Fischen genutzt und zur Freude aller Expeditionsteilnehmer einen großen Tucunaré gefangen. Der wohlschmeckende Fisch wog beinahe zehn Kilo und würde den Speiseplan am heutigen Abend angenehm bereichern.
Sie setzten ihre Fahrt fort und folgten einer weiteren Schleife des Flusses, als plötzlich nach leichten Stromschnellen ein paar Hütten am bewaldeten Flussufer auftauchten. Die Ribeirinhos, die das erste Boot steuerten, schenkten den Hütten keine weitere Beachtung. Nur kurz tuschelten sie miteinander.
»Was sagen sie?«, fragte einer der belgischen Forscher seinen Kollegen, der die Sprache der brasilianischen Flussbewohner einigermaßen verstand.
»Cangaceiros«, wiederholte der belgische Expeditionsleiter. »Sie meinen, das ist das Camp von Banditen.«
»Banditen?«
»Holzräuber«, bestätigte der Expeditionsleiter. »Die brasilianische Holzmafia ist hier beinahe genauso gut organisiert wie die Mafia bei uns in Europa. Sie schlagen Edelhölzer wie das Pau Brasil und Jacarandá oder roden ganze Urwaldflächen für die Fazendeiros, die darauf ihre Tiere grasen lassen oder Früchte anbauen. Der Boden hier gibt nicht viel her, spätestens nach zwei Jahren ist er ausgelaugt, und es wächst kein Korn mehr darauf. Dann ziehen die Bauern weiter und beackern neue Flächen. Man sollte denken, dass es hier überall fruchtbar ist, aber das stimmt nicht. Landwirtschaft ist eigentlich nur auf ganz kleinen Flächen möglich, wo es die sogenannte Terra preta, die schwarze Erde, gibt.«
»Dazu kommen noch unzählige Garimpeiros, illegale Goldsucher, die den Urwald im Norden durchstreifen«, mischte sich der einheimische Ruderer ein.
Sie passierten die Ansammlung von Hütten und ließen den kleinen Palmenwald hinter sich, als sie plötzlich am Ufer mehrere reglose Körper erspähten, die im brackigen Wasser trieben.
»Um Gottes willen!«, rief einer der Expeditionsteilnehmer aufgeregt. Sieben männliche Leichen, zum Teil mit nacktem Oberkörper, trieben im Fluss. Ein süßlicher Verwesungsgeruch lag in der Luft.
»Was ist da bloß passiert?«, fragte der Expeditionsleiter einen Ruderer.
»Hier gab es eine illegale Siedlung«, antwortete er. »Entweder war die Militärpolizei hier, oder es gab einen Kampf mit einer anderen Bande. Wir müssen hier verschwinden. Es ist nicht gut, wenn man uns sieht.«
Die Ruderer legten sich ins Zeug, und die drei Boote nahmen rasch Fahrt auf.
»Aber wir können die Toten doch nicht einfach hier zurücklassen«, protestierte der Expeditionsleiter. »Was ist, wenn an Land noch jemand am Leben ist?«
Einer der Bootsführer schüttelte den Kopf. »Wenn man uns hier sieht, dann treiben bald unsere toten Körper im Wasser. Hier im Wald gibt es kein Gesetz, hier ist jeder sich selbst der Nächste. Und solche Kämpfe gibt es immer wieder, wenn sich die Banden um ertragreiche Plätze streiten. Und jetzt rudert, wenn ihr heute noch nach São Sebastião kommen wollt!«
Der Expeditionsleiter holte tief Luft, dann stieß er die Ruder mit aller Kraft in das Wasser. Seinen stillen Protest schluckte er einfach hinunter.
Brownsville in Miami, Florida
Jake war ein Riese mit bronzefarbener Haut und Muskelpaketen, die selbst Profiboxer hätten neidisch werden lassen. Doch er war weder besonders intelligent, noch mochte er unangemeldete Besuche. Nachdem Gene mehrfach geklopft hatte, riss Jake die Tür auf und baute sich vor ihm auf.
»Was soll das, Mann!«
Gene lehnte sich locker an den Türrahmen und grinste den Muskelprotz unbeeindruckt an.
»Bist du von der Bewährungsaufsicht oder bist du ein Bulle?«
Gene spielte den Coolen, wenngleich er wusste, dass er nur geringe Chancen hatte, wenn dieser Riese erst einmal in Wallung kam. »Was wäre dir lieber?«
»Wer sind Sie?«
»Sagen wir, ich habe ein paar Fragen. Und wenn mich deine Antworten zufriedenstellen, bin ich auch schon wieder weg.«
»Also doch ein Bulle.«
Gene blieb ungerührt. »Hier draußen, oder gehen wir rein?«
Jake trat einen Schritt zur Seite und gab den Weg frei. Gene ging durch den kurzen Flur in das einzige Zimmer, das es hier in dieser Kellerwohnung gab. Überall lagen Klamotten umher. Es war unordentlich und schmuddelig. Nur in einer Ecke des Zimmers, dort wo ein Trimmgerät mit Gewichten stand, schien es etwas aufgeräumter.
»Was willst du von mir, Bulle?«, fragte Jake, der in seinem eigenen Reich offenbar wieder Fassung gewonnen hatte. Gene kannte diese Sorte Menschen noch gut aus seiner Dienstzeit. Sobald sie ihr Gegenüber nicht einschätzen konnten, wurden sie unsicher. Doch auf heimischem Terrain waren sie wie Hunde, die ihr Revier verteidigten.
»Ich suche nach Tarston«, sagte Gene und suchte nach einer Sitzgelegenheit. Er beschloss, weiterhin den Überlegenen zu spielen, wischte ein paar Zeitschriften von einem Stuhl und ließ sich locker darauf nieder.
»Tarston wohnt nebenan«, kam es zurück.
»Oh, ein Intelligenzbolzen. Da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«
»Ich interessiere mich nicht für ihn.«
»Bewährungshilfe, soso«, antwortete Gene gelassen. »Wir können uns auch auf dem Revier weiter unterhalten.«
»Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Er ist schon seit drei Wochen nicht mehr hier gewesen.«
»Er hatte einen Freund, so einen dunkelhaarigen Collegeboy, du erinnerst dich bestimmt an ihn. Er passt eher nach Miami Beach als in diese Gegend.«
»Was ist mit ihm?«
»War er bei ihm, als du ihn das letzte Mal gesehen hast?«
»Ich habe keine Ahnung«, entgegnete Jake und setzte sich im Schneidersitz auf den Boden.
»Du trainierst?«
»Sieht man doch.«
»Bist du gut?«
»Gut wofür?«
»Sagen wir, im Ring. Wie viele Runden hältst du durch?«
»Ich bin zufrieden.«
»Dann sorge dafür, dass es so bleibt. Sonst boxt du neuerdings wieder für das Big Pine Team.«
»Mann, warum könnt ihr Bullen einen nicht einfach in Ruhe lassen. Ich habe weder mit Tarston noch mit dem Collegeboy was am Hut. Er wohnt nebenan, das ist alles.«
»Ich weiß, dass ihr zusammen früher durch die Vorstadt gezogen seid.«
»Mann, das ist ein ganzes Leben her. Tarston war in der letzten Zeit nur noch abgedreht.«
Gene horchte auf. »Hatte er ein Ding am Laufen?«
Jake lachte laut. »Er hatte immer Dinger am Laufen, aber nichts klappte. Er ist ein typischer Loser. Aber frag nicht mich, Bulle. Frag seinen Bruder.«
»Er hat einen Bruder?«
»Ja, Mann«, antwortete Jake gedehnt. »Schaut ihr eigentlich nie in eure Bullencomputer, wenn ihr nach jemandem sucht? Sein Bruder war in letzter Zeit ein paar Mal hier. Ist so ein glatzköpfiger White-Army-Typ mit einer Kriegsbemalung an den Armen, dass man meinen könnte, von hier bis hinauf nach Norland gäbe es keine Farbe mehr.«
»Wo finde ich den Bruder?«