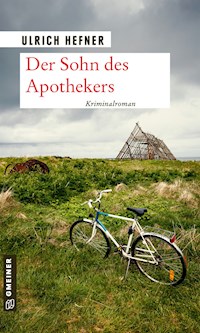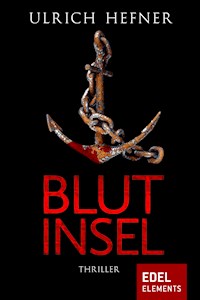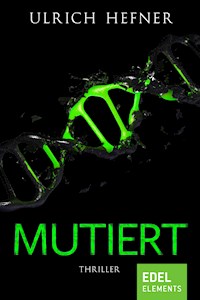5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um das Überleben der Menschheit hat begonnen ... USA, Frühjahr 2004: Monsterhurrikans und Flutwellen biblischen Ausmaßes verwüsten die Küsten, Millionen Menschen fürchten um ihr Leben. Ist eine weltweite Klimakatastrophe die Ursache? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Während die Wissenschaftler Brian und Suzannah dies herauszufinden versuchen, ahnen sie nicht, dass sie dabei auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Denn sie sind einem hoch geheimen Experiment auf der Spur, das die ganze Menschheit bedroht ... Brillant erzählt, erschreckend real – der mitreißendste Öko-Thriller seit "Der Schwarm".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 953
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Der Kampf um das Überleben der Menschheit hat begonnen ...
USA, Frühjahr 2004: Monsterhurrikans und Flutwellen biblischen Ausmaßes verwüsten die Küsten, Millionen Menschen fürchten um ihr Leben. Ist eine weltweite Klimakatastrophe die Ursache? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Während die Wissenschaftler Brian und Suzannah dies herauszufinden versuchen, ahnen sie nicht, dass sie dabei auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Denn sie sind einem hoch geheimen Experiment auf der Spur, das die ganze Menschheit bedroht ...
Brillant erzählt, erschreckend real – der mitreißendste Öko-Thriller seit „Der Schwarm“.
Ulrich Hefner
Die dritte Ebene
Thriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Ulrich Hefner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-027-3
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Es gibt keinen Frieden, es gibt nur die Zeit zwischen den Kriegen …
Für meine Mutter, die in der Nacht auf den 5. Februar 2006
Hauptpersonen
Dr. Brian Saint-Claire, Parapsychologe und Journalist aus Long Point View, Kanada.
Dr. Suzannah Shane, Psychologin und Schlafforscherin an der Universität von Chicago.
Professor Dr. Wayne Chang, Meteorologe und Geophysiker beim National Weather Service in Camp Springs.
Sheriff Dwain Hamilton, Sheriff im Socorro County in New Mexico.
Professor James Paul, Leiter des Space-Shuttle-Programms der NASA in Cape Canaveral.
Professor Cliff Sebastian, Leiter der meteorologischen Abteilung der National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder, Colorado.
Dr. Antony Schneider, Kollege von Wayne Chang beim National Weather Service in Camp Springs.
Dr. Allan Clark, Leiter des National Hurricane Center in Miami, Florida.
Gerad Pokarev, genannt Porky, Chefredakteur des ESO-Terra-Magazins in Cleveland.
PROLOG
Oktober 2003
Socorro County, New Mexico
Die Frau hetzte durch den beginnenden Morgen, ihre Füße waren von blutigen Schrammen übersät, und Schweißtropfen rannen ihr über die Stirn. Ihr Brustkorb hob und senkte sich im rasenden Takt der Angst und der Erschöpfung. Ihre Lunge schmerzte, und Tränen liefen ihr über die alabasterfarbenen Wangen. Alles Blut war aus ihrem Gesicht gewichen.
Sie war auf der Flucht und wusste weder aus noch ein. Nur mit einem Nachthemd und einem Morgenmantel bekleidet, ohne Schuhe und Strümpfe hastete sie durch das Wäldchen. Mit jedem Schritt entfernte sie sich weiter von dem Ort des Grauens. Die Kälte des Oktobertags spürte sie nicht, sie hatte nur ein Ziel: Entkommen!
Bestimmt waren die Kerle in den schwarzen Anzügen längst hinter ihr her. Sie wusste, dass in der Nähe eine Straße durch das sandige Tal führen musste, nur wo genau sie verlief, das wusste sie nicht. Sosehr sie sich auch zu konzentrieren versuchte, immer wieder wurden ihre Gedanken durch grellfarbene Explosionen in ihrem Kopf durchbrochen. Vielleicht wäre es das Beste, sich einfach auf den Boden zu legen und auf den Tod zu warten. Den Tod, der einer Erlösung für sie gleichkommen würde. Doch sie lehnte sich mit aller Macht gegen die innere Müdigkeit auf. Sie musste es einfach schaffen, nur so würde die Welt von den Grausamkeiten erfahren, die man ihr angetan hatte.
Sie verharrte eine Weile und schaute hinunter ins Tal. Insgeheim hoffte sie, dass ein Scheinwerferlicht den wabernden Nebel durchdringen und ihr den weiteren Weg weisen würde. Doch sie hoffte vergebens. Allein die Nebelschwaden zogen an ihr vorüber, und durch den jungen Tag hallte das Gezwitscher der Vögel, das bald durch ein anderes Geräusch überlagert wurde – ein bedrohliches Brummen, das unaufhaltsam näher kam.
Eine Woge des Schmerzes überflutete ihren Kopf. Sie presste die Hände gegen die Schläfen. Der Schmerz verzog sich so plötzlich, wie er gekommen war. Sie tastete über ihre kurz geschorenen Haare. Tränen liefen ihr über die Lippen. Sie hätte am liebsten geschrien, aber der Laut blieb ihr im Hals stecken. Wallende Locken hatten ihr bis über die Schultern gereicht, und sie war immer stolz auf ihre Haarpracht gewesen, doch nun waren nicht viel mehr als einen Zentimeter lange Stoppeln übrig geblieben. Lange Haare seien unpraktisch, hatten die Männer gesagt, bevor sie ihr die Locken kurzerhand abgeschnitten hatten. Seither hatte sie keinen Blick mehr in einen Spiegel geworfen.
Das Brummen entfernte sich, nahm eine andere Richtung. Sie atmete auf. Dann hetzte sie den Abhang hinunter, rannte über sandigen Boden, bevor sie erneut in ein Wäldchen eintauchte und eins mit den dichten Nebelschwaden wurde.
Kennedy Space Center, Florida
Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Die dampfende Trägerrakete vom Typ Delta IV im Startgerüst des Kennedy Space Center war startbereit. Die große Digitaluhr über der Videoleinwand im Kontrollzentrum zeigte noch drei Minuten bis zum Start, und die Augen der Mitarbeiter waren gebannt auf ihre Terminals gerichtet. Der Flightcommander hatte die grüne Lampe aktiviert. Alle Systeme arbeiteten innerhalb der Norm.
Commander Nicolas Leach beobachtete argwöhnisch das Kontrollpaneel und schickte leise ein letztes Stoßgebet gen Himmel. Die Auslastung des Startgewichts lag im Grenzbereich, aber der verantwortliche Ingenieur hatte seine Bedenken mit einem Wink beiseitegeschoben.
»Wenn wir wollen, dann schießen wir Ihnen ein ganzes Hochhaus in den Himmel«, hatte er gesagt, bevor er hinter seinem Kontrollpult Platz genommen hatte.
Im gesicherten und abgeschirmten Nutzlastcontainer der ersten Delta-Stufe befand sich eine wertvolle Fracht. Mit knapp 2,7 Tonnen war der Satellit mit dem geheimnisvollen Namen Prophet 1 um knapp 400 Kilogramm schwerer geworden als ursprünglich geplant. Dies lag an der extrem leistungsfähigen Stromquelle, die nachträglich in den Flugkörper eingebaut worden war. Der Satellit, der zu einer Reihe von künstlichen Himmelskörpern gehörte, die in den nächsten Wochen der Nummer 1 folgen sollten, war Bestandteil eines Navy-Projekts, das zur Verbesserung der Überwachung der südöstlichen Pazifikregion diente.
Nördlich des zwanzigsten Breitengrades sollte Prophet 1 etwas mehr als 200 Kilometer vor der Küste des Kontinents in geostationärer Position verankert werden. Für die erfahrenen und routinierten Techniker auf Cape Canaveral stellte dieser Raketenstart nicht viel mehr dar als eine weitere Mission in ihrem prall gefüllten Terminkalender, doch für Commander Nicolas Leach war er die Krönung seines Lebenswerks. Knapp eine Milliarde US-Dollar und zwanzig Jahre intensiver Forschung standen auf dem Spiel, und angesichts des Sparkurses, der ihnen verordnet worden war, konnte jeder Fehler das plötzliche und jähe Ende seiner Bemühungen bedeuten. Nicht allein deshalb kribbelten Nicolas Leach die Finger. Ihm standen dicke Schweißperlen auf der Stirn.
Highway 60, Socorro County, New Mexico
Gene Morgan hatte ein gutes Gefühl, als er mit seinem Laster über den Highway 60 von Magdalena nach Socorro donnerte. Er hatte die Interstate 40 bei Chambers verlassen, weil es kurz vor Gallup einen schweren Unfall gegeben hatte, und war über Saint Johns nach Quernado hinuntergefahren. Damit hatte er sich einen großen Umweg erspart, denn die Polizei leitete den Verkehr über die nördlichen Nebenstraßen an der Unfallstelle vorbei, was zu kilometerlangen Staus führte.
Der Dieselmotor seines Peterbilt Freewheelers schnurrte vor sich hin, und aus dem Radio erklang gedämpft Countrymusik. Gene war mit Leib und Seele Fernfahrer. Den Truck hatte er sich auf Pump gekauft, doch in den letzten Monaten hatte es nicht an Aufträgen gemangelt. Der Auflieger seines Trucks war randvoll gefüllt mit Fernsehern, DVD-Playern und Digitalrecordern für einen Elektronik-Großmarkt, der in Kürze seine Pforten öffnen würde. Der Auftrag war gut bezahlt, und für den Rückweg nach Houston war bereits die nächste Ladung gebucht. Er wusste, dass er seinen Erfolg im Frachtgeschäft seiner Frau verdankte, denn seit sie die Disposition übernommen hatte, fuhr er immer weiter in die Gewinnzone. Ihm war es egal, was er hinter sich auf der Ladefläche transportierte, Hauptsache, es stank nicht und brachte reichlich Bucks auf sein Bankkonto.
Er freute sich auf das Wochenende, wenn er mit Rita nach Del Rio fahren würde, um dort auf dem großen Truckertreffen alte Bekannte wiederzusehen. Das würden ein paar lange und feuchte Nächte werden. Mit den Fingern schlug er auf dem Lenkrad den Takt. Es kam ihm vor, als sei die Musik früher besser gewesen, gefühlvoller, harmonischer, ja, auch eine Spur ehrlicher als der Kram, der heutzutage die Charts rauf- und runterdudelte.
Es war kurz vor Socorro, als die Frau plötzlich wie aus dem Nichts durch die morgendlichen Nebelfetzen mitten auf seiner Fahrbahn auftauchte. Mit voller Wucht presste er den rechten Fuß auf die Bremse. Die Reifen des Peterbilt kreischten, und der Laster schlitterte über die feuchte Fahrbahn. Fast schien es, als wollte die Rutschpartie kein Ende nehmen. Das Ächzen und Stöhnen des Trucks schmerzte ihm in den Ohren. Eine Sekunde später holperte der Lastzug über den Randstreifen und schlitterte eine kleine Böschung hinunter. Ein erschütternder Schlag beendete die Fahrt, und der Laster knallte gegen einen Baum, wo er schließlich zum Stehen kam.
Gene fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, was geschehen war. Mit zitternden Knien stieg er aus. Sein Gesicht war kalkweiß. Im morgendlichen Dämmerlicht suchte er mit den Augen die Umgebung ab. Doch niemand war zu sehen. Hatte er sich das alles nur eingebildet? Er hätte schwören können, dass eine Frau in einem hellen Morgenmantel direkt vor ihm auf der Straße gestanden hatte. Ihm wurde flau im Magen. Hatte er sie etwa überfahren?
Er trat vor den Laster. Der Rammschutz hatte ihn vor größerem Schaden bewahrt, auch wenn der Baum nahezu entwurzelt war. Aber seine Sorge galt im Moment etwas anderem. Er suchte nach Blut, nach einem Fetzen Stoff, nach einem Hinweis auf die Frau, doch er fand nichts. Das Chrom des Stoßfängers glänzte nahezu unberührt. Erleichtert atmete er auf. Er umrundete den Wagen und fluchte, weil sich die Reifen tief in den sandigen Boden eingegraben hatten. Aus eigener Kraft würde er es nicht schaffen, den Wagen aus dem feuchten Untergrund zu befreien. Langsam ging er zurück zur Straße. Er folgte den frischen Profilspuren der Reifen. Durch die milchigen Nebelfetzen lief er zu der Stelle, an der er die Frau gesehen hatte. Plötzlich hörte er ein leises Wimmern, und ein Schreck durchzuckte seinen Körper. Er hatte nicht geträumt. Die Frau kauerte am Straßenrand und verbarg das Gesicht in den Händen. Das Wimmern verstummte, als er sich näherte. Mit weit aufgerissenen Augen schaute sie auf.
»Lady, ist Ihnen etwas passiert?«, fragte er.
Die Frau wirkte wie ein Gespenst aus einer anderen Welt.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Sie versuchte sich zu erheben, doch ihre Beine knickten ein. Er sprang hinzu und stützte sie. Behutsam ließ er sie wieder zu Boden gleiten. Irgendetwas stimmte hier nicht. Was tat eine Frau im Morgenmantel, noch dazu ohne Schuhe, weitab von der nächsten Stadt mitten auf der Straße? Er musterte sie, doch außer ein paar Schrammen an Armen und Beinen konnte er keine Verletzung entdecken.
»Bleiben Sie hier liegen. Ich hole eine Decke.«
Gene wandte sich um, doch die Frau griff nach seinem Arm. Wie eine Ertrinkende krallte sie sich an ihm fest.
»Helfen Sie mir! Bitte, gehen Sie nicht!«
Ihre Worte waren ein einziges Flehen.
»Ich hole nur eine Decke und mein Handy«, erwiderte Gene. »Ihnen muss kalt sein. Außerdem brauchen wir Hilfe. Der Truck steckt im Sand fest.«
Noch bevor die Frau antworten konnte, näherte sich ein dunkler Geländewagen und hielt gegenüber am Straßenrand an. Gene Morgan atmete auf. Zwei Männer stiegen aus dem Jeep und rannten über die Straße. Sie trugen dunkle Anzüge und wirkten auf den ersten Blick wie Geschäftsleute, die geradewegs aus ihren hell erleuchteten Büros einer Stadt im Osten kamen. Der Griff der Frau verstärkte sich. Gene musterte die beiden.
»Es gab einen Unfall«, stammelte er. »Sie stand plötzlich direkt vor mir auf der Straße.«
Der eine Mann – er hatte dunkles, welliges Haar – nickte kurz und gab seinem Begleiter ein Zeichen, woraufhin der andere nach der Frau griff. Gene schaute ihn ungläubig an. Die Frau zuckte zusammen und krallte die Fingernägel schmerzhaft in seinen Arm. Ihr panischer Blick blieb ihm nicht verborgen.
»Was soll das?«, protestierte Gene. »Was haben Sie mit ihr vor?«
Der Dunkelhaarige langte in seine Jackentasche, und einen Augenblick lang dachte Gene, dass sein letztes Stündlein geschlagen habe, doch als die Hand des Mannes wieder auftauchte, brachte er ein Mäppchen mit seiner Dienstmarke zum Vorschein. Gene entspannte sich, als er den Adler im Wappen erkannte, doch bevor er den daneben steckenden Ausweis lesen konnte, wurde das Mäppchen wieder zugeklappt. »Wir sind schon seit Stunden auf der Suche nach ihr«, sagte der Dunkle. »Diesmal hat sie es verdammt weit geschafft. Sie haben uns sehr geholfen, Mister.«
Gene zog die Stirne kraus. »Was ist mit ihr?«
Während der andere mit einem kräftigen Ruck die Finger der Frau von Genes Arm löste und sie gegen ihren vergeblichen Widerstand zum Wagen führte, vollführte der Dunkelhaarige eine eindeutige Geste vor seiner Stirn. »Sie ist nicht ganz beieinander. Ausgebüxt aus der Nervenheilanstalt in Socorro. Leidet unter Verfolgungswahn und sieht überall Gespenster.«
Jetzt entspannte sich Gene ein wenig. Er schüttelte erleichtert den Kopf.
Bevor der Begleiter des Dunkelhaarigen die Frau in den Jeep bugsieren konnte, wandte sie sich noch einmal um. »Helfen Sie mir!«, rief sie herüber. Dann wurde sie in den Wagen geschoben und verschwand hinter den abgedunkelten Scheiben.
Trotz des Dienstausweises des Mannes wusste Gene noch immer nicht so recht, wie er sich verhalten sollte, wenngleich Kleidung und Zustand der Frau durchaus darauf schließen ließen, dass sie aus einer Irrenanstalt entlaufen war.
»Wenn ich mich nicht täusche, liegt Socorro knapp fünf Kilometer von hier entfernt«, sagte er. »Sollten wir nicht den Sheriff holen? Schließlich hat sie einen Unfall verursacht, und ich kriege den Truck allein nicht mehr aus dem Graben. Ich meine, ich habe Ladung an Bord. Was, wenn etwas beschädigt ist?«
Der Dunkelhaarige schaute hinüber zum LKW. »Der Sheriff ist ebenfalls auf der Suche nach ihr. Wir werden ihn über Funk verständigen und einen Abschleppwagen anfordern. Um den Schaden machen Sie sich keine Sorgen, der Sheriff kennt die Frau. Sie hat nicht zum ersten Mal auszubrechen versucht.«
Grinsend drehte sich der Dunkelhaarige um und ging hinüber zu seinem Wagen.
Gene nickte. »Dann warte ich hier solange.«
»Was bleibt Ihnen anderes übrig?«, sagte der Dunkle lachend. »Aber es kann noch eine halbe Stunde dauern, der Sheriff ist gerade oben bei Bernardo.«
Nachdem der Mann eingestiegen war, brauste der Jeep in Richtung Magdalena davon. Gene versuchte noch einen Blick auf das Kennzeichen des Wagens zu erhaschen, doch mehr als die Anfangsbuchstaben REI konnte er nicht erkennen. Er ging zurück zu seinem Laster, stieg in das Führerhaus und wartete. Der Dunkelhaarige hatte recht, was konnte er schon anderes tun?
Nachdem er zwei Stunden vergeblich gewartet hatte, griff er zum Handy und wählte die Notrufnummer. Auf seine Frage, wo denn der Sheriff bleibe, reagierte die Telefonistin erstaunt. Sie wisse weder von einem Unfall noch von der Suche nach einer vermissten Frau, aber den Sheriff werde sie benachrichtigen.
Eine weitere Stunde später tauchte ein blau-weiß lackierter Ford Maverick mit blauen und roten Rundumleuchten auf. Das Wappen des Sheriff-Departments von Socorro prangte an den Türen. Ein zwei Meter großer Hüne von der Statur eines Ringers stieg aus dem Wagen und kam auf den LKW zu. Die braune Uniform und der goldene Stern über der Brust wiesen ihn als Hüter des Gesetzes aus.
Gene wartete geduldig, bis der Sheriff den LKW umrundet hatte.
»Wohl noch ein bisschen müde heute Morgen?«, raunte der Sheriff und musterte Gene von oben bis unten.
»Ich musste dieser Frau ausweichen, dieser Irren, nach der Sie die ganze Zeit gesucht haben«, entgegnete Gene. »Sie stand plötzlich mitten auf der Straße. Ihre Kollegen haben sie mitgenommen und mir versprochen, einen Abschleppdienst zu rufen.«
»Wir suchen keine Irre, und meine Kollegen fahren bestimmt nicht hier draußen spazieren. Wir haben anderes zu tun.«
Gene verschlug es einen Moment lang die Sprache, doch auch als er den Rest der Geschichte erzählte, blieb die Miene des Sheriffs starr.
»Ich denke, ich rufe Ihnen einen Abschleppdienst, der Sie hier herauszieht, außerdem zahlen Sie dreißig Dollar Strafe«, entgegnete der Sheriff. »Und das nächste Mal, mein Junge, schlafen Sie richtig aus, bevor Sie sich hinters Steuer setzen und mir solche Lügenmärchen auftischen.«
»Aber ich erzähle Ihnen doch keinen Mist«, protestiere Gene Morgan. »Die Frau saß hier im Gras. Sie war barfuß und nur mit einem Morgenmantel bekleidet. Sie müssen mir glauben.«
»Es sollte mich schwer wundern, wenn sich eine Frau im Morgenrock und noch dazu ohne Schuhe von Albuquerque in diese Gegend verirrt«, erwiderte Sheriff Hamilton.
»Wieso Albuquerque? Die Kerle sagten Socorro.«
»Mein Junge, die nächste Irrenanstalt ist in Albuquerque, Hier draußen gibt es im Umkreis von sechs Kilometern nur Steine, Hügel, Bäume und Sand. Ein paar Hütten allenfalls, aber bestimmt keine Irrenanstalt. Also was ist, zahlen Sie die dreißig Dollar, oder soll ich den Richter anrufen?«
Entmutigt griff Gene nach seiner Brieftasche.
ERSTES BUCH
Visionen
Frühling 2004
1
Cumaná, Venezuela
Der Flug in der einmotorigen Piper der Linea Turistica Aerotuy unterhalb der dichten Wolkendecke von Cumaná nach Ciudad Guayana verlief geräuschvoll und unruhig. Brian Saint-Claire schaute aus dem Kabinenfenster auf die ausgedehnten Wälder. Unter ihm lag eine einzige grüne Weite, die sich bis zum Horizont erstreckte.
Der Pilot, ein braun gebrannter und bärtiger Venezolaner aus Apure, warf hin und wieder einen besorgten Blick auf die tiefschwarzen Regenwolken, die sich im Westen zu einer gigantischen Sturmfront aufgetürmt hatten. Brian hing schweigend seinen Gedanken nach. Er dachte an den heftigen Streit mit Cindy und ihren theatralischen Abgang vor knapp einer Woche. Seither hatte er nichts mehr von ihr gehört. Dieser Trip nach Südamerika war genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen und würde ihn hoffentlich auf andere Gedanken bringen. Er sollte für ein Magazin mit dem geheimnisvollen Namen ESO-Terra eine Reportage über eine Schamanin der Warao-Indianer verfassen, die in einem kleinen Dorf irgendwo im Orinoco-Delta lebte. Den Schilderungen einiger Augenzeugen zufolge hatte die Frau neben der Gabe der Levitation noch weitere bemerkenswerte psychokinetische Fähigkeiten. Doch wie viel Wahrheit hinter den Erzählungen steckte, blieb abzuwarten. Oft genug hatten ihn seine Exkursionen auf den Spuren übernatürlicher Phänomene zu irgendwelchen Spinnern, Fantasten und Hochstaplern geführt, deren einzige außergewöhnliche Fähigkeit es war, gutgläubige Mitmenschen hinters Licht zu führen.
Für Brian, der an der Universität von Chicago Psychologie und Philosophie studiert und dann eine Ausbildung in Parapsychologie absolviert hatte, war das nichts Neues. Als Parapsychologe wusste er sehr wohl Betrügereien und Zaubertricks von echten metaphysischen Erscheinungen zu unterscheiden, wobei Letztere im Vergleich zu Ersteren äußerst rar waren. Brian war gespannt, was ihn diesmal erwartete. Doch selbst wenn er sich wieder einmal vergeblich auf eine lange Reise begeben hatte, so war es eine willkommene Gelegenheit, sich von dem heftigen Streit mit Cindy zu erholen. Außerdem wurde er für seine Arbeit gut bezahlt.
Brian Saint-Claire mit seinen welligen dunkelblonden Haaren und der Ausstrahlung eines Hollywoodschauspielers sah man seine vierzig Jahre nicht an.
Das Leben war für ihn ein einziges unergründliches Abenteuer – und somit waren Gleichförmigkeit, feste Gewohnheiten und eine tiefe Beziehung kaum mit seinem Rhythmus vereinbar. Die Vorstellung, zu heiraten und Kinder großzuziehen, so wie Cindy es sich wünschte, jagte ihm Angst ein.
Die Piper hüpfte im aufkommenden Wind auf und ab. Die Gewitterfront raste auf sie zu. Blitze zuckten aus den Wolken der Erde entgegen, und der Pilot fluchte laut.
»Was für ein schreckliches Jahr«, raunte er auf Spanisch. »Die Stürme nehmen kein Ende. Es ist die Strafe Gottes für die Menschen, die ein gottloses Leben führen.«
Brian nickte und schaute auf seine Uhr. Wenn ihn nicht alles täuschte, dann müssten sie ihr Ziel in Kürze erreichen. Suchend warf er einen Blick aus dem Fenster, doch wohin er auch sah, war er umgeben von grünem Dschungel.
»Vorgestern ist vor La Guaira eine Fähre im Sturm gesunken«, fuhr der Pilot fort, scheinbar unbeeindruckt von der Wolkenfront, die immer näher kam. »Es heißt, die Wellen waren so hoch wie die Wolkenkratzer in Caracas. Sie haben das Schiff einfach verschluckt. Hundert Menschen waren an Bord. Sie kamen von Curaçao. Keiner konnte mehr lebend geborgen werden.«
Der Pilot beobachtete amüsiert die Wirkung seiner Worte.
Brian wurde langsam unruhig. Nicht, dass er ein ängstlicher Mensch war, ganz im Gegenteil, er hatte so manches Abenteuer überstanden, doch er wusste immer seine Chancen einzuschätzen. Und angesichts der gewaltigen Gewitterfront schienen die Chancen in diesem kleinen und klapprigen Flugzeug gegen null zu gehen.
»Wie lange dauert es noch?«, rief er dem Piloten in fließendem Spanisch zu.
Der Pilot wies in nördliche Richtung, und Brians Augen folgten dem Daumen, doch er musste sich gewaltig strecken, um einen Blick aus dem Seitenfenster des Piloten zu erhaschen. Die Landschaft dort wechselte ihr Gesicht. Der Wald blieb zurück, und stattdessen tauchten Häuserdächer am Horizont auf.
»Ciudad Guayana«, sagte der Pilot. »In zehn Minuten werden wir landen. Es wird holperig, aber wir werden schneller als der Sturm sein.«
Der Pilot behielt recht. Wenige Minuten später setzte die Piper auf dem asphaltierten Rollfeld des kleinen Flughafens auf. Brian wurde ordentlich durchgeschüttelt, doch es lag weniger an dem Wind als vielmehr an den Wellen und Löchern der Landebahn, die aus der Ferne vollkommen ebenmäßig ausgesehen hatte.
Brian kletterte aus dem engen Cockpit und streckte erst einmal seine Glieder aus. Er fühlte sich wie gerädert, und sein Rücken schmerzte. Der Pilot beförderte unterdessen Brians Rucksack und die Reisetasche aus dem Flugzeugrumpf. Er hatte es offenbar eilig, denn auch der Himmel über der Stadt begann sich zuzuziehen. Die feuchte Hitze wurde von einem böigen Wind hinweggefegt. Neben einer Holzbaracke in der Nähe stand ein alter sandfarbener Landrover, an dem ein groß gewachsener Mann mit Cowboyhut lehnte und scheinbar gelangweilt die Szenerie beobachtete. Während sich Brian bei dem Piloten bedankte und ihm ein paar Dollars zusteckte, schlenderte der Gaucho in seinen schwarzen Stiefeln langsam näher. An dem Gürtel, der um seine Hüfte gebunden war, steckte ein großkalibriger Colt in einem Halfter. Er wirkte wie ein Westernheld aus einer längst vergangenen Zeit.
»Dr. Saint-Claire?«
Seine Stimme mischte sich unter den Motorenlärm der startenden Piper. Brian nickte.
»Ich bin Juan Andreas Casquero«, stellte er sich vor. Dann zeigte er in die Wolken. »Sie haben Glück gehabt.«
Er nahm Brian eine Tasche ab und begleitete ihn zum Landrover. Nachdem er Brians Gepäck im Kofferraum verstaut hatte, öffnete er die Beifahrertür.
»Was macht ein Gringo-Arzt in Ciudad Guayana?«, fragte Juan, während er sich hinters Steuer schwang.
Brian lächelte. »Ich bin kein Arzt, ich bin Psychologe.«
»Ein Seelenklempner, das ist ja noch besser.«
»Wohin fahren wir jetzt?«, fragte Brian, um das Thema zu wechseln.
»Es ist unklug, sich bei Sturm in den Dschungel zu begeben«, erklärte Juan. »Bis Tucupita ist es weit, und die Straßen sind auch ohne Unwetter schon gefährlich genug. Wir fahren in die Stadt. Ich habe in einer kleinen Pension zwei Zimmer reserviert. Morgen sehen wird dann weiter. Bei den Warao wird gerade die Hölle los sein.«
Brian Saint-Claire seufzte. Juan war ihm als kompetenter Führer empfohlen worden. Außerdem war er auf ihn angewiesen, denn Juan sprach fließend den Warao-Dialekt.
Devon Island, Barrowstraße
Der kanadische Polarfrachter Island Queen war am frühen Morgen mit vollen Frachträumen aus dem Hafen von Churchill in der Hudsonbay ausgelaufen und hatte bei mäßigem Wind und wolkenlosem Himmel gute Fahrt aufgenommen. Mit knapp zwölf Knoten hielt das Schiff über das Foxebecken auf die Barrowstraße zu. Die Frachträume quollen über von Weizen, der für Yokohama bestimmt war. Knapp 7000 Seemeilen durch eine eisfreie Beringstraße lagen vor den Seemännern. Bei voller Fahrt wäre das Schiff 18 Tage unterwegs. Doch bereits südlich der Devon-Inseln brach das Inferno aus heiterem Himmel über das Schiff herein.
Das Unheil kündigte sich mit der raschen Zunahme des Windes an. Über der Baffinbai türmten sich Wolken zu einem riesigen dunklen Wolkengebirge auf. Der Wind wühlte die Wellen auf und trieb die Sturmfront rasch westwärts. Der Kapitän der Island Queen schaute ungläubig auf seine Instrumente. Das Barometer fiel ebenso rasant wie die Temperatur, und Orkanböen peitschten gegen die großen Fenster der Brücke. Der Sturm schob die Wellenberge vor sich her, die mit einem heftigen Donnern gegen den Schiffsrumpf prallten. Noch immer vermeldete der Wetterdienst einen trockenen und warmen Frühlingstag mit mäßigem Wind aus südöstlicher Richtung, doch inzwischen hatte der Wind auf Nordost gedreht. Das Schiff lief querab zu den Wellen, und der Kapitän wies seinen Steuermann an, den Frachter in den Wind zu drehen.
Eine Welle traf die Island Queen und ließ das Schiff erzittern. Der massige Rumpf neigte sich bedrohlich nach Backbord.
»Beidrehen, um Gottes willen, kurbeln Sie schon!«, rief der Kapitän auf der Brücke dem Rudergänger zu, als erneut ein Brecher den Schiffskörper traf. Plötzlich spielten sämtliche Instrumente verrückt, sogar der elektronische Kreiselkompass drehte sich wie wild, ganz so als ob das Instrument selbst die Orientierung verloren hätte. Aus dem Lautsprecher des Funkgeräts drang nur noch statisches Rauschen. Jeglicher Kontakt zur Außenwelt war abgebrochen.
Mittlerweile hatte das Wolkengebirge die Barrowstraße erreicht, und eine nahezu undurchdringliche Dunkelheit senkte sich auf das Schiff herab. Blitze erhellten jäh die Finsternis. Ein weiterer Brecher überspülte das Deck und riss einige überraschte Matrosen mit sich in die kalte Flut. Andere konnten sich mit letzter Kraft an die Reling klammern. Der Kapitän hielt sich am Kontrollpult fest, während der Rudergänger von der Wucht des Aufpralls in eine Ecke des Brückenraums geschleudert wurde. Benommen raffte er sich wieder auf, nachdem sich das Schiff wieder ausgerichtet hatte. Blut rann ihm über die Stirn. Der Funker und der zweite Offizier, die sich noch auf der Brücke befanden, suchten Halt an fest verankerten Konsolen. Das Schiff ächzte und stöhnte angesichts des Drucks der Fluten auf die Stahlflanken.
»Kommt!«, rief der Kapitän den Männern zu. »Wir müssen sie in den Wind drehen, sonst …«
Ungläubig starrte er auf die Wand aus Wasser und Gischt, die über die Steuerbordseite auf die Brücke zuraste. Eine Monsterwelle von gigantischem Ausmaß. Die Vorläufer der Wellen drückten das Schiff auf die Backbordseite. Der Kapitän wandte den Kopf. Er wusste, dass es für ein Ausweichmanöver zu spät war. Nur noch Sekunden würde es dauern, bis die gigantische Welle das Schiff erfasste und mit sich riss. Er hatte von diesen Monsterwellen und ihrer verheerenden Wirkung gehört und machte sich keine Illusionen. Das Letzte, was der Kapitän wahrnahm, war das schrille Lachen des Rudergängers. Jetzt verliert er auch noch den Verstand, dachte er, als im selben Augenblick die Woge auf der Brücke wie eine Bombe einschlug. Das Sicherheitsglas barst, und eiskaltes Wasser ergoss sich in den Raum. Der Kapitän wurde von den kalten Fluten gegen die Außenwand gedrückt und verlor die Besinnung. Die Island Queen rollte zur Seite, und die letzten Matrosen, die sich noch auf dem Vorschiff befunden hatten, verschwanden in der Tiefe.
Erst als die Welle ablief, kam das Schiff zur Ruhe, doch es war zu spät. Die Wassermassen waren bereits in das Unterdeck eingedrungen und hatten die Frachträume überspült. Die Maschinen waren verstummt, auch in diesen Räumen stand das Wasser bereits mannshoch. Ein riesiges Loch klaffte am Bug. Das Schiff war verloren.
Sieben Minuten nachdem die Island Queen zehn Seemeilen südlich der Devon-Inseln in der Barrowstraße gesunken war, funkte die Außenstation des Meteorologischen Dienstes in Coppermine eine Sturmwarnung an die Schiffe in der Labradorsee und warnte vor orkanartigen Winden und heftigen Wellen. Zu spät für die Island Queen und zwei weitere Schiffe, die sich zu dieser Zeit auf dem Weg in die Hudsonstraße befunden hatten.
Ciudad Guayana, Venezuela
Sie hatten den Tag in der kleinen Bodega neben der Pension Margarita in Ciudad Guayana zugebracht, bevor sie am Abend müde und auch ein wenig betrunken zu Bett gegangen waren. Der Sturm war über die Stadt hereingebrochen, und die Regenfluten hatten sich über die Straßen ergossen und sie in schlammige Bäche verwandelt. Juan hatte eine Flasche Tequila bestellt und sich zu Brian an den Tisch gesetzt. Sie kamen ins Gespräch, und Juan erzählte, dass er seit Jahren schon Touristen durch das Orinoco-Delta führte. Zwar gebe es nicht viele Besucher übers Jahr, das Geschäft sei dennoch lohnenswert, denn die meisten der Touristen waren gut betucht und ließen den einen oder anderen Dollar springen. So ermöglichten sie ihm ein einträgliches Geschäft und ein gutes Leben. Er selbst stamme aus Cabimas im Osten, wo er als Fischer gearbeitet hatte, doch diesem Leben habe er vor einigen Jahren den Rücken gekehrt.
Juan schien ein patenter Bursche zu sein. Die sonnengegerbte Haut und der dunkle Bart ließen ihn etwas verwegen erscheinen, aber mit jedem Glas wurde er Brian sympathischer. Als Juan nach dem Grund seines Besuchs bei den Warao-Indianern fragte, zögerte Brian und wich einer Antwort aus. Was hätte er sagen sollen? Dass er eine Frau aufsuchen wolle, die zaubern und in der Luft schweben konnte? Eine solche Antwort hätte bei seinem Gegenüber Gelächter und Spott hervorgerufen. Juan blieb jedoch beharrlich. Schließlich legte sich Brian eine Antwort zurecht, die der Wahrheit nahekam, ohne ihn verrückt oder idiotisch erscheinen zu lassen. Doch das Gegenteil trat ein.
»Gringo, es gibt Dinge hier, da würdet ihr Americanos staunen«, antwortete Juan und goss ein weiteres Glas ein. »Ich weiß, wovon ich rede. Die Warao sind ein Volk mit alter Tradition. Und wenn ich Hilfe brauche, weil ich mich verletzt habe oder krank fühle, dann mache ich einen großen Bogen um die Hospitäler. Ich kenne eine Medizinfrau ganz in der Nähe, die Wunder vollbringen kann. Ich weiß, es mag komisch klingen in einer Zeit, wo uns die Zivilisation immer weiter von unseren Wurzeln entfernt, aber wir Menschen haben eine Seele, und wenn diese Seele krank wird, dann nützt eure ganze moderne Medizin nichts mehr. Ich weiß, wovon ich spreche.«
Brian schluckte. Juan hatte diese Worte mit einer Inbrunst ausgesprochen, die erkennen ließ, wie aufrichtig er es meinte. Brian war überrascht, hatte er doch Juan anfänglich für einen ungebildeten Gaucho gehalten, den außer Dollars nicht viel mehr interessierte.
»Aber wir beide sind ja gesund«, fuhr Juan fort und schenkte noch einmal ein. »Jetzt trinken wir, und morgen fahren wir nach Tucupita. Dort wartet ein Boot, mit dem wir den Orinoco hinunterfahren. Ich bringe dich zu deiner fliegenden Frau, keine Angst, Gringo.«
Brian ergriff das Glas. »Wann werden wir aufbrechen?«
»Nach Sonnenaufgang.«
»Aber der Regen?«
»Bis morgen hat die Sonne die Straßen wieder ausgetrocknet«, erklärte Juan und bestellte eine weitere Flasche. »In diesem Land wirst du immer nass. Entweder es regnet, oder dir läuft der Schweiß in Strömen über den Rücken.«
Juan sollte recht behalten. Als sie am nächsten Morgen kurz nach sechs Uhr aufbrachen, waren die Straßen um Ciudad Guayana wieder befahrbar. Die Luft war kühl und frisch. Sie setzten sich in den Landrover und fuhren, nachdem sie die Stadt hinter sich gelassen hatten, durch eine ausgedehnte Savanne Richtung Westen, dem Orinoco entgegen. Brian griff in seine Hemdtasche und zog eine Schachtel Tabletten hervor. Er schluckte eine der weißen Pillen und spülte sie mit Wasser aus seiner Feldflasche hinunter.
Juan musterte ihn grinsend. »War der Tequila nicht gut?«, fragte er.
Brian nickte. »Gut schon, nur ein wenig zu viel.«
»Oh, ihr Americanos«, seufzte Juan. »Ihr seid stolz auf euren Whiskey, aber kaum bekommt ihr etwas Anständiges, schon seid ihr krank.«
»Ich bin kein Amerikaner«, entgegnete Brian. »Ich bin Kanadier.«
Er ließ sich im Sitz zurücksinken und schloss die Augen. Ihm stand nicht der Sinn nach einer Unterhaltung.
2
National Weather Service, Camp Springs, Maryland
Der Fernschreiber ratterte unaufhörlich und spuckte Unmengen von Papier aus, das in einem blauen Wäschekorb landete. Professor Wayne Chang, Meteorologe und Geophysiker, saß vor seinem Computer und warf einen ungläubigen Blick auf die Bildschirmdaten. Die Landkarte auf dem Monitor zeigte die Südküste Floridas bis hinunter zu den Antillen. Grellgelbe Isobaren – Linien, die Flächen gleichen Luftdrucks miteinander verbinden – unterteilten das Gebiet in verschiedene Bereiche, doch irgendetwas stimmte nicht. Der Luftdruck in Höhe von Puerto Rico war innerhalb der letzten drei Stunden über 30 Hektopascal gefallen, die Windgeschwindigkeit lag bei 57 Knoten, und die Luftströmung eines 250 Kilometer entfernten subtropischen Hochdruckgebiets speiste über das Meer unaufhörlich das entstandene Tief. »Wir erhalten auch von der kanadischen Nordküste sonderbare Werte«, erklärte Changs Kollege Schneider, der das Papier aus dem Wäschekorb einer oberflächlichen Prüfung unterzogen hatte. »Dort treibt ein Ausläufer des Islandtiefs auf die Hudsonbay zu. Das ist für diese Jahreszeit ziemlich außergewöhnlich.«
»Was ist in diesem Frühjahr überhaupt noch so, wie es sein soll?«, knurrte Chang. »Da unten braut sich etwas zusammen. Wir müssen eine Sturmwarnung herausgeben. Es sieht gar nicht gut aus.«
»Ein Hurrikan?«
»Ich fürchte, ja. Eines gewaltigen Ausmaßes und einen ganzen Monat zu früh. Er ist vor Barbados entstanden. Nach meinen Berechnungen treibt er mit rasender Geschwindigkeit auf die Südküste Floridas zu. Ich habe den Kurs mittlerweile dreimal überprüft. Florida und die Bahamas, sofern sich die Parameter nicht ändern.«
»Und genau da haben wir wieder das Problem«, erwiderte Schneider. »Vor einem Jahr lagen wir bei achtzig Prozent unserer Vorhersagen richtig. Wenn wir in diesem Jahr fifty-fifty schaffen, dann können wir noch von Glück reden. Das sind keine Vorhersagen mehr, das ist reinste Wahrsagerei.«
Chang drückte auf die Eingabetaste seines Keyboards. Zahlenreihen liefen über den Bildschirm. »Vielleicht sind unsere Rastergrößen nicht mehr zeitgemäß. Das Jahr fängt jedenfalls gut an. Ein Hurrikan, mitten im Frühjahr. Das darf doch wohl nicht wahr sein.« Er zoomte auf der Landkarte in das Gebiet, in dem sich der Sturm zusammenbraute. Ein Raster von schwarzen Vierecken lag darüber. Jedes Quadrat war mit einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen beschriftet. Die Sturmfront überdeckte bereits mehr als zwei Drittel der Fläche. »Schauen wir mal, was da draußen vorgeht«, murmelte Chang. »Weißt du, was wir im Planquadrat DSQ 327 haben?«
Schneider durchsuchte die nicht enden wollende Liste. Schließlich legte er die Aufzeichnungen auf das Schreibpult. »Das ist eine Boje draußen im Golf. Sie arbeitet mit Funk.«
»Ich hole mir mal die Daten rein«, sagte Chang und klickte auf den Link, der sich hinter den Buchstaben im Viereck versteckte. »Windgeschwindigkeit bei 61 Knoten aus Süd-Südwest, 890 Hektopascal, Temperatur 21,3 Grad Celsius und knapp 82 Prozent Luftfeuchtigkeit.«
Schneider warf einen Blick auf den Monitor und verglich die Daten mit denen der Prognose. »Das ist plausibel.«
Chang klickte auf das daneben liegende Quadrat. Weitere Daten wurden übermittelt – sie waren nahezu identisch mit den Werten von DSQ 327. Chang prüfte weitere Raster. Hinter jeder Einteilung steckte eine Wetterstation, die ihre festgestellten Daten online übermittelte: eine Boje, Satellitenwerte, Messungen eines Wetterballons mit Sonde oder einer einfachen Wetterstation in irgendeinem Garten eines Grundstücks oder eines öffentlichen Gebäudes. Dazu kamen noch einige tausend herkömmliche Wetterstationen, wo ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, meist Rentner, viermal täglich die Werte ablas und sie dann per Telefon oder Fax durchgab. Mitarbeiter des Instituts übertrugen diese Werte unverzüglich in den Zentralrechner, damit sich ein schlüssiges Bild ergab und eine Prognose errechnet werden konnte. Als Chang den Link auf der DSQ 334 aktivierte, stutzte er. Windgeschwindigkeit bei 72 Knoten aus westlicher Richtung, Luftdruck bei 1020, 13,8 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 72 Prozent. Das Ergebnis wich drastisch von der Norm ab.
»Was ist da bei 334?«, fragte Chang und zeigte mit dem Finger auf den Bildschirm. Das Quadrat lag über der Region von West Palm Beach.
Schneider wühlte in den Papieren. »Ich hab’s«. sagte er. »Es ist ein Funksignal, kommt online rein und geht direkt auf den Rechner.«
»Da stimmt doch was nicht«, entgegnete Chang. »Eine solche Abweichung auf knapp fünf Quadratkilometern liegt zu weit außerhalb des Varianzbereiches.«
Schneider griff zum Telefonhörer. »Ich werde ein Wartungsteam runterschicken. Die sollen sich dort mal umsehen und die Sensoren überprüfen.«
»Ach, und wenn du gerade dabei bist, ruf in Key West an, die sollen eine Ballonsonde aufsteigen lassen! Ich brauche Werte aus den oberen Schichten.«
Noch bevor Schneider zum Telefonhörer gegriffen hatte, wurde lautstark die Tür aufgestoßen. Vargas stürzte in den Raum, das Gesicht rot vor Anstrengung. »Wir haben was Großes auf dem Schirm!«, rief er atemlos. »Was wirklich Gigantisches. Dreihundert Kilometer unterhalb der Baja. Es kommt rasch näher.«
Chang schaltete auf eine Übersichtskarte und zoomte auf die Westküste des Kontinents.
»Verdammt!«, zischte er. Ein Wolkenwirbel mit einer Ausdehnung von fast dreihundert Kilometern lag knapp einhundert Kilometer vor der Baja California. Das Satellitenbild wurde alle zehn Sekunden aktualisiert. Zweifellos trieb der Wolkenwirbel auf das Festland zu.
»Verflucht, ein weiterer gigantischer Wirbelsturm!«, sagte Schneider mit großen Augen.
»Gebt sofort eine Warnung heraus!«, ordnete Chang an. Für die Schifffahrt im Pazifik südlich der Baja und für die gesamte Südwestküste. Am besten bis hinauf nach Los Angeles. Wenn uns das hier trifft, dann gnade uns Gott. Habt ihr ein Verlaufsschema berechnet?«
»Wir haben den Wirbel vor fünfzig Minuten vor der Küste Mexikos geortet, da war er noch ein kleines Wolkenknäuel, nicht mehr als ein dichtes Wolkenband. Die Rotationsgeschwindigkeit liegt weit über 250 Kilometer. In vierzig Stunden ist er da, wenn er nicht die Richtung wechselt.«
»Wahrscheinlichkeit?«, fragte Schneider.
Vargas atmete tief ein. »Nördliche Richtung, wir haben dort draußen eine Tiefdruckrinne, die bis San Francisco hinauf reicht.«
»Teufel, das wird verdammt eng.«
Wayne Chang fasste sich an den Kopf. »Der reinste Albtraum … dabei hat die Saison der Stürme noch gar nicht begonnen. Ich denke, die Jungs in Miami sollten sich das mal genauer anschauen. Irgendetwas stimmt dort nicht.«
Raumfähre Discovery, 500 Kilometer vor der Baja California
8.23 GMT. Nach vier Tagen im All befand sich die Raumfähre Discovery auf dem Rückflug von der Raumstation ISS und war vor knapp zwei Minuten von ihrer Umlaufbahn in den Orbit eingetreten. Die Manövriertriebwerke waren planmäßig gezündet und die Sinkgeschwindigkeit auf exakt 336 Stundenkilometer verringert worden. Der Übergang in die Stratosphäre stand bevor, und alle Systeme arbeiteten auf Automatik. Der Routinesinkflug war eingeleitet, und Copilot Sanders und der Missionsgast Helmut Ziegler von der Austrian Space Agency hatten sich auf Anweisung des Flugleiters zur Ruhe begeben. Die Überwachung der Steuerungsautomatik lag bei der Bodenkontrolle in Houston. Don Gibson, der Pilot der Raumfähre, beobachtete die Instrumente mit wachem Blick. Er war ein routinierter und erfahrener Pilot. Diese Mission war sein vierter Flug ins All und sollte, ginge es nach ihm, auch nicht sein letzter sein. Er schaute aus dem kleinen Dreiecksfenster auf die blau schimmernde Kugel hinab, die von hier oben so winzig und verletzlich erschien. Schon als kleiner Junge hatte er davon geträumt, mit den riesigen Raketen ins Weltall zu fliegen, um die Planeten zu erforschen. Mittlerweile wusste er, wie naiv seine Vorstellung vom All und von Raum und Zeit gewesen war. Selbst eine Mondlandung bedurfte höchster Anstrengungen und eines Heers von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern, um die Expedition zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Und dabei war der Mond astronomisch gesehen nicht einmal einen Katzensprung entfernt.
Der Mars war gemessen an der unermesslichen Ausdehnung des Weltalls für bemannte Raumflüge immer noch unerreichbar. Verglich man die bisherigen Leistungen der Raumfahrt mit astronomischen Dimensionen, hatte man im Grunde genommen gerade mal einen Fuß vor die Haustür gesetzt. Trotzdem wollte Don Gibson diesen Anblick nicht mehr missen. Die Erde war in ein tiefes Blau getaucht, in dem weiße, flauschige Wollebällchen dahinschwebten, und dahinter ergoss sich die undurchdringliche Schwärze des Kosmos.
Gibson blickte auf seine beiden Begleiter, die in ihren Raumanzügen steckten und auf Anordnung des Flightcommanders den schönsten Teil der Mission verschliefen. Die beiden hatten vor kaum einer Stunde noch über der Raumstation geschwebt, um eine defekte Satellitenantenne auszurichten. Die Außenmission im Weltall war mit allerlei Komplikationen verbunden gewesen, und Sanders sowie Ziegler waren bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen, um ihren Auftrag erfolgreich zu beenden. Länger als im Zeitplan vorgesehen hatte das Shuttle im All verbringen müssen, der Sauerstoffvorrat war nahezu aufgezehrt, und die beiden waren völlig erschöpft ins Shuttle zurückgekehrt.
»Commander/NTO: G/S Zero!« Die Stimme des Flightcommanders der Flugkontrolle in Houston ertönte im Kopfhörer.
»Ich höre«, antwortete Gibson.
»Sie halten auf eine gewaltige Sturmfront zu. Korrigieren Sie Ihren Kurs und drehen Sie auf 325, drei … zwo … fünf. Damit weichen Sie dem Sturmzentrum aus und streifen nur die äußeren Schichten.«
Gibson warf einen Blick aus dem Fenster. Direkt unter der Nase der Discovery entdeckte er ein gewaltiges Wolkenfeld.
»Roger«, bestätigte Gibson. »Übernehme manuelle Steuerung.«
Manuelle Kurskorrekturen waren jederzeit möglich. Die Geschwindigkeit und der Winkel des Sinkfluges lagen noch immer im grünen Bereich. Nach der Kurskorrektur galt es lediglich, einen anderen Landewinkel zu berechnen und das Resultat in das automatische Landesystem einzuspeisen. Danach konnte sich Gibson wieder zurücklehnen und zusehen, wie die Discovery wie an einer Schnur gezogen die weitläufige Landebahn auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien ansteuerte. Er führte ein sanftes Lenkmanöver aus, bis er den angegebenen Kurs erreicht hatte, dann schwenkte er wieder in die horizontale Position ein. Die Geschwindigkeit sank auf 320 Kilometer.
»Korrektur erfolgt«, gab er kurz an das Kontrollzentrum durch.
»Wir haben euch auf dem Schirm, das sieht gut aus«, erhielt er zur Antwort. »Die neuen Landevektoren sind in den Rechner übertragen. Discovery, gehen Sie wieder auf Automatik. Wir melden uns.«
Ein zufriedenes Lächeln huschte über Gibsons Gesicht. Der Sinkflug verlief ruhig. Am Übergang in die Troposphäre wurde das Schiff durchgerüttelt, doch Gibson blieb gelassen. Die Dichte der Gasschichten nahm deutlich zu, und die Geschwindigkeit verringerte sich zusehends. Plötzlich war aus dem Kopfhörer nur noch ein Rauschen zu vernehmen, und das Schiff begann zu trudeln. Gibson riss am Steuerruder und schaltete die Automatik ab. Ein heftiges Schütteln lief durch das Schiff, und ein lautes Prasseln war zu vernehmen. Eiskristalle prallten gegen die Außenhaut. Gibson fluchte.
Für einen kurzen Moment hielt er inne. Irgendetwas war dort draußen in den Wolken. Die aufkeimende Angst jagte ihm eine Gänsehaut über den Rücken. Es war, als ob ihn sein eigener Schatten verfolgte und nach seiner Seele griff. Ein ohrenbetäubendes Donnern ließ ihn zusammenzucken. Ein gleißend heller Blitz durchzuckte das Cockpit, und die Instrumente begannen verrücktzuspielen.
»Houston!«, rief er in das Sprechgeschirr. »Houston, wir sind in Schwierigkeiten!«
Er wartete, doch außer dem Rauschen und Knistern herrschte Schweigen im Kopfhörer. Er warf einen Blick nach draußen und sah, dass sie sich mitten in einer Wolkenhülle befanden. Erneut erzitterte das Shuttle unter einem kräftigen Donnerschlag. Die aufblitzende Helligkeit brannte in seinen Augen. Für Sekunden schloss er geblendet die Lider.
»Verdammt, Houston!«, rief er, doch die Antwort blieb aus. Er wandte sich Sanders zu und rief seinen Namen in das Bordfunkgerät. Doch Sanders rührte sich nicht, seine Augen blieben geschlossen. Auch Ziegler, der auf dem Sitz hinter ihm in seinen Gurten saß, schlief einfach weiter. Irgendetwas stimmte mit ihnen nicht, doch er hatte keine Zeit, sich um die Kollegen zu kümmern, denn erneut wurde das Schiff von einem Blitz getroffen. Es schien, als ob die Raumfähre wie ein Stein durch die Wolken sackte.
»Verdammt, wir stürzen ab!«, rief er in das Mikro.
»Discovery … melden … Kurs … «
Nur Wortfetzen, unverständliche Fragmente drangen an sein Ohr. Mit eisernem Griff hielt er das Steuerruder umklammert und versuchte, sich dem Zerren des Sturms entgegenzustemmen. Das Schiff stöhnte und ächzte unter der Belastung, doch es gelang ihm, die Lage des Shuttles zu stabilisieren. Die Geschwindigkeit war auf 275 Kilometer gesunken. Viel zu langsam, um die Landebahn in Edwards zu erreichen. Er überlegte. Schließlich kam ihm ein abenteuerlicher Gedanke. Noch war das Monomethylhydrazin in den Treibstofftanks nicht ganz aufgebraucht. Der Schub würde für einen kurzen Zündimpuls ausreichen. Er legte den grünen Kippschalter um, der die Zufuhr von Stickstofftetroxid regelte, dann schlug er mit dem Handballen auf den roten Schalter unterhalb des Steuerruders. Der künstliche Horizont signalisierte ihm, dass sie in einem steilen Winkel dem Boden entgegenstürzten. Bevor er das Steuer nach hinten riss, schickte er noch ein Stoßgebet in den Himmel. Die beiden Orbitalmanövertriebwerke setzten ein. Ruckartig wurde das Schiff nach vorn katapultiert. Rasch gewann es an Geschwindigkeit und Höhe. Gibsons Plan schien aufzugehen. Auf dem Anzeigeinstrument hob sich die Nase immer mehr der Nulllinie entgegen. Plötzlich durchstieß das Schiff die Wolkendecke, und der milchige Nebel gab den Blick auf die Erde frei. Sekunden später verstummten die Schubaggregate. Gibson kontrollierte die Instrumente. Die Geschwindigkeit betrug nun wieder 324 Stundenkilometer bei einer Höhe von 26 000 Fuß. Edwards lag noch 90 Kilometer entfernt.
»Houston, verdammt, meldet euch!«, sagte Gibson keuchend. Schweiß lief ihm über die Stirn.
»Discovery, Gott sei Dank«, erwiderte der Flightcommander. »Was war los bei euch?«
»Was los war?«, schnauzte Gibson. »Der verdammte Sturm war näher, als ihr dachtet. Hat uns ganz schön durchgewirbelt. Beinahe wären wir abgeschmiert. Ich glaube, in den Wolken steckte etwas … «
»Was heißt das? Geht es euch gut?«
Gibson schaute sich um. Er seufzte laut.
»Commander/NTO: G/S Zero«, ertönte die ernste Stimme des Flightcommanders. »Geben Sie uns Ihren Status!«
Gibson riss sich zusammen und verscheuchte den bedrückenden Gedanken. »Ihr werdet es nicht glauben«, sagte er. »Während wir beinahe in den großen Teich gefallen wären, haben meine Begleiter geschlafen wie die Murmeltiere. Sie sind einfach nicht wach zu kriegen.«
»Geben Sie uns Ihren Status!«
Die Stimme aus der Flugkontrolle klang nach wie vor besorgt. Offenbar hatte der Flugleiter den Eindruck gewonnen, der Pilot der Discovery wäre nun total verrückt geworden. Gibson kontrollierte seine Instrumente. Alles schien in Ordnung. Er schaltete das Check-up-Terminal ein und versuchte, eine Kurzanalyse durchzuführen, aber auf dem Bildschirm flimmerte nur ein rotes Viereck: Offline.
»Ich habe ein Problem«, sagte er leise. »Ich fürchte, an dem Vogel stimmt was nicht. Ich bekomme keine Daten für einen Statuscheck.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Noch einmal tippte Gibson auf die Eingabetaste des Computersystems. Doch das Bild änderte sich nicht.
»Discovery«, zerschnitt der Flightcommander die Stille. »Wir stehen vor dem gleichen Problem. Wir haben keine Kontrolle über Ihre Steuerautomatik, ich wiederhole, wir sind ebenfalls offline. Sie müssen den Vogel mit der Handsteuerung landen. Wie ist Ihre augenblickliche Position?«
Gibson schaute auf den elektronischen Kompass und nannte die abgelesenen Daten, die Geschwindigkeit und die augenblickliche Höhe. Wieder herrschte für einen Augenblick Ruhe.
»Sie sind zu schnell, steigen Sie auf 28000 Fuß, damit reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Drehen Sie auf 124, ich wiederhole, drehen Sie auf eins … zwo … vier.«
Gibson bestätigte und führte die Anweisungen aus. Sein Manöver mit den Orbitaldüsen hatte die Raumfähre auf eine Position gebracht, die ein paar Kilometer zu weit nördlich lag.
»Ich habe jetzt eins zwo vier auf 28 000. Meine Geschwindigkeit liegt bei 280 Kilometer«, meldete Gibson ein paar Minuten später.
»Schauen Sie aus dem Cockpit«, erwiderte die Flugkontrolle. »Sie sehen jetzt Edwards am Horizont auftauchen. Wir übergeben an die Landekontrolle. Folgen Sie den Anleitungen. Es ist alles vorbereitet. Viel Glück.«
Sekunden später meldete sich der Tower der Edwards Air Force Base bei der Discovery. Der verantwortliche Flugleiter übernahm die Einweisung zur manuellen Landung.
»Halten Sie sich genau an meine Anweisungen, ich bringe Sie runter«, versprach der Flugleiter von Edwards. »Fahren Sie jetzt die Landeklappen aus und reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 250. Gehen Sie auf Sinkflug! Sie brauchen 2000 Fuß.«
Als Don Gibson kurz darauf die Anweisung zum Ausfahren des Fahrwerks erhielt, fixierte er mit den Augen das Flugfeld von Edwards, das am Horizont aufgetaucht war. Jetzt war alles nur noch eine Frage von Minuten. Gibson beobachtete gebannt die Fahrwerkskontrolle. Mit einem Piepen kündigten die Tragflächenfahrwerke an, dass sie ausgefahren und verriegelt waren. Zwei grüne Lichter, die direkt über dem Piloten aufleuchteten, bestätigten die Meldung. Plötzlich schnarrte ein lauter Warnton. Das Bugrad hing fest. Ein rotes Licht signalisierte eine Fehlfunktion.
»Verdammt, Edwards!«, fluchte Gibson. »Mein Bugrad rastet nicht ein. Habt ihr gehört?«
»Verstanden!«
»Was soll ich tun?«
Die Landebahn näherte sich rasch. Die Geschwindigkeit war auf 210 Kilometer gesunken. Die Höhe betrug noch knapp 450 Meter.
»Zum Teufel, Edwards, was soll ich tun?«
»Kommen Sie nach Hause«, sagte der Flugleiter. »Landen Sie, Pilot. Kommen Sie rein und beten Sie.«
Die Discovery setzte knapp drei Minuten nach dem letzten Funkruf auf der Landebahn der Edwards Air Force Base auf. Zuerst bekamen die Fahrwerke unter der Tragfläche Bodenkontakt. Eine ganze Weile brauste die Discovery mit aufgerichteter Nase über den Asphalt. Als sich die Geschwindigkeit immer weiter reduzierte, zog die Schwerkraft die Nase des Shuttles dem Boden entgegen. Das Busrad bekam unter einem Schwall von Qualm und Staub Bodenkontakt. Doch es knickte nicht ein. Zumindest nicht sofort. Gibson bremste und aktivierte die zusätzlichen Bremsfallschirme. Schließlich gab das Bugrad nach, und der Rumpf der Raumfähre streifte über den Boden. Funken stieben auf, und ein Teil der Rumpfkacheln löste sich. Noch immer rollte das Raumschiff auf den Tragflächenfahrwerken geradeaus weiter, bis es kurz vor dem Ende der Landebahn zum Stehen kam. Sofort brausten Rettungsfahrzeuge über die Landebahn und hielten auf die Discovery zu.
»Mein Gott, das war knapp«, sagte der Chef des Rettungsteams, nachdem die Astronauten aus dem Shuttle geborgen waren. »Sie haben es geschafft, Sie Teufelskerl. Wie haben Sie das bloß hingekriegt?«
»Ich habe gebetet«, antwortete Don Gibson mit krächzender Stimme.
Caraguela, Orinoco-Delta, Venezuela
Trotz der holperigen Fahrt über staubige Straßen war Brian eingedöst. Die Umgebung wechselte ihr Gesicht. Der rötliche Staub wurde durch eine ausgedehnte Graslandschaft ersetzt, die von einem breiten Gürtel von Sträuchern und Büschen durchzogen war. Obwohl es noch früh am Morgen war, wurde es bald unerträglich heiß im Wagen. Die subtropische Luftfeuchtigkeit ließ Brians Hemd und Hose an seinem Körper festkleben. Schließlich rückte die Waldgrenze näher, und die ersten Bäume säumten ihren Weg. Brian hätte manches für eine Klimaanlage gegeben, doch der Landrover hatte seine besten Jahre schon hinter sich. Der Motor schnaubte, und dunkler Rauch quoll aus dem dröhnenden Auspuff, als sie eine Steigung passierten, deren Fahrbahnbelag aus blankem Felsgestein bestand. Kurz vor Mittag, bei tropischen Temperaturen, endete die Piste an einem reißenden Fluss.
»Maldita sea!«, fluchte Juan.
»Und was jetzt?«, fragte Brian, der schon das jähe Ende seiner Reise gekommen sah, doch Juan schaute ihn unbeeindruckt an.
»Me cago en diez!«, sagte er grinsend und legte einen Schalter um, der sich direkt neben dem Schaltknüppel befand. »Jetzt waschen wir den Wagen.« Er stieg aus dem Jeep und wies Brian an, sich hinter das Steuer zu setzen.
»Gas!«, rief er Brian zu, als er sich direkt vor dem Wagen postiert hatte.
Brian zuckte mit der Schulter.
»Auskuppeln und Gas geben, Canadiense!«
»Ich denke, das kriegt sogar ein Eskimo aus dem kalten Norden hin.«
Brian fluchte und tat, wie ihm aufgetragen wurde. Der Motor heulte auf. Schließlich erkannte er, was Juan vorhatte. Der Venezolaner hielt den Karabinerhaken der Seilwinde in der Hand und zog das Stahlseil hinter sich her. Der Fluss war tatsächlich nicht sonderlich tief. Das Wasser reichte Juan bis zu den Knien. Trotzdem bedurfte es einer gehörigen Anstrengung, die knapp zehn Meter breite und tückische Furt zu durchqueren. Am anderen Ufer angekommen, schlang Juan das dicke Stahlseil um einen kräftigen Baum. Wenig später zog die Winde den Wagen über die Furt ans andere Ufer.
»Auf den Straßen in das Delta muss man auf alles gefasst sein«, meinte Juan. »Aber ich sagte doch, ich kenne mich hier aus.«
Brian nickte anerkennend und schlug sich mit der flachen Hand gegen den Hals. Diese verdammten Mücken waren eine einzige Plage, und dabei hatte er sich vor dem Abflug mit reichlich Mückenschutzmittel eingedeckt. Eine Stunde später, drei Kilometer vor Tucupita, tauchten die ersten Hütten am Wegesrand auf. Juan lenkte den Wagen von der breiten Piste in einen schmalen Seitenweg, der mitten hinein in den dichten Dschungel führte. Brian lief inzwischen der Schweiß in Strömen über den Rücken. Die Luft im Wagen blieb trotz heruntergelassener Scheiben heiß und stickig. Zehn Minuten später bemerkte Brian das Glitzern, das durch das lichte Blätterwerk der Bäume drang. Ein Seitenarm des Orinoco tauchte vor ihnen auf. Der Fluss war gewaltig, Brian schätzte die Breite auf beinahe einen halben Kilometer. Zwei Hütten standen am Ufer. Einfache Pfahlhütten, mit Außenwänden aus verschnürten Palmwedeln. Juan brachte den Landrover zum Stehen. Ein Eingeborener mit nacktem Oberkörper kam aus einer der Hütten. Er begrüßte Juan freundlich. Brian stieg aus. Das Geschrei von Brüllaffen hallte durch den dichten Wald.
Während sich Juan mit dem Indio in einer gutturalen Sprache unterhielt, ging Brian hinunter ans Ufer des Flusses. Zwei Langboote mit Außenbordmotoren lagen an einem hölzernen Landesteg vertäut. Erneut klatschte er mit der flachen Hand gegen seinen Arm. Ein weiterer Mückenstich.
»Dabei schlafen die meisten Viecher noch«, erklang Juans Stimme in seinem Rücken. Brian drehte sich herum. Juan ging zum Wagen und kehrte mit einer silbernen Dose zurück.
»Wenn Sie bis zum Abend nicht aufgefressen werden wollen, dann schmieren Sie sich das auf die Haut.«
Skeptisch öffnete Brian die Dose, die Juan ihm gegeben hatte, und roch daran. Er zuckte zurück und verzog das Gesicht.
»Was ist das?«
»Kerosin, Limone und Babyöl«, erwiderte Juan. »Das Einzige, was gegen diese verfluchten Plagegeister hilft.«
Widerwillig tauchte Brian den Zeigefinger in die stinkende Melange.
»Zweihundert Stiche am Tag sind keine Seltenheit«, erklärte Juan. »Vor allem hier am Fluss.«
»Und wie geht es weiter?« Brian strich sich die widerliche Emulsion auf die Arme.
»Yakuna bringt uns mit dem Boot nach Caraguela«, sagte Juan. »Es liegt etwa zwei Stunden nördlich von hier. Wir essen etwas und brechen in zwanzig Minuten auf. Und nicht vergessen, es hilft nur, wenn man alle Körperteile damit bestreicht. Aber das ist Ihre Sache, Doktor.«
»Na ja, vielleicht hält es wenigstens die Piranhas ab«, seufzte Brian.
Sie brachen planmäßig auf. Der Fluss war ruhig und die Strömung mäßig. Der Fahrtwind kühlte ihre erhitzten Körper und machte den Tag ein wenig erträglicher. Brian reckte die Arme in die Höhe und genoss die Abkühlung. Hin und wieder trieben Äste und Holzstämme am Boot vorbei.
»Der Sturm von gestern hat einige Bäume entwurzelt«, erklärte Juan. »Es gab ein kräftiges Gewitter.«
Sie bogen in einen Seitenarm ab, der nach Osten führte. Ein paar Orinoco-Delfine begleiteten das Boot ein Weilchen. Brian holte seine Kamera aus dem Rucksack und schoss ein paar Fotos von den grauen Gefährten. Nach einer weiteren Biegung tauchten Hütten am Ufer auf. Vor ihnen lag Caraguela.
3
Interstate 25, San Antonio, New Mexico
Ein kühler Morgen zog über White Sands herauf, und über den Wäldern des Cibola National Forest trieben Nebelschwaden in der Morgendämmerung. Sheriff Dwain Hamilton schlug den Pelzkragen seiner Jacke hoch und schaute hinüber auf die Interstate 25. Auf der Straße herrschte noch Ruhe, doch bald schon würden sich Tausende von Pendlern auf den Weg hinauf nach Albuquerque machen. Die Raststätte an der Interstate 25 lag von Bäumen umsäumt an einem kleinen Bachlauf, der sich ein paar Kilometer östlich in den Rio Grande ergoss. Die roten Lichter des Polizeiwagens rotierten hektisch, und das gelbe Absperrband jenseits der Müllcontainer flatterte im aufkommenden Wind.
Vor knapp einer Stunde hatte Deputy Lazard, Hamiltons Neffe, angerufen und ihn aus einem unruhigen Schlaf gerissen. Seit Margo an Weihnachten mit den Kindern das Haus verlassen hatte, brauchte er nachts ein paar Drinks, um einschlafen zu können. In Hamiltons Kopf hämmerte eine ganze Schar Gleisarbeiter, trotzdem war er sofort hellwach, nachdem Lazard ihm vom Fund einer Leiche auf dem Parkplatz bei San Antonio berichtet hatte. In den letzten drei Jahren, seit er Sheriff geworden war, hatte es nur einen Mord gegeben. Hamilton war stolz darauf, dass er die 9000-Seelen-Gemeinde und das umliegende County fest im Griff hatte. Ein paar Diebstähle, Scherereien mit Trunkenbolden und hier und da eine Schlägerei – doch jetzt lag eine Leiche am Coward Creek zwischen zwei großen Müllcontainern. Ein junger Mann, etwa dreißig, auffallend blass, rothaarig und nur mit einer Schlafanzughose und einem gelben Sweatshirt bekleidet, das die Aufschrift POW trug. Keine Schuhe, keine Jacke, keinen Rucksack, nichts, das auf seine Identität oder seine Herkunft schließen ließ.
»Also, wenn Sie mich fragen, Sheriff«, sagte Dr. Roberts, der ortsansässige Arzt, »dann liegt er bereits seit gestern hier. Die Leichenstarre hat sich schon zurückgebildet. Aber sehen Sie, diese punktförmigen Eintrübungen hier sind sehr ungewöhnlich.«
Er zeigte auf die hellen Flecken, die den Kopf und den Oberkörper der Leiche bedeckten.
»Wenn mich nicht alles täuscht, sind das noch leichte Druckmarken von Sensoren, wie man sie im Krankenhaus beim EKG oder einem EEG verwendet.«
Der Doktor kniete sich nieder und hob den rechten Arm des Toten an. »Außerdem diese Einstiche in der Armbeuge«, fuhr er fort. »Entweder ist er ein Junkie oder aus einem Krankenhaus entlaufen.«
Sheriff Hamilton notierte die Angaben des Arztes in seinem kleinen schwarzen Notizblock.
»Woran könnte er gestorben sein?«, fragte der Sheriff.
Der Doktor überlegte. Noch einmal öffnete er die Augen des Toten und schaute prüfend in dessen Pupillen. Dann richtete er sich auf.
»Todesursache könnte durchaus eine Intoxikation sein, aber ich will mich da nicht festlegen. Erst müssen wir die Gewebeuntersuchungen abwarten. Auf den ersten Blick sieht es mir tatsächlich nach einer Überdosis aus.«
Sheriff Hamilton fluchte.
»Dann hat er sich einen goldenen Schuss gesetzt?«, fragte Deputy Lazard.
Dr. Roberts lächelte. »Entweder er – oder ein anderer.«
»Ermordet?«, fragte Lazard.
»Das herauszufinden ist Ihr Job.«
Ein schwarzer Buick bog auf den Parkplatz ein. Der Deputy an der Zufahrt versuchte, den Wagen anzuhalten, doch der Buick fuhr kurzerhand an ihm vorbei und bremste direkt vor Hamiltons Geländewagen. Ein Mann in grauem Anzug und einem beigefarbenen Trenchcoat öffnete die Beifahrertür und stieg aus. Breitbeinig schlenderte er auf Hamilton zu.
»Hallo, Sheriff!«, sagte der Mann. »So früh schon auf?«
»Howard«, erwiderte Sheriff Hamilton. »Was führt Sie in diese gottverlassene Gegend?«
Howard ließ den Sheriff einfach stehen. Er ging hinüber zu den Müllcontainern und warf einen Blick auf die Leiche. Inzwischen war auch der Fahrer des Buick ausgestiegen und wartete an der offenen Fahrertür.
»Tex, holen Sie die Spurensicherung und informieren Sie Albuquerque!«, rief Howard seinem Fahrer zu. »Die sollen gleich einen Leichenwagen herschicken. Außerdem will ich ein Team mit Hunden. Wir suchen hier alles ab!«
Tex nickte und verschwand im Wagen.
Sheriff Hamilton verzog das Gesicht. »Wenn ich mich nicht täusche, dann liegt der Parkplatz im Socorro County. Damit ist das unser Fall.«
Howard grinste breit und deutete auf den Highway. »Irrtum, Hamilton. Für den Highway ist die State Police zuständig, also wir.«
»Für den Highway vielleicht, aber der ist dort drüben.«
Howard zog ein Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer. Wenig später wechselte er ein paar Worte mit dem Teilnehmer am anderen Ende. Dave Lazard warf Hamilton einen fragenden Blick zu. Schließlich trat Howard zu ihnen und reichte Hamilton das Mobiltelefon. Nach einem kurzen Telefonat mit dem Büro des Bezirksstaatsanwalts war die Zuständigkeit geklärt. Hamilton klappte das Telefon zu und reichte es Howard, der noch immer grinsend vor ihm stand.
»Dave, pack alles zusammen«, sagte Hamilton zu seinem Deputy. »Wir rücken ab.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«, rief ihm Howard nach, als der Sheriff zu seinem Wagen ging.
»Es war Crow«, antwortete Hamilton. »Er hat die Müllcontainer geleert.«
»Und wo ist er jetzt?«
»Er ist weitergefahren. Vermutlich im Reservat.«
»Dann bringen Sie ihn her!«
Hamilton schüttelte den Kopf und setzte sich hinter das Steuer. »Ihr Fall, Captain Howard!«
Caraguela, Orinoco-Delta, Venezuela
Einfache Holzhütten, auf Pfählen erbaut und mit Palmwedeln gedeckt, säumten das Flussufer. In einer kleinen Bucht ragte ein primitiver Bootsanleger in den Fluss. Nachdem Juan das Boot vertäut hatte, schwang er sich auf die schwankenden Bohlen. Vier Indios vom Stamme der Warao, mit Lendenschurz bekleidet und starrem Blick, beobachteten vom Flussufer argwöhnisch die Besucher. Sie hielten Äxte in den Händen und schienen über die unvorhergesehene Störung ihres Alltags nicht gerade begeistert zu sein.
Yakuna zog es vor, im Boot zu warten, bis Juan das Begrüßungsritual vollzogen hatte. Als sich Brian erheben wollte, legte Yakuna die Hand auf dessen Schenkel, zum Zeichen, dass es besser sei, erst einmal im Boot zu bleiben, bis Juan zurückkehrte. Hier draußen im Dschungel waren ungebetene Gäste nicht immer willkommen. Juan ging, die Handflächen ihnen zugewandt, ohne Eile auf die vier Indios zu. Eine Geste, die den Indios sagte, dass sie nichts zu befürchten hatten.
Schließlich näherte sich ein weiterer Warao. Ein Mann um die sechzig, mager, mit einem zerschlissenen Strohhut auf dem Kopf. Sein Gang und seine Gebärden hatten etwas Aristokratisches. Juan blieb stehen und wartete, bis der Alte bei ihnen war. Dann verneigte er sich kurz und begrüßte den Warao. Wortfetzen wehten zu Brian herüber, aber er konnte den Sinn der Worte nicht verstehen. Die Unterhaltung zog sich eine ganze Weile hin, doch der Alte schien nicht zum Ende kommen zu wollen. Brian wartete geduldig in der Hitze des verklingenden Tages und hoffte, bald diese schaukelnde Nussschale verlassen zu können. Inzwischen fanden sich immer mehr Dorfbewohner am Ufer ein. Auch Frauen und Kinder zeigten sich. Brian atmete auf, denn der Anblick von Kindern in dieser gespannten und scheinbar feindseligen Stille ließ ihn zuversichtlicher werden. Fast zwanzig Minuten später wandte sich Juan endlich dem Boot zu und bedeutete den beiden Wartenden, dass sie ebenfalls aussteigen durften.
Brians Glieder schmerzten, und er streckte sich. Das Boot wankte bedrohlich, als er mit einem ausgreifenden Schritt den Ausleger betrat. Yakuna sprang behände vom Boot und folgte ihm. Langsam gingen sie auf Juan und den Alten zu.
»Das ist der Dorfälteste«, erklärte Juan. »Er erlaubt uns, das Dorf zu betreten, und heißt uns willkommen. Allerdings gibt es ein kleines Problem mit Ihrer fliegenden Frau.«
Brian blickte Juan fragend an. »Ist sie etwa … tot?«