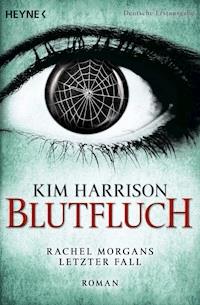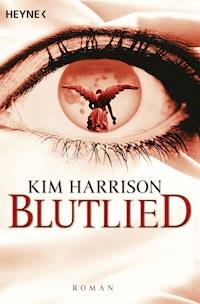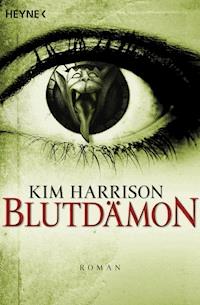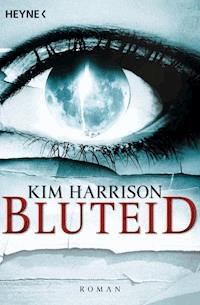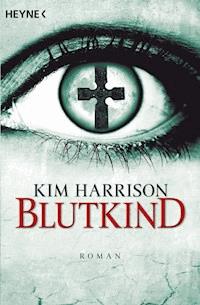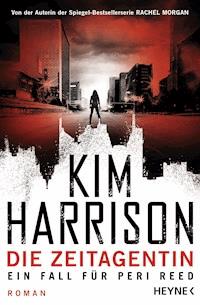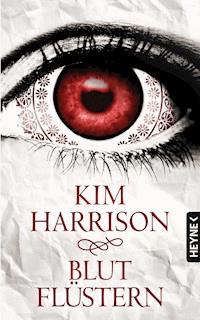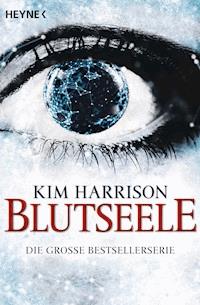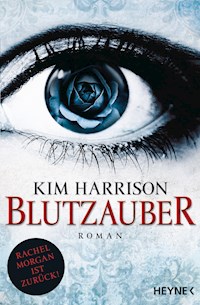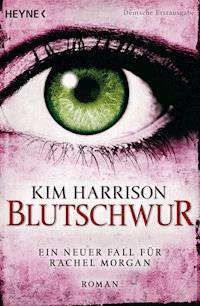
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rachel Morgan
- Sprache: Deutsch
Rachel Morgans heißester Fall
Rachel Morgan hat es vermasselt: Durch einen Fehler ihrerseits beginnt das Jenseits zu schrumpfen. Sollte es ganz verschwinden, bedeutet das das Ende für Vampire, Feen und Hexen. Als dann auch noch ihr Patenkind von wütenden Dämonen entführt wird, bleibt Rachel nichts anderes übrig, als ins Jenseits zurückzukehren, sich ihren Feinden zu stellen und die Apokalypse aufzuhalten. Unmöglich? Nicht, wenn man Rachel Morgan heißt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 897
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Erdhexe Rachel Morgan steckt bis zum Hals in Schwierigkeiten: Eine ihrer Kraftlinien, die sie zwischen der Realität und dem Jenseits, dem Reich der Dämonen, erzeugt hat, ist aus dem Gleichgewicht geraten – mit möglicherweise katastrophalen Folgen für Menschen, Vampire, Hexen und Dämonen. Doch noch bevor Rachel die Kraftlinie reparieren und so das Ende der Welt verhindern kann, wird ihr Patenkind Lucy von wütenden Dämonen entführt. Der Vater des Kindes ist ausgerechnet Trent Kalamack, der mächtigste Elfenfürst Cincinnatis und nebenbei der bestaussehendste Typ, dem Rachel je begegnet ist. Ihr bleibt also nichts anderes übrig, als sich selbst auf den Weg ins Jenseits zu machen, Lucy zu befreien und die Apokalypse aufzuhalten. Doch dann taucht ein alter Bekannter aus Rachels Vergangenheit auf und droht, all ihre Pläne zunichte zu machen …
Die Autorin
Kim Harrison, geboren im Mittleren Westen der USA, wurde schon des Öfteren als Hexe bezeichnet, ist aber – soweit sie sich erinnern kann – noch nie einem Vampir begegnet. Sie spielt schlecht Billard und hat beim Würfeln meist Glück. Kim mag Actionfilme und Popcorn, hegt eine Vorliebe für Friedhöfe, Midnight Jazz und schwarze Kleidung und ist bei Neumond meist nicht auffindbar. Mehr Informationen unter: www.kimharrison.net
KIM HARRISON
BLUTSCHWUR
ROMAN
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für den einzigen Mann, dem ich Karamellpudding mache.
1
»Das ist nah genug. Danke«, sagte ich zu dem Taxifahrer, und er fuhr einen Block vor dem Carew Tower an den Randstein. Es war Sonntagabend, und die schicken Restaurants in den unteren Stockwerken von Cincinnatis bekanntestem Hochhaus waren wegen des March Madness Food Fests gut gefüllt – die Drehtür stand nie still, während lachende Pärchen und Gruppen hinein- und herausdrängten. Einige Gäste hatten sich wahrscheinlich auch die Ausstellung mit Kunst von Kindern angesehen. Doch das gesetzte Paar in Anzug und paillettenbesetztem Kleid, das vor mir aus einem schwarzen Auto stieg, wollte sicher wie ich in das Drehrestaurant.
Ich suchte in meiner lächerlich kleinen Handtasche nach einem Zwanziger und reichte den Schein nach vorne. »Stimmt so«, sagte ich, während ich mein Schultertuch enger zog und mir dabei ein leichter Fliederduft in die Nase stieg. »Aber ich bräuchte bitte eine Quittung.«
Der Fahrer warf mir einen dankbaren Blick zu. Vielleicht war das Trinkgeld etwas zu hoch, aber er war schließlich bis in die Hollows gefahren, um mich abzuholen. Nervös rückte ich noch mal das Schultertuch zurecht und glitt zur Tür. Ich hätte mit meinem Auto fahren können, aber während des Festivals war es fast unmöglich, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Außerdem verlor ein Kleid aus feuerfarbener Seide mit Spitzenbesatz einen Großteil seines Charmes, wenn man versuchte, damit aus einem Mini Cooper zu steigen. Ganz abgesehen davon, dass der Wind vom Fluss mir vielleicht mein sorgfältig geflochtenes Haar zerzaust hätte, wenn ich weiter hätte laufen müssen als einen Block.
Ich bezweifelte, dass das Treffen mit Quen heute Abend zu einem Job führen würde. Aber ich brauchte im Moment jeden Steuerabzug, den ich bekommen konnte, selbst wenn es sich nur um eine Taxifahrt handelte. Ein Jahr ohne Steuererklärung, während entschieden wurde, ob ich nun ein Bürger war oder nicht, hatte sich nicht als der Segen erwiesen, für den ich es am Anfang gehalten hatte.
»Danke«, antwortete ich, als ich die Quittung einsteckte. Dann atmete ich einmal tief durch, die Hände im Schoß verschränkt. Vielleicht sollte ich einfach wieder nach Hause fahren. Ich mochte Quen, aber er war Trents oberster Sicherheitschef. Ich war mir sicher, dass er mir einen Job anbieten würde – aber ich war mir ganz und gar nicht sicher, ob ich ihn auch annehmen wollte.
Doch meine Neugier war schon immer stärker gewesen als mein gesunder Menschenverstand. Als der Fahrer mich im Rückspiegel musterte, griff ich nach dem Türöffner. »Was auch immer es ist, ich lehne ab«, murmelte ich beim Aussteigen. Der Werwolf am Steuer lachte leise. Das Türknallen war neben dem lauten Getöse der drei Grufti-Teenager, die sich auf seinen Wagen stürzten, kaum zu hören.
Meine niedrigen Absätze klapperten über den Gehweg. Die kleine Tasche unter einen Arm geklemmt, hielt ich mit der anderen Hand meine Haare fest. Die Tasche war immerhin groß genug, dass meine zugelassene, mit Gute-Nacht-Tränken geladene Splat Gun darin Platz fand. Sollte Quen ein Nein als Antwort nicht akzeptieren, konnte ich ihn immer noch mit dem Gesicht nach unten in seiner Zwölf-Dollar-Suppe zurücklassen.
Ich blinzelte in den Wind und wich den Leuten aus, die auf eine Fahrgelegenheit warteten. Quen hatte mich zum Abendessen eingeladen, nicht Trent. Mir gefiel nicht, dass er glaubte, sich in einem Fünf-Sterne-Lokal mit mir unterhalten zu müssen statt in einem Café, aber vielleicht mochte der Mann ja einfach alten Whiskey.
Ein letzter Windstoß schob mich in die Drehtür, und ich verspürte eine Vorahnung von Gefahr, als der Geruch von altem Messing und Hundepisse in der plötzlich unbeweglichen Luft aufstieg. Dann öffnete sich die Tür auf eine weite Lobby mit viel Marmor. Beim Weg zu den Aufzügen lief mir ein Schauder über den Rücken. Und das lag nicht nur an der Märzkühle.
Das Paar, das ich auf dem Gehweg gesehen hatte, war schon längst verschwunden, und ich musste auf den speziellen Restaurantlift warten. Ich drückte mir die Tasche wie ein Feigenblatt vor den Körper, während ich die anderen Leute beobachtete. In meinem langen, feuerfarbenen Etuikleid fühlte ich mich irgendwie fehl am Platz. Es hatte mir im Laden so fantastisch gestanden, dass ich es gekauft hatte, obwohl ich darin nicht richtig rennen konnte. Teilweise hatte ich heute Abend Quen nur zugesagt, um es tragen zu können. Für meine Arbeit machte ich mich oft schick, aber immer in der Annahme, dass der Abend wahrscheinlich damit enden würde, dass ich vor Banshees weglaufen oder Vampiren hinterherrennen musste. Vielleicht will Quen sich nur nett unterhalten? Aber ich bezweifelte es.
Die Aufzugglocke ertönte, und ich setzte ein Lächeln auf, falls jemand darin stand, das jedoch schnell verblasste, als die Türen sich öffneten und lediglich den Blick auf mehr Messing, Samt und Mahagoni freigaben. Ich trat hinein und drückte den R-Knopf ganz oben auf der Leiste. Vielleicht fühlte ich mich nur deswegen so unbehaglich, weil ich allein war. Ich war diese Woche viel allein gewesen, während Jenks sich bemühte, im Garten die Arbeit von fünf Pixies zu erledigen, und Ivy in Flagstaff weilte, um Glenn und Daryl beim Umzug zu helfen.
Die Geräusche der Lobby verklangen, als die Türen sich schlossen. Ich sah in den Spiegel und schob mir eine Strähne hinters Ohr, die dem lockeren Zopf entkommen war, den Jenks’ jüngste Kinder mir heute Abend geflochten hatten. Wäre Jenks hier gewesen, hätte er mir gesagt, ich solle mich zusammenreißen. Es knackte in meinen Ohren, und ich straffte die Schultern. In den Handlauf des Lifts war ein Muster aus Kraftliniensymbolen eingelassen, aber es war nur ein leichter Euphorie-Zauber. Ich lehnte mich dagegen. Ich konnte heute Abend alle Euphorie brauchen, die ich bekommen konnte.
Als die Türen sich schließlich öffneten und Livemusik in den Raum hallte, hatte ich mich ein wenig entspannt. Himmel, es war nur ein Abendessen. Ich lächelte den jungen Mann am Empfangstisch an. Seine Uniform stand ihm gut, und er hatte die Haare mit Gel nach hinten gekämmt. Hinter ihm erstreckte sich Cincinnati durch die Dunkelheit, und die Lichter der Stadt glitzerten in der Nacht wie unzählige Seelen. Der Gestank und der Lärm waren weit entfernt, sodass man nur die Schönheit wahrnahm. Vielleicht hatte Quen sich deswegen für dieses Restaurant entschieden.
»Ich bin mit Quen Hanson verabredet«, sagte ich und zwang meine Aufmerksamkeit wieder auf den Empfangschef. Alle Tische, die ich sehen konnte, waren mit Leuten gefüllt, die sich an den Festival-Spezialitäten schadlos hielten.
»Ihr Tisch ist noch nicht fertig, aber Mr. Hanson wartet an der Bar auf Sie«, antwortete der Mann. Ich blinzelte bei dem unerwarteten Respekt in seiner Stimme. »Darf ich Ihnen das Schultertuch abnehmen?«
Das wird ja immer besser, dachte ich, während ich mich umdrehte, um die Seide von meinen Schultern gleiten zu lassen. Ich spürte, wie er beim Anblick meiner Rudel-Tätowierung kurz zögerte, und richtete mich zu meiner vollen Größe auf. Ich war stolz darauf.
»Hier entlang, bitte«, sagte er, gab das Tuch einer Frau, nahm eine Papierquittung dafür entgegen und reichte sie an mich weiter.
Ich ließ meine Hüften schwingen, als ich ihm folgte und mühelos auf den sich drehenden Teil des Restaurants überwechselte. Ich war schon ein paarmal hier gewesen, und die Bar lag am anderen Ende. Wir schritten zwischen Tischen hindurch, an denen verschiedenste schicke Leute fürstlich speisten. Das Paar, das das Hochhaus vor mir betreten hatte, saß bereits an seinem Platz. Ihre Gläser waren mit Wein gefüllt, und sie saßen eng nebeneinander, als würden sie sich gegenseitig mehr genießen als den Ausblick. Es war schon eine Weile her, seitdem ich mich so gefühlt hatte, und ich verspürte einen kurzen Stich. Doch ich verdrängte das Gefühl und trat zurück in den unbeweglichen Mittelteil des Restaurants, in dem sich die Bar aus Messing und Mahagoni befand.
Außer dem Barkeeper war Quen die einzige Person an der Bar. Er trug Jackett und Krawatte. Seine Körperhaltung verriet Unsicherheit, denn er stand kerzengerade vor der Bar, statt zu sitzen. Die förmliche Kleidung sah gut an ihm aus, schränkte aber wahrscheinlich seine Bewegungsfreiheit mehr ein, als ihm lieb war. Ich lächelte, als er mit einem Stirnrunzeln an seinem Ärmel zog; er hatte mich noch nicht gesehen. Die Reflexionen im Glas hinter dem Spiegel zeigten die Lichter auf dem Fluss. Quen wirkte erschöpft – wachsam, aber erschöpft.
Nichts entging seinem Blick, und er legte den Kopf schräg, um dem leise gestellten Fernseher in der Ecke über ihm zu lauschen. Dann bemerkte er uns und drehte sich lächelnd um. Ich erwiderte das Lächeln. Ich war wirklich froh, ihn zu sehen. Irgendwie war er für mich zu einer Art Vaterfigur geworden. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass wir im ersten Jahr unserer Bekanntschaft regelmäßig aneinandergeraten waren. Und damit, dass er mich immer noch mühelos mit seiner Magie ausschalten konnte. Außerdem spielte möglicherweise eine Rolle, dass ich ihm einmal das Leben gerettet hatte, während ich das Leben meines richtigen Dads nicht hatte retten können.
»Quen«, sagte ich, als er unnötigerweise sein Jackett und seine Stoffhose zurechtrückte. »Ich muss sagen, es ist besser, als dich auf dem Dach zu treffen.«
Die leichte Erschöpfung in seinen Augen verwandelte sich in Wärme, als er meine angebotene Hand nahm und mir mit festem Griff auf den Barhocker half. Müde oder nicht, er sah auf eine reife, durchtrainierte Bodyguard-Art gut aus. Im Gegensatz zu den meisten seines Volkes war Quen eher klein und dunkel, was ihm aber gut stand. Ich fragte mich, ob er wirklich an den Schläfen grau wurde, oder ob das nur am Licht lag. Er strahlte ein ganz neues Gefühl von Zufriedenheit und innerem Frieden aus – das Familienleben schien ihm zu bekommen, selbst wenn es wahrscheinlich auch der Grund für seine Müdigkeit war. Lucy und Ray waren zehn und dreizehn Monate alt. Als Trents Sicherheitschef war Quen mächtig in seiner Magie, standhaft in seinen Überzeugungen … und er liebte Ceri von ganzem Herzen.
Quen zog bei dieser Erinnerung an unser erstes Treffen am Carew Tower eine gleichzeitig belustigte und doch mürrische Grimasse. »Rachel, danke, dass du zugestimmt hast, mich zu treffen«, sagte er. Seine tiefe, melodische Stimme erinnerte mich an Trent. Es lag nicht so sehr an seinem Akzent als vielmehr an der kontrollierten Grazie seiner Sprechweise. Er sah auf, als der Barkeeper zu uns kam und ihm Weißwein nachschenkte. »Was willst du trinken, während wir warten?«
Der Fernseher hing an der Decke direkt hinter seinem Kopf. Ich wandte den Blick von den Börsenkursen ab, die in einem Banner unter dem neuesten nationalen Skandal durchliefen. Mein Rücken war der Stadt zugewandt, aber ich konnte im Spiegel hinter der Bar einen kurzen Blick auf die Hollows jenseits des Flusses erhaschen. »Jede Art von Schaumwein ist in Ordnung«, erwiderte ich. Quen riss die Augen auf. »Es muss kein Champagner sein«, setzte ich schnell hinterher, während mein Gesicht warm wurde. »Aber Sekt hat keine Sulfate.«
Der Barkeeper nickte wissend, und ich lächelte. Es war schön, mich nicht erklären zu müssen.
Quen beugte sich zu mir, und ich atmete seinen Geruch nach dunklem Zimt mit einem Hauch von Moos ein. »Ich dachte, du würdest etwas ohne Alkohol nehmen«, sagte er. Ich stellte meine Tasche neben mich auf die Bar.
»Limo? Auf keinen Fall. Du hast mich zu einem Treffen in einem Fünf-Sterne-Lokal nach Cincy bestellt; ich will das Feinste vom Feinsten.« Er lachte leise, aber für meinen Geschmack verklang es zu schnell. »Gewöhnlich«, bemerkte ich langsam, in dem Versuch, herauszufinden, warum ich überhaupt hier war, »möchte ein Mann, der mich an einen so schicken Ort einlädt, die Beziehung mit mir beenden, ohne dass ich eine Szene machen kann. Ich weiß, dass das hier nicht zutrifft.«
Er schwieg und biss die Zähne zusammen. Mein Pulsschlag beschleunigte sich. Der Barkeeper kam mit meinem Getränk zurück, und ich schob das Glas abwartend in kleinen Kreisen vor mir hin und her. Quen saß einfach nur da. »Was soll ich für Trent tun, was mir nicht gefallen wird?«, drängte ich schließlich, und er verzog tatsächlich das Gesicht.
»Er weiß nicht, dass ich hier bin«, sagte Quen. Plötzlich bekam sein leichtes Unbehagen eine vollkommen neue Bedeutung.
Das letzte Mal, als ich mich mit Quen getroffen hatte, ohne dass Trent davon wusste … Mann! »Verdammt, hast du Ceri wieder geschwängert? Gratulation! Aber wofür brauchst du mich? Babys sind doch toll!« Außer, man ist zufällig ein Dämon.
Er runzelte die Stirn, sackte in sich zusammen, nahm einen Schluck von seinem Wein und warf mir einen Blick zu, der mich aufforderte, meine Stimme zu senken. »Ceri ist nicht schwanger, aber die Kinder haben etwas mit dem zu tun, worüber ich mit dir reden wollte.«
Plötzlich besorgt lehnte ich mich vor. »Was ist?«, fragte ich. Ich verspürte einen wütenden Stich. Trent war manchmal ein ziemlicher Trottel und konnte sein »Das Volk retten«-Streben viel zu weit treiben. »Geht es um die Mädchen? Setzt er dich irgendwie unter Druck? Ray ist deine Tochter!«, meinte ich erregt. »Sie und Lucy zusammen als Schwestern aufzuziehen ist eine tolle Idee, aber wenn er glaubt, dass ich einfach zusehen werde, wie er dich aus ihrem Leben drängt …«
»Nein, nichts könnte der Wahrheit ferner sein.« Quen stellte sein Glas ab und ergriff meine Hand. Er drückte sie warnend, und ich verstummte. Erst als ich eine Grimasse zog, ließ er mich wieder los. Ich konnte ihn jederzeit mit einem Fluch auf den Hintern werfen, aber das würde ich nicht tun. Und zwar nicht, weil wir uns in einem schicken Restaurant befanden, sondern weil ich ihn respektierte. Außerdem, wenn ich ihn umhaute, würde er sich revanchieren, und neben Quens Zauberrepertoire sah meines lächerlich aus.
»Ray und Lucy werden mit zwei Vätern und einer Mutter aufwachsen. Es funktioniert wunderbar, aber darüber wollte ich nicht reden«, sagte er und verwirrte mich damit noch mehr.
Ein wenig eingeschnappt legte ich meine Hände in den Schoß. Dann hatte ich eben voreilige Schlüsse gezogen. Ich kannte Trent zu gut. Ihm war durchaus zuzutrauen, dass er Quen verdrängte, um das offizielle Bild der glücklichen, traditionellen Familie zu vervollkommnen. »Ich höre.«
Quen nahm noch einen Schluck Wein, um mir auszuweichen. »Trent ist ein anständiger junger Mann«, sagte er und beobachtete, wie der Wein sich im Glas bewegte.
»Ja …«, meinte ich vorsichtig. »Wenn man einen Drogenbaron und Produzenten von verbotener Medizin einen anständigen jungen Mann nennen kann.« Beides entsprach der Wahrheit, aber die Anschuldigung hatte schon vor geraumer Zeit ihren Stachel verloren. Ich glaube, das war passiert, als Trent den Kerl erledigt hatte, der mich in ein Leben voller Erniedrigungen verschleppen wollte.
Quens irritierte Miene entspannte sich wieder, als ihm klar wurde, dass ich nur einen Witz gemacht hatte – zumindest einen halben. »Ich habe kein Problem mit der zweitrangigen Rolle im Leben der Mädchen, die ich in der Öffentlichkeit spiele«, sagte er abwehrend. »Trent achtet sehr darauf, dass ich genügend Zeit mit ihnen verbringe.«
Wahrscheinlich mitternächtliche Ausritte und Vorlesen vor dem Schlafengehen, aber kein öffentlicher Auftritt als Elternteil. Trotzdem schaffte ich es, mich auf ein scharfes »Er genehmigt dir die Zeit, Vater zu sein. Nett von Trent« zu beschränken. Dann nippte ich an meinem Sekt und blinzelte gegen das Kitzeln in der Nase an, bevor es mich zum Niesen brachte.
»Es ist wirklich schwer, mit dir zu reden, Rachel«, erwiderte er barsch. »Würdest du einfach mal die Klappe halten und zuhören?«
Die scharfe Zurechtweisung ließ mich zögern. Ja, ich war unhöflich, aber Trent irritierte mich einfach. »Tut mir leid«, antwortete ich und konzentrierte mich auf Quen. Der Fernseher hinter ihm lenkte mich ab, und ich wünschte mir, sie würden ihn noch leiser stellen.
Als er sah, dass meine Aufmerksamkeit sich auf ihn richtete, senkte er den Kopf. »Trent stellt gewissenhaft sicher, dass ich genug Zeit mit Ray und Lucy verbringen kann, aber es wird immer deutlicher, dass dies eine unkluge Verringerung seiner persönlichen Sicherheit nach sich zieht.«
Verringerung seiner persönlichen Sicherheit?Ich schnaubte und griff nach meinem Sektglas. »Bekommt er nicht genug Daddy-Zeit?«
»Nein, er setzt Termine an, wenn ich keine Zeit habe, und nutzt diese Ausrede, um allein loszuziehen. Das muss aufhören.«
»Oh!«, sagte ich verständnisvoll. Quen versuchte, für Trents Sicherheit zu garantieren, seit dessen Vater gestorben war und ihn allein zurückgelassen hatte. Quen hatte Trent sozusagen aufgezogen. Es passte ihm wahrscheinlich gar nicht, den klugen Idioten, der gleichzeitig Multimillionär war, allein losziehen zu lassen, damit er sich auf dem Golfplatz mit Geschäftsleuten unterhielt. Besonders, nachdem Trent neuerdings davon überzeugt war, dass auch er Magie wirken konnte.
Dann verband sich dieser Gedanke mit der Frage, warum ich wohl hier saß, und ich riss die Augen noch weiter auf. »Oh, zur Hölle, nein!«, sagte ich, packte meine Tasche und machte Anstalten, von meinem Stuhl zu rutschen. »Ich werde nicht noch mal deinen Job übernehmen, Quen. Dafür gibt es nicht genug Geld auf dieser Welt. Nicht mal in zwei Welten.«
Nun, in zwei Welten vielleicht doch, aber darum ging es nicht.
»Rachel, bitte«, flehte er und packte meine Schulter, noch bevor meine Füße den Boden berührten. Was mich aber erstarren ließ, war die Sorge in seiner Stimme. »Ich bitte dich nicht, meinen Job zu erledigen.«
»Gut, weil ich es nicht tun werde!«, zischte ich leise, aber bestimmt. »Ich werde nicht für Trent arbeiten. Er ist ein … ein …« Ich zögerte, weil all meinen üblichen Beleidigungen inzwischen einfach der Biss fehlte. »Er hört nie auf mich«, sagte ich stattdessen. Quen senkte mit einem leisen Lächeln seine Hand. »Und deswegen gerät er in Schwierigkeiten. Ich habe ihn für dich an die Westküste gebracht, und schau dir an, was passiert ist!«
Quen wandte sich wieder der Bar zu. »Er hat dafür gesorgt, dass eine Bar abgebrannt und ein Monument der Vereinigten Staaten eingestürzt ist«, erwiderte er ausdruckslos.
»Es war nicht einfach nur eine Bar, es war Margaritaville. Ich bekomme immer noch Hassmails. Es war sein Fehler, und ich werde dafür verantwortlich gemacht. Und lass uns bitte nicht vergessen, dass San Francisco abgefackelt wurde. Oh! Und natürlich bin ich auch noch in einer Babyflasche gelandet, bis meine Aura sich weit genug erholt hatte, damit ich überleben konnte. Glaubst du, ich habe das genossen?«
Zugegeben, der Kuss, um den Zauber zu brechen, war wirklich nett gewesen. Aber als ich das letzte Mal für Trent gearbeitet hatte, hatten mich Meuchelmörder aufs Korn genommen.
Aufgebracht wandte ich mich wieder dem Spiegel hinter der Bar zu. Mein Gesicht war rot angelaufen. Ich zwang mich dazu, mich zu entspannen. Vielleicht hatte Quen richtig gedacht, als er mich hierhergebracht hatte. Hätten wir bei Juniors gesessen, wäre ich wahrscheinlich schon auf dem Weg zu meinem Auto gewesen. Mit den geflochtenen Haaren und dem eleganten Kleid, das mich schlank wirken ließ und nicht knochig, sah ich aus, als gehörte ich hierher. Aber es war alles nur Show. Ich hatte hier nichts zu suchen. Ich war weder wohlhabend noch besonders klug oder talentiert. Ich war einfach nur gut darin zu überleben – das war alles –, und jede einzelne Person hier oben außer Quen würde sofort abhauen, falls es Ärger gab. Vielleicht mit Ausnahme des Kochs. Köche konnten gut mit Messern umgehen.
Quen hob den Kopf, und die Falten auf seiner Stirn hatten sich noch vertieft. »Genau das sage ich doch«, meinte er leise. »Der Mann braucht jemanden, der auf ihn aufpasst. Jemanden, der die Schwierigkeiten überleben kann, in die er sich bringt und seine … Eigenarten versteht.«
»Eigenarten?« Frustriert ließ ich meine Tasche los und nahm noch einen Schluck Sekt. »Mann, das kannst du laut sagen. Ich verstehe«, meinte ich. Quen blinzelte irritiert. »Ich fühle sogar mit dir, aber ich kann nicht. Am Ende würde ich ihn umbringen. Er ist zu stur und unwillig, die Meinungen anderer zu akzeptieren, besonders in kniffligen Situationen.«
Quen lachte leise und entspannte sich ein wenig. »Klingt irgendwie vertraut.«
»Wir reden hier über Trent, nicht über mich. Und außerdem braucht er keinen Babysitter. Er ist erwachsen, und du«, ich deutete auf Quen, »traust ihm einfach nicht genug zu. Er hat es wunderbar geschafft, Lucy zu stehlen, und da haben sie sogar auf ihn gewartet.« Ich drehte mich wieder zur Bar und dem Spiegelbild der Hollows. »Er kann mit allem umgehen, womit Cincinnati ihn herausfordert«, fuhr ich leise fort, und ging im Kopf meine kurze Problemliste durch. »In letzter Zeit war es sehr ruhig.«
Quen seufzte, legte beide Hände um sein Glas und sackte in sich zusammen. Aber ich nahm ihm diese Haltung nicht ab. »Ich gebe ja zu, dass Trent eine Begabung dafür hat, einen Plan zu entwerfen und ihn bis zum Ende zu verfolgen. Aber sobald Improvisation notwendig wird, versagt er. Du dagegen bist toll im Improvisieren. Ich wünschte, du würdest noch einmal darüber nachdenken.«
Ich sah ihn an, weil mir die Wahrheit seiner Worte bewusst war, und Quen prostete mir mit seinem Glas zu. Trent war clever genug, um einen Ausweg aus einem Dämonenvertrag zu finden, aber das würde ihm gegen einen Heckenschützen-Zauber gar nichts helfen. Und da lag die wahre Gefahr. Ich biss die Zähne zusammen und verdrängte den Gedanken. Was interessierte es mich?
»Ich habe die I. S. verlassen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, für jemanden zu arbeiten. Daran hat sich nichts geändert.«
»Das stimmt so nicht ganz«, meinte er. Ich runzelte die Stirn. »Mit Ivy und Jenks arbeitest du ständig.«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Ja. Ich arbeite mit Jenks und Ivy, nicht für sie. Sie tun nicht immer das, was ich für das Beste halte, aber sie hören mir zumindest immer erst zu.« Ich tat auch nicht, was sie für das Beste hielten, also kamen wir halbwegs gut miteinander aus. Trent allerdings musste unbedingt zuhören. Der Geschäftsmann machte sogar mehr Fehler als … ich.
»Er wird schon viel besser«, meinte Quen. Ich konnte ein Lachen nicht unterdrücken.
»Wirklich?«
»Er hat mit Jenks zusammengearbeitet«, erwiderte Quen, aber ich konnte die Zweifel in seiner Stimme hören.
»Ja, er hat mit Jenks zusammengearbeitet«, sagte ich. Der Sekt glitt bitter durch meine Kehle. »Aber Jenks hat erzählt, Trent dazu zu bringen, ihn auch nur in das kleinste Detail mit einzubeziehen, wäre so anstrengend gewesen wie einem Fairy die Flügel auszureißen. Nein.«
Quens Sorgenfalte auf der Stirn wurde immer tiefer.
»Quen, ich verstehe deine Besorgnis«, sagte ich und legte ihm eine Hand auf den angespannten Arm, zog sie aber sofort zurück. Vielleicht hätte ich ihn nicht berühren sollen. »Es tut mir leid, aber ich kann es einfach nicht.«
»Könntest du es wenigstens probieren?«, bat er und schockierte mich damit tief. »Nächsten Freitag wird im Museum eine Sonderausstellung über das Erbe der Elfen eröffnet. Trent hat ein paar Ausstellungsstücke beigesteuert und muss dort auftauchen. Dir wird es gefallen.«
»Nein.« Wieder drehte ich mich zum Spiegel und sah mir selbst beim Trinken zu.
»Kostenloses Essen«, sagte er. Ich warf ihm im Spiegel einen ungläubigen Blick zu. So verzweifelt war ich wirklich nicht. »Jede Menge Kontakt zu Leuten mit einer Menge Geld«, fügte er hinzu. »Du musst netzwerken. Lass Cincy wissen, dass du die Rachel Morgan bist, die einen Banshee gefangen und San Francisco gerettet hat. Nicht nur eine Hexe, die eigentlich ein Dämon ist.«
Ich lief rot an, stellte das Glas ab und sah auf die Uhr. Himmel, war ich wirklich erst zehn Minuten hier?
»Ich nehme an, du könntest ein paar richtige Aufträge ergattern«, sagte er. Ich versteifte mich. Noch war mir das Geld nicht ausgegangen, aber die Leute versuchten mich nur deshalb anzuheuern, weil ich Dämonenflüche winden konnte. So war ich nicht, auch wenn ich das Potenzial dazu hatte. Es machte mich unruhig, dass Quen scheinbar wusste, wer alles bei mir angeklopft hatte. Ein paar einfache Bodyguard-Aufträge für die Elite von Cincy würde mein Ansehen tatsächlich aufpolieren.
Bietet Quen mir nicht genau das an?
»Du bekämst auch Kleidergeld«, schmeichelte Quen. Mein Pulsschlag beschleunigte sich, allerdings nicht bei dem Gedanken an ein neues Paar Stiefel, sondern weil ich dämlich genug war, darüber nachzudenken. »Rachel, ich bitte dich als Freund darum«, fügte er hinzu, als er mein Zögern spürte. »Für mich, und für Ceri.«
Stöhnend ließ ich meinen Kopf in die Hände fallen. Ceri. Obwohl sie zugestimmt hatte, das öffentliche Bild mit Trent aufrechtzuerhalten, liebte sie Quen. Und Quen erwiderte ihre Liebe mit der Wildheit einer Person, die nie erwartet hatte, so etwas Wunderbares zu finden. Zur Hölle, wenn ich nicht mehr war als eine Personenschützerin, konnte ich Trent ein paar Stunden lang bewachen. In wie viel Ärger konnte der Mann schon in einem Museum geraten?
»Du kämpfst mit harten Bandagen«, sagte ich säuerlich zu seinem Spiegelbild, und wieder prostete er mir zu, diesmal mit einem verschlagenen Lächeln.
»Es liegt in meiner Natur. Also, machst du es?«
Ich rieb mir den Nacken und drehte mich zu ihm um. Ich war zwischen Schuld- und Pflichtgefühl hin- und hergerissen. Um seinem Blick auszuweichen, schaute ich auf den Fernseher, auf dem die Skyline von Cincy zu sehen war. Das war ungewöhnlich, denn es war kein Lokalsender. Im Bild stand die Einblendung »Drittes Kind entführt«, dann verschwand es hinter einer Versicherungswerbung. Als Trents Bodyguard auftreten?, dachte ich, während ich mich an Trents wilde, beschützerische Miene unter der Stadt erinnerte, als er den Mann schlafen gelegt hatte, der mich hatte entführen wollen. Und dann daran, wie er vor meiner Tür ausgesehen hatte, als er feststellte, dass Wayne mich über der Schulter aus der Kirche trug. Trent hatte mühelos einen Zauber gesponnen, um den Werwolf auszuschalten. Sicher, eigentlich war das nicht nötig gewesen, aber das konnte Trent zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.
Ich drehte den Stiel meines Sektglases langsamer, als ich mich daran erinnerte, wie Trent sich mir gegenüber geöffnet hatte, um mir von der Person zu erzählen, die er sein wollte. Als wäre ich die Einzige, die ihn vielleicht verstehen konnte. Und Quen will, dass ausgerechnet ich ihm das verweigere?
»Nein«, flüsterte ich. Ich wusste einfach, dass Trent meine Gegenwart als Versagen deuten würde. Das hatte er nicht verdient. »Nein, ich werde nicht seinen Babysitter spielen.«
»Rachel, du musst deinen kleinlichen Groll beiseiteschieben und …«
»Nein!«, sagte ich lauter, jetzt wütend, und er verstummte. »Hier geht es nicht um mich. Trent kann für sich selbst einstehen. Du traust ihm zu wenig zu. Du hast mich gefragt, und ich habe Nein gesagt. Finde jemand anderen, der ihm ins Gesicht spuckt.«
Quen wich mit wütendem Ausdruck auf dem Gesicht ein Stück zurück. »Das tue ich nicht«, entgegnete er, aber in seiner Ablehnung lag ein Hauch von Sorge. »Ich will einfach nicht, dass er allein dort draußen ist. Es ist nichts daran auszusetzen, ihm Rückendeckung zu geben. Er kann auch für sich selbst einstehen, ohne deswegen allein zu sein.«
Der Fernseher hinter Quen zeigte den Eingang zu Cincys Krankenhaus, hell erleuchtet und mit massenweise Einsatzfahrzeugen davor. Rückendeckung geben?
»Ich werde es nicht noch mal ansprechen«, sagte er, plötzlich verschlossen, und wandte sich von mir ab. »Ich glaube, unser Tisch ist bereit.«
Verwirrt glitt ich vom Hocker und achtete darauf, dass mein Kleid richtig fiel. Wenn ich dort auftauchte, würde Trent mich nicht als Rückendeckung sehen. Er würde behaupten, ich wäre sein Babysitter. Quen lag falsch.
Oder?
»Nach dir«, sagte Quen schlecht gelaunt und deutete auf den Mann, der mit zwei riesigen Speisekarten in der Hand vor uns stand.
Gott rette mich vor mir selbst, aber vielleicht hat der Elf ja recht. »Quen …«
Aber dann huschte mein Blick wieder zu dem Fernseher über der Bar, als mir eine vertraute Formulierung ans Ohr drang und jeder Gedanke an Trent verschwand. Plötzlich erkannte ich im gezeigten Bild hinter dem Sprecher den neuen Rosewood-Flügel. Das war einfach nur ein schicker Name für drei gemütliche, eher wohnhausähnliche Gebäude, die sie für die todgeweihten Babys mit Rosewood-Syndrom gebaut hatten. Die Sackgasse war feucht vom Regen, und die Lichter der Polizeiautos und der Übertragungswagen ließen den Boden glänzen. Der Gedanke Dritte Entführung hallte in mir wider, und ich blieb abrupt stehen. Hinter mir grunzte Quen überrascht.
»Machen Sie lauter!«, rief ich, drehte mich wieder zur Bar und drängte mich an Quen vorbei.
»… anscheinend von einem Entführer mitgenommen worden, der als Nachtschwester verkleidet war«, erklärte die Frau gerade. Ich fühlte, wie mein Gesicht blass wurde. »I. S.-Beamte untersuchen den Vorfall, aber bisher gibt es keine Hinweise darauf, von wem oder warum die todkranken Kinder entführt wurden.«
»Machen Sie lauter!«, wiederholte ich. Diesmal hörte mich der Barkeeper, hob die Fernbedienung und regelte die Lautstärke hoch. Quen trat neben mich, und beide starrten wir nach oben. Ein Telefon summte, und Quen zuckte zusammen, während seine Hand bereits zur hinteren Hosentasche glitt.
»Aufgrund von Baby Benjamins wundersamen Fortschritten im Kampf gegen die tödliche Krankheit fürchten die Behörden, dass es keine Lösegeldforderung geben wird – sondern das Opfer stattdessen von skrupellosen Bioingenieuren entführt wurde, die versuchen, ein Heilmittel zu entwickeln und zu verkaufen.«
»Oh mein Gott«, flüsterte ich und wühlte in meiner kleinen Tasche nach meinem Handy. Während des Wandels waren alle Bioingenieure getötet worden. Das war eine Tradition, die sowohl von Menschen als auch von Inderlandern fröhlich bis heute fortgeführt wurde. Und die Tatsache, dass ich nur wegen genetischer Manipulationen noch am Leben war, sorgte auch nicht dafür, dass ich mich besser fühlte.
»Lassen Sie uns hoffen, dass die Kinder bald gefunden werden«, sagte die Frau, und damit folgte die nächste Meldung von einem neuen Skandal in Washington.
Mit gesenktem Kopf tippte ich Trents Nummer ein. Damit würde ich direkt in seiner Privatwohnung herauskommen, ohne erst in der Vermittlung zu landen. Mir wurde erst heiß, dann kalt, und meine Hände zitterten. Er hätte das Baby nicht entführt, aber er besaß vielleicht eine kurze Liste der Personen, die dafür infrage kamen. Die Menschen-gegen Paranormale-Gesellschaft, MegPaG, vielleicht – jetzt, wo klar war, dass sie mich nicht bekommen würden. Trent hatte einst versprochen, dass er den Dämonen das Heilmittel für ihre Unfruchtbarkeit geben würde. Aber nachdem er das ganze Chaos ertragen hatte, das meine Rettung durch seinen Vater ausgelöst hatte, ging ich nicht davon aus, dass Trent scharf darauf war, schon jetzt die Anzahl der überlebenden Dämonen zu erhöhen.
Überrascht hörte ich ein Besetzt-Zeichen. Ich blickte neben mich und sah, wie Quen mit gerunzelter Stirn auf den Bildschirm seines Handys schaute. Mit einem Blinzeln erinnerte ich mich daran, wo ich mich befand. Quens Lippen zuckten, und er hielt mir sein Handy entgegen. Es war kleiner und glänzender als meines. »Er ruft mich gerade an«, sagte er mit dünner, irgendwie abwesender Stimme. »Rede du mit ihm.«
Mit zitternden Fingern nahm ich das Telefon entgegen. »Er wird merken, dass wir zusammen sind, dass wir uns unterhalten haben.« Oh Gott, Trent sollte nicht erfahren, dass Quen an ihm zweifelte. Er sah ihn als Vater, trotz des monatlichen Gehalts.
Quen zuckte mit den Achseln. »Er wird es sowieso herausfinden.«
Mit plötzlich trockenem Mund hob ich ab und hielt mir das Telefon ans Ohr. »Trent?«
Es folgte ein vielsagendes Zögern, aber er fing sich schnell wieder. »Rachel?«, fragte Trent offensichtlich überrascht. »Es tut mir leid. Ich muss den falschen Knopf gedrückt haben. Ich wollte Quen erreichen.«
Ich hielt mir das Handy fester ans Ohr. Mein Puls raste. Seine Stimme klang wunderschön, und ich war froh, dass ich Quens Vorschlag abgelehnt hatte. »Ähm«, sagte ich mit einem Blick zu dem unbeweglichen Quen. »Du hast schon die richtige Nummer erwischt.«
Wieder zögerte Trent. »Okay?«
»Wir wollten zusammen zu Abend essen.« Ich erklärte nichts, und Quens Miene wurde sogar noch ausdrucksloser. »Quen und ich. Hast du die Nachrichten gesehen? Weißt du, wer das war?«
Meine Besorgnis kam zurück und verdrängte die kurze Freude darüber, Trent überrascht zu haben. Das schaffte ich selten. Der Kellner wartete immer noch. Als Quen den Kopf schüttelte, schenkte er uns ein schleimiges Lächeln, ließ die Speisekarten auf die Bar fallen und ging davon.
»Nein, aber ich fahre jetzt sofort hin.« Trent klang angespannt, und jede Vermutung meinerseits, dass er die Rosewood-Babys geheilt hatte, erstarb. »Nachdem du gerade mit Quen zusammen bist, würdet ihr mich dort treffen?«
Ich hörte die Anklage in seinem Ton. Er wollte, dass ich dort hinkam? Zu ihm?
»Rachel, bist du noch da?«, fragte Trent. Ich wurde rot und warf einen schnellen Blick zu Quen, bevor ich mir das Handy noch fester ans Ohr drückte.
»Ja. Zum Krankenhaus, richtig?« Wo die ganzen Reporter stehen? Super. Ich fragte mich, ob er meine professionelle Meinung einholen oder einfach nur erfahren wollte, was Quen und ich gerade taten.
»Rosewood-Flügel«, sagte er grimmig. »Ich bezweifle, dass wir Hinweise darauf finden werden, wer den Säugling entführt hat. Aber ich will nicht, dass die I. S. Beweise verschwinden lässt, weil ihr nicht gefällt, was sie entdeckt. Wenn einer von uns dort ist, erfahren wir zumindest die Wahrheit.«
Ich nickte, während Quen ein paar Worte mit dem Barkeeper wechselte und ihm einen Schein zuschob. Vor dem Wandel war die I. S. ein geheimer Ableger des ehemaligen FBI und der Polizei gewesen. Sie hatte Inderlander-Verbrechen versteckt, bevor die nichts ahnenden Menschen Hinweise entdecken konnten, dass es Hexen, Werwölfe und Vampire wirklich gab. Es lag ihnen im Blut, das Unangenehme oder Unprofitable einfach unter den Teppich zu kehren.
»Rachel, könnte ich mit Quen sprechen?«, fragte Trent und riss mich damit aus meinen Gedanken.
»Ähm, sicher. Wir sehen uns gleich.« Mein Magen war ein einziger Knoten. Ich streckte Quen das Handy entgegen. »Er will mit dir reden.«
Quen starrte auf das Telefon, dann nahm er es widerwillig entgegen. Er wandte sich ein wenig von mir ab und straffte die Schultern. »Sa’han?« Er zögerte. »Abendessen.« Ein weiteres Zögern. »Natürlich weiß Ceri davon. Es war ihre Idee.«
Ceri steckte auch mit drin? Mit einem Stirnrunzeln zwang ich mich, die Arme zu senken. Trent wäre ziemlich sauer. Ich war es jedenfalls gewesen, als meine Mom und mein Dad mir für ein paar Monate einen Bodyguard gemietet hatten.
»Nein«, sagte Quen entschlossen, und dann wieder: »Nein. Ich sehe Sie dort.«
Ich konnte Trents Beschwerden hören, als Quen das Telefon zuklappte und ihn einfach abwürgte. Das schien nicht besonders gut zu laufen. Als Quen mir bedeutete, ich solle vorgehen, folgte ich seiner Aufforderung widerspruchslos. In Gedanken war ich bereits beim Krankenhaus.
Hinter uns lachten die Leute und stießen mit ihren Gläsern an. Unter uns lag Cincinnati mit seinen Einwohnern, gleichgültig und nichts ahnend. Jetzt fühlte es sich falsch an. Jemand stahl Rosewood-Babys. Und der Grund dafür war scheußlich.
Quen schwieg den gesamten Weg zum Aufzug. Er wich meinem Blick aus, als ich ihm meine Garderobenmarke gab, damit er sie der Garderobiere geben konnte. Ich hätte sie auch selbst überreichen können, aber in der High Society galten seltsame Regeln, und mir war es egal. »Du wirst es ihm nicht sagen?«, fragte ich in der Hoffnung, dass wir die Fahrt zum Krankenhaus dafür nutzen konnten, eine andere Geschichte zu erfinden als die bittere Wahrheit: dass Quen mich gebeten hatte, auf Trent aufzupassen.
Mit nachdenklichem Blick nahm Quen mein Schultertuch entgegen. Mit gesenktem Kopf drehte ich mich um. »Du könntest recht haben«, sagte er. Ich zitterte, als sich die kühle Seide auf meine Schultern legte. »Vielleicht habe ich gedankenlos gehandelt.«
Das war eine ehrliche Antwort, aber es konnte genauso sein, dass Quen recht hatte. Trent brauchte keinen Babysitter. Aber jeder konnte jemanden gebrauchen, der ihm den Rücken freihielt.
2
In Quens Auto war es warm. Die Sitzheizung lief, und ich hatte die Lüftung auf mich ausgerichtet. Die losen Strähnen an meinem Zopf kitzelten mich am Nacken, während wir langsam über das verschachtelte Krankenhausgelände fuhren. Mir war ein wenig übel. Ich lehnte mich vor und spähte durch die Windschutzscheibe, gleichermaßen begierig darauf, endlich anzukommen und unsicher, was ich Trent sagen wollte. Nebel stieg auf, alles glühte in unwirklichem Schein. Das hohe Hauptgebäude mit den Lichtern auf den glatten Wänden wirkte im Regen irgendwie unheilvoll. Doch das war nicht unser Ziel. Im Krankenhaus wurden die Leute – überwiegend – gesund. Wo wir hinfuhren, konnten nur die emotionalen Wunden irgendwann heilen.
Die Reifen zischten über den nassen Asphalt, als wir scharf nach rechts in eine Sackgasse abbogen. Vor uns lagen drei einfache, bis auf ihre Farbe absolut identische Häuser. I. S.-Streifenwagen und schwarze Crown Vics parkten in den Einfahrten und am Randstein. Beim Anblick der Übertragungswagen verzog ich angewidert die Lippen. Helle Lichter ergossen sich zusammen mit schweren Kabeln aus einem der Gebäude. Die Kabel sahen aus wie absurde Nabelschnüre. Es musste den Reportern die Nacht versüßt haben, dass ihre Lokalstory landesweit aufgegriffen wurde.
Die drei zweistöckigen Häuser wirkten in der sonst so klinischen Krankenhausumgebung fehl am Platz. Sie waren relativ neu; die frisch gepflanzten Büsche der Außenanlage sahen noch klein und jämmerlich aus. Das war Cincinnatis Rosewood-Flügel, in den die Rosewood-Babys verlegt wurden. Manche wurden hier geboren, andere starben hier. Keines überlebte. Viele Eltern, aber nicht alle, entschlossen sich, ihr Kind für die letzten Tage mit nach Hause zu nehmen. Somit war es ein Segen, dass die Häuser so gemütlich waren. Hier gab es mehr Psychologen als Krankenschwestern. Als ich geboren wurde, hatte es so etwas noch nicht gegeben. Ich fühlte mich melancholisch und seltsam, als Quen seinen Zweisitzer in eine Parklücke lenkte, die für die anderen Wagen zu klein war.
Quen schaltete den Motor aus, machte aber keine Anstalten, das Auto zu verlassen. Ich lehnte mich ebenfalls in den weichen Sitz zurück. Fast hatte ich Angst. Quen stieß hörbar den Atem aus, dann wandte er sich mir zu. »Ich werde ihm sagen, dass wir Abendessen gegangen sind und über seine Security geredet haben«, erklärte er schließlich. In seinen Augen stand ein flehender Ausdruck. »Außerdem werde ich ihm erzählen, dass ich dich in der Frage, ob er allein sicher ist, um deine Meinung gebeten habe und dass du gesagt hast, ja, das wäre er, aber du, sollte die Situation sich ändern …«
Mein Herz machte einen Sprung, als er den Satz unvollendet ließ. Er erwartete, dass ich mich bereit erklärte, auf Trent aufzupassen, wenn er es nicht konnte. Ganz abgesehen von der Notlüge. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, und musterte Quens Gesicht. Das dämmrige Licht, das von dem hell erleuchteten Gebäude zu uns drang, ließ ihn älter aussehen, und seine Sorge war deutlich zu erkennen. Verdammt und zur Hölle. »… ich, sollte die Situation sich ändern, jederzeit zur Verfügung stünde, um bei der Bewachung der Mädchen zu helfen«, erklärte ich entschlossen. Quen quittierte es mit einer ausdruckslosen Miene.
»In Ordnung, Tal Sa’han«, grummelte er. Ich zog die Augenbrauen hoch. Tal Sa’han? Das war neu. Ich hätte ihn gefragt, was das bedeutete, aber er hatte etwas spöttisch geklungen.
»Dann lass uns gehen«, sagte ich stattdessen und griff nach meiner Tasche. Die Clutch wirkte zu klein, als ich ausstieg, und meine Kleidung war für einen Tatort vollkommen ungeeignet. Der kühle Nebel berührte mein Gesicht, und als Quens Tür zuschlug, zuckte ich zusammen. Ich senkte den Blick zu Boden und schloss meine Wagentür ebenfalls.
Dann atmete ich tief durch, hob das Kinn und machte mich auf den Weg zur Tür, die bereits für die Besucher offen stand. Mir fiel auf, dass der Türrahmen doppelt so breit war wie üblich. Ich hasste so breite Türen – oder vielmehr die Rollstühle, an die sie erinnerten. Plötzlich wünschte ich mir, ich wäre überall, nur nicht hier. Ich war dem Tod durch Rosewood-Syndrom entkommen. Es hatte mich fast meine gesamte Jugend gekostet und auf eine Weise geprägt, die ich erst jetzt langsam verstand. Aber es war eine bittersüße Erinnerung.
Quen blieb neben mir. »Geht es dir gut?«
Wir hatten den Gehweg erreicht, der sich in schönen Kurven dahinzog, um den Eindruck von Entfernung zu vermitteln. »Prima«, sagte ich, während meine Laune sich verschlechterte. Ich wollte nicht hier sein – und mir gefielen die Erinnerungen nicht, die plötzlich aufgewühlt wurden. Jemand stahl Rosewood-Babys, und die Folgen dieses Umstandes würden mir schlaflose Nächte bescheren.
Mit gesenktem Kopf trat ich über die Kabel des Übertragungswagens. Dann schob ich mich seitwärts durch die Tür, um dem I. S.-Kerl dort meinen Ausweis zu zeigen, auch wenn ich eher das Gefühl hatte, dass uns Quens Anzug und mein schickes Kleid den Zugang ermöglichten. Der Officer erkannte mich nicht. Aber nur jemand, der unbedingt hier sein musste, würde in Abendgarderobe auftauchen. Das musste ich mir merken.
Der kühle Nebel verschwand. Ich zögerte in dem breiten Flur, wobei ich Quens schweigende, zuverlässige Gegenwart hinter mir spürte. Vor uns führte eine Treppe nach oben, wahrscheinlich zu den Räumen der Schwestern; hinter der Treppe, am Ende eines kurzen Flurs, lag die Küche. Es gab zwei Wohnzimmer, eines auf jeder Seite der Tür. Beide waren voller Leute, die herumstanden und sich unterhielten, aber nur eines davon hatten die Nachrichtenleute ausgeleuchtet. Es war warm, sogar meinem Empfinden nach. Mir gefiel der Ton der aufgeregten Reporterin nicht, die die verzweifelte Mutter fragte, wie sie sich fühlte, jetzt, wo ihr Baby – das entgegen aller Wahrscheinlichkeit noch lebte – gestohlen worden war.
»Was für eine widerliche Kuh«, flüsterte ich wütend, und Quen räusperte sich. Jemand hatte erkannt, dass das Rosewood-Syndrom die Folge von zu vielen Dämonenenzymen war und »erntete« Dämonenblut, während die Babys noch lebten. Ich wäre ebenfalls tot, hätte Trents Vater nicht meine Mitochondrien verändert. Jetzt produzierten sie ein Enzym, das die tödliche Wirkung des Dämonenenzyms neutralisierte und mir dadurch ermöglichte, Dämonenmagie zu entzünden. Das war die komplizierte Erklärung. Letztendlich bedeutete es, dass er dafür gesorgt hatte, dass ich es überlebt hatte, als Dämon geboren worden zu sein.
Quen legte seine Hand an meinen Ellbogen und zog mich sanft zur Seite, um jemandem Platz zu machen. Wie betäubt sah ich mich nach einem vertrauten Gesicht um – jemandem, mit dem ich anfangen konnte. Mein Abendkleid zog einige Blicke auf sich, aber es hielt mir auch die Leute vom Leib. Diese dämliche Reporterin interviewte immer noch die Eltern, und am Rand der Szene standen I. S.-Agenten, die auf einen Moment im Rampenlicht hofften. Gott sei Dank erkannte mich niemand. Ich verspürte Schuldgefühle, weil ich von so viel Trauer umgeben war – Trauer, die meine Eltern ebenfalls ertragen hatten, nur um letztendlich zu triumphieren. Verdammt, ich würde mich nicht schuldig fühlen, weil ich überlebt hatte.
»Da ist er«, hauchte Quen erleichtert. Ich folgte seinem Blick zum hinteren Ende des Wohnzimmers und einem Flur, der wahrscheinlich über das Kinderzimmer zur Küche führte.
»Und Felix«, sagte ich, überrascht zu sehen, dass Trent sich mit dem untoten Vampir unterhielt. Eigentlich unterhielt er sich mit Nina, der jungen Vampirin, die Felix momentan so gerne als sein Sprachrohr einsetzte. Die junge Frau wirkte dünner als beim letzten Mal, als ich sie gesehen hatte, besser angezogen und selbstbewusst, aber auch verhärmt, als hätte sie in den letzten vier Monaten zu viele Aufputschmittel genommen. Es fiel schwer, sie hinter dem weltmännischen, gefassten, untoten Vampir, der ihren Körper kontrollierte und immer für ein paar Stunden durch sie lebte, noch zu erkennen.
Das hatte ich erwartet. Als Sprachrohr eines untoten Meisters zu dienen, war für keinen der beiden Beteiligten sicher – der alte Vampir wurde zu intensiv an das Leben erinnert und fing an, sich danach zu verzehren; und der junge Vampir hatte plötzlich zu viel Macht in Körper und Geist, um allein damit umzugehen. Es war eine Gratwanderung, an die sich nur die Erfahrensten wagten. Langsam glaubte ich, dass die Beziehung die Grenze überschritten hatte, an der sie noch sicher beendet werden konnte.
Besorgt biss ich mir auf die Lippe und fragte mich, ob die I. S. Trent wegen der Entführungen verhörte. Aber während ich die beiden beobachtete, entschied ich, dass Trent – auch wenn er schon bewiesen hatte, dass er sogar ruhig bleiben konnte, wenn man ihn auf seiner eigenen Hochzeit verhaftete – nicht verhalten genug wirkte, um gerade einer Entführung bezichtigt zu werden. Felix lieferte ihm wahrscheinlich gerade die wahre Geschichte, nicht den gequirlten Mist, den sie den Reportern servierten.
Trents kurze, fast durchsichtig blonde Haare leuchteten förmlich neben Ninas dichten, schulterlangen schwarzen Latinohaaren. Die Frau selbst hatte keine politische Macht, aber Felix’ Einfluss verlieh ihr ungewöhnlich viel Niveau und Kontrolle – und ein leicht männliches Auftreten. Für das schicke Kostüm, das sie trug, stand sie einfach zu breitbeinig da.
»Langsam wird es zur Gewohnheit, an Tatorten auf Trent und Felix zu stoßen«, sagte ich, als ich mich in Bewegung setzte und mir langsam einen Weg durch die Reporter bahnte. Während ich Trent musterte, merkte ich, wie sich meine Meinung über Quen änderte. Oh, beide Männer waren elegant, aber Quens Auftreten entsprang der Überzeugung, dass er mit jeder Situation umgehen konnte. Trent verdankte seine einem Leben, in dem ihm jeder immer zugehört und ihn mehr als wichtig genommen hatte. Beide waren gut angezogen, aber Trents Anzug war für seinen durchtrainierten, attraktiven Körper maßgeschneidert, während bei Quen immer offensichtlicher wurde, dass er lieber seine übliche, lockere Security-Uniform getragen hätte. Ich hatte beide Männer schon dabei beobachtet, wie sie einen Angreifer überwältigten. Quen würde immer nur ein Mindestmaß an Gewalt einsetzen. Trent dagegen bot einen lebenden Widerspruch – furchterregende Eleganz gepaart mit Wildheit und gesungener Magie.
Trent fühlte meinen Blick und wirkte für einen kurzen Moment überrascht. Erst nachdem er seine Augen einmal anerkennend über meinen Körper in dem Abendkleid hatte gleiten lassen, berührte er Felix’ Schulter, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Der/Die alte/junge I. S.-Agent/in drehte sich mit einem strahlenden Lächeln um. Das übliche Auftreten der jungen Frau verschwand, als Felix die Kontrolle vollkommen übernahm.
»Rachel!«, sagte Nina ein wenig zu laut und übertrieben langsam, als Quen und ich in den etwas ruhigeren Flur traten, von dem aus wir immer noch die Geschehnisse beobachten konnten. »Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Ist Ivy schon zurück?«
Zurückhaltend schüttelte ich gleichzeitig ihre Hand und meinen Kopf. »Erst nächsten Samstag«, sagte ich und entzog ihr meine Hand. Mir gefiel Felix’ Interesse an meiner Mitbewohnerin nicht. »Ich war gerade beim Abendessen, als ich die Nachrichten hörte, und bin vorbeigekommen, weil …« Ich zögerte und umklammerte meine kleine Tasche fester. Weil ich wissen will, wer Babys entführt, die Dämonenmagie entzünden können? Das klingt ja toll.
Trent räusperte sich, als das Schweigen unangenehm wurde. »Weil ich sie darum gebeten habe«, erklärte er, als auch er mir die Hand schüttelte. An seiner fehlten die letzten zwei Finger, aber er versteckte den Makel gut, bis unsere Hände sich berührten. An seinem Zeigefinger glitzerte immer noch der Ring, der der Zwilling von meinem war. Schnell versteckte ich die Hand hinter dem Rücken, um zu verhindern, dass Felix die beiden Schmuckstücke bemerkte und Fragen stellte. »Hallo, Rachel. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du … deine Pläne geändert hast.« Es war nur ein winziges, aber doch erkennbares Zögern gewesen. Neben mir räusperte sich Quen, der offensichtlich vor Felix nichts erklären wollte.
Ich weiß nicht, ob ich weiter lügen will, dachte ich. Bei seiner Berührung wurde mir warm, und ich fragte mich, ob ich tatsächlich ein leichtes Kribbeln ausgetauschter Energie gespürt hatte, als unsere Finger sich wieder voneinander lösten. »Wer hat das getan?«, fragte ich und bemühte mich, die schluchzende Frau auf dem Sofa auszublenden. Mein Gott, hatten Reporter denn gar keine Gefühle?
Nina lachte, weil Felix der menschlichen Tragödie offensichtlich gleichgültig gegenüberstand. »Lassen Sie mich meine Kristallkugel befragen«, sagte sie, um sofort ernst zu werden, als sowohl Trent als auch ich sie nur anstarrten. Wir waren nicht die Einzigen. Es war ein durchdringendes Lachen gewesen.
»Quen, ich danke dir dafür, dass du Ms. Morgan mitgebracht hast«, sagte Trent mit einem Nicken.
»Es war kein Problem, Sa’han …« Quen zögerte. »Dürfte ich um eine Sekunde Ihrer Zeit bitten?«
»Gleich.« Trent lächelte sein professionellstes Lächeln, und ich sackte leicht in mich zusammen. Solange Felix hier war, wäre Trent so glatt wie Teflon – wusste nichts, sah nichts, erreichte nichts – langweilig, langweilig, langweilig. Außerdem war er sauer. Das konnte ich an dem leichten roten Schein seiner Ohren erkennen. Er würde sich nicht mit Quen unterhalten, bis sie allein waren. Und bis zu diesem Zeitpunkt würde er vom Schlimmsten ausgehen. Die drei Tage, die wir zusammen in einem Auto verbracht hatten, hatten mir unerwartete Einblicke verschafft. »Ich hoffe, du und Rachel hattet einen schönen Abend.«
Das war wirklich gehässig. Ich schob meinen Arm unter Quens und überraschte damit beide Männer, aus verschiedenen Gründen. »Er hat mir einen Sekt spendiert. Davon bekomme ich im Gegensatz zu anderen Weinen kein Kopfweh.«
Trent starrte auf meinen untergehakten Arm, dann hob er den Blick zu seinem Security-Chef. Langsam löste sich Quen von mir, mit steifen, unangenehm berührten Bewegungen.
»Quen«, sagte Nina, während sie die Reporter beobachtete, die inzwischen die Pflegekräfte befragten. »Nachdem Sie schon da sind, dürfte ich Ihre professionelle Meinung zu etwas einholen?«
Quen blinzelte überrascht und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Meine Meinung?«
Nina nickte eifrig. »Ja. Nun, falls Trent zulässt, dass ich Sie für ein paar Momente entführe. Sie sind sehr erfahren in Security-Fragen, ob nun technischer oder magischer Natur«, sagte sie. Sie streckte einen Arm aus, um ihn an der Schulter zu berühren, während sie mit der anderen Hand tiefer ins Gebäude und Richtung Schlafzimmer zeigte.
»Personenschutz, ja. Ich verstehe nicht, wie ich helfen kann.«
Quen wurde von dem lebenden/toten Vampir vorwärtsgezogen und glitt in einer Wolke aus Wolle und Zimt an mir vorbei. »Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich das Security-System hier ansehen könnten und mir sagen, was nötig wäre, um es zu umgehen«, erklärte Nina.
Der Mann warf einen Blick zu Trent, und als dieser mit den Achseln zuckte, sagte Quen: »Es wäre mir ein Vergnügen. Ähm, aber ich will nicht vor Gericht aussagen. Nur meine persönliche Meinung.« Das war das Letzte, was ich hörte, bevor sie sich weit genug entfernten, dass der Lärm des vorderen Raumes ihr Gespräch übertönte.
Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Dicht gefolgt von säuerlichem Neid. »Immer eine Brautjungfer«, murmelte ich, als ich neben Trent trat. Niemand bat je mich um meine Meinung zu einem Tatort. Oder zumindest erst, wenn die Kerle mit den Staubsaugern schon fertig waren.
Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich vermutet, dass Felix Quen absichtlich weggeführt hatte, damit Trent und ich uns unterhalten konnten. Das Gefühl verstärkte sich noch, als Trent mir einen kurzen Blick zuwarf, um sich dann wegzudrehen, als wären wir zwei Mauerblümchen, die von ihren jeweiligen Verabredungen abgestellt worden waren, um »sich kennenzulernen«. Trent in seinem Dreiteiler, der mehr kostete als mein Auto, und ich in einem schicken roten Kleid, das ich wahrscheinlich nie wieder anziehen würde.
Dann begann die Frau auf der Couch wieder zu schluchzen, und das Gefühl verschwand.
»Das ist übel«, sagte Trent. Seine Maske hatte er abgelegt.
Er hatte nicht gefragt, was Quen und ich getan hatten. Meine Schultern entspannten sich. »Wie ernst nimmt die I. S. die Sache?«
Trent atmete ein wenig zu laut aus, ein verräterisches Zeichen, das mich erschütterte. Er war beunruhigt – und zwar sehr. »Nicht ernst genug.«
Das hatte ich bereits gemerkt, aber nur deswegen wäre Trent nicht hier. »Wie viele Babys sind weg?«, fragte ich. Dann verzog ich das Gesicht, als die Mutter ihr Taschentuch in der Faust zerknüllte. Ihre Augen waren rot und wund. »Bis auf dieses jetzt, meine ich. Die Medien sprechen von drei.«
Mit in die Ferne gerichtetem Blick flüsterte Trent: »Insgesamt acht über die Vereinigten Staaten verteilt, aber die I. S. bestätigt nur die, von denen die Presse erfährt. Die Entführung vor dieser waren die Zwillinge eines bekannten Politikers. Sie waren über einen Monat alt. Die Eltern sind am Boden zerstört. Sie wissen nicht, warum ihre Kinder überlebt haben. Die meisten entführten Babys sind männlich, was seltsam ist, weil das weibliche Geschlecht von Natur aus widerstandsfähiger ist.«
Deswegen war er hier. Ich zog die Augenbrauen hoch, als er sich zu mir umdrehte und flüsterte: »Ich bin es nicht. Jemand verabreicht ihnen das Enzym, das die zerstörerische Wirkung der Rosewood-Gene hemmt. Sonst hätten sie niemals so lange überlebt. Und jetzt, da der- oder diejenige weiß, dass es klappt, kommt er oder sie zurück und stiehlt die behandelten Kinder.«
Mir wurde schlecht, als ich mit einer Mischung aus Schmerz und Schuldgefühlen ins Wohnzimmer sah. »MegPaG?«
Er schüttelte den Kopf. »Felix sagt Nein.«
Diese Information war im besten Falle fraglich, aber bis ich etwas anderes hörte, würde ich sie glauben. »Nun, wer weiß sonst noch, dass diese Babys Dämonenmagie entzünden können?«
Trent sah den Flur entlang, als wollte er von hier verschwinden. Er war müde, aber das bemerkte ich nur, weil er mir gegenüber offen war. »Jeder hätte es sich zusammenreimen können – jetzt, wo allgemein bekannt ist, was du bist.« Sein Blick landete wieder auf mir, mit hilflosem Bedauern darin. »Die einzige Überlebende des Rosewood-Syndroms ist zufällig ein Dämon? Vielleicht hatten wir sogar Glück, dass es überhaupt so lange gedauert hat. Aber dass ein Enzym die Kinder am Leben halten kann?« Er presste die Lippen aufeinander. »Das weiß nur eine Handvoll Personen, und die meisten davon arbeiten für mich.«
Schweigend zwang ich mich dazu, meine Arme entspannt hängen zu lassen. Die Seide meines Kleides raschelte.
»Das ist nicht gut«, sagte Trent so leise, dass ich ihn kaum verstand.
»Ehrlich?«
Zwischen uns breitete sich Schweigen aus, nicht gesellig, aber auch nicht unangenehm. Das Fernsehteam schien die Zelte abzubrechen, und die I. S.-Agenten wurden lauter. Es war ein letzter Versuch, noch einmal gefilmt zu werden, bevor die Kameras verschwanden. Ich schaute auf Trents nervös wippenden Fuß und zog die Augenbrauen hoch.
Trent zog eine Grimasse und hörte auf zu zappeln. »Du siehst gut aus heute Abend«, sagte er und überraschte mich damit. »Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich deine Haare lieber offen oder geflochten mag.«
Ich errötete und berührte den lockeren Zopf, zu dem Jenks’ Kinder meine Haare geflochten hatten. Er war noch feucht vom Nebel. »Danke.«
»Und, hattet du und Quen ein schönes Abendessen?«, fragte er und brachte mich damit noch mehr durcheinander. »Carew Tower, richtig?«
»Um genau zu sein war es nur ein Drink an der Bar, aber ja, es war der Carew Tower.« Verwirrt packte ich meine Tasche fester. »Wie hast du das erraten?«
Seine Fußspitze scharrte über den Boden, was mir verriet, dass er einerseits befriedigt, andererseits aber immer noch verärgert war. »Du riechst nach angeschlagenem Messing. Das bedeutete entweder Carew Tower oder die kleine Sandwich-Bar an der Vine. Die mit der alten Fußbank.«
Ich blinzelte. Wow. »Oh«, meinte ich, während ich darüber nachdachte, was ich sagen sollte. »Ja. Wir waren im Carew Tower.« Ich sah an meinem Kleid herunter, das so offensichtlich nicht zu einer Sandwich-Bar passte.
Trent stellte sich neben mich, so nahe, dass ich seinen Duft von zerdrücktem Gras unter seinem Aftershave riechen konnte. Zusammen beobachteten wir, wie die Reporterin ihr Interview mit der Krankenschwester beendete. Ihn so nahe neben mir zu fühlen, war fast schlimmer als sein vorwurfsvoller Blick. »Ihr habt über mich gesprochen.« Seine Stimme war ein wenig zu hoch, sein Blick starr ans andere Ende des Raums gerichtet. Saurer Wein und Zimt gesellten sich zu der Duftmischung, die von ihm ausging.
»Quen hat mich gebeten, für ihn einzuspringen, wenn eure Zeitpläne nicht zusammenpassen«, erklärte ich. »Er weiß, dass du die Planungsprobleme absichtlich einfädelst – hast du geglaubt, er würde nichts unternehmen?«
Nur sein Auge zuckte, aber das reichte mir, um ihn zu durchschauen. »Sei ein bisschen nachsichtiger mit ihm«, sagte ich. Er gab sein vorgespieltes Desinteresse auf, um mich böse anzustarren. »Quen hat deine Abschlussball-Verabredung überprüft und dich zum Amt gefahren, damit du deinen Führerschein abholen kannst. Er macht sich Sorgen um dich, okay?«
Trent runzelte die Stirn, offensichtlich nicht bereit, das zu glauben. Ich konnte fühlen, dass die Reporter uns beobachteten. Seine Augen huschten ebenfalls hinüber, und langsam öffneten sich seine Hände wieder. Er atmete tief durch und setzte ein falsches Lächeln auf, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwer ihm das abnahm. Er war drauf und dran, einfach abzuhauen. Ich packte seinen Ellbogen.
»Trent, ich habe abgelehnt«, sagte ich leise. Seine Augen schossen von meinen Fingern an seinem Arm nach oben, um meinen Blick einzufangen. »Ich habe ihm gesagt, dass du keinen Babysitter brauchst. Dass er dich unterschätzt und du fähig bist, auf dich selbst achtzugeben. Er bemüht sich, es zu akzeptieren. Aber es fällt ihm schwer, nachdem er ein Jahrzehnt lang auf dich aufgepasst hat. Du könntest vielleicht eine Weile etwas weniger aufsässig sein.«
Trents Wut löste sich in Luft auf. »Aufsässig?«, meinte er, dann traten wir beide einen Schritt beiseite, weil die Kerle mit den Staubsaugern vorbeiwollten. »Ist das deine Wortwahl oder seine?«
»Meine«, erklärte ich, erleichtert, dass ich nicht versucht hatte, ihn anzulügen. »Ich erkenne Aufsässigkeit, wenn ich sie sehe. Komm schon«, drängte ich und ließ ihn los. »Lass den armen Kerl sich doch langsam an deine Unabhängigkeit gewöhnen, statt ihn dazu zu zwingen. Irgendwie ist es doch auch cool, oder? Dass er dich so liebt?«
Wieder wirkte er überrascht und verlegen. »Danke«, erwiderte er. Seine Augen glitten über den Raum hinter mir, aber als sein Blick wieder auf mir landete, war sein Lächeln ehrlich. »So habe ich es noch nie gesehen.«
Mein Herz machte einen Sprung, als Trent den Kopf beugte, um sich reuig das Kinn zu reiben, und ein seltsames Gefühl breitete sich in meinem Bauch aus. Hinter mir beleuchteten die hellen Scheinwerfer des Fernsehteams die menschliche Tragödie fest wie die Sonne Afrikas, gaben sie in einer unangenehmen Wildheit preis, die daran erinnerte, wie einer Gazelle der Bauch aufgerissen wurde. Und trotzdem fiel es mir schwer, den Blick abzuwenden.
Ich holte Luft, um ihm zu sagen, dass er mich jederzeit anrufen konnte, wenn er Rückendeckung brauchte, aber im letzten Moment verließ mich der Mut. Stattdessen stellte ich mich nervös wieder neben ihn. Ein Gefühl der Distanz machte sich zwischen uns breit. »Du gehst.«
»Ähm, ja«, antwortete er offensichtlich überrascht. »Diese Reporterin beäugt mich, und ich will kein Interview geben.«
Ich nickte verständnisvoll. Sobald er verschwand, würde ich mich eilig auf der Suche nach Nina in die andere Richtung davonmachen. Vielleicht würden sie mich den Tatort sehen lassen, wenn Felix darum bat.
»Rachel«, sagte Trent plötzlich. Ich riss meinen Blick von dem leeren Flur zwischen Küche und Schlafzimmern los. »Sei vorsichtig. Es könnte MegPaG sein, selbst wenn Felix das Gegenteil behauptet.«
Wütend nickte ich. Wer auch immer das tat, wusste, dass ich ein schwieriges Ziel war, also entführten sie stattdessen Babys. Feiglinge.
Trent wollte gehen, aber ich streckte ihm die Hand entgegen. »Aber sei du auch vorsichtig. Wenn diejenigen, die diese Kinder entführen, von dem Enzym wissen, dann wissen sie auch, dass du der Einzige bist, der eine dauerhafte Heilung herbeiführen kann.« Könnte ich je für ihn arbeiten?, fragte ich mich, während er meine Hand musterte. Ich erinnerte mich daran, wie befriedigend es gewesen war, mit ihm die MegPaG-Sektion von Cincinnati zur Strecke zu brin