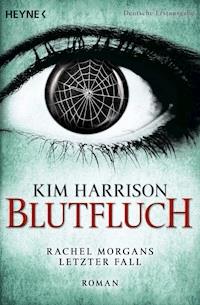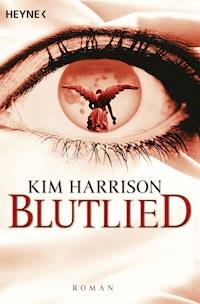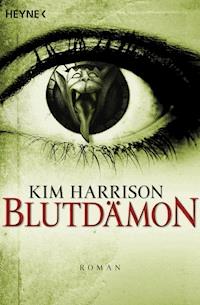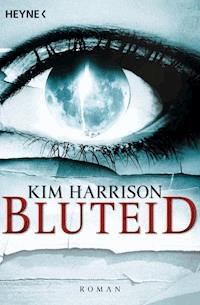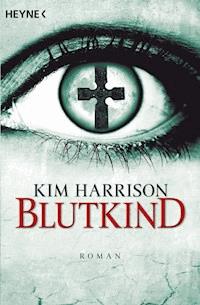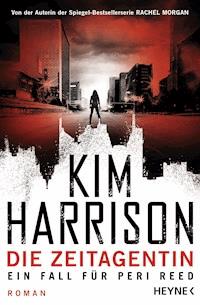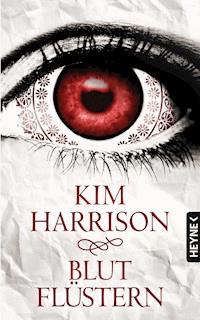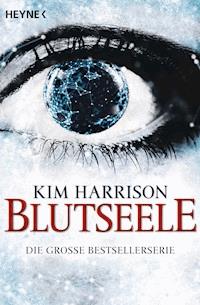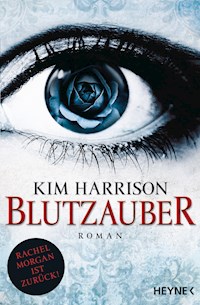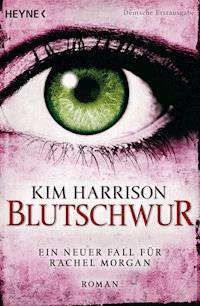9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rachel Morgan
- Sprache: Deutsch
Rachel Morgans zweiter Fall hat es in sich: Ein Serienkiller, der es besonders auf begabte Hexen abgesehen hat, treibt in Cincinnati sein Unwesen. Schnell hat Rachel einen Verdächtigen im Visier, doch der Schein trügt – hinter dem Serienkiller verbirgt sich eine Verschwörung, die weit in die Vergangenheit reicht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
HEYNE‹
Das Buch
Nach einer weltumspannenden Seuche hat sich das Leben auf der Erde grundlegend verändert. Die magischen Wesen sind aus dem Schatten getreten. Vampire, Kobolde und andere Untote machen die Straßen unsicher.
Die Kopfgeldjägerin Rachel Morgan hat ein Problem: Cincinnatis Inderlander-Bevölkerung wird durch einen grausamen Serienkiller dezimiert, der es auf begabte Hexen abgesehen hat. Auf Bitten der Behörden beginnt Rachel zu ermitteln und sie ist sich schnell sicher, die Identität des Mörders zu kennen: Zahlreiche Indizien weisen darauf hin, dass ihr gefährlichster Widersacher, der mysteriöse Trent Kalamack, in die Morde verwickelt ist. Doch dieser Fall ist nicht so eindeutig, wie es zunächst scheint. Und als es Rachel schließlich gelingt, Trents größtes Geheimnis zu entschlüsseln, gerät sie selbst in tödliche Gefahr …
DIE RACHEL-MORGAN-SERIE:
Bd. 1: Blutspur
Bd. 2: Blutspiel
Bd. 3: Blutjagd
Die Autorin
Kim Harrison, geboren im Mittleren Westen der USA, wurde schon des Öfteren als Hexe bezeichnet, ist aber – soweit sie sich erinnern kann – noch nie einem Vampir begegnet. Sie hegt eine Vorliebe für Friedhöfe, Midnight Jazz und schwarze Kleidung und ist bei Neumond nicht auffindbar.
Inhaltsverzeichnis
Für den Mann, der weiß, dass zuerst das Koffein kommt, dann die Schokolade und danach die Romantik – und wann es angebracht ist, die Reihenfolge zu ändern.
1
Ich zog den Leinengurt des Wasserkanisters höher auf die Schulter und streckte mich, damit ich die Wasserdüse in den Topf der Hängepflanze halten konnte. Die Wärme des hereinströmenden Sonnenlichts drang durch meinen blauen Arbeitsanzug. Hinter den schmalen Flachglasfenstern lag der Innenhof, umgeben von den VIP-Büros. Ich blinzelte in die Sonne, drückte den Sprühknopf, aber nur einige Tröpfchen quälten sich durch das Scheißding.
Das laute Klappern der Computertastaturen drang in meine Ohren, als ich zum nächsten Grünzeug ging. Aus dem Büro hinter der Rezeption waren Telefongespräche zu hören, begleitet von einem bauchigen Lachen, das an das Kläffen eines Hundes erinnerte. Tiermenschen! Je höher sie in der Rangordnung standen, desto menschlicher sahen sie aus, aber dieses Lachen verriet sie immer.
Ich blickte die Reihe der Hängepflanzen vor dem Fenster entlang. Hinter dem Empfang befand sich ein frei stehendes Aquarium. Jepp! Cremefarbene Flossen. Ein schwarzer Punkt auf der rechten Seite. Das musste er sein. Mr. Ray züchtete Koi, die er auf der jährlichen Fischausstellung in Cincinnati präsentierte. Der Gewinner des letzten Jahres wurde immer in seinem Vorzimmer ausgestellt, aber nun schwammen da zwei Fische, und das Maskottchen der Howlers war verschwunden. Mr. Ray war ein Anhänger der Dens, eines Rivalen des Inderlander Baseballteams. Zählte man eins und eins zusammen, ergab das einen gestohlenen Fisch.
»So, so«, meinte die freundliche Frau hinter dem Tresen, als sie aufstand, um einen Stapel Papier in den Drucker einzulegen. »Mark hat Urlaub? Er hat mir gar nichts davon gesagt.«
Ich nickte, sah die Sekretärin in ihrem beigen Geschäftsanzug aber nicht an, während ich mein Equipment einen Meter weiter zerrte. Mark machte nur einen Kurzurlaub. Er lag im Treppenhaus des Gebäudes, in dem er vorher gearbeitet hatte, durch einen temporären Schlafzauber außer Gefecht gesetzt. »Ja, Madam«, antwortete ich mit lauter Stimme und einem leichten Lispeln. »Er hat mir erklärt, welche Pflanzen bewässert werden müssen.« Bevor sie näher hinschauen konnte, drückte ich meine rot lackierten Fingernägel in die Handinnenflächen. Die passten wirklich nicht zum Erscheinungsbild einer Gärtnerin. Ich hätte vorher daran denken sollen. »Zuerst kommen die Pflanzen auf dieser Etage dran, und danach der Baumgarten auf dem Dach.«
Die Frau lächelte und entblößte dabei ihre leicht überlangen Zähne. Sie war ein Werwolf und stand anscheinend weit oben in der Hackordnung des Büros. Mr. Ray würde wohl auch keinen dahergelaufenen Straßenköter einstellen, wenn er sich so ein schnuckeliges Ding leisten konnte. Ihr leichter Moschusgeruch war gar nicht mal unangenehm.
»Hat Mark Ihnen von dem Arbeitsaufzug auf der Rückseite des Gebäudes erzählt?«, fragte sie hilfsbereit. »Das ist viel bequemer, als diese Karre die Treppen hinaufzuschleppen.«
»Nein, Madam.« Ich zog die hässliche Kappe mit dem Gärtnerlogo tiefer ins Gesicht. »Ich glaube, er will mir das Leben richtig schwer machen, damit ich nicht versuche, ihm ins Gehege zu kommen.« Mit steigender Pulsfrequenz schob ich Marks Arbeitswagen weiter die Pflanzenreihe entlang. Auf ihm befanden sich Gartenscheren, Düngestäbchen und das Bewässerungsequipment. Natürlich kannte ich den Aufzug, ebenso wie die Lage der sechs Notausgänge, der Feuermelder und das Donut-Depot.
»Männer«, seufzte sie, rollte mit den Augen, und setzte sich wieder vor den Bildschirm. »Haben die denn immer noch nicht kapiert, dass wir die Welt regieren könnten, wenn wir es nur wollten?«
Ich nickte zustimmend und bespritzte die nächste Pflanze mit ein wenig Wasser. Irgendwie regierten wir doch sowieso schon die Welt. Über dem Geräusch des Druckers und des entfernten Bürogeschnatters erklang ein durchdringendes Summen. Es war Jenks, mein Partner, und er hatte offensichtlich eine ziemlich miese Laune, als er aus dem Büro des Chefs geflogen kam. Seine libellenähnlichen Flügel waren rot vor Wut, und das Licht der Sonne erleuchtete den von ihnen herabfallenden Pixiestaub. »Ich bin mit den Pflanzen da fertig«, moserte er lauthals und landete auf dem Rand des Hängetopfes vor mir. Die Hände in die Hüften gestemmt, sah er in dem blauen Overall aus wie ein erwachsener Peter Pan, der es bis zum Müllmann gebracht hatte. Seine Frau hatte ihm sogar eine passende Mütze genäht. »Die brauchen nur Wasser. Kann ich dir hier irgendwie helfen oder kann ich zurück in den Truck und schlafen?« Er klang ätzend und genervt.
Ich nahm den Wasserkanister vom Wagen und stellte ihn auf den Boden, um den Deckel abzuschrauben. »Ich bräuchte ein Düngestäbchen.« Was hatte der denn für ein Problem?
Grummelnd flog Jenks zum Wagen und begann darin herumzuwühlen. Grüne Verschlussstreifen, Rankhölzer und gebrauchte ph-Teststreifen flogen durch die Gegend. »Hab eins«, meinte er und zog ein weißes Stäbchen hervor, das so groß war wie sein Kopf. Er warf es in den Kanister, wo es sich mit einem Zischen auflöste. Es war allerdings kein Düngestäbchen, sondern ein Sauerstoffpellet, das auch gegen Algen wirkte. Wozu einen Fisch stehlen, wenn er beim Transport krepiert?
»Oh mein Gott, Rachel«, flüsterte Jenks, als er auf meiner Schulter landete. »Das ist Polyester. Ich trage Polyester!«
Ich entspannte mich. Daher kam also die schlechte Laune. »Alles wird wieder gut.«
»Ich hab Ausschlag!«, rief er und kratzte sich wie ein Besessener unter seinem Kragen. »Ich kann keinen Polyester tragen! Pixies reagieren allergisch auf Polyester. Schau mal, siehst du das?« Jenks neigte den Kopf nach vorne, sodass die blonden Haare seinen Nacken freigaben, aber er war viel zu nahe vor meinen Augen, als dass ich ihn klar hätte erkennen können. »Überall Striemen. Und es stinkt. Ich kann das Öl riechen. Ich trage tote Dinosaurier. Ich kann doch kein totes Tier tragen! Das ist barbarisch, Rachel«, flehte er.
»Jenks?« Ich schraubte den Verschluss provisorisch auf den Kanister und warf ihn mir über die Schulter, während ich Jenks wegschob. »Ich trage die gleichen Klamotten. Das musst du abkönnen.«
»Aber es stinkt!«
Ich verdrehte genervt die Augen und stieß zwischen zusammengebissenen Zähnen ein »Mach mal halblang« hervor.
Während er rückwärts abschwirrte, zeigte der Kerl mir doch glatt beide Mittelfinger! Ich klopfte die Gesäßtasche meines schäbigen Overalls ab und fand die Gartenschere. Miss »Büroprofi« tippte gerade einen Brief, und so stellte ich die kleine Stehleiter auf, kletterte hinauf und begann die Hängepflanzen hinter ihrem Schreibtisch zu beschneiden. Jenks hatte sich wieder eingekriegt und half mir dabei. Nach wenigen Momenten fragte ich ihn flüsternd: »Hast du alles vorbereitet?«
Die Augen auf die offene Tür von Mr. Rays Büro gerichtet, nickte er. »Wenn er das nächste Mal die Mails checkt, wird das ganze Internetsicherheitssystem verrückt spielen. Seine Sekretärin wird fünf Minuten brauchen, um es zu reparieren, wenn sie sich auskennt, vier Stunden, wenn sie keinen blassen Schimmer davon hat.«
»Ich brauche nur fünf Minuten.« Durch die hereinströmende Sonne begann ich zu schwitzen. Hier drin roch es wie in einem Garten – einem Garten, in dem ein nasser Hund auf den kühlen Fliesen liegt.
Mein Herz schlug schneller, und ich schob die kleine Leiter eine Pflanze weiter. Ich stand nun hinter dem Schreibtisch und konnte die Anspannung der Frau spüren. Sie musste wohl oder übel damit klarkommen, dass ich in ihr Revier eingedrungen war. Immerhin war ich die Wassertussi. Ich arbeitete weiter und hoffte, dass sie meine Nervosität auf die Nähe zu ihr zurückführen würde. Meine Hand lag auf der Verschlusskappe des Kanisters. Nur eine Drehung, und sie wäre ab.
»Vanessa!« Aus dem Büro schallte eine wütende Stimme.
»Los jetzt«, drängte Jenks und flog hoch an die Decke zu den Überwachungskameras.
Ich drehte mich um und sah den verärgerten Mann, offensichtlich ein Werwolf, erkennbar an der schmalen Figur und der Körpergröße. Er stand in der Tür zu seinem Büro. »Es ist schon wieder passiert.« Mit gerötetem Kopf krallte er sich an der Türzarge fest. »Ich hasse diese Technik. Was ist so schlecht an gutem, altem Papier. Ich mag es.«
Auf dem Gesicht der Sekretärin erschien ein professionelles Lächeln. »Mr. Ray, Sie haben ihn schon wieder angeschrien, nicht wahr? Ich habe Ihnen doch erklärt, dass Computer wie Frauen sind. Wenn Sie sie anschreien oder zu viel auf einmal verlangen, machen sie dicht und tun gar nichts mehr.«
Er knurrte irgendeine Antwort und verschwand in seinem Büro. Entweder ignorierte er die indirekte Warnung seiner Sekretärin, oder er hatte sie überhaupt nicht bemerkt. Mein Herz schlug bis zum Hals, als ich das kleine Treppchen direkt hinter das Aquarium stellte.
Vanessa seufzte. »Gott steh ihm bei«, murmelte sie beim Aufstehen. »Wenn er weiter solche Sprüche bringt, wird ihm irgendwann mal jemand gehörig die Eier zerquetschen.« Sie warf mir einen aufgebrachten Blick zu und verschwand dann mit klappernden Absätzen in dem Büro. »Rühren Sie bloß nichts an«, rief sie. »Ich komme ja schon.«
Ich holte tief Luft. »Kameras?«
Jenks schnellte von der Decke herab. »Zehnminutenschleife. Leg los.«
Er flog zur Haupttür, setzte sich auf die obere Türleiste und beobachtete kopfüber den gesamten Eingangsbereich. Seine Flügel bewegten sich so schnell, dass sie vor meinen Augen verschwammen, als er mir das Okayzeichen gab.
Mein ganzer Körper war angespannt wie ein Stahlseil. Ich öffnete den Deckel des Aquariums und zog das grüne Fischnetz aus der Innentasche meines Overalls. Auf der obersten Stufe der Leiter balancierend, krempelte ich die Ärmel bis zum Ellbogen hoch und tauchte den Käscher ins Wasser. Beide Fische flitzen sofort in den hinteren Teil des Beckens.
»Rachel, die hat was drauf. Sie ist schon halb durch.«
»Pass einfach nur auf die Tür auf«, zischte ich. Wie lange kann es schon dauern, einen Fisch zu fangen? Ich drückte einen Stein nach vorne, um das dahinter versteckte Tier zu fangen. Beide Fische schossen zur Vorderseite des Aquariums.
Plötzlich klingelte mit einem weichen Summen das Telefon. »Jenks, gehst du mal ran?« Behutsam trieb ich beide Fische mit dem Käscher in eine Ecke. »So, jetzt hab ich dich …«
Jenks sauste von der Tür zum Telefon und landete mit den Füßen auf dem blinkenden Annahmeknopf. »Mr. Rays Büro, bitte warten Sie einen Augenblick«, fiepte er in einem hohen Falsett.
»Du hinterhältiges Schuppenvieh«, fluchte ich, als sich der zappelnde Fisch aus dem Netz befreite. »Na, komm schon. Ich versuche doch nur, dich nach Hause zu bringen, du schleimiges, schuppiges Ding«, säuselte ich mit zusammengebissenen Zähnen. »Ja … fast … komm schon.« Er steckte jetzt zwischen dem Netz und dem Glas. Wenn er doch nur stillhalten würde …
»Hey!«
Das Adrenalin schoss mir in den Kopf. Im Durchgang zu den vorderen Büros stand ein kleiner Mann mit gepflegtem Bart, der einige Akten unter dem Arm trug. »Was machen Sie denn da?«, fragte er streitlustig.
Ich blickte auf meinen Arm im Aquarium. Der Käscher war leer. Der Fisch hatte sich befreit. »Ähh, mir ist die Schere da reingefallen?« Es klang nicht sonderlich überzeugend.
Aus Mr. Rays Büro kam ein Aufstampfen, dann ein Stoßseufzer von Vanessa. »Mr. Ray!«
Verflucht. Das klappte wohl doch nicht auf die leichte Tour. »Plan B, Jenks.« Ächzend schnappte ich mir die Abdeckung des Aquariums und zog daran.
Als das Becken kippte und sich über hundert Liter ekliges Fischwasser über ihren Schreibtisch ergossen, hörte ich Vanessa schreien.
Plötzlich stand sie mit Mr. Ray in der Tür. Von der Taille bis zu den Füßen durchnässt torkelte ich von der Leiter. Geschockt standen sie alle wie angegossen da. Ich suchte den Boden nach den Fischen ab. »Da seid ihr ja.« Mit einem Aufschrei versuchte ich mir den richtigen der beiden zu greifen.
»Sie will den Koi«, schrie der kleine Mann, während noch mehr Leute aus dem Flur hereinkamen. »Schnappt sie euch!«
»Lauf!«, kreischte Jenks. »Ich halte sie dir vom Leib.«
Triefend watschelte ich hinter dem Fisch her und versuchte ihn zu fassen, ohne ihn zu verletzen. Der Koi rutschte zuckend über den Boden. Endlich bekam ich ihn zwischen die Finger, ließ ihn in den Kanister fallen und drehte den Verschluss fest zu.
Jenks flitzte währenddessen wie ein Leuchtkäfer aus der Hölle zwischen den Tiermenschen hin und her, fuchtelte dabei mit Bleistiften herum und donnerte sie ihnen wie ein Speerwerfer in die empfindlichsten Körperpartien. Ein gerade mal zehn Zentimeter großer Pixie hielt drei Tiermenschen in Schach. Nicht, dass mich das überrascht hätte. Mr. Ray stand nur fassungslos da, bis er bemerkte, dass ich einen seiner Fische hatte. »Was, zum Teufel, machen Sie mit meinem Koi?« Sein Gesicht lief vor Wut knallrot an.
»Ich gehe mal mit ihm spazieren.«
Er kam auf mich zu und versuchte, mich mit seinen klobigen Händen festzuhalten. Höflich streckte ich ihm meine Hand entgegen und riss ihn vorwärts, direkt in mein Knie. Er stolperte zurück und drückte sich beide Hände in die Magengrube.
»Hör auf, mit den Hunden zu spielen!«, schrie ich in Jenks’ Richtung und suchte verzweifelt nach einem Fluchtweg. »Wir müssen verschwinden.«
Ich hob Vanessas Monitor hoch und warf ihn in das Flachglasfenster. Das wollte ich schon lange mal machen, allerdings mit Ivys Bildschirm! Er krachte mit einem wohltuenden Geräusch durch das Glas und schlug auf dem Rasen auf, ein merkwürdiger Anblick. Wütende Tiermenschen strömten in den Raum und sonderten ihren starken Moschusgeruch ab. Ich schnappte mir den Kanister und hechtete durch das Fenster.
»Los, hinterher«, schrie jemand.
Meine Schulter knallte auf den gepflegten Rasen, und ich rollte mich ab. »Komm hoch«, hörte ich Jenks direkt an meinem Ohr. »Da entlang.«
Er flitzte durch den kleinen Innenhof. Ich folgte ihm, wobei ich mir den schweren Kanister auf den Rücken schnallte, um beide Hände frei zu haben. Dann zog ich mich an dem Rosengitter an der Mauer hoch, ohne auf die Dornen zu achten, die meine Haut durchdrangen.
Keuchend kam ich oben an. Das Rascheln der Zweige verriet mir, dass sie mir auf den Fersen waren. Ich zog mich über die Brüstung des mit Teer und Kieselsteinen bedeckten Flachdachs und sprintete los. Hier oben wehte ein heißer Wind, und ich warf einen kurzen Blick auf die Skyline von Cincinnati.
»Spring«, brüllte Jenks, als ich am Rand angekommen war.
Ich vertraute ihm und sprang mit wirbelnden Armen und Beinen von der Dachkante.
Adrenalin schoss durch meinen Körper, und ich hielt die Luft an. Es war ein Parkplatz. Er hatte mich vom Dach auf einen Parkplatz springen lassen!
»Ich hab keine Flügel, du Idiot.«Zähneknirschend zog ich die Knie an. Als ich am Boden aufschlug, kam der Schmerz wie eine Explosion. Ich fiel nach vorne und riss mir die Handinnenflächen auf. Der Schultergurt riss, und der Kanister schlug klappernd auf den Asphalt. Ich rollte zur Seite, um den Sturz abzufangen.
Der metallene Kanister rollte in die entgegengesetzte Richtung. Noch immer keuchend vor Schmerz stolperte ich hinterher. Beinahe hätte ich ihn erwischt, doch dann rollte er unter einen Wagen. Mit einem Fluch legte ich mich flach auf den Bauch und versuchte das Ding mit einem Arm zu erreichen.
»Da ist sie!«
Ich hörte ein Pling von dem Auto über mir, dann noch eins. Im Asphalt klaffte plötzlich ein Loch, und ich konnte den stechenden Schmerz von Splittern in meinem Arm spüren. Schossen die etwa auf mich?
Mit einem Stöhnen schlängelte ich mich unter dem Auto hervor und zog den Kanister hinter mir her. Den Fisch wie einen Schutzschild vor die Brust gedrückt, ging ich langsam rückwärts. »Hey«, rief ich und zog mir eine Strähne aus dem Gesicht. »Was zur Hölle macht ihr da? Es ist nur ein Fisch! Er gehört euch doch nicht einmal!«
Das Tiermenschentrio glotzte vom Dach herab. Einer von ihnen legte seine Waffe auf mich an.
Blitzschnell drehte ich mich um und rannte los. Und das alles für fünfhundert Dollar? Für fünftausend vielleicht! Ich lief hinter Jenks her und schwor mir, mich das nächste Mal über die Einzelheiten zu informieren, bevor ich das Standardhonorar veranschlagte.
»Hier lang«, brüllte Jenks. Teile des Asphalts platzten ab und trafen mich, begleitet vom Echo der Schüsse. Der Platz war nicht abgesperrt, und so rannte ich mit vor Adrenalin zitternden Muskeln über die Straße, um mich möglichst unauffällig in den Strom der Fußgänger einzureihen. Mit klopfendem Herzen hielt ich kurz an und entdeckte ihre Silhouetten, die sich vor dem weiten Himmel abzeichneten. Sie waren nicht gesprungen. Sie mussten sich auch nicht beeilen, denn am Gitter klebte noch überall mein Blut. Trotzdem glaubte ich nicht, dass sie mich verfolgen würden. Der Fisch gehörte nicht ihnen, sondern den Howlers. Das Baseballteam würde mich bezahlen, und damit hätte ich das Geld für die Miete.
Ich versuchte meine Atmung zu verlangsamen und mich der Geschwindigkeit der Fußgänger anzupassen. Die Sonne brannte vom Himmel, und ich schwitzte in dem verdammten Polyestersack. Wahrscheinlich hielt mir Jenks den Rücken frei, also bog ich in eine Gasse ein, um mich umzuziehen. Ich stellte den Kanister ab, ließ den Kopf nach hinten fallen und lehnte mich an die kühlende Wand des Gebäudes. Ich hatte es geschafft. Die Miete war wieder für einen Monat gesichert.
Mit einer Hand riss ich mir den Tarnzauber vom Hals und fühlte mich augenblicklich besser. Das Trugbild einer dunkelhäutigen Frau mit dicker Nase und braunen Haaren verschwand und enthüllte mein krauses, schulterlanges rotes Haar und meinen blassen Teint. Ich begutachtete meine zerschundenen Hände und rieb sie behutsam aneinander. Vielleicht hätte ich einen Schmerzzauber einpacken sollen. Nein, es war besser, so wenige Zauber wie möglich mit mir rumzutragen. Hätten sie mich gefangen, wäre ich nur wegen »versuchten Diebstahls« dran gewesen, und nicht wegen »versuchten Diebstahls und des Vorsatzes der Körperverletzung«. Vor einer Anschuldigung hätte ich mich drücken können, aber zwei wären zu viel gewesen. Ich war ein Runner – ich kannte das Gesetz.
Während die Leute am Eingang der Gasse vorbeigingen, zog ich den feuchten Overall aus und stopfte ihn in einen Müllcontainer. Erleichtert bückte ich mich, um den Saum meiner Lederhose über meine schwarzen Stiefeletten zu rollen. Wieder in der Vertikalen, betrachtete ich die neuen Kratzspuren an meiner Hose und drehte mich dabei, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten. Ivys Lederpolitur würde die feinen Risse ein wenig ausbessern, aber eins war klar – Leder und Asphalt harmonierten nicht miteinander. Aber besser Kratzer an der Hose als Kratzer an mir. Darum trug ich sie ja schließlich.
Selbst hier im Schatten strich die Septemberluft wohltuend über meine Haut, während ich mein schwarzes Top in die Hose steckte und dann nach dem Kanister griff. Wieder ganz ich selbst, trat ich in die Sonne hinaus und setzte einem vorbeigehenden Jungen meine Kappe auf. Er sah sie sich an, lächelte, und winkte mir schüchtern zu, als seine Mutter sich runterbeugte und fragte, wo er das herhatte. Zufrieden mit der Welt und mir spazierte ich mit klappernden Absätzen den Fußgängerweg entlang und schüttelte meine Haare aus. Schließlich schlug ich die Richtung zum Fountain Square ein, wo meine Mitfahrgelegenheit auf mich warten sollte. Heute Morgen hatte ich dort meine Sonnenbrille versteckt und mit etwas Glück war sie noch da. Bei Gott, ich liebte meine Unabhängigkeit.
Es war jetzt fast drei Monate her, dass ich wegen der Scheißaufträge meines alten Bosses bei der Inderland Security ausgerastet war. Ich hatte mich benutzt gefühlt, meine Arbeit war nicht gewürdigt worden. Also hatte ich das ungeschriebene Gesetz gebrochen, den Dienst bei der I. S. quittiert und meine eigene Agentur gegründet. Damals schien das eine gute Idee zu sein. Da ich nicht in der Lage gewesen war, mich aus meinem Vertrag freizukaufen, hatten sie mich auf die Abschussliste gesetzt. Die folgenden Attentate hatten mir endgültig die Augen geöffnet. Ohne Jenks und Ivy hätte ich das nie geschafft.
Inzwischen machte ich mir langsam aber sicher einen Namen, aber merkwürdigerweise wurde meine Finanzlage nicht besser, sondern schlechter. Na klar, ich konnte aus meinem Uniabschluss einigen Nutzen ziehen und Zauber brauen, die ich früher hatte kaufen müssen und sogar einige zubereiten, die mein Budget überschritten hätten. Aber die Finanzen waren ein ständiges Problem. Es war nicht so, dass ich keine Jobs an Land ziehen konnte, es war eher so, dass die Kohle irgendwie nie lange in der Keksdose auf dem Kühlschrank blieb.
Ich hatte nachgewiesen, dass ein Fuchsmensch von einem rivalisierenden Clan mit einem Fluch belegt worden war. Mit dem Lohn musste meine Hexenlizenz erneuert werden, etwas, das früher immer die I. S. bezahlt hatte. Dann war da noch der Job für den Hexer. Ihm war sein Schutzgeist abhanden gekommen, und ich musste ihn ausfindig machen. Das Geld ging für den monatlichen Beitrag meiner Krankenversicherung drauf. Ich hatte nie gewusst, dass es so teuer war, einen Runner zu versichern. Die I.S. hatte mir damals die Karte gegeben, und ich hatte sie ganz selbstverständlich benutzt. Dann musste ich noch einen Typen bezahlen, der die tödlichen Sprüche bannte, die immer noch an meinen eingelagerten Sachen hafteten, Ivy einen seidenen Morgenmantel kaufen, da ich ihren ruiniert hatte, und mir selbst einige nette Outfits zulegen. Ich hatte ja jetzt einen Ruf zu verlieren.
Aber wahrscheinlich waren die ständigen Taxifahrten für das dauerhafte Finanzloch verantwortlich. Die meisten Busfahrer Cincinnatis kannten mich vom Sehen und nahmen mich nicht mit, darum musste Ivy mich immer abholen. Verdammt unfair. Es war jetzt schon fast ein Jahr her, dass ich bei dem Versuch einen Werwolf festzunageln die Passagiere eines voll besetzten Busses enthaart hatte.
Ich hatte es satt, ständig pleite zu sein, aber mit dem Geld für die Beschaffung des Howlers-Maskottchens würde ich einen weiteren Monat überstehen. Vor den Tiermenschen war ich sicher. Der Fisch gehörte ihnen nicht, und wenn sie bei der I. S. eine Beschwerde einreichen wollten, müssten sie ja erst mal erklären, woher sie ihn hatten.
»Hey, Rachel«, meinte Jenks, als er von irgendwo und nirgendwo hergeflogen kam. »Keine Verfolger. Und wie lautet nun Plan B?«
Ich zog meine Augenbrauen hoch und sah ihn missbilligend an. Er flog in Schrittgeschwindigkeit genau neben mir her. »Pack dir den Fisch und renn, als ob der Teufel hinter dir her wäre.«
Jenks prustete los und landete auf meiner Schulter. Er hatte die Uniform entsorgt und sah in dem langärmeligen, jägergrünen Seidenhemd und den dazu passenden Hosen wieder ganz normal aus. Um seine Stirn hatte er ein rotes Tuch gebunden. Damit signalisierte er allen Pixies und Fairys, deren Territorium wir kreuzten, dass er in friedlicher Absicht kam. Das Licht blitzte von den Stellen seiner Flügel, wo noch Reste des durch die Aufregung entstandenen Pixiestaubs klebten.
Ich verlangsamte meinen Schritt, als wir den Fountain Square erreichten. Unbesorgt setzte ich mich auf die trockene Seite des Springbrunnens und suchte mit meinen Fingern unter der Mauer nach der Sonnenbrille. Sie würde bald kommen. Die Frau war süchtig nach geordneten Tagesplänen.
Während sich Jenks im wässrigen Nebel des Brunnens duschte, um den »Dinosauriergestank« loszuwerden, klappte ich die Bügel der Brille auseinander und schob sie mir auf die Nase. Es war eine Erleichterung für die Augen, als dadurch das grelle Licht des Septembernachmittags gemildert wurde. Meine langen Beine ausstreckend, nahm ich beiläufig das Geruchsamulett ab und warf es in den Brunnen. Tiermenschen folgten Geruchsspuren. Sollten sie hinter mir her sein, würde die Fährte hier enden, sobald ich in Ivys Auto eingestiegen und weggefahren war.
In der Hoffnung, dass niemand mich bemerkt hatte, ließ ich meinen Blick über die Leute schweifen. Da stand ein nervöser, anämisch wirkender Vampirlakai, der wohl Tagesjobs für seinen Liebhaber erledigte, zwei flüsternde Menschen, die kicherten, als sie seinen mit Narben übersäten Hals sahen, ein müder Hexenmeister – nein, eher ein Hexer, wie mir der nur schwache Rotholzgeruch verriet –, der auf einer nahen Bank saß und einen Muffin aß, und meine Wenigkeit. Ich holte langsam Luft und machte es mir bequem. Nach diesem ganzen Stress auf einen Fahrer zu warten war irgendwie enttäuschend.
»Hätte ich bloß ein Auto«, sagte ich zu Jenks und zog den Fischkanister zwischen meine Füße. Nur wenige Meter entfernt floss der Verkehr zäh dahin. Die Straßen füllten sich und ich schätzte, dass es inzwischen nach zwei Uhr mittags sein musste. Um diese Zeit drängten sich sowohl Inderlander als auch Menschen auf den engen Verkehrswegen. Es stellte einen täglichen, nervenaufreibenden Kampf dar. Wenn dann die Sonne unterging und sich die Menschen in ihre Häuser zurückzogen, wurde alles wesentlich einfacher.
»Was willst du denn mit einem Auto?«, fragte Jenks, als er sich auf mein Knie setzte und damit begann, seine libellenähnlichen Flügel sorgfältig abzutrocknen. »Ich habe auch kein Auto. Hab niemals eins gehabt. Ich komme auch so überall hin. Autos machen nur Ärger.« Ich hörte ihm schon gar nicht mehr zu. »Du musst sie andauernd betanken und reparieren. Dann musst du sie putzen und brauchst immer einen Parkplatz. Und denk nur an das Geld, dass man da reinsteckt. Dagegen ist eine Freundin ja richtig billig.«
»Aber trotzdem«, antwortete ich und wackelte mit dem Bein, um ihn zu irritieren. »Ich will trotzdem ein Auto.« Ich betrachtete die Leute um mich herum. »James Bond musste nie auf den Bus warten. Ich habe alle seine Filme gesehen, und er hat nie auf einen Bus gewartet.« Ich warf Jenks einen kurzen Blick zu.
»Das hat einfach keinen Stil.«
»Hmm, ja«, antwortete er, wobei seine Augen einen Punkt hinter meinem Rücken fixierten. »Jetzt fällt mir auch ein Argument für ein Auto ein … die Sicherheit, Tiermenschen auf elf Uhr.«
Ich drehte mich um, und meine Entspannung war wie weggeblasen. »Scheiße«, flüsterte ich und schnappte mir den Kanister. Es waren drei. Man konnte sie an ihrer gebückten Statur, der schweren Atmung und dem schleppenden Gang erkennen. Völlig verkrampft stand ich auf und brachte den Springbrunnen zwischen uns. Wo, zur Hölle, blieb Ivy?
»Rachel, warum sind die dir immer noch auf der Spur?«
»Keine Ahnung.« Ich musste an das Blut auf den Rosen denken. Wenn es mir nicht gelang, die Fährte zu unterbrechen, würden sie mich bis nach Hause verfolgen. Aber warum? Ich setzte mich so hin, dass ich ihnen den Rücken zukehrte, wohlwissend, dass Jenks sie beobachtete. Mein Mund war plötzlich vollkommen ausgetrocknet. »Haben sie mich gewittert?«
Jenks hob mit surrenden Flügeln ab. »Nein«, lautete die Antwort, als er kaum eine Sekunde später zurückkam. »Sie sind noch einen halben Block entfernt, aber du solltest dich langsam mal in Bewegung setzen.«
Jetzt war ich wirklich nervös. Ich wog das Risiko ab. Sollte ich hier ruhig sitzen bleiben und auf Ivy warten, oder abhauen und riskieren erkannt zu werden? »Verdammt, hätte ich bloß ein Auto«, murmelte ich und lehnte mich ein wenig nach vorne, um die Straße nach einem Bus, einem Taxi oder einem anderen fahrbaren Untersatz abzusuchen. Wo, zum Teufel, war Ivy?
Mit klopfendem Herzen stand ich auf, schnappte mir den Fisch und ging in Richtung Fahrbahn. Wenn ich das angrenzende Bürogebäude erreichte, konnte ich mich im Labyrinth der Korridore verstecken und auf Ivy warten. Aber da verlangsamte ein großer, schwarzer Crown Victoria seine Fahrt, stoppte und blockierte meinen Weg. Ich starrte den Fahrer an. Als er sich über den Beifahrersitz lehnte und das Fenster runterkurbelte, konnte ich ihn nur entgeistert angaffen. »Ms. Morgan?«, fragte der dunkelhäutige Mann angriffslustig.
Ich spähte zu den Tiermenschen hinter mir, dann zum Wagen und sah dann wieder ihn an. Ein schwarzer Crown Victoria, gefahren von einem Mann in einem schwarzen Anzug konnte nur eins bedeuten – er kam vom Federal Inderland Bureau, dem von Menschen geführten Äquivalent der I. S. Was wollte das FIB? »Ja, und wer sind Sie?«
Für einen Moment wirkte er besorgt. »Ich habe vorhin mit Ms. Tamwood gesprochen. Sie sagte, ich könnte Sie hier finden.«
Ivy? Ich legte meine Hand auf das geöffnete Fenster. »Geht es ihr gut?«
Er presste die Lippen aufeinander. Hinter seinem Wagen bildete sich schon ein Stau. »Als ich mit ihr telefoniert habe, ging es ihr noch gut.«
Jenks schwebte über mir, das kleine Gesicht verängstigt. »Sie haben deine Witterung aufgenommen, Rachel.«
Ich holte zischend Luft und drehte mich hastig um. Mein Blick fiel auf einen der Tiermenschen. Er sah, dass ich ihn beobachtete und bellte ein lautes Kommando. Die beiden anderen setzten sich in Bewegung und näherten sich gemächlich. Ich schluckte schwer. Jetzt war ich Hundefutter. Alles gelaufen. Hundefutter. Game over, bitte drücken Sie Reset.
Mit einer schnellen Drehung angelte ich nach dem Türgriff, riss ihn hoch, sprang in den Wagen und knallte die Tür zu. »Fahren Sie!«, schrie ich, drehte mich um und starrte aus dem Fenster.
Auf dem Gesicht des Mannes machte sich ein Anflug von Ekel breit, als er in den Rückspiegel schaute. »Gehören die zu Ihnen?«
»Nein! Fährt dieses verdammte Ding auch, oder sitzen Sie hier einfach nur rum und spielen mit sich selbst?«
Er gab ein kaum hörbares Schnaufen von sich und beschleunigte langsam. Hastig drehte ich mich um und sah die Tiermenschen, die in der Mitte der Straße stehen geblieben waren. Die wartenden Autos begannen ein Hupkonzert. Erleichtert ließ ich mich in den Sitz fallen, packte den Fischkanister und schloss die Augen. Diese Nummer würde ich Ivy heimzahlen, soviel war sicher. Vielleicht würde ich ihre kostbaren Landkarten als Unkrautbarriere im Garten aufstellen. Sie sollte mich abholen und nicht irgendeinen FIB-Fuzzi schicken.
Als sich mein Puls wieder beruhigt hatte, sah ich ihn mir genauer an. Er war einen guten Kopf größer als ich, was schon einiges hieß, hatte wohlgeformte Schultern, schwarzes, sehr kurz geschnittenes, lockiges Haar und einen kantigen Kiefer. Seine steife Haltung bettelte förmlich darum, dass ich ihm eine reinhaute. Allerdings war er ziemlich muskulös – gerade richtig, nicht zu breit, und keine Spur von einem Bauch. In seinem perfekt geschnittenen schwarzen Anzug, dem weißen Hemd und der schwarzen Krawatte war er das perfekte FIB-Pin-Up. Sein Bart war modern getrimmt – so kurz, dass man kaum mehr etwas sah – aber beim Aftershave hätte er zurückhaltender sein sollen. Ich betrachtete die Handschellen an seinem Gürtel und wünschte mir meine zurück. Sie waren I.S.-Eigentum gewesen, und ich vermisste sie sehr.
Jenks machte es sich auf seinem Lieblingsplatz auf dem Rückspiegel bequem, wo der Wind nicht an seinen Flügeln zerren konnte. Der steife Typ neben mir betrachtete ihn mit ausgiebiger Neugier, die mir verriet, dass er bisher wohl kaum etwas mit Pixies zu tun gehabt hatte. Was für ein Glückspilz!
Aus dem Funkgerät kam eine Meldung über einen Ladendieb im Einkaufszentrum. Mit einem schnellen Griff stellte er es aus. »Danke fürs Mitnehmen. Ivy hat Sie also geschickt?«
Er riss seinen Blick von Jenks los. »Nein. Sie meinte nur, dass Sie hier wären. Captain Edden will mit Ihnen reden. Es hat etwas mit dem Abgeordneten Trent Kalamack zu tun«, erklärte er emotionslos.
»Kalamack!« Sofort verfluchte ich mich, dass ich überhaupt etwas gesagt hatte. Dieser stinkreiche Bastard wollte entweder, dass ich für ihn arbeitete oder tot in einem Rinnstein endete. Das hing ganz von seiner Laune und den Börsenkursen ab. »Kalamack also?«, wiederholte ich und rutschte unbehaglich auf dem Ledersitz herum. »Warum schickt Edden Sie, um mich abzuholen? Sind Sie diese Woche auf seiner schwarzen Liste?« Das kam wohl nicht so gut an, denn er erwiderte nichts, krallte aber seine kräftigen Hände so fest um das Lenkrad, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Unangenehmes Schweigen breitete sich aus. Wir fuhren über eine Ampel, die gerade von Gelb auf Rot umsprang. »Äh, wie heißen Sie überhaupt?«, fragte ich schließlich. Ich hörte ein unterdrücktes Lachen. Normalerweise begegneten mir die Menschen mit Misstrauen, aber dieser Typ zeigte keine Angst, und das nervte mich gewaltig. »Detective Glenn, Madam.«
»Madam«, lachte Jenks lauthals, »er hat dich Madam genannt.«
Ich warf dem Pixie einen giftigen Blick zu. Für einen Detective sah er reichlich jung aus. Das FIB hatte wohl Personalprobleme. »Tja, vielen Dank, Detective Glade«, säuselte ich und verhunzte dabei absichtlich seinen Namen. »Sie können mich einfach irgendwo rauslassen, ich nehme dann den Bus. Captain Edden werde ich dann morgen aufsuchen, im Moment arbeite ich an einem wichtigen Fall.« Jenks kicherte, und der Mann wurde rot, was unter seinem dunklen Teint kaum zu erkennen war. »Ich heiße Glenn, Madam, und ich habe Ihren wichtigen Fall gesehen. Soll ich Sie zum Springbrunnen zurückbringen?«
»Nein.« Ich warf mich in den Sitz und Bilder von jungen, wütenden Tiermenschen drehten sich in meinem Kopf. »Sie können mich aber gerne zu meinem Büro fahren. Es ist in den Hollows, einfach die Nächste links.«
»Ich bin nicht Ihr persönlicher Chauffeur«, meinte er grimmig. Ihm behagte die ganze Situation offensichtlich nicht. »Ich soll Sie zum FIB bringen.«
Ich nahm den Arm vom Türrahmen, als er einen Schalter an der Armaturenleiste bediente, woraufhin sich das Fenster langsam hochschob. Die Luft wurde sofort stickig. Jenks flitzte empört zur Decke. Er fühlte sich eingesperrt. »Was, zur Hölle, machst du da?«
»Ja«, rief ich, mehr irritiert als besorgt, »was geht hier ab?«
»Captain Edden will Sie jetzt sehen, Ms. Morgan, nicht morgen.«
Ruckartig blickte er von der Straße zu mir herüber. Sein gezwungenes Lächeln wirkte mies und hinterhältig. Dieser Gesichtsausdruck gefiel mir ganz und gar nicht. »Und wenn Sie auch nur den Versuch machen, einen Zauber rauszuholen, werde ich Ihren Hexenarsch aus meinem Wagen befördern, Ihnen Handschellen anlegen und Sie in den Kofferraum packen. Captain Edden hat mich beauftragt, Sie zu holen, aber er sagte nicht, in welchem Zustand Sie bei ihm ankommen müssen.«
Jenks landete auf meinem Ohrring und fluchte so sehr, dass er anfing, blau zu glühen. Ich versuchte ein paar Mal, das Fenster wieder aufzumachen, aber Glenn hatte es verriegelt, und so ergab ich mich schließlich mit einem Schnaufen meinem Schicksal. Ich konnte ihm meinen Finger ins Auge bohren und uns so von der Straße abbringen, aber wozu? Ich wusste, wohin die Fahrt ging. Edden würde sich sicherlich darum kümmern, dass ich nach unserem Meeting nach Hause kam. Trotzdem nervte es mich, einen Menschen zu treffen, der noch kaltschnäuziger war als ich. Was war bloß aus dieser Stadt geworden?
Wir verfielen wieder in brütendes Schweigen. Ich nahm die Sonnenbrille ab, lehnte mich zu ihm rüber und sah, dass er fünfzehn Meilen zu schnell fuhr. Na, das passte.
»Pass auf«, flüsterte Jenks. Ich hob überrascht die Augenbrauen, als der Pixie von meinem Ohrring flitzte. In dem Licht der durch die Windschutzscheibe einfallenden Herbstsonne blitzte plötzlich ein glitzernder Strahl auf. In aller Heimlichkeit überzog Jenks den Detective mit feinem Staub, und ich war bereit, meine heißesten Spitzenhöschen zu verwetten, dass es kein normaler Pixiestaub war. Glenn war angepixt worden!
Ich verkniff mir ein Grinsen. In ungefähr zwanzig Minuten würde Glenn von einem so starken Juckreiz heimgesucht werden, dass er nicht mehr ruhig würde sitzen können. »Wieso haben Sie eigentlich keine Angst vor mir?«, fragte ich mit honigsüßer Stimme.
»Als ich noch ein Kind war, lebten wir neben einer Hexenfamilie«, antwortete er vorsichtig. »Sie hatten eine Tochter in meinem Alter. Diese kleine Hexe ärgerte mich mit allen nur erdenklichen Mitteln.« Ein leichtes Lächeln huschte über sein kantiges Gesicht, und auf einmal wirkte er gar nicht mehr wie ein FIB-Beamter. »Es war der traurigste Tag meines Lebens, als sie fortzog.«
Ich machte einen Schmollmund. »Armer Kleiner.« Sein mürrischer Gesichtsausdruck kehrte zurück, aber es verschaffte mir keine Genugtuung. Edden hatte Glenn geschickt, weil er wusste, dass ich ihn nicht einschüchtern konnte.
Verdammte Montage!
2
Als wir auf einem der reservierten Parkplätze direkt vor dem Gebäude parkten, konnte ich die Wärme der Nachmittagssonne spüren, die vom grauen Stein des FIB-Gebäudes reflektiert wurde. Auf der Straße quälte sich der Verkehr entlang, und Glenn eskortierte mich und meinen Fisch stocksteif durch die Eingangspforte. Winzig kleine Bläschen bildeten sich direkt über seinem Kragen. Die pinken Quaddeln bildeten eine starken Kontrast zu seiner dunklen Haut und sahen ziemlich übel aus.
Jenks bemerkte, dass ich auf Glenns Nacken starrte und lachte höhnisch. »Mr. FIB-Detective reagiert wohl empfindlich auf Pixiestaub«, flüsterte er. »Das Zeug verbreitet sich durch sein Lymphsystem. Er wird sich an Stellen kratzen, die er vorher noch nicht einmal kannte.«
»Wirklich?« Ich war schon ein wenig entsetzt. Normalerweise juckte es nur dort, wo der Pixiestaub die Haut berührt hatte. Glenn hatte vierundzwanzig Stunden Höllenqualen vor sich.
»Tja, er wird in seinem ganzen Leben nie wieder einen Pixie in einem Auto einsperren.«
Trotz seines Triumphs schien es mir, als läge in seiner Stimme ein wenig Schuldgefühl. Er sang auch nicht seine Siegeshymne, die von Gänseblümchen und rot glänzendem Stahl im Mondlicht handelte. Bevor ich das im Boden eingelassene FIB-Emblem der Eingangshalle überquerte, verlangsamten sich meine Schritte. Ich war nicht abergläubisch – mal abgesehen von den Momenten, in denen mein Leben davon abhing –, aber ich betrat ein Territorium, das gewöhnlich nur den Menschen gehörte. Es gefiel mir nicht, in der Minderheit zu sein.
Die vereinzelten Gesprächsfetzen und das Klappern der Computertastaturen erinnerten mich an meinen alten Job bei der I. S., und ich entspannte mich ein wenig. Die Mühlen des Gesetzes wurden mit Papier geschmiert und von schnellen Füßen auf den Straßen angetrieben. Ob nun Menschen oder Inderlander die Laufarbeit erledigten, war egal – zumindest mir.
Das FIB wurde gegründet, um nach dem Wandel sowohl die Stadtverwaltung als auch die Bundesregierung zu vertreten. Zumindest auf dem Papier sollte das FIB die überlebenden Menschen vor den – na ja – eher aggressiven Inderlandern beschützen, vor allem vor Vampiren und Tiermenschen. Doch die Realität sah anders aus. Die Auflösung der alten Gesetzesstrukturen war nur ein paranoider Versuch gewesen, uns Inderlander auszugrenzen.
Aber dann kam alles anders. Die geouteten, gefeuerten Polizeibeamten und Bundesagenten hatten ganz einfach ihre eigene Behörde gegründet – die I.S. Vierzig Jahre später war das FIB ihnen hoffnungslos unterlegen. Da sich die I. S. um die übernatürlichen Fälle kümmerte, die das FIB nicht bewältigen konnte, mussten sie im Kampf gegen das Verbrechen in Cincinnati immer wieder Demütigungen hinnehmen.
Als ich Glenn zu den hinteren Büroräumen folgte, verdeckte ich mit dem Kanister meine linke Hand. Nicht viele erkannten die kleine, kreisförmige Narbe an der Unterseite meines Handgelenks als das, was sie war – ein Dämonenmal. Aber man konnte ja nie wissen, und so versteckte ich es lieber. Weder das FIB noch die I. S. wussten, dass ich in den Zwischenfall mit dem Dämon verwickelt gewesen war, bei dem im vergangenen Frühling das Archiv für antike Bücher verwüstet worden war. Und das sollte auch so bleiben. Der Dämon war geschickt worden, um mich zu töten, aber letztendlich hatte er mir das Leben gerettet. Ich musste das Mal tragen, bis ich einen Weg gefunden hatte, mich aus dem Pakt freizukaufen.
Glenn ging zielstrebig zwischen den Tischen hinter der Lobby hindurch, und ich musste verblüfft feststellen, dass nicht ein einziger Beamter anzügliche Bemerkungen über einen Rotschopf in Leder machte. Aber im Vergleich zu der schreienden Nutte mit den lila Haaren und der fluoreszierenden Kette, die von der Nase bis unter ihre Bluse reichte, war ich wahrscheinlich unsichtbar.
Im Vorbeigehen warf ich einen Blick auf die geschlossenen Jalousien von Eddens Büro und winkte Rose, seiner Assistentin. Ihr Gesicht lief rot an, während sie vorgab, mich zu ignorieren. Ich rümpfte die Nase, da ich dieses Verhalten nur zu gut kannte. Trotzdem nervte es. Die Rivalität zwischen dem FIB und der I. S. hatte eine lange Tradition. Es schien keine Rolle zu spielen, dass ich nicht mehr für die Inderlander Security arbeitete. Vielleicht mochte sie aber auch einfach keine Hexen.
Ich war erleichtert, als wir den Eingangsbereich verließen und einen steril wirkenden, mit Neonröhren erleuchteten Flur betraten. Auch Glenn entspannte sich und ging langsamer. Ich konnte die Präsenz der alles verschlingenden Bürokratie förmlich in meinem Rücken spüren, war aber zu deprimiert, um mich darüber aufzuregen. Wir kamen an einem Besprechungsraum vorbei, und ich betrachtete die große Pinnwand, an der die dringendsten Fälle der Woche hingen. Neben der üblichen Rubrik »Menschen verfolgt von Vampiren« hing eine weitere Liste. Ich fühlte Übelkeit in mir aufsteigen und schloss die Augen. Um alles genau erkennen zu können, gingen wir zu schnell, aber mir war klar, worum es sich handeln musste. Wie jeder andere auch hatte ich es in den Zeitungen verfolgt.
»Morgan!«, dröhnte plötzlich eine bekannte Stimme, und ich drehte mich so schnell um, dass meine Stiefeletten auf den grauen Fliesen ein quietschendes Geräusch machten.
Es war Edden, der uns mit rasender Geschwindigkeit durch den Flur entgegenkam. Seine untersetzte Silhouette mit den pendelnden Armen war unverkennbar. Augenblicklich fühlte ich mich besser.
»Bei allen Nachtschnecken«, murrte Jenks. »Ich verzieh mich, Rachel. Wir sehen uns dann zu Hause.«
»Bleib hier.« Mich amüsierte der Groll des Pixies. Er erinnerte an einen Vulkan kurz vor dem Ausbruch. »Und wenn du Edden auch nur ein Schimpfwort an den Kopf wirfst, werde ich eine Ladung Ameisenkiller in deinen Baumstumpf blasen.«
Glenn kicherte, weshalb ich Jenks’ Antwort nicht verstand. Was vielleicht auch besser so war.
Edden war ein Ex-Navy-SEAL und wirkte immer noch wie ein Soldat, was nicht zuletzt an seinem kurz geschnittenen Haar und den zerknitterten Khakihosen lag. Ein gestärktes weißes Hemd verbarg seinen muskulösen Oberkörper. Sein grauer Bart bildete einen starken Kontrast zu seinem dichten, tiefschwarzen Haupthaar. Als er uns entgegenkam, steckte er die billige Lesebrille in die Hemdtasche, und ein einladendes Lächeln erhellte sein rundes Gesicht. Der Captain des FIB Cincinnati blieb abrupt stehen, sodass ich in eine Wolke von Kaffeeduft gehüllt wurde. Er hatte beinahe meine Körpergröße – war für einen Mann also eher klein –, aber dieses Defizit glich er durch seine starke Präsenz aus.
Als Edden meine Lederhose und das legere Top sah, zog er ironisch die Augenbrauen hoch. »Schön, Sie zu sehen, Morgan. Ich hoffe, meine Anfrage kam nicht ungelegen.«
Ich verlagerte den Kanister auf den anderen Arm und streckte ihm die Hand hin. Seine kurzen, fleischigen Finger umfassten sie, vertraut und herzlich. »Nein, überhaupt nicht«, erwiderte ich trocken. Edden legte eine Hand auf meine Schulter und führte mich einen kurzen Flur entlang.
Auf eine so vertrauliche Geste hätte ich normalerweise mit einem Ellbogenstoß in den Magen reagiert, aber Edden war eine verwandte Seele, er hasste Ungerechtigkeit genau so sehr wie ich. Obwohl er meinem Dad nicht sonderlich ähnelte, erinnerte er mich in mancher Hinsicht an ihn. Edden hatte sich meinen Respekt verdient, da er mich als Hexe akzeptiert hatte. Er behandelte mich als Gleichberechtigte und schenkte mir sein Vertrauen, was mir sehr schmeichelte. Und ich war süchtig nach Schmeicheleien.
Schulter an Schulter schlenderten wir den Gang entlang, wobei Glenn ein wenig zurückblieb. »Schön, Sie wieder fliegen zu sehen, Mr. Jenks«, meinte Edden mit einem Nicken zu dem Pixie.
Jenks verließ mit einem harten, klappernden Flügelschlag meinen Ohrring. Edden hatte ihm einen Flügel gebrochen, als er ihn in einen leeren Wassertank stopfte – und die Wut eines Pixies ist langlebig. »Ich heiße Jenks«, sagte er kalt, »einfach nur Jenks.«
»Na gut, dann Jenks. Können wir Ihnen etwas anbieten? Zuckerwasser, oder vielleicht ein wenig Erdnussbutter …« Er wandte sich zu mir, und ich sah, dass er vergnügt schmunzelte. »Kaffee, Ms. Morgan? Sie sehen müde aus.« Sein breites Grinsen vertrieb auch den letzen Rest meiner schlechten Laune. »Das wäre großartig«, antwortete ich. Edden warf Glenn einen auffordernden Blick zu. Der Detective machte keinen sonderlich entspannten Eindruck. An seinem Unterkiefer waren einige neue Striemen zu erkennen. Als sich der gepeinigte Mann abwenden wollte, packte Edden ihn am Unterarm und flüsterte ihm ins Ohr: »Es ist schon zu spät, um den Pixiestaub noch abzuwaschen. Versuchs mal mit Kortison.«
Als er sich schließlich abwandte, warf Glenn mir einen undurchdringlichen Blick zu. Dann ging er aus dem Büro und den Weg zurück, den wir gekommen waren.
»Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vorbeizukommen. Ich habe heute Morgen etwas reinbekommen, und Sie sind die Einzige, die mir dabei helfen kann, Kapital daraus zu schlagen.«
Jenks lachte spöttisch. »Was ist denn los, hat sich ein Werwolf einen Dorn in die Pfote gerammt?«
»Halt die Klappe, Jenks«, unterbrach ich ihn reflexartig. Glenn hatte Trent Kalamacks Namen erwähnt, und das machte mich verdammt nervös. Edden drehte sich um und stand vor zwei Türen ohne Aufschrift. Er setzte zu einer Erklärung an, zuckte dann aber nur mit den Schultern und öffnete eine der Türen, hinter der sich ein nackter, schlecht beleuchteter Raum befand. Edden führte mich hinein und wartete, bis die Tür zugefallen war. Dann zog er den Lamellenvorhang vor dem großen Spionspiegel hoch.
Ich starrte in den anderen Raum. »Sara Jane«, flüsterte ich verblüfft.
»Sie kennen die Frau?« Edden verschränkte seine kräftigen Arme vor der Brust. »Da haben wir ja Glück.«
»Es gibt kein Glück«, schnappte Jenks süffisant. Er schwebte jetzt in Augenhöhe, und die leichte Brise seiner Flügel strich über meine Wangen. Die Hände hatte er in die Hüften gestemmt, und seine Flügel hatten sich zu einem leichten Pink verfärbt. »Das ist ein abgekartetes Spiel.«
Ich näherte mich dem Spiegel. »Sie ist Trent Kalamacks Sekretärin. Was macht sie hier?«
Edden stand mit gespreizten Beinen neben mir. »Sie sucht ihren Freund.«
Überrascht drehte ich mich zu ihm. Sein rundes Gesicht wirkte angespannt. »Sein Name ist Dan Smather, Hexe. Wird seit Sonntag vermisst. Die I.S. wird sich erst nach dreißig Tagen rühren. Sie ist davon überzeugt, dass sein Verschwinden mit den Morden des Hexenjägers zusammenhängt, Und ich glaube, sie hat recht.«
Mein Magen zog sich zusammen. Cincinnati war nicht gerade bekannt für seine Serienmörder, aber in den letzten sechs Wochen mussten wir uns mit mehr unaufgeklärten Morden herumschlagen als in den vorangegangenen drei Jahren zusammen. Die kürzlich aufgekeimte Gewalt hatte alle schockiert – Inderlander genauso wie Menschen. Das Spiegelglas beschlug durch meinen Atem, und ich trat zurück. »Passt er ins Profil?«, fragte ich, obwohl ich wusste, dass die I. S. sie nicht abgewimmelt hätte, wenn sein Verschwinden mit der Mordserie in einen direkten Zusammenhang gebracht werden konnte.
»Wenn er tot wäre, würde er ins Profil passen. Bisher wird er nur vermisst.«
Das trockene Surren von Jenks’ Flügeln durchbrach die Stille. »Und wozu brauchen Sie Rachel?«
»Es gibt zwei Gründe. Erstens ist Ms. Gardenko eine Hexe.«
Er nickte in Richtung der attraktiven Frau hinter dem Glas. Seine Stimme klang frustriert. »Meine Beamten können sie nicht vernünftig befragen.«
Ich fixierte Sara Jane, die zur Uhr blickte und sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischte.
»Sie kann aber keine Zauber brauen«, sagte ich sanft. »Sie kann sie nur evozieren. Formal gesehen ist sie ein Hexer. Wann kapiert Ihr endlich mal, dass der Unterschied zwischen einer Hexe und einem Hexer nicht im Geschlecht, sondern im Grad des Könnens liegt?«
»Wie dem auch sei, meine Beamten können ihre Antworten nicht vernünftig auswerten.«
Seine Ignoranz machte mich wütend. Mit zusammengepressten Lippen schaute ich ihn an. »Sie meinen, Sie wissen nicht, ob sie lügt?«
Der Captain zog seine beeindruckenden Schultern nach oben. »Wenn Sie es so ausdrücken möchten.«
Jenks schwebte zwischen uns und warf sich mal wieder in seine Peter-Pan-Pose. »Okay, Sie wollen also, dass Sara Jane von Rachel verhört wird. Und was ist der zweite Grund?«
Edden lehnte sich mit den Schultern gegen die Wand. »Ich brauche jemanden, der noch mal die Schulbank drückt, und da ich keine Hexe auf meiner Gehaltsliste habe, kommen nur Sie dafür infrage, Rachel.«
Einen Moment lang starrte ich ihn fassungslos an. »Wie bitte?«
Wenn der Mann lächelte, ähnelte er einem hinterlistigen Troll. »Sie haben die Geschichte in den Zeitungen verfolgt?« Ich beantwortete die überflüssige Frage mit einem Nicken. Wer nicht?
»Alle Opfer waren Hexen«, sagte ich. »Alle, bis auf die beiden ersten, waren Singles, und alle hatten Erfahrung in der Kraftlinienmagie.« Ich verkniff es mir gerade noch, eine abfällige Grimasse zu schneiden. Ich mochte die Kraftlinien nicht, und vermied es so weit wie möglich, sie zu benutzen. Sie stellten Brücken zum Jenseits und zu den Dämonen dar. Eine der verbreitetsten Mordtheorien besagte, dass die Opfer mit den schwarzen Künsten herumexperimentiert und ganz einfach die Kontrolle verloren hatten. Wer’s glaubt. Niemand war so dumm, einen Dämon zu beschwören – außer natürlich mein Freund Nick. Und das auch nur, um mir das Leben zu retten.
Edden nickte. »Die Öffentlichkeit weiß allerdings nicht, dass jedes der Opfer irgendwann einmal Unterricht hatte bei einer gewissen Dr. Anders.«
Ich rieb meine verschrammten Hände. »Anders«, murmelte ich. In meiner Erinnerung tauchte das Bild einer dürren, griesgrämigen Frau auf, mit viel zu kurzem Haar und einer schrillen Stimme, die an den Klang von Fingernägeln auf einer Tafel erinnerte. »Ich hatte ein Seminar bei ihr.« Ich sah Edden kurz an und wandte mich dann verlegen wieder zum Spiegel um. »Sie war eine Gastdozentin von der Universität, während unser Seminarleiter ein Forschungssemester einlegte. Unterrichtete Kraftlinienmagie für Erdhexen. Sie ist eine arrogante Kröte, hat mich im dritten Trimester rausgeworfen, nur weil ich keinen Schutzgeist binden konnte.«
Edden gab ein grunzendes Lachen von sich. »Versuchen Sie diesmal das Seminar abzuschließen und eine Zwei zu schaffen, damit ich die Ausgaben als Fortbildungskosten abrechnen kann.«
»Moment mal!«, schrie Jenks schrill. »Hey, Edden, Sie können nicht einfach Ihren Sonnenblumensamen in fremden Gärten aussäen. Rachel wird auf keinen Fall auch nur in die Nähe von Sara Jane kommen. Das ist Kalamacks Werk. Er versucht, sie in seine manikürten Finger zu kriegen.«
Mit einem Stirnrunzeln löste sich Edden von der Wand.
»Mr. Kalamack ist hier in keiner Form involviert. Und wenn Sie diesen Fall dazu benutzen wollen, ihn abzuschießen, werde ich Ihren blütenweißen Hexenarsch nehmen und ihn über den Fluss zurück in die Hollows schleifen. Dr. Anders ist unsere Verdächtige. Wenn Sie den Fall wollen, müssen Sie mir versprechen, Mr. Kalamack da raus zu lassen.«
Jenks surrte wütend mit den Flügeln. »Hattet ihr heute Morgen alle Frostschutzmittel im Kaffee? Das ist eine Falle. Es hat überhaupt nichts mit den Morden zu tun. Verdammt, Rachel, sag ihm, dass das nichts mit den Morden zu tun hat.«
»Das hat nichts mit den Morden zu tun«, meinte ich ausdruckslos. »Ich nehme den Fall an.«
»Rachel!«
Ich holte tief Luft, wohl wissend, dass ich das nicht erklären konnte. Sara Jane war ehrlicher als die Hälfte aller I. S.-Agenten, mit denen ich gearbeitet hatte. Sie kam vom Land und hatte Schwierigkeiten, sich in der Stadt zurechtzufinden und ihre Familie zu unterstützen, die mittlerweile für Trent Kalamack arbeitete. Obwohl sie mich nicht kannte, schuldete ich ihr einiges. Im letzten Frühjahr war ich drei Tage lang als Nerz in Trent Kalamacks Büro gefangen gehalten worden und hatte Höllenqualen durchlitten. Sie war die Einzige gewesen, die mir ein wenig Freundlichkeit entgegengebracht hatte.
Äußerlich hätten wir unterschiedlicher nicht sein können. Sara Jane saß in ihrem schicken, gepflegten Businessanzug stocksteif am Tisch, ihr Make-up war so perfekt aufgetragen, dass es fast unsichtbar war. Jede Strähne ihres blonden Haares befand sich am richtigen Platz. Ich stand da in meiner zerrissenen Lederhose und mein strubbeliges, rotes Haar hing wild und ungekämmt herunter. Sie hatte eine zierliche Figur und wirkte mit ihrer weißen Haut und den feinen Gesichtszügen wie eine zerbrechliche Porzellanpuppe. Ich hingegen war groß und hatte einen athletischen Körper, der mir unzählige Male das Leben gerettet hatte – so oft, dass es sogar die Anzahl meiner Sommersprossen überstieg. Sara Jane war gut gebaut und hatte Kurven an den richtigen Stellen – mir fehlten jegliche Rundungen, und die kleinen Hügelchen konnten auch nicht als Busen durchgehen. Aber ich fühlte eine tiefe Verbundenheit mit ihr. Trent Kalamack hatte uns beide gefangen, und wahrscheinlich erkannte sie das jetzt.
Jenks gab nicht auf. »Nein! Trent benutzt sie, um dich anzulocken.«
Irritiert wedelte ich ihn weg. »Trent kann mir nichts anhaben. Edden, haben Sie immer noch den pinken Ordner, den ich Ihnen im Frühjahr gegeben habe?«
»Den mit der Disc und dem Terminkalender, der Beweise enthält, dass Trent Kalamack illegale Genprodukte herstellt und vertreibt?« Der gedrungene Mann grinste breit. »Na klar. Er liegt auf meinem Nachttisch, eine interessante Lektüre für schlaflose Nächte.«
Mir fiel die Kinnlade runter. »Sie sollten ihn nur öffnen, falls ich spurlos verschwinde!«
»Ich kann nichts dafür, ich schnüffele auch in versteckten Weihnachtsgeschenken herum. Entspannen Sie sich. Ich werde erst in Aktion treten, wenn Kalamack Sie umbringt. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es verdammt gefährlich ist, Kalamack zu erpressen …«
»Es ist das Einzige, was mich am Leben erhält«, schrie ich wütend und zuckte dann zusammen. Hoffentlich hatte mich Sara Jane durch das Glas nicht gehört!
»… aber wahrscheinlich sicherer, als ihn zum jetzigen Zeitpunkt vor Gericht zu bringen.« Er deutete auf Sara Jane. »Für so etwas ist er doch viel zu clever.«
Wenn es ein anderer als Trent gewesen wäre, hätte ich zugestimmt. Trent Kalamack war ein Ehrenbürger wie aus dem Bilderbuch. In der Öffentlichkeit war er so charmant und attraktiv, wie er hinter verschlossenen Türen kalt und skrupellos war. Aber wenn Edden mir nicht in die Quere kam, würde mich der unantastbare Mann in Ruhe lassen.
Plötzlich flitzte Jenks direkt vor meine Augen und verharrte dort. Seine winzigen Gesichtszüge waren sorgenvoll. »Das stinkt doch schlimmer als gammeliger Fisch. Dreh dich um und geh, lass die Finger von der Sache.«
Ich blickte an Jenks vorbei zu Sara Jane. Sie hatte geweint. »Ich schulde ihr etwas«, flüsterte ich. »Egal, ob sie es weiß oder nicht.«
Edden stellte sich neben mich. Zusammen betrachteten wir die verzweifelte Frau. »Morgan?«
Jenks hatte recht. Es gab kein Glück – außer man kaufte es sich –, und im Dunstkreis von Trent geschah nichts ohne Grund. Ich konnte meine Augen nicht von Sara Jane abwenden. »Ja. Ja, ich werde den Fall übernehmen.«
Titel der amerikanischen Originalausgabe THE GOOD, THE BAD, AND THE UNDEAD Deutsche Übersetzung von Alan Tepper
Deutsche Erstausgabe 12/2007 Redaktion: Charlotte Lungstrass
Copyright © 2005 by Kim Harrison Copyright © 2007 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN: 978-3-641-09173-6
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe