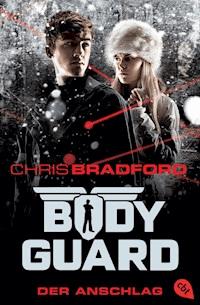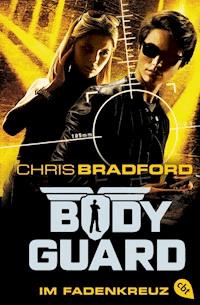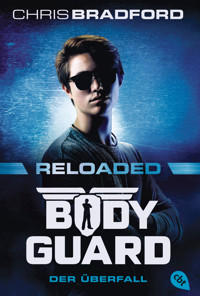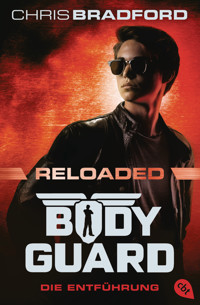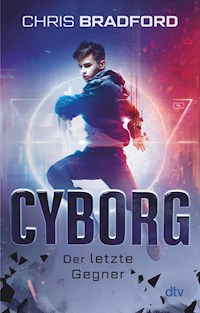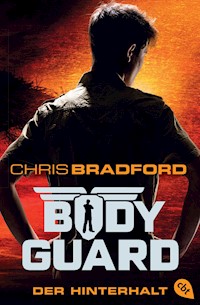
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bodyguard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Renn um dein Leben - der dritte Auftrag des knallharten Schutzengels
Eigentlich klingt der Auftrag eher nach einer Art Erholungsreise: Connor soll eine Diplomatenfamilie auf einem dreiwöchigen Safaritrip als Bodyguard durch eine der schönsten Regionen Afrikas begleiten. Doch es kommt ganz anders: Ein Militärputsch stürzt das Land in einen blutigen Bürgerkrieg. Die Safarigesellschaft gerät in die Hände einer bewaffneten Miliz. In einem günstigen Augenblick gelingt es Connor, gemeinsam mit seinen Schutzbefohlenen zu entkommen. Eine atemlose Flucht durch den afrikanischen Busch beginnt ...
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
DER AUTOR
© Danny Fitzpatrick
CHRIS BRADFORD recherchiert stets genau, bevor er mit dem Schreiben beginnt: Für seine neue Serie »Bodyguard« belegte er einen Kurs als Personenschützer und ließ sich als Leibwächter ausbilden. Bevor er sich ganz dem Bücherschreiben widmete, war Chris Bradford professioneller Musiker und trat sogar vor der englischen Königin auf. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Chris Bradford lebt mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und zwei Katzen in England.
Bereits erschienen:
Band 1: Bodyguard – Die Geisel
Band 2: Bodyguard – Das Lösegeld
Mehr Informationen zurBodyguard-Serie unter:
www.cbj-verlag.de/bodyguard
CHRIS BRADFORD
DER HINTERHALT
Aus dem Englischen von
Karlheinz Dürr
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
Erstmals als cbj Taschenbuch Januar 2016
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe:
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2015 der englischen Originalausgabe: Chris Bradford
Erstmals erschienen unter dem Titel »Bodyguard – Ambush«
bei Puffin Books, einem Imprint von Penguin Books Ltd., UK
Übersetzung: Karlheinz Dürr
Lektorat: Andreas Rode
Umschlagfoto: Richard Jenkins
Umschlaggestaltung: © semper smile,
unter Verwendung des Originalumschlags
© Cover art by Larry Rostant represented by Artist Partners
MP · Herstellung: ReD
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17169-8
www.cbj-verlag.de
Zu Ehren der HGC –
ihr wisst, wer ihr seid!
PROLOG
NoMercy nahm die AK-47 in die linke Hand und wischte sich die rechte am T-Shirt ab. Seine Finger waren schweißnass, das Sturmgewehr schwer. Für das, was er vorhatte, musste die Waffe gut und sicher in den Händen liegen. Der Dschungel ringsum pulsierte vor Gefahren, in jedem düsteren Schatten konnte ein Feind lauern. Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel über Afrika, schaffte es aber kaum, durch das dichte Blätterdach zu dringen. Der Dschungel, der in Burundis nördlichem Grenzland im Überfluss vorhanden war, absorbierte die Hitze des Tages langsam, aber beständig und verwandelte sich so in eine lebende Hölle.
Wolken von Moskitos summten in der feuchtschwülen Luft; Affen schnatterten ängstlich in den Wipfeln. NoMercy rückte gemeinsam mit seinen Waffenbrüdern durch den Wald vor. Für einen eiskalten Drink hätte er seinen linken Arm gegeben. Aber er blieb nicht stehen – er durfte nicht stehen bleiben, bevor der General nicht den ausdrücklichen Befehl gegeben hatte. Und so war er gezwungen, sich den Schweiß von der Oberlippe zu lecken, was nun wirklich ein schwacher Ersatz für einen Schluck Wasser war.
Während er in Richtung des Treffpunkts vorrückte, hielt er ständig nach Sprengfallen und alten Minen aus dem Bürgerkrieg Ausschau. Irgendwann wurde ihm bewusst, dass die Affen in den Baumwipfeln verstummt waren. Dann merkte er, dass der gesamte Dschungel still geworden war. Nur das leise, unvermeidliche Summen der Fliegenschwärme war noch zu hören.
Der General reckte die geschlossene Faust in die Luft; der Trupp hielt an. NoMercy ließ den Blick rundum schweifen, um sich zu vergewissern, dass nirgendwoher Gefahr drohte. Doch er sah nichts außer hoch aufragenden Baumstämmen, grünen Lianen und dichten Palmwedeln. Dann, urplötzlich, trat ein Weißer hinter einem Baumstamm hervor.
NoMercy schwang sofort die AK-47 zu ihm herum, den Finger am Abzug.
Der Weiße verzog keine Miene. Seine Gesichtshaut erinnerte NoMercy an fahles Elfenbein. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ der Fremde den Blick über die verwahrloste Rebellenbande in ihren zusammengewürfelten Uniformen gleiten, über ihre dreckigen T-Shirts, auf denen noch die ausgebleichten Logos verschiedener Hilfsorganisationen zu erkennen waren, und über ihre veralteten und angerosteten Waffen. Schließlich fasste er NoMercy ins Auge, der die AK-47 immer noch auf seine Brust gerichtet hielt.
NoMercy kam der Weiße fast wie ein Außerirdischer vor, jedenfalls ein Mensch, der hier im Dschungel völlig fehl am Platz wirkte. Er trug ein makelloses olivgrünes Hemd, eine Cargohose und schwarze Springerstiefel; die brütende Hitze schien ihm nicht das Geringste auszumachen. Er war weder außer Atem, noch schwitzte er. Selbst die Moskitos schienen sich von ihm fernzuhalten. Der Fremde war wie eine Echse, kaltblütig und unmenschlich.
NoMercy hielt die Mündung der AK-47 weiterhin auf den Mann gerichtet. Sein Zeigefinger juckte förmlich danach, endlich auf den Abzug drücken zu dürfen. Ein Wort des Generals würde genügen, selbst das leichteste Nicken, und die AK-47 würde den Mann mit einem Kugelhagel durchsieben. NoMercy tötete unbarmherzig, ohne eine Spur von Mitleid; er trug seinen Kampfnamen nicht ohne Grund.
General Pascal trat vor. Der burundische General war eine eindrucksvolle Erscheinung: Furcht einflößend, stark und groß wie ein Silberrücken-Gorilla überragte er den Weißen um einen guten Kopf. Er trug Tarnkleidung und ein Barett, so rot wie frisches Blut. Sein dunkles, pockennarbiges Gesicht jagte jedem Dorfbewohner, der ihn zu sehen bekam, Schreckensschauder über den Rücken, und seine eisenharten Fäuste trugen die schwieligen Narben unzähliger Faustschläge, die jeder zu spüren bekam, der dumm genug war, sich ihm in den Weg zu stellen.
»Dr. Livingstone, nehme ich an?«, fragte der General. Sein bleistiftdünner Schnauzbart verzog sich zu einem entwaffnenden Lächeln, mit dem bei diesem brutalen Mann niemand gerechnet hätte.
»Sie haben offenbar Sinn für Humor, General«, gab der Weiße zurück, seinerseits jedoch ohne den geringsten Anflug von Humor. »Und jetzt befehlen Sie mal dem Knaben dort, er soll mit seiner Knarre woanders hinzielen, bevor ihm jemand eine Kugel gibt.«
NoMercy hob wütend die Waffe noch ein bisschen höher, als er die Beleidigung hörte. Er mochte zwar erst fünfzehn sein, aber das Alter spielte schließlich keine Rolle, denn wer die Waffe hat, hat die Macht.
Der General winkte ihm lässig, das Gewehr zu senken. NoMercy folgte dem Befehl zögernd und schob schmollend die Unterlippe vor. Jetzt hing die mächtige AK-47 schlaff am Gurt und sah an dem mageren Jungen wie eine überdimensionale Wasserpistole aus.
»Haben Sie den Stein?«, fragte der Fremde.
General Pascal schnaubte verächtlich. »Ihr Weißen! Kommt immer gleich zur Sache!« Er betrachtete den Mann von oben bis unten. »Aber unser Geschäft hat schließlich zwei Seiten. Haben Sie meine Waffen?«
»Erst der Stein.«
»Vertrauen Sie mir nicht, Mr Grey?«
Der Weiße gab keine Antwort. Das verwirrte NoMercy noch mehr. Dass der Fremde keinerlei Furcht zeigte, obwohl er dem berüchtigten General gegenüberstand, konnte nur bedeuten, dass er unerhört mutig war – oder unglaublich dumm. General Pascal hatte schon wegen viel geringerer Vergehen, als keine Antwort auf seine Frage zu geben, Leuten die Hände abgehackt. Dann schoss NoMercy ein furchtbarer Gedanke durch den Kopf, der ihn erschaudern ließ: dass dieser Mr Grey vielleicht sogar nochgefährlicher als der General selbst sein könnte.
General Pascal nickte NoMercy zu. »Zeig ihm den Stein.«
NoMercy zog einen schmutzigen Stoffbeutel aus der Tasche seiner zwei Nummern zu großen Tarnjacke. Er reichte das Bündel dem Fremden, wobei er vorsichtig vermied, dessen aschfarbene Haut zu berühren. Mr Grey schüttete den Inhalt des Beutels in die Hand. Ein großer hellrosa Kristall fiel auf die offene Handfläche. Mr Grey nahm eine Juwelierlupe aus der Tasche und inspizierte den unauffälligen, schlichten Stein genau. Nachdem er ihn eine Weile von allen Seiten betrachtet hatte, verkündete er: »Armselige Qualität.«
Der General ließ ein donnerndes Lachen hören, das durch die Stille des Dschungels dröhnte. »Sie halten mich wohl für einen Idioten, Mr Grey. Wir beide wissen doch ganz genau, dass das hier ein sehr wertvoller rosa Diamant ist.«
Mr Grey tat so, als würde er den Stein noch einmal, aber genauer, untersuchen. Das kleine Machtspiel gehörte eben zum Verhandlungsprozess. Schließlich seufzte er widerwillig. »Er deckt vielleicht die erste Waffenlieferung, mehr nicht«, sagte er und fügte nach kurzer Pause hinzu: »Gibt es dort, wo er herkommt, noch mehr davon?«
Der General bedachte ihn erneut mit seinem entwaffnenden Lächeln. »Mehr, als Sie sich jemals erträumen könnten.«
»Haben Sie das Gebiet gesichert, in dem die Diamanten gefunden wurden?«
»Noch nicht«, gab der General zu, »aber mit Ihren Waffen werden wir das tun können.«
Mr Grey ließ den Stein in den Beutel fallen und steckte ihn in die Tasche. »Equilibrium wird die Waffen liefern, die Sie brauchen – unter einer Bedingung: Sobald Sie, General, an der Macht sind, werden Sie der Organisation die alleinigen Schürfrechte für das Gebiet übertragen. Einverstanden?«
»Einverstanden«, stimmte General Pascal zu und bot dem Weißen seine fleischige Pranke.
Mit offensichtlichem Widerstreben schüttelte ihm Mr Grey die Hand.
NoMercy schaute zu, als die beiden Männer das Geschäft mit ihrem Handschlag besiegelten. Und dann zuckte er zusammen, als plötzlich im Dschungel starke Motoren aufheulten. Zwei riesige Militärtrucks pflügten wie Bulldozer auf dem unbefestigten, halb überwachsenen Dschungelweg daher. Auf ihren Ladeflächen waren Waffenkisten aufgestapelt: brandneue AK-47, Browning M2-Maschinengewehre, Granatwerfer und zahlreiche Kisten Munition.
»Versuchen Sie bloß nicht, uns auszutricksen, General«, überschrie Mr Grey das Brüllen der Motoren. »Denn dann wäre Ihr kleiner Bürgerkrieg ein Honigschlecken im Vergleich zu dem, was wir mit Ihnen und Ihren Männern anstellen werden.«
Der General lächelte unerschütterlich. »Das gilt auch für Sie, mein Freund, für Sie und für Ihre Leute.«
»Dann sind wir im Geschäft«, antwortete Mr Grey und verschmolz mit den Schatten des Dschungels.
KAPITEL 1
Connor wurde brutal aus dem Schlaf gerissen. Ein Sack wurde ihm über den Kopf gestülpt. Der dichte, dunkle Stoff ließ keinen Lichtschimmer durch. Während er nach Atem rang, rissen ihm kräftige Hände die Arme hinter den Rücken. Er wehrte sich heftig, aber schon wurden ihm Kabelbinder so fest um die Hand- und Fußgelenke zusammengezogen, dass er sich nicht mehr rühren konnte.
»Lasst mich los!«, schrie er und warf sich heftig hin und her, aber an Flucht war nicht mehr zu denken. Brutal aus dem Schlaf gerissen, empfand er nichts als Verwirrung und blinde Panik. Wieder warf er sich hoch, und dieses Mal trafen seine gefesselten Beine einen der Leute, die ihn überfielen. Er hörte ein schmerzhaftes Aufstöhnen.
Nun wurde Connor noch von weiteren Händen gepackt und auf die Füße gestellt. Er wurde aus dem Zimmer geschleppt, wobei seine Füße über den Teppich schleiften. Laut schrie er: »HILFE! HILFE!«
Aber niemand antwortete, niemand reagierte auf seinen Hilfeschrei, der ohnehin durch die Stoffhaube gedämpft wurde.
Plötzlich schlug Connor eiskalter Wind entgegen. Sie hatten ihn ins Freie geschleppt. Er zitterte noch immer vor Schock über den Überfall, und sein Herz raste, aber er wusste, dass er sich in den Griff kriegen musste, wenn er diese Sache überleben wollte. Während seiner Bodyguard-Ausbildung hatte er auch gelernt, wie man eine Geiselnahme übersteht. Demnach waren die ersten dreißig Minuten nach der Entführung die gefährlichsten. In diesem Zeitraum waren die Entführer extrem angespannt, übernervös und somit höchst unberechenbar.
»In diesem Stadium musst du möglichst ruhig und absolut aufmerksam bleiben«, hatte seine Trainerin Jody erklärt, »obwohl es jedem menschlichen Instinkt zuwiderläuft. Achte genau auf alles, das dir einen Hinweis auf den Ort geben könnte, an dem du dich befindest, oder darauf, wer deine Entführer sind.«
Schritte knirschten auf Kies. Drei Paar Schuhe, glaubte Connor zu hören, und schon diese Entdeckung gab ihm das Gefühl, die Kontrolle nicht völlig verloren zu haben. Er hörte, dass ein Kofferraum geöffnet wurde. Einen Augenblick später wurde er in ein Fahrzeug gestoßen; der Kofferraumdeckel wurde zugeschlagen.
Nein, kein Kofferraum, korrigierte Connor sich in Gedanken. Bei einem Kofferraum hätte man ihn über den Rand heben müssen. Stattdessen hatte man ihn in das Fahrzeug geschoben oder vielmehr gestoßen.
Ein Motor wurde gestartet; das tiefe, kräftige Brummen bestätigte seinen Verdacht: Seine Entführer hatten ihn in einen Geländewagen verfrachtet.
Der Wagen setzte sich ruckartig in Bewegung; auf dem Kies drehten die Reifen kurz durch, als der Fahrer zu viel Gas gab. Connor wurde zurückgeworfen, sein Kopf schlug so heftig gegen die Rückwand, dass er buchstäblich Sterne sah und ihm ein heftiger Schmerz durch den Kopf schoss. Die letzten Reste von Schläfrigkeit waren wie weggewischt.
Jemand muss die Entführung doch beobachtet haben, dachte er, als er nun endlich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Bestimmt wird jemand Alarm auslösen.
Das Knirschen von Kies hörte auf; der Wagen fuhr jetzt auf Asphalt. Er bog scharf nach links ein, dann beschleunigte er. Während das Auto die Straße entlangraste, versuchte Connor, sich die Strecke vorzustellen. Aufmerksam zählte er die Sekunden bis zur nächsten Kurve.
Siebenundsechzig … achtundsechzig … neunundsechzig … Das Allradfahrzeug fuhr in eine scharfe Rechtskurve. Connor begann erneut zu zählen, sodass er sich allmählich einen ungefähren Streckenverlauf vorstellen konnte. Er spürte, wie das Fahrzeug einen sehr kurzen Hügel hinauf und wieder hinunter fuhr – das musste eine alte, kleine Brücke gewesen sein. Er zählte weiter. Vierundzwanzig … fünfundzwanzig … sechsundzwanzig …
Die Entführung verblüffte ihn. Gewöhnlich wurden die Klienten entführt, die Personen, die ein Bodyguard beschützen sollte, aber nicht die Bodyguards. Seine Entführer mussten einen Fehler gemacht haben.
Pech, Leute, ihr habt den Falschen erwischt!, dachte er.
Außerdem war er gar nicht auf einer offiziellen Mission. Doch dann beschlich ihn ein unangenehmer Gedanke: Vielleicht hatten die Entführer tatsächlich den Richtigen entführt?
Connor versuchte, seine Position zu verändern, um mehr Platz für seine Hände zu bekommen. Aber er wurde gegen die Rückseite des Fahrzeugs gepresst und seine Hand- und Fußgelenke waren so eng gefesselt, dass die Plastikbinder in die Haut schnitten und die Blutzirkulation verringerten. Er versuchte, eine Hand aus der Schlinge zu ziehen, erreichte aber nur, dass der Binder, vermutlich extrastarke Qualität, noch tiefer einschnitt. So sehr er sich auch abmühte, der Binder riss nicht.
Als er bis siebenundvierzig gezählt hatte, schwang der Wagen urplötzlich nach rechts. Nach weiteren zehn Sekunden bog er nach links ab. Und kurz darauf noch einmal. Bis zum sechsten Abbiegen hintereinander hatte Connor bereits die Orientierung verloren – die gedachte Landkarte war nur noch ein einziges Chaos. Anscheinend fuhr der Geländewagen im Kreis, um den Gefangenen absichtlich zu verwirren. Über den Motorenlärm und die Fahrgeräusche hinweg horchte Connor angestrengt auf Gesprächsfetzen im Fahrzeug. Vielleicht konnte er so Aufschluss über die Identität der Entführer bekommen: Akzent, Sprache, Geschlecht, vielleicht sogar ein Name. Aber es blieb still, was ihn noch mehr beunruhigte. Connor folgerte daraus, dass er es mit Profis zu tun hatte. Es war gar nicht anders möglich, denn sonst hätten die Entführer es nicht geschafft, die Sicherheitsvorkehrungen im Buddyguard-Hauptquartier auszutricksen.
Vielleicht haben die Kidnapper etwas mit meiner letzten Mission zu tun?, dachte er.
Bestenfalls konnte er hoffen, dass die Entführer ein Lösegeld herausholen wollten. In diesem Fall wäre er für sie lebend weit mehr wert als tot. Aber wenn sie ihn verhören oder ihn als Geisel für irgendeinen politischen oder religiösen Protest benutzen wollten, würden sie ihn wahrscheinlich irgendwann umbringen. In diesem Fall würde er einen Fluchtversuch riskieren müssen.
Jedenfalls musste er ihre Pläne so schnell wie möglich herausfinden – davon konnte sein Leben abhängen.
Endlich kam der Allradwagen zum Stillstand. Der Motor wurde abgeschaltet. Die Hecktür wurde geöffnet und Connor wurde nicht sehr sanft aus dem Wagen gezerrt. Ein grausam kalter Wind ließ ihn schaudern; sein T-Shirt bot nur wenig Schutz gegen die eisige Winterkälte. Zwei Entführer packten ihn an den Oberarmen und schleppten ihn mit sich. Durch die Kopfhaube roch Connor einen kaum wahrnehmbaren Parfümduft. War etwa einer der Entführer eine Frau?
»Wohin bringt ihr mich?«, wollte Connor wissen. Seine Stimme klang jetzt ruhig; er hoffte, dass die Frau antworten würde.
Aber die Kidnapper blieben schweigsam. Sie zogen ihn so schnell von dem Wagen weg, dass Connor ins Stolpern kam. Er hörte das leise Zischen einer Tür, die aufglitt. Ein Schwall warmer Luft begrüßte ihn, willkommene Wärme nach der Kälte draußen, und statt Asphalt spürte er jetzt weichen Teppich unter den Füßen. Die Unbekannten führten ihn weiter in das Gebäude hinein. Connor stieg der Geruch dünstender Zwiebeln in die Nase und er hörte gedämpftes Klappern von Töpfen und Pfannen. Dann verklangen die Küchengeräusche wieder. Er wurde noch ein paar Dutzend Schritte in einen anderen Raum geführt, dann stießen sie ihn unsanft auf einen Stuhl. Die Rückenlehne presste schmerzhaft gegen seine gefesselten Hände, aber er konnte beide Füße auf den Boden setzen. Er richtete sich auf, um vor seinen Entführern wenigstens einen Rest von Würde zu bewahren und nicht wie ein nasser Sack in sich zusammenzusinken. Und um jederzeit aufspringen zu können, sollte sich eine Gelegenheit ergeben.
In dem Raum, in den sie ihn gebracht hatten, herrschte absolute Stille, aber eine Stille, die verriet, dass sich noch andere Personen im Raum befanden.
Niemand sprach. Nach einer Weile fragte Connor scharf: »Was soll das? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir?«
»Was wir wollen, spielt keine Rolle«, antwortete eine Männerstimme. »Die Frage ist eher, was du willst.«
KAPITEL 2
Die Stoffhaube wurde ihm so plötzlich vom Kopf gerissen, dass er für einen Moment geblendet die Augen schließen musste. Als er sie wieder öffnete, sah er im Schein greller Deckenstrahler, dass er am Kopfende eines langen Glastisches saß, der für ein Dinner festlich gedeckt war. So desorientiert, wie er war, brauchte er ein paar Sekunden, bis er die Leute erkannte, die sich in dem Raum befanden.
»Happy Birthday to you!«, sang das gesamte Alpha-Team.
Connor blieb buchstäblich der Mund offen stehen, während er die anderen Buddyguards nacheinander anstarrte – Charley, Amir, Ling, Jason, Marc und Richie saßen an den beiden Tischseiten. Und am anderen Ende saßen Colonel Black und Connors Personenschutztrainer Jody, Steve und Bugsy.
»Was zum …?«, rief Connor und wusste nicht, ob er sich erleichtert fühlen, sich freuen oder einfach furchtbar wütend sein sollte.
Auf Colonel Blacks hartem, faltigem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus, was ausgesprochen selten vorkam. »Freut mich, dass du kommen konntest.«
Connor hatte es die Sprache verschlagen. Er hatte wirklich geglaubt, dass er irgendeiner Terroristenzelle in die Hände gefallen war oder, noch schlimmer, zu Tode gefoltert werden sollte. Und nicht, dass die »Entführung« in einem schicken Restaurant irgendwo am Rande der Brecon Beacons in Wales enden würde.
Charley lächelte ihn strahlend an und reichte ihm die Speisekarte. »Also – was willst du?«, fragte sie.
Connor warf nur einen flüchtigen Blick auf die Karte; er war immer noch davon geschockt, wie clever sie ihn hereingelegt hatten.
»Du hast dir vor Angst fast in die Hose gemacht!«, lachte Ling.
Die Bemerkung riss Connor endlich aus seiner Benommenheit. »Nein, hab ich nicht! Ich hatte immer alles voll unter Kontrolle!«
»Ja, genau, so unter Kontrolle wie eine Weihnachtsgans in der Bratpfanne!«, kicherte Jason.
»Na, ich wusste jedenfalls, dass ich in einem Allradwagen transportiert wurde und dass wir nicht mal eine Viertelstunde vom Hauptquartier entfernt sind. Außerdem hab ich festgestellt, dass es drei Kidnapper waren und dass eine Frau zu ihnen gehörte.« Dabei warf er Jody einen Blick zu, die eine schwarze Lederjacke trug und ihr dunkelbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte.
»Wirklich?«, fragte Jody unbeeindruckt. »Und wieso?«
»Ihr Parfüm hat Sie verraten.«
Sie hob anerkennend eine Augenbraue. »Dann hast du ja wirklich einen klaren Kopf behalten. Das ist immer gut, und ganz besonders für einen Bodyguard.«
»Du bist wirklich ein schlüpfriger Fisch, Connor«, gab Bugsy zu, der kahlköpfige Trainer für Überwachungstechniken. Er rieb sich das Stoppelkinn, das schmerzhafte Bekanntschaft mit Connors Absatz gemacht hatte. »Bin froh, dass wir dich zuerst immobilisiert hatten, sonst hätten wir dich womöglich gar nicht in den Range Rover gebracht.«
Connor spürte, dass seine Würde wenigstens teilweise wiederhergestellt war: Er hatte bewiesen, dass er in einer schwierigen Situation nicht den Kopf verloren hatte und sich vielleicht sogar selbst in Sicherheit hätte bringen können. Jetzt, da der Schock nachließ, konnte er allmählich sogar die komische Seite an der Sache sehen.
»Na, jedenfalls ist das ein Geburtstagsgeschenk, das ich nicht so schnell vergessen werde! Und ganz bestimmt werde ich nach einer Nachtschicht nie mehr im Aufenthaltsraum einschlafen!«, rief er lachend. Er stand auf und reckte den anderen seine immer noch gefesselten Hände entgegen. »Vielleicht kann mir mal jemand endlich diese Dinger hier abnehmen?«
Amir stand sofort auf, aber der Colonel schüttelte den Kopf und winkte ihm, sich wieder zu setzen.
Connor runzelte die Stirn. »Aber wie soll ich denn damit meine Geschenke auspacken?«, rief er mit übertrieben jammernder Stimme.
»Dürfte ein wenig schwierig werden«, stellte Colonel Black gelassen fest. »Es sei denn, du kannst dich selbst befreien.«
Connor schaute den Colonel ungläubig an. »Sie machen sich über mich lustig, stimmt’s? Das sind Kabelbinder, extrastark, die kann man nicht zerreißen, ich hab’s schon versucht.« Er zeigte ihnen die wundgescheuerten Stellen an den Gelenken.
»Dann wird es höchste Zeit, dass du es lernst«, sagte der Colonel und nickte Steve zu, dem Trainer für unbewaffneten Kampf. Steve war 1,85 Meter groß und gebaut wie ein Panzer, ein ehemaliger Soldat der britischen Special Forces, der jeden im Raum überragte. Er streckte Jody Hände entgegen, die wie Vorschlaghämmer aussahen, wobei die Muskeln auf seinen mächtigen Armen zuckten. Jody zog extrastarke Kabelbinder aus der Tasche und band ihm damit die Hände zusammen.
»Um eine bestimmte Art von Fessel zu überwinden, muss man zunächst einmal analysieren, wie sie funktioniert«, erklärte Steve. »Diese Plastikbinder hier bestehen aus einem Nylonstreifen mit Querrillen und einem Verschluss mit winzigen Zähnen in einem kleinen, offenen Gehäuse. Der Schwachpunkt ist der Verschluss. Deshalb muss man die Kraftanwendung darauf konzentrieren.«
Steve fasste das Plastikband mit den Zähnen und zog es so zurecht, dass sich der Verschluss zwischen seinen Handgelenken befand. Dann hob er die Hände über den Kopf, riss sie mit einer kräftigen Bewegung herab und schlug sie gegen seinen Körper, wobei er gleichzeitig die Hände spreizte, so weit es die Fesseln zuließen. Die Plastikfessel sprang mit einem leisen »Ping!« auseinander wie ein Gummiband. »Na bitte. So leicht ist die Sache.«
»C’est facile pour vous«, murrte Marc und fuhr auf Englisch fort: »Sie sind ja auch gebaut wie der Terminator.«
»Ja, und Connors Hände sind hinter dem Rücken gefesselt«, warf Amir ein.
Steve zuckte nur die Schultern. »Es gilt dasselbe Prinzip. Beuge dich nach vorn und schlage die Hände gegen die Hüften. Gleichzeitig spreizt du die Hände. Übrigens: Wichtig ist nur die Technik und die Schnelligkeit, nicht die Kraft.«
Connor folgte den Abweisungen, dann beugte er sich nach vorn und schlug die Hände gegen die Hüfte. Der Binder platzte, seine Hände waren frei. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er an den Fesseln gezerrt und gezogen, dabei wäre nur ein einziger Schlag mit der richtigen Technik nötig gewesen. Er schüttelte die Hände, um die Blutzirkulation wieder anzuregen. »Das ist absolut super. Aber was ist mit meinen Fußfesseln?«
Steve nickte zum Esstisch. »Dort liegt dein Steakmesser. Brauchst du eine Gebrauchsanweisung?«
Connor grinste und schnitt das Band mit dem Messer durch. Jason gab sich damit nicht zufrieden: »Aber wenn man grade nicht in einem Restaurant ist, was ist dann?«
»Wenn du meinen Anweisungen gefolgt bist und deine Schnürsenkel gegen Paracord ausgetauscht hast, kannst du sie als Reibesäge verwenden.«
Ling sprang auf und streckte Steve ihre Hände hin. »Das sieht total cool aus. Ich will es auch mal versuchen.«
»Du bist wohl eine kleine Masochistin, wie?«, sagte Steve grinsend, nahm einen Plastikbinder und band ihn Ling um die Handgelenke.
»Autsch! Doch nicht so fest!«, protestierte Ling, als Steve den Binder festzog.
»Je enger, desto leichter ist der Schließmechanismus zu zerstören«, erklärte Steve ohne jeden Anflug von Mitleid.
»Viel Spaß dabei, Mücke!«, rief Jason.
Ling, die es hasste, wenn man auf ihren schmächtigen Körperbau anspielte, warf ihm einen giftigen Blick zu und hob die Hände über den Kopf. Trotz ihrer Zierlichkeit schaffte sie es schon beim ersten Versuch, das Band aufzusprengen.
»Dazu braucht man keine Muskeln wie ein Zuchtbulle«, sagte sie und verneigte sich spöttisch vor Jason.
»Jetzt ich!«, rief Amir eifrig.
Steve band Amirs Hände hinter dem Rücken. »Na, dann los.«
Amir bückte sich und schlug die Arme gegen den Rücken. Der Binder hielt. Er versuchte es noch einmal. Ohne Erfolg.
»Ist das eine andere Art von Binder?«, fragte Amir frustriert.
»Nein. Sie sind alle gleich.«
»Probiere es noch einmal«, drängte Connor. »Du musst nur den richtigen Winkel erwischen.«
Amir versuchte es noch ein paarmal, aber der Binder riss nicht. Bei jedem Versuch wurde Amir noch frustrierter. Er hüpfte im privaten Speiseraum des Restaurants herum und schlug sich mit den gefesselten Händen auf den Hintern wie ein durchgeknallter Pinguin.
»Er sieht aus wie ein Hühnchen beim Breakdance!«, witzelte Richie.
Alle platzten schier vor Lachen. Amir ließ sich geschlagen auf einen Stuhl fallen.
Auch Steve konnte nur mühsam ein Grinsen unterdrücken und sagte zu Colonel Black: »Vielleicht sollten wir das zu einem regulären Partyspiel machen, Sir.«
KAPITEL 3
Connor erbarmte sich schließlich und schnitt Amirs Fessel durch. »Wessen Idee war es eigentlich, mich zu kidnappen?«, wollte er wissen.
»Meine natürlich!«, sagte Jason, hob sein Glas und prostete Connor zu.
Hätte ich mir doch denken können, dachte Connor. Die ganze Sache entsprach genau der Art von Humor, die der Australier hatte. »Wäre es nicht einfacher gewesen, ein Taxi zu rufen?«
Jason grinste breit. »Einfacher ja, aber nicht mal halb so witzig.«
Amir ließ sich neben Connor auf den Stuhl fallen und widmete sich scheinbar interessiert der Speisekarte, um seine Verlegenheit zu verbergen. Als Einziger hatte er den Trick mit dem Plastikbinder nicht geschafft. »Ist schwieriger, als es aussieht«, murmelte er.
Connor nickte mitfühlend. »Dann können wir nur hoffen, dass du bei deiner Mission nicht mit diesen Dingern gefesselt wirst, oder?«
»Jep – dein Klient würde sich sonst totlachen, bevor du ihn retten kannst!«, witzelte Richie.
Amir ließ sich auf dem Stuhl zurücksinken, als hätte jemand seinen Stecker gezogen. Bedrückt ließ er den Kopf hängen, so dass eine Strähne seines glatten schwarzen Haars seine Augen verdeckte. Seine Enttäuschung konnte er nicht so leicht verstecken. Connor warf Richie einen wütenden Blick zu. Richies rustikaler irischer Humor war wieder einmal gründlich danebengegangen. Richie zuckte entschuldigend die Schultern, aber der Schaden war schon angerichtet.
Connor klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Kopf hoch, Amir. Mach dir keine Sorgen. Deine Mission wird super laufen, du wirst schon sehen.«
»Du hast leicht reden«, murmelte Amir. »Du hast schließlich schon die Goldenen Flügel.« Er deutete auf das glänzende Abzeichen an Connors T-Shirt: einen Schild mit goldenen Flügeln, der die Silhouette eines Bodyguards zeigte. »Und ich hatte noch keinen einzigen Einsatz!«
Seit Connor im vergangenen Jahr in die Buddyguard-Organisation aufgenommen worden war, hatte sein Freund verzweifelt darauf gewartet, dass ihn der Colonel auf eine Mission schickte. Jetzt war es endlich so weit: In drei Wochen sollte Amir seinen ersten Einsatz absolvieren und seine Nerven lagen blank.
»Weißt du nicht mehr, wie nervös ich vor meinem ersten Einsatz war?«, fragte Connor. »Ich konnte vorher eine Woche lang kaum schlafen. Und ich hatte grade mal die Grundausbildung hinter mir. Du hast den Vorteil, dass du fast ein ganzes Jahr trainieren konntest – und außerdem kannst du aus meinen Fehlern lernen!«
Amir brachte ein angespanntes Grinsen zustande. »Macht mir die Sache nicht leichter.«
»Leicht wird es nie, jedenfalls ist das meine Erfahrung.«
»Was ist, wenn ich versage? Genau wie mit diesen blöden Kabelbindern. Oder wenn ich bei einem Angriff einfach in Schockstarre verfalle?«
»Passiert dir nicht«, versicherte ihm Connor. »Glaub mir, jeder Bodyguard macht sich darüber Sorgen. Aber ich kann dir versichern, wenn es so weit kommt, schaltet sich deine Ausbildung ganz automatisch ein. Du wirst reagieren. Außerdem bin ich dein Missionskontakt im Hauptquartier und unterstütze dich. Dieses Mal sind unsere Rollen vertauscht.«
Amir schluckte heftig und nickte. »Danke. Gut zu wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauche.«
»Okay, Geburtstagskind«, unterbrach Charley die beiden Freunde. »Was möchtest du essen?«
Connor wandte sich zu ihr um. Charley saß auf seiner anderen Seite. Sie trug ein silbern glitzerndes Top und hatte die langen blonden Haare zu einem dicken goldenen Zopf geflochten. Ein Hauch von Make-up ließ ihre himmelblauen Augen noch strahlender erscheinen. Connor brauchte ein paar Sekunden, bis er merkte, dass die Kellnerin hinter ihm stand und geduldig auf seine Bestellung wartete.
»Ich kann noch mal wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit brauchen«, sagte die Kellnerin lächelnd.
»Nein, nein, geht schon«, sagte Connor eilig und überflog die Speisenauswahl. Er hoffte, dass Charley nicht bemerkt hatte, wie er sie angestarrt hatte. Er bestellte ein großes Steak mit einer extragroßen Portion Pommes. Die perfekt vorgetäuschte Entführung hatte einen Adrenalinschub ausgelöst, sodass er nun einen gewaltigen Appetit verspürte.
»Du fliegst also nach Hause zu deiner Familie?«, fragte Charley, nachdem auch sie ihr Gericht bestellt hatte.
Connor nickte. »Der Colonel hat mir zum Ende des Monats Urlaub gegeben.«
Charley blickte ihn aufmerksam an; überrascht stellte sie fest, dass er nicht besonders glücklich wirkte. »Freust du dich denn nicht, wieder nach Hause zu gehen?«
Er seufzte, beugte sich ein wenig näher zu ihr und gestand mit leiser Stimme: »Doch, natürlich freue ich mich … Aber ich mache mir Sorgen, wie es meiner Mutter geht. Als ich letztes Mal nach Hause kam, bin ich erschrocken, wie … wie gebrechlich sie aussah.«
Charley legte ihm leicht die Hand auf den Arm. »Was meinst du, würde es euch allen helfen, wenn ich mitkomme?«
Connor zögerte. »Danke, aber ich will dich damit nicht belasten.«
»Das ist kein Problem«, sagte sie beharrlich. »Außerdem könnte mir ein Tapetenwechsel ganz gut tun. Mir fällt hier im Hauptquartier allmählich die Decke auf den Kopf. Wir Californian Girls werden uns wohl nie an lange Winter wie hier in Wales gewöhnen.«
Connor lächelte. Wenn er ehrlich mit sich selbst war, musste er zugeben, dass ihm Charleys Angebot gefiel. Auch die lange Reise würde weniger langweilig sein. Und zumindest würde er damit die Neugier seiner Mutter stillen können, die sich immer nach seinen Freunden in dem »Privatinternat« erkundigte.
»Okay, das wäre wirklich großartig …« Plötzlich wurde eine große Geschenkpackung zwischen ihn und Charley geschoben.
»Zeit zum Geschenkeauspacken!«, trillerte Ling aufgeregt.
Connor packte das Geschenk aus und lachte laut auf, als er sah, was sich darin befand.
»Ersatz für deinen alten, den ich kaputt gemacht habe«, sagte Ling mit breitem Grinsen, als Connor den gepolsterten Kopfschutz hochhob. Ein, zwei Wochen zuvor hatte er sich einen hitzigen Kickboxkampf mit Ling geliefert, bei dem sie ihn mit einem derart vernichtenden Drehkick am Kopf getroffen hatte, dass sein Kopfschutz auseinandergebrochen war. Die Sache hatte ihn den Sieg gekostet.
»Ich bin ja froh, dass du mir nicht auch noch den Kopf geknackt hast«, sagte Connor und bewunderte den neuen Kopfschutz von allen Seiten. Maximaler Schutz durch schockabsorbierende Geleinlagen. »Der wäre nämlich schwerer zu ersetzen gewesen.«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Ling. »In dem Laden hatten sie auch Fußbälle in deiner Kopfgröße. Mir ist es egal, was ich kaputt trete!«
»Solange du noch aufrecht stehst«, gab Connor zurück. Inzwischen stand es zwischen ihnen unentschieden, beide hatten jeweils vier Kämpfe gewonnen und wussten, dass der nächste Kampf härter sein würde als alle vorherigen. Connor hatte gehört, dass sogar die Ausbilder Wetten auf den Sieger abschlossen. Oder eben auf die Siegerin.
Jason warf Connor ein ziemlich schlecht eingepacktes Geschenk zu. »Hoffentlich passt es.«
Das Päckchen platzte von selbst auf, als Connor es auffing. Auf dem Tisch landete ein grellgelbes T-Shirt. Auf der Brust prangte ein Koala mit übertrieben scharf dargestellten Zähnen. Vorsicht, Drop Bears!, stand darunter. Das war eine ziemlich blamable Erinnerung, denn bei seinem letzten Einsatz war Connor von Jason vor den angeblichen Killerbären gewarnt worden. Connor, der zum ersten Mal nach Australien gereist war, war prompt darauf hereingefallen. Grinsend hielt er das T-Shirt vor sich hin, um die Größe abzuschätzen.
»Ist es kugelsicher?«, wollte er wissen.
»Nö«, antwortete Jason mit seinem breiten australischen Akzent. »Aber es schreckt garantiert alle Drop Bears ab!«
»Wirkt es so gut wie dein Aftershave, mit dem du die Mädchen abschreckst?«, witzelte Richie, was besonders bei den Mädchen lautes Gelächter auslöste.
Jason fauchte zurück: »Hallo – mein Aftershave wirkt super!«, wobei er Ling den Arm um die Schultern legte.
Ling lächelte lieb zu ihm auf – und rammte ihm den Ellbogen in die Rippen.
Jason knickte vor Schmerzen zusammen. »AUA! War das liebevoll gemeint oder wie?«
Während sich Jason noch von Lings zärtlichem Ellbogenhieb erholte, packte Connor seine anderen Geschenke aus. Marc hatte ihm ein Designerhemd aus Paris gegeben; von Richie erhielt er die neueste Version des Computerspiels Assassin’s Creed, und schließlich öffnete er auch das gemeinsame Geschenk von Amir und Charley.
»Hoffentlich gefällt es dir«, sagte Charley und biss sich ein wenig besorgt auf die Unterlippe, als sie eine kleine Geschenkschatulle vor ihn hinlegte. »Amir und ich haben es gemeinsam ausgesucht.«
Connor öffnete die Schatulle. Darin lag eine G-Shock Rangeman XL.
Eifrig beugte sich Amir zu ihm herüber, um ihm sofort die Hightechfunktionen der Uhr zu erläutern. »Sie hat Solarbetrieb, Atomzeitsynchronisation in sechs Frequenzen weltweit, Weltzeiten für achtundvierzig Städte und einunddreißig Zeitzonen und automatische LED-Beleuchtung durch Handbewegung, außerdem ist die neueste Generation des Triple-Sensor-Moduls V.3 verbaut worden. Und was für dich am wichtigsten ist: Sie ist absolut wasserdicht und stoßfest. Die Uhr wurde so konstruiert, dass sie immer funktionsfähig bleibt, sogar unter den grausamsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Dieses Ding hier, Kumpel, kannst nicht einmal du kaputt machen.«
Connor war fast sprachlos. »Danke, ihr zwei … das ist … absoluter Wahnsinn«, sagte er verlegen, legte die Uhr an und hob den Arm hoch, damit auch alle anderen das Geschenk sehen konnten.
»Das ideale Geschenk für einen Bodyguard«, meinte Colonel Black und nickte billigend. »Ein Zeitmesser, der immer funktioniert, ist bei jeder Mission wichtig. Und hier nun auch das letzte Geschenk.«
Er stieß einen kleinen schwarzen Gegenstand über den Glastisch, der akkurat vor Connor zu liegen kam. Alle starrten entgeistert und geschockt darauf. Ein Autoschlüssel!
»Sie schenken ihm ein Auto!«, rief Jason aus.
»Den Fahrunterricht, um genau zu sein«, antwortete Jody. »Das Auto selbst ist für das ganze Alpha-Team bestimmt.«
Connor nahm den Schlüssel und starrte ihn verwirrt an. »Aber ich bin noch nicht alt genug, um fahren zu dürfen.«
Colonel Black schüttelte den Kopf. »In einer Gefahrensituation ist dafür kein Bodyguard zu jung.«
KAPITEL 4
»Das Herz Afrikas wird wieder schlagen!«, rief Michel Feruzi. Zur Betonung hieb der burundische Minister für Handel und Tourismus im Takt der Wörter mit seiner fleischigen Faust auf den abgenutzten alten Kabinettstisch, sodass die Eiswürfel in den Wassergläsern klirrten.
»Da kann ich nur lebhaft zustimmen!«, schloss sich Finanzminister Uzair Mossi dem begeisterten Kollegen an, wobei seine Augen so funkelten wie die Diamanten, über die sie gerade sprachen. »Burundi war nun lange genug der arme Mann dieses reichen Kontinents. Wenn die Gerüchte stimmen, wäre das ein Wendepunkt für unser Land, eine …«
Präsident Bagaza hob die Hand und wartete, bis die verfrühten Begeisterungsstürme seiner Minister verstummten. Er selbst teilte ihren Enthusiasmus über die Nachricht nicht.
»Angola. Sierra Leone. Liberia. Kongo«, zählte er leise mit monotoner Stimme auf. »Bedeuten Ihnen denn die tragischen Erfahrungen dieser Länder nichts?« Er schwieg für ein paar Augenblicke, bis er sicher war, dass sich seine Minister wieder an die Geister der grauenhaften Geschichte dieser Länder erinnerten: brutale Bürgerkriege, angeheizt durch Blutdiamanten. »Der Bericht über die Entdeckung eines Diamantenfelds kann Anlass für Freude, aber genauso Anlass für größte Sorge sein. Unser Land hat Stammeskonflikte hinter sich, die eine ganze Generation andauerten. Der Friede ist immer noch unsicher und kann jederzeit wieder brüchig werden. Wir können, wir dürfen nicht zulassen, dass wir wieder in einen Bürgerkrieg hineingezogen werden.«
Die Minister schauten sich peinlich berührt an. Obwohl das Blutvergießen schon über ein Jahrzehnt zurücklag, waren die Narben noch immer nicht völlig verheilt. Die Spannungen zwischen den rivalisierenden Stämmen der Hutu und der Tutsi brodelten dicht unter der Oberfläche vor sich hin und zogen sich sogar mitten durch das Kabinett, das hier am Tisch versammelt war.
»Der Präsident hat recht«, erklärte Minister Feruzi schließlich. Sein Stuhl knarrte laut, als er seinen massigen Körper zurücklehnte. »Erst kürzlich haben wir sämtliche Stammesgruppen der Batwa aus dem Erweiterungsgebiet des Ruvubu-Nationalparks umgesiedelt. Wenn sie nun erfahren, dass dort ein Diamantenfeld entdeckt wurde, werden sie wieder Ansprüche auf das Land ihrer Ahnen erheben. Wir können nicht zulassen, dass ein Stamm, der noch dazu eine kleine Minderheit ist, als einziger Nutznießer auftritt. Diese Entdeckung muss dem ganzen Land Wohlstand bringen.«
»Alles schön und gut – wenn es überhaupt Diamanten gibt«, meldete sich Adrien Rawasa, der Minister für Bergbau und Energie, zu Wort, ein magerer Mann mit kahl geschorenem Kopf und eingesunkenen Wangen. Er schob die runde Goldrandbrille höher auf die Nase und trat vor eine verblichene, ausgefranste und ziemlich veraltete geologische Karte Burundis, die an der weiß getünchten Wand hing.
»Wie Ihnen allen bekannt ist«, sagte er und tippte mit dem Zeigefinger auf die Karte, »befindet sich unsere Bergbauindustrie immer noch in der Aufbauphase. Wir haben beträchtliche Vorkommen an Nickel, Kobalt und Kupfer, die wir nur mit Unterstützung ausländischer Investoren ausbeuten können. Wir haben sogar ein paar Goldadern und ein wenig Uran. Aber wir sind nicht mit reichen Bodenschätzen gesegnet – oder, wenn man es so sehen will, verflucht – wie einige unserer Nachbarländer. Die fragliche Gegend im Nationalpark weist nicht die typischen geologischen Bedingungen auf, in denen man normalerweise Diamanten findet. Das Gerücht mag also sehr wohl auf Steinen beruhen, die illegal aus dem Kongo oder aus Ruanda über die Grenze geschmuggelt wurden.«
»Aber ist es denn überhaupt denkbar, dass Diamanten im Park gefunden wurden?«, fragte Präsident Bagaza.
Minister Rawasa sog an seiner Unterlippe, während er nachdenklich die Karte betrachtete. »Nun, sagen wir mal, es wäre nicht unmöglich.«
»Dann müssen wir äußerst behutsam vorgehen«, sagte der Präsident. »Minister Feruzi, schließen Sie den Nationalpark für die Öffentlichkeit. Dann lassen Sie den Park von den Rangern Sektor um Sektor durchsuchen. Ich will eine Bestätigung haben, dass es dieses Diamantenfeld wirklich gibt, bevor wir irgendwelche Hoffnungen auslösen oder weitere Pläne machen. Erklären Sie den Rangern nur, dass sie nach Wilderern suchen, aber auch alles berichten sollen, was ihnen ungewöhnlich erscheint. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein falscher Diamantenrausch.«
»Soll ich auch den Besuch des französischen Botschafters auf später verschieben?«, fragte Minister Feruzi.
Präsident Bagaza klickte aus alter Gewohnheit ein paarmal mit seinem Kugelschreiber, während er über die Frage nachdachte. »Nein. Nicht nach all den Millionen, die Frankreich in unser Naturschutzprogramm investiert hat. Wir müssen ihnen unsere Fortschritte zeigen, sonst fließen bald keine internationalen Hilfen mehr in unser Land. Wir können es uns nicht leisten, diese Gelder zu verlieren.« Er schaute seine Kabinettskollegen eindringlich an. »Bis wir genauere Informationen haben, darf diese Nachricht nicht nach außen dringen. Sie bleibt auf das hier versammelte Kabinett begrenzt. Ist das klar?«
Seine Minister nickten gehorsam. Aber Präsident Bagaza wusste, wie fruchtlos sein Befehl war. Er traute keinem seiner Minister über den Weg; keiner würde ein Geheimnis lange für sich behalten können. Und wenn jetzt sogar seine Minister von diesen Diamanten erfahren hatten, dann musste man annehmen, dass auch andere – und gefährlichere – Leute längst Bescheid wussten. Korrupte Menschen wurden von Diamanten so unvermeidlich angelockt wie Wespen von einem Marmeladebrot.
KAPITEL 5
»ANGRIFF VON VORN!«, schrie Jody, als ein Auto aus einer Nebenstraße schoss und mit qualmenden und quietschenden Reifen mitten auf der Straße zum Stillstand kam.
Connor stampfte mit dem Fuß auf das Bremspedal. Jody war vorbereitet und stützte sich am Armaturenbrett ab. Aber Charley und Marc auf dem Rücksitz wurden nach vorn geschleudert und nur durch ihre Sicherheitsgurte vor Verletzungen bewahrt. Connor fummelte an der Gangschaltung, hatte Mühe, den Rückwärtsgang zu finden. Zwar hatte er in den letzten drei Wochen recht gut Autofahren gelernt, aber der plötzliche Angriff stellte seine Fähigkeiten auf eine harte Probe.
»Komm schon!«, knurrte er frustriert und rüttelte wütend am Schalthebel. Endlich gelang es ihm, den Rückwärtsgang einzulegen. Er blickte über die Schulter und trat das Gaspedal durch. Der Motor protestierte mit lautem Aufheulen, als er die Höchstgeschwindigkeit im Rückwärtsgang erreichte.
Connors Hand verkrampfte sich am Lenkrad, während er versuchte, in möglichst gerader Linie aus der Schusszone zu kommen. Selbst unter normalen Bedingungen fällt das Rückwärtsfahren vielen geübten Fahrern schwer. Mit Höchstgeschwindigkeit rückwärts zu fahren, gilt als extrem gefährlich – eine winzige Fehleinschätzung konnte den Wagen ins Schleudern bringen, unter Umständen mit fatalen Konsequenzen.
Die Angreifer waren inzwischen aus ihrem Fahrzeug gesprungen und eröffneten das Feuer. Connors Wagen entfernte sich zwar rasch, war aber im Rückwärtsgang bei Weitem nicht schnell genug, um zu entkommen. Er musste dringend wenden! Adrenalin schoss durch sämtliche Adern, als er den Fuß vom Gas nahm, das Lenkrad hart nach rechts herumriss und gleichzeitig die Handbremse zog. Mit quietschenden Reifen vollführte der Wagen eine 180-Grad-Wende. Noch in der Drehung legte Connor den ersten Gang ein, dann ließ er die Handbremse los und trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Die Räder drehten durch; Qualm und Gummigestank stiegen auf, als der Wagen davonschoss.
Sekunden später waren sie aus der Gefahrenzone. Marc stieß einen erleichterten Pfiff aus und Charley murmelte: »Reinste Achterbahnfahrt!«
Jody hakte ein weiteres Kästchen auf dem Formular ab und tippte mit dem Kugelschreiber auf ihr Klemmbrett. Das war wohl anerkennend gemeint. »Gut gemacht, Connor. Der Gangwechsel war jämmerlich, aber die Rockford-Wende war absolut spitze!«
Erleichtert atmete Connor aus und nahm die Geschwindigkeit zurück, froh, das erste Stadium der Übung überstanden zu haben. Routinemäßig blickte er immer wieder in den Rückspiegel; schließlich musste er damit rechnen, dass die Angreifer die Verfolgung aufnahmen. Drei Wochen intensiven Fahrunterrichts lagen hinter dem Alpha-Team; jetzt hatten sie mit dem Fortgeschrittenenkurs begonnen, in dem sie lernen sollten, mit dem Auto aus einer Überfallsituation zu fliehen. Die 180-Grad-Wende, auch Rockford-Wende genannt, war eines der wichtigsten Manöver gewesen, die sie hatten erlernen müssen. Sicheres Fahren bei Höchstgeschwindigkeit, Schleuderkontrolle, Rammen von Straßenblockaden oder Abdrängen von Verfolgerfahrzeugen hatten ebenfalls zur Ausbildung gehört. Beim heutigen Abschlusstest mussten sie zeigen, was sie gelernt hatten.
»Autofahren ist immer potenziell gefährlich«, hatte Jody erklärt.
Im Vergleich zu der Sicherheit, für die ein Buddyguard sorgen konnte, wenn sich sein Klient zu Hause oder auch in der Schule aufhielt, war ein Fahrzeug so etwas wie eine bewegliche Zielscheibe. Im Auto war ein Klient für Angriffe oder Entführungsversuche besonders anfällig. Und das war auch der Grund, warum sämtliche Mitglieder des Alpha-Teams lernen mussten, ein Auto selbstsicher und zuverlässig zu steuern, vor allem bei hoher Geschwindigkeit. Und das, obwohl sie das Führerscheinalter noch nicht erreicht hatten. Schließlich konnte man nie wissen, ob es nicht doch irgendwann nötig würde, dass sich ein Buddyguard ans Steuer setzte, um das Auto mit dem Klienten aus einer Gefahrensituation zu bringen.
»Pass auf!«, schrie Marc, als Connor um eine Ecke steuerte.
Nicht weit entfernt standen zwei Fahrzeuge Nase an Nase quer über der Straße. Nach dem Abbiegen war Connors Fahrzeug nicht schnell genug und der Blockade auch schon zu nahe, um noch eine effektive Rockford-Wende ausführen zu können. Connor hielt nicht an. Er fuhr direkt auf die Straßenblockade zu. Ihm war völlig klar, dass es jetzt nur darum ging, die beiden anderen Autos genau an der richtigen Stelle zu treffen – er musste alle beide an den vorderen Radkästen erwischen, wo die Karosserie eines modernen Autos stabil genug war und genug Widerstand bot, um es aus dem Weg rammen zu können. Und um zwei Fahrzeuge wegrammen zu können, musste er sie mit genau der richtigen Kraft und im richtigen Winkel treffen.
Zwanzig Meter vor dem Straßenblock verringerte Connor die Geschwindigkeit, schob den ersten Gang ein und trat das Gaspedal wieder voll durch. Auch die Geschwindigkeit musste genau stimmen. War er zu langsam, würde er hängen bleiben. War er zu schnell, würde er den eigenen Wagen zu stark beschädigen und womöglich liegen bleiben.
»Festhalten!«, schrie er seinen Beifahrern zu.
Es krachte ohrenbetäubend, als sie in die Blockade rasten. Der Aufprall war gewaltig, aber nicht so katastrophal, dass Connors Fahrzeug nicht mehr funktionsfähig gewesen wäre. Bei der Vorbereitung waren die Airbags deaktiviert worden, damit sie sich beim Aufprall nicht aufblähten und den Motor abwürgten.
ENDE DER LESEPROBE