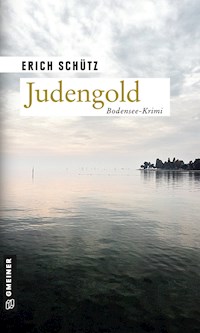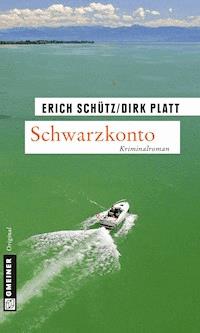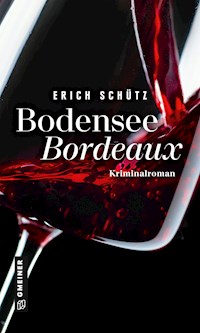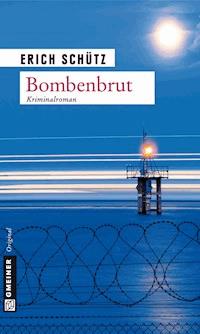
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Gmeiner-VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalist Leon Dold
- Sprache: Deutsch
Es ist ein heißer Sommer. Das Ferienparadies Bodensee ist Ziel von Millionen Touristen, aber auch von skrupellosen Waffenschiebern und internationalen Geheimdiensten. Der Erfinder Herbert Stengele hat eine sensationelle Strahlenwaffe entwickelt, sie könnte den Krieg der Sterne entscheiden. Journalist Leon Dold hat den Auftrag, das Leben des Luftfahrtpioniers Claude Dornier nachzuzeichnen, doch plötzlich steckt auch er mitten in diesem Krieg am Ufer seines idyllischen Bodensees …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Erich Schütz
Bombenbrut
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2011 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2011
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart,
unter Verwendung eines Fotos von: © ariwari und
© Gerisch / Fotolia.com
Druck: Fuldaer Verlagsanstalt, Fulda
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-3732-8
Vorbemerkung
Es ist ein heißer Sommer. Das Ferienparadies Bodensee ist Ziel von Millionen Touristen, aber auch von skrupellosen Waffenschiebern. Der Erfinder Herbert Stengele hat eine sensationelle Strahlenwaffe entwickelt, sie könnte den Krieg der Sterne entscheiden. Die Geheimdienste der Großmächte schicken ihre Agenten an den sommerlichen See. Leon Dold, der investigative Journalist, hat den Auftrag, das Leben des Luftfahrtpioniers Claude Dornier nachzuzeichnen, doch plötzlich steckt er mitten im Krieg der Sterne am Ufer seines idyllischen Bodensees.
Widmung
Für Hermann Hügenell,
der mit seiner Erfindung eines neuartigen Teleskops die Vorlage für diesen Politthriller lieferte.
Zitat
Alle unsere Bemühungen, etwas Vernunft in die Geschichte des Menschen zu bringen, um sie vor Gräueln des Krieges zu warnen, haben nichts genützt. Ihr habt nichts dazugelernt. Denkt keiner an das Ende des vorigen Krieges?
Tami Oelfken (dt. Schriftstellerin † 1957)
1
Herbert Stengele lacht bitter. Die Untertöne klingen grell, er ist verzweifelt. Es ist ihm zum Kotzen zumute, er versteht die Welt nicht mehr. Er wollte immer nur ein Erfinder sein, nicht mehr; zugegeben, ein genialer Erfinder. Er wollte die Unendlichkeit des Weltalls erforschen, er wollte einen kleinen, aber wesentlichen Stein zur Lösung des Weltall-Puzzles hinzufügen. Doch jetzt dämmert ihm, dass er einen ganz anderen Weg gegangen ist. Er hat mit seiner Erfindung ein Fass geöffnet, das nun überschäumt. Plötzlich ist er im Visier sämtlicher Geheimdienste dieser Welt.
Sein Herz rast. Er greift mit der rechten Hand an seine linke Brust und massiert sie kräftig, aber gemächlich, ganz betulich, als könne er seinen viel zu schnellen Herzrhythmus so verlangsamen. Er geht zum Fenster, reißt es auf, öffnet seinen Mund weit und schnappt gierig nach frischer Luft. Er zieht den kühlen Sauerstoff tief ein, dann überfällt ihn eine Angst, fast Panik. Er hört ein Rascheln in einem Busch vor seinem Reihenhaus, er blickt ins Dunkel, schnell schließt er das Fenster wieder.
»Du wirst keine Ruhe mehr finden, bis deine Erfindung verkauft ist«, hatte ihn sein Kollege Matthias Kluge gewarnt, »deine Formel ist zu begehrt, sie kann – das wissen jetzt alle – den nächsten Krieg entscheiden.«
Stengele fühlt sich in einer Falle. Er sitzt in den Nesseln, will es aber nicht hören, doch Matthias ist in Rage und poltert weiter. »Chinesen, Russen, Amerikaner – die werden uns nicht zusehen, wie wir in unserem Trödelladen dein angebliches Teleskop-Patent verramschen. Die wissen, was Sache ist, sie alle werden uns den Arsch aufreißen«, hatte Matthias ihn angebrüllt und die Tür mit der Drohung zugeknallt: »Ihr wisst doch gar nicht, wen ihr da am Hals habt und zu was die imstande sind!«
Stengele geht eilig weg vom Fenster, zurück in den vermeintlich Schutz bietenden großen Wohnraum, bleibt vor seinem stählernen Schreibtisch stehen und blickt auf ein Modellteleskop. Es ist eine Abbildung des Hubble-Space-Teleskops, ein Teleskop, das die US-Regierung seit Jahren im Weltall kreisen lässt. Der Vorteil: Im All gibt es keine störenden Luftbewegungen, keine lästigen elektromagnetischen Wellenlängen und auch keine fremden Lichteinwirkungen auf das Teleskopauge. Deshalb schafft das Hubble-Teleskop Bilder, die die Welt noch nie gesehen hat.
»Pah«, entfährt es Herbert Stengele und er greift sich unkontrolliert in seine schwarze Mähne, die wirr von seinem kantigen Kopf absteht. Am liebsten hätte er das Modell zwischen seinen großen Pranken zermalmt und zum Fenster hinausgeworfen.
Dabei war er als junger Student ein glühender Anhänger des US-Astronomen Edwin Hubble, dem Vater des größten Teleskops der Welt. Doch das war lange her. Denn kaum hatte er sich mit dem Teleskop während seines Studiums an der Uni in Stuttgart beschäftigt, hatte er bald erkannt, dass das Hubble-Teleskop längst nicht so optimal ist, wie es die Amerikaner angeben.
In dem größten Teleskop der Welt sind verschiedene Spiegel miteinander verbunden, um eine einzige, riesige Spiegelfläche zu schaffen. Aber die Übergänge der großen Glasplatten zu einem Ganzen sind problematisch. Von Beginn an war die Fläche begrenzt, größer ging nicht, oder es hätte keine spiegelglatte Einheit mehr geboten.
Herbert Stengele lacht erneut auf. Jetzt noch greller und lauter als zuvor, aber auch freudiger. Er scheint selbst darüber erschrocken und hält seine auffallend großen Hände vor seinen breiten Mund. Er richtet sich stolz auf und blickt zufrieden auf ein weiteres, bedeutend großflächigeres Teleskopmodell, das neben dem Hubble-Modell steht, hinunter. Es zeigt in einer geöffneten Kugel einen übergroßen, leicht nach innen gewölbten Spiegel, wie eine riesige Schüssel. Stengeles schwarze Augen flackern unruhig hinter seinen dicken Brillengläsern. Er blickt konzentriert auf die große Spiegelfläche und sieht mit Stolz seine rechteckigen, ineinander verzahnten Glasplatten. Der gesamte Spiegel starrt aus der geöffneten Kugel wie ein einziges gewölbtes, überdimensionales Auge – und vor allem, auch bei näherem Betrachten, zeigen die einzelnen Waben keine unterbrochenen Flächen, sondern gehen nahtlos ineinander über.
Ich hab dich berechnet, ich kann dich unendlich groß schaffen, schießen die Gedanken des Erfinders, bei seinem Blick auf den Spiegel, durch seinen Kopf. Er kniet nieder, um sein Werk auf Augenhöhe zu betrachten. Erneut flackern seine schwarzen Pupillen lebhaft hin und her. Es ist das Modell eines mehr als 20 Meter großen Teleskops, wie es die Welt noch nie gesehen hat.
»Es ist alles nur eine Frage des Schliffs«, weiß er heute. Der Teleskopspiegel in der geöffneten Kugel setzt sich aus vielen kleinen, gewölbten, achteckigen Augen zu einem einzigen, überdimensionalen Insektenauge zusammen. Die Aneinanderreihung der Achtecke war bisher für alle Wissenschaftler das Problem. Doch jetzt, mit seiner Formel des genialen Schliffs der Gläser über die Zentralachse, ist jeder Übergang leicht und überaus glatt zu polieren. Für ihn ist klar: Jetzt erst, mit seiner Erfindung, ist das Hubble-Teleskop geschlagen.
»Du kannst ja darauf malen lassen: ›Nur zur friedlichen Nutzung verwendbar‹«, hatte Matthias ihn ausgelacht, als er ihm gegenüber die Möglichkeiten eingeräumt hatte, dass man mit diesem überdimensionierten Teleskopspiegel, als Laserwaffe verwendet, eine hochgradige zielgenaue Energie abfeuern kann. Den Krieg der Sterne wird gewinnen, wer diese Formel besitzt, das war auch ihm klar geworden.
Im zivilen Bereich könnte man mit dieser geballten Energiemenge aber auch leicht durch riesige Bergmassive Löcher schießen, dass sie danach aussehen würden wie Schweizer Käse. »Denk mal, wie problemlos man damit einen Tunnel durch das riesige Aral-Massiv schießen könnte«, hatte Stengele versucht, gegen Kluge zu argumentieren.
»Wenn die Chinesen einen Tunnel wollen, lassen die ihn von unzähligen gelben Männchen buddeln«, hatte dieser gelacht, »was willst du eigentlich? Einen Platz im Himmel oder endlich deine Erfindung verkaufen und zu guter Letzt allen zeigen, was du wirklich drauf hast?« Matthias war während des Gesprächs gereizt und erbost: »Du spielst hier den Heiligen, während ich den Arsch hinhalte. Verstehst du denn nicht? Seit ihr die Scheiße als Patent angemeldet habt, ist das alles öffentlich! Ich habe keine Ruhe mehr. Jeden kleinen Wirtschaftsspion habt ihr aufgescheucht, von den Geheimdiensten gar nicht zu reden.« Matthias Kluge wurde immer lauter, während Herbert Stengele kein Wort mehr sagte.
»Glaub mir, ich würde gern verhandeln, aber das tun diese Leute nicht. Die feilschen nicht lange rum wie auf einem Basar für einen Berber-Teppich. Wir haben eine Topwaffe unter der Ladentheke, die Herren fühlen sich von ihr bedroht, und ich bin nun mal in den Augen dieser Affen der Ladenbesitzer.«
»Und ich bin der Erfinder!«, sagt Herbert Stengele trotzig vor sich hin, winkt mit der rechten Hand energisch ab und beendet damit seine Erinnerungen an das Streitgespräch mit seinem Kollegen.
Bisher hatte sich immer alles nur um ihn gedreht. Matthias gilt für alle als die Spitzenkraft in ihrem kleinen Unternehmen Defensive-Systems, er ist der Vertriebschef, Starverkäufer und Sonnyboy. Doch jetzt ist Schluss damit, jetzt ist er, Herbert Stengele, dran. Er hat die Sensation geschaffen, er hat den stärksten Spiegel der Welt erfunden! Pah, verkaufen kann er diese Erfindung auch allein.
Jahrelang hatte er daran getüftelt, jetzt, noch keine 50 Jahre alt, will er seinen eigenen Erfolg ernten. Nein, er wird sich nicht beiseite schieben lassen. Nein, jetzt will er das Geschäft machen. Er, und dieses Mal nicht sein Freund Matthias Kluge.
Dr. Matthias Kluge. Ja, der Titel ist dem Mann wichtig, zu mehr hat er es auch nicht gebracht, denkt Herbert Stengele, dieser wissenschaftliche Knilch!
Matthias war während des Physikstudiums sein Kommilitone in Stuttgart. Er war ein glänzender Musterstudent, aber nur nach außen. In Wirklichkeit ist er ein Blender, weiß Herbert Stengele, dagegen war er schon immer der geniale Kopf.
Die Professoren allerdings sind Matthias auf den Leim gegangen. Er hatte sich glänzend verkauft, das Diplom mit summa cum laude abgeschlossen und anschließend auch noch promoviert. Während er, Herbert Stengele, sich langsam durch die Semester quälte und immer allein zu Hause in seinem Kämmerlein Teleskopspiegelflächen berechnete.
Aber jetzt, jetzt fordert er endlich Genugtuung für all die Jahre, in denen er verkannt wurde. Jetzt will er endlich das Geld, das ihm zusteht. Er will sein Werk verkaufen. Vielleicht braucht er Kluge noch, aber nur vielleicht, spricht sich Herbert Stengele Mut zu: »Diese Erfindung bedarf keines Schwätzers!«, brummelt er selbstsicher vor sich hin.
Mit entschlossenem Schritt geht er um seinen großen Schreibtisch herum, öffnet die obere Schublade und nimmt eine SIG Sauer Pistole heraus. Ein Nachbau des Klassikers von Dynamit Nobel. Er weiß, dass er in Gefahr ist. Seine Erfindung ist gefragt, sogar von zwielichtigen Gestalten. Aus seiner Erfindung wurde über Nacht ein sogenanntes ›Dual-use-Gut‹. Verwendbar in zivilen Bereichen wie im Krieg.
»Verdammt, das war nie und nimmer mein Ziel. Ich bin doch kein Rüstungsspekulant!«, wehrt Stengele sich gegen die neuen Erkenntnisse, die ihm die Erfüllung seines Traums, neue Planeten zu entdecken, zerstören könnten.
Aber gleichzeitig steigt seine Erregung. Seine Tüftelei, von vielen jahrelang verspottet, ist auf einmal die Begierde vieler Staaten. Mit der Bedeutung dieser Erfindung steigt sein Marktwert als Wissenschaftler. Bisher fühlte er sich nicht ernst genommen von seinen Kollegen. Nur weil er das Studium nicht beendet hatte, hatte er immer das Gefühl, sie würden ihn nicht anerkennen. Doch das wird sich bald radikal ändern, freut sich Stengele.
Dabei streichelt, fast schon zärtlich, seine linke Hand die kalte Sauer Pistole, die er noch immer in der Rechten hält. Er hatte nicht umsonst den Nachbau von Dynamit Nobel gekauft. Vielleicht erging es ihm wie dem Gründer der Dynamit Nobel AG, Alfred Nobel. Auch er wollte in erster Linie nur den Menschen in den Bergwerken unter Tage eine Erleichterung verschaffen. Er wollte einen sicheren Sprengstoff entwickeln und wurde bald zum größten Munitionsproduzenten im Deutschen Reich. »Und zu einem der reichsten«, lacht Stengele selbstzufrieden in sich hinein.
Oder freut er sich zu früh? Wieder steigt in ihm diese Angst auf. Matthias hatte ihm die Probleme beim Verkauf seines Patents dargelegt, er hatte ihm zum Kauf der Pistole geraten. »Es ist heiß, zu heiß«, hatte er beschwörend auf ihn eingeredet, »wir sitzen auf deiner Erfindung wie auf einer glühenden Herdplatte.«
Herbert Stengele wird es erneut speiübel. Er wollte ja nur ein Riesenteleskop schaffen, the great eye. Jetzt hat er es berechnet, das Patent ist angemeldet, die ersten Interessenten haben angefragt. Wo liegt, verdammt noch mal, eigentlich das Problem?
Übertreibt Matthias mal wieder hemmungslos? Kann er ihm überhaupt noch vertrauen? Nach all seinen bisherigen Erfahrungen mit seinem alten Kommilitonen wittert Herbert Stengele eine Falle. Matthias geht über Leichen, wenn es ihm zum Vorteil gereicht. Doch bisher brauchten sie sich gegenseitig. Herbert ist der Erfinder, Matthias der Verkäufer. So hatten sie gemeinsam den kleinen Laden Defensive-Systems, bei Immenstaad am Bodensee, von Gunther Schwanke, hochgebracht.
Kluge hatte dabei richtig gut verdient, auch Schwanke wurde reich, und endlich bin ich an der Reihe, schwört sich Herbert Stengele.
Er geht zu seinem CD-Player und schiebt eine Klassik-CD ein: ›Verleih uns Frieden‹ von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Stengele legt sich in seinen großen Ohrensessel, verschließt die Augen und will nur noch das Kammerorchester hören. Das ganze Leben kommt ihm meist wie das gesamte Leiden Christi vor. Allein in der Musik, da findet Stengele Erlösung. Er hört die ersten Klänge, sieht ein tiefes Universum vor sich. Sterne, Planeten und das unendliche, geheimnisvolle All.
2
Die Leiche ist durch die schwarz-weiß-Zeichnung des Okulars kaum zu erkennen. Im Sucher der TV-Kamera schimmern nur Grautöne. Dabei lässt die Morgensonne das blaue Wasser des Sees, am romantischen Friedrichshafener Seeufer des Seemooser-Horns, golden glitzern. Im Gegenlicht tanzen die Sonnenstrahlen ein Morgenballett über die leicht gekräuselten Wellen. Im Sucher zeichnen sich klar und deutlich die Kanten der Schienen der Slipanlage des württembergischen Jachtklubs ab.
Doch was ist das?, fragt sich der junge Kameramann ungläubig und streicht sich eine Haarsträhne aus seinem Gesicht. Simon Class presst erneut sein rechtes Auge fest auf das Okular. Mit den Händen wehrt er störende Sonnenstrahlen vor dem Objektiv ab. Er stiert durch seinen Sucher und sieht deutlich einen Gegenstand unter den Schienen, der aussieht wie der Oberkörper eines Menschen.
Der junge Kameramann des Fernsehteams winkt aufgeregt seinen Redakteur, Leon Dold, zu sich: »Drehen wir einen Dokumentarfilm oder einen Tatort?«, lacht er unbedarft, »das musst du gesehen haben, sieht aus, als läge da ein Toter im Wasser.«
Leon Dold stöhnt. Er hat am frühen Morgen keine Lust auf die Scherze seiner ausgeschlafenen Kollegen. Es ist kurz vor neun, für ihn noch immer mitten in der Nacht. Der Kameramann soll gefälligst die paar Schnittbilder zügig drehen, die er benötigt, denn der Drehplan für den heutigen Tag ist proppenvoll, schnaubt Leon in seinen nicht vorhandenen Bart.
Vor allem nervt ihn dieser Tonmann, der zu jedem einfachen Schnittbild einen passenden Originalton einfangen will, als sei er hinter dem Ton-Grammy-Award her. Gerade streckt er einem Entenpaar, das friedlich auf den leichten Wellen des Sees döst, den Puschel seines Richtmikrofons unter den Schnabel, als wolle er die beiden interviewen. Doch bevor der Mann seine Tonangel in Position bringt, hat sich das Entenpaar auch schon laut schnatternd davongemacht.
Leon bläst hörbar genervt die Luft aus seinen aufgeblähten Wangen, lässt sich des lieben Friedens willen auf die Aufforderung seines Kameramanns ein und beugt sich zum Okular der Kamera, um hindurchzuschauen. »Bleib einfach totaler, dann sieht man da nichts und mach fertig«, rät er seinem Teamkollegen, »zwei Schnittbilder von der alten Slipanlage und gut ist«, weist er ihn mürrisch zurecht.
Doch er selbst fährt, kaum hat er das Sucherbild vor seinem rechten Auge, den Zoom in den extremen Telebereich. Gespannt schwenkt er die Kameralinse über die Slipanlage. Im Fokus hat er die alten Eisenschienen, über die Claude Dornier schon vor rund hundert Jahren seine berühmt gewordenen Wasserflugzeuge in den Bodensee setzte. Hier am Seemooser-Horn in Friedrichshafen kann Leon noch heute sichtbare Reste der einstigen Gründung der Dornier-Werke zeigen, die heute als Startblock des Weltunternehmens und Rüstungskonzerns EADS gelten.
Das ist der Auftrag, den Leon Dold hat. Er soll in einer halbstündigen Fernsehdokumentation den Aufstieg des legendären Luftfahrtpioniers Claude Dornier zum Rüstungsunternehmer darstellen. Von den Anfängen des jungen Ingenieurs, als Adjutant des legendären Grafen Zeppelin, bis zu dem heutigen Konzerngeflecht der EADS mit Beteiligung des Daimler-Konzerns.
Allerdings scheint ihm da etwas anderes vor die Linse geschwommen zu sein. Ohne Zweifel ein Körper, der einem Menschen verdammt ähnelt. Es scheint, als ob der Oberkörper eingeklemmt wäre, genau an dem Punkt, an dem die alten Eisenschienen in das Wasser eintauchen.
»Sakradi«, nuschelt Leon undeutlich und läuft sofort los. Was er entdeckt hat, sieht zu deutlich nach einem Menschen aus. Es sind keine hundert Meter von seinem Standort bis zu der fraglichen Stelle. Und je näher Leon der Slipanlage kommt, umso deutlicher werden die Umrisse. Schnell wird ihm klar: Da schwimmt tatsächlich ein Mensch. Der Körper wird festgehalten von dem gleichmäßigen Druck der zum Ufer strömenden Wellen und zwei Dolmen, die die Eisenstränge der Slipanlage stützen.
Leon überlegt nicht mehr, er läuft immer schneller, läuft einfach weiter, watet, ohne zu zögern, durch das Wasser und bleibt direkt vor dem Fund stehen. Jetzt sieht er deutlich: Vor ihm schwimmt eine Leiche mit dem Gesicht nach unten. Im Hinterkopf klafft ein aufgerissenes, großes Loch. Leon hat so etwas noch nie gesehen, aber dass dieses Loch ein Einschuss ist, ist auch für ihn offensichtlich. Exakt in der Mitte des Schädels ist die Kugel in den Hinterkopf eingedrungen. Die Entfernung des Lochs zum Scheitel wie auch zum Kragen dürfte auf den Zentimeter identisch sein, ebenso die akkurate Koordinate zwischen den beiden Ohren.
Der Anzug und die Körperstatur verraten Leon, dass es sich um eine männliche Leiche handelt.
Irritiert schaut er sich um. Soll er den toten Körper drehen, ihn aus dem Wasser ziehen? Klar ist, dass jede Hilfe zu spät kommt, der Tote muss allem Anschein nach schon länger im Wasser liegen.
Er muss ein gutes Leben gehabt haben, denkt Leon unwillkürlich und mustert die Ausstattung der Leiche: Der edle, grau melierte Anzug beweist trotz der Nässe gute Qualität, die Jacke zeigt auch im Wasser noch Form. Am linken Armgelenk zieht, unbeirrt der schwappenden Wellen, der Sekundenzeiger einer Rolex seine Runden. Zwischen Kopf und rechtem Arm schwimmt die Schärpe einer Seidenkrawatte.
Der Tote liegt vor Leon wie ein ungeübter Brustschwimmer, Oberkörper und Kopf ragen zu einem Viertel aus dem Wasser, seine Beine sind unter Wasser.
Das Gesicht ist nicht zu erkennen, kopfunter ragt nur der Hinterkopf aus dem See. Das Wasser hat seine Schusswunde im Schädel längst ausgespült, Blut ist lediglich auf seinem weißen Hemdkragen im Nacken und dem grauen Jackett zu sehen.
Leons Neugierde ist geweckt. Er greift aufgeregt nach der Leiche, berührt sie, zieht den Leichnam unter den Schienen hervor und dreht ihn um. Er will ihm ins Gesicht sehen, so als ob er ihn kennen könnte. Beim Anblick muss er sich fast übergeben. Die Kugel ist durch den Schädel des Toten gedrungen und im Stirnbereich wieder ausgetreten.
Er wendet sich zuerst ab, kann sich dennoch nicht ganz davon lösen. Das Gesicht der Leiche ist aufgedunsen, die Nasenlöcher sind extrem gedehnt, die Pupillen starren weit, direkt in Leons Augen. Der breite, viereckige Schädel wirkt schwabbelig aufgequollen und dadurch so quadratisch, wie er im Leben wohl nie ausgesehen hat. Ein buschiger, schwarzer Oberlippenbart ist ausgefranst, die Lippen sind geschwollen.
Auf Brusthöhe des Toten funkelt eine überproportionierte, goldene Krawattennadel. Sie gleicht der legendären Apollo-Kapsel der ersten US-Raumfahrer. Leon erinnert die Nadel auch an Satelliten, mit denen er gerade bei Dornier zu tun hat. Auf der kleinen Satellitenkapsel prangen in Gold die zwei Buchstaben ›DS‹.
»Was isch mit dem?«, ruft Simon, der Kameramann, in breitem Schwäbisch.
»Nichts mehr«, antwortet Leon leise und ruft laut: »Los, bring die Kamera her, wir drehen schnell einige Bilder von ihm.« Leon wird plötzlich klar, dass er die Bilder exklusiv haben wird. Weit und breit ist noch kein Segler des Jachtklubs zu sehen und schon gar kein Journalistenkollege.
»Komm schon«, treibt Leon seinen Kameramann an und sieht, wie der Tonmann sein Richtmikrofon in Position bringt. »Von dem bekommst nicht mal mehr du einen Pups zu hören«, wimmelt er ihn ab schultert die Kamera selbst, steigt noch tiefer ins Wasser und geht um den Toten herum. Dabei dreht er hemmungslos die Leiche, eine Totale, eine Große, einmal mit Verbindung zum Ufer und einmal im grellen Gegenlicht der Morgensonne. Das Gesicht wird so zur bizarren Fratze.
»Wir müssen die Polizei rufen«, drängt Simon.
»Das kommt jetzt auf ein paar Minuten früher oder später auch nicht mehr an«, beruhigt Leon sein Team, reicht Simon die Kamera zurück und beginnt, die Taschen des Toten zu durchwühlen, als würde er die polizeiliche Untersuchung durchführen. Simon ruft entgeistert: »Was machsch? Lass des, des darfsch it.«
»Das weicht doch sonst alles nur auf«, rechtfertigt Leon seine Neugierde.
»Wir müssen die Polizei rufen«, blafft nun auch der Tonmann ungeduldig.
»Wenn ich hier fertig bin«, beruhigt Leon sein Team, während er die Brieftasche des Toten durchstöbert.
Leon Dold ist Journalist durch und durch. Er weiß, was er jetzt in Erfahrung bringt, wird ihm nach dem Eintreffen der Polizei verwehrt sein. Zwar ist der Tote nicht sein Auftrag, aber was er auf die Schnelle nebenbei an Informationen bekommen kann, nimmt er als Journalist sicherheitshalber immer mit. Sollte sich nichts Sensationelles finden, dann werden ihn die weiteren polizeilichen Untersuchungen nichts mehr angehen, denn ein Mord ist auch, selbst wenn er am idyllischen Bodensee geschieht, keine Weltsensation. Und für regionale Polizeigeschichten ist die hiesige Redaktion vor Ort, in Friedrichshafen, zuständig. Ihr wird er nachher die Bilder übergeben und schleunigst versuchen, seinem eigenen Job nachzugehen.
Denn ›Claude Dornier – ein Leben für die Luftfahrt‹ heißt seine halbstündige Dokumentation, die er möglichst schnell abzudrehen hat. Verdammt, da bleibt für irgend so eine Leiche keine Zeit, überhaupt, er hat ein randvolles Drehbuch für den heutigen Tag in der Tasche. Am besten, er vergisst den Toten schnell und überlässt alles Weitere tatsächlich der Polizei und den Kollegen des aktuellen Teams.
Ratlos zieht er seine Achseln hoch und lässt sie ebenso hilflos wieder fallen. »Scheiße, das war’s wohl für heute Morgen«, erkennt er resigniert. Das Pensum seines geplanten Drehtages ist nicht mehr zu schaffen und jetzt muss er auch noch warten, bis die Polizei eintrudelt.
In der Hand hält Leon noch immer die Brieftasche des Toten. Er zieht ein Bündel nasser Geldscheine heraus und eine Kreditkarte: ›Dr. Matthias Kluge‹.
»Na und?«, denkt Leon Dold, »kenn ich nicht.«
3
Die schwere Limousine bahnt sich zeitraubend einen Weg durch das bunte Treiben von Menschen. Hinter dem Steuer sitzt ein Asiate, der nur mühsam über sein teures Mahagonilenkrad blicken kann. Seine kleinen Finger betätigen ununterbrochen die laute Hupe. Doch die Menschen auf der Straße scheinen ihn nicht hören zu wollen. Sie treten beschwerlich in die Pedale ihrer alten Stahlrösser, die zum Teil beladen sind wie Packesel der Schweizer Bergarmee. Dazu knattern um den weißen 500er Mercedes unzählige kleine Mopeds. Auf manchen der Zweiräder halten sich gleich mehrere Personen aneinander fest, oft die gesamte Familie auf einer einzigen schmalen Mopedbank, die ursprünglich für nur zwei Personen gebaut wurde.
Alle Fahrer, ob auf dem Rad, dem Moped oder im Auto, jagen in jede Lücke der vollgestopften Straße, als würden sie während eines Grand-Prix-Rennens um die Poleposition kämpfen. Gegen den selbst ausstoßenden Smog und Gestank haben sich die Hunderte von Moped- und Radfahrern ein weißes Tuch vor Nase und Mund gebunden. Sie sehen aus wie eine OP-Brigade vor dem Eingriff. Den noblen, hupenden Mercedes beachten sie kaum. Jeder ist nur bemüht, dass er unbeschadet und schnell vorwärtskommt.
Björn Otto kennt dieses wuselige Bild. Er sitzt im Fond seines klimatisierten Daimlers und blättert in der ›Berliner Zeitung‹, die ihn aber eigentlich auch schon längst nicht mehr interessiert. Seit zehn Jahren wohnt er in diesem Sieben-Millionen-Moloch von Ho-Chi-Minh-Stadt, im Süden Vietnams, und da wird er so schnell auch kaum wegkommen. Die Geschäfte laufen zu gut, ein Ende ist nicht abzusehen.
Nicht nur zu Hause, im fernen Deutschland, zählt sein Unternehmen DigDat zu den günstigsten Datenverarbeitern. Längst hat sich sein Angebot weltweit herumgesprochen. So günstig wie DigDat mit seinen hundert Vietnamesen Daten speichert, verarbeitet und vor allem, wenn es sein muss, auch mal abgleicht, so günstig ist weltweit kein zweiter, und schon gar nicht so diskret. Längst kennen selbst die Inder ihren Marktwert, auch die Thailänder, jetzt sind die Vietnamesen in der untersten Lohnstufe obenauf. Für keine 100 Euro im Monat arbeiten sie 30 Tage fast rund um die Uhr.
Björn Otto hat die kostengünstigste Lösung im offiziell sozialistischen Vietnam für die kapitalistische Welt gefunden. Er war schon in Vietnam, als die Mauer in Berlin noch stand. Damals war er im Auftrag des APN, des ›Außenpolitischen Nachrichtendienstes‹ der DDR, zum Wohle der Völkerfreundschaft unterwegs.
Heute ist er Computerspezialist. Schon bevor die meisten Menschen wussten, was digitale Datenspeicherung heißt, hat er sich im Auftrag des MfS in Berlin um Datensammlung im großen Stil gekümmert. Genauer: Er war einer der aufstrebenden, jungen Offiziere des SWT, des ›Sektors wissenschaftlich technische Aufklärung‹. Diese Abteilung war der Hauptverwaltung Aufklärung unterstellt, zählte aber mit der zunehmenden Digitalisierung immer mehr zum wichtigsten Standbein des DDR Ministeriums für Staatssicherheit.
Björn Otto hatte seine Affinität zur Computerwelt frühzeitig genutzt. Er war noch ein kleiner Mitarbeiter der Stasi, als die ersten IBM Computer in die DDR gebracht worden waren und in Karl-Marx-Stadt im Kombinat Robotron zerlegt wurden. Schnell war den verantwortlichen Offizieren klar, dass diese Teufelsgeräte in der DDR produziert werden mussten, wollte man den Anschluss an die Weltentwicklung nicht verpassen.
Doch Björn Otto interessierte etwas ganz anderes. Er war sich schnell bewusst darüber, dass diese Geräte die Informationsflut des MfS kontrollieren konnten. Ihm war gleichgültig, woher die Geräte kamen, das gigantische Potenzial, das auf den Festplatten gehortet werden konnte, war ihm viel wichtiger. Wer auf ihnen gespeichert war, der ließ sich vortrefflich verwalten und überwachen.
Björn Otto schmunzelt und legt die ›Berliner Zeitung‹ neben sich. Gerade hat er die Überschrift ›Datenskandal bei Telekom‹ gelesen. Oft genug hatte er in Deutschland gepredigt, die Firmen sollten alle ihre Daten in Vietnam speichern und hier in seinen Servern bearbeiten lassen. Schon allein dieses Unwort amüsiert ihn: ›Datenskandal!‹ – Solch einen Begriff gibt es in Vietnam nicht. Denn wo es keine Gesetze gibt, gibt es auch keinen Skandal. Hier am Saigon River ist die Welt noch einfach gestrickt.
Er hatte schnell erfahren, dass nach dem Zusammenbruch der DDR sein Know-how auch im Westen gefragt war. Was die Stasi, dank den Abschnittsbevollmächtigten, an Informationen über jeden einzelnen Bürger sammelte, will im Westen auch jeder Kaufmann an der Ecke wissen: Welche Zigarettenmarke raucht Herr Müller, welchen Sekt bevorzugt Frau Maier oder benötigt Familie Huber nicht bald einen neuen Fernseher? Abgesehen davon, ob Herr Müller und Frau Maier nicht doch …?
Björn Otto war schon während seiner Tätigkeit bei der Stasi klar geworden, dass alle diese Informationen von Bedeutung sind. Nicht nur für den Staat, sondern heute, im kapitalistischen Westen, für Kaufhäuser, Banken und vor allem Versicherungen. Er musste nach der Wende nicht lange für seine Fähigkeiten werben. Großunternehmen erkannten ihre Chance und griffen auf das Fachpersonal des MfS der DDR zurück. Björn Otto hatte Erfahrungen im Sammeln von Daten und vor allem bei deren Auswertung.
Und nichts weiter war bei der Telekom geschehen. Schließlich will man doch wissen, wen man beschäftigt?, denkt Björn Otto. Warum nur diese Aufregung? Das ist schließlich das tägliche Brot seines Unternehmens DigDat.
»Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt …« Chorgesang und ein voll besetztes Symphonieorchester lässt plötzlich die alte DDR-Hymne im Fond des noblen Daimlers erklingen. Björn Otto zieht sein Handy aus der Jackentasche, blickt auf die Uhrzeit und betätigt die Freisprechanlage. »Du solltest um diese Zeit im Bett sein«, lacht er laut, »du weißt doch, wir erledigen hier eure Arbeit und stehen deshalb früher auf. Also, leg du dich wieder hin.«
»Ich werde mich gleich hinlegen, habe gerade auch schon genügend auf unseren Erfolg getrunken, aber das muss ich dir noch schnell mitteilen: Wir haben’s!« Die Stimme des Anrufers klingt jung, fröhlich und hell, der Mann scheint aufgekratzt und lässt die Katze schnell aus dem Sack: »Wir werden die Daten der ›Exklusiv Krankenkasse‹ übernehmen, wir werden über unsere Firma in Nürnberg den Auftrag erhalten und intern an euch weiterleiten.«
Björn Ottos Miene erhellt sich. Solche Neuigkeiten aus Deutschland gefallen ihm.
»Das Gesundheitsministerium hat vergangene Woche ausdrücklich erlaubt, dass Krankenkassen ihre Daten an externe EDV-Dienstleister zu Verarbeitung weiterleiten dürfen, das war der Durchbruch!«
Dank ihrer zielgerichteten Lobbyarbeit in Berlin haben Björn Otto und seine ehemaligen Stasikollegen die wichtigsten Entscheidungsträger in den BRD-Ministerien überzeugt. Datenverarbeitung muss zur Sicherung der Arbeitsplätze in erster Linie Unternehmen entlasten. Und wo bitte ist denn das Problem? Krankenkassen sind nun mal keine Datenverarbeitungsspezialisten.
Sein Erfolgsrezept ist einfach. In Deutschland ist offiziell der Sitz seiner Datenverarbeitungsfirma. In Nürnberg sitzt der Vertrieb, der die Aufträge ködert. Dadurch wird dem Kunden ein seriöser Datenschutz, streng nach deutschen Gesetzen, vorgegaukelt. Aber was denken sich denn die Kunden?
Um die bestechend günstigen Preise in Deutschland zu bieten, werden die Daten dort weder verarbeitet noch verwaltet, das schaffen nur billige Arbeitskräfte im Fernen Osten.
Björn Otto blickt nochmals auf dieses Unwort ›Datenskandal‹ und lacht dann aus vollem Hals: »Frag doch mal bei der Telekom an, ob wir denen nicht auch helfen können.«
»Wir sind schon in Verhandlungen«, antwortet die aufgekratzte Stimme vergnügt, »nur im Augenblick will die Telekom erst mal ein bisschen Ruhe, aber wir haben ihnen die Vorteile auf den Tisch gelegt.«
Längst lassen die meisten europäischen Großfirmen ihre Daten bei DigDat in Vietnam bearbeiten. Die Übertragung der Daten aus jedem Winkel Europas nach Ho-Chi-Minh-Stadt dauert den Bruchteil einer Sekunde. Oft werden im teuren Europa Informationen nur noch hingeschrieben, Aufnahmeformulare für Kundenkarten einfach per Hand ausgefüllt, dann werden die Papiere eingescannt und im billigen Vietnam erst aufwendig in die Systeme eingegeben und verwaltet. So ruhen in den Servern von DigDat unzählige Namen vor allem deutscher Bürger, ihre Geburtsdaten, Bankverbindungen, Einkaufsverhalten, Schuldenstand und jetzt auch noch ihre Krankheitsbilder. Für Björn Otto als ehemaliger Stasischnüffler geradezu paradiesische Zustände, die er auch zu nutzen weiß.
Der Mercedes biegt aus der Nguyen-Huri-Cáhn-Straße über die Saigonbridge in die Xa-lo-Ha-Noi-Straße ein. Jetzt kann der Chauffeur endlich das Gaspedal durchtreten. Die alte Hauptstraße in Richtung Hanoi im Norden ist frei und breit. Der kleine Asiate lenkt den Wagen am Saigon River entlang in den nordöstlichen Teil des Ho-Chi-Minh-Bezirks.
Nach etwa 20 Minuten verlangsamt er seine Fahrt. Inmitten trostloser Häuserfassaden liegt eine grüne Oase. Eine hohe Mauer umzäunt das Anwesen. Dahinter hat Björn Otto mit einer Investmentgroup seine Firma DigDat hingestellt. Er hat alte Hütten abreißen lassen und einen Gewerbepark angelegt, wie sie zu Hause rund um Berlin, Leipzig oder Dresden nach der Wende aus dem Boden schossen. Er hat verschiedene Bürogebäude hochgezogen, einige an europäische Firmen vermietet, allein für sein Unternehmen DigDat hat er ein gläsernes Gebäude für über 500 Arbeiter errichtet. Björn Otto gehört zu den Vorzeigeunternehmern des sehr unsozialistischen Staates Vietnam mit real–kapitalistischen Strukturen.
Für einen Unternehmer mit der Vergangenheit Björn Ottos ist Vietnam ein ideales Terrain. Er kennt sich aus mit kommunistischen Funktionären und weiß, wie der ehemalige Klassenfeind tickt. Die Kapitalisten hatte er dank intensiver Marx-Schulungen schnell durchschaut, und noch schneller wurde er einer von ihnen.
Kaum ist er seinem Prestigewagen entstiegen und hat sich von einem Fahrstuhl in das 13. Stockwerk seines Büros hochhieven lassen, kommt ihm schon Phebe Delia entgegen. Sie ist seine zierliche, hellhäutige Vorzimmerdame und trägt, wie von ihm gewünscht, den für vietnamesische Frauen klassischen langen Rock Ao Dai. Sie hat es offensichtlich eilig, trotzdem senkt sie den Blick, kaum hat sie ihren Chef gesehen. Vor der großen, weißen Langnase hält sie kurz inne und macht mit ihrem Oberkörper eine tiefe Verbeugung.
Björn Otto lächelt selbstgefällig. Offensichtlich genießt er den Respekt, den ihm diese junge Frau entgegenbringt. Dann sieht er durch seine Goldrandbrille einen weißen Zettel, den sie in der rechten Hand hält. Da er nun schon vor ihr steht, entreißt er ihr das Stück Papier ungeduldig und liest: »Romeo und Julia beendet, Ödipus läuft.«
Phebe Delia weiß nicht, was das heißt, sie kann kein Deutsch, sie weiß jedoch, jede Meldung mit diesem Absender aus Deutschland will ihr Chef sofort sehen.
Er lächelt zunächst irritiert, gleich darauf erleichtert und zufrieden, während er die Meldung liest. Es ist seine Sprache, wenn er auch sonst von klassischer Literatur, oder gar von griechischen Sagen, keine Ahnung hat. Aber es ist die Sprache der Geheimdienste, diese verschlüsselte Botschaft versteht er. Zwar ist ihm die erste Meldung noch ein Rätsel, warum ›Romeo und Julia‹ beendet ist, aber wenn ›Ödipus‹ schon läuft, dann ist sein Mann beziehungsweise seine Frau vor Ort weiterhin am Ball.
4
Wer auf der Autobahn der A 8 von Stuttgart nach München rauscht, sieht auf der linken Seite, fast verborgen, kurz vor Augsburg, ein riesiges, fragiles Spinnengewebe aus Stahl und Draht. Form und Ausmaß erinnern an die Allianz-Arena, die aber erst in München zu sehen ist. Die Erbauer dieser Arena wollen allerdings auch gar nicht, dass man sich ihr Kunstwerk näher betrachtet. Im Gegenteil, viele Schilder warnen: Militärisches Sperrgebiet. Bereich der amerikanischen Streitkräfte. Fotografieren, Anfertigen von Notizen oder Zeichnungen verboten!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!