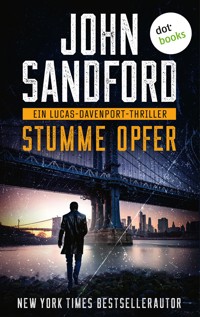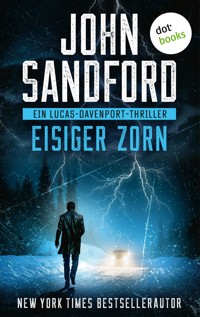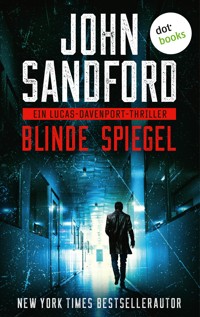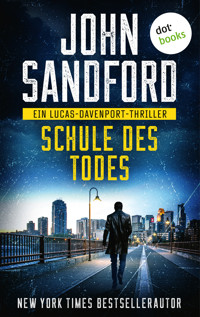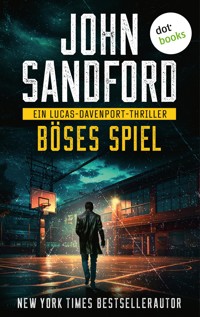
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
Er raubt Kinder, ohne mit der Wimper zu zucken: Der rasante Thriller »Böses Spiel« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Die Psychotherapeutin Andi Manette wird am helllichten Tag zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern entführt. Der Kidnapper ist einer ihrer ehemaligen Patienten – John Mail, ein gefährlicher Psychopath und skrupelloser Killer. Er nimmt Kontakt mit Lucas Davenport auf, um den Inspektor zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel herauszufordern: Es dauert nicht lange, bis Davenport erkennen muss, dass dieser Mann verdorbener und intelligenter ist als jeder andere Verbrecher, mit dem er bisher zu tun hatte. Obwohl er weiß, dass Mail mehr über Psychospielchen weiß als er selbst, lässt er sich auf seine Bedingungen ein – denn die Zeit der kleinen Familie läuft unerbittlich ab … »Action ohne Pause und eine Menge überzeugender Figuren machen dieses Buch zu einem der besten, das Sandford je geschrieben hat.« Kirkus Reviews Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Böses Spiel« von John Sandford – der spektakuläre siebte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Lee Child und Jussi Adler-Olsen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Psychotherapeutin Andi Manette wird am helllichten Tag zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern entführt. Der Kidnapper ist einer ihrer ehemaligen Patienten – John Mail, ein gefährlicher Psychopath und skrupelloser Killer. Er nimmt Kontakt mit Lucas Davenport auf, um den Inspektor zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel herauszufordern: Es dauert nicht lange, bis Davenport erkennen muss, dass dieser Mann verdorbener und intelligenter ist als jeder andere Verbrecher, mit dem er bisher zu tun hatte. Obwohl er weiß, dass Mail mehr über Psychospielchen weiß als er selbst, lässt er sich auf seine Bedingungen ein – denn die Zeit der kleinen Familie läuft unerbittlich ab…
»Action ohne Pause und eine Menge überzeugender Figuren machen dieses Buch zu einem der besten, das Sandford je geschrieben hat.« Kirkus Reviews
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: https://www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: https://www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: https://www.instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Mind Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Ana, mihail
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-187-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Böses Spiel« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Böses Spiel
Ein Lucas-Davenport-Thriller 7
Aus dem Amerikanischen von Marcel Bieger
dotbooks.
Kapitel 1
Der Sturm kam am späten Nachmittag auf, und kompakte graue Wolken jagten über den See dahin wie schmutzige und zusammengerollte Sportsocken, die aus einem Korb purzelten. Ein kühler Wind riß die Blätter von den Ulmen, Eichen und Ahornbäumen am Ufer. Die weißen Flammenblumen und Schwarzäugigen Susannen verbeugten davor tief ihre Köpfe.
Das Ende des Sommers nahte – viel zu früh.
John Mail lief über das Schwimmdock von Irv’s Bootswerft, und die Gerüche von Premix-Benzin, zum Trocknen aufgehängten Elritzen und Moos stiegen ihm in die Nase. Der Alte humpelte hinter ihm her und hatte die Hände tief in den Taschen seines abgewetzten Kittels vergraben. John Mail verstand nicht viel von altmodischen Motoren und ihren Bestandteilen wie Anlasser, Zündkerzen oder Vergaser. Er kannte sich weit besser mit Dioden, Widerständen und den Schwächen und Stärken von Chips aus. Doch in Minnesota saugen die Menschen die Bootskunde mit der Muttermilch auf. Es kostete ihn keine Mühe, eine 14-Fuß-Lund mit einem 9.9 Johnson Außenborder zu mieten. Bei Irv’s brauchte man dafür nur den Kapitänsbrief vorzulegen und einen 20-Dollar-Schein zu hinterlegen.
Mail stieg in das Boot, wischte mit einer Handfläche den Wasserfilm von der Sitzbank und ließ sich dann nieder. Irv hockte sich auf den Steg neben das Gefährt und erläuterte seinem Kunden, wie man den Motor startete und ausschaltete, wie man steuerte und wie man beschleunigte. Diese Nachhilfestunde nahm nur dreißig Sekunden in Anspruch, dann fuhr John Mail mitsamt seiner billigen Zebco-Angel und einer leeren roten Werkzeugkiste aus Plastik auf den Minnetonka-See hinaus.
»Seien Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück!« rief Irv ihm hinterher. Der weißhaarige Mann blieb auf dem Dock stehen und verfolgte noch eine Weile, wie das Boot davontuckerte.
Als Mail den Pier verließ, war der Himmel noch klar. Kein Lüftchen regte sich, und es roch nach Sommer. Nur im Westen schien sich etwas zusammenzubrauen. Da kommt etwas auf uns zu, dachte er, hinter den Bäumen lauert ein Unwetter. Aber das machte nichts. Es mußte ja nicht ausbrechen. Noch war nicht mehr als eine gewisse Unruhe festzustellen.
Er folgte der Küste drei Meilen weit nach Nordosten. Große, prächtige Häuser standen hier aufgereiht wie auf einer Perlenkette, jedes einzelne davon ein millionenschweres Gebilde aus Naturstein und Ziegeln, das von sorgfältig getrimmtem Rasen umgeben war, der bis hinunter zum Wasser reichte. Von professioneller Gärtnerhand gepflegte Blumenbeete klebten wie Briefmarken auf den Rasenstücken, und Wege aus imitierten Pflastersteinen wanden sich wie Schlangen zwischen ihnen hindurch. Steinerne Schwäne und Gipsenten paddelten über das Gras.
Vom Wasser aus wirkte alles anders. Mail fürchtete schon, er sei zu weit gefahren, denn er hatte das gesuchte Gebäude noch nicht entdeckt. Er hielt an, wendete und kreiste dann ein Stück weit. Schließlich erkannte er viel weiter im Norden, als er erwartet hatte, das sonderbar aussehende Turmhaus, das als Wahrzeichen dieses Uferabschnitts auf ragte. Und ein Stück weiter, ja, da stand es, das Haus aus Stein, Glas und Zedernholz. Da waren auch die roten Dachziegel und dahinter kaum sichtbar die Spitzen der Blautannen, die entlang der Straße wuchsen. Das Petunienbeet, patriotisch in den Landesfarben Rot, Blau und Weiß erblüht, leuchtete vom oberen Ende des Steinplattenwegs, der den Rasenhang hinaufführte. Und in der Bootsaufhängung neben dem Schwimmdock prunkte ein schnittiger Kreuzer.
Mail schaltete den Außenborder ab und ließ das Boot treiben. Der Sturm verbarg sich immer noch hinter den Bäumen, und der Wind legte sich. Er hockte sich auf die Bank, nahm die Angel, fädelte die Schnur durch die Halterungen und warf sie, ohne einen Köder oder einen Schwimmer daran zu befestigen, weit aus. Ein Spinnennetz aus Schnur legte sich auf die Wasseroberfläche, aber das machte nichts. Aus der Ferne sah er so aus, als würde er angeln.
Mail ließ die Schultern hängen und beobachtete heimlich das Haus. Nichts rührte sich dort. Nach einer Weile fing er an zu phantasieren.
Darin war er ziemlich gut, auf seine Weise sogar ein Spezialist. Es hatte in seinem Leben Zeiten gegeben, in denen man ihn zur Strafe eingesperrt und ihm weder Bücher noch Spiele noch Fernsehen erlaubt hatte. Als jemand, der an Klaustrophobie litt – sie wußten genau, welches Leiden er hatte, und es gehörte ja gerade zu ihrer Bestrafung, ihn in einen geschlossenen Raum einzusperren –, hatte Mail sich in seine Phantasie geflüchtet, um seinen Verstand nicht zu verlieren. Dann hockte er auf seinem Bett, drehte sich zur leeren Wand und ließ vor seinem geistigen Auge seine selbstgedrehten Filme ablaufen, in denen es sich meistens um Feuer und Sex drehte.
Andi Manette war in seinen ersten Gedankenstreifen die Hauptdarstellerin gewesen. In den späteren kam sie immer seltener vor, und in den letzten zwei Jahren hatte sie darin überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Fast hatte er sie schon vergessen gehabt. Doch dann waren die Anrufe gekommen, und mit ihnen war sie zurückgekehrt.
Andi Manette. Schon ihr Parfüm konnte Tote zum Leben erwecken. Sie besaß einen großen, schlanken Körper mit einer schmalen Taille und großen weißen Brüsten. Und wenn man sie von hinten sah und ihr dunkles Haar über ihren kleinen Ohren hochgesteckt war, wies sie eine wunderbar geschwungene Nackenlinie auf.
Mail starrte mit offenen Augen ins Wasser, während die Rute träge über das Dollbord hing, und sah zu, wie Andi in seinem Gedankenkino durch ein halbdunkles Zimmer auf ihn zukam und dabei ihr seidenes Nachthemd auszog. Er lächelte. Als er sie berührte, war ihre Haut warm, sanft und makellos. Er konnte sie unter seinen Fingerspitzen spüren. »Faß mich da an«, sagte er laut und mußte grinsen. »Tiefer, ja da«, stöhnte er dann.
Ein oder zwei Stunden hockte er so da, gab hin und wieder Worte oder halbe Sätze von sich, bis er schließlich laut seufzte und endlich aus seinem Tagtraum erwachte. Die Welt um ihn herum hatte sich verändert.
Der Himmel war mit einem zornigen Grau überzogen, und tiefliegende Wolken rollten über den See. Ein starker Wind war aufgekommen, brachte das Boot zum Schaukeln und wehte die Angelschnurschlingen wie Laub über das Wasser. Ungefähr in der Mitte des Sees konnte er bereits weiße Schaumkronen ausmachen.
Höchste Zeit zurückzukehren.
Als er sich umdrehte, um den Motor wieder anzuwerfen, erblickte er sie. Andi stand im Erkerfenster und trug ein weißes Kleid. Obwohl sie dreihundert Meter von ihm entfernt war, erkannte er ihre Figur und ihr einzigartiges, aufmerksames Schweigen wieder. Und er spürte ihren Blick. Andi Manette war telepathisch begabt. Sie konnte einem direkt ins Gehirn sehen und dort die Worte aufspüren, die man vor ihr verbergen wollte.
John Mail drehte das Gesicht zur Seite, um sich vor ihr zu schützen.
Sie durfte nicht erfahren, daß er wieder da war und sie holen wollte.
Andi Manette stand am Erkerfenster und verfolgte, wie der Regen über den See auf ihr Haus zukam. Und sie sah die Finsternis, die ihm folgte. Am unteren Ende des Hangs, kurz vor dem Ufer, tanzten die Blüten der langstieligen Flammenblumen im Wind. Sie würden das Wochenende nicht überleben. Ein Stück weiter auf dem See saß ein einsamer Angler in einem der orangefarbenen Leihboote, die man bei Irv’s bekam. Der Mann versuchte dort schon seit siebzehn Uhr sein Glück, und soweit sie sehen konnte, hatte er bislang noch nichts gefangen. Andi hätte ihm gleich sagen können, daß er hier wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Der Seegrund setzte sich an dieser Stelle aus dickem Schlamm zusammen, in dem nichts gedieh. Sie selbst hatte jedenfalls am Dock noch nie etwas an die Angel bekommen.
Während sie noch zusah, ließ er den Außenborder wieder an. Andi, die ihr ganzes Leben lang mit Booten zu tun gehabt hatte, erkannte gleich an den ungelenken Bewegungen des Mannes, daß er sich mit der Handhabung solcher Motoren nicht sonderlich auskannte – und vor allem nicht wußte, wie man sich hinsetzen mußte, um gleichzeitig an der Leine ziehen zu können.
Als er sich dabei kurz zu ihr umdrehte, spürte sie seinen Blick und sagte sich, daß sie ihn von irgendwoher kannte, auch wenn ihr das in diesem Moment mehr als unwahrscheinlich vorkam. Er war so weit von ihr entfernt, daß sie nicht einmal seine Gesichtszüge ausmachen konnte. Und dennoch – dieser Gesamteindruck von Kopf, Augen, Schultern und Bewegung schien ihr irgendwie vertraut...
Dann riß er wieder an der Schnur, und einen Moment später tuckerte er bereits entlang des Ufers zurück. Mit einer Hand hielt er seinen Hut auf dem Kopf, während die andere auf dem Ruder lag. Er hat mich überhaupt nicht gesehen, sagte Andi sich. Hinter ihm prasselte der Regen nieder.
Und sie dachte: Wolken ziehen auf, und die Blätter fallen von den Bäumen.
Der Sommer geht zu Ende.
Viel zu früh.
Andi entfernte sich vom Fenster, kehrte ins Wohnzimmer zurück und schaltete die Lampen ein. Der Raum war warm und mit Geschmack eingerichtet: eine schwere Ledergarnitur im Country-Stil, ein von Hand gefertigter Tisch, rustikale Lampen und Teppiche. Drüben die Ecke im Quäker-Stil, viel naturbelassenes Holz und organische Gewebe. Nichts hier wirkte aufdringlich, alles war hervorragend aufeinander abgestimmt: das Rot im Läufer harmonierte mit dem antiken Tisch aus Ahornholz, und der Blauton im Teppich entsprach dem des Himmels, den man durch das Erkerfenster sehen konnte.
Doch das Haus, das früher immer Wärme verbreitet hatte, verströmte jetzt Kälte, seit George nicht mehr da war.
Er hatte dem Haus seine Note aufgeprägt.
George, das war stete Bewegung, Intensität und Kräftemessen gewesen. Mit seiner direkten, oft aggressiven Art, seinem groben Gesicht und seinen intelligenten Augen hatte er ihr manchmal sogar ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben können. Und seitdem... nur Leere und Kälte.
Andi war eine schlanke, große Frau mit dunklem Haar, von der eine Würde ausging, die ihr gar nicht bewußt war. Auch wenn sie es nicht beabsichtigte, saß sie oft so da, als würde sie für eine Kamera oder einen Porträtisten posieren. Ihr Körper fiel von allein in die richtige Haltung, und sie hielt den Kopf stets so, als würde man eine Aufnahme von ihr machen. Ihre Frisur und ihre Perlenohrringe kündeten von Pferden, Segelyachten und Urlaub in Griechenland.
Andi konnte nichts dafür, daß sie einen solchen Eindruck erweckte. Und sie hatte auch nicht vor, etwas daran zu ändern, selbst wenn ihr das möglich gewesen wäre.
Das Licht der Lampen im Wohnzimmer sperrte das wachsende Halbdunkel aus, das von draußen kam. Andi lief über die Treppe nach oben, um dafür zu sorgen, daß ihre Töchter in die Gänge kamen. Schließlich war morgen der erste Schultag, und da galt es, die Kleider herauszulegen und darauf zu achten, daß die beiden rechtzeitig ins Bett kamen.
Oben angekommen, bog sie nach rechts ab und steuerte die Kinderzimmer an, als sie aus der entgegengesetzten Richtung die dünne und blechern klingende Musik eines schlechten Films vernahm.
Die Mädchen sahen im Elternschlafzimmer fern. Auf dem Weg dorthin hörte Andi, wie plötzlich der Kanal gewechselt wurde. Sie öffnete die Tür und sah ihre Töchter, die scheinbar fasziniert den Ausführungen von ein paar schwatzhaften Experten über Warenkorb, Preisindex und durchschnittliches Einkommen der Haushalte folgten.
»Hi, Mom«, rief Genevieve fröhlich. Grace blickte ebenfalls auf und lächelte ein wenig zu breit darüber, sie zu sehen.
»Hi«, sagte die Mutter und schaute sich um. »Wo steckt denn die Fernbedienung?«
Arglos antwortete Grace: »Irgendwo auf dem Bett.«
Das Gerät lag einige Meter von den Mädchen entfernt auf der Tagesdecke – so als sei es hastig dorthin geworfen worden, dachte Andi. Sie ging zum Bett, nahm die Fernbedienung in die Hand, sagte: »Entschuldigt bitte« und zappte durch die Sender. Auf einem Kabelkanal stieß sie auf eine Szene, in der ein Mann und eine Frau sich sehr nackt sehr nahe gekommen waren und sich immer noch im Ringkampf miteinander befanden.
»Ihr seid mir zwei Früchtchen«, tadelte sie ihre Töchter.
»Das ist doch wichtig für uns«, protestierte die jüngere der beiden, ohne sich die Mühe zu machen, etwas zu leugnen. »Wir müssen uns doch weiterbilden, damit wir später vorbereitet sind.«
»Aber nicht auf diese Weise«, erklärte Andi und schaltete das Fernsehgerät aus. »Jetzt gilt es, andere Dinge zu erledigen.« Sie sah zu Grace hinüber, doch ihre Älteste wandte den Blick ab. Vielleicht war sie sauer, oder aber verlegen. »Auf mit uns«, sagte die Mutter, »wir legen uns jetzt alles für die Schule morgen zurecht und nehmen dann unser Bad.«
»Jetzt sprichst du wieder wie ein Arzt, Mom«, bemerkte Grace.
»Tut mir leid.«
Auf dem Weg zu den Mädchenzimmern platzte es aus Genevieve heraus: »Der Mann hatte aber wirklich ein riesiges Gerät!«
Nach einer Sekunde schockierten Schweigens fing Grace an zu kichern, und zwei Sekunden später lagen alle drei auf dem Teppich im Flur und lachten, bis ihnen die Tränen die Wangen hinunterliefen.
Der Regen fiel die ganze Nacht hindurch, hörte am frühen Morgen auf und setzte dann unvermindert wieder ein.
Andi brachte ihre Töchter zum Schulbus, kam zehn Minuten zu früh in der Praxis an und arbeitete sich dann konzentriert durch ihre Patientenliste. Sie hörte jedem aufmerksam zu, lächelte ihn ermutigend an und redete gelegentlich intensiv auf ihn ein. Da war die Frau, die ständig von Gedanken an Selbstmord geplagt wurde. Eine andere, die glaubte, sie sei ein Mann, der in einem Frauenkörper gefangen saß. Oder der Mann, der von dem Drang besessen war, im Leben seiner Familie alles bis auf die kleinste Kleinigkeit zu kontrollieren; er wußte, daß das nicht richtig war, konnte aber nichts gegen diese Obsession tun.
Am Mittag lief Andi zwei Blocks weit zu einer Snack-Bar und kaufte dort etwas für sich und ihre Kollegin zu essen. Sie verbrachten die Pause mit dem Buchhalter und unterhielten sich mit ihm über Sozialversicherung und steuerliche Absetzmöglichkeiten für Angestellte.
Am Nachmittag erwartete Andi eine angenehme Überraschung: Ein Polizeibeamter, den die Ketten einer chronischen Depression fesselten, schien auf das neue Medikament anzusprechen. Er war ein sehr ernster Mann mit einem breiten Gesicht und stank entsetzlich nach Nikotin, doch heute konnte er sie zum ersten Mal etwas verlegen anlächeln und ihr mitteilen: »Mein Gott, das war meine beste Woche seit fünf Jahren. Ich konnte mich sogar wieder nach Frauen umdrehen.«
Andi verließ die Praxis etwas früher und fuhr durch einen nervtötenden, alles in feuchten Schmutz verwandelnden Nieselregen über die Stadtautobahn nach Westen zu den wie dahingestreut wirkenden weißen Villen im Neu-England-Stil und den grünen Spielfeldern der Birches School. Ahornbäume umrahmten den Parkplatz. Flammen von Herbstrot zogen sich durch ihre dichten Wipfel. Vor dem Schuleingang lag ein Wäldchen der namengebenden Birken in sonniges Gold getaucht und mutete an diesem trüben Tag an wie ein etwas zu strahlender Gruß.
Andi stellte ihren Wagen auf dem Parkplatz ab und eilte ins Schulgebäude. Der warme Geruch des alles durchdringenden Regens hing wie Nebel über dem feuchten Asphalt.
Die Elternsprechtage waren für sie reine Routine geworden. Sie fanden am ersten Schultag statt, und Andi besuchte sie jedes Jahr. Man traf die Lehrer, hatte für jeden ein Lächeln übrig, erklärte sich für das Schulfest an Thanksgiving zur Mitarbeit bereit und schrieb für den Förderverein einen Scheck aus. Ich freue mich wirklich sehr darauf Grace in meiner Klasse zu haben. Sie ist ein so intelligentes und aktives Kind, die auch ihre Kameradinnen motiviert und mitreißen kann bla-bla-bla...
Andi ging zu diesen Veranstaltungen nicht ungern. Und doch war sie immer wieder froh, wenn sie sie hinter sich gebracht hatte.
Als alles erledigt war, verließen Andi und ihre Töchter das Schulhaus, um festzustellen, daß der Regen inzwischen schlimmer geworden war und wie entfesselt vom verrückt gewordenen Himmel herabprasselte. »Ich sag dir was, Mom«, erklärte Grace, als sie den überdachten Eingang erreicht hatten und einer Frau hinterhersahen, die mit einem kaputten Schirm über den Bürgersteig lief. »Ich habe mein bestes Kleid an, und es hat heute kaum Falten bekommen. Das heißt, ich kann es also noch einmal tragen. Warum holst du nicht schon einmal den Wagen und liest mich hier auf?«
»Einverstanden.« Es hatte ja auch wirklich wenig Sinn, wenn sie alle drei naß würden.
»Ich fürchte mich nicht vor dem Regen«, sagte Genevieve zänkisch. »Komm, worauf warten wir noch?«
»Warum bleibst du nicht hier bei Grace?« wandte Andi ein.
»Nöh. Grace hat ja nur Angst vor dem Regen, weil sie fürchtet, in ihm wie die böse Hexe aus dem Zauberer von Oz zu zerschmelzen.«
Grace sah ihre jüngere Schwester grimmig an und drohte ihr, indem sie mit Daumen und Zeigefinger eine Kneifbewegung machte.
»Mom!« rief Genevieve gleich entsetzt.
»Grace!« ermahnte Andi sie.
»Warte nur, heute Nacht, wenn du gerade einschlafen willst«, raunte Grace Genevieve zu. Sie wußte, wie sie ihrer kleinen Schwester Angst einjagen konnte.
Mit ihren zwölf Jahren war Grace nicht nur die ältere, sondern auch eindeutig die größere von beiden. Sie wirkte noch etwas unbeholfen und linkisch, entwickelte aber schon die Formen und Kurven der beginnenden Pubertät. Grace war ein sehr ernstes Mädchen, fast schon düster, so als erwarte sie jeden Moment etwas Schlimmes. Aus ihr würde später bestimmt eine Ärztin werden.
Genevieve war das genaue Gegenteil. Sie wetteiferte ständig mit ihrer älteren Schwester, war laut und frivol – und fast schon zu hübsch. Obwohl sie erst neun war, sagten schon alle, daß ihr später einmal alle Jungs nachlaufen würden. Scharenweise. Aber bis dahin würde es wohl noch ein paar Jährchen dauern. Im Moment hockte sie auf dem steinernen Absatz, hatte ein Bein angezogen und puhlte an der untersten Sohle ihres Tennisschuhs.
»Genevieve, was machst du denn da?« rief die Mutter.
»Die Sohle geht sowieso von ganz allein ab«, entgegnete das Mädchen, ohne den Kopf zu heben. »Ich habe dir doch gesagt, daß ich dringend neue Schuhe brauche.«
Ein Mann in einem Regenmantel und ohne Hut lief mit gesenktem Kopf auf den Eingang zu: David Girdler, der sich selbst Psychotherapeut nannte und sich in der Schulpflegschaft engagierte. Er war ein ausgesprochener Langweiler, der gern mit Ausdrücken wie die richtige Rolle im Leben oder eingefleischtes Gebaren um sich warf. Gerüchten zufolge sollte er bei seiner Behandlung auch Tarot-Karten einsetzen. Zu allem Überfluß schien er an Andi ganz besonderen Gefallen zu finden und scharwenzelte bei jeder Gelegenheit um sie herum. »Dr. Manette!« rief er, nickte ihr zu und verlangsamte seine Schritte. »Was für ein scheußlicher Tag.«
»Ja«, entgegnete sie, aber ihre gute Erziehung hinderte sie daran, so kurz angebunden zu sein, auch wenn sie ihr Gegenüber nicht ausstehen konnte. »Es soll wieder die ganze Nacht durchregnen.«
»Das habe ich auch im Wetterbericht gehört«, bestätigte Girdler. »Sagen Sie, haben Sie eigentlich schon die neue Ausgabe des Therapodist gelesen? Da steht ein interessanter Artikel über die Struktur eines reaktivierten Erinnerungsvermögens drin... «
Er plapperte drauflos, und Andi setzte ein automatisches Lächeln auf, als Genevieve ihn ziemlich lautstark unterbrach: »Mom, wir sind superspät dran!« Die Mutter packte die Gelegenheit gleich beim Schopf: »Tut mir leid, David, aber wir müssen wirklich los.« Sich an die Manieren der Höflichkeit erinnernd fügte sie hinzu: »Aber ich werde mir den Artikel bestimmt ansehen.«
»Natürlich«, sagte Girdler. »War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten.«
Als er im Schulgebäude verschwunden war, nickte Genevieve in seine Richtung, verzog den Mund wie Humphrey Bogart und knurrte wie der Schauspieler: »Und was sagen wir jetzt, Mom?«
»Danke, Gen, du hast mir das Leben gerettet.«
»Keine Ursache, Mom, gern geschehen.«
»Okay«, erklärte die Mutter, »dann laufe ich jetzt los.« Sie sah zum Parkplatz hinüber. Ein roter Lieferwagen hatte sich neben ihre Fahrerseite gesetzt, und sie würde um ihn herumlaufen müssen, um ihr Auto zu erreichen.
»Ich komme mit«, verkündete Genevieve.
»Dafür darf ich aber vorn sitzen«, erklärte Grace.
»Nein, ich komme nach vorn«, widersprach die Jüngere.
»Du hast doch schon neulich vorn gesessen, Mistkäfer!« schimpfte Grace.
»Mom, sie hat gerade Mistkäfer zu mir gesagt!«
Grace drohte ihr wieder mit Daumen und Zeigefinger, und Andi entschied: »Du sitzt hinten, Gen. Schließlich warst du beim letzten Mal vorn.«
»Sonst zwicke ich dich«, fügte die Altere hinzu.
Mutter und Tochter rannten Hand in Hand durch den Regen. Andi hatte ihre flachen Schuhe an, und Genevieve kam mit ihren kurzen Beinen kaum mit. Als sie an dem Econoline vorbeigekommen waren, ließ sie ihre Tochter los, öffnete mit der Fernbedienung die elektronische Verriegelung und hörte im Regenschauer das Klacken der Türknöpfe, die nach oben fuhren.
Sie schob sich mit eingezogenem Kopf zwischen den Lieferwagen und ihr Auto, Genevieve folgte ihr auf dem Fuße und streckte die Hand nach dem Türgriff aus.
Andi hörte, wie hinter ihr die Seitentür des Econolines aufgezogen wurde, und spürte die Anwesenheit eines Mannes, der sich auf sie zu bewegte. Automatisch verzog sich ihr Mund zu einem Lächeln, und sie drehte sich um.
Genevieve stöhnte, und im nächsten Moment sah Andi den sonderbaren runden Kopf mit dem Gestrüpp von blondem Haar auf sich zukommen...
Erkannte die an eine Straßenkreuzung erinnernden Falten und geplatzten Äderchen in dem Gesicht, das dafür noch viel zu jung war.
Erblickte die Zähne, die Speichelansammlung in den Mundwinkeln und die Hände, die groß wie Keulen waren.
Und schrie: »Gen, lauf weg!«
Und der Mann schlug sie ins Gesicht.
Andi sah, wie die Faust auf sie zu sauste, aber sie war nicht in der Lage, ihr auszuweichen. Der Hieb warf sie gegen die Wagentür, ihre Knie gaben nach, und sie sackte an dem Metall hinab auf den Asphalt.
Andi spürte den Schlag nicht als Schmerz, sondern kam sich zwischen Faust und Auto vor wie zwischen Hammer und Amboß. Sie bekam mit, wie der Mann sich umdrehte, spürte Blut auf ihrer Haut, roch den Asphalt, als sie auf ihm landete, spürte den rauhen und nassen Belag, der ihr die Hände aufschürfte, dachte für einen verrückten Sekundenbruchteil, daß sie sich die Kleidung ruinieren würde, und fühlte, wie der Fremde sich von ihr entfernte.
Sie wollte ihrer Tochter »Lauf weg!« zurufen, aber nur ein Krächzen kam über ihre Lippen, und sie registrierte mit irgendeinem Sinnesorgan – ob es die Augen gewesen waren, wußte sie später nicht mehr genau zu sagen, wie der Angreifer sich Genevieve zuwandte. Die Mutter wollte erneut schreien, irgendeinen Laut von sich geben, der das Mädchen gewarnt hätte, aber dann blubberte Blut aus ihrer Nase, und der Schmerz setzte ein. Ein blendendes, unerbittliches Brennen, das sich wie Feuer auf ihrem Gesicht ausbreitete.
Und wie aus großer Entfernung hörte sie Genevieve schreien.
Andi versuchte, sich aufzurichten. Aber da legte sich eine Hand auf ihren Mantel und hob sie hoch. Sie flog durch die Luft und krachte gegen Autoblech. Andi rutschte mit dem Gesicht nach unten daran ab, bemühte sich auf den Knien aufzukommen und vernahm, wie eine Wagentür zugeschlagen wurde.
Halb bei Sinnen und halb benommen drehte sie sich mit wilden Augen um und sah Genevieve in einem Haufen vor sich liegen. Das Mädchen war von Kopf bis Fuß rot verschmiert. Andi streckte eine Hand nach ihr aus, aber da richtete sich ihre Tochter auf und starrte sie mit großen Augen an. Die Mutter wollte das Mädchen zurückhalten, es dazu bringen, sich nicht zu bewegen, als ihr plötzlich auffiel, daß es sich bei dem Rot nicht um Blut handelte, sondern um irgendeine andere Substanz. Genevieve kam auf sie zu, und als sie nur noch wenige Zentimeter von ihr entfernt war, schrie sie: »Mom, du blutest ja... «
Wagen, dachte Andi.
Sie mußten sich im Innern des Lieferwagens befinden. Darüber mußte sie gründlich nachdenken. Sie lehnte sich gegen die Blechwand, zog die Knie an und flog durch den halben Innenraum, als der Wagen mit quietschenden Reifen den Parkplatz verließ.
Grace wird uns sehen, schoß es ihr durch den Kopf.
Sie rappelte sich wieder auf und wurde nach hinten geworfen, als der Fahrer scharf nach links abbog und dann auf die Bremse trat. Die Tür an seiner Seite flog auf, und Licht strömte herein. Andi hörte einen Schrei, dann rollte die Seitentür zurück, und Grace flog kopfüber durch die Öffnung. Sie landete auf ihrer Schwester, und ihr weißes Kleid war ebenfalls von diesem Rot beschmiert.
Alle Türen wurden wieder geschlossen, und schon brauste der Lieferwagen davon.
Andi rollte herum, kam auf die Knie, ruderte mit den Armen und versuchte, in all dem einen Sinn zu finden: Grace kreischte, Genevieve jammerte, und überall an ihnen das rote Zeugs.
Am Geruch und Geschmack erkannte sie, daß zumindest sie blutete. Sie sah sich um und entdeckte hinter einer Absperrung aus Maschendraht auf dem Fahrersitz den kräftigen Körper eines Mannes. »Anhalten! So halten Sie doch an!« rief sie ihm zu, aber der Fremde ignorierte sie, drehte das Lenkrad, bog ab und gleich danach noch einmal.
»Mom, ich habe mir weh getan«, heulte die Jüngste. Andi wandte sich wieder ihren Töchtern zu, die auf allen vieren vor ihr hockten. Grace sah aus wie ein getretener Hund. Ihre verdrossene Miene wirkte, als habe sie immer schon geahnt, daß dieser Mann sie eines Tages überfallen würde.
Die Mutter sah sich im Innern des Lieferwagens um und suchte nach einem Weg hinaus. Aber über den Stellen, an denen sich normalerweise Türgriffe befanden, hatte jemand Metallplatten angebracht und mit Schrauben befestigt. Sie legte sich auf den Rücken und trat mit beiden Füßen gegen die Tür, konnte damit aber rein gar nichts bewirken. Andi trat ein zweites Mal mit aller Kraft und ließ noch ein drittes Mal die langen Beine mit voller Wucht gegen die Klappe schnellen. Dann versuchten es ihre Töchter, und als auch sie damit nicht weiterkamen, fing Genevieve an, fürchterlich zu kreischen. Andi ging wieder in Position und trat, bis sie keine Puste mehr hatte. Keuchend rief sie Grace zu: »Wir müssen hier raus, müssen hier raus, hier raus, hier raus... «
Der Mann am Lenkrad fing plötzlich an zu lachen, schrill und laut, als befände er sich auf einer Achterbahnfahrt, und dieses Geräusch übertönte sogar Genevieves Geschrei. Er lachte so lange, bis seine drei Gefangenen ruhig geworden waren. Sie entdeckten im Rückspiegel seine Augen, und schließlich erklärte er: »Ihr kommt hier nicht raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich kenne mich nämlich bestens mit Türen ohne Griffe aus.«
Zum ersten Mal vernahmen sie seine Stimme, und die Mädchen zuckten vor ihr zurück. Andi richtete sich unbeholfen auf, duckte sich, um unter dem niedrigen Dach stehen zu können, und entdeckte, daß sie ihre Schuhe verloren hatte – und auch noch ihre Handtasche. Aber nein, da vorn war sie doch, auf dem Beifahrersitz. Wie war die Tasche dorthin gelangt? Sie klammerte sich mit beiden Händen an dem Maschendraht fest, um Halt zu finden, schwang dann ein Bein weit zurück und trat gegen das Seitenfenster. Ihre Ferse traf gut, und Sprünge breiteten sich auf der Scheibe aus. Der Lieferwagen fuhr rechts ran, und der Entführer trat hart auf die Bremse, drehte sich zu ihr um, richtete eine schwarze 45er auf sie und drohte mit wutschnaubender Stimme: »Wenn du mein beschissenes Seitenfenster aufbrichst, knall ich deine beschissenen Kinder ab!«
Andi konnte nur die Seite seines Gesichts erkennen. Doch das reichte ihr schon, und sie dachte: Den kenne ich. Aber er sieht irgendwie anders aus. Wo habe ich ihn bloß schon einmal gesehen? Wann? Andi hockte sich auf den Boden, und der Fahrer drehte sich wieder um. Er steuerte den Wagen vom Bordstein und murmelte: »Versucht sie doch glatt, mein Fenster einzutreten? Will sie doch wirklich mein Seitenfenster aufbrechen?«
»Wer sind Sie?« fragte Andi ihn.
Das schien ihn noch zorniger zu machen. Wer war er? »John«, antwortete er rauh.
»John wer? Was wollen Sie von uns?«
John wer? Was für ein verdammter John? »Du weißt, welcher verdammte John.«
Grace blutete aus der Nase und stierte verwirrt vor sich hin. Genevieve hatte sich in die hinterste Ecke zurückgezogen. Andi fragte ihn ein zweites Mal: »John, und wie weiter?«
Er warf einen Blick über die Schulter, und der blanke Haß stand in seinen Augen. Dann hob er eine Hand und zog sich die blonde Perücke vom Kopf.
Andi brauchte einen Moment, ehe sie ächzen konnte: »O nein, nicht Sie. Nicht John Mail!«
Kapitel 2
Der Regen war kalt und ungemütlich, aber wenigstens kein Wolkenbruch. Wenn er zwei Monate später gekommen wäre, hätte er sich bestimmt zu einem Killer-Blizzard ausgewachsen, und dann hätten sie hier knöcheltief durch Schnee und Eis waten können. Marcy Sherrill hatte das oft genug mitmachen müssen und sich noch immer nicht daran gewöhnt. An solchen Tagen bekam man es immer mit den häßlichsten und widerlichsten Dingen zu tun: gefrorene Blutlachen und Schlimmeres. Regen hingegen, ganz gleich, wie kalt er daherkam, hatte stets die angenehme Eigenschaft, eine Menge von dem Ekelerregenden wegzuspülen. Sherrill warf einen Blick in den Nachthimmel und dachte: Ein schwacher Trost.
Sie stand im Scheinwerferlicht des Tatort-Szenarios, hatte die Hände tief in die Taschen ihres Regenmantels geschoben und starrte auf die Füße des Mannes, der vor ihr lag. Selbige lugten unter der Heckklappe eines cremefarbenen Lexus mit echten Ledersitzen hervor und gaben alle paar Sekunden ein konvulsivisches Zucken von sich.
»Was treibst du da eigentlich, Hendrix?« fragte sie.
Der Mann unter dem Wagen murmelte etwas Unverständliches.
Sherrills Partner bückte sich ein Stück, um Hendrix besser zu verstehen. »Ich glaube, er hat gerade gesagt, daß er sich unter einer Palme in der Sonne räkelt.« Regen rann von seinem Hutrand, und die Tropfen verfehlten die Spitze seiner vollkommen trockenen Zigarette jeweils um ein paar Millimeter. Er wartete auf eine Entgegnung des Mannes unter dem Wagen, bei dem es sich um einen Wiedergeborenen Christen handelte, und als die ausblieb, murmelte er: »Verdammter Spinner« und richtete sich wieder auf.
»Ich wünschte, dieser Scheißregen würde endlich aufhören«, bemerkte Sherrill und warf wieder einen Blick nach oben. Revolverblättern wie dem National Enquirer würde das gefallen. Der Himmel sah aus, als sei der Satan höchstpersönlich erschienen. Die auseinandergerissenen Sturmwolken brodelten durch die Lichter, die von der Stadtautobahn kamen, und reflektierten den häßlichen flackernden Schein von den Blaulichtern der Streifenwagen.
Ein Stück die Straße hinunter, etwas von den Polizeiautos entfernt, duckten sich Ü-Wagen der Fernsehstationen geduldig im Regenguß. Vor ihnen auf der Straße drängten sich die Reporter und verfolgten das Treiben von Sherrill und ihren Kollegen rings um den Lexus. Natürlich mußten nur die Kameraleute und die von der schreibenden Zunft hinaus in dieses Wetter. Die Fernsehstars blieben lieber in ihren Fahrzeugen und achteten darauf, daß ihr Make-up nicht zerlief.
Sherrill zitterte, senkte den Kopf und wischte sich das Wasser aus den Augenbrauen. Irgendwann einmal hatte sie zu dem Mantel auch eine Kapuze besessen, sie aber bei irgendeinem anderen Tatort verloren, bei dem es geregnet, geschneit oder gehagelt oder sonstwas hatte... Früher oder später mußte man für alles bezahlen.
»Du hättest einen Hut mitbringen sollen«, sagte ihr Partner. Er hieß Tom Black und gehörte nicht gerade zu den offenen und aufgeschlossenen Menschen. »Oder wenigstens einen Schirm.«
Einen Schirm hatte sie auch einmal ihr eigen genannt, ihn aber ebenfalls irgendwo vergessen. Vermutlich hatte ihn ein lieber Kollege mitgehen lassen, der wußte, wie wertvoll ein Schirm bei einem Wolkenbruch sein konnte. Und so kam es, daß Sherrill hier im Unwetter stand und sich das eisige Regenwasser in den Kragen laufen ließ. Sie war sauer, weil die Uhr schon halb sieben anzeigte und sie immer noch Dienst hatte, während ihr verdammter Gatte längst im Applebee’s hockte und seinen Charme bei der Barfrau sprühen ließ.
Und noch mehr ärgerte es sie, daß Black neben ihr trocken war und nicht unter dem Regen leiden mußte – und daß er ihr noch nicht einmal seinen Hut angeboten hatte, obwohl sie doch eine Frau war.
Und erst recht verdroß es sie, daß sie, wenn er ihr denn tatsächlich seinen Hut angeboten hätte, diesen hätte ablehnen müssen, weil sie eine der beiden einzigen Frauen im Mordkommissariat war und sie deswegen sich und den männlichen Kollegen beweisen mußte, daß sie kein hilfloses Frauchen war und mit allen Problemen hervorragend zurechtkam. Dabei hatte sie das jetzt schon seit einem Dutzend Jahren unter Beweis gestellt, zuerst als Streifenbeamtin, dann im mittleren Dienst als Lockvogel, Undercoveragentin in der Drogenabteilung und bei der Sitte, bis sie schließlich im Morddezernat gelandet war.
»Hendrix«, murrte sie, »ich will endlich aus diesem gottverdammten Regen raus, Mann!«
Auf der Straße kam ein Wagen mit tiefem Brummen zum Stehen. Sherrill warf einen Blick über Blacks Schulter und sagte: »Oha!« Ein schwarzer Porsche 911 hatte am Bordstein angehalten, unmittelbar vor der Absperrung, die die Beamten mit gelbem Band gezogen hatten. Zwei Fernsehkameras wurden eingeschaltet, und ein Streifenpolizist zeigte auf den Dienstwagen. Der Porsche setzte zurück und sauste behende und rasch wie ein Wiesel oder ein zurückschnellendes Gummiband um die Absperrung herum auf den Parkplatz.
»Davenport«, murmelte Black, bevor er sich umdrehte. Sherrills Partner war eher klein und auch etwas rundlich an den Hüften. Über seinem breiten Schnurrbart thronte eine mächtige Nase. Er war stets unnatürlich ruhig. Das änderte sich lediglich, wenn das Gespräch auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten kam, den er entweder mit dieser kommunistische Scheißkopf oder mit dieser faschistische Mutterschänder zu betiteln pflegte, was ganz von seiner jeweiligen Stimmung abhing.
»Das Unheil naht«, sagte Sherrill. Ein kleiner Bach hatte sich in ihrem Haar gesammelt und rann nun ihren Nacken und Rücken hinab. Sie reckte und schüttelte sich. Marcy Sherrill war groß und schlank, hatte eine lange Nase, unbezähmbares schwarzes Haar und weiche Brüste und besaß die heimliche, befriedigende Gewißheit, daß in der Abteilung alle Männer hinter ihr her waren.
»Hmm«, machte Black und fragte kurz darauf unvermittelt: »Bist du ihm schon mal an die Wäsche gegangen? An Davenports Wäsche, meine ich.«
»Selbstverständlich nicht«, antwortete sie. Black hatte etwas ausufernde Vorstellungen über ihr Sexualleben. »Ich habe es nicht einmal versucht.«
»Wenn du es trotzdem vorhast, solltest du dich damit beeilen«, bemerkte er lakonisch. »Der Gute heiratet nämlich bald.«
»Tatsächlich?«
Der Porsche hielt jetzt quer auf den selbst bei diesem Wetter deutlich sichtbaren Parktaschenstreifen an, und die Fahrertür öffnete sich im selben Moment, in dem die Scheinwerfer ausgeschaltet wurden.
»Habe ich jedenfalls gehört«, sagte Black und schnippte den abgerauchten Zigarettenstummel in das Gras am Rand des Parkplatzes.
»Dann wird er sich aber gehörig wundern«, entgegnete Sherrill. »Dann ist Schluß mit dem lustigen Leben, und wenn er nicht brav ist, legt seine bessere Hälfte das Einfahrt-Verboten-Schild an.«
»Mike glaubt aber immer noch, überall freie Fahrt zu haben, oder?« Mike war Sherrills Ehemann.
»Ich weiß, wie ich ihn zu nehmen habe«, erwiderte sie. »Hm, ich frage mich, was Davenport... «
Plötzlich blitzte unter dem Lexus ein helles Licht auf, die beiden Füße zuckten unkontrolliert, und Hendrix rief: »Verflixt noch mal!«
Sherrill bückte sich. »Was ist denn los, Hendrix?«
»Ich hätte mir fast selbst einen Stromschlag verpaßt«, antwortete der Mann unter dem Wagen. »Dieser Regen ist wirklich ver... die Pest am Hinterteil.«
»Jetzt paß aber auf, was du sagst«, tadelte ihn Black. »Immerhin ist eine Dame anwesend.«
»Tut mir leid.« Die Stimme klang zwar gedämpft, aber durchaus so, als wäre es ihm ernst damit.
»Komm endlich da unten raus und gib uns den blöden Schuh«, murrte Sherrill und trat nach einem der Füße.
»Verflixt, tu das nicht wieder. Ich versuche, mich hier unten zurechtzufinden. «
Sherrills Blick wanderte über den Parkplatz. Davenport kam gerade auf sie zu. Er bewegte sich mit langen und glatten Schritten wie ein Profi-Sportler und hatte die Hände in den Taschen vergraben. Die Mantelschöße flatterten um seine Beine. Der kräftige, breitschultrige Mann sah in seinem teuren Mohair-Anzug und mit den vielen Narben im Gesicht wie ein Mafiagangster aus, dachte Sherrill, zumindest wie die, die man im Kino vorgeführt bekam.
Er hätte aber auch als Spanier oder als Inder durchgehen können – bis man seiner blauen Augen und seines grausamen Grinsens gewahr wurde. Sherrill schüttelte sich wieder. »Von ihm geht wirklich etwas... « Sie suchte nach einem passenden Begriff, »etwas Pulsierendes aus.«
»Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen«, bemerkte ihr Partner nur.
Plötzlich erschien vor Sherrills geistigem Auge das Bild von Black und Davenport, wie sie sich miteinander im Bett tummelten. Viel Haar auf Schultern und Rücken war dabei zu sehen und auch einiges von den Körperteilen, die normalerweise bedeckt bleiben. Sie grinste für einen kurzen Moment, aber ihrem Partner entging das nicht, und weil er ihr stets ansehen konnte, was sie dachte, brummte er: »Fick dich doch selbst, Täubchen.»
Deputy Chief Lucas Davenports Parka verfügte über eine im Kragen eingelassene Kapuze, die er gleich herauszog, während er den Parkplatz überquerte. Als er sie über den Kopf gestreift hatte, sah er aus wie ein Mönch. Sherrills Vorgesetzter besaß eine ebenso trockene und selbstgefällige Art wie ihr Kollege Black. Noch bevor sie den Mund auf machen konnte, reichte er ihr schon eine khakifarbene Tenniskappe. »Setzen Sie die auf«, brummte er und fragte dann: »Was haben wir hier vor uns?«
»Unter dem Wagen befindet sich ein Schuh«, teilte Sherrill ihm mit, während sie sich die Kappe aufsetzte. Ohne die ständigen Tropfen im Gesicht, die vom Schirm abgehalten wurden, fühlte sie sich gleich besser. »Den zweiten haben wir hier auf dem Parkplatz gefunden. Damenschuhe. Die Trägerin muß ganz schön was abbekommen haben, um aus ihren Schuhen gerissen zu werden.«
»Ja, sie muß sich ein ziemliches Ding eingefangen haben«, bestätigte Black.
Lucas war ein großer Mann mit breiten Schultern und den Händen eines Boxers: groß, viereckig und voller Narben. Sein Gesicht paßte zu diesen Pranken: das eines Faustkämpfers, der einiges hat einstecken müssen. Und aus seinen blauen Augen strahlte unentwegt Kampfeswille. Eine weiße Narbe, die dünn wie ein Rasiermesserschnitt war, zog sich von der Stirn bis über das rechte Auge und zeichnete sich deutlich auf der dunklen Haut ab. Eine weitere Narbe, rund und voller Falten, hob sich wie ein plattgetretener Kaugummi von seinem Hals ab – das Ergebnis einer Kugel und eines Luftröhrenschnitts, das gerade erst anfing, sich weiß zu verfärben. Der Chief Deputy ging neben den Füßen, die unter dem Wagen herausragten, in die Hocke und sagte: »Kommen Sie da raus, Hendrix.«
»Gut, nur noch eine Minute. Den Schuh können Sie aber nicht haben. Da klebt nämlich Blut dran.«
»Dann machen Sie voran«, brummte Lucas und erhob sich wieder.
»Haben Sie schon mit Girdler gesprochen?« fragte Sherrill.
»Wer ist das?«
»Ein Zeuge«, informierte sie ihn. Sie hatte heute ihr teures Parfüm benutzt, Obsession. Der Duft drang ihr in diesem Moment in die Nase, und sie stellte fest, daß er tatsächlich leise Leidenschaft in einem auslösen konnte.
Lucas schüttelte den Kopf: »Ich war bis eben in Stillwater, beim Abendessen. Auf der Fahrt hierher bin ich alle fünf Minuten angerufen worden, und jeder wollte wissen, wie wir vorzugehen gedenken. Mehr weiß ich auch nicht, und ich habe keine Ahnung, was Sie hier schon herausgefunden haben.«
»Eine Frau... «, begann Black.
»Sie heißt Manette«, warf Lucas ein.
»Richtig. Also Mrs. Manette und ihre beiden Töchter, Grace und Genevieve, kamen gerade vom Elternsprechtag. Die Mutter und eines der Mädchen sind offensichtlich in einen roten Lieferwagen verfrachtet worden. Wie es dazu gekommen ist, haben wir noch nicht feststellen können. Wir wissen nicht einmal, ob der Täter Tränengas eingesetzt oder sie niedergeschossen hat, oder ob er tatsächlich so stark ist, daß er sie einfach ergreifen konnte.
Uns ist nicht einmal bekannt, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat. Wie dem auch sei, das alles ereignete sich, bevor auch die zweite Tochter an die Reihe kam, und zwar dort hinten, am überdachten Schuleingang.« Black deutete hinüber zu dem Gebäude. »Wir nehmen an, daß Mrs. Manette und eine Tochter durch den Regen zu ihrem Wagen gelaufen sind und dort überfallen wurden. Die andere Tochter hat inzwischen vor der Schule gewartet, weil sie nicht naß werden wollte. Und dort haben der oder die Täter sie dann erwischt.«
»Warum ist sie nicht davongelaufen?« fragte Lucas.
»Das wissen wir auch nicht«, antwortete Sherrill. »Vielleicht handelte es sich bei dem Täter um jemanden, den sie kannte.«
»Und wo hat sich zur Tatzeit dieser Zeuge aufgehalten?«
»Es waren mehrere. Der eine ein erwachsener Mann, irgendeine Art von Seelenklempner, der zweite ein junges Mädchen, das hier zur Schule geht. Beide haben aber nur etwas vom letzten Akt mitbekommen, als Grace, das ist die ältere Tochter, die dort drüben gewartet hat, aufgegriffen wurde. Sowohl der Psychiater wie auch die Schülerin haben ausgesagt, daß die Mutter zu dem Zeitpunkt noch am Leben gewesen sei. Mrs. Manette soll sich auf allen vieren im Laderaum des Wagens befunden haben. Aber ihr Gesicht war anscheinend voller Blut. Die andere Tochter lag wohl bäuchlings in einer Ecke, und sie war blutüberströmt. Niemand hat einen Schuß gehört oder eine Pistole oder ein Gewehr bemerkt. Die beiden Zeugen haben nur einen Täter bemerkt. Aber das heißt nichts, denn ein Komplize hätte sich noch im Lieferwagen befinden können. Davon gehen wir sogar aus, denn es ist kaum vorstellbar, daß ein Mann ganz allein drei Personen packen und in seinen Wagen werfen kann. Außer natürlich, er hat sie erst so zusammengeschlagen, daß er sie nur noch wie Kartoffelsäcke aufzulesen brauchte.«
»Hm.. .Und was noch?«
»Der Täter war ein Weißer«, sagte Sherrill, »und sein Wagen war ein Lieferwagen, kein Kleinbus. Mit Frontantrieb. Wir schätzen, daß es sich dabei um einen Econoline, einen Chevrolet GIO, einen Dodge Bl50 oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben muß. Die Zeugen können sich leider nicht an das Kennzeichen erinnern.«
»Wie lange hat es gedauert, bis wir hier eingetroffen sind?« wollte Lucas wissen.
»Es scheint einige Verwirrung gegeben zu haben«, antwortete Sherrill, »und so sind nach der Entführung wohl drei oder vier Minuten vergangen, ehe die Polizei verständigt wurde. Unser Einsatzwagen hat dann noch einmal die gleiche Zeit gebraucht, um hierher zu gelangen. Der Anrufer klang irgendwie zweifelnd, so als sei er sich nicht sicher, ob überhaupt etwas passiert sei. Tja, und dann sind weitere Minuten vergangen, ehe wir über Funk durchgeben konnten, daß nach einem roten Lieferwagen gesucht werden solle.«
»Also hat der Täter bereits zehn Meilen zurücklegen können, ehe wir nach ihm Ausschau gehalten haben«, stellte Lucas fest.
»Das ist so ziemlich alles«, fügte Black hinzu. »Der Mann hat bei hellem Tageslicht zugeschlagen und sich wieder verdrückt.« Die drei standen für eine Weile nur nachdenklich da und lauschten dem Prasseln des Regens auf ihren Kopfbedeckungen. Schließlich fragte Sherrill: »Warum sind Sie eigentlich hierher gekommen?«
Lucas zog die Rechte aus der Manteltasche und vollführte eigenartige Bewegungen damit. Sherrill erkannte erst nach einem Moment, daß er etwas zwischen den Fingern hin und her rollte. »Die Geschichte könnte... Komplikationen mit sich bringen«, antwortete er und sah zur Schule. »Wo halten sich die beiden Zeugen auf?«
»Der Seelenpfuscher hockt dort drin in der Cafeteria«, erklärte die Polizistin. »Wo das Mädchen zur Zeit steckt, weiß ich auch nicht. Greave kümmert sich um die beiden. Was meinten Sie eigentlich mit Komplikationen?«
»Nun, wir haben es hier mit Superreichen zu tun«, antwortete Lucas und drehte sich zu ihr um. »Die Entführte ist nämlich die Tochter von Tower Manette.«
»Das habe ich auch schon gehört«, sagte Sherrill und sah den Chief Deputy stirnrunzelnd an. »Black und ich bearbeiten diesen Fall, und wir können auf irgendwelchen Aufruhr oder Ärger gern verzichten. Schließlich haben wir uns auch noch um diese verdammte Geschichte mit der Beihilfe zum Selbstmord zu kümmern... «
»Diese Sache können Sie genausogut zu den Akten legen«, erklärte Lucas. »Dem Mann ist kaum was anzuhängen.«
»Gerade das geht mir ja so auf die Eierstöcke«, knurrte sie. »Ihm wäre es doch nie in den Sinn gekommen, daß seine alte Dame Selbstmord begehen sollte, bis er dieser Pißnelke über den Weg gelaufen ist... Ich weiß hundertprozentig, daß er dann die Frau dazu gebracht hat, Hand an sich zu legen...«
»Pißnelke?« fragte Lucas und grinste Black an.
»Unsere Marcy Sherrill ist eben eine echte Poetin«, bemerkte der Polizist.
»Geht mir ganz gewaltig gegen den Strich«, schimpfte Sherrill. »Was ist nun mit diesem Tower Manette? Ist er schon dabei, seine politischen Beziehungen spielen zu lassen?«
»Ganz recht«, bestätigte Lucas. »Und es kommt noch viel besser: Andi Manettes Gatte und der Vater der beiden Mädchen ist George Dunn. Habe ich selbst eben erst erfahren. Sie wissen schon, North Light Development. Republikanische Partei. Und jede Menge Kohle.«
»Und Manette ist ein hohes Tier bei den Demokraten«, murmelte Black mit finsterer Miene. »Grundgütiger, da stecken wir aber wirklich mittendrin im Schlamassel.«
»Ich wette, unser Chief macht sich bereits die Hosen voll«, sagte Sherrill.
»Das können Sie laut sagen«, nickte Lucas. »Kann dieser Seelenklempner uns eine Beschreibung von dem Täter liefern?«
Sherrill schüttelte zweifelnd den Kopf. »Greave meinte, der Typ habe kaum was gesehen. Nur das Ende von der Geschichte. Ich habe gerade mal ein paar Worte mit diesem Girdler gewechselt, und er kam mir ein bißchen plemplem vor.« Sie tippte sich an die Stirn, um ihre Worte zu verdeutlichen.
»Na toll. Und Greave hat ihn gerade in der Mangel?«
»Ja.«
Wieder schwiegen alle, denn keiner wollte es aussprechen. Es war im ganzen Revier bekannt, daß Greave nicht gerade eine Leuchte war, wenn es darum ging, Personen zu vernehmen oder zu verhören. Genauer gesagt war er in dieser Hinsicht sogar ein ganz trübes Licht. Lucas wandte sich ab, um zum Schulgebäude zu gehen, als es aus Sherrill herausplatzte: »Dunn war es!«
In neunzig Prozent aller Fälle traf sie mit ihren Vorhersagen ins Schwarze. Lucas blieb abrupt stehen, drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf: »Sagen Sie so etwas nicht, Marcy – denn vielleicht steckt er wirklich dahinter.« Seine Finger spielten immer noch mit dem Gegenstand, den Sherrill noch nicht hatte identifizieren können. »Ich möchte nicht, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, wir seien hinter ihm her, ohne etwas Konkretes gegen ihn in der Hand zu haben.«
»Haben wir denn überhaupt etwas Konkretes?« wollte Black wissen.
»Bis jetzt weiß noch niemand etwas«, erklärte Lucas leise, »aber Dunn und Andi Manette haben sich vor kurzem getrennt. Vermutlich eine andere Frau. Trotzdem...«
»Ich weiß schon«, sagte Sherrill, »wir müssen höflich sein.«
»Ja, und zwar zu jedem. Klebt ihnen am Arsch, aber seid dabei sehr nett zu ihnen«, riet Lucas. »Und... ich weiß nicht so recht. Wenn es wirklich Dunn gewesen sein sollte, dann muß er einen Komplizen haben.«
Die Polizistin nickte. »Jemand, der sich um die drei kümmert, während er, ganz der besorgte Vater, mit den Bullen redet.«
»Es sei denn, er hat Frau und Töchter hier aufgegriffen und längst irgendwo verscharrt«, warf Black ein.
Darüber wollten die Beamten lieber nicht nachdenken. Alle drei hoben gleichzeitig den Kopf, und der Regen fuhr ihnen ins Gesicht. Im nächsten Moment glitt Hendrix auf einem quietschenden Rollbrett unter dem Lexus hervor, und sie senkten synchron ihre Häupter, um nach ihm zu sehen. Der Mann trug einen weißen Overall und eine Brille mit Gläsern von der Dicke eines Colaflaschenbodens. Alles in allem wirkte er wie ein bleicher Grottenolm.
»Auf dem Schuh befindet sich ein Blutfleck. Zumindest halte ich das für Blut. Passen Sie auf, daß er nicht verwischt wird«, erklärte er Sherrill und reichte ihr eine Plastiktüte.
Die Polizistin starrte auf einen schwarzen Damenschuh mit flachem Absatz und sagte: »Geschmack hat die Lady ja.«
Lucas ließ den mysteriösen Gegenstand zwischen Mittel- und Ringfinger hin und her rollen und schob ihn dann unbewußt über den Zeigefinger. »Vielleicht stammt das Blut ja von diesem Mistkerl.«
»Klar, und wir glauben auch noch an den Osterhasen«, brummte Black.
Er half Hendrix, der noch immer auf dem Rollbrett lag, auf die Beine. Lucas runzelte die Stirn und fragte: »Was ist das denn da für ein Zeugs?«
Lucas zeigte auf ein Hosenbein des Overalls. Im Licht der Scheinwerfer vom Dienstwagen zeigte sich am Unterschenkel eine hellrote Stelle, so als habe Hendrix sich eine Wunde zugezogen.
»Gott im Himmel!« stöhnte Black. Er zog seine Hosenbeine hoch, bis darunter die Schuhe zum Vorschein traten. »Das ist Blut.«
Hendrix ließ sich auf die Knie fallen, zog ein Papiertaschentuch aus der Tasche und breitete es auf dem schwarzen Asphalt aus. Als es durchgeweicht war, hob er es hoch und hielt es ins Scheinwerferlicht. Das Tuch war rot gefärbt.
»Gott, die Frau muß ja hier verblutet sein!« rief Sherrill.
Hendrix schüttelte den Kopf. »Nein, das ist kein Blut«, erklärte er, hielt das Taschentuch zwischen sich und das Licht und starrte hindurch.
»Aber was ist es denn?«
Der Techniker zuckte die Achseln. »Farbe. Oder irgendeine Chemikalie, aber auf gar keinen Fall Blut.«
»Ist ja ein Ding«, sagte Sherrill. Im Scheinwerferlicht wirkte ihr Gesicht noch blasser als sonst. Sie sah hinab auf ihre Schuhe. »Ich hasse es, durch diesen Mist zu waten. Wenn man das Zeugs nicht gleich abwischt, fängt es an zu stinken.«
»Aber bei dem Fleck auf dem Schuh handelt es sich doch um Blut, oder?« fragte Lucas.
»Ich glaube, ja«, antwortete Hendrix.
Sherrill beobachtete den Deputy Chief und vor allem den Gegenstand, mit dem er unablässig spielte. Endlich kam sie hinter des Rätsels Lösung. »Ist das ein Ring?« fragte sie ihn.
Lucas ließ rasch die Hand mitsamt dem Objekt in der Manteltasche verschwinden. In der Dunkelheit war nicht genau auszumachen, ob er rot anlief. »Ja, könnte sein.«
»Was soll das heißen? Wissen Sie es etwa nicht?« Sie gab die Tüte mit dem Schuh an Black weiter. »Steht uns etwa eine Verlobung ins Haus?«
»Könnte sein.«
»Darf ich den Ring mal sehen?« Sie trat einen Schritt auf ihn zu und klimperte mit den Wimpern.
»Wozu?« entfuhr es ihm, und er wich vor ihr zurück, begriff dann aber, daß er sich nicht vor Sherrill in Sicherheit bringen konnte.
»Damit ich den verdammten Stein herausbrechen und einstecken kann«, entgegnete sie ungeduldig, flötete dann aber: »Weil ich mir das gute Stück gern näher betrachten würde, was dachten Sie denn?«
»Sie zeigen ihn ihr besser«, riet Black ihm. »Sonst jault sie Ihnen die ganze Nacht die Ohren voll.«
»Ach, halt die Klappe«, fuhr Sherrill ihn an. Black schloß den Mund, und Hendrix fuhr erschrocken einen Schritt zurück. Sie wandte sich wieder an Lucas, legte den Kopf schief und sagte mit betörendem Lächeln: »Nun kommen Sie schon, ja? Bitte...«
Lucas zog mit sichtlichem Zögern die Hand aus der Tasche und ließ den Ring in Sherrills ausgestreckte Rechte fallen. Marcy vollführte sofort eine halbe Drehung, um das Stück im Scheinwerferlicht betrachten zu können. »Heiliger Strohsack!« entfuhr es ihr anerkennend, ehe sie sich an Black wandte: »Der Stein ist dicker als dein Schwanz.«
»Aber nicht halb so hart«, entgegnete ihr Kollege.
Der Wiedergeborene Christ schüttelte traurig den Kopf. Solcherlei loses Gerede zwischen Männern und Frauen war ein weiteres Anzeichen für den verderbten Zustand der Welt – und ließ nur darauf schließen, daß der Untergang bevorstand.
Sie alle machten sich durch den Regen auf den Weg ins Schulgebäude. Der Techniker warf immer wieder besorgte Blicke in den Himmel und suchte dort nach Manifestationen von Gott oder Luzifer. Black trug die Tüte mit dem blutbeschmierten Schuh wie eine Handtasche. Lucas hielt verlegen oder besorgt den Kopf gesenkt, und Sherrills Gedanken kreisten immer noch um den tropfenförmigen Diamant von drei Karat und wie er im Scheinwerferlicht gefunkelt und geblitzt hatte.
Die Wände der Cafeteria waren mit lustigen Kinderbildern geschmückt, und trotzdem wirkte der Raum düster. Von diesem Saal ging der Charme eines Bunkers aus. Überall verschalte Betonwände und die Fenster viel zu hoch angebracht, um hindurchschauen zu können.
Bob Greave hockte auf einem viel zu kleinen Stuhl an einem zu schmalen Tisch, trank Cola light und machte sich auf einem Schreibblock Notizen. Er trug einen rostbraunen italienischen Anzug und darüber einen leichten, beigefarbenen Mikrofaser- Regenmantel. Neben ihm saß ein schmächtiger Mann in einem Trenchcoat auf einem ebenfalls zu kleinen Stuhl. Seine knochigen Beine ragten unter der Tischplatte heraus und verliehen ihm das Aussehen eines Kranichs. Seine Gesichtsmuskeln schienen von Zuckungen geplagt.
Lucas trat durch die Garagentür, und Black, Sherrill und Hendrix folgten ihm wie nasse Entenküken ihrer Mutter. »Hey, Bob«, grüßte der Deputy Chief.
»Ist das ein Beweisstück?« fragte Greave mit Blick auf die Tüte, die Black in der Hand hielt.
»Nein, wieso?« fuhr Lucas erschrocken zusammen, weil er sofort an den Ring denken mußte, ehe ihm einfiel, daß Greave noch nichts davon wissen konnte und er außerdem den Schuh gemeint hatte, den sie unter dem Wagen hervorbefördert hatten. Lucas grinste nervös und stellte fest, daß die anderen nichts von seiner Reaktion bemerkt zu haben schienen. Der Mann mit dem unablässigen Zucken im Gesicht fragte: »Sind Sie Chief Davenport?«
»Ja«, nickte Lucas.
»Ihr Mr. Greave hier«, er nickte in Richtung des Beamten, »hat erklärt, ich müsse so lange hierbleiben, bis Sie auftauchen würden. Ich habe ihm aber schon alles gesagt, was ich weiß. Kann ich jetzt gehen?«
»Ich möchte Ihre Geschichte auch gern hören«, teilte Lucas ihm mit.
Girdler erzählte ihm rasch alles. Er sei zur Schule gekommen, um mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden über den diesjährigen Veranstaltungsplan der Elternvertretung zu sprechen. Draußen vor der Tür sei er auf Mrs. Manette und ihre beiden Töchter gestoßen. Mrs. Manette habe ihn um Rat in einem bestimmten psychologischen Problem ersucht – immerhin seien sie beide Therapeuten und damit Kollegen –, und sie hätten sich dann ein paar Minuten unterhalten, bis er sich verabschiedet und das Gebäude betreten habe.
Auf halbem Weg durch den Flur sei ihm dann ein bestimmter Artikel in einer Fachzeitschrift eingefallen, der sich mit dem von ihr angeschnittenen Problem beschäftige und auf den er zuvor nicht gekommen sei. So habe er auf der Stelle kehrtgemacht, und als er um die Ecke gebogen sei und sich noch zwanzig oder dreißig Meter von der Eingangstür entfernt befunden habe, habe er einen Mann gesehen, der mit einer der Töchter rang.
»Er hat sie einen Moment später hinten in den Laderaum geworfen«, schloß Girdler, »ist nach vorn gelaufen, eingestiegen und gleich losgefahren.«
»Und sie haben die Mutter und die Töchter im Wagen gesehen?«
»Äh, ja...« antwortete der Psychologe, wandte aber dabei den Blick ab, und Lucas dachte: Der Mann lügt. »Die Mädchen lagen auf dem Boden, und Mrs. Manette hockte auf allen vieren. Ihr Gesicht war voller Blut.«
»Und was haben Sie dann gemacht?« wollte Lucas wissen.
»Ich bin gleich losgerannt, auf die Tür zu, weil ich dachte, ich könnte den Mann noch aufhalten«, antwortete Girdler und wich wieder Lucas’ Blick aus. »Aber ich bin natürlich zu spät gekommen. Der Wagen hatte bereits die Straße erreicht. Ich bin mir aber sicher, daß das Fahrzeug ein Minnesota-Nummernschild hatte. Der Wagen war rot und hatte an den Seiten Gleittüren. Der Entführer war jung und ziemlich groß. Und kräftig. Nicht dick, sondern muskulös. Er hat ein T-Shirt und Jeans getragen.«
»Aber an sein Gesicht können Sie sich nicht erinnern?«
»Überhaupt nicht. Er hatte langes blondes Haar, so wie einer von diesen Rock-Typen. Es ging ihm bis zu den Schultern.«
»Hm. Und das ist schon alles?«
Das schien den Psychologen zu verletzen. »Für mein Dafürhalten und unter den gegebenen Umständen ist das eine ganze Menge. Ich meine, ich bin hinter einem fahrenden Lieferwagen hergerannt und konnte ihn leider nicht mehr einholen. Dann bin ich gleich zurück ins Sekretariat und habe die Sekretärin gebeten, die Polizei zu verständigen. Wenn Sie ihn noch nicht geschnappt haben, ist das doch nicht meine Schuld.«
Lucas lächelte. »Ich habe gehört, es gibt eine zweite Zeugin. Ein Mädchen, das den Vorfall ebenfalls mitbekommen hat.«
Girdler zuckte die Achseln. »Ich kann mir kaum vorstellen, daß sie viel gesehen hat. Die Schülerin hat auf mich einen ziemlich konfusen Eindruck gemacht. Das liegt vielleicht aber auch daran, daß sie mir nicht sehr helle vorkam.«
An Lucas gewandt erklärte Greave: »Ich habe ihre Aussage aufgenommen. Sie deckt sich ziemlich mit dem, was Mr. Girdler zu Protokoll gegeben hat. Die Mutter von dem Mädchen war allerdings ziemlich aufgebracht.«
»Großartig«, sagte der Deputy Chief.
Er blieb noch zehn Minuten, entließ den Psychologen und beriet sich dann mit seinen Kollegen. »Viel haben wir nicht, oder?«
»Nur das Blut«, sagte Sherrill. »Aber aus den Aussagen von Girdler und der Schülerin wußten wir ja schon, daß die Geschichte nicht unblutig verlaufen ist.«
»Und dieses rote Zeugs auf dem Parkplatz«, meinte Hendrix
und betrachtete das rotgetränkte Taschentuch. »Ich vermute, es handelt sich dabei um wasserlösliche Farbe, mit der der Täter seinen Wagen gestrichen hat, um ihn unkenntlich zu machen oder um ihn zu tarnen.«
»Was bringt Sie zu dieser Überlegung?«
»Nun ja, die beiden Zeugen haben erklärt, der Wagen sei rot gewesen, und das hier ist eindeutig Rot. Ist ja nur eine Vermutung. Was ich allerdings nicht so recht verstehe... «
»Heraus mit der Sprache.«
Der Techniker kratzte sich am Kopf. »Warum hat der Mann das so und nicht anders gemacht? Warum fährt er am hellichten Tag vor und überwältigt ganz allein drei Personen? Ich frage mich, ob wir es dabei möglicherweise mit einer Kurzschlußhandlung zu tun haben, daß irgendein Drogensüchtiger durchgeknallt ist, weil er dringend Geld für den nächsten Schuß gebraucht hat. Aber wenn es ihm wirklich nur darum gegangen ist, warum hat er denn dann ausgerechnet Mrs. Manette entführt? Und auch noch ihre Töchter? Das läßt doch den Schluß zu, daß er sie kannte, oder? Außer natürlich, er ist nur auf gut Glück hier vorgefahren, weil diese Schule vornehmlich von reichen Kindern besucht wird und er sich den oder die erstbesten greifen wollte. Und dann hat er den Lexus gesehen und sich gesagt, das dürfte sich doch lohnen...«
»Aber warum hat er dann nicht nur eines der Kinder gekidnappt? Wenn man von jemandem ein Lösegeld verlangen will, entführt man nicht gleich die ganze Familie«, wandte Black ein. »Wenigstens die Eltern läßt man in Ruhe, weil die ja das Geld aufbringen sollen.«
»Der ganze Fall kommt mir beschissener als gequirlte Scheiße vor«, sagte Sherrill, und die anderen nickten.
»Moment, das könnte es sein!« rief Black. »Die Manette ist doch Seelenklempnerin, und bei dem Entführer könnte es sich um einen ihrer Patienten handeln. Um einen Irren.«
»Wie auch immer«, sagte Lucas, »ich hoffe nur, dem Burschen geht es lediglich um Geld.«
»Wieso?« fragte Hendrix.