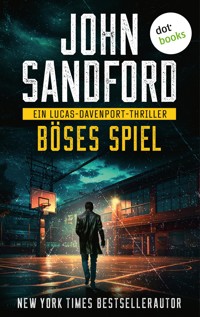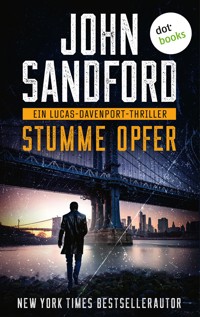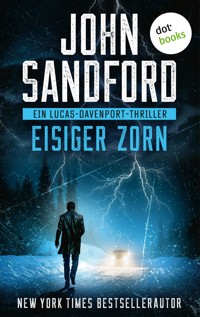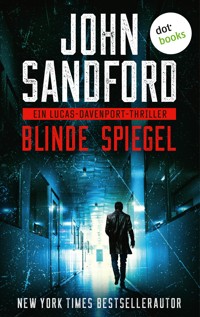9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Brust durchlöchert – die Augen blind … Der rasante Thriller »Jagdpartie« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Die fünf Direktoren der Polaris Bank treffen sich zu ihrem jährlichen Jagdausflug – doch nur vier kommen zurück ... Dass es für den Mord am Vorstandsvorsitzenden ebenso viele Motive wie Verdächtige gibt, erschwert die Ermittlungen für die Polizei von Minneapolis enorm. Als schon bald ein weiterer Bänker stirbt, wird Lucas Davenport, der schlimmste Alptraum eines jeden Serienmörders, zu Hilfe gerufen: Der Detective macht sich gemeinsam mit seiner neuen Assistentin Seargent Sherrill daran, die böse Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Viel zu spät erkennt Davenport, dass er es mit einem Widersacher zu tun hat, wie er ihm noch nie zuvor begegnet ist – und der ihn bereits tief in ein Netz aus Verrat und Intrigen eingesponnen hat, aus dem es kein Entkommen gibt … »Sandfords Fans werden begeistert sein, denn dies ist sein bester Thriller seit Jahren – voll raffinierter Spannung und explosiver Action!.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Jagdpartie« von John Sandford – der spektakuläre neunte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von David Baldacci und Jussi Adler-Olsen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die fünf Direktoren der Polaris Bank treffen sich zu ihrem jährlichen Jagdausflug – doch nur vier kommen zurück ... Dass es für den Mord am Vorstandsvorsitzenden ebenso viele Motive wie Verdächtige gibt, erschwert die Ermittlungen für die Polizei von Minneapolis enorm. Als schon bald ein weiterer Bänker stirbt, wird Lucas Davenport, der schlimmste Alptraum eines jeden Serienmörders, zu Hilfe gerufen: Der Detective macht sich gemeinsam mit seiner neuen Assistentin Seargent Sherrill daran, die böse Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Viel zu spät erkennt Davenport, dass er es mit einem Widersacher zu tun hat, wie er ihm noch nie zuvor begegnet ist – und der ihn bereits tief in ein Netz aus Verrat und Intrigen eingesponnen hat, aus dem es kein Entkommen gibt …
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
Die Website des Autors: www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/johnsandfordauthor/
***
eBook-Neuausgabe Juli 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Secret Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Die Jagdpartie« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Suzanne Tucker und AdobeStock/Ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-097-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Jagdpartie« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Jagdpartie
Ein Lucas-Davenport-Thriller 9
Aus dem Amerikanischen von Manes H. Grünwald
dotbooks.
Kapitel 1
Der Aufsichtsratsvorsitzende zog die Tür hinter sich zu, lehnte das Gewehr gegen die Wand des Blockhauses und ging zum Ende der Veranda. Das Licht aus dem Küchenfenster fiel hinaus in die Dunkelheit des frühen Morgens und die absolute Stille des Waldes. Der seit zwei Wochen andauernde Nachtfrost hatte die Insekten getötet und die Amphibien in den Winterschlaf getrieben; für einige Sekunden war er allein hier draußen.
Dann gähnte der Aufsichtsratsvorsitzende, öffnete den Reißverschluß des Overalls, knöpfte den Hosenschlitz auf und scharrte mit den Füßen, so daß die Bohlen der Veranda unter seinen gefütterten Jagdstiefeln knarrten. Es gibt nichts Schöneres, als den Tag mit einem ausgiebigen Pinkeln zu beginnen, dachte er. Als er sich an das Verandageländer vorschob, hörte er, daß hinter ihm die Tür geöffnet wurde. Er kümmerte sich nicht darum.
Drei Männer und eine Frau kamen hintereinander aus der Tür und taten so, als ob sie ihn nicht sehen würden.
»Wir bräuchten dringend Schnee«, sagte die Frau und starrte in die Dunkelheit. Susan O’Dell war eine schlanke Vierzigerin, hatte ein sonnengebräuntes, schmales Gesicht, ruhige braune Augen und Lachfältchen um den Mund. Über ihre grellorangefarbene Strumpfmütze spannte sich das Gummiband einer Stirnlampe, die sie jedoch noch nicht eingeschaltet hatte. Sie trug einen grell-orangefarbenen Browning-Parka und Thermohosen, in den Händen einen Rucksack und ein 308-Remington-Jagdgewehr mit einem Leupold-Vari-XIII-Zielfernrohr. Nicht sichtbar war der Druckpunktabzug des Gewehrs. Das Abzugsgewicht des Hahns betrug exakt 1135 Gramm.
»Saukalt jedenfalls«, sagte Wilson McDonald, während er einen seiner kräftigen Arme unter den Gewehrriemen schob. Er war ein großer Mann und viel zu schwer: In seinem Jagdanzug sah er wie ein grell-orangefarbener Pillsbury-Infanterist aus. Er trug ein altes 30-06-Jagdgewehr mit Kimme-und-Korn-Visiereinrichtung, die in den dreißiger Jahren bei Abercrombie & Fitch in New York gekauft worden war. Er war zweiundvierzig und bestimmten Traditionen verhaftet – sein Sommerauto, ein giftgrüner Jaguar XK-E, hatte er von seinem Vater geerbt, sein Gewehr stammte von seinem Großvater, und seine Mitgliedschaft im Country-Club ging auf seinen Urgroßvater zurück. Den Jaguar verteidigte er eisern gegen jeden bequemeren Wagen, das .30-06 gegen jedes moderne Gewehr und die Clubmitgliedschaft gegen jeden Parvenü, Neureichen und, natürlich, gegen jeden Schwarzen und Juden.
»Alle abmarschbereit?« fragte der Aufsichtsratsvorsitzende und trat, schnell den Reißverschluß des Overalls hochziehend, auf die anderen zu. Er war der Älteste der Gruppe, ein recht korpulenter, rotgesichtiger Mann mit dichtem weißem Haarschopf und raupenbreiten Augenbrauen. Als er in die Nähe der anderen kam, konnte er den Geruch nach Pfannkuchen und Kaffee riechen, der noch von ihnen ausging. »Ich möchte nicht, daß noch jemand im Wald rumstolpert, wenn’s gerade spannend wird.«
Alle nickten; sie kannten die Prozedur.
»Wir sind spät dran«, sagte O’Dell. Sie hatte den Reißverschluß des Parkas noch nicht zugezogen, und auch die Kapuze baumelte noch auf ihrem Rücken; aber sie hatte eine rotweiße Kufija um Hals und Kinn geschlungen. Aus einer Laune heraus in der Altstadt von Jerusalem gekauft, wärmte dieser Schal, dazu gedacht, Araber vor der Wüstensonne zu schützen, jetzt eine in dritter Generation in den USA lebende Irin in Minnesota. »Wir sollten uns schleunigst auf den Weg machen und unsere Positionen einnehmen.«
Fünf Uhr fünfundvierzig, Eröffnungstag der Rotwild-Saison ... O’Dell ging voraus über die Veranda, gefolgt vom Aufsichtsratsvorsitzenden, dahinter die drei anderen Männer.
Terrance Robles war der Jüngste der Gruppe, erst Mitte Dreißig. Er war ein untersetzter Mann mit einem dünnen, gekräuselten Kinnbart, und er trug eine Brille mit schwarzer Fassung und dicken Gläsern. Seine wäßrigen blauen Augen blitzten immer wieder nervös auf, und er lachte zu oft, meist mit einem flachen, unsicheren Kichern. Er hatte ein makellos gepflegtes Jagdgewehr geschultert, ein 270 Sako mit einem seidig glänzenden Nikon-Zielfernrohr. Robles hatte keinen Sinn für Traditionen: Alles, was er zur Jagd einsetzte, bestand aus neuester Technologie.
James T. Bone hätte Susan O’Dells Bruder sein können: Er war vierzig, schlank, gebräunt und dunkeläugig, und seine Gesichtszüge zeigten unter einer eisenhart wirkenden Oberfläche doch auch Anzeichen dafür, daß er Sinn für Humor hatte. Er ging am Schluß der Reihe und hielt ein 242 Mauser-Gewehr Modell 66 in der Armbeuge.
Vier der fünf – der Aufsichtsratsvorsitzende, Robles, O’Dell und Bone – waren eingefleischte Jäger.
Der Vater des Aufsichtsratsvorsitzenden war Banker in einer Kleinstadt gewesen. Sie hatten ein hübsches verschachteltes Fachwerkhaus am Blueberry Lake südlich von Itasca besessen, und sein Vater hatte sich intensiv im Rotary-Club und in der Veteranenlegion engagiert. Die Rotwildjagd war ein jährliches Ritual: Der Aufsichtsratsvorsitzende hatte in seinen sechsundvierzig Jahren der Jagd bereits mehr als zwanzig Hirsche erlegt – wahre Männer schossen keine Hirschkühe.
Robles war erst als Erwachsener zum Jäger geworden. Man hatte ihn als Geschenk zum dreißigsten Geburtstag zu einer Elchjagd eingeladen, und dieses Erlebnis hatte ihn emotional tief bewegt. Seitdem hatte er jährlich an fünf bis sechs größeren Jagdausflügen teilgenommen, von Alaska bis Neuseeland.
O’Dell war die Tochter eines Ranchers. Ihr Vater besaß zwanzig Quadratmeilen des Staates South Dakota entlang der Grenze zu Wyoming, und sie hatte seit ihrem achten Lebensjahr an der jährlichen Antilopenjagd teilgenommen. Während des Studiums am Smith-College war sie stets zur Jagd nach Hause geflogen, während die anderen Mädchen mit ihren Beaus die Footballspiele der acht Elite-Universitäten im Osten der USA besucht hatten.
Bone stammte aus Mississippi. Er war schon als Kind auf die Jagd gegangen, weil er etwas zu essen brauchte. Einmal, als er neun Jahre alt gewesen war, hatte er für sich und seine Mutter eine Suppe aus drei mit Bedacht erlegten Amseln gekocht.
Nur McDonald mochte die Jagd nicht. Er hatte früher bereits Rotwild geschossen – er stammte aus Minnesota, und in diesem Staat erwartete man von einem echten Mann, daß er so etwas tat –, aber insgeheim betrachtete er die Jagd schlicht und einfach als Ärgernis. Wenn er ein Tier erlegte, mußte er es ausweiden. Das hatte zur Folge, daß er schlecht roch und Blutflecke an die Kleidung bekam. Und dann mußte er auch noch irgendwas mit dem Fleisch anstellen. Ein vergeudeter Tag ... Im Club würden sich die Leute die Zeit mit ein paar kräftigen Gin vertreiben – wie schön, ein paar kräftige Gin runterzukippen, dachte er –, und er mußte diesen Blödsinn hier mitmachen und bald auch noch auf irgendeinen verdammten Baum klettern.
»Verdammt«, sagte er laut.
»Was?« brummte der Aufsichtsratsvorsitzende und drehte sich zu ihm um.
»Nichts«, sagte McDonald. »Ich war gedanklich woanders.«
Eine gute Seite hatte die Sache: Wenn man einen Hirsch erlegte, würden die Leute im Club das als einen Beweis der Zugehörigkeit anerkennen – nicht als ordinäre Gemeinsamkeit, die Probleme aufwerfen konnte, sondern als »Kontakt dieses unseres Clubmitgliedes zur Mutter Natur«, den so mancher von ihnen als wichtige Tugend betrachtete. Das war immerhin einiges wert; nicht genug, um sich hier draußen rumquälen zu müssen, aber wenigstens etwas ...
Der Geruch nach Holzfeuer hing um das Blockhaus, aber er wurde vom beißenden Gestank der Galläpfel an den Eichenblättern abgelöst, als sie in den Wald kamen. Nach rund fünfzig Metern gerieten sie aus dem Lichtschein des Blockhauses, und O’Dell schaltete ihre Stirnlampe an, der Aufsichtsratsvorsitzende seine Taschenlampe. Die Morgendämmerung würde erst in fünfundvierzig Minuten einsetzen, aber der mondlose Himmel war klar, und sie konnten über dem Pfad eine lange Sternenspur sehen. An der Deichselspitze des Kleinen Wagens glitzerte der Polarstern.
»Wunderschöne Nacht«, sagte Bone, den Blick zum Himmel gerichtet.
Direkt unterhalb des Blockhauses lag ein kleiner See, matt schimmernd wie ein beschlagener Spiegel. Sie folgten etwa hundertfünfzig Meter einem Pfad am Ufer entlang, stiegen hintereinander einen Höhenrücken hoch und gingen dann parallel zum See weiter.
»Treten Sie nicht in die Scheiße«, durchbrach die Stimme der Frau schneidend die Stille. Der Strahl ihrer Stirnlampe war auf einen Haufen frischer Hirschlosung gerichtet, der wie eine Ansammlung purpurner Hühnerherzen auf dem Pfad lag.
»Das haben wir in der vergangenen Woche bei dem Deal mit Cove Links gemacht«, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende trocken.
Der Höhenrücken trennte den See von einem Sumpf, in dem nur einzelne Gruppen von Lärchen wuchsen. Fünfzig Meter weiter sagte Robles: »Hier ist meine Abzweigung.« Er wandte sich nach links, in Richtung auf den Sumpf. Ehe er sich von der Gruppe löste, schaltete er seine Taschenlampe an, sagte: »Waidmannsheil Ihnen allen« und verschwand über einen schmalen Pfad in Richtung auf seinen Hochsitz.
Als nächster war der Aufsichtsratsvorsitzende an der Reihe. Ein weiterer Pfad führte nach links, ebenfalls auf den Sumpf zu, und er bog ab, sagte: »Bis gleich dann.«
»Holen Sie sich den Hirsch«, sagte O’Dell, und sie, McDonald und Bone gingen weiter.
Der Aufsichtsratsvorsitzende folgte dem schmalen Strahl seiner Lampe rund vierzig Meter einen sanften Hang hinunter zum Rand des Sumpfes. Der See war noch nicht zugefroren, aber die flachen Wasserpfützen des Sumpfes waren mit Eisplatten, dünn wie Fensterglas, bedeckt.
Eine knorrige Eiche stand am Rand des Sumpfes; die Art von Eiche, bei der man sich vorstellen kann, daß eine Elfe darin wohnt. Der Aufsichtsratsvorsitzende griff in seine Jackentasche, nahm eine Rolle Fallschirmschnur heraus, knotete das Ende um den Schulterriemen seines Gewehrs, lehnte das Gewehr an den Baumstamm und stieg auf den Eisenkrampen, die er bereits vor acht Jahren in den Stamm getrieben hatte, auf den Baum.
Er hatte von diesem Ansitz aus schon drei Hirsche geschossen. Der Vorarbeiter der Kolonne, die die Straßengräben zur Vorbereitung auf die Schneemonate reinigte, hatte ihm gesagt, ein Zwölfender sei im Sommer in dieser Gegend aufgetaucht. Der Vorarbeiter hatte den Hirsch gesehen, als er mitten durch den Sumpf in Richtung auf eben diese Eiche gewechselt war. Etwa vor zwei Wochen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende kletterte die rund fünf Meter zum Ansitz hoch, setzte sich zum Verschnaufen auf die Bank und lehnte den Rücken gegen den Eichenstamm. Der Ansitz sah wie die Veranda eines Vorstadthauses aus; die Plattform war aus imprägnierten 5-mal-12-cm-Bohlen gezimmert, das als Gewehrauflage gedachte Geländer aus 5-mal-10-cm-Balken. Er nahm den Rucksack ab, hängte ihn an einen Haken rechts neben sich und zog dann das Gewehr an der Schnur zu sich hoch.
Die Patronen waren noch warm, als er sie aus der Jackentasche nahm und das Gewehr lud. Das würde nicht lange so bleiben. Die Temperatur lag bei ungefähr zehn Grad minus, und ein eisiger Wind biß ihm in die Haut. Später am Tag würde es wärmer werden, vielleicht knapp über dem Gefrierpunkt, aber jetzt, am frühen Morgen ungeschützt hier auf dem Hochsitz kauernd, würde er ganz schön frieren. Hoffentlich fror sich auch diese verdammte O’Dell den Arsch ab. Sie behauptete immer, sie sei unempfindlich gegen Kälte; aber dieser Morgen würde sie eines Besseren belehren.
In seiner nylongefütterten Thermojacke war es dem Aufsichtsratsvorsitzenden nach der Anstrengung des Hochkletterns im Moment jedoch noch recht warm, und er döste vor sich hin, während er auf seinem Baum saß und auf das erste Büchsenlicht wartete. Er wurde hellwach, als er die Bewegungen eines Hirsches im trockenen Laub hörte, der offensichtlich einem Wildwechsel zum Sumpf folgte. Jetzt ließ das Tier sich irgendwo auf der Anhöhe links hinter ihm nieder.
Das war ja sehr interessant ...
Vierzig oder fünfzig Meter entfernt, mehr nicht. Noch oben am Kamm der Höhe, aber er würde das Tier sehen können, sobald es hell wurde und es sich wieder bewegte. Wenn es das nicht tat, würde er es auf dem Rückweg zum Blockhaus aufscheuchen.
Er saß da und wartete, horchte auf den Wind. Die meisten Eichen trugen ihre Blätter noch, wenn auch braun und tot. Wenn er die Augen schloß, klang ihr Rascheln wie das Knistern eines kleinen, intimen Kaminfeuers.
Der Aufsichtsratsvorsitzende seufzte: Es gab so viel zu tun ...
Der Mörder trug die bei diesen Anlässen übliche, grell-orangefarbene Jagdkleidung und bewegte sich leise und schnell auf dem Pfad. Die Morgendämmerung stand kurz bevor, und das Fenster der Gelegenheit war nur für wenige Minuten offen ...
Ab hier: vierundzwanzig Schritte den Pfad hinunter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ... dreiundzwanzig, vierundzwanzig. Hier jetzt links eine markante Eiche ... Ich wollte, ich könnte eine Taschenlampe benutzen ...
Da war die Eiche, ihre Rinde rauh unter seinen Fingerspitzen. Und dicht rechts davon eine kleine Mulde im Boden hinter einer umgestürzten Espe.
Leg dich da rein ... leise, leise! Ob er mich gehört hat? Diese verdammten, trockenen Blätter ... Habe gestern nicht an die Blätter gedacht, und jetzt knistern sie unter meinem Gewicht wie trockene Cornflakes ... Wo ist der Espenstamm, muß doch direkt vor mir sein ... aha!
In der Mulde war der Stamm der umgestürzten Espe genau in der richtigen Höhe für den Anschlag des Gewehrs. Ein schneller Blick durch das Zielfernrohr: nichts als eine dunkle Scheibe.
Wieviel Uhr ist es? Mein Gott, meine Uhr ist stehengeblieben! Nein, doch nicht. Sechs Uhr siebzehn. Okay. Noch Zeit. Beruhige dich. Und mach die Ohren auf! Wenn jemand über den Pfad kommt und mich sieht, muß ich ihn wahrscheinlich erschießen ... Wie spät ist es jetzt? Sechs Uhr achtzehn. Erst eine Minute vergangen? Oder zwei? Kann mich nicht mehr erinnern ... Zwei wahrscheinlich.
Es gab bei dieser Sache nur einen einzigen Versuch. Es waren andere Leute in der Nähe, und sie trugen Waffen. Wenn jemand über den Pfad angestolpert kam und die orangefarbene Jacke in der Mulde sah ...
Wenn jemand kommt, solange es noch dunkel ist, könnte ich vielleicht noch wegrennen und mich irgendwo verstecken. Aber man könnte mich für einen Hirsch halten und auf mich schießen. Was dann? Nein ... Wenn jemand kommt, knalle ich ihn ab, egal, wer es ist. Zwei Schüsse sind okay. Ich kann mir zwei Schüsse leisten. Es wird dann zwar nicht mehr wie ein Jagdunfall aussehen, aber es wird wenigstens auch keinen Zeugen geben.
Was war das? Kommt da tatsächlich jemand? Ist da jemand in der Nähe?
Der Mörder lag in der Mulde und horchte angestrengt, aber die einzigen Geräusche stammten von den im Wind raschelnden Blättern an den Bäumen, vom Schaben der Zweige aneinander und vom Rauschen des Windes selbst. Schau auf die Uhr ...
Jetzt ist es bald soweit. Niemand in der Nähe, und ich bin ganz ruhig. Kalt hier, allerdings. Kälter, als ich gedacht habe. Ich muß mich bereit machen ... Der alte Mann ... ich muß mich auf den alten Mann konzentrieren. Wenn er hier ist, im Blockhaus, muß ich einfach die Gelegenheit ergreifen ... Und wenn seine Frau dabei ist, muß sie auch dran glauben ... Das ist okay: Sie sind alte Leute ... Immer noch nichts im Zielfernrohr zu erkennen. Wo bleibt der Sonnenaufgang?
Daniel S. Kresge war Aufsichtsratsvorsitzender, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Präsident von Polaris Bank System. Er hatte die Titel auf sich vereint wie ein archaischer, sowjetischer Diktator. Und er übte sein Regime durchaus auch wie ein Diktator aus: über zweihundertfünfzig Bankfilialen in sechs Staaten des Mittelwestens befanden sich fest in seinen stets auf Kostensenkung bedachten Klauen.
Wenn alles nach seinen Plänen verlief, würde er seinen Job noch für weitere fünfzehn Monate ausüben – bis Polaris in Midland Holding aufging, der Besitzerin von sechshundert Banken in den zentralen Südstaaten. Es würden dabei einige Schlachtopfer auf der Strecke bleiben.
Die Zentrale der vereinigten Banken würde in Fort Worth sein. Nicht viele Topmanager von Polaris würden dorthin umzuziehen brauchen. Tatsache war, daß die gesamte zentrale Verwaltung von Polaris letztlich aufgelöst wurde, dazu auch ein Großteil des Topmanagements. Bone würde wahrscheinlich auf die Füße fallen: Seine Investment-Abteilung war eines der zentralen Profitzentren bei Polaris, und er hatte mit seinen Erfolgen einiges Aufsehen in der Bankenwelt erregt. O’Dell leitete den Detailhandel bei Polaris. Midland würde jemanden brauchen, der dieses Territorium kannte, zumindest einige Zeit lang, und sie konnte eventuell eine Verwendung als Nummer zwei oder drei in Midlands Abteilung finden. Das würde ihr nicht gefallen. Würde sie sich damit zufriedengeben? Kresge war sich nicht sicher.
Robles würde noch einige Zeit gebraucht werden: Er war ein reiner Techniker, Leiter der Datenverarbeitung bei Polaris, und Midland würde ihn benötigen, um bei der Zusammenführung der unterschiedlichen Datensysteme von Polaris und Midland mitzuarbeiten.
McDonald war erledigt, »totes Fleisch« sozusagen. Die Hypotheken-Abteilung bei Polaris spielte keine große Rolle mehr, und Midland hatte seine eigene Hypotheken-Abteilung – die man dazu auch noch auflösen wollte, wie das nun mal so ist.
Kresge ging in Gedanken die zu erbringenden Schlachtopfer durch: Wenn sie die Detailregelungen der Fusion in Angriff nahmen, mußte er versuchen, die Härten für die Polaris-Manager, deren Übernahme bei der Zusammenführung nicht gesichert war, abzumildern – und auch für die Topmanager, die Midland übernehmen würde: Robles ganz sicher. Wahrscheinlich auch O’Dell und Bone.
McDonald? Scheiß drauf ...
Kresge würde wie die meisten anderen auch seinen Job verlieren. Aber anders als bei den anderen würde sein Ausscheiden mit einer Summe im Bereich von vierzig Millionen Dollar – nach Steuern – versüßt werden. Und er würde frei sein.
In zwei Wochen würde Kresge in einem Gerichtssaal sitzen und feierlich schwören, daß seine Ehe unheilbar zerrüttet war. Seine Frau hatte auf Unterhaltszahlungen verzichtet. Als Gegenleistung für dieses Zugeständnis hatte sie gefordert – und er hatte zugestimmt –, mehr als fünfundsiebzig Prozent ihres derzeitigen gemeinsamen Besitzes zu erhalten. Acht Millionen Dollar. Es war eines der schwersten Dinge in seinem Leben gewesen, auf acht Millionen Dollar zu verzichten, aber es war die Sache wert: Er war mit einem Schlag alle Verpflichtungen los.
Als sie den Deal unterzeichnet hatten, war weder seiner Frau noch ihrem geldgierigen Anwalt klar gewesen, was die damals noch in den Anfängen steckende Fusion finanziell bedeuten konnte. Sie hatten keine Ahnung, daß es einen goldenen Rettungsfallschirm für den Aufsichtsratsvorsitzenden geben würde. Und seine Exfrau würde keinen Cent von diesem Geld bekommen. Er lächelte beim Gedanken an diese Tatsache vor sich hin. Sie hatte diesen geldgierigen Anwalt speziell dazu angeheuert, ihn bei dem Übereinkommen über den Tisch zu ziehen, und war überzeugt, das sei ihr gelungen. Warte nur, bis die Einzelheiten über die Fusion in die Zeitungen kommen ... Und sie würden in den Zeitungen veröffentlicht werden.
Fahr zur Hölle, Exfrau ...
Vierzig Millionen. Er wußte, was er damit anfangen würde.
Als erstes würde er die Doppelstadt Saint Paul/Minneapolis verlassen – er hatte die Kälte satt –, würde nach Los Angeles ziehen, sich schicke Sachen zulegen. Vielleicht eines dieser tollen BMW-Cabriolets kaufen, den 850er. Er war zeitlebens ein guter, grauer Minnesota-Banker gewesen. Jetzt würde er mit seinem Geld nach L. A. gehen und ein wenig leben ... Er schloß die Augen und dachte weiter darüber nach, was er in der »Stadt der Engel« mit vierzig Millionen Dollar alles anfangen konnte. Mein Gott, schon allein die Frauen ...
Kresge wurde sich plötzlich der zunehmenden Kälte bewußt, und er öffnete die Augen wieder; er zitterte, schüttelte dann gezielt die Steifheit aus den Gelenken. Er schaute nach Osten, hinüber zum Blockhaus, sah dort deutlich einen hellen Lichtstreifen am Himmel. Rechts von ihn war ein gleichmäßiges Trampeln im Laub zu hören. Ein weiterer Hirsch zog vorbei, ein Schatten im Halbdunkel, als das Tier seinen Weg durch eine Reihe fingerdicker junger Erlen am Rand des Sumpfes suchte. Keine Geweihsprossen zu sehen. Er behielt den Schatten im Auge, bis er unter einer Gruppe von Lärchen verschwand.
Er nahm jetzt das Gewehr hoch, widerstand der Versuchung, das Schloß zurückzuziehen, zu überprüfen, ob es durchgeladen war. Er wußte, daß es schußbereit war, und wenn er das Schloß betätigte, würde das ein Geräusch verursachen. Er legte den Sicherungshebel um, sicherte dann das Gewehr aber wieder.
Die nächsten Minuten krochen nur langsam dahin. Zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn der Rotwildsaison war der Wald noch in graues Halbdunkel gehüllt; in den folgenden Minuten schien es jedoch auf wundersame Weise schnell heller zu werden. Dann hörte er in der Ferne einen Schuß: jemand verursachte einen Fehlstart. Eine Minute später folgte ein zweiter Schuß, dann zwei oder drei weitere in den nächsten zwei Minuten: mehrere Jäger legten nun also zu früh los. Kresge schaute auf die Uhr. Noch zwei Minuten. Keine Bewegung auf dem Sumpfgelände.
Durch das Fernrohr wirkte das Ziel, fünf bis sechs Meter hoch oben im Baum, wie ein überdimensionierter Kürbis. Der Körper war von der Hüfte abwärts außer Sicht, ebenso der rechte Arm. Der Mörder konnte den größten Teil des Rückens sehen, nicht aber das Gesicht. Das Fadenkreuz des Zielfernrohrs streichelte die Wirbelsäule des Ziels, und der Finger des Mörders lag leicht um den Abzug.
Er muß es sein. Dieses verdammte Licht, ich kann es nicht genau erkennen. Dreh den Kopf. Komm, dreh den Kopf! Schau mich an. Es muß passieren, die Sonne geht auf es muß jetzt passieren ... Schau mich an. Ja, mach so weiter! Dreh den Kopf, ja, noch ein Stück weiter ...
Dreißig Sekunden vor der offiziellen Eröffnungszeit der Rotwildsaison ging das Schießen rundum in ein allgemeines Geballer über. Aber keine Schüsse in der Nähe, dachte Kresge. Entweder hielten seine Jagdgenossen sich noch zurück, oder es kam ihnen nichts vor die Flinte.
Was war mit dem Hirsch, der sich am Hang links hinter ihm niedergelassen hatte?
Er drehte den Oberkörper, ganz langsam, vorsichtig, und schaute in diese Richtung. In den letzten wenigen Sekunden seines Lebens sah Daniel S. Kresge als erstes die grell-orangefarbene Jacke, dann das Gesicht. Er erkannte den Mörder, und er dachte noch: Was, zum Teufel ...
Dann senkte sich das Gesicht, und Kresge erkannte, daß der dunkle Kreis unter der Kapuze die Objektivlinse eines Zielfernrohrs war – und daß dieses Zielfernrohr auf ihn gerichtet war, ebenso der kleine Kreis der Laufmündung ... O Gott ...
Das O Gott zuckte im gleichen Augenblick durch Kresges Kopf, in dem die Kugel durch sein Herz fuhr.
Der Körper des Aufsichtsratsvorsitzenden wurde herumgerissen, sank von der Bank; Kresge spürte keinerlei Schmerz, spürte gar nichts, und sein Gewehr fiel vom Ansitz hinunter auf den Boden. Er kniete einen kurzen Moment am Geländer wie ein Mann, der die Kommunion empfängt, dann knickte sein Rücken ein, und er fiel unter dem Geländer hindurch nach unten, dem Gewehr hinterher.
Er sah den Boden noch auf sich zukommen, verschwommen wie im Nebel, schlug mit einem dumpfen Knall und dem Gesicht voran auf, und sein Genick brach. Er rollte auf den Rücken, die Augen noch immer offen; den hellen Streifen am Himmel sahen sie jedoch nicht mehr. Er spürte auch nicht mehr die Hand, die seine Halsschlagader abtastete, ob ein Pulsschlag zu fühlen sei.
Daniel S. Kresge würde noch eine Weile daliegen, mit dem Kopf den Hang hinunter, ein Loch in der Brust und den Mund voll mit Schmutz und Eichenblättern. Niemand würde herbeigerannt kommen, um nachzusehen, was dieser Schuß zu bedeuten hatte. Niemand würde die Notrufnummer 911 anrufen. Keine Neugierigen. Einfach nur ein ganz normaler Jagdtag.
Aber ein wirklich schlechter Tag für den Aufsichtsratsvorsitzenden.
Kapitel 2
Ein recht derangierter Del Capslock kam aus der Herrentoilette im Untergeschoß des Polizeipräsidiums gestolpert; er fingerte noch an den Knöpfen des Hosenschlitzes seiner Jeans herum und machte insgesamt den Eindruck, als sei er durch die Hölle gezogen worden. Schritte dröhnten durch den dunklen Flur hinter ihm, und als er sich umdrehte, sah er Sloan mit einem dünnen Lächeln auf dem hageren Gesicht auf sich zukommen.
»Na, du hast wohl ein kleines Spielchen mit dir selbst getrieben«, sagte Sloan, und seine Stimme hallte durch den am Wochenende leeren Flur. Sloan war adrett, aber recht farblos gekleidet – in eine Khaki-Hose und einen braunen Parka mit einknöpfbarem Wollfutter. »Ich hätte es mir denken können; ich wußte schon längst, daß du irgendwie pervers bist. Ich wußte nur nicht, daß bei dir genug vorhanden ist, um damit rumzuspielen.«
»Meine Frau hat mir diese Calvin-Klein-Jeans gekauft«, sagte Del und zog die Hose über die Hüfte hoch. »Sie hat statt ’nem Reißverschluß Knöpfe am Hosenstall.«
»Die Theorie der Knöpfe ist eigentlich recht einfach«, begann Sloan. »Du nimmst dieses runde, flache Ding und ...«
»Ja, du Arschloch«, knurrte Del. »Das Problem ist, daß Calvin Klein Jeans für fette Typen produziert. Diese hier sollen angeblich eine Bundweite von siebenundachtzig haben, in Wirklichkeit sind es aber mindestens siebenundneunzig. Ich kriege die störrischen Knöpfe nur schwer zu, und wenn ich es dann doch geschafft habe, rutscht diese verdammte Scheißhose dauernd runter.«
»So?« Sloan war nicht länger an diesem Thema interessiert. Sein Blick wanderte durch den Flur, während Del den Kampf gegen die Hosenknöpfe fortsetzte. »Hast du Lucas gesehen?«
»Nein.« Del schaffte es bei einem der Knöpfe. »Sieh mal, der Vorteil von Knöpfen ist natürlich, daß man sich den Schwanz nicht in ’nem Reißverschluß einklemmen kann.«
»Okay, aber vielleicht klemmst du ihn dir in ’nem Knopfloch ein.«
Del fing an zu lachen, was ihm die Arbeit an den Knöpfen zusätzlich erschwerte. »Halt jetzt mal die Schnauze«, sagte er. »Bis auf einen habe ich es geschafft ... Du könntest mir ja beim letzten Knopf helfen.«
»Das mache ich auf keinen Fall; es ist ein zu schöner Tag, um wegen eines schweren Falls gleichgeschlechtlicher Unzucht eingelocht zu werden.«
»Man darf doch ruhig zugeben, welche Freunde man hat«, brummte Del. »Warum suchst du Lucas?« Er hatte es endlich geschafft, den letzten Knopf am Hosenstall zuzuknöpfen, und sie gingen die Treppe hoch zu Lucas Davenports neuem Büro im ersten Stock.
»Ein VIP-Typ ist umgelegt worden«, sagte Sloan. »Dan Kresge, drüben von der Polaris-Bank.«
»Nie von ihm gehört.«
»Aber doch von der Polaris-Bank, oder?«
»Ja, natürlich. Das große Gebäude mit der schwarzen Glasfassade.«
»Er ist der Boß dort. Oder besser, war es – jemand hat ihn oben im Garfield County umgelegt. Der dortige Sheriff hat Rose Marie angerufen, die hat dann Lucas angerufen, und Lucas hat mich angerufen, ich soll vorbeikommen.«
»Aus Freundschaft – oder wegen der Überstunden?«
»Ich mache so was gerne«, sagte Sloan freundlich. Er hatte eine Tochter auf dem College, und das kostete viel Geld; es wurde nie darüber geredet, aber Davenport verschaffte ihm immer wieder einmal gutbezahlte Überstunden. »Großartiger Tag für so was – obwohl die Färbung schon fast ganz vorbei ist. Die Färbung der Bäume, meine ich.«
»Ich scheiß auf Bäume. Kresge ... Geht’s um Mord?«
»Das wissen wir noch nicht«, sagte Sloan. »Heute ist der Eröffnungstag der Rotwildjagd. Er wurde von einem Ansitz auf einem Baum runtergeschossen.«
»Wenn ich jemanden umlegen wollte, würd ich’s auch so machen«, sagte Del.
»Ja, jeder sagt das.« Davenports Büro war nicht verschlossen, aber leer. »Rose Marie ist da«, sagte Sloan, als sie hineingingen. »Lucas hat gesagt, wenn er nicht da wäre, sollte ich hier auf ihn warten.«
Lucas stand auf, um das Büro von Rose Marie Roux, der Polizeichefin, zu verlassen, fragte sie dann aber doch, warum sie keine einfachere Methode anwende, zum Beispiel diese Nikotin-Pflaster.
»Weil ich dann meine ganze Körperoberfläche mit diesen Dingern bepflastern müßte, um genug Nikotin abzukriegen. Ich müßte sie mir sogar auf die Fußsohlen kleben.«
Es war der dritte Tag ihres Entzugs, und sie kaute sich durch ein Päckchen Nikotinkaugummi. Lucas nahm seine Jacke, grinste sie an und sagte: »Vielleicht würde ein bißchen Speed helfen. Sie kriegen den Kick, aber kein Nikotin in den Körper.«
»Großartige Idee, mich statt des Rauchens vom Speed abhängig zu machen«, knurrte Roux. »Natürlich, dann würde ich wahrscheinlich abnehmen. Wenn ich nichts unternehme, lege ich neunhundert Pfund zu.« Sie wog bereits jetzt zuviel und war nun auch noch dabei, appetitfördernd ihre Geschmacksknospen vom Marlboro-Land zurückzugewinnen. Sie lehnte sich über den Schreibtisch. »Hören Sie zu, rufen Sie mich an, und geben Sie mir einen Kurzbericht, sobald Sie vor Ort einen ersten Eindruck gewonnen haben. Und ich erwarte die Feststellung, daß es sich um einen Unfall handelt. Ich will nichts von einem verdammten Mord hören.«
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte Lucas. Er ging zur Tür.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?« fragte Roux.
»Nein.« Er blieb stehen und schaute sie über die Schulter an.
»Ich mache mir Sorgen um Sie«, sagte Roux. »Eine dunkle Wolke scheint über Ihrem Kopf zu schweben.«
»Ich habe viel zu tun ...«
»Darüber mache ich mir keine Sorgen – ich mache mir Sorgen um Sie«, sagte Roux. »Ich hatte dasselbe Problem – Sie wissen das. Ich habe es inzwischen dreimal durchgestanden, und ich kann nur sagen, daß Ärzte einem helfen können. Sehr sogar.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich wieder losgeht«, sagte Lucas. »Noch bin ich nicht in die volle Tiefe abgesackt. Ich kann die Dinge immer noch ... aufhalten.«
»Okay«, sagte Roux und nickte skeptisch. »Wenn Sie aber den Namen eines Arztes brauchen – meiner ist gut.«
»Danke.« Lucas ging hinaus in den Flur, schloß die Bürotür hinter sich und war plötzlich schlechter Laune. Er haßte es, an die Depression erinnert zu werden, die am Rand seines Bewußtseins darauf lauerte, ihn zu überfallen. Sie war so etwas wie ein Nagetier, eine Ratte, die an seinem Gehirn nagte.
Er würde nicht noch einmal durch diese Hölle gehen. Ein Arzt – vielleicht; vielleicht aber auch nicht. Aber er würde das nicht noch einmal mitmachen ...
Del saß auf einem von Lucas’ Besucherstühlen, hatte einen Fuß auf Lucas’ Schreibtisch gelegt, blies Rauch zur Decke und sagte: »Was schlägst du denn vor? Sollen wir ihm zur Aufheiterung ’nen Schwulen schicken oder was?«
Lucas’ Büro roch nach neuem Teppich und neuer Farbe. Durch die Fenster sah man hinaus auf die Fourth Street; ein wunderschöner Herbsttag, klar, blauer Himmel, und junge blonde Frauen mit geröteten Wangen und langen, abgetragenen Mänteln waren mit ihren männlichen Begleitern unterwegs zum Metrodome, um sich ein Footballspiel der Universität von Minnesota anzusehen.
Sloan, der auf Lucas’ Drehstuhl saß, sagte: »Der Mann leidet. Wir könnten ... ich weiß auch nicht. Mit ihm ausgehen. Ihn abends irgendwie beschäftigen.«
Del stöhnte. »Ja, richtig. Wir gehen mit ihm zum Essen, nehmen unsere Frauen mit. Und wir reden denselben Scheiß, den wir den ganzen Tag im Dienst reden, denn wir können ja schlecht über die Sache mit Weather reden. Dann ist das Essen zu Ende, und wir gehen mit unseren Frauen nach Hause. Er geht auch nach Hause und sitzt mit seinem Schwanz in der Hand allein im Dunkeln rum.«
»Was willst du damit sagen?« fragte Sloan.
»Was ich sagen will, ist, daß er allein ist, und darin besteht das ganze verdammte Problem ...« Dann legte Del den Zeigefinger auf die Lippen und senkte die Stimme. »Er kommt ...«
Als Lucas sein Büro betrat, hatte er das Gefühl, daß sein Kommen ein plötzliches Schweigen hervorgerufen hatte. In letzter Zeit hatte er dieses Gefühl öfter gehabt.
Lucas war ein großgewachsener Mann mit breiten Schultern und einem markanten Gesicht, auf dem sich noch Spuren einer Sommerbräune gehalten hatten. Eine dünne weiße Narbe zog sich wie ein Stück Angelschnur durch die rechte Augenbraue bis über die Wange. Eine andere Narbe verlief quer über seinen Hals – das Überbleibsel eines Luftröhrenschnitts, den ein Freund mit einem Klappmesser an ihm vorgenommen hatte.
Sein dunkles Haar zeigte erste graue Spuren, und seine Augen waren von einem auffallend intensiven Blau. Er trug eine Lederjacke, ein schwarzes Seidensweatshirt, unter dem der Kragen eines blauen Hemdes hervorschaute, Jeans und eine 45er in einem im Hosenbund eingearbeiteten Holster.
Er nickte Del zu, giftete dann Sloan an: »Runter von meinem Stuhl, oder ich erwürge dich!«
Sloan gähnte erst einmal und gab dann betont langsam den Stuhl frei. »Hast du deine Jeans chemisch reinigen lassen?« fragte er.
»Was?« Lucas schaute hinunter auf seine Jeans.
»Sie sehen so glatt aus«, erklärte Sloan. »Haben fast eine Bügelfalte. Wenn ich Jeans trage, sehe ich immer aus, als würde ich mich dranmachen, irgendwas anzustreichen.«
»Selbst wenn du einen Smoking trägst, siehst du aus, als würdest du dich dranmachen, irgendwas anzustreichen«, sagte Del.
»Mr. Modebewußt höchstpersönlich spricht zu uns«, kommentierte Sloan.
Del trug bereits seinen Winterparka, dunkel-oliv mit einem Aufnäher des DDR-Heeres am linken Oberarm, ein dunkles Sweatshirt mit der Aufschrift »Eat More Muffin«, feuerrote Turnschuhe mit Löchern über den großen Zehen, durch die dünne schwarze Socken zu sehen waren – Del litt unter Fußballenentzündungen –, sowie die übergroßen Calvin-Klein-Jeans. »Du Arschloch«, erwiderte er.
»Was ist los?« fragte Lucas und sah Del an. Er ging um den Schreibtisch herum und setzte sich auf den von Sloan geräumten Stuhl, drehte einen zur Standardausrüstung der Polizei zählenden Schreibblock zu sich herum, starrte darauf, riß das oberste Blatt ab und knüllte es zu einem Ball zusammen.
»Wir haben gerade überlegt, was wir tun können, um dich aus dieser Scheiße rauszuholen«, sagte Del ohne Umschweife.
Lucas schaute auf, zuckte dann die Schultern. »Da gibt’s nichts zu tun.«
»Weather kommt bestimmt zu dir zurück«, sagte Sloan. »Sie ist doch viel zu vernünftig, um sich echt von dir zu trennen.«
Lucas schüttelte den Kopf. »Sie kommt nicht zu mir zurück, und mit Vernunft hat das alles nichts zu tun.«
»Weather und du – ihr seid solche Arschlöcher«, sagte Del.
»Du sagst ›Arschloch‹ viel zu oft«, tadelte Sloan.
»Ja, Kumpel, du Arschloch«, sagte Del scherzhaft, aber doch mit einem giftigen Unterton in der Stimme.
Lucas schnitt den Disput ab: »Können wir gehen, Sloan?«
Sloan nickte. »Ja.«
Lucas sah Del an. »Was machst du eigentlich hier?«
»Ich suche den Rat und die Hilfe meiner Vorgesetzten«, sagte Del. »Ich habe es mit einem Opium-Ring zu tun, bestehend aus siebenundfünfzig Mitgliedern, fast alle wohnhaft in Minneapolis und den westlichen Vorstädten, besonders den reichen wie Edina und Wayzata. Ein oder zwei Mitglieder auch in St. Paul. Bauen das Zeug hier unter unseren Augen an. Besitzen es, benutzen es selbst – verkaufen es vielleicht auch in kleinen Mengen.«
Lucas runzelte die Stirn. »Wie zuverlässig sind die Erkenntnisse?«
»Absolut zuverlässig.«
»Okay, dann sag mir mal was.« Er richtete den Zeigefinger auf Del. »Ist der verdammte Genosse etwa wieder aus dem Knast? Ich dachte, er sei für fünfzehn Jahre eingebuchtet.«
Del schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Also – wer steckt dann dahinter?«
»Es handelt sich um siebenundfünfzig alte Ladys des Mountbatten-Gartenclubs«, erklärte Del. »Ich habe die Mitgliederliste.«
Sloan und Lucas sahen sich stirnrunzelnd an; dann sagte Sloan: »Wie bitte?«
Und Lucas fragte: »Woher hast du die Liste?«
»Von einer der alten Ladys«, sagte Del. »In dem Club gibt es nur alte Ladys.«
»Zum Teufel, wovon redest du überhaupt?« fragte Lucas.
»Als ich nach dieser Zickzackscheren-Sache in die Hennepin-Klinik ging, um mir den Finger nähen zu lassen, erzählte mir der Arzt dort, er habe einen Alte-Lady-Junkie in Behandlung. Es ging ihr schlecht wegen des Opiumkonsums, aber sie dachte, sie hätte eine Grippe oder so was. Es stellte sich raus, daß sie seit Jahren Mohn anbaute. Nicht nur sie, der ganze Club. Sie sammeln am Ende des Sommers die Mohnkapseln und machen sich Tee daraus – Opium-Tee. Eine ganze Reihe von ihnen ist bereits abhängig, kocht sich drei- bis viermal am Tag diesen Tee.«
Lucas rieb sich die Stirn. »Del ...«
»Was ist?« Del sah Sloan an, bereit, seine Sache zu verteidigen. »Was ist? Soll ich das denn einfach ignorieren?«
»Ich weiß nicht«, sagte Lucas. »Woher haben die Ladys denn den Samen für diesen speziellen Mohn bekommen?«
»In Samengeschäften«, antwortete Del.
»Quatsch«, knurrte Lucas. »Man kann doch nicht einfach in ein Geschäft gehen und Samen von Opium-Mohn kaufen.«
»Doch«, sagte Del. »Ich habe jedenfalls welchen bekommen.« Er griff in seine Parkatasche und zog ein halbes Dutzend Samentütchen heraus. Lucas, der sich in Gartendingen nicht auskannte, las erstaunt die Sortennamen.
»Das gibt’s doch nicht!«
»Doch, das gibt’s. Sie haben unverfängliche Namen, aber ich habe mit einem Fachmann an der Uni gesprochen, und, Bruder ...« Er breitete die Tütchen auf dem Schreibtisch aus. »Es handelt sich um Samen von Opium-Mohn.«
»O Mann!« Lucas rieb sich wieder die Stirn. Müde. In letzter Zeit war er so oft müde ...
»Zum Teufel mit den alten Ladys«, sagte Sloan. «Komm, Lucas, wir verschwinden.«
»Ich rede später noch mal mit dir darüber« sagte Lucas zu Del. »Und versuche inzwischen, um Himmels willen, irgendeinen Fall zu finden, der echt gefährlich ist.«
Lucas und Sloan nahmen Lucas’ neuen Chevy Tahoe: Kresges Leiche, so hatte man ihnen gesagt, lag abseits großer Straßen irgendwo im Gelände.
»Ich will dich wegen deines ... ehm, bedrückten Zustands nicht weiter drängen«, sagte Sloan. »Laß es mich einfach wissen, wenn ich was für dich tun kann.«
»Ja, das mach ich«, sagte Lucas.
»Und du solltest darüber nachdenken, Tabletten zu nehmen.«
»Ja, ja, ja ...«
»Ist ...Wie geht’s Weather?«
»Ist noch in der Therapie. Es geht ihr besser ohne mich, und es wird schlechter, wenn ich bei ihr bin. Und sie hat andere Freunde, von denen ich jetzt abgeschnitten bin. Sie baut sich ein neues Leben auf, und ich gehöre nicht mehr dazu.«
»O Gott ...«
»Als sie ausgezogen ist«, fuhr Lucas fort, »hat sie ein Kleid im Schrank hängenlassen: das grüne für dreitausend Dollar. Das vorgesehene Hochzeitskleid.«
»Vielleicht bedeutet das, daß sie zurückkommen will.«
»Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, daß sie es einfach aufgegeben hat.«
Sie legten fast den ganzen Rest der Fahrt nach Norden, durch eine Landschaft im letzten Aufglühen der Herbstfarben, in düsterem Schweigen zurück; aber das Ende war in Sicht – die tote Jahreszeit nahte.
Jacob Krause, der Sheriff des Garfield County, kauerte gerade neben der Leiche und sprach mit dem amtlichen Leichenbeschauer, als er Lucas und Sloan den Hang herunterkommen sah. Sie wurden von einem dicken Mann in grell-orangefarbener Jagdjacke sowie einem uniformierten Deputy Sheriff, der einen Schäferhund an der Leine hielt, begleitet. Der Deputy deutete auf Krause, drehte sich dann um und ging zurück zum Blockhaus.
»Ist er das?« fragte Krause.
Der Arzt schaute hoch, sagte dann: »Ja. Davenport ist der größte von den dreien. Der andere, der in der braunen Jacke, ist Sloan, auch ein Prominenter bei der Mordkommission. Den dicken Typen kenne ich nicht.«
»Er ist einer von uns«, sagte der Sheriff. Sein Gesicht wirkte wie das eines traurigen, blauäugigen Bluthundes, und er hatte ein kleines braunes Muttermal, das wie ein aufgeklebtes Schönheitspflaster aussah, im rechten Mundwinkel an seiner Oberlippe. Er seufzte und fügte hinzu: »Leider.«
Ein paar Meter daneben waren zwei Angehörige der Spurensicherung dabei, Plastiktütchen mit Beweismaterial für die Laboruntersuchung in einem Spezialkoffer zu verstauen; auf der Anhöhe warteten zwei Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens mit einem Blechsarg auf ihren Einsatz. Sie würden die Leiche zunächst einmal zur Autopsie zum Hennepin-County-Krankenhaus bringen. Krause schaute ein letztes Mal auf Kresges kreidebleiches Gesicht, richtete sich dann auf und ging den drei Männern den Pfad hinauf entgegen. Er beeilte sich nicht, sah zu, wie Davenport und Sloan und der dicke Mann den Pfad herunterkamen – wie Holmes und Watson in Begleitung von Oliver Hardy auf einem Sonntagsspaziergang. Als sie näher kamen, sah Krause, daß Davenport Mokassins mit Troddeln trug, daß seine Socken ein schwarz-weißes Diamantmuster zeigten und daß das Leder der Mokassins zum Leder seiner Jacke paßte. Er seufzte wieder – die schnelle Urteilsbildung über diesen Mann reichte, um seine allgemeine Verunsicherung noch zu steigern.
»Hallo, ich bin Lucas Davenport ...« Lucas streckte die Hand aus, der Sheriff ergriff sie, war über ihre Größe und Härte erstaunt – und über die Traurigkeit in Davenports Augen. »Und das ist wohl Detective Sloan«, ergänzte der Sheriff und schüttelte auch ihm die Hand. »Ich bin Jake Krause, der Sheriff.« Er schaute an den beiden vorbei auf den dicken Mann. »Wie ich sehe, haben Sie Arne bereits getroffen.«
»Drüben bei den Wagen«, sagte der dicke Mann. »Was hast du rausgefunden, Jake?«
»Die Spurensicherung ist noch bei der Arbeit, Arne. Es wäre mir recht, wenn du nicht zu nahe kämst. Wir müssen versuchen, den Schaden am Tatort so gering wie möglich zu halten.«
»Okay«, sagte der dicke Mann. Er legte den Kopf schief und schaute an den anderen vorbei auf die Leiche in der orangefarbenen Jacke, auf den immer noch darüber kauernden Amtsarzt und die beiden Leute von der Spurensuche mit ihrem Spezialkoffer.
»Unfall?« fragte Lucas.
Krause zuckte die Schultern. »Kommen Sie, schauen Sie es sich selbst an und sagen mir dann Ihre Meinung dazu. Arne, du wartest besser hier, okay?«
»Natürlich ...«
Auf dem Weg zur Leiche fragte Lucas den Sheriff: »Arne ist wohl irgendwie ein Problem für Sie, oder?«
»Er ist der Vorsitzende des County-Polizeiausschusses. Man hat ihm diesen Job gegeben, weil ihm niemand eine Vorgesetztenposition oder auch nur die Verwaltung unserer Finanzen zutraute. Darüber hinaus ist er Reserve-Deputy. Er ist kein schlechter Kerl, einfach nur ein allgemeines Ärgernis. Und es scheint ihm irgendwie zu gefallen, Leichen zu betrachten.«
»Ich kenne solche Typen«, sagte Lucas. Er schaute zu dem Ansitz im Baum hoch, während sie auf die Leiche zugingen, und fragte: »Kresge wurde vom Ansitz da oben runtergeschossen?«
»Ja, die Kugel hat ihn genau ins Herz getroffen«, antwortete Krause. »Ich glaube nicht, daß er danach noch länger als zehn Sekunden gelebt hat.«
»Irgendeine Chance, das Geschoß zu finden?« fragte Sloan.
»Nein. Die Kugel steckt irgendwo im Sumpf da draußen. Die ist unwiederbringlich weg.«
»Aber Sie sind sicher, daß er oben auf dem Ansitz erschossen wurde?« vergewisserte sich Sloan.
»Ja, ganz sicher«, bestätigte Krause. »Es sind ein paar Blutspuren am Geländer und Fäden von seiner Kleidung an den Kanten der Bodenbretter da oben – sie können nur dort haftengeblieben sein, als er über den Rand des Ansitzes nach unten gestürzt ist.«
Lucas trat zu der Leiche, die mit dem Gesicht nach oben etwa vierzig Zentimeter neben einem kleinen Haufen blutgetränkter Eichenblätter lag. Kresges Gesicht zeigte weder Überraschung noch Trauer, noch irgendeinen anderen Ausdruck, den es bei Eintritt des Todes gezeigt haben könnte. Es sah einfach nur tot aus, wie ein zusammengeknülltes Stück Abfallpapier. »Wer hat die Leiche berührt, die Lage verändert?«
»Als erste einige andere Mitglieder der Jagdgesellschaft. Sie haben seine Jacke geöffnet, um den Herzschlag zu überprüfen und sicherzugehen, daß er tatsächlich tot war. Und er war tot. Dann haben der Doc hier« – Krause nickte zu dem Amtsarzt hinüber – »und ich ihn zur Seite gerollt, um uns die Austrittswunde der Kugel anzusehen.«
Lucas nickte dem Arzt zu, sagte: »Hey, Dick, ich hörte, daß Sie hier sein würden.« Der Arzt reagierte nur mit einem »Hmmm«, und Lucas bat: »Rollen Sie ihn mal auf die Seite, okay?«
»Natürlich.«
Der Arzt packte den Jackenkragen der Leiche und zog sie in die Seitenlage. Lucas und Sloan schauten auf den Rücken, wo dicht über dem Schulterblatt ein kleines Loch – eine Motte hätte es hineingefressen haben können – von einem handtellergroßen Blutfleck umgeben war. Lucas sagte: »Aha«, und er und Sloan traten ein Stück nach links, sahen sich den Einschuß in der Brust an, dann von rechts wieder den Ausschuß. Gleichzeitig drehten sich beide um und schauten den Hang hoch, warfen sich dann einen Blick zu, und Lucas sagte: »Okay.« Der Arzt ließ die Leiche wieder auf den Rücken sinken.
Lucas rieb sich die kalten Hände und grinste den Sheriff an. Das Grinsen war so kalt, daß der Sheriff sein eben gefälltes, schnelles Urteil – teuer gekleideter Lackaffe, engagiert sich wahrscheinlich nicht besonders bei diesem Fall – revidierte. »Guter Schuß«, sagte Lucas.
»Was sind Ihre Schlußfolgerungen?« fragte Krause.
»Der Schütze ist nahe rangekommen«, sagte Lucas.
»Der Schußwinkel durch den Körper verläuft aufwärts, und das beweist eindeutig, daß sich der Schütze unterhalb des Opfers befand«, erklärte Sloan. »Und wenn der Schütze sich bei Abgabe des Schusses tiefer als Kresge befand« – sie schauten alle zurück auf den Hang –, »dann kann er nicht weiter als dreißig bis vierzig Meter von ihm weg gewesen sein. Natürlich, wir wissen nicht, wie Kresges Sitzposition in diesem Moment war. Er könnte sich gerade zur Seite gelehnt und den Hang raufgeschaut haben. Oder er könnte zurückgelehnt dagesessen haben, als die Kugel ihn traf.«
»Das glaube ich nicht, nach diesem Schußkanal«, sagte Krause.
»Ich auch nicht«, bestätigte Lucas.
»Eines steht jedenfalls fest – es war Mord«, faßte Krause zusammen. Er schüttelte den Kopf, schaute von der Leiche hoch zu Lucas. »Ich wünschte, Sie hätten diese ganze verdammte Scheiße bei sich in der Stadt behalten.«
»Was dagegen, wenn ich mich auf dem Ansitz umsehe?« fragte Lucas die Cops von der Spurensicherung.
»Wenn der Sheriff nichts dagegen hat – wir sind jedenfalls fertig da oben«, antwortete einer der beiden.
»Machen Sie nur«, sagte Krause.
Lucas kletterte an den Steigeisen hoch. Als er die Plattform erreichte, schaute er nach unten und fragte: »Wie sieht’s mit einem Motiv aus?«
Krause nickte. »Ich habe die Leute drüben im Blockhaus danach gefragt. Statt eines Namens hat man mir eine Schätzung genannt: fünfzehnhundert möglicherweise zweitausend Leute.«
Sloan nickte. »Aha. Und wieso?«
»Da ist eine Bankenfusion im Gang ...«
Lucas hörte Krauses Erklärung der Fusion zu, während er sorgfältig den Rucksack untersuchte, der an einem Haken am Baumstamm hing. Er erinnerte sich, daß er Storys über Bankenfusionen in der Star-Tribune gelesen hatte. Er hatte ihnen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt – bankinternes, juristisches Gemauschel, hatte er gedacht.
»Jedenfalls war Kresge mit einer Gruppe von Topmanagern seiner Bank zur Jagd hergekommen«, spulte Krause seine Story weiter ab. »Einige von ihnen, vielleicht sogar alle, werden bei der Fusion ihre Topmanagerjobs verlieren.«
»Sind das die Leute, die wir drüben beim Blockhaus gesehen haben?« fragte Lucas. Er war mit der Untersuchung des Rucksacks fertig, ließ ihn an dem Krampen hängen und kletterte wieder hinunter.
»Ja«, sagte Krause mürrisch. »Sie haben mir diese Fusionsstory erzählt.«
»Ihn zu erschießen scheint aber eine recht extreme Lösung der Probleme zu sein«, meinte Sloan.
»Warum?« fragte Krause. Er meinte es ernst, und Sloan schaute Lucas an, dann wieder den Sheriff, der seine Frage begründete: »Soweit ich das alles verstanden habe, war Kresge dabei, das Leben Hunderter von Menschen aus den Angeln zu heben, ja, zu zerstören. Einige von ihnen – zum Teufel, wahrscheinlich die meisten von ihnen – werden nie mehr so gute Jobs bekommen, nie mehr in ihrem Leben. Und er hat das alles nur gemacht, um noch mehr Geld zu scheffeln, als er schon hatte, und das war bereits ein großer Sack voll. Für mich klingt es ausgesprochen rational, ihn ins Jenseits befördern zu wollen. Falls man darauf hoffen kann, nicht erwischt zu werden.«
»Ich würde diese Meinung nicht der Presse gegenüber äußern«, sagte Lucas sanft. Er trat wieder zur Leiche, ließ sich auf ein Knie nieder und begann, die Taschen des Toten zu durchsuchen.
»Ich sage nie was zur Presse, das ich nicht mit meiner Frau besprochen habe«, grunzte Krause, während er Lucas zusah. »Sie hat mir noch nie einen falschen Rat gegeben.« Dann, nach einer kurzen Pause, fügte er hinzu: »Es gibt noch eine andere Möglichkeit als Motiv für den Mord: seine Frau. Sie standen kurz vor der Scheidung.«
»Das könnte eine Rolle gespielt haben«, stimmte Lucas zu. Er tastete durch die Handschuhe suchend Kresges Hände ab, stand dann auf und knetete seine Finger.
»Die Leute da drüben im Blockhaus sagten, die Abmachungen zur Scheidung seien unterschrieben und besiegelt, nur noch nicht richterlich bestätigt, und Kresges Frau habe sich dabei den Großteil des Vermögens unter den Nagel gerissen.«
»Was die Möglichkeit eines Motivs für sie reduziert«, sagte Sloan.
»Ja, es sei denn, sie hat ihn gehaßt«, gab Lucas zu bedenken. »Und das könnte ja sein.«
Sloan öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloß ihn dann wieder – dachte plötzlich an Weather ... Krause fragte Lucas: »Haben Sie irgendwas Besonderes in dem Rucksack entdeckt?«
»Ein paar Snickers, ein paar M&M-Schokoriegel, ein halbes Dutzend Handwärmpackungen.«
»Dasselbe, was ich gefunden habe«, bestätigte Krause.
»Gehen Sie auch auf die Hirschjagd, Sheriff?« fragte Lucas.
»Nein. Ich bin Angler. Ich wollte heute nachmittag die Hechtsaison abschließen, ehe die Gewässer zufrieren. War gerade dabei, meinen Truck zu beladen, als der Anruf kam. Warum fragen Sie?«
»Auf einem Ansitz im Baum wird es im November genausokalt wie beim Angeln von Hechten«, sagte Lucas.
»Kälter als die kalte Hölle«, bestätigte Krause.
»Richtig. Aber Kresge hatte nichts von seinem Proviant gegessen und die Handwärmer nicht benutzt, obwohl er sie mitgebracht und natürlich beabsichtigt hatte, sie zu benutzen. Er war also wahrscheinlich noch nicht sehr lange auf dem Ansitz, als er erschossen wurde.«
»Hat irgend jemand vorzeitige Schüsse gehört?« fragte Sloan.
»Ich habe die anderen Leute nach ungewöhnlichen Schüssen gefragt, aber keiner hat so was gehört. Bone, einer aus der Gruppe, sagte, er habe gedacht, entweder Kresge oder Robles, einer der anderen, habe kurz nach der offiziellen Freigabe der Jagd einen Schuß abgegeben. Aber Robles sagte, er habe nicht geschossen, und sein Gewehr war tatsächlich nicht abgefeuert worden, ebensowenig das von Kresge.«
»Wie lange saßen die Leute zu diesem Zeitpunkt auf ihren Hochsitzen?«
»Ungefähr fünfundvierzig Minuten.«
Lucas nickte: »Dann war das wahrscheinlich der Todesschuß. Kresge war es bis dahin sicher noch nicht zu kalt.«
Sie sprachen noch einige wenige Minuten über nebensächliche Dinge, dann ließen sie den Amtsarzt bei der Leiche zurück und machten sich durch den Wald auf den Weg zum Blockhaus. Als sie an den beiden Angestellten des Bestattungsunternehmens vorbeikamen, die es sich inzwischen auf dem Blecksarg bequem gemacht hatten, sagte Krause: »Er gehört jetzt euch, Jungs.«
Dann redete der Sheriff sich seine leichte Verbitterung von der Seele: »War bis jetzt ein ruhiger Monat. Keine Tötungsdelikte, keine Vergewaltigungen, keine Raubüberfälle, nur ein halbes Dutzend der üblichen Fälle – ein paar Autounfälle unter Alkoholeinfluß und ein paar unbedeutende Einbrüche. Dieser Fall versaut uns die Statistik.«
Lucas reagierte nicht darauf, sagte: »Der Mörder mußte den Ort im Dunkeln finden – er muß ihn also genau gekannt haben.«
»Es sei denn, er kam nach Anbruch der Morgendämmerung«, sagte Krause. »Das wäre möglich.«
»Ja, aber als wir ankamen, hat Ihr Deputy – der mit dem Hund – uns gezeigt, wo dieser Robles seinen Ansitz hatte und die Richtung, wo die anderen waren. Der Mörder hätte es riskieren müssen, gesehen zu werden, es sei denn, er kannte sich bestens in der Umgebung aus.«
»Und selbst wenn er das alles berücksichtigt hätte, er hätte von den anderen erkannt werden können«, warf Sloan ein. »Und das bedeutet, daß er sich wohl doch bei Dunkelheit angeschlichen hat.«
»Es könnte natürlich einer von diesen Leuten gewesen sein«, sagte Krause. »Sie hatten alle erforderlichen Informationen, darüber hinaus auch einen Grund dafür, mit einem Gewehr in der Gegend rumlaufen zu dürfen ... Und sie wußten, daß niemand angerannt kommen würde, wenn ein Schuß fiel.«
»Ja, es könnte einer von diesen Leuten gewesen sein«, bestätigte Lucas. »Aber dann muß er verdammt viel Mumm in den Knochen haben.«
»Oder er ist ein Irrer«, sagte Sloan.
Von der Anhöhe aus konnten sie am Ende des Pfades ein halbes Dutzend Leute auf der Veranda des Blockhauses stehen oder sitzen sehen. Ein Mann in einem rotkarierten Hemd sprach lebhaft auf die anderen ein. Ein kleiner Mann in einem blauen Anzug saß abseits von den anderen.
»Wie sieht es mit der Befragung dieser Leute aus?« fragte Lucas, während sie den Hang hinunter auf das Blockhaus zugingen. »Wer hat sie gefragt?«
»Ich und einer meiner Leute, Ralph – der Mann da drüben in dem blauen Anzug.«
»Ist er gut?«
Der Sheriff dachte einen Moment nach, sagte dann: »Ralph wäre nicht in der Lage, Pisse aus einem Stiefel zu gießen, nicht mal, wenn eine schriftliche Bedienungsanleitung dazu an der Ferse angebracht wäre.«
Sloan fragte: »Wieso macht er dann ...«
»Ich versuche, ihn mir aus dem Weg zu halten, aber er war heute morgen als Telefonwache im Büro, und ich mußte ihn mitnehmen.«
»Hat er die Gewehre der Leute eingesammelt?«
»Nein, aber ich«, antwortete Krause. »Zwei davon sind abgefeuert worden – beide Schützen haben zur Erklärung erlegte Hirsche vorzuweisen. Die anderen Gewehre sind sauber.«
»Ich habe die Hirsche am Blockhaus hängen sehen ...«, sagte Lucas. »Setzen Sie Ihre Spurensicherer darauf an, die Hände und Gesichter der Leute nach Schmauchspuren zu untersuchen. Und zählen Sie die Patronen – lassen Sie sich sagen, was sie als verschossene Patronen angeben, und zählen Sie dann nach.«
»Das will ich gerne tun, bis auf das Patronenzählen«, sagte Krause. Er sah zu Lucas hoch. »Ich gehe nach Vorschrift vor. Genau nach Vorschrift. Mein Problem liegt eher bei den Vernehmungen und so weiter, bei der Begutachtung und diesem Kram.«
Lucas nickte zu Sloan hinüber. »Sloan ist der beste Vernehmungsbeamte in unserem Staat.«
Sloan grinste den Sheriff an und sagte: »Da hat er recht.«
»Dann möchte ich Sie gern für eine Weile ausleihen«, sagte Krause. »Wenn Sie Zeit dafür haben, natürlich.«
»Paßt mir gut in den Kram«, sagte Sloan. »Überstunden sind Überstunden ...«
»Besteht auch die Möglichkeit, daß Sie für mich ein paar Nachforschungen in Minneapolis anstellen?« hakte Krause nach.
Sloan sah Lucas an. »Ich habe da ein paar Fälle laufen ... Sherrill stellt gerade Ermittlungen in dieser Shack-Sache an, aber sie kommt nicht so recht weiter. Vielleicht könnte sie das übernehmen.«
Lucas nickte. »Ich rufe sie heute nachmittag auf dem Rückweg an. Gib du alles, was du bei diesen Leuten rauskriegst, an sie weiter. Ich veranlasse, daß sie mit Kresges Frau spricht, nachforscht, ob er Affären mit Frauen hatte ...«
»Oder mit Männern«, unterbrach Sloan.
»Oder mit Männern, okay. Und ich sage ihr, sie soll mit den Leuten in seinem Büro sprechen – Sekretärinnen und so weiter.« Lucas sah Krause an. »Ich möchte Ihnen natürlich nicht die Untersuchung aus der Hand nehmen ...«
»O nein, nein, machen Sie sich darüber keine Gedanken«, sagte Krause hastig. »Je mehr Sie in der Sache tun können, um so besser. Meine besten Leute sind zweischwänzige Rüden in einer Hundezuchtanstalt ... Und meine anderen Leute hätten Schwierigkeiten, Minneapolis zu finden, geschweige denn einen Menschen darin.«
»Klingt so, als ob Sie gewisse Personalprobleme hätten«, stellte Sloan fest. »Erst Arne, dann Ralph ...
»Wir machen gerade eine Übergangsperiode durch«, sagte Krause verbittert. »Sehen Sie, ich bin neu in diesem Job. Ich war fünfundzwanzig Jahre bei der Autobahnpolizei, dann wurde ich im vergangenen Herbst zum Sheriff gewählt. Das Büro hinkt ungefähr fünfzig Jahre hinter der Zeit her, ist voller Ladenhüter, und alle diese Ladenhüter sind untereinander verwandt. Ich kämpfe dagegen an, aber das braucht seine Zeit. Ich nehme gern jede Hilfe an, die ich kriegen kann.«
»Wir werden alles für Sie tun, was wir können«, sagte Lucas.
Krause nickte. »Danke.« Er war darauf eingestellt gewesen, diese Typen aus Minneapolis nicht leiden zu können, aber es war anders gekommen. Für Städter waren sie eigentlich ganz nett, und er mochte sie sogar irgendwie, besonders Sloan, aber auch Davenport mit seiner teuren Kleidung und den Troddeln an den Schuhen. Er warf wieder einen schnellen Blick auf Davenport. Aus einiger Entfernung konnte man zu der Beurteilung kommen: Weichling. Wenn man ihn jedoch aus der Nähe betrachtete, hielt man dieses Urteil nicht aufrecht. Nicht mehr, nachdem man sein Lächeln gesehen hatte.
Er fügte hinzu: »Ich glaube nicht, daß ich hier bei uns in dieser Sache weit komme. Tatsächlich meine ich, daß ich gar nichts rausfinden werde – alles, was mit diesem Mord zusammenhängt, hat seinen Ursprung in Minneapolis oder St. Paul.«
Sie waren jetzt vor der Veranda angekommen, und Sloan sagte leise: »Dann wollen wir diesen Stadtmenschen doch mal auf den Zahn fühlen. Uns ansehen, ob irgend jemand nervös wird.«
Kapitel 3
Die vier Überlebenden der Jagdgesellschaft saßen auf rustikalen Holzstühlen mit abblätternder Rinde und regenfesten Plastikkissen in der Nachmittagssonne auf der Veranda. Alle hielten Becher mit mikrowellenerhitztem Kaffee in den Händen; Wilson McDonald hatte seinen zusätzlich mit einem doppelten Cognac angereichert. James T. Bone rauchte einen Stumpen und hatte sich höflich in den Windschatten der anderen gesetzt, so daß der Qualm niemanden belästigte.
Der sogenannte Untersuchungsbeamte des Sheriffs saß wie der sprichwörtliche Klassentrottel auf einem Hocker am Ende der Veranda und vermied es, die anderen anzusehen. Was mußte er tun, wenn plötzlich einer dieser Bankleute in den Wald abhaute? Ihn erschießen? Der Sheriff hatte ihm nur gesagt, »ein Auge auf die Typen zu halten«. Was, zum Teufel, aber hieß das im Klartext?
Diese Bankleute waren zweifellos sauer, und ihr Zorn war etwas, dem seine angekratzten Nerven nicht standhielten. Er konnte mit Schlägereien zwischen Leuten auf Wohnwagenplätzen umgehen und mit Koks dealenden Farmerskindern, aber Leute, die in Harvard studiert hatten, die luxuriöse Lexus- und Lincoln-Geländewagen fuhren und achthundert Dollar teure, von konzessionierten Schneidern im guten alten England hergestellte Après-Jagd-Tweedjacketts trugen – nun ja, sie machten ihn nervös. Besonders, wenn einer von ihnen ein Mörder sein konnte.
»Davenport ist ein scharfer Hund«, sagte Bone aus seinem Windschatten, während sie gemeinsam beobachteten, wie Krause seine Karawane durch den Wald zum Blockhaus führte. Bone biß zwei Millimeter vom Ende seines Stumpens ab und spuckte den Tabak ins Gras vor der Veranda. »Er wird uns bestimmt schon einiges zu der Sache sagen können.«
»Nach seinem Ruf zu urteilen, ein gemeiner Mistkerl«, sagte O’Dell ungezwungen und sah die anderen durch den Dampf ihres Kaffees an. Sie war offensichtlich nicht beeindruckt. Schließlich war sie ja von gemeinen Mistkerlen umgeben. Und wahrscheinlich traf dieses Urteil – in weiblicher Form natürlich – ja auch auf sie selbst zu.
«D-der ist d-doch auch nur ein C-Cop unter v-vielen anderen«, stotterte Robles. Er war verängstigt – die anderen konnten es riechen. Es gefiel ihnen. Robles war der Macho-Killer, und seine Angst war auf seltsame Weise wohltuend ...
»Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen, als er seine Software-Firma verkauft hat – Sie erinnern sich doch, daß er der Besitzer von Davenport Simulations war?« fragte Bone. Alle nickten; das war ein Gebiet, auf dem sie sich auskannten. »Er hat damals seine Firma an sein Management verkauft und dabei mehr als zehn eingepackt, n. S.« Er meinte damit zehn Millionen Dollar, nach Steuern.
»Warum hat er dann nicht den Dienst quittiert und ist nach Palm Springs gezogen?« fragte Robles, inzwischen ein wenig gefaßter.
»Weil ihm sein Job Spaß macht«, erklärte Bone.