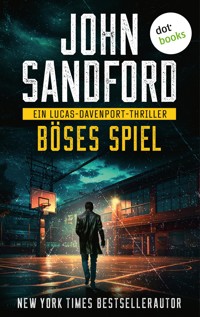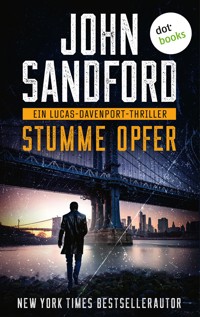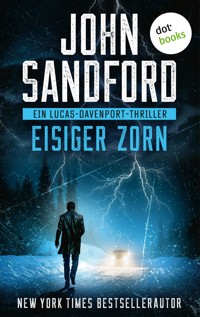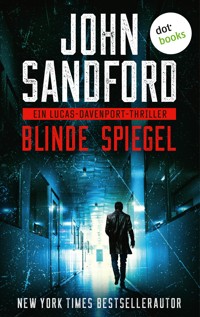9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er will dir alles nehmen, was du hast: Der actionreiche Thriller »Kalte Rache« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Es ist das älteste Mordmotiv von allen: Rache … Seit Monaten verfolgen Inspektor Lucas Davenport und seine Männer eine gerissene Bankräuberin namens Candy, der es immer wieder gelingt, in letzter Sekunde zu entwischen. Nur ein einziges Mal ist die Polizei schneller – und im folgenden Schusswechsel wird die Verbrecherin tödlich verletzt. Doch damit beginnt der Alptraum für die Ermittler erst: Candys Mann schwört all jenen Rache, die am Tod seiner Frau beteiligt waren … und schon bald sterben die ersten Polizisten. Als Davenport das Muster der Morde durchschaut, treiben ihn Wut und Verzweiflung zu einer gnadenlosen Jagd auf den Killer – denn der hat es nicht auf den Inspektor selbst abgesehen, sondern auf seine Familie … »Der Einsatz ist hoch, die Charaktere lebensnah, die Action unerbittlich.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der rasante Thriller »Kalte Rache« von John Sandford – der spektakuläre achte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Michael Connelly und Lee Child. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es ist das älteste Mordmotiv von allen: Rache … Seit Monaten verfolgen Inspektor Lucas Davenport und seine Männer eine gerissene Bankräuberin namens Candy, der es immer wieder gelingt, in letzter Sekunde zu entwischen. Nur ein einziges Mal ist die Polizei schneller – und im folgenden Schusswechsel wird die Verbrecherin tödlich verletzt. Doch damit beginnt der Alptraum für die Ermittler erst: Candys Mann schwört all jenen Rache, die am Tod seiner Frau beteiligt waren … und schon bald sterben die ersten Polizisten. Als Davenport das Muster der Morde durchschaut, treiben ihn Wut und Verzweiflung zu einer gnadenlosen Jagd auf den Killer – denn der hat es nicht auf den Inspektor selbst abgesehen, sondern auf seine Familie …
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
Die Website des Autors: www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/johnsandfordauthor/
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Sudden Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/LIKE HE und AdobeStock/Ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-096-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Kalte Rache« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Kalte Rache
Ein Lucas-Davenport-Thriller 8
Aus dem Amerikanischen von Klaus Kamberger
dotbooks.
Kapitel 1
Süße Kinderstimmen klangen von oben aus den Lautsprechern: O holy night, the stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior’s birth ...
Der Mann, der Candy LaChaise womöglich töten würde, stand in der Kälte und beobachtete sie durch die Glastür. Manchmal konnte er nur ihren Kopf sehen, manchmal nicht einmal das. Aber er blieb ihr immer auf der Spur.
Candy bemerkte ihn nicht, während sie von Regal zu Regal ging und in der Damenwäsche stöberte. Sie interessierte sich nicht wirklich für Damenunterwäsche. Weiter hinten im Kaufhaus war die Abteilung für Haushaltsgeräte, und auf die war sie neugierig. Sie blieb stehen, zog ein Bustier heraus, hielt es vor den Körper und neigte den Kopf, wie Frauen es gerne tun, prüfend zur Seite. Dann legte sie das Stück zurück und wandte sich zur Tür um.
Der Mann, der sie vielleicht töten würde, trat einen Schritt zurück außer Sichtweite.
Ein Mini-Van stoppte am Bordstein. Eine rundliche Frau in orangefarbenem Parka sprang heraus und zog die Seitentür auf. Eine Meute dicker Kinder stürmte auf den Gehsteig. Es waren Jungen und Mädchen, alle blond und vielleicht vier, fünf, sieben, acht und neun Jahre alt. Der Van fuhr weiter zum Parkplatz, und die Frau schob die Kinder in Richtung Kaufhaustür.
Der Mann zog eine Flasche aus der Tasche, steckte die Zungenspitze in ihren Hals, legte den Kopf in den Nacken und tat, als ob er einen oder zwei Schlucke nähme. Die Frau deckte die Kinder mit ihrem Körper ab und trieb sie an ihm vorbei in den Laden. Er sah sie nicht mehr, und das war ihm nur recht. Er steckte die kleine Flasche weg und blickte wieder durch die Tür.
Da war sie ja, immer noch bei der Wäsche. Er sah sich um und fluchte über diese Jahreszeit mit ihrem Weihnachtsschmuck, den schmutzigen Haufen gefrorenen Schnees an den Straßenrändern und dem Wind, der ihm durch die Wollhandschuhe schnitt. Er hatte ein schmales Gesicht, war unrasiert, und seine Haut spannte sich wie ein Trommelfell. Das Nikotin hatte seine Zähne gelb gefärbt wie altes Elfenbein. Er zündete sich eine Camel an. Seine Hände zitterten vor Kälte, als er die Zigarette zwischen die Lippen schob. Er atmete aus, und der Wind trug den Rauch und seinen dampfenden Atem fort. Er hatte das Gefühl, daß ihm noch kälter wurde.
Ein öliger Bariton, es war bestimmt nicht Bing Crosby, sang: ... Let nothing you dismaaay, Remember Christ our Sa-ay-vior was born on Christmas Day ...
Himmel, dachte er, wenn ich nur diese Musik ausschalten könnte ...
Von seinem Standort aus konnte er das goldene Kuppeldach des State Capitol sehen. Unter dem trüben Dezemberhimmel sah es eher aus, als wäre es aus verwittertem Messing. Scheiß-Minnesota. Er führte die Flasche zum Mund, und diesmal ließ er etwas Wein die Kehle hinunterrinnen. Der herbe Weingeschmack biß ihm in die Zunge, aber Wärme spendete der Alkohol nicht.
Was, zum Teufel, machte sie jetzt?
Sie wanderte bei Sears durch die Markengeräte-Abteilung, ließ sich dabei Zeit und begutachtete die Kühlschränke. Aber sie kaufte nichts. Dann schlenderte sie zur Damenoberbekleidung und sah sich Blusen an. Schließlich ging es wieder zurück zu den Markengeräten, wo sie jetzt das Angebot an Mobiltelefonen verglich.
Wieder ging sie weiter. Diesmal war er selber drinnen, und fast hätte sie ihn bei den ausgestellten Fernsehern entdeckt. Er drückte die Tür auf und trat erneut in den kalten Wind hinaus ... Doch sie war schon wieder auf dem Weg zur Damenwäsche. Hatte sie ihn gesehen? Der TV-Verkäufer bestimmt. Ihm waren seine abgewetzte Jacke und die abgetretenen Schuhe aufgefallen, und so hatte er sich neben den Toshibas mit dem Breitbildschirm postiert und ihn wie ein Habicht beäugt. Vielleicht hatte sie ...
Da. Sie war auf dem Weg nach draußen.
Candy trat vor die Tür, aber er sah sie nicht an. Er hatte sie zwar im Blickfeld, hielt den Kopf aber unbewegt. Er stand einfach an die Außenwand gelehnt, wippte auf den Absätzen, murmelte etwas in seinen Parka und nahm noch einen Schluck MD 20-20.
Candy nahm ihn nicht wirklich wahr, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Beim Verlassen des Kaufhauses drehte sie sich halb zu ihm um, aber ihr Blick ging über ihn hinweg, als stünden da nur eine Mülltonne oder ein Feuerhydrant. Sie ging mit leichten, athletischen Schritten, eine selbstsichere, heitere Frau. Sie war hübsch, in den Dreißigern, und erinnerte an ein Cheerleader-Girl von der High-School, hatte naturblondes Haar, ein rundes Wisconsin-Gesicht und einen glatten Wisconsin-Teint.
Sie hatte den halben Parkplatz überquert, als sie den Chevy-Van entdeckte. Sie steuerte auf ihn zu.
Der Mann, der sie vielleicht töten würde und noch immer an der Tür stand, sagte: »An ihrem eigenen Wagen ist sie einfach vorbeigelaufen.«
Ein republikanischer Abgeordneter in wollenem Brooks-Brothers-Mantel hörte das und eilte in das Kaufhaus. Keine Zeit, mit so einem Straßen-Schizo eine Diskussion anzufangen: Du siehst sie überall und hörst sie ständig etwas in ihre weinbekleckerten Parkas murmeln.
»Sieht so aus, als ginge sie zu dem Van da, Kumpel.«
Candy liebte Countrymusik und Hemdtaschen mit diesen metallverstärkten Ecken. Sie tanzte gern und trank Grain Belt. Sie liebte die Rasthäuser an den Straßen draußen auf dem Land, Pickups und Cowboystiefel, kleine Kinder mit blauen Augen und Revolver. Als sie den Chevy-Van erreichte, zog sie einen großen Schlüsselring aus der Tasche und probierte einen nach dem anderen. Der zwölfte paßte. Sie öffnete die Tür.
Der Van gehörte einem leicht heruntergekommenen Waschmaschinen-Verkäufer bei Sears namens Larry. Larry hatte sie zuletzt neben einer Siebenhundert-Dollar-Kenmore-Waschmaschine mit Geräuschdämmung und automatischer Temperaturkontrolle stehen gesehen, als er gerade sein Namensschild ansteckte. Er hatte sich etwa zehn Minuten verspätet – und sie hatte angefangen, sich entsprechende Sorgen zu machen, während sie in den Blusen und der Unterwäsche stöberte. Hatte er eine Panne mit dem Van? Das brächte sie einigermaßen in Schwierigkeiten ...
Doch dann war er atemlos hereingestürzt, das Gesicht rot vor Kälte, und hatte sich gegen die Kenmore gelehnt. Larry war ein gescheiter Kerl, wie sie wußte, und für gescheite Kerle hatte sie nichts übrig. Sie wußte, daß er ein gescheiter Kerl war, weil er einen Aufkleber auf der hinteren Stoßstange hatte, und auf dem stand in großen Buchstaben geschrieben: GEGEN ABTREIBUNG? Und darunter in kleineren Buchstaben: Dann laß es eben. Abtreibung war für sie kein Thema für witzige Aufkleber.
Der Mann, der sie vielleicht töten würde, murmelte in seinen Parka: »Sie sitzt jetzt in dem Van und fährt los.«
Was ihm antwortete, war nicht Gottes Stimme. »Ich hab sie.«
War schon eine tolle Sache mit den Parkas. Keiner konnte sehen, wie er ausgerüstet war, mit Mikrophon und Ohrstöpseln. »Sie macht es«, sagte Del. Er stellte die Flasche Mogen David vorsichtig auf den Boden, um nichts zu verschütten. Er würde sie nicht mehr brauchen, aber vielleicht jemand anders.
»Franklin sagt, LaChaise und Cale sind in dem Pizza-Schuppen hinter der Rampe zur Parkebene verschwunden«, sagte die Stimme in seinem Ohr. »Sie sind hinten auf der anderen Seite der Rampe durch ein Loch in der Hecke geschlüpft.«
»Baldowern es noch mal aus, zum letzten Mal. Da werden sie dann den Van abstellen«, sagte Del. »Jetzt muß Davenport los.«
»Franklin hat ihn angerufen. Er ist unterwegs. Bringt Sloan und Sherrill mit.«
»In Ordnung«, sagte Del in neutralem Ton. Nicht in Ordnung, dachte er. Vor etwas mehr als vier Monaten hatte Marcy Sherrill eine Kugel abbekommen. Das Projektil hatte eine Arterie verletzt, und sie war fast verblutet, ehe sie im Krankenhaus ankam. Del hatte die Ader so fest abgebunden, daß Sherrill später geblödelt hatte, ihr ginge es ja ganz gut bis auf den Bluterguß in ihrem Bein, wo Del es zusammengequetscht habe.
Sherrill so bald wieder rauszuschicken könnte doch zuviel des Guten sein, dachte Del. Bisweilen demonstrierte Davenport einen gesunden Menschenverstand, der für ein Gehirn ausreichte so groß wie ... Del fiel kein passender Vergleich ein. Vielleicht wie das von einer Forelle. Besser: von einem Goldfisch.
»Sie fährt los«, sagte die Stimme.
Der Van des Verkäufers stank nach Zigarrenrauch. Candy rümpfte die Nase, aber lange würde sie ihn nicht aushalten müssen. Sie lenkte den Van vom Parkplatz und prüfte den Benzinstand: halbvoll, mehr als genug. Sie fuhr langsam einen Block weit zur Dale, dann die Dale hinunter bis zur I-94 nach Minneapolis. Georgie und Duane würden in Ham’s Pizza warten.
Sie sah auf den Tacho: vierundfünfzig Meilen. Perfekt. Gauner fuhren meistens zu schnell. Dick sagte, Verkehrsvorschriften kümmerten ihn einen Dreck, wie all dieses unwichtige Zeugs. In fünfzig Prozent aller Fälle ging das auch gut, und sie wurden nicht erwischt, aber dann hatte man sie plötzlich am Wickel, weil sie fünfundsechzig gefahren waren, wo man nur fünfundfünfzig durfte. Den Fehler wollte sie nicht machen.
Sie versuchte sich zu entspannen, sah in die Rückspiegel. Nichts Ungewöhnliches. Sie zog die P7 aus der Manteltasche, ließ das Magazin herausschnappen, preßte den Daumen gegen die oberste Patrone. Sie konnte ertasten, daß das Magazin voll war.
Dick machte sich immer lustig über diese winzigen Neunmillimeterpatronen, aber sie mochte sie. Die kleine Pistole lag ihr richtig in der Hand, und mit dem Rückstoß kam man gut zurecht. Die P7 hatte dreizehn Schuß. Neun bis zehn trafen, wenn sie sie in sieben Sekunden auf den Deckel einer Campbell-Dose abfeuerte, Entfernung acht Meter. Noch ein paarmal, und sie würde mit allen dreizehn treffen.
Keine schlechte Quote. Natürlich, Suppendosen bewegten sich nicht. Aber bei den beiden Gelegenheiten, als sie dann wirklich schießen mußte, hatte sie keinen größeren Druck gespürt als draußen bei Dicks Dosenballerei aus doppelter Entfernung. Man konnte ja nicht alles vorweg arrangieren, mußte nur die Augen offenhalten, über Kimme und Korn peilen, dem Ziel folgen, und dann gab es die kurze Sekunde, wo man einen Hemdknopf ins Ziel nahm oder einen anderen geeigneten Punkt, dann noch einmal die Waffe um weniger als einen Millimeter anhob und ...
Peng. Peng, peng.
Candy wurde ein bißchen heiß bei dem Gedanken.
Danny Kupicek hatte lange schwarze Haare, die ihm daheim von seiner Frau geschnitten wurden. Es fiel ihm über die Augen und die überdimensionale Brille. Er sah damit aus wie ein schusseliger Schuhverkäufer. Das half ihm, wenn er mit den Dopers zu tun hatte: Drogensüchtige fürchteten sich vor Leuten, die allzu smart daherkamen. Sie trauten Schuhverkäufern, Versicherungsagenten und Typen mit McDonald’s-Hüten mehr. Danny sah aus wie alle zusammen. Er stoppte den Dodge am Straßenrand, ließ Del einsteigen und fuhr weiter. Dreihundert Meter vor ihnen fuhr der Chevy-Van. Del hielt die Hände über die Heizungsdüse.
»Muß mir für den Winter wohl mal eine neue Arbeitsplatzbeschreibung verschaffen«, sagte Del. »Wo einem ein warmer Wintermantel zusteht.«
»Am besten wirst du Abgeordneter«, sagte Kupicek. Er hatte unterhalb des Kapitols in seinem Wagen gesessen und ein Auge auf Candys Auto gehabt. Dabei hatte er die Politiker kommen und gehen sehen und gemerkt, wie wohlhabend sie anscheinend waren.
»Nee«, sagte Del und schüttelte den Kopf. »So’n Gesetzesmensch möchte ich nie werden.«
»So oder so, auf dem Kopf solltest du jedenfalls etwas haben«, sagte Kupicek. Er hatte eine dicke Kordhose, einen Sweater und darunter ein Hemd mit Button-down-Kragen an, eine blaue Strickmütze und einen offenen Parka. »Die Hälfte des Wärmeverlusts geht über den Kopf.«
»Was meinst du, wofür ich die Kapuze habe?« fragte Del und zeigte auf seine Schultern.
»So was sitzt zu locker«, sagte Kupicek, als wüßte er, wovon er redete. Neun Wagen waren jetzt zwischem ihrem und Candys, als sie auf die I-94 mit ihren drei Fahrbahnen gelangten. »Darunter mußt du eine fest sitzende Wollmütze aufsetzen.«
»Ich scheiß auf Wollmützen. Was ich brauche, ist ein Schreibtischjob. Vielleicht bewerbe ich mich um ein Stipendium.«
Kupicek sah ihn an, seine gelben Zähne und den Zweitage-Stoppelbart. »Dafür bist du kaum der Richtige«, sagte er unverblümt. »Ich dagegen würde mich schon eignen. Auch Sherrill. Sogar Frank. Aber du, du ganz bestimmt nicht.«
»Ihr könnt mich mal alle, du, deine Frau und alle deine kleinen Kinder«, sagte Del. Er griff nach Kupiceks Funkgerät. »Lucas, hörst du mich?«
Davenport meldete sich sofort. »Wir stehen auf dem Parkplatz vom Swann. Wo ist sie?«
»Gerade an der Lexington vorbei«, sagte Del.
»Bleibt ihr auf den Fersen. Wenn sie am Exit 280 rausfährt, sagt mir Bescheid. Sobald sie auf der Ausfahrt ist.«
»Machen wir«, sagte Del.
Kupicek behielt den Van im Auge. »Sie fährt sehr diszipliniert. Ich glaube, wir sind nicht ein einziges Mal nur an die fünfundsechzig herangekommen, seit wir auf der Interstate sind.«
»Sie ist ein Profi«, sagte Del.
»Ich an ihrer Stelle hätte so die Hosen voll, daß ich neunzig drauf hätte. Sicher, vielleicht machen sie es auch gar nicht.«
Georgie LaChaise war eine dunkelhaarige Frau; ihre blauen Augen schauten unter zu langen und zu dicken Brauen hervor. Sie hatte eine fleischige Nase und volle Lippen, die sie an den Seiten herunterzog. Sie fixierte Duane Cale, der ihr am Tisch gegenübersaß und sagte: »Duane, du alter Motherfucker, wenn du abhaust, werde ich dich finden und dir eine Kugel in deinen Scheißarsch verpassen. Das verspreche ich dir.«
Duane beugte sich über die gelbe Resopalplatte. Seine Hände umklammerten einen großen Becher Coke Classic. Er hatte ein unförmiges Gesicht und Haare, die sich nie für eine Farbe entscheiden konnten – man konnte sie für blond halten, andere würden schwören, sie wären braun. Der eine würde seine Apfelbäckchen als charakteristisch ansehen, der andere sein Fuchsgesicht. Er schien sich dauernd zu verwandeln, selbst während man ihn anschaute. Zu Jeans und Stiefeln trug er eine Army-Tarnjacke. Den Kragen hatte er hochgeschlagen. Auf dem Kopf saß eine Baseballmütze der Saints.
»Klar, mach ich’s«, sagte er. »Aber ich habe kein gutes Gefühl. Einfach kein gutes Gefühl. Ich meine, bei der Sache da in Rice Lake, da war ich gut.«
»Große Klasse warst du in Rice Lake«, sagte Georgie. Und dabei dachte sie: Du hattest solche Angst, daß ich dachte, wir müßten dich wegtragen. »Diesmal mußt du nur fahren, sonst nichts.«
»Okay, und du meinst, es läuft glatt?« fragte Duane und klopfte mit dem Becher auf die Tischplatte. »Du hast es selbst gesagt: Ich war große Klasse. Aber heute habe ich kein gutes Gefühl. No, Sir. Ich meine, ich mache es, wenn du es sagst, aber ich ... «
Georgie fiel ihm ins Wort. »Ich sage es«, sagte sie grob und schaute auf die Uhr. »In einer Minute ist Candy hier. Heb deinen Arsch und setz dich ans Steuer, und alles läuft glatt. Du weißt, was du zu tun hast. Du mußt nur zwei Blocks weit fahren. Du wirst große Klasse sein.«
»Na ja, okay ... « Sein Adamsapfel hüpfte auf und ab. Duane Cale hatte so viel Angst, daß er sich nicht einmal übergeben konnte, und die Coca-Cola machte da auch keinen Unterschied.
Lucas Davenport pellte sich aus seinem Mantel und dem grauen Island-Sweater. Sloan reichte ihm die kugelsichere Weste, und Lucas schlüpfte hinein. Er schob die Knebelverschlüsse durch die Schlaufen. Alles proper, es sei denn, man fing sich einen Schuß in die Achselhöhle ein. Der ging dann direkt durchs Herz und beide Lungenflügel und trat bei der anderen Achselhöhle wieder aus ... Nie zur Seite drehen.
»Scheißkalt draußen«, sagte Sloan. Er war ein schmalbrüstiger Mann, der einem nicht gerade in die Augen sehen konnte. Er hatte heute seine Kaninchenfellmütze auf. »Leben wir hier eigentlich in Scheiß-Rußland? In dieser verschissenen Sowjetunion?«
»Ist keine Sowjetunion mehr«, sagte Lucas. Sie waren auf einem Drugstore-Parkplatz aus dem noch mäßig warmen Auto gestiegen, Lucas, Sloan und Sherrill, um sich die Westen überzuziehen. Beobachtet wurden sie dabei von einem Zivilisten in blauer Jacke, der auf dem Parkplatz herumlungerte, während sein Hund am Bordstein an der Eisschicht schnüffelte.
»Ich weiß«, sagte Sloan. »Jetzt haben wir sie hier.«
Lucas zog sich den Sweater wieder über die Schultern. Dann kam die Jacke an die Reihe. Er war groß, hatte dunkle Haare, einen dunklen Teint und eisblaue Augen. Eine Narbe lief über sein Gesicht, eine lange weiße Schramme, von der Braue abwärts über die Wange. Als sein Kopf durch den Ausschnitt des Sweaters schlüpfte, grinste er seinen alten Freund Sloan an: »Wolltest du mit uns im Dezernat nicht eine Skigruppe bilden?«
»Hey, du solltest mal in der ... «
Das Funkgerät unterbrach ihn. »Lucas?«
Lucas griff nach dem Hörer. »Ja.«
»Ist jetzt auf der Ausfahrt«, sagte Del.
»Verstanden. Hast du es auch mitbekommen, Franklin?«
Franklin meldete sich fröstelnd. »Verstanden. Ich kann LaChaise und Cale sehen. Sitzen noch da. Sieht aus, als würden sie streiten.«
»Bleib in Bewegung«, sagte Lucas.
»Tu ich. Mir ist so verdammt kalt, daß ich Angst davor habe stehenzubleiben.«
»Jetzt ist sie auf der University ...« sagte Del.
»Besser, wir fahren los«, sagte Sherrill. Ihr Gesicht, von einer frechen schwarzen Frisur umrahmt, war von der Kälte gerötet. Sie hatte eine schwarze Lederjacke an, enge Jeans und Turnschuhe und dazu weiße Pelzfäustlinge, die sie im Ausverkauf zum Sonderpreis erstanden hatte. So etwas trug vielleicht ein Mädchen im High-School-Alter, doch sie hatte sich, wie das Jäger auch mit ihren Handschuhen machen, einen Schlitz für den Zeigefinger gemacht, damit sie besser abziehen konnte. »Sie wird sie abholen.«
»Ja«, nickte Lucas. Dann stiegen sie in ihre Limousine. Sloan setzte sich ans Steuer, Sherrill neben ihn, und Lucas machte es sich hinten bequem.
»Sie kommt«, sagte Franklin in das Funksprechgerät.
»Check deine Waffe«, sagte Lucas von hinten zu Sherrill. Er war sich nicht ganz sicher, wie sie sich verhalten würde. Man würde sehen. Er zog seine eigene .45er aus der Jackentasche, dann das Magazin aus dem Griff, ließ die Patronen aus dem Magazin in die offene Hand schnippen und begann das Ritual des erneuten Ladens. Vor ihm ließ Sherrill die Trommel ihres .357er Revolvers rotieren.
Sloan wendete und fuhr die drei Blocks zur Midland Steel Federal Credit Union. Lucas sah aus dem Fenster auf die Straße und hatte das Gefühl, gleich abzuheben.
Das passierte ihm immer vor einem Kampf: Er sog diesen plötzlichen Schwall aus scharfen Körpergerüchen, Teer- und Nikotinqualm, Juicy Fruit, Gewehröl und nassem Leder genußvoll ein. Wenn dein Kopf immer so arbeiten könnte, dachte er, wenn er immer auf dieser Wahrnehmungsebene operieren könnte, dann wärst du ein Genie. Oder verrückt. Oder beides.
Lucas fiel ein, was ihm vorher schon durch den Kopf gegangen war, griff nach dem Funkgerät und rief die Zentrale.
»Wir brauchen zwei Wagen Verstärkung auf der University«, sagte er. »Wir verfolgen einen gestohlenen Chevy. Eine Streife soll ihn so schnell wie möglich stoppen.«
Er gab seine Identifizierung durch und die Nummer des verfolgten Wagens, und die Zentrale bestätigte es. »Wir haben einen Wagen auf dem Riverside Drive. Den schicken wir gleich hin.«
Candy hielt mit dem Van direkt vor Ham’s Pizza. Georgie und Duane kamen heraus, und sie rutschte auf den Beifahrersitz und machte für Georgie die Hintertür auf. Duane setzte sich ans Steuer.
»Alles okay?« fragte Duane.
»Bestens, Duane«, sagte Candy. Sie schenkte ihm ihr Cheerleader-Lächeln.
Duane hing an ihr, auf seine Weise. Sie waren zusammen zur Schule gegangen, Grundschule und High-School. Sie hatten zusammen dieselben Klettergerüste unsicher gemacht, die smarte Candy und der nicht so smarte Duane. Später hatte sie ihm ein paarmal ihre Titten gezeigt – einmal unten am Meyer’s Creek beim Nacktbaden mit Dick, als Dick Duane nicht kommen sah, aber Candy schon. Gut, sie war Dicks Frau, aber sie wußte, wie man sich nebenbei seine Loyalitäten sicherte für den Fall, daß man sie mal brauchte.
»Fahr los«, sagte Georgie von hinten. Und zu Candy: »Alles klar?«
»Alles klar.«
»Wird ein starker Auftritt heute«, sagte Georgie.
»Ein ganz toller«, sagte Candy. Zehn Uhr morgens, Zahltag. Die Lohn- und Gehaltsschecks wurden um elf Uhr ausgegeben. Schon eine Minute später kamen die ersten Kunden angeschlichen und würden ihre Schecks zu Bargeld machen wollen. Das wäre dann eine Stunde zu spät.
»Da ist wieder dieser Nigger«, sagte Duane zerstreut.
Ein riesiger Schwarzer war ins Ham’s gekommen, bevor Candy vorgefahren war, hatte ein Stück Pizza bestellt und gefragt, ob er mit Essensmarken bezahlen könne. Als das verneint wurde, hatte er zögernd zwei zerknitterte Dollarnoten aus der Tasche gezogen und über die Theke geschoben.
»Essensmarken«, sagte Georgia verächtlich. »Wieder so ein Spinner. Sieh ihn dir an, wie er mit sich selbst redet.«
Franklin schlurfte vorbei und sagte: »Ein Block, fünfzehn Sekunden.«
Duane sagte: »Da drüben ist es.« Seine Stimme hatte dabei wohl etwas gezittert. Georgie und Candy ließen den Schwarzen gehen. Ihr Blick wanderte die Straße hinunter zu dem gelben Backsteingebäude mit dem Plastikschild und der kurzen Vorderveranda.
»Denk dran, was ich dir gesagt habe, Duane. In einer Minute sind wir drinnen«, sagte Georgie. Sie hatte sich vorgebeugt und es ihm leise ins Ohr gesagt, und als Duane versuchte, den Kopf wegzudrehen, packte sie sein Ohrläppchen, krallte ihre Nägel hinein und zog ihn zurück. Duane zuckte zusammen, und sie sagte: »Wenn du abhaust, wird einer von uns dich so lange jagen, bis du tot bist. Wenn du wegfährst, Duane, bist du tot. Stimmt’s, Candy?«
»Stimmt«, sagte Candy und sah ihn an. Es war etwas Eisiges in ihrem Blick. Dann schaltete sie wieder zu ihrem Mein-Gott-Duane-ich-würde-es-ja-mit-dir-treiben-aber-ich-muß-Dick-treubleiben-Blick um. »Aber das tut er nicht. Duane ist okay.« Sie tätschelte seinen Oberschenkel.
»Ja, ich tu’s«, sagte Duane. Er sah aus wie eine Ratte in der Falle. »Ich meine, ich mach’s. Ich hab es in Rice Lake auch gemacht, oder?«
Er stoppte den Van am Bordstein, und Georgie sah ihn an. Dann zogen sich die beiden Frauen Nylonstrümpfe über die Gesichter und holten ihre Pistolen aus den Jackentaschen.
»Gehen wir«, sagte Georgie. Sie stieg aus, Candy gleich hinterher. Georgie fand, daß Candy toll aussah.
»Ich habe das Gefühl, als würde ich heute einen abknallen«, sagte Candy zu Georgie, als sie die vier Stufen zur Eingangstür der Credit Union hochstiegen.
Franklin war noch einen halben Block entfernt, als sie hineingingen, und sagte: »Die beiden Frauen sind drinnen. Haben sich Nylons über die Köpfe gezogen. Es geht los.«
Fünf Sekunden später stoppten Del und Kupicek hinter ihm und bewegten sich dann vorsichtig weiter, bis sie den Chevy von hinten und Cales Kopf sehen konnten. Sie waren vierzig Meter entfernt.
An der anderen Ecke hielt Sloan an und fuhr dann langsam weiter, bis er den Van sehen konnte. »Alles klar?« fragte Lucas. Er öffnete seine Tür.
»Ja.« Sloan nickte. Er sah fast schläfrig aus und gähnte. Die Anspannung.
»Gehen wir«, sagte Lucas. Und ins Funkgerät sagte er: »Los!«
Georgie und Candy stürmten in die Halle, sehr auffällig, sehr laut. Sie schrien durch die Masken, die Pistolen im Anschlag.
»An die Wand«, schrie Georgie als erste. »An die Wand!« Und hinter ihr schwang Candy sich auf den Counter, zielte mit ihrer Kanone auf die Leute und schrie: »An die Wand ...«
Vier weibliche Angestellte und ein einsamer Kunde, ein Mann mit schwarzer Skijacke und Sonnenbrille, befanden sich in der Bank. Die Frau, die Candy am nächsten stand, sah aus wie ein Karpfen. Sie machte den Mund auf und zu, auf und zu, und dann hob sie die Hände und schwenkte sie vor dem Gesicht, als könne sie so die Kugeln wegwedeln. Sie hatte einen pinkfarbenen Sweater mit von Hand in einer Reihe quer über die Brust aufgenähten blauen Flachsblüten. Eine andere Frau wirbelte herum und sah im Weggehen über die Schulter zurück. Sie stellte sich an die Rückwand neben einen Aktenschrank. Sie sah Candy nicht an. Eine jüngere Frau, eine Kassiererin, machte einen Satz zurück, schrie auf, hielt sich den Mund zu, wich nach hinten aus, riß dabei ein Telefon vom Tisch, machte wieder einen Satz, erstarrte. Die vierte Frau ging einfach nach hinten, die Arme über Kreuz vor der Brust. Die Hände lagen auf den Schultern.
Georgie ratterte los wie ein Maschinengewehr: »Ruhig, ruhig, alle ganz ruhig bleiben. Kein Wort, Mund zu, Mund zu, bleiben Sie stehen. Alles ruhig stehenbleiben und den Mund halten ... Das ist ein Überfall, Mund halten.«
Zehn Sekunden waren sie jetzt drinnen. Candy ließ sich hinter dem Counter wieder auf den Boden herunter, zog einen Kopfkissenbezug aus dem Gürtel und schüttete den Inhalt der Geldschubladen hinein.
»Das ist nicht alles«, übertönte sie Georgies Anweisungen. »Nicht alles. Es muß noch mehr da sein.«
Georgie suchte sich die am besten angezogene Frau aus, die mit den Flachsblüten, zeigte mit dem Finger auf sie und bellte: »Wo ist es, wo ist der Rest?«
»Nein-nein-nein«, sagte die Frau.
Georgie zielte auf den Mann in der Skijacke und sagte: »Wenn Sie es nicht sagen, blase ich dem da sein verdammtes Hirn aus dem Kopf.«
Georgie stand da wie die Cops im Fernsehen: die Pistole in beiden Händen, die Arme ausgestreckt, und zielte auf den Kopf des Jackenmanns. Der Lauf schwankte keinen Millimeter. Die Lady mit den Flachsblüten sah sich nach Hilfe um. Einer mußte ihr jetzt doch sagen, was sie tun sollte. Aber da war niemand. Sie gab auf und sagte: »Im Büro ist eine Kiste.«
Candy packte sie und schob sie grob zu dem kleinen Büro im hinteren Bereich. Die Frau hastete hin und zeigte auf eine Kiste, die unter dem Schreibtisch auf dem Boden stand. Candy schob sie zur Tür zurück, hob die Kiste auf den Schreibtisch und klappte sie auf: gebündelte Scheine, Zehner, Zwanziger, Fünfziger, Hunderter.
»Hab es«, rief sie und schüttete das Geld in den Bezug.
»Raus jetzt«, rief Georgie. »Raus ...«
Candy drehte den Kissenbezug zu und warf ihn sich wie der heilige Nikolaus über die Schulter. Sie rannte um den Counter zur Eingangstür. Der Mann in der Skijacke stand an der Wand neben einem kleinen Kundenschreibtisch. Er hielt die Hände über dem Kopf und hatte ein schiefes Ich-will-auch-ganz-nett-sein-Lächeln im Gesicht. Die Augen hinter der Sonnenbrille waren vor Angst weit aufgerissen.
»Was gibt es da zu lachen?« schrie Candy ihn an. »Lachst du über uns?«
Sein Lächeln wurde noch breiter, aber er wedelte abwehrend mit der Hand: »Nein, nein, ich lache nicht...«
»Scheiß drauf«, sagt sie und schoß ihm ins Gesicht.
Der Knall hörte sich in der kleinen Kassenhalle an, als wäre eine Bombe explodiert. Die vier Frauen kreischten und warfen sich zu Boden. Der Mann fiel einfach hin. An der Wand hinter seinem Kopf sah man Blutspritzer. Georgie wirbelte herum und sagte: »Los.«
In Sekunden waren sie aus der Tür ...
»Auf geht’s«, sagte Del, und Kupicek war erst einmal baff.
Von vorne kam Sloan. Duane sah ihn, und ihm blieb keine Zeit mehr zu überlegen. Der Wagen schoß heran und blieb quietschend fünf Zentimeter vor seiner Stoßstange stehen. So kam er nicht mehr vom Bordstein weg. Mit einem schnellen Blick in den Rückspiegel sah er, wie ihn ein anderer Wagen von hinten einklemmte. In der nächsten Sekunde flog die Beifahrertür auf, und der riesige Pizza-Schwarze stand da und zielte auf Duanes Nase.
»Nicht einmal kratzen darfst du dich«, sagte Franklin mit seiner gewinnendsten Stimme, und so gewinnend war die nicht. »Einfach nur still sitzen.« Er schob den Automatikschalthebel auf Parkposition, drehte den Motor ab, zog den Zündschlüssel heraus und warf ihn auf die Bodenmatte. »Einfach sitzen bleiben.«
Dann kamen noch ein paar, alle zur Beifahrertür. Doch Duane drehte, so sehr ihn Franklins Pistolenmündung fesselte, den Kopf und wollte sehen, was an der Tür der Credit Union passierte.
Den Schuß hatte er wahrgenommen. Er war hier draußen zwar nur gedämpft zu hören gewesen, aber es gab keinen Zweifel.
»Scheiße«, sagte der Schwarze, und dann laut: »Achtung, das war ein Schuß.«
»Raus«, schrie Georgie. Sie lächelte dazu wie ein südamerikanisches Revolutions-Postergirl, die schwarzen Haare zurückgeworfen, und deckte die Innentür ab, während Candy durch die Außentür auf die Veranda stürzte. Georgie war gleich hinter ihr, und da vorne stand auch schon der Van.
Und die Polizei.
Sie hörten sie rufen. Aber Candy konnte kein Wort verstehen. Ihr war klar, daß Georgie hinter ihr zur Waffe griff. Sie selbst spürte, wie ihre Hand den Sack losließ, wie er links von ihr auf den Boden fiel und wie ihre Hand mit der Pistole hochging. Ihr Finger war schon am Abzug, bevor sie die Waffe ganz ausgerichtet hatte. Sie sah den dünnen Mann mit dem platten Gesicht und einer Nase, die so groß sein mochte wie der Durchmesser eines Campbell-Dosendeckels, und ihre Pistole ging hoch und höher ...
Lucas hörte den Schuß in der Bank, sprang zur Seite und sah Franklin reflexartig in Deckung gehen. Links von ihm stand Sherrill, die Arme auf Kupiceks Wagendach gestützt, und zielte auf die Eingangstür. Lucas dachte nur: Hoffentlich sehen sie nicht aus dem Fenster...
Dann flog die Tür auf, und die beiden Frauen waren auf der Veranda. Sie rissen die Waffen hoch, und er rief: »Nein, nein, nicht.« Er hörte Del schreien, und Candy LaChaise fing an zu schießen, und er sah Sherrills Kanone in ihrer Hand zucken ...
Candy sah den Mann mit den gelben Zähnen und das auf sie gerichtete schwarze Loch der Pistolenmündung, und sie sah die schwarzhaarige Frau, und vielleicht, dachte sie – wenn sie genug Zeit hätte –, würde sie ... Zu spät.
Sie spürte, wie die Kugeln einschlugen, eine nach der anderen, hörte die Knallerei, sah die Mündungsblitze, die Gesichter wie auf Fahndungsplakaten: Sie kamen auf sie zu. Aber sie spürte keinen Schmerz, nur einen Druck und etwas, das ihr wie Strahlen durch die Brust schoß ... Der Zustand hielt nicht an. Neben ihr stürzte Georgie zu Boden. Sie lag mit dem Kopf nach unten, die Füße auf der Veranda, die Stirn auf dem Gehwegpflaster, und sie wartete darauf, daß es hell würde. Das Licht würde kommen, und dahinter ...
Sie war tot.
Lucas schrie: »Aufhören, aufhören.« Und fünf Sekunden, nachdem die beiden Frauen aus der Credit Union gestürzt waren, gab es auch keinen Grund mehr, noch weiter auf sie zu schießen.
Plötzlich war es totenstill, und durch den Pulvergeruch sagte jemand: »Gott im Himmel.«
Kapitel 2
Die City Hall von Minneapolis ist ein abweisender Steinklotz, feuchtheiß im Sommer, kalt im Winter, in dem es von Cops, Gaunern, Politikern, Bürokraten, Antragstellern, Reportern, TV-Teams und wütenden Steuerzahlern wimmelt. Drinnen ist für alle das Rauchen verboten.
Und so folgte ihr eben eine Fahne von unerlaubtem Zigarettenrauch, als Rose Marie Roux ihr Chefbüro der Polizeipräsidentin von Minneapolis verließ und durch die düsteren Marmorflure unterwegs zur Mordkommission war. Die oberste Polizeichefin war eine große und in die Breite gehende Frau, und ihr Gesicht wurde vom Druck ihres Jobs und dem Gang der Jahre immer mürrischer. Vor der Tür zur Mordkommission blieb sie stehen, zog noch einmal tief an ihrer Zigarette und blies eine blaue Wolke in die Luft.
Durch die Scheiben konnte sie Davenport sehen. Er stand da, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Er trug einen blauen Anzug und ein weißes Hemd mit langem Kragen und einer Krawatte mit Pferdemuster – jede Menge hüpfende Rösser. Er war Deputy Chief und politisch zu seinem Amt gekommen, und das Geschäft, das er nebenbei betrieb und das sich nach neuesten Gerüchten in Größenordnungen von zehn Millionen Dollar bewegte, machte ihn zu einer wichtigen Figur im Spiel. Er sprach gerade mit Sloan und Sherrill.
Sloan war dünn, hatte ein teigiges Gesicht und einen ernsten Blick. Er war ganz in Braun gekleidet – er hätte sich nur gegen die Wand lehnen müssen und wäre nicht mehr zu sehen gewesen. Er kam mit allen gut zurecht und war der Verhörexperte in ihrem Team. Sloan hatte seine Waffe nicht benutzt und war deswegen noch voll im Einsatz.
Sherrill dagegen hatte alle sechs Schüsse aus ihrem Revolver abgegeben. Sie stand noch immer unter Hochspannung, ausgelöst von der Angst und dem Hochgefühl, das einen manchmal nach einer Schießerei überkommt. Roux hatte in den wenigen Jahren Streifendienst, bevor sie dann Jura studierte, ihre Pistole nie gezogen. Sie mochte keine Waffen.
Sie beobachtete die drei, Lucas Davenport und sein Team. Und schüttelte den Kopf: Möglich, daß die Dinge aus dem Ruder liefen. Sie ließ die Zigarette auf den Boden fallen, trat sie aus und schob die Tür auf.
Die drei drehten sich zu ihr um. Sie sah Lucas an und machte eine Kopfbewegung in Richtung Flur. Lucas folgte ihr und schloß die Tür hinter sich. Sloan und Sherrill sollten nichts mitbekommen.
»Es geht um die Anforderung einer uniformierten Einsatzgruppe – wann hatten Sie an die gedacht?« fragte Roux. Ihre Worte hallten durch den Marmorgang, aber niemand hörte sie.
Lucas lehnte sich gegen den kühlen Marmor. Er lächelte sein schnelles Lächeln, das, kaum war es aufgetaucht, auch schon wieder verschwand. Es war ein Lächeln, das ihn hart machte, sogar zu hart: gemein. Er hat es regelrecht eingeübt, dachte Roux. Von Zeit zu Zeit tat er das tatsächlich, und wenn er sich richtig an die Kandare genommen hatte, wirkte er zäh wie Leder. Sie sah, wie sich die Haut über seinem Schädel spannte.
»Hatte nach einem Routine-Einsatz ausgesehen, bei dem nichts schiefgehen konnte«, sagte er mit ruhiger Stimme. Sie wußten beide, worüber sie sprachen.
Sie nickte. »Na ja, es hat geklappt. Wir haben das Tonband aus der Zentrale freigegeben, und damit ist die Luft raus. Aber in der Star-Tribune werden sie auf der Meinungsseite einigen Quark über herumballernde Zivilpolizisten absondern. Und Fragen stellen, wie sie überhaupt reingekommen sind – also, warum ihr so lange gewartet habt, bis ihr aktiv wurdet. Aber ich glaube ... wirkliche Probleme wird es nicht geben.«
»Wenn wir sie bloß festgenommen hätten, hätten wir eine Menge Zeugenaussagen bekommen, die uns in ein schlechtes Licht gerückt hätten«, sagte Lucas. »Und außerdem wären sie jetzt schon wieder draußen.«
»Ich weiß. Aber so, wie es aussieht...« Sie seufzte. »Hätten die beiden LaChaises nicht diesen Farris erschossen, hätten wir einigen Ärger mehr.«
»Dieser Farris hat uns schon rausgehauen«, sagte Lucas und setzte noch einmal sein grimmiges Lächeln auf.
»So habe ich das nicht gemeint«, sagte Roux. Sie sah zur Seite. »Wie dem auch sei, ein Glück, daß wir Farris haben.«
»Ja, ein bißchen Kunststoff in den Backenknochen, den Kiefer aufschneiden, ein paar neue Zähne einsetzen, ein Stück Gewebe ans Ohr nähen ...«
»Ich versuche, Sie zu decken«, sagte Roux scharf.
»Hört sich aber an, als hätten Sie ’nen Scheiß für uns übrig«, schnappte Lucas zurück. »Die Leute von der Rice Bank haben sich die Videos aus den Überwachungskameras der Credit Union angesehen. Es gibt keinen Zweifel – die LaChaises waren es beide Male. Sie hatten die gleichen Hosen an, sagten das gleiche, gingen gleich vor. Und Candy LaChaise war es, die damals den Kassierer erschossen hat. Wir warten noch, was sie uns von Ladysmith and Cloquet zu sagen haben, aber es wird das gleiche Muster sein.«
Roux schüttelte den Kopf und sagte: »Ihr habt die harte Methode gewählt, und es wird entsprechend hart, bis alles wieder bereinigt ist.«
»Sie sind rausgekommen, sie haben angefangen, wir haben uns richtig verhalten«, sagte Lucas. »Sie haben zuerst geschossen. Das ist nicht erfunden, kein Cop-Bullshit.«
»Ich kritisiere ja nicht«, sagte Roux. »Ich sage nur, die Zeitungen stellen Fragen.«
»Vielleicht sagen Sie den Zeitungen mal, sie sollen sich selbst ins Knie ficken«, sagte Lucas. Seine Chefin war eine Politikerin, die schon mal daran gedacht hatte, sich für den Senat nominieren zu lassen. »Das wäre genau der richtige politische Schachzug, so, wie die Dinge liegen.«
Roux zog eine altmodische silberne Zigarettendose aus der Tasche und klappte den Deckel auf. »Ich rede hier nicht über Politik, Lucas. Ich mache mir nur Gedanken über das, was passiert ist.« Sie fummelte in der Dose, bis sie eine Zigarette heraus hatte, und klappte den Deckel wieder zu. »Sie haben das Gefühl, wir ... machen ihnen was vor. Als hätten wir selber das Gesetz in die Hand genommen. Wir sind gut dran, weil Farris tatsächlich was abgekriegt hat und Sie gerufen haben, sie sollen aufhören. Aber da sind auch noch sechs oder sieben Löcher in Candy LaChaise. Es sieht nicht so aus, als wärt ihr nicht darauf aus gewesen.«
»Das waren wir«, gab Lucas zu.
»... Also könnte die Autopsie noch etwas zutage fördern, das stinkt.«
»Sagen Sie der Gerichtsmedizin, sie soll sich mit ihrem Bericht Zeit lassen«, sagte Lucas. »Sie wissen ja, wie das läuft: In einer Woche oder so kräht kein Hahn mehr danach. Und in ein paar Monaten kommen dann die großen Entscheidungsspiele im Baseball. Dann sind die das Thema.«
»Ja, ja. Die Gerichtsmedizin macht mit. Noch.«
»Die LaChaises haben angefangen«, insistierte Lucas. »Und für sie war das Töten nichts als Sport. Candy LaChaise hat Menschen erschossen, um zu sehen, wie sie starben. Scheiß drauf.«
»Ja, ja«, sagte Roux. Sie winkte zum Abschied und machte sich mit hängenden Schultern wieder auf den Weg in ihr Chefbüro. »Schicken Sie alle nach Hause. Morgen geht die Sache vor den Ausschuß.«
»Sind Sie wirklich sauer?« rief Lucas ihr nach.
»Nein. Irgendwie ... bedrückt es mich nur. Dieses Jahr hat es zu viele Leichen gegeben«, sagte sie. Sie blieb stehen, zündete das Feuerzeug an und schob sich eine neue Zigarette zwischen die Lippen. Die Spitze glühte im Halbdunkel wie ein Leuchtkäfer. »Zu viele Leute sind umgebracht worden. Daran sollten Sie denken.«
Weather Karkinnen erledigte in ihrem Arbeitszimmer Papierkram, als Lucas heimkam. Sie hörte ihn in die Küche gehen und rief durch den Flur: »Hier, im Arbeitszimmer.«
Einige Augenblicke später lehnte er mit einer Flasche Bier in der Hand in der Tür. »Hallo.«
»Ich habe versucht, dich anzurufen«, sagte sie.
Weather war eine kleine, athletisch gebaute Frau mit breiten Schultern und kurz geschnittenen blonden Haaren. Sie hatte hohe Backenknochen und dunkelblaue Augen, leicht schräg stehend, wie Finnen und Lappen sie haben. Ihre Nase war ein bißchen zu groß und gebogen, als hätte sie mal bei einem Kampf eins draufgekriegt. Genaugenommen keine hübsche Frau, aber auf Parties wirkte sie auf Männer anziehend. »Sie haben im Fernsehen von der Schießerei berichtet.«
»Was haben sie gesagt?« Er öffnete die Flasche und trank einen Schluck.
»Zwei Frauen sind nach einem Bankraub erschossen worden. Sie sagen, die Schießerei wäre eine umstrittene Sache.« Sie wischte sich besorgt die Haare aus der Stirn.
Lucas schüttelte den Kopf. »Um das, was sie im Fernsehen sagen, mußt du dich nicht kümmern.«
Er war wütend.
»Lucas ...«
»Ja?« Er war in der Defensive, und das gefiel ihm nicht.
»Du bist wirklich auf hundertachtzig«, sagte sie. »Was ist passiert?«
»Ach, die Medien wollen uns Feuer unterm Hintern machen. Alle scheinen sich Sorgen darum zu machen, ob es ein fairer Kampf war. Warum sollte er fair sein? Das hier ist kein Spiel, es ist Verbrechensbekämpfung.«
»Hättest du sie festnehmen können? Einsperren? Vor Gericht bringen, in Verbindung mit den anderen Banküberfällen in Wisconsin?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Sie waren jedesmal maskiert und haben jedesmal gestohlene Wagen benutzt. Vor zwei Jahren ist Candy LaChaise mal in River Falls wegen bewaffneten Raubüberfalls verhaftet worden. Der Typ, den sie überfallen hatte, ein Autohändler, wurde zwei Wochen später, noch vor dem Prozeß, erneut überfallen und erschossen. Es gab keine Zeugen, und sie hatte ein Alibi. Die Cops aus River Falls glauben, ihre eigene Bande habe ihr wieder herausgeholfen.«
»Aber es ist doch nicht euer Job, sie umzulegen«, sagte Weather.
»Hey, mal langsam«, sagte Lucas. »Ich bin da nur aufgetaucht und hatte eine Kanone bei mir. Was danach passiert ist, geht auf deren Konto. Nicht auf meins.«
Sie schüttelte den Kopf, war noch nicht zufrieden. »Ich weiß nicht«, sagte sie. »Was du tust, macht mir angst, aber anders, als dir lieb sein sollte.« Sie verschränkte die Arme und schlang sie um ihren Körper, als wäre ihr kalt. »Ich fürchte mich weniger davor, was dir ein anderer antun könnte, als was du selbst dir antun könntest.«
»Ich habe dir doch gesagt ...« Er wurde ärgerlicher.
»Lucas«, fiel sie ihm ins Wort, »ich weiß, wie dein Verstand arbeitet. Im Fernsehen sagen sie, ihr hättet diese Leute seit neun Tagen überwacht. Ich spüre es richtig, wie ihr sie in den Überfall hineinmanipuliert habt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich weiß es.«
»Quatsch«, blaffte er und ging weg.
»Lucas...«
Er war schon halb den Flur hinunter, mit den adressierten Briefkuverts in der Hand. Sie schrieb gerade Hochzeitseinladungen. Er drehte sich um und kam zurück.
»Mein Gott, tut mir leid, ich bin gar nicht sauer auf dich«, sagte er. »Manchmal ... Ich weiß nicht, manchmal verliere ich zu schnell die Geduld.«
Sie stand auf und sagte: »Komm her. Setz dich da in den Sessel.«
Er setzte sich, und sie kletterte auf seinen Schoß. Er konnte immer wieder nur staunen, wie klein sie war, alles an ihr. Ihr kleiner Kopf, ihre kleinen Hände, ihre kleinen Finger.
»Du brauchst etwas, das deinen Blutdruck wieder sinken läßt«, sagte sie.
»Dafür habe ich mir doch schon das Bier geholt«, sagte er.
»Als deine Ärztin sage ich dir, das Bier reicht dazu nicht«, meinte sie und kuschelte sich in seinen Schoß.
»Ja? Was verschreibst du mir denn nun genau ...?«
Kapitel 3
›Crazy‹ Ansel Butters wartete, daß der Schub kam, und als er da war, sagte er: »Na also.«
Dexter Lamb lag auf der Couch, ein Arm hing auf den Boden herab. Er musterte die Risse an der pinkfarbenen Stuckdecke, die wie Spinnwebenmuster aussahen, und sagte: »Sagte ich doch, Kumpel.«
Lambs ›Alte‹ war in der Küche und starrte auf die Plastiktischdecke. Langsam und mit gedämpfter Stimme murmelte sie: »Wenn ich nur schon weg wäre... Verdammt, Dexter, wo hast du die Tüte? Ich weiß, du hast eine.«
Ansel hörte sie nicht, hörte nicht das Jammern und Klagen. Ansel schwebte über eine Kokainlandschaft hinweg, die sein Kopf malte – grüne Hügel, hübsche Frauen, rote Mustangs, Labradors – eine wahre Wonne! Sein Kopf lag zur Seite geneigt auf der Schulter, und seine langen Haare fielen hinab wie ein Regenschwall vor einem Fenster. Nach zwanzig Minuten war der Traum vorbei – bis auf das Nachbrennen in seinem Hirn, das erst langsam ausglühen würde.
Doch bis dahin hatte er noch ein paar Minuten, und er murmelte: »Dex, ich muß was mit dir bereden.« Lamb stopfte gerade eine neue Pfeife und hielt inne. Seine Augen waren verschwommen von den zu häufigen Ausflügen und den zu vielen Tagen ohne Schlaf. »Was willste?«
Seine Frau kam in ihrem dünnen Baumwollslip aus der Küche, kratzte sich im Schritt und sagte: »Wo hast du die Tüte hin, Dex?«
»Ich muß jemanden finden«, sagte Ansel dazwischen. »Bringt mir echtes Geld. Für einen Monat Stoff. Und ich brauche eine Bude in der Nähe. Fernsehen, ein paar Betten, so in etwa.«
»Die Bude kann ich dir besorgen«, sagte Lamb. Er zeigte mit dem Daumen auf seine Frau. »Mein Schwager hat ein paar Häuser, ziemlich runtergekommen, aber in einem kannst du wohnen. Mußt dir die Möbel aber selbst kaufen. Ich weiß, wo du ganz billige kriegst.«
»Wäre schon okay so.«
Dex stopfte seine Pfeife fertig, machte das Feuerzeug an und wollte die Pfeife gerade in den Mund stecken, als ihm die Frage einfiel: »Und was ist das für ein Typ, den du suchst?«
»Ein Cop. Ich suche einen Cop.«
Lambs Alte, große schwarze Augen, hohle Wangen, eine weißliche Narbe im Gesicht, kratzte sich noch einmal im Schritt und fragte: »Wie heißt er?«
Butters sah sie an. »Genau das möchte ich gerne wissen.«
Bill Martin kam in seinem umgebauten Ford-Truck von der Upper Peninsula. Die Kotflügel waren durchgerostet, aber der Achtzylindermotor war perfekt hochfrisiert. Er nahm die Landstraßen durch Wisconsin, hielt an einem Rasthaus auf ein Bier und ein paar gekochte Eier, dann wieder an einer Tankstelle, und zwischendurch sprach er mit einem Waffenverkäufer in Ashland.
Draußen auf dem Land war noch alles gefroren. Zwischen den grünen Kiefern und den grauen Stämmen der Eschen lagen schmutzig verkrustete Schneehaufen. Martin hielt mehrmals an, um sich die Beine zu vertreten, von Brücken zu schauen und sich die Spuren im Schnee anzusehen. Er mochte diesen Winter nicht mit seinem vielen Schnee und den Graupelschauern, die alles mit einer fast einen Zentimeter dicken Eisschicht bedeckten. Das viele Eis würde am Morgen den Moorhühnern noch zum Verhängnis werden, nachdem ihre Population sich gerade erst wieder ausgebreitet hatte.
Er suchte nach Spuren von ihnen, fand aber keine. Für Bärenspuren war die Jahreszeit noch zu früh, aber in sechs bis acht Wochen würden sie hier draußen sein mit ihren glänzenden Fellen, voller Kraft und unglaublich schnell. Ein junger männlicher Bär konnte aus dem Stand einem Pferd davonrennen. Nichts putzte einem die Stirnhöhlen besser aus, als auf einen alten, hungrigen Bären zu stoßen, wenn man mit Schneeschuhen unterwegs war und mit nichts anderem bewaffnet als einer Plastikfeldflasche und einer Prise Schnupftabak.
Er fuhr Richtung Süden. Um zwei Uhr nachmittags sah er im hüfthohen gelben Gras, das an einem Bach aus der Schneedecke ragte, einen Kojoten nach etwas kratzen. Vielleicht nach Wühlmäusen. Er hielt an und zog seinen Bausch-and-Lomb-Entfernungsmesser und die AR-15 heraus. Der Lasermesser zeigte 274 Meter an. Die Ballistik würde dreiundzwanzig Zentimeter ausmachen, die seitliche Abweichung bis zu fünf Zentimeter. Er stützte seine Army-Rifle auf den vorderen Kotflügel und zielte ein paar Zentimeter über das Blatt des Kojoten. Die .223er-Kugel traf die Flanke zwar etwas tief. Aber der Kojote sprang mit einem Satz hoch, sackte zusammen und blieb bewegungslos liegen.
»Getroffen«, murmelte Martin und bleckte die Zähne. Ein guter Schuß.
Martin überquerte den St. Croix in Grantsburg, hielt an, um einen Blick auf den Fluß zu werfen – die gefrorene Oberfläche war von den Spuren der Snowmobile gezeichnet –, und fuhr dann zögernd zur I-35 weiter. Die Interstates durchzogen das Land wie störende Narben. Nirgends kam man nah genug heran, um irgend etwas zu sehen. Aber wenn man schnell weiterwollte, hatten sie natürlich ihren Nutzen. Er machte ein letztes Mal an einem Rasthaus an der I-35 kurz vor den Cities halt, wie sie Minneapolis und ihre Zwillingsstadt St. Paul kurz nannten, erledigte einen Anruf und fuhr dann hinein.
Butters wartete an einer Amoco-Tankstelle an der I-94. Neben seinen Füßen stand ein olivgrüner Matchbeutel. Martin stoppte am Straßenrand, und Butters stieg ein und sagte: »Geradeaus und wieder die Auffahrt runter.«
Martin bemerkte die Ampel und fragte: »Wie geht’s?«
»Müde«, sagte Butters. Er sah ihn schläfrig aus kleinen Augen an.
»Das warst du letzten Herbst auch schon«, sagte Martin. Martin war damals von einer seiner Verkaufstouren – er handelte mit Waffen – durch Tennessee zurückgekommen und hatte Butters zu einem Jagdausflug auf Eichhörnchen mitgenommen.
»Diesmal bin ich noch müder«, sagte Butters. Er sah nach hinten in den Truck. »Was hast du dabei?«
»Drei alte Pistolen, drei chinesische AK-Semiautomatiks, zwei umgebaute AR-15, einen Bogen, ein paar Dutzend Pfeile und mein Messer«, sagte Martin.
»Den Bogen wirst du wohl nicht brauchen«, sagte Butters trocken.
»Ist aber tröstlich, ihn zu haben«, sagte Martin. Er war ein wuchtiger und muskulöser Mann, einer, der viel draußen war, mit einem dunkel-rötlichen Bart und einem pockennarbigen Gesicht. »Wo ist dieser Typ, den wir treffen wollen?«
»Drüben in Minneapolis. Nicht weit von der City. Beim Metrodome.«
Martin grinste sein dünnes Kojoten-Killer-Grinsen. »Hast du ihn ausgekundschaftet?«
»Ja, habe ich.«
Sie nahmen die I-94 nach Minneapolis, verließen sie an der Ausfahrt zur Fifth Street, kauften in der City eine Pizza und fuhren zurück zur Eleventh Avenue. Butters dirigierte Martin zu einem alleinstehenden einstöckigen Backsteingebäude mit einem Waschsalon im Erdgeschoß und einer Wohnung darüber. Es war ein altes Haus, aber gut erhalten. In den Vierzigern war es vielleicht einmal ein Tante-Emma-Laden gewesen. Hinter den Fenstern der Wohnung war Licht.
»Ihm gehört der Waschsalon«, sagte Butters. »Da oben im ersten Stock ist eine einzige große Wohnung. Er wohnt da mit seinem Mädchen.« Butters sah zu den beleuchteten Fenstern hinauf. »Sie muß zu Hause sein, denn er ist in der Stadt. Er paßt dort auf seine Jungs auf, bis Geschäftsschluß ist. Gestern nacht ist er etwa um zwei nach Hause gekommen und hatte eine Pizza dabei.«
Martin sah auf seine Uhr, eine schwarze Chronosport im Militärlook mit Leuchtziffern. »Haben jetzt eine Stunde gebraucht.« Er musterte das Haus durch das Wagenfenster. Nach oben führte nur eine Tür. »Wo geht es zur Garage, von der du gesprochen hast?«
»Durch die Seiteneinfahrt. Hinten ist eine Feuertreppe, eine zum Runterklappen. Zu hoch, um raufzukommen. Letzte Nacht ist er in die Garage gefahren – er hat eine Fernbedienung für das Tor – und hat hinter sich wieder zugemacht. Eine Minute später ist dann das hintere Licht in der Wohnung angegangen. Es muß also drinnen eine Treppe von der Garage hochführen. Da ist er dann auch wieder runtergekommen, durch die Garage raus und um die Ecke in den Waschsalon. Er war dann im rückwärtigen Teil, hat wahrscheinlich die Münzfächer in den Maschinen geleert.«
Martin nickte. »Hmm. Die Vordertreppe hat er nicht benutzt?«
»Nee. Habe nicht darauf geachtet, weil drinnen etwas hätte ablaufen können.«
»In Ordnung. Wir schnappen ihn uns in der Garage?«
»Ja. Und vielleicht essen wir inzwischen unsere Pizza. Wir brauchen ohnehin nur den Karton. Harp will sicher keine.«
Sie plauderten locker weiter. Sie hatten es bequem in ihrem Pickup und seinem Geruch, einem Gemisch aus Benzin, Rost, Öl und Stroh, in dem die Waffen verpackt waren. Dann fragte Martin, während er sich den Bart mit einem Papiertaschentuch abwischte: »Was hörst du so von Dick?«
»Habe nichts Dickes von Dick gehört«, sagte Butters. Er wartete erst gar nicht ab, ob Martin lachte, weil der das doch nicht tat. Dennoch hatte Butters das Gefühl, daß Martin manchmal für kleine Späßchen zu haben war. »Das letztemal«, sagte er, »als ich mit ihm redete, klang er so, als würde er sich ... da draußen absetzen.«
Martin kaute, schluckte und sagte: »Da draußen läuft keine krumme Tour.«
»Nein, da nicht«, bestätigte Butters. Er war genauso weit raus da wie alle anderen. »Aber wenn es soweit kommt, daß wir Cops umlegen müssen, dann muß er selber Boden unter den Füßen haben.«
»Wieso? Hast du dann vor abzuhauen?«
Butters dachte eine Weile nach, lachte fast traurig und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, nicht.«
»Ich habe mir überlegt, ob ich rauf nach Alaska gehe und mich in die Wälder schlage«, sagte Martin nach kurzem Schweigen. »Du weißt, als ich diesen Anruf bekam. Aber sie kriegen dich sogar in Alaska. Sie finden deine Spur überall. Ich bin es leid. Ich meine, es ist Zeit, daß wir was unternehmen. Als ich also von Dick hörte, dachte ich mir, ich kann genauso gut herkommen.«
»Ich weiß nichts über das Drumherum«, sagte Butters. »Aber ich schulde Dick etwas. Und jetzt zahle ich es eben ab, weil ich es satt habe.«
Martin sah ihn eine Weile an und sagte: »Wenn du es so satt hast, mußt du ja überhaupt keine Angst vor den Cops haben. Oder vor sonst was.«
Sie kauten wieder schweigend. Dann sagte Butters: »Stimmt.« Und kurz darauf sagte er: »Habe ich dir gesagt, daß mein Hund tot ist?«
»Das kann einen Mann schon so weit bringen, daß er’s satt hat«, sagte Martin.
Wenn Daymon Harp arbeitete, pfiff er dazu ein Liedchen wie die Sieben Zwerge. Doch bei seiner Arbeit kam etwas anderes heraus als bei Schneewittchen und ihren kleinen Freunden. Er verkaufte nämlich Kokain und Speed, war dabei halbwegs Großhändler und belieferte ein halbes Dutzend verläßliche Weiterverkäufer in Clubs, Bars und Bowlingbahnen in Minneapolis und einigen ausgewählten Vorstädten.
Harp hatte siebentausend Dollar in der Manteltasche und pfiff ein Menuett aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, als er aus der Lincoln in die Eleventh abbog. An der Ecke vor seinem Waschsalon stand ein junger Kerl mit hellem Haarschopf, hielt eine Pizzaschachtel in der Hand und sah zu seiner Wohnung hinauf. Die Pizzaschachtel hätte ihn eigentlich darauf bringen können, sich auch nach dem Lieferantenwagen umzuschauen. Das versäumte er aber.
Harp fuhr um die Ecke, drückte den Öffner für sein automatisches Garagentor und sah, wie der junge Kerl ihm nachschaute. Er fuhr hinein, stellte den Motor ab und stieg aus. Der junge Kerl ging, die Pizzaschachtel flach auf der Hand balancierend, über den Gehsteig, und Daymon dachte: Wenn diese verdammte Schnepfe sich eine Pizza liefern läßt, wo sie doch selbst da ist und sie sich holen könnte ...
Er sah den jungen Kerl auf sich zukommen, während Martin hinter ihm auftauchte und ihm eine Pistole ans Ohr drückte: »Zurück in die Garage.«
Daymon fuhr hoch, faßte sich aber. Er hielt die Hände seitlich ausgestreckt und ging in die Garage zurück. »Ganz ruhig«, sagte er. Er wollte den Typen nicht nervös machen. Er hatte schon mal eine Pistole am Ohr gehabt, und wenn einem das passiert, sieht man besser zu, daß keiner nervös wird. Er versuchte, eine Drohung unterzubringen: »Du weißt, wer ich bin?«
»Daymon Harp, der berühmteste aller Drogen-Dealer«, sagte Martin, und Harp dachte: Soso.
Der Junge mit der Pizza kam hinter ihnen her, entdeckte den beleuchteten Knopf zum Schließen der Garage und drückte ihn. Das Tor fuhr herab, und Martin drängte Harp zur hinteren Treppe.
»Da bleibst du stehen«, sagte Martin.
Harp lehnte sich gegen die Wand und spreizte Arme und Hände. »Habe keine Waffe«, sagte er. Er sah Martin von der Seite an. »Ihr seid keine Cops.«
»Da kämen wir aber arg in Verlegenheit, wenn du uns wegen der Kanone anlügen würdest«, sagte Martin. Der Jüngere klopfte ihn ab, entdeckte das Bündel Geldscheine und zog es heraus. »Sieh mal an«, sagte er. »Besten Dank.«
Harp sagte keinen Ton.
»Nun zum Geschäftlichen«, sagte Martin, während Butters das Geld einsteckte. »Wir brauchen ein paar Informationen. Wir tun dir nichts. Nur, wenn du Dummheiten machst. Du machst also am besten mit.«
»Was wollt ihr?« fragte Daymon.
»Nach oben gehen«, sagte Butters in seinem weichen Tennessee-Akzent. Harp musterte ihn aus dem Augenwinkel: Butters hatte unter dem linken inneren Augenwinkel drei dunkelblaue Tränen eintätowiert, und Daymon Harp dachte wieder: Soso.
Das Trio stieg die Treppe hoch, und nun stach der Pistolenlauf des Jungen aus dem Süden Daymon ins Kreuz. Der andere zielte auf seine Schläfe. Gespannt blieben sie stehen, als Daymon die Tür aufschloß. Eine Frauenstimme kam aus dem Flur: »Day? Bist du das?«
Butters ließ die beiden stehen und trat auf Zehenspitzen in den Flur. Er war gerade an der Ecke, als die Frau herumkam. Sie schreckte zurück, als Butters sie am Handgelenk packte und ihr die Waffe zeigte. »Klappe halten«, sagte er.
Sie hielt die Klappe.
Fünf Minuten später waren Harp und die Frau mit Klebstreifen an Küchenstühle gefesselt. Die Hände der Frau lagen flach auf ihren Schenkeln. Um Brust und Oberarme waren die Klebstreifen gebunden. Im Mund hatte sie eine Socke, die noch einmal zwei oder drei Schlingen Klebeband an Ort und Stelle hielten. Ihr angstvoller Blick schoß zwischen Harp und dem einen oder anderen Weißen, der in ihr Blickfeld kam, hin und her.
Martin und Butters sahen sich in der Wohnung um. Martin öffnete die Korridortür nach vorn und sah, daß auf dem Treppenabsatz davor ein Stapel Kartons für Haushaltsgeräte im Weg stand. Die Kartons sorgten für eine Art Pufferzone und dienten als eine Alarmanlage für den Fall, daß die Polizei kam, ließen aber, wenn nötig, auch noch genug Platz für einen Fluchtweg.
Butters checkte die beiden Schlafzimmer, fand aber nichts Interessantes außer einer Sammlung Jazzplatten, alte 33er Vinylscheiben.
»Alles sauber«, sagte er, als er wieder nach vorne kam.
Martin setzte sich auf den dritten Stuhl und sagte, Knie an Knie mit Harp: »Leute wie uns kennst du wahrscheinlich. Hast uns in der Kneipe gesehen. Für Schwarze haben wir nicht viel übrig. Wir würden euch zu gern die Kehlen durchschneiden, und das wär’s dann. Aber das geht heute nicht, weil wir dich brauchen. Du sollst uns mit einem deiner Freunde bekannt machen.«
»Mit wem?« fragte Daymon Harp.
»Dem Cop, mit dem du gemeinsame Sache machst.«
Harp bemühte sich, ein überraschtes Gesicht zu zeigen. »Es gibt keinen Cop.«
»Wir wissen, die Show mußt du jetzt abziehen, aber wir haben nicht allzuviel Zeit«, sagte Martin. »Um dir also zu zeigen, wie... hmm ... ernst wir es meinen ...« Er wählte seine Worte sorgfältig und sagte leise: »... werden wir deine Kleine hier aufschlitzen.«
»Motherfucker«, sagte Harp. Aber er sagte es nicht zu Martin. Es war nur ein Ausruf, und Martin nahm ihn auch als solchen. Der Frau traten die Augen aus dem Kopf. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Martin ließ sie gewähren. Über die Schulter sagte er: »Ansel, sieh mal nach, ob du in der Küche ein Messer findest...«
Draußen auf der Straße vor dem Waschsalon war kein Mensch zu sehen, und das war gut für Butters und Martin. Denn Harp konnte man nicht einfach so zum Reden bringen, und für einen kurzen Augenblick konnte man Jasmine schreien hören, trotz des Knebels in ihrem Mund und trotz der wegen der Winterkälte fest geschlossenen Fenster.