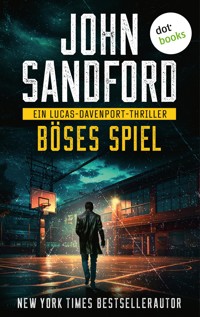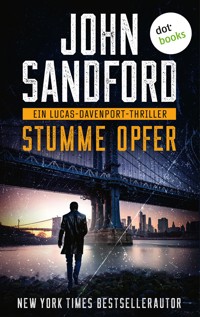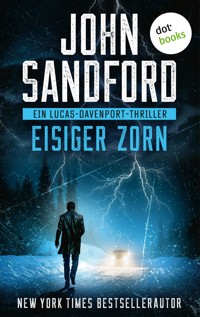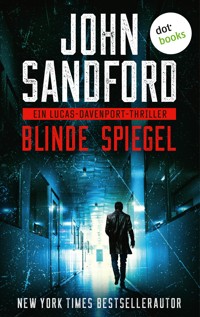5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sie löscht Leben aus, ohne zu zögern: Der rasante Thriller »Spur der Angst« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Die Anwältin Carmel Loan ist daran gewöhnt, zu bekommen, was sie will. Als ihr Liebhaber sich von ihr abwendet, engagiert sie kurzerhand Clara Rinker, die beste Auftragskillerin des Landes. Aber das Mordkommando geht schief, und der Tod eines Polizisten bringt Lucas Davenport auf den Plan: Der hartgesottene Detective von der Mordkommission ahnt nicht, welchen Tribut der Fall von ihm fordern wird: Denn von den vielen Kriminellen, die er im Laufe seines Lebens gejagt hat, ist keiner so effizient oder so intelligent wie Rinker – und keiner weiß so genau, wo seine Schwachstellen liegen wie sie … »Knisternde Spannung und ein echter Page-Turner … großartige, erschreckende Unterhaltung!« The New York Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Spur der Angst« von John Sandford – der spektakuläre zehnte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Dean Koontz und Mark Dawson. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Anwältin Carmel Loan ist daran gewöhnt, zu bekommen, was sie will. Als ihr Liebhaber sich von ihr abwendet, engagiert sie kurzerhand Clara Rinker, die beste Auftragskillerin des Landes. Aber das Mordkommando geht schief, und der Tod eines Polizisten bringt Lucas Davenport auf den Plan: Der hartgesottene Detective von der Mordkommission ahnt nicht, welchen Tribut der Fall von ihm fordern wird: Denn von den vielen Kriminellen, die er im Laufe seines Lebens gejagt hat, ist keiner so effizient oder so intelligent wie Rinker – und keiner weiß so genau, wo seine Schwachstellen liegen wie sie …
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: https://www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: https://www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: https://www.instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Certain Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Paul Vasarhelyi, DARK MOON PICTURES und AdobeStock/Ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-956-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Spur der Angst« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Spur der Angst
Ein Lucas-Davenport-Thriller 10
Aus dem Amerikanischen von Manes H. Grünwald
dotbooks.
Für Tom
und
Rozanne Anderson
Kapitel 1
Clara Rinker ...
Der Erste der drei unglücklichsten Tage im Leben von Barbara Allen war der Tag, als Clara Rinker in St. Louis im Hinterhof einer Stripteasebar namens Zanadu vergewaltigt wurde. Die Bar lag am Westrand der Stadt in einem schachbrettartig angelegten, staubigen Gewerbegebiet, das vornehmlich aus Truckterminals, Lagerhallen und Montagefabriken besteht. Im Zanadu ging es, wie die Chromreklametafel an der Interstate 70 in gelber Leuchtschrift verkündete, »locker zu«. Clara Rinker war jedoch keinesfalls ein »lockeres Mädchen«, egal, was die Gäste des Zanadu auch glaubten.
Rinker war sechzehn, als sie vergewaltigt wurde – ein kleines, sportlich durchtrainiertes Mädchen, eine Tänzerin, die ihrer Familie in Ozark davongelaufen war. Sie hatte blondes, am Ansatz dunkleres Haar und einen Körper, der in dünnen Baumwollkleidchen mit roten Punktmustern aus dem K-Mart ausgesprochen attraktiv wirkte. Es war ein Körper, der die Aufmerksamkeit von Cowboys, Truckern und anderen Männern, die sich in Träumen von Nashville ergingen, auf sich zog.
Sie hatte sich für den Nackttanz entschieden, weil sie Talent dafür hatte, und zwar ausschließlich deshalb, nicht etwa wegen des Geldes oder weil sie sonst hungern müsste. Die Vergewaltigung geschah um zwei Uhr in einer ansonsten wunderschönen Aprilnacht, in einer dieser Nächte, in denen die Kids im Mittleren Westen länger aufbleiben und Krieg spielen dürfen und in denen Zikaden in ihren Verstecken unter den Borken der Ulmen ihr Summen ertönen lassen. Rinker hatte in dieser Nacht die Eingangstür der Bar abgeschlossen; sie war als letzte Tänzerin aufgetreten.
Danach saßen noch vier Männer bei ihren Drinks an der Bar. Drei waren Fernfahrer mit gehetzten Gesichtern, die nirgendwo anders hingehen konnten als in die engen Kojen ihrer Kenworth-, Freightliner- oder Peterbilt-Trucks; der Vierte war ein norwegischer Tierhändler, spezialisiert auf exotische Tiere, der gegen den Kummer über ein gerade aufgeflogenes Geschäft antrank, bei dem es um eine große Kiste Boa constrictors und eine Ladung illegal eingeführter tropischer Vögel im Wert von sechsunddreißigtausend Dollar gegangen war.
Ein fünfter Mann namens Dale-Sowieso, ein Gorilla mit schräg abfallenden Schultern, war aus der Bar gegangen, als Rinker etwa die Hälfte der Theke abgewischt hatte. Er ließ zwölf Dollar in zerknüllten Einer-Noten auf dem Tresen zurück, darüber hinaus zwei kleine Schweißringe, wo er die nackten Ellbogen aufgestützt hatte. Rinker hatte vor jedem Mann für zehn Sekunden ihre Arbeit unterbrochen, um ihn mit dem Blick anzublitzen, den die Mädchen »Schluss-Schluss« nannten. Dale-Sowieso war als Erster an der Reihe gewesen, und er war aufgestanden und gegangen, sobald sie sich wischend auf den nächsten Mann zubewegt hatte. Als sie fertig war, stieg Rinker die Stufe am Ende der Bar hinunter und ging zu einem der Hinterzimmer, um ihre Straßenkleidung anzuziehen.
Einige Minuten später klopfte der Barmann, ein Ringer im Team der Universität von Missouri namens Rick, an die Tür des Umkleidezimmers und fragte: »Clara, schließt du die Hintertür ab?«
»Mach ich«, antwortete sie und streifte ein fusseliges Stretchoberteil über den Kopf, wobei sie mit dem Hintern wackelte, um es nach unten ziehen zu können. Rick respektierte die Privatsphäre der Tänzerinnen, wofür sie ihm dankbar waren; eigentlich war das aber nur eine psychologischer Trick, da er ja hinter der Bar arbeitete und die halbe Nacht damit zubrachte, ihre nackten Körper zu betrachten.
Egal, er respektierte jedenfalls ihre Privatsphäre ...
Als sie sich umgezogen hatte, machte Rinker das Licht im Umkleideraum aus, ging dann zur Damentoilette, vergewisserte sich, dass sie leer war, machte dasselbe in der Herrentoilette, in der ihr der unausrottbare, mit Bier gewürzte Uringestank beißend in die Nase stieg. An der Hintertür entriegelte sie das Schloss, knipste das Flurlicht aus und trat hinaus in die weiche Nachtluft. Sie zog die Tür hinter sich zu, hörte das Einschnappen des Riegels, rüttelte noch einmal am Türknauf, um sich zu vergewissern, dass die Tür auch wirklich verschlossen war, und ging dann auf ihren Wagen zu.
Auf etwa zwei Dritteln des Weges zu ihrem Wagen stand ein verrosteter Dodge Pickup auf dem Parkplatz. Eine zerbeulte Aluminiumwohnkabine mit zerlumpten Vorhängen an den Fenstern war auf der Ladefläche festgezurrt. Es kam hin und wieder vor, dass Gäste der Bar, die zu viel getrunken hatten, ihren Rausch in ihren Wagen auf dem Parkplatz ausschliefen; der Truck mit der Kabine stellte also keine Abweichung von der Norm dar. Dennoch kam er Rinker irgendwie unheimlich vor. Sie wäre beinahe um das Gebäude zum Haupteingang zurückgelaufen, um Rick noch zu erreichen, ehe er nach Hause ging.
Beinahe. Aber der Weg um das Gebäude war weit, und außerdem kam sie sich albern vor, und vielleicht hatte Rick es eilig, nach Hause zu kommen, und der Truck war ja schließlich unbeleuchtet, es schien niemand drin zu sein ...
Dale-Sowieso saß auf der Rinker abgewandten Seite des Trucks auf dem Kiesboden, den Rücken gegen die Fahrertür gelehnt. Er wartete nun schon seit zwanzig Minuten mit steigender Ungeduld auf sie, kaute Pfefferminzdragees und dachte dabei an ihren Körper. Irgendwo in den Tiefen seines Bewusstseins betrachtete er Pfefferminzdragees als Zugeständnis an die Galanterie, die man Frauen gegenüber zeigen sollte. Er kaute das Zeug, um dieser kleinen Tänzerin einen Gefallen zu tun.
Als er hörte, dass die Hintertür geschlossen wurde, stand er auf, schaute durch das Wagenfenster und sah sie kommen, allein. Er wartete geduckt hinter dem Truck; er war ein großer Mann, und wenn auch ein erheblicher Anteil seiner Körpermasse aus Fett bestand, war er jedenfalls stolz auf seine Größe.
Und er war schnell: Rinker hatte nicht den Hauch einer Chance.
Als sie am Truck vorbeikam, einen klirrenden Schlüsselbund in der Hand, stürzte er sich aus der Dunkelheit auf sie wie ein Tackle beim Football. Der Aufprall nahm ihr den Atem; sie stürzte auf den Rücken, lag unter ihm, rang nach Luft, und der Kies schnitt ihr in die nackten Schultern. Er wirbelte sie herum, zog ihre Arme auf dem Rücken zusammen, umspannte ihre dünnen Handgelenke mit einer Hand, drückte die andere in ihren Nacken.
Sein Pfefferminzatem war dicht an ihrem Ohr, und er zischte ihr zu: »Wenn du schreist, brech ich dir dein verdammtes Genick.«
Sie schrie nicht, denn so was war ihr schon einmal passiert, mit ihrem Stiefvater. Damals hatte sie geschrien, und er hatte ihr beinahe das Genick gebrochen. Aber Rinker wehrte sich heftig, zappelte, spuckte, strampelte, wand und drehte sich, versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. Aber Dale-Sowiesos Hand war wie ein Schraubstock an ihrem Genick, und er zerrte sie zur Camper-Kabine, zog die Hecktür auf, schob sie hinein, riss ihr die Unterhose herab und tat im flackernden gelben Licht der Innenbeleuchtung, was er sich vorgenommen hatte.
Als er fertig war, warf er sie aus der Hecktür, spuckte auf sie hinunter und knurrte: »Du dreckiges Miststück, wenn du jemand was sagst, bring ich dich um.« Später erinnerte sie sich hauptsächlich daran, wie sie nackt auf dem Kies gelegen und er auf sie heruntergespuckt hatte. Und an die borstigen Haare auf Dales fettem Wackelarsch.
Rinker ging nicht zu den Cops, denn das wäre das Ende ihres Jobs gewesen. Und wie sie die Cops kannte, hätten die sie bestimmt zurück zu ihrem Stiefvater geschickt. Aber sie wandte sich an die Besitzer des Zanadu und erzählte ihnen von der Vergewaltigung. Die Brüder Ernie und Ron Battaglia waren besorgt – zum einen wegen Rinker, zum anderen wegen ihrer Lizenz. Eine Stipteasebar geriet in argen Verruf, wenn auf ihrem Parkplatz Sexualverbrechen passierten.
»Ach du heilige Scheiße«, sagte Ron, als Rinker ihm und Ernie von der Vergewaltigung berichtete. »Das ist ja schrecklich, Clara. Bist du verletzt? Du musst dich von ’nem Arzt untersuchen lassen, ganz klar.«
Ernie nahm eine Geldscheinrolle aus der Tasche, schälte zwei Hunderter davon ab, dachte ein paar Sekunden nach, entschloss sich zu einem weiteren Hunderter, schob ihr die drei Geldscheine in den Ausschnitt ihres Reserve-Stretchoberteils. »Geh und lass dich untersuchen, Kid.«
Sie nickte, sagte dann: »Wisst ihr, ich will nicht zu den Cops gehen. Aber dieses verdammte Arschloch soll für das bezahlen, was er mir angetan hat.«
»Wir kümmern uns darum«, bot Ernie an.
»Nein, lasst mich das selber machen«, sagte Rinker.
Ron hob die Augenbrauen. »Was hast du vor?«
»Schafft ihn für mich in den Keller. Er hat mal gesagt, er wäre Dachdecker. Er braucht also seine Hände zum Geldverdienen. Ich nehme mir einen verdammten Baseballschläger und zertrümmere ihm einen von seinen Armen.«
Ron sah Ernie an, der wiederum Rinker anschaute und sagte: »Das ist okay. Wenn er nächstes Mal herkommt, hm?«
Sie machten es nicht, als er eine Woche später wieder in die Bar kam. Er wirkte nervös, vermied jeden Blickkontakt mit Rinker, nahm wohl zu Recht an, dass er nicht willkommen war. Rinker lehnte es ab, Dale-Sowieso an der Bar zu bedienen, und als sie Ernie in der Küche auf die geäußerte Absicht ansprach, knurrte der nur, gottverdammt, der Steuertermin stehe vor der Tür, und weder er noch Ron wären im Moment mental auf eine Auseinandersetzung mit dem Kerl eingestellt.
Rinker bearbeitete die beiden weiter, und als Dale-Sowieso zwei Tage nach dem Steuertermin wieder auftauchte, hatten die Brüder mental keinerlei Schwierigkeiten, sich auf eine Auseinandersetzung mit ihm einzulassen. Sie fütterten Dale-Sowieso mit Drinks und Erdnüssen »aufs Haus« und verwickelten ihn bis zur Sperrstunde in Gespräche. Rick, der Barkeeper, komplimentierte den vorletzten Gast nach draußen und folgte ihm schleunigst, ohne noch einmal zurückzuschauen; er schien zu ahnen, dass irgendwas geplant war.
Dann ging Ron um den Tresen, Ernie brachte Dale-Sowieso dazu, in die andere Richtung zu schauen, und Ron verpasste ihm einen überraschend wilden rechten Schwinger, der ihn vom Barhocker holte. Ron stürzte sich auf ihn, zerrte ihn auf den Bauch, und Ernie kam um den Tresen gerannt und nahm ihn in den speziellen Schwitzkasten, wie ihn Profiringer kennen. Zusammen schleppten sie dann Dale-Sowieso, der kaum Widerstand leistete, die Kellertreppe hinunter.
Die Brüder stellten ihn auf die Füße, und er war bei vollem Bewusstsein, als Rinker herunterkam. Sie hatte einen Baseballschläger aus Aluminium dabei; korrekter gesagt, einen T-Ball-Schläger, der vom Schwunggewicht her für klein gewachsene Frauen besser geeignet ist.
»Ich werd euch beschissenen Arschlöchern ‘ne Klage an den Hals hängen, die euch um jeden verdammten Cent von eurem Vermögen bringt«, keuchte Dale-Sowieso, und Blut tropfte von seiner aufgeplatzten Unterlippe. »Mein verdammter Anwalt macht Freudentänze über das Geld, das er an euch verdammten Drecksäcken verdient.«
»So’n Scheiß wirst du nicht machen«, sagte Ron. »Du hast dieses kleine Mädchen da vergewaltigt ...«
»Wie willst du’s haben, Clara?«, fragte Ernie. Er stand hinter Dale, hatte die Arme unter seinen Achseln hindurchgeschoben und die Hände in seinem Nacken verschränkt. »Willst du ’nen Arm oder ’n Bein?«
Rinker stand dicht vor Dale-Sowieso, der sie finster anstarrte. »Ich werd ...«, fing er an.
Rinker ließ ihn nicht aussprechen. »Scheiß-Beine«, knurrte sie. Sie hob den Schlagstock und ließ ihn dann auf Dale-Sowiesos Schädeldach niedersausen.
Der Aufschlag klang, als ob ein dicker Mann auf eine Walnuss getreten wäre. Ernie zuckte zusammen, lockerte seinen Griff, und Dale-Sowieso sackte auf den Boden wie ein zweihundert Pfund schwerer Sandsack.
»Heilige Scheiße«, sagte Ron und bekreuzigte sich.
Ernie stieß Dale-Sowieso mit der Spitze seiner braunen Stiefel an, und eine Blutblase quoll aus Dales Mund. »Der is’ nicht tot«, sagte Ernie.
Rinker hob den Schlagstock und schlug noch einmal zu, diesmal gegen den Knöchel hinter seinem linken Ohr. Sie führte den Schlag mit erheblicher Wucht aus; ihr Stiefvater hatte oft von ihr verlangt, Feuerholz zu spalten, und sie war geübt darin, einem Schlag mit einem Werkzeug die entsprechende Wucht zu verleihen. »Das müsste reichen«, sagte sie.
Ernie nickte und brummte zustimmend »hm«. Dann sahen sich alle drei im Licht der einzigen nackten Birne im Raum an, und Ron sagte zu Rinker: »Irgendwie große Scheiße, Clara ... Wie fühlst du dich jetzt?«
Clara sah auf Dale-Sowiesos Leiche hinunter, auf den schwärzlichen Blutring um seine dicken Lippen, und sagte: »Er war nur ein Stück Scheißdreck.«
»Und du fühlst gar nichts?«, fragte Ernie.
»Nein, gar nichts.« Ihre Lippen waren ein dünner, harter Strich.
Nach einigen Sekunden des Schweigens sah Ron zu der schmalen Kellertreppe hinüber und sagte: »Wird verdammt schwierig sein, seinen Arsch aus dem Keller zu schaffen.«
»Da hast du Recht«, sagte Ernie und fügte philosophisch hinzu: »Ich hätte ihm rechtzeitig sagen sollen, dass es bei uns keine Muschi umsonst gibt.«
Dale-Sowieso landete im Mississippi, und sein Truck wurde auf der anderen Flussseite in Granate City abgestellt, wo er prompt zwei Tage später geklaut wurde. Niemand fragte je nach Dale, und Rinker trat weiterhin als Tänzerin auf. Einige Wochen nach der Sache bat Ernie sie, sich zu einem älteren Mann zu setzen, der auf ein Bier in die Bar gekommen war. Rinker legte den Kopf schief, und Ernie sagte schnell: »Nein, nein, das ist okay. Du brauchst dich auf nichts einzulassen.«
Also nahm sie sich ein großes Budweiser und setzte sich zu dem Mann, der sagte, er sei der Bruder vom Mann von Ernies Tante. Er wusste von der Sache mit Dale-Sowieso. »Haben Sie inzwischen irgendwelche schlechten Gefühle deswegen oder immer noch nicht?«
»Nein, hab ich nicht. Aber ich bin sauer, dass Ernie Ihnen davon erzählt hat.« Sie trank einen Schluck von ihrem Budweiser.
Der ältere Mann lächelte. Er hatte sehr kräftige weiße Zähne, die von seinen schwarzen Augen und den dunklen, langen, fast femininen Wimpern abstachen. Rinker hatte plötzlich den Eindruck, der Mann könnte einem Mädchen zu schönen Zeiten verhelfen, obwohl er schon über Vierzig sein musste. »Haben Sie schon mal eine Schusswaffe abgefeuert?«, fragte er.
So wurde Rinker zur »Hit-Lady« – zur Profikillerin. Sie betrieb ihr Geschäft nicht spektakulär wie dieser Jackal oder die Profikiller in den Fernsehfilmen. Sie erledigte ihre Aufträge emotionslos, ruhig und effizient und benutzte dabei verschiedene kleinkalibrige Pistolentypen, stets mit Schalldämpfern, meistens .22er, also Kaliber 5,6 mm. Auftragsmorde aus nächster Nähe wurden zu ihrem Warenzeichen.
Rinker hatte sich nie für dumm gehalten; ihr war klar, dass sie einfach noch nie die Chance gehabt hatte, ihre Intelligenz unter Beweis zu stellen. Als das Geld von den Auftragsmorden sich summierte, erkannte sie, dass sie nicht wusste, was sie damit tun sollte. Also besuchte sie morgens das Intercontinental College of Business und belegte Kurse in Buchhaltung und Organisation eines Kleinunternehmens. Als sie zwanzig und damit schon ein wenig alt für den Nackttanz wurde, verschaffte ihr der Mafioso, der sie ins Killergeschäft gebracht hatte, einen Job in der Verwaltung eines Lagerhauses für alkoholische Getränke. Und als sie vierundzwanzig wurde und sich in der Führung eines Geschäfts ein wenig auskannte, kaufte sie sich eine eigene Bar im Zentrum von Wichita, Kansas, und nannte sie »The Rink«.
Die Bar lief gut, dennoch verließ Rinker einige Male im Jahr mit einer Pistole im Gepäck die Stadt und kam mit einem Bündel Geld wieder zurück. Einen Teil davon gab sie aus, aber den größten Teil deponierte sie unter verschiedenen Namen in verschiedenen Orten bei verschiedenen Banken. Eines hatte sie von ihrem Stiefvater gelernt: Wie gut es dir im Moment auch geht, früher oder später wirst du dich absetzen müssen ...
Carmel Loan ...
Carmel war groß gewachsen, elegant und kostspielig wie eine neue Jaguarlimousine.
Sie hatte ein schmales Gesicht mit einer hübschen Nase, dünnen blassen Lippen, einem eckigen Kinn und eine kleine, spitz zulaufende Zunge. Sie stammte von schwedischen Vorfahren ab und war blond – eine dieser Schwedinnen vom Typ Rennhund mit kleinen Brüsten, schmalen Hüften und einer langen Taille dazwischen. Sie hatte die Augen eines Vogels, der stets auf Beute aus ist – eines Raubvogels. Carmel war Strafverteidigerin in Minneapolis, und zwar eine der drei Erfolgreichsten. In den meisten Jahren schaffte sie bequem ein Einkommen von mehr als einer Million Dollar.
Carmel wohnte in einem fantastischen, absolut coolen Hochhausappartement im Zentrum von Minneapolis – durchweg helle Parkettfußböden und weiße Wände mit Schwarzweißfotos von Ansel Adams und Diane Arbus und Minor White, keine davon war aber so modern und revolutionär wie Robert Mapplethorpe. Unter all diesem Schwarz-Weiß sprang das Blutrot der Möbel und Teppiche ins Auge, und auch ihr Wagen, ein Jaguar XK8, war – in Sonderanfertigung – blutrot lackiert.
Am zweiten der drei unglücklichsten Tage im Leben von Barbara Allen entdeckte Carmel Loan, dass sie ernsthaft, zutiefst und für alle Ewigkeit in Hale Allen verliebt war, Barbara Allens Ehemann.
Hale Allen, ein Anwalt mit Spezialgebiet Haus- und Grundbesitz, war der Schwarm aller Frauen. Er hatte schwarzes Haar, das ihm in kleinen Löckchen in die Stirn fiel, warme braune Augen, ein eckiges Kinn mit einem kleinen Grübchen, große Hände, breite Schultern und schmale Hüften. Er war knapp einsfünfundachtzig groß, hatte Anzugsgröße zweiundvierzig und einer seine Schneidezähne wies eine kleine Scharte auf. Der Knoten seiner Krawatte war ständig verrutscht, und immer wieder fühlten sich Frauen bemüßigt, ihn gerade zu rücken. Um damit Hand an ihn legen zu können. Er hatte ein natürliches Talent, mit Frauen umzugehen, mit ihnen zu plaudern, mit ihnen zu spielen ...
Hale Allen liebte die Frauen; und das nicht nur aus sexuellen Gründen. Es gefiel ihm ganz einfach, mit ihnen zu reden, mit ihnen Einkaufsbummel zu machen, mit ihnen zu joggen – und das alles, ohne etwas von seiner Männlichkeit zu verlieren. Er hatte Carmel Anlass zu dem Glauben gegeben, er finde sie nicht unattraktiv. Und immer, wenn Carmel ihn sah, rastete tief in ihrem Inneren etwas aus.
Dennoch, bei all seiner Attraktivität und dem Naturtalent im Umgang mit Frauen war Hale Allen intellektuell nicht »das schärfste Messer in der Spülmaschine«. Er begnügte sich mit einfachsten Rechtsfällen, dem Abschließen von Routineverträgen, und er verdiente nur einen Bruchteil von Carmels Jahreseinkommen. Das spielte jedoch für eine Frau, die die große Liebe ihres Lebens gefunden hatte, keine bedeutende Rolle. Wenn eine Frau eine echte körperliche Leidenschaft für einen Mann empfindet, kann sie übersehen, dass er ein wenig dumm ist, meinte Carmel. Außerdem gab Hale bestimmt ein tolles Bild ab, wenn er bei ihrer jährlichen Weihnachtsparty neben dem gemauerten Kamin stand, mit einem Scotch in der Hand und vielleicht einer blutroten Krawatte um den Hals; die geistvollen Gespräche konnte sie übernehmen.
Bedauerlicherweise schien Hale auf ewig an seine Frau Barbara gebunden zu sein.
Durch ihr Geld, dachte Carmel. Barbara hatte eine ganze Menge davon, von ihrer Familie. Und auch wenn Hales zerebrale Glühfäden nicht so hell leuchteten wie bei anderen, er wusste, was fünfzig Millionen Bucks waren, wenn er sie vor Augen hatte. Er wusste, wie es kam, dass man sich diesen schwarzen Kaschmirsportmantel von Giorgio Armani für tausendsechshundert Dollar leisten konnte.
Allens Bindung an seine Frau – oder an ihr Geld, wie auch immer – ließen für eine Frau von Carmels Qualitäten nur wenige Optionen zu.
Sie wollte nicht rumhängen und vor Sehnsucht zerfließen oder Weinkrämpfe und Depressionen kriegen oder sich betrinken und sich ihm an den Hals werfen. Sie musste etwas unternehmen.
Zum Beispiel diese Frau ins Jenseits befördern.
Vor fünf Jahren hatte Carmel einmal vor Gericht die Beweiskette in Stücke gerissen, die ein unerfahrener junger Cop in St. Paul zusammengetragen hatte, nachdem eine normale Verkehrskontrolle sich zu einem schwereren Fall von Drogenhandel ausgeweitet hatte.
Ihr Klient, Rolando (»Rolo«) D’Aquila, war somit einer Anklage wegen Drogenhandels entgangen, obwohl die Cops zehn Kilo Kokain unter dem Ersatzreifen seines kaffeebraunen Continentals gefunden hatten. Die Cops hatten schließlich nur das Verwirkungsgesetz anwenden und den Wagen einbehalten können, aber das hatte Rolo nicht besonders beeindruckt. Beeindruckt war er jedoch von der Tatsache gewesen, dass er nicht mehr als exakt fünf Stunden in der Zelle hatte sitzen müssen, und das war die Zeit gewesen, die Carmel zur Organisation der Kaution in Höhe von einer Million dreihunderttausend Dollar gebraucht hatte.
Und später, als sie nach dem Freispruch aus dem Gerichtsgebäude gingen, sagte Rolo zu ihr, wenn er ihr je einmal einen echten Gefallen tun könne – einen wirklich echten Gefallen –, solle sie sich an ihn wenden. Auf Grund der vorher mit ihm geführten Gespräche wusste Carmel sehr gut, was er damit meinte. »Ich steh ja auch echt in Ihrer Schuld«, betonte Rolo. Sie sagte nicht nein, weil sie in solchen Fällen niemals nein sagte.
Sie sagte nur: »Wir werden sehen.«
An einem warmen, regnerischen Maitag fuhr Carmel in ihrem Zweitwagen – einem unscheinbaren schwarzblauen Volvo-Kombi, zugelassen auf den in zweiter Ehe erworbenen Namen ihrer Mutter – zu einem heruntergekommenen Haus in St.-Paul-Frogtown, hielt am Bordstein an und schaute aus dem Seitenfenster.
Das alte Fachwerkhaus schien im ungehindert wuchernden Gras einer früheren Rasenfläche zu versinken. Regenwasser lief über die Ränder der mit Laub verstopften Dachrinnen, und der abblätternde grüne Anstrich des Hauses ließ Flecken der früheren Farbe erkennen, einem kreidigen Blau. Kein Fenster und keine Tür war noch ganz im Lot oder in der Waagerechten zu den Fachwerkbalken des Hauses, auch nicht zueinander. Die meisten der Fenster waren verglast, einige hatten jedoch nur schwarze Fliegengitter.
Carmel nahm einen kleinen Reiseschirm vom Rücksitz, stieß die Wagentür mit dem Fuß auf, ließ den Schirm aufschnappen und lief über den Gehweg zum Haus. Die innere Tür stand offen; sie klopfte zweimal gegen die geschlossene Fliegentür, die daraufhin in ihrem Rahmen erzitterte, und hörte dann Rolos Stimme: »Kommen Sie rein, Carmel. Ich bin in der Küche.«
Das Innere des Hauses passte sich dem Äußeren an. Die Teppiche waren zwanzig Jahre alt, und der dünne Flor war von abgetretenen Pfaden durchzogen. Die Wände zeigten ein schmuddeliges Gelb, die Möbel bestanden aus schäbigem, plastikfurniertem Sperrholz mit angeschlagenen Kanten und Beinen. An den Wänden hingen weder Bilder noch andere schmückende Gegenstände. Nägel ragten an helleren Stellen aus den Wänden, wo frühere Bewohner sich mehr Mühe um eine gewisse Wohnlichkeit gegeben hatten. Es stank intensiv nach Nikotin und Teer.
In der Küche war es unwahrscheinlich hell. An den beiden Fenstern, die den Küchentisch flankierten, gab es weder Rollos noch Vorhänge, und sie waren weit geöffnet. Nur zwei Stühle standen am Tisch, einer herangeschoben, der andere ein Stück weggezogen. Rolo, der dünner war als vor fünf Jahren, trug Jeans und ein T-Shirt, auf dem – recht rätselhaft – die Aufschrift Jesus prangte. Er hatte beide Hände im Spülstein.
»Wegen Ihres Besuchs wollte ich schnell noch abwaschen«, sagte er.
Es war ihm nicht peinlich, bei der Hausarbeit erwischt zu werden, und der Gedanke – Es sollte ihm peinlich sein – zuckte durch Carmels Anwaltsgehirn.
»Setzen Sie sich«, sagte er und nickte zu dem vom Tisch weggezogenen Stuhl. »Die Kaffeemaschine läuft.«
»Ich hab’s ziemlich eilig«, erwiderte sie.
»Wie, haben Sie etwa keine Zeit für einen Kaffee mit Ihrem Freund Rolando?« Er schüttelte das Spülwasser von den Händen, riss ein Papiertuch von einer Rolle auf der Arbeitsplatte, trocknete sich die Hände ab und warf den zusammengeknüllten Papierball in Richtung auf einen Abfalleimer in der Ecke. Der Ball prallte gegen die Wand und hüpfte dann in den Eimer. »Zwei Punkte«, sagte Rolo zufrieden.
Sie schaute auf die Uhr, korrigierte dann ihre Entscheidung im Hinblick auf den Kaffee. »Na ja, ein paar Minuten habe ich natürlich Zeit.«
»Ich bin ziemlich tief gesunken, hm?«
Sie sah sich in der Küche um, zuckte die Schultern und sagte: »Sie werden wieder hochkommen.«
»Ich weiß nicht«, erwiderte er. »Ich habe die Nase ziemlich tief im Koks stecken.«
»Dann müssen Sie einen Entzug machen.«
»Ja, ein E-Programm«, sagte er und lachte. »Zwölf Schritte zu Jesus ...« Dann, entschuldigend: »Ich habe nur Kaffee mit Koffein.«
»Ich trinke nie koffeinfreien«, sagte sie, und dann: »Sie haben den Anruf also gemacht.« Keine Frage, eine Feststellung.
Rolo goss Kaffee in zwei gelbe Keramikbecher, die bei Carmel Erinnerungen an die Ferienorte an den Seen in den North Woods hervorriefen. »Ja. Und sie ist noch im Dienst meiner Freunde, und sie nimmt den Job an.«
»Sie? Es ist eine Frau?«
»Ja. Ich war selbst überrascht. Ich hab früher nie nach so was gefragt, verstehen Sie ... Aber als ich jetzt gefragt hab, hat mein Freund ›sie‹ gesagt.«
»Sie muss aber gut sein«, sagte Carmel.
»Sie ist gut. Hat einen ausgezeichneten Ruf. Jeder Schuss ein Treffer. Sehr effizient, sehr schnell. Immer aus kürzester Entfernung, da kann gar nichts schief gehen.« Rolo stellte einen der Kaffeebecher vor sie hin, und sie drehte ihn mit den Fingerspitzen, nahm ihn hoch.
»Genau das, was ich brauche«, sagte sie und trank einen Schluck. Guter Kaffee, sehr heiß.
»Sie sind sich ganz sicher?«, fragte Rolo. Er lehnte sich gegen die Arbeitsplatte und gestikulierte mit dem Kaffeebecher. »Wenn ich denen mal zugesagt hab, gibt’s kein Zurück mehr. Bei dieser Frau weiß man nie, wie sie den Auftrag ausführt, niemand weiß, wo sie sich aufhält oder welchen Namen sie benutzt. Wenn Sie zustimmen, tötet sie Barbara Allen.«
Carmel runzelte bei der Nennung von Barbara Allens Namen die Stirn. Sie hatte bisher nie wirklich überlegt, dass es um einen Mord ging. Sie hatte die Angelegenheit eher abstrakt betrachtet, als Lösung eines ansonsten unlösbaren Problems. Natürlich, sie hatte gewusst, dass es ein Mord sein würde, aber sie hatte diese Tatsache einfach noch nicht gedanklich verarbeitet. »Ich bin sicher«, sagte sie.
»Sie haben das Geld?«
»Ja. Im Haus. Ihre zehntausend Dollar habe ich dabei.«
Sie stellte den Becher ab, kramte in ihrer Handtasche, holte ein dünnes Bündel großer Scheine heraus und legte es auf den Tisch. Rolo nahm es an sich und blätterte die Scheine mit dem Daumen durch. »Eines sollten Sie noch wissen«, sagte er. »Wenn jemand kommt und das Geld haben will – zahlen Sie jeden Cent. Jeden Cent. Feilschen Sie, um Himmels willen, nicht, zahlen Sie einfach. Wenn Sie das nicht tun, wird man keinen weiteren Versuch machen, das Geld einzutreiben, sondern man wird Sie umlegen – als abschreckendes Beispiel.«
»Ich weiß, wie das läuft«, erwiderte Carmel mit einem Anflug von Ungeduld. »Die Leute werden das Geld – wie abgemacht – kriegen. Und niemand kann es zurückverfolgen, da ich es nach und nach beiseite gelegt habe.«
Rolo zuckte die Schultern. »Wenn Sie also zustimmen, rufe ich heute Abend meinen Freund an. Und Barbara Allen ist eine tote Frau.«
Diesmal zuckte Carmel nicht zusammen, als Rolo den Namen nannte. Sie stand auf. »Ja«, sagte sie, »tun Sie das.«
Rinker kam drei Wochen später in die Stadt. Sie war mit ihrem eigenen Wagen von Wichita losgefahren, hatte dann zwei verschiedenfarbige Wagen verschiedenen Typs von Hertz und Avis gemietet, unter zwei verschiedenen Namen und der Vorlage authentischer, in Missouri ausgestellter Führerscheine sowie absolut sauberer Kreditkarten von gut gefüllten Konten.
Sie hängte sich eine Woche an Barbara Allens Fersen und fasste schließlich den Entschluss, sie im Treppenhaus eines Parkhauses im Stadtzentrum zu töten. Im Verlauf der Beobachtungswoche war Barbara Allen viermal in das Parkhaus gefahren und jedes Mal über die Innentreppe bis zur Etage mit einer Verbindungspassage in ein benachbartes Bürogebäude hinuntergegangen. Hinter dem Verbindungsgang hatte sie ein Büro betreten, an dessen Tür die Inschrift »Wohlfahrtsverband Stern des Nordens« stand. Als Rinker mit Sicherheit wusste, dass Allen nicht im Büro war, hatte sie dort angerufen und nach ihr gefragt.
»Es tut mir Leid, sie ist nicht da.«
»Wann kann ich sie erreichen?«
»Sie ist normalerweise morgens ein bis zwei Stunden hier, vor dem Mittagessen.«
»Danke, ich versuch’s dann morgen noch mal.«
Barbara Allen ...
Am letzten der drei unglücklichsten Tage in ihrem Leben stieg sie morgens aus dem Bett, ging unter die Dusche und aß zum Frühstück ein leichtes Müsli aus Rosinenkleie und Erdbeeren – mit einem Ehemann wie Hale musste man auf die Figur achten. Während die Haushälterin das Geschirr abräumte, schaltete Barbara den Fernseher ein und sah sich die Dow-Jones-Eröffnungskurse des Tages an, setzte sich dann an ihren Schreibtisch und überprüfte noch einmal die ausgearbeiteten finanziellen Bewilligungspläne für wohltätige Aktivitäten des Stern des Nordens, um schließlich gegen halb zehn die Papiere zusammenzuraffen, in eine braune Coach-Aktentasche zu stecken und sich auf den Weg ins Stadtzentrum zu machen.
Rinker folgte ihr zunächst in einem roten Cherokee-Jeep, bis sie sicher war, dass Allen zum Stadtzentrum unterwegs war, überholte sie dann und fuhr zügig voraus.
Allen war eine langsame, vorsichtige Fahrerin, aber der Verkehr und die Ampeln waren unberechenbar, und Rinker wollte bei der Ankunft mindestens fünf Minuten Vorsprung vor ihr haben.
Rinker hatte sich ein anderes Parkhaus ausgesucht, das ebenfalls über das System der Verbindungsgänge mit dem Bürogebäude verbunden war. Von dort aus war der vorgesehene Ort des Geschehens bei schnellem Gehen in etwas weniger als zwei Minuten zu erreichen. Sie steuerte den Wagen in das Parkhaus, stellte ihn ab, ging zu ihrem eigenen Wagen, den sie am frühen Morgen hier geparkt hatte, und kletterte auf den Rücksitz. Sie schaute sich um und sah einen Mann auf den Ausgang zugehen, sonst aber niemanden. Sie hob die Fußmatte hinter dem Beifahrersitz hoch und klappte den Deckel einer flachen Stahlkassette auf, in der zwei halbautomatische .22er Remington-Pistolen mit bereits aufgeschraubten Schalldämpfern in einem Bett aus kleinen Styropor-Kügelchen lagerten.
Rinker trug ein weites Hemd, darunter einen selbst geschneiderten elastischen Gürtel. Sie steckte die beiden Pistolen durch die breiten Taschenschlitze auf beiden Seiten des Hemdes und die aufgetrennten Taschenfutterale in den Elastikgürtel. Die .22er waren damit beiderseits fest an ihren Körper gedrückt, aber sie konnte sie in Sekundenbruchteilen herausziehen. Als die Waffen verstaut waren, sprang sie aus dem Wagen und ging zum Verbindungsgang.
Barbara Allen, eine untersetzte deutsche Blondine mit kurzem, teurem Haarschnitt und einem Tupfer Lippenstift, gekleidet in eine glatte weiße Baumwollbluse, einen blauen Rock und dazu passende, flache blaue Schuhe, betrat um 09.58 Uhr das Treppenhaus des Parkhauses in der Sixth Street. Auf halbem Weg die Treppe hinunter kam ihr eine kleine Frau entgegen, eine Rothaarige. Als sie aneinander vorbeigingen, lächelte die Frau mit gesenktem Kopf, und Barbara, die sich in solchen Dingen auskannte, schaute auf das rote Haar und dachte »Perücke«.
Das war der letzte Gedanke, der ihr am unglücklichsten Tag ihres Lebens durch den Kopf ging.
Rinker verpasste den richtigen Zeitpunkt. Sie hatte sich vergewissert, dass aus der unteren Parketage niemand kam, und wollte Allen dort unten abfangen. Aber Allen kam sehr langsam die schmale Treppe herunter, und Rinker, inzwischen in ihrem Sichtfeld, wollte sich nicht verdächtig machen, indem sie unten stehen blieb und auf sie wartete. Also ging sie die Treppe hinauf und Allen entgegen. Im Vorbeigehen nickte Allen ihr lächelnd zu, und einen Sekundenbruchteil später zog Rinker die Pistole an ihrer rechten Seite, entsicherte sie und feuerte aus einer Entfernung von fünf Zentimetern eine Kugel in Allens Hinterkopf. Allens Haare wirbelten hoch, als ob jemand kräftig dagegen gepustet hätte, und sie sackte zusammen.
Der Schalldämpfer war gut. Das lauteste Geräusch im Treppenhaus war das Repetieren des Verschlusshebels der Pistole. Rinker brachte noch einen zweiten Schuss an, ehe Allen nach vorn stürzte; dann trat sie hinter den auf einen Treppenabsatz gerutschten Körper und feuerte fünf weitere Schüsse in Allens Schläfe.
Rinker trat zur Seite, um an der Leiche vorbei nach unten zur Parketage zu gehen, schaute sich noch einmal um – und zuckte zusammen. Ein Cop kam durch die Tür auf dem Treppenabsatz über ihr. Er war in Uniform, ein korpulenter Mann mit einem Aktenordner in der Hand.
Rinker hatte die Möglichkeit, von einem Cop überrascht zu werden, in ihre Überlegungen einbezogen, obwohl sie nie so etwas erlebt hatte. Aber sie war auf eine solche Situation vorbereitet.
»Heh ...«, sagte der Cop. Er streckte die freie Hand aus, und Rinker schoss auf ihn.
Kapitel 2
Der erste Tag auf Streifenfahrt in Baily Dobbs Polizistenleben hatte ihn gelehrt, dass die Polizeiarbeit komplizierter war, als er sich vorgestellt hatte – und gefährlicher, als er erwartet hatte. Baily hatte diesen Job als eine Möglichkeit angesehen, eine gewisse Autorität zu erlangen, einen Status. Er hatte nicht erwartet, dass er in Kämpfe mit Männern verwickelt werden könnte, die größer und kräftiger waren als er, dass Betrunkene den Rücksitz des Streifenwagens voll kotzen könnten, dass er sich vor dem Target Center den Arsch abfrieren musste, wenn drinnen die Wolves spielten. Also entschloss sich Baily, den Kopf einzuziehen, sich für keinerlei Aktivitäten freiwillig zu melden, bei gefährlich klingenden Notrufen mit geziemender Verspätung am Ort des Geschehens zu erscheinen und so schnell wie möglich vom Dienst auf der Straße wegzukommen.
Er schaffte das nach weniger als zwei Dienstjahren.
An einem Halloween-Abend, als er – mit geziemender Verzögerung – auf einen örtlichen Notruf reagierte, war er in einer dunklen Nebengasse auf die Hinterachse eines Kinderdreirads getreten, gestürzt und hatte sich das Knie ausgerenkt. Er wurde nicht für dienstunfähig befunden, aber es war klar, dass er nicht mehr schnell laufen konnte und somit für den Außendienst untauglich war. Sein starkes Humpeln während der Rehabilitationszeit in der Gymnastikhalle täuschte die Ärzte und amüsierte seine früheren Partner. Der Spruch »du willst wohl den Baily spielen« wurde im Vokabular der Stadtpolizei von Minneapolis ein Synonym für Drückebergerei.
Baily kam also in den Innendienst und blieb dort. Er trug weiterhin die Uniform samt der Dienstwaffe, wurde auch wie jeder andere Cop bezahlt, aber er war jetzt ein »Bürohengst« – und er war glücklich. Das alles trug wohl erheblich dazu bei, dass er nicht so schnell reagierte, wie er es hätte tun sollen, als er sah, wie Rinker mit der Exekution von Barbara Allen beschäftigt war. Seine Reflexe waren ihm abhanden gekommen. Bailys Mittagspause begann normalerweise um elf Uhr, aber an diesem Tag hatte er sich zu einer »Unterstunde« entschlossen. Er stahl sich aus dem Trakt des Polizeipräsidiums im Rathaus und ging durch das Kellergeschoss hinüber ins Verwaltungsgebäude des Hennepin-County; in der Hand hielt er einen Aktenordner mit einigen Papieren, die an einen Gerichtsangestellten adressiert waren – seine Rückendeckung, falls er einem seiner Vorgesetzten begegnen sollte.
Im County-Gebäude schaute er sich schnell um, schlüpfte dann in den Verbindungsgang, der zur Tiefgarage in der Sixth Street führt.
Sein Plan war, von dort aus die Treppe zum Straßenniveau hinunterzusteigen und dann hinüber ins Zentralkrankenhaus des Hennepin-County zu gehen, wo es eine nette, diskrete Cafeteria gab, die kaum von anderen Cops aufgesucht wurde. Er würde sich einen Cheeseburger und eine Portion Fritten zu Gemüte führen, ein paar Tassen Kaffee trinken, die Zeitung lesen und dann zurück in die City Hall schlendern, um die Mittagspause nicht zu verpassen.
Dieser überaus viel versprechende Plan ging daneben, als er das Treppenhaus des Parkhauses betrat.
Zwei Frauen befanden sich auf dem Treppenabsatz unter ihm, und eine von ihnen, eine Rothaarige, schien der anderen, die auf dem Boden lag, etwas ins Ohr stecken zu wollen.
»Heh ...«, sagte er.
Die Rothaarige sah zu ihm hoch, und im nächsten Sekundenbruchteil erkannte Baily, dass der Gegenstand in ihrer Hand eine Pistole war. Die Pistole kam noch, Baily streckte abwehrend die Hand aus, und die Rothaarige schoss auf ihn. Es war kaum ein Geräusch zu hören, aber er spürte, dass etwas gegen seine Brust prallte, und er stürzte nach hinten.
Er fiel unter den Türrahmen, und das rettete ihm das Leben: Rinker unten auf dem Treppenabsatz hatte die Pistole im Anschlag, konnte aber von Baily nichts mehr sehen als seine Fußsohlen. Baily seinerseits stöhnte und hörte dann verschwommen die Stimme eines Mannes: »Was ist los mit Ihnen?«
Rinker hatte schon zwei schnelle Schritte die Treppe hinauf gemacht, um ihn endgültig zu erledigen, als sie die fremde Stimme hörte. Eine zusätzliche Komplikation, also ab nach unten, in Sicherheit. Sie ging die Treppe runter, rannte nicht, bewegte sich jedoch schnell.
Baily wollte sich hoch stemmen, vom Treppenhaus wegkriechen, als er hörte, wie unten eine Tür ins Schloss fiel. Seine Brust schmerzte, ebenso seine Hand. Er schaute auf die Hand und sah, dass sie aufgeschürft war, offensichtlich vom Sturz. Dann entdeckte er den langsam größer werdenden Blutfleck auf der Tasche seines weißen Uniformhemds.
»Oh, Mann ...«, sagte er.
Die Männerstimme rief wieder: »Heh, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
»O Jesus, o mein Gott, o Jesus Gott«, wimmerte Baily, der ansonsten kein religiöser Mann war. Er versuchte erneut, sich hoch zu stemmen, und merkte, dass seine Hand schlüpfrig von Blut war, und fing an zu schluchzen. »O Jesus ...« Er schaute die Rampe hoch, sah einen Mann mit einer Aktentasche, der eilig auf ihn zukam und zu ihm herunterschaute. Eine Frau kam hinter ihm her, allerdings mit sichtlichem Widerstreben.
»Helfen Sie mir«, flehte Baily. »Helfen Sie mir, man hat auf mich geschossen ...«
Sloan kam in Lucas Davenports Büro gestürzt. »Man hat auf Baily Dobbs geschossen« – er sah auf seine Uhr – »vor zwölf Minuten.«
Lucas war gerade dabei, verdrossen in einem sechshundert Seiten dicken Bericht zu lesen, auf dessen blauem Einband die Aufschrift prangte: Sonderausschuss der Stadtverwaltung Mineapolis zur Thematik »Kulturelle Vielfalt, alternative Lebensstile und andere Normabweichungen bei den Angehörigen der Stadtpolizei Minneapolis«. Eine Voruntersuchung zu den divergierenden Modalitäten (Zusammenfassung für Leitende Angestellte). Die Aufschrift war mit einem fluoreszierenden gelben Markierstift hervorgehoben. Lucas war auf Seite sieben angekommen.
Er schaute von seiner Lektüre auf und fragte ungläubig: »Unser Baily Dobbs?«
»Wie viele Baily Dobbs haben wir im Department?«, konterte Sloan.
Lucas stand auf und griff nach seinem blauen Seidenjackett, das an einem Garderobenständer der städtischen Standardbüroausstattung hing. »Ist er etwa tot?«
»Nein.«
»Ein Unfall? Hat sich versehentlich ein Schuss gelöst?«
Sloan schüttelte den Kopf. Er war ein dünner Mann mit scharf geschnittenem Gesicht, farblich in Schattierungen von Braun bis Gelbbraun gekleidet. Detective bei der Mordkommission, der beste Verhörspezialist im Department – und ein alter Freund. »Sieht aus, als ob er in eine Schießerei geraten wäre, drüben im Parkhaus in der Sixth Street«, erklärte er. »Der Schütze hat eine Frau getötet, dann auf Baily geschossen. Da Rose Marie und Lester nicht in der Stadt sind und Thorn nicht aufzutreiben ist, solltest du deinen Arsch zu Baily ins Krankenhaus in Bewegung setzen.«
Lucas grunzte, zog seine Jacke an. Rose Marie Roux war die Polizeichefin der Stadt, Lester, Thorn und Lucas ihre Stellvertreter. »Irgendwelche Erkenntnisse über den Schützen?«
»Keine präzisen. Baily sagte, es sei eine Frau gewesen. Sie hat, wie gesagt, eine andere Frau erschossen, und Baily hat zwei Schüsse in die rechte Titte abgekriegt.«
»Der letzte verdammte Cop, bei dem ich so was erwartet hätte.«
Lucas war ein großer, schlanker, aber keinesfalls magerer Mann, mit breiten Schultern und sonnengebräuntem Gesicht. Eine dünne Narbe zog sich wie ein weißer Faden durch die Sonnenbräune von der rechten Augenbraue die Wange hinunter. Eine andere Narbe verlief quer über seinen Hals, über der Luftröhre, direkt oberhalb des V-Ausschnitts seines blauen Golfhemdes. Er nahm eine .45er in einem Holster mit Laschenverschluss aus der Schreibtischschublade und hakte es unter der Jacke in die Vorrichtung im Hosenbund ein. Er tat es unbewusst, etwa so, wie ein anderer Mann seine Brieftasche in die Gesäßtasche steckt. »Wie schlimm steht’s um ihn?«
»Er muss operiert werden«, antwortete Sloan. »Swanson ist bei ihm, aber das ist auch schon alles, was ich weiß.«
»Also dann, geh’n wir«, sagte Lucas. »Weiß man, was Dobbs in diesem Treppenhaus zu suchen hatte?«
»Seine Mitstreiter im Büro sagen, er hätte sich offiziell zur County-Verwaltung abgemeldet, aber wahrscheinlich wollte er sich in die Cafeteria des Hennepin-Krankenhauses davonschleichen, um einen Cheeseburger zu essen, Kaffee zu trinken und die Zeitung zu lesen.«
»Das ist der Baily, den wir alle kennen und lieben«, sagte Lucas.
Die Notaufnahme lag fünf Minuten zu Fuß vom Rathaus entfernt. Es war auf einen Cop geschossen worden, er war schwer verletzt, aber das Leben ging weiter. Auf den Bürgersteigen drängten sich Fußgänger, die Straßen waren von Autos verstopft, und Sloan wurde in seinem Eifer, schnell zum Krankenhaus zu kommen, an einer Kreuzung beinahe von einem Auto angefahren – Lucas musste ihn am Arm packen und zurückreißen. »Du bist zu hässlich, um als Kühlerfigur zu dienen«, grunzte Lucas.
In der Notaufnahme war es seltsam ruhig, was Lucas auffiel. Normalerweise eilten hier mindestens dreißig Leute durcheinander, wenn ein Cop bei einer Schießerei verletzt worden war, egal, wer dieser Cop auch war. Jetzt aber standen nur drei andere Cops, zwei Krankenschwestern und ein Arzt in dem nach medizinischem Alkohol riechenden Empfangsbereich herum, und keiner schien sich zu irgendwelchen Aktivitäten gedrängt zu fühlen.
»Ruhig hier.« Sloan schien Lucas’ Gedanken zu erraten.
»Die Sache hat sich noch nicht rumgesprochen«, sagte Lucas. Zwei der Cops waren in Uniform. Einer von ihnen sprach in ein Telefon, während der andere, ein Sergeant, ihm offensichtlich ins Ohr flüsterte, was er sagen sollte. Swanson, ein sanftgesichtiger, übergewichtiger Detective der Mordkommission im grauen Anzug, lehnte am Empfangsschalter, hatte sein Notizbuch vor sich auf die Wasser abweisende Platte gelegt und sprach mit einer Krankenschwester. Als er Lucas und Sloan kommen sah, hob er zur Begrüßung die Hand.
»Wo ist Baily?«, fragte Lucas.
»Sie bringen ihn gerade in den OP«, antwortete Swanson. »Sie haben ihm schon ein Betäubungsmittel gegeben, damit sie ihm diesen Scheißbeatmungsschlauch in den Hals schieben können. Der Chirurg schrubbt sich gerade die Hände da hinten im Vorraum zum OP, wenn du mit ihm reden willst.«
»Hat schon jemand Bailys Frau verständigt?«
»Wir sind noch auf der Suche nach dem Pfarrer«, antwortete Swanson. »Er ist bei irgend ’ner Kirchensache im Norden, ’nem Basar oder so was. Dick da drüben telefoniert hinter ihm her.« Er nickte zu dem Cop mit dem Telefon hinüber. »Kriegt ihn sicher in den nächsten Minuten an die Strippe.«
Lucas wandte sich an Sloan. »Lass den Pfarrer schnellstens herholen, schick einen Streifenwagen hin, mit Blaulicht und Sirene.«
Sloan nickte und ging zu dem Cop mit dem Telefon. Lucas sah Swanson wieder an. »Wie sieht’s am Tatort aus?«
»Gottverdammte Sache. Die Frau ist regelrecht hingerichtet worden.«
»Hingerichtet?«
»Mindestens vier oder fünf Schüsse aus einer kleinkalibrigen Pistole in den Schädel, aus nächster Entfernung; man sieht die Schmauchspuren an der Schläfe. Kein Mensch hat was gehört, also Schalldämpfer. In diesem Treppenhaus gibt’s bei jedem Geräusch ein irres Echo, es hallt von den Betonwänden zurück, aber Baily sagt, er kann sich nicht erinnern, die Schüsse gehört zu haben. Er hat den Täter gesehen, kann sich aber nur erinnern, dass es eine Frau war und dass sie rote Haare hatte. Sonst nichts. Kein ungefähres Alter oder Gewicht, nichts. Wir gehen wegen der roten Haare davon aus, dass es sich bei der Täterin um eine Weiße handelt, aber, verdammte Scheiße, im Stadtzentrum laufen jeden Tag wahrscheinlich fünftausend Rothaarige rum, echte und falsche.«
»Wer bearbeitet den Fall?«
»Sherrill und Black. Ich hab den Notruf mitbekommen und bin rübergerannt, hab einen kurzen Blick auf die tote Frau geworfen und bin dann mit Baily im Krankenwagen hergefahren.«
»Die Leiche liegt also noch dort drüben?«
Swanson nickte. »Ja. Sie war mausetot. Wir haben nicht eine Sekunde überlegt, sie noch ins Krankenhaus zu schaffen.«
»Okay ... Du sagst, der Doc schrubbt sich da hinten noch die Hände?«
»Ja. Dan Wong, unten am Ende des Flurs. Übrigens – Baily behauptet, er hätte nur einen Schuss abgekriegt, aber der Doc sagt, er hätte zwei Kugeln in der Brust.«
»So viel zur Verlässlichkeit von Augenzeugen«, knurrte Lucas.
»Ja. Aber es bedeutet, dass dieses Killerpüppchen schnell und zielsicher ist. Die Einschüsse liegen kaum einen Zentimeter auseinander. Aber sie hat das Herz nicht getroffen.«
»Falls sie darauf gezielt hat. Wenn es ein Zweiundzwanziger mit geringer Durchschlagskraft war ...«
»Ja, so sieht’s aus.«
»... könnte sie absichtlich neben das Brustbein gezielt haben.«
Swanson schüttelte den Kopf. »So gut schießt niemand.«
»Wollen wir’s hoffen«, sagte Lucas.
Lucas schob sich an einer Schwester vorbei, die einen halbherzigen Versuch machte, ihn aufzuhalten. Dr. Wong hatte die Arme bis zu den Ellbogen in einem Becken mit grüner Seife stecken. Er drehte sich zu Lucas um und sagte: »Oje, die Cops ...«
»Wie schlimm sind Bailys Verletzungen?« fragte Lucas.
»Nicht allzu schlimm«, sagte Wong und fing an, seine Fingernägel zu bearbeiten. »Er wird eine Weile Schmerzen haben, aber ich habe schon verdammt viel schlimmere Fälle gehabt. Zwei Kugeln – auf den Röntgenbildern sehen sie ziemlich deformiert aus, sind also wahrscheinlich Hohlladungsgeschosse. Sie drangen dicht neben der rechten Brustwarze ein, und blieben unter dem rechten Schulterblatt stecken. Zwei kleine Einschusslöcher, nur geringe Blutungen, obwohl sich bei seinem Körperfett nur schwer sagen lässt, wie’s innen aussieht. Sein Blutdruck ist gut. Scheint ein gottverdammter Gangster mit einer beschissenen Zweiundzwanziger gewesen zu sein.«
»Er wird also überleben?« Lucas spürte, wie seine Anspannung nachließ.
»Ja, es sei denn, er kriegt eine Herzattacke, oder einen Schlaganfall«, anwortete Wong. »Er hat zu hohes Übergewicht, und er war in Panik, als sie ihn reingebracht haben. Die Operation ist kein Problem, die kann ich mit den Zehen ausführen.«
»Was soll ich der Presse sagen? Wong macht die Operation mit den Zehen?«
Wong zuckte die Schultern und schüttelte die Seifenbrühe von den Händen. »Sagen Sie doch: ›Er wird gerade operiert, sein Zustand ist stabil, und er wird überleben, sofern sich nicht noch Komplikationen einstellen‹.«
»Sie werden nachher mit den Presseleuten sprechen?«
»Ich habe um zwei Uhr eine Einladung zum Tee in Wayazata«, sagte Wong. Er trat vom Waschbecken zurück.
»Könnte doch aber sein, dass Sie absagen müssen, oder?« fragte Lucas.
»Quatsch. Ich bekomme nicht oft solche nette Einladungen.«
»Danny ...«
»Okay, ich rede ein paar Minuten mit den Leuten«, knurrte Wong. »So, und jetzt bewegen Sie Ihren bazillenverseuchten Arsch hier raus, und ich mache mich an die Arbeit.«
Randall Thorn, der neue Deputy Chief für den Einsatz der Verkehrspolizei, erschien zehn Minuten später. Inzwischen war die Zahl der Cops im Empfangsraum auf fünfzehn angewachsen – die in solchen Fällen übliche Menschenmenge begann, sich zu versammeln. »Ich war kurz vor dem verdammten Flughafen«, sagte Thorn zu Lucas. Seine Uniformjacke wies Schweißringe unter den Achseln auf. »Wie sieht’s aus?«
Lucas erklärte ihm den Stand der Dinge, dann kam Sloan zu ihnen und sagte: »Der Pfarrer ist zu Bailys Haus unterwegs. Er wird Bailys Frau in den nächsten fünf Minuten unterrichten.«
Lucas nickte, wandte sich dann wieder an Thorn. »Können Sie die Stellung hier halten? Ich bin hergerannt, weil Rose Marie nicht da war und ich hörte, dass auch Sie und Lester unterwegs sind. Baily gehört ja irgendwie zu Ihren Leuten.«
Thorn nickte. »Mach ich. Sie gehen rüber zum Tatort?«
»Ja, für ein paar Minuten. Ich möchte mir ein Bild machen.«
Thorn nickte wieder und sagte dann: »Wissen Sie, welches Bild ich mir nicht machen kann? Dass auf Baily Dobbs geschossen wird. Er ist der letzte verdammte ...«
»... Cop, bei dem ich so was erwartet hätte«, ergänzte Lucas für ihn.
Wenn es in der Notaufnahme zunächst unnatürlich ruhig gewesen war, sah es im Parkhaus in der Sixth Street aus wie bei der Jahresversammlung des Verbandes der Strafverfolgungsbehörden: ein Dutzend Detectives der Mordkommission sowie uniformierte Cops, Personal des Leichenbeschauers, ein stellvertretender Bürgermeister, der Manager des Parkhauses und zwei mögliche Augenzeugen standen vor den Aufzügen des unteren Parkdecks und im Treppenhaus.
Lucas nickte dem Cop zu, der die Parketage absperrte, dann gingen Sloan und er ins Treppenhaus. Marcy Sherrill und Tom Black sahen sich gerade den Inhalt der Handtasche des Opfers an. Die Leiche selbst lag auf dem Treppenabsatz vor ihren Füßen. Den Rock hatte man über die üppigen Oberschenkel und die Unterhose hochgezogen. Eine Hand lag seltsam verdreht neben dem Gesicht – sie hatte sich beim Sturz wahrscheinlich den Arm gebrochen, dachte Lucas –, und die erstarrten Augen waren halb geöffnet. Eine Lache aus geronnenem Blut hatte sich unter der immer noch untadeligen Frisur angesammelt. Das Gesicht kam Lucas irgendwie bekannt vor; die Frau sah aus, als sei sie ein netter Mensch gewesen.
Sherrill drehte sich um, sah Lucas und sagte, ein wenig scheu: »Hey ...«
»Hey«, reagierte Lucas und nickte ihr zu. Sherrill und er hatten gerade eine sechs Wochen andauernde Romanze beendet; oder, wie Sherrill es ausdrückte, eine Vierzig-Tage-Vierzig-Nächte-Sex-und-Disputier-Affäre. Sie befanden sich jetzt in der ein wenig unangenehmen Situation, dass sie sich nicht mehr privat trafen, aber weiterhin dienstlich zusammenzuarbeiten hatten. »Sieht scheußlich aus«, fügte Lucas hinzu. Im Treppenhaus wurde der Geruch nach feuchtem Beton von dem Geruch des Blutes und der Darmgase, die aus der Leiche strömten, überlagert.
Sherrill sah auf die Leiche hinunter und sagte: »Das wird ein ungewöhnlicher Fall, glaube ich.«
»Swanson hat gesagt, sie wäre regelrecht hingerichtet worden«, sagte Sloan.
»Das ist sie, und wie«, bestätigte Black. Sie alle schauten jetzt auf die Leiche hinunter, um ihre Füße versammelt wie ein Gutachterteam. »Ich habe sieben Einschusslöcher gezählt, aber keine Austrittswunden. Man braucht kein forensischer Wissenschaftler zu sein, um zu erkennen, dass die Schüsse aus nächster Nähe abgegeben wurden – ungefähr aus zwei bis drei Zentimetern Entfernung.«
»Wer ist sie?«, fragte Lucas.
»Barbara Paine Allen. Sie hat eine Im-Notfall-Benachrichtigen-Karte dabei, sieht so aus, als ob ihr Mann Anwalt wäre.«
»Ich kenne das Gesicht von irgendwoher, und auch der Name kommt mir bekannt vor«, sagte Lucas. »Ich glaube, sie ist jemand.«
Sherrill und Black nickten, und Sherrill murmelte: »Großartig ...«
Lucas ging für einen Moment neben der Leiche in die Hocke und sah sich die Schusswunden im Kopf an. Die Eintrittslöcher waren klein und glatt, als ob sie mit einem Metallstift eingestanzt worden wären. Zwei Einschüsse befanden sich am Hinterkopf, eine Serie von fünf in der Schläfe. Ihr Herz hatte nach dem Sturz noch einige Sekunden geschlagen; ein dünner Blutstrom, inzwischen geronnen, war aus jedem der Löcher ausgetreten. Diese sieben Blutrinnsale verliefen sauber voneinander getrennt, was bedeutete, dass die Frau sich nach dem Sturz auf den Treppenabsatz nicht mehr bewegt hatte. Sehr professionell und zielbewusst ausgeführt, dachte Lucas. Er stand auf und fragte Sherrill und Black: »Gibt es Tatzeugen? Außer Baily?«
»Baily sagte, der Mord sei von einer rothaarigen Frau begangen worden, und wir haben zwei Zeugen, die aussagen, sie hätten nach der Schießerei eine rothaarige Frau vom Tatort weggehen sehen. Keine gute Beschreibung. Trug eine Sonnenbrille, sagen die Zeugen, und sie hätte sich beim Weggehen die Nase geputzt.«
»Um ihr Gesicht zu verbergen«, meinte Lucas.
»Ich kann diese ganze Scheiße nicht glauben«, sagte Sloan und schaute auf die Leiche von Barbara Allen hinunter. »Bei uns gibt’s doch keine solchen Morde ...«
»Nein, nicht in Minneapolis«, bestätigte Sherrill.
»Nicht durch Profikiller«, schloss sich Black an.
Lucas kratzte sich am Kinn und sagte: »Aber das war ein Profi. Ich frage mich nur, warum man die Frau getötet hat.«
»Hängst du dich in den Fall rein?«, fragte Sherrill. »Könnte eine interessante Sache werden.«
»Ich habe nicht die Zeit dazu«, antwortete Lucas. »Ich habe die Gleichberechtigungskommission am Hals.«
»Wenn wir den Killer finden, könnten wir ihn vielleicht anheuern, die Kommission nach und nach umzulegen.«
»Diese Leute sind nicht totzukriegen«, sagte Lucas düster. »Sie kommen direkt aus den tiefsten Tiefen der Hölle.«
»Wir halten dich jedenfalls auf dem Laufenden«, versprach Sherrill.
»Ja, macht das.« Lucas schüttelte den Kopf und sah ein letztes Mal auf die Leiche hinunter. Und er sagte noch einmal: »Ich frage mich, warum ...«
Kapitel 3
Barbara Allen wurde auf den Tag genau einen Monat nach der Auftragserteilung durch Carmel Loan getötet. Als die Nachricht in Carmels Anwaltsbüro die Runde machte, sagte sie sich sofort, dass sie nichts damit zu tun hatte. Sie hatte das Arrangement schon vor so langer Zeit getroffen, dass es nicht mehr zählte ...
Carmel erfuhr von dem Mord, als sie gerade die Aussage eines Mannes las, der zur späten Nachtzeit noch seinen Hund ausgeführt und gesehen hatte, wie Rockwell Miller – Carmels Klient – mit einem Fünfgallonenkanister Benzin durch die Hintertür in sein bankrottes Restaurant geschlichen war. Der Staatsanwalt würde mit Nachdruck darauf hinweisen, dass ein Kanister des beschriebenen Typs von den Spezialisten der Feuerpolizei unter den Trümmern des Restaurants im Keller gefunden worden war. Die Hitzeentwicklung war so heftig gewesen, dass die Feuerlöscher in der Küche geschmolzen waren.
Carmel suchte nach etwas, das sie einen Kratzer nannte. Wenn sie die Fingernägel an irgendeinen Aspekt einer gegnerischen Zeugenaussage oder an irgendeinen Schwachpunkt bei dem Zeugen selbst legen konnte, war sie auch in der Lage, daran zu kratzen, die Zeugenaussage eventuell in Stücke zu reißen und die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage zu stellen. Sie überlegte gerade, ob sie bei dem Hundebesitzer einen Kratzer anbringen könnte. Er war geschieden und zweimal wegen familieninterner Körperverletzung vorbestraft, was jede Zeugenaussage ins Wanken bringen kann, wenn genug Frauen unter den Geschworenen sind. Okay, sie konnte damit die Frauen auf ihre Seite bringen, aber die Schwierigkeit lag darin, die Vorstrafen des Zeugen den Geschworenen überhaupt gerichtsverwertbar zur Kenntnis geben zu können, denn der normale Richter bewertete sie fälschlicherweise meistens als irrelevant.
Der Hundebesitzer wohnte in der Nähe des Restaurants und kannte ihren Klienten vom Sehen. Waren er und seine Exfrau mal zum Essen in dem Restaurant gewesen? Hatten die beiden in der Phase der Trennung vielleicht einmal eine Auseinandersetzung in dem Lokal gehabt? Konnte es sein, dass der Hundebesitzer negative Gefühle gegen das Restaurant oder seinen Besitzer entwickelt hatte, eventuell auch nur unterbewusst?
Es war alles ziemlicher Blödsinn, aber wenn man es zuließ, dass sie zwölf kreuzbraven amerikanischen Frauen die Frage stellte: »Können Sie der Zeugenaussage eines überführten, brutalen Frauenverprüglers glauben?«, wäre das ein echter Kratzer.
Sie wollte gerade die Nummer ihres Klienten wählen, als ihre Sekretärin unaufgefordert den Kopf durch die Tür steckte und fragte: »Haben Sie das von Hale Allens Frau schon gehört?«
Carmels Herz hämmerte in ihrer Kehle, und sie legte schnell den Hörer wieder auf. »Nein, was denn?«, fragte sie. Sie gehörte zu den drei erfolgreichsten Strafverteidigern der Doppelstadt Minneapolis/St. Paul, und ihr Gesicht zeigte die Emotion einer Frau, die man nach der Außentemperatur gefragt hat.
»Sie ist getötet worden. Ermordet.« Die Sekretärin schaffte es nicht ganz, die Wonne der Übermittlung einer Gruselnachricht aus ihrer Stimme herauszuhalten. »In einem Parkhaus im Zentrum. Die Polizei sagt, der Mord sei durch einen Profikiller begangen worden. Wie ein Mob-Hit, sagen sie.«
Carmel senkte die Stimme, und gab sich Mühe, ein natürliches Interesse anklingen zu lassen. »Barbara Allen?«
Die Sekretärin trat ins Zimmer, drückte die Tür hinter sich ins Schloss. »Jane Roberts sagt, die Cops hätten Hale verständigt und wären mit ihm zum Krankenhaus gerast, aber es war zu spät. Sie war bereits tot.«
»O mein Gott, die arme Frau ...« Carmel legte die Hand auf die Kehle und dachte: Ich habe das nicht getan. Und sie dachte auch: Ich habe hier im Büro gesessen, das können mehrere Leute bezeugen.
»Wir haben schon überlegt, ob wir eine Sammlung machen und ein paar Blumen hinschicken sollen«, sagte die Sekretärin.
»Tun Sie das, eine gute Idee«, erwiderte Carmel. Sie kramte in ihrer Handtasche auf dem Schreibtisch. »Ich mache den Anfang mit einem Hunderter.« Sie strich den Schein auf der Schreibtischplatte glatt. »Halten Sie das für ausreichend?«
Später an diesem Nachmittag saß Carmel mit einem Gin-Tonic in der Hand auf dem Balkon ihres Appartements und machte sich Sorgen: Sie nagte an ihrem Daumennagel, eine schlechte Angewohnheit seit der Grundschule, knabberte ihn ab bis aufs rohe Fleisch. Zum ersten Mal, seit sie sich in diese irre Liebe zu Hale Allen hineingesteigert hatte, schaffte sie es, sich gedanklich von allem zu lösen und zurückzuschauen.
Sie hatte ihren Klienten oft gesagt, vor allem denen, die mehr oder weniger Berufsverbrecher waren, dass man niemals in der Lage war, alle Möglichkeiten auszuschließen, die die Aufdeckung eines Verbrechens zur Folge haben konnten. Wie intensiv man sich auch absicherte, es blieben immer Unabwägbarkeiten übrig, gegen die kein Kraut gewachsen war.
Carmel hatte durchaus die Möglichkeit erwogen, den Mord an Barbara Allen selbst zu begehen. Sie hatte bisher noch keinem Menschen körperlichen Schaden zugefügt, aber der Gedanke an einen Mord hatte sie auch nicht besonders beunruhigt. Ganz klar, sie würde sich nichts daraus machen, den Abzug einer Schusswaffe zu ziehen ... Aber der Teufel steckte im Detail, und es gab zu viele Details. Wie konnte sie an eine Waffe kommen? Wenn sie eine Pistole kaufte, würde sie auf ihren Namen registriert sein. Sie konnte sie einsetzen und dann verschwinden lassen, aber wenn die Cops kamen und danach fragten, würde die Antwort »Der Hund hat sie gefressen« ganz sicher unzulänglich sein.
Sie konnte eine Waffe stehlen, aber man könnte sie dabei erwischen oder ihr den Diebstahl später nachweisen. Und sie würde sie bei einem von zwei oder drei Leuten stehlen müssen, von denen sie wusste, dass sie eine Waffe besaßen, und das brachte sie unweigerlich in den Kreis der Verdächtigen. Sie konnte versuchen, eine Waffe unter Vorlage eines falschen Personalausweises – schon das allein ein Verbrechen – zu kaufen, aber es war klar, dass der Verkäufer eines Waffengeschäftes sie nachträglich identifizieren könnte, spätestens dann, wenn die Cops ihm ein Foto von ihr vorlegten.
Dann war da der Mord selbst. Sie könnte ihn begehen. Sie konnte alles tun, wozu sie sich einmal entschlossen hatte. Aber, wie sie ihre Klienten warnte, selbst ein noch so gut geplantes Verbrechen konnte durch kleinste Unachtsamkeiten, unglückliche Entwicklungen oder banale Zufälle ruiniert werden. Im Staat Minnesota bedeuteten kleine Unachtsamkeiten, unglückliche Entwicklungen oder banale Zufälle bei einem Mord dreißig Jahre in einem keinesfalls luxuriösen Raum von der Größe einer Badewanne.
Sie war schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass das geringste Risiko darin bestand, einen Profikiller anzuheuern. Sie hatte eine ganze Menge Bargeld, dessen Herkunft nicht zurückverfolgt werden konnte, in ihrem Bankschließfach gehortet, und sie hatte Rolando D’Aquila als Verbindungsmann zum Killer. Und sie hatte einen Sicherheitsfaktor. Weder der Verbindungsmann noch der Killer durften den Cops etwas von ihr als Auftraggeberin sagen, denn sie würden sich damit ebenso schuldig des Mordes ersten Grades machen wie Carmel selbst. Und auch wenn die Killerin von den Cops irgendwie aufgespürt werden sollte, war ihre Verteidigung vor einem Gericht äußerst leicht zu gestalten. Als kompetenter Profi hatte sie bestimmt keine Spuren hinterlassen, die sie als Täterin entlarven konnten, und es bestanden ja keinerlei frühere Verbindungen zu dem Opfer.