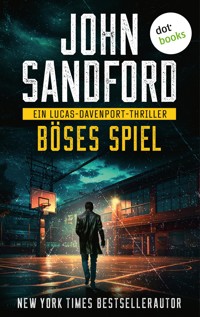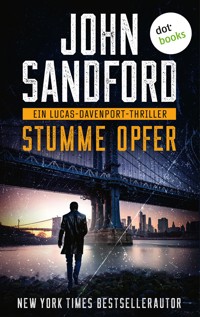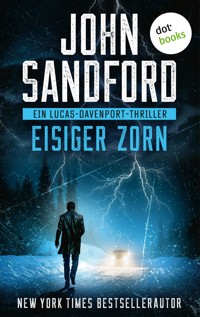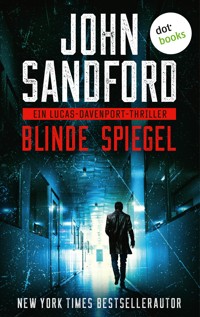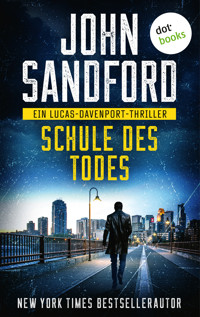
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
Dein Schrei ist Musik in seinen Ohren: Der rasante Thriller »Schule des Todes« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Töte nach diesen Regeln und du wirst niemals gefasst werden … Der Serienkiller, der die Twin Cities terrorisiert, ist nicht nur verrückt – sondern auch extrem intelligent. Er tötet aus reiner Mordlust und genießt es, die Polizei in die Irre zu führen. Doch als der abgebrühte Lieutenant Lucas Davenport mit den Ermittlungen beauftragt wird, hat der Psychopath plötzlich einen Gegner, der seiner Genialität würdig ist: Der Polizist erkennt in den eisernen Regeln der »Schule des Todes«, nach denen der Killer vorgeht, ein perfides Spiel … und er ist festentschlossen, seinen Gegenspieler mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen! »Ein bösartiger und temporeicher Thriller. Ein großes Buch, schockierend und packend bis zur letzten Seite!« Stephen King Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Schule des Todes« von John Sandford – der spektakuläre erste Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Michael Connelly und David Baldacci. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Töte nach diesen Regeln und du wirst niemals gefasst werden … Der Serienkiller, der die Twin Cities terrorisiert, ist nicht nur verrückt – sondern auch extrem intelligent. Er tötet aus reiner Mordlust und genießt es, die Polizei in die Irre zu führen. Doch als der abgebrühte Lieutenant Lucas Davenport mit den Ermittlungen beauftragt wird, hat der Psychopath plötzlich einen Gegner, der seiner Genialität würdig ist: Der Polizist erkennt in den eisernen Regeln der »Schule des Todes«, nach denen der Killer vorgeht, ein perfides Spiel … und er ist fest entschlossen, seinen Gegenspieler mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen!
»Ein bösartiger und temporeicher Thriller. Ein großes Buch, schockierend und packend bis zur letzten Seite!« Stephen King
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: https://www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: https://www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: https://www.instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »Rules of Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 unter dem Titel »Die Schule des Todes« bei Goldmann
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1989 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1990 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/ana, Melissa Woolf
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-926-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Schule des Todes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Schule des Todes
Ein Lucas-Davenport-Thriller 1
Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner
dotbooks.
Kapitel 1
Die Leuchtreklame auf dem Nachbardach warf ihren flackernden blauen Lichtschein durch die Atelierfenster. Das Licht spiegelte sich in Glas und Edelstahl: einer leeren Kristall vase in Blütenform, an deren Rand sich Staub angesetzt hatte, einem Bleistiftspitzer, einem Mikrowellenherd, Erdnußbuttergläsern, in denen Buntstifte, Pinsel und Pastellkreide steckten. Daneben ein Aschenbecher voller Centstücke und Büroklammern. Gläser mit Acrylfarbe. Messer. Eine Stereoanlage war undeutlich als Ansammlung rechteckiger Silhouetten sichtbar. Eine Digitaluhr zerhackte die Stille in rote Minuten.
Der Werwolf lauerte im Dunkeln.
Er konnte hören, wie er atmete. Spürte, wie Schweiß aus den Hautporen unter seinen Achseln trat. Schmeckte, was er abends zu sich genommen hatte. Spürte, wie die Stoppeln seiner rasierten Schamhaare stachen. Witterte den Duft der Auserwählten.
Nie fühlte er sich so lebendig wie in den letzten Augenblicken einer langen Pirsch. Manche Leute – Leute wie sein Vater – mußten jede Minute jeder Stunde von diesem Gefühl erfüllt sein: sie lebten auf einer höheren Existenzebene.
Der Werwolf beobachtete die Straße. Die Auserwählte war eine Malerin. Sie hatte glatte hellbraune Haut und ausdrucksvolle braune Augen, kleine Brüste und eine schlanke Taille. Sie lebte illegal hier im Lagerhaus, duschte spät nachts im Umkleideraum am Ende des Korridors und bereitete sich heimlich Mikrowellengerichte zu, sobald der Hausmeister heimgefahren war. Sie schlief, in Lein- und Terpentinöldüfte gehüllt, in einem winzigen Lagerraum auf einem schmalen Klappbett. Jetzt war sie unterwegs, um Mikrowellen-Fertiggerichte einzukaufen. Der Mikrowellenscheiß bringt sie um, wenn du’s nicht tust, dachte der Werwolf. Wahrscheinlich tust du ihr sogar einen Gefallen damit. Er grinste.
Die Malerin würde sein drittes Mordopfer in der Großstadt und das fünfte seines Lebens sein.
Sein erstes Opfer war eine Rancherstochter, die eine abgelegene Koppel verließ und auf die bewaldeten Kalksteinhügel von East Texas zuritt. Sie trug Jeans, eine rot-weiß karierte Bluse und Cowboystiefel. Sie saß hoch in einem Westernsattel und ritt mehr mit Kopf und Knien als mit den Zügeln in ihren Händen. Sie kam geradewegs auf ihn zu, und ihr langer blonder Zopf hüpfte auf ihrem Rücken auf und ab.
Der Werwolf hatte ein Gewehr: ein Remington Model 700 ADL in Kaliber 27 Winchester. Er stützte seinen Arm auf einen vermodernden Baumstamm und drückte ab, sobald sie auf vierzig Meter herangekommen war. Das Geschoß durchschlug ihr Brustbein und warf sie aus dem Sattel.
Dieser erste Mord war anders gewesen. Sie war nicht auserwählt worden; sie hatte ihre Ermordung selbst provoziert. Drei Jahre zuvor hatte sie in Hörweite des Werwolfs gesagt, er habe Lippen wie rote Würmer. Wie die sich windenden roten Würmer unter den Felsen am Fluß. Das hatte sie in der Eingangshalle ihrer High-School, von Freundinnen umringt, behauptet. Einige von ihnen hatten sich nach dem Werwolf umgesehen, der fünf Meter von ihnen entfernt stand – wie immer allein – und seine Bücher ins oberste Fach seines Schranks räumte.
Er hatte sich nicht anmerken lassen, daß er ihre Beleidigung gehört hatte. Schon seit frühester Kindheit verstand er es sehr gut, seine Gefühle zu verbergen, obwohl sie der Rancherstochter vermutlich gleichgültig gewesen wären. Gesellschaftlich war der Werwolf ein Nichts.
Aber sie hatte für diese Kränkung büßen müssen. Er bewahrte die Erinnerung an ihre Bemerkung drei Jahre lang in seinem Herzen, denn er wußte, daß seine Zeit kommen würde. Und sie kam. Von einem schnell zerplatzenden Kupfermantelgeschoß, wie Jäger es verwendeten, tödlich getroffen, kippte die Rancherstochter rückwärts vom Pferd.
Der Werwolf trabte leichtfüßig durch die Wälder und über sumpfiges Grasland. An der durch den Sumpf führenden Straße versteckte er sein Gewehr unter einem rostigen eisernen Dränagerohr. Dieses Rohr würde die Waffe tarnen, falls mit einem Metalldetektor nach ihr gesucht wurde. Allerdings rechnete der Werwolf nicht mit einer Suchaktion: Die Jagd auf Rotwild war im Gange, und die Wälder waren voller verrückter Städter, die bis an die Zähne bewaffnet waren und auf alles schossen, was sich bewegte. Der Zeitpunkt und das Waffenversteck waren lange zuvor sorgfältig ausgewählt worden. Schon in seinem zweiten Collegejahr war der Werwolf ein großer Planer.
Er ging zur Beerdigung des Mädchens. Ihr Gesicht war unversehrt, deshalb war sie in einem offenen Sarg aufgebahrt. In seinem dunklen Anzug setzte er sich so nahe wie möglich an den Sarg, starrte in ihr Gesicht und genoß das in ihm aufsteigende Machtgefühl. Er bedauerte nur, daß sie nichts von ihrem bevorstehenden Tod gewußt und diesen Schmerz nicht bis zur Neige ausgekostet hatte; und er bedauerte, daß ihm keine Zeit geblieben war, sich an ihrem Leid zu erfreuen.
Dem zweiten Mord fiel die erste der wirklich Auserwählten zum Opfer, obwohl er diese Tat nachträglich nicht mehr für eine reife Leistung halten konnte. Sie war wohl eher ein ... ein Experiment gewesen? Ja. Bei seinem zweiten Mord vermied er die Unzulänglichkeiten des ersten.
Sie war eine Nutte. Er ermordete sie in den Frühlingsferien seines zweiten Studienjahres, des Krisenjahres, in der Law School. Wie er wußte, war das Bedürfnis nach einer solchen Tat schon lange vorhanden gewesen und durch den intellektuellen Druck des Jurastudiums verstärkt worden. Und in einer kühlen Nacht in Dallas verschaffte er sich mit einem Messer zeitweilige Erleichterung an dem blassen, weißen Leib eines einfachen Mädchens, das aus Mississippi in die Großstadt gekommen war, um dort ihr Glück zu machen.
Der Tod der Rancherstochter wurde als Jagdunfall beklagt. Ihre Eltern trauerten um sie, aber das Leben ging weiter. Zwei Jahre später sah der Werwolf die Mutter der Ermordeten vor einem Konzertsaal lachen.
Die Polizei in Dallas tat die Hinrichtung der Nutte als einen mit der Drogenszene in Verbindung stehenden Straßenmord ab. In ihrer Handtasche fanden die Cops einige Kapseln Speed – und das genügte ihnen. Von ihr war nur der Name bekannt, den sie sich für die Straße zugelegt hatte. Sie kam in ein Armengrab mit diesem Namen, dem falschen Namen, auf der winzigen Eisenplakette, die das Grab bezeichnete. Sie hatte ihren sechzehnten Geburtstag nicht mehr erlebt.
Diese beiden Morde waren befriedigend, aber nicht bis ins letzte durchdacht gewesen. Die Großstadtmorde waren ganz anders. Sie waren detailliert vorbereitet, und die Taktik basierte auf sachkundiger Begutachtung der Ermittlungen in einem Dutzend Mordfälle.
Der Werwolf war intelligent. Er war Mitglied der Anwaltskammer. Er stellte die wichtigsten Regeln auf:
Niemals jemanden ermorden, den du kennst.
Niemals ein Tatmotiv haben.
Niemals nach erkennbarem Schema handeln.
Niemals eine Waffe nach Gebrauch bei sich tragen.
Niemals riskieren, zufällig entdeckt zu werden.
Niemals Beweismaterial zurücklassen.
Es gab noch weitere Regeln. Er betrachtete sie als intellektuelle Herausforderung.
Er war natürlich verrückt. Und das wußte er recht gut.
In der besten aller Welten wäre er lieber geistig normal gewesen. Seine Geisteskrankheit brachte vielfältigen Streß mit sich. Er hatte jetzt Pillen: schwarze gegen hohen Blutdruck, rötlichbraune gegen Schlafstörungen. Er wäre lieber geistig normal gewesen, aber man spielte mit dem Blatt, das einem das Schicksal gegeben hatte. Das hatte sein Vater gesagt.
Gut, er war also verrückt.
Aber nicht ganz so, wie die Polizei glaubte.
Er fesselte und knebelte die Frauen und vergewaltigte sie.
Die Polizei hielt ihn für einen Sexualverbrecher. Für einen eiskalten Triebtäter. Er ließ sich bei den Morden und den Vergewaltigungen Zeit. Die Cops glaubten, er rede mit seinen Opfern und verhöhne sie. Er benützte Kondome. Mit einem Gleitmittel beschichtete Kondome. Bei der Obduktion hergestellte Scheidenabstriche seiner beiden ersten Großstadtopfer hatten Hinweise auf ein Gleitmittel geliefert. Da die Kondome nie zu finden waren, vermuteten die Cops, daß er sie immer mitnahm.
Psychiater, die zur Erstellung eines psychologischen Profils hinzugezogen wurden, waren der Überzeugung, der Täter habe Angst vor Frauen – möglicherweise, sagten sie, weil er in seiner Kindheit unter der Fuchtel einer dominierenden Mutter stand, die abwechselnd tyrannisch und liebevoll mit sexuellen Untertönen gewesen sei. Vielleicht habe der Täter auch Angst vor Aids, und möglicherweise – sie sprachen unablässig von Möglichkeiten – sei er im Kern seines Wesens homosexuell.
Möglicherweise, sagten sie, tue er etwas mit seinem Samen, den er in den Kondomen mitnahm. Als die Psychiater das andeuteten, sahen die Cops sich fragend an. Etwas tun? Aber was? Zu Sahnehäubchen verarbeiten? Was?
Die Psychiater irrten sich. In allen Punkten.
Er verhöhnte seine Opfer nicht, sondern tröstete sie und half ihnen mitzuwirken. Kondome benützte er nicht so sehr aus Angst, er könnte sich anstecken, sondern um sich vor der Polizei zu schützen. Samen war Beweismaterial, das von Gerichtsmedizinern sorgfältig untersucht und klassifiziert wurde. Der Werwolf kannte einen Fall, in dem eine Frau von einem Stadtstreicher überfallen, vergewaltigt und ermordet worden war. Zwei Männer waren verdächtigt worden – beide hatten sich gegenseitig beschuldigt. Eine Samenuntersuchung hatte entscheidend dazu beigetragen, den Mörder zu überführen.
Der Werwolf hob die Kondome nicht auf. Er tat nichts mit ihnen. Er spülte sie mitsamt ihrem beweiskräftigen Inhalt im WC seiner Opfer hinunter. Und seine Mutter war keine Tyrannin gewesen. Sie war eine kleine, unglückliche, schwarzhaarige Frau, die im Sommer bedruckte Kattunkleider und breitkrempige Strohhüte getragen hatte. Sie war in seinem vorletzten High-School-Jahr gestorben. Er konnte sich kaum noch an ihr Gesicht erinnern, aber als er einmal in Kartons mit Familienandenken gewühlt hatte, war er auf ein von einer Schnur zusammengehaltenes Bündel Briefe, die sie an seinen Vater geschrieben hatte, gestoßen. Ohne recht zu wissen, weshalb, hatte er an den Umschlägen gerochen und war von ihrem zarten Duft, der ihn an seine Mutter erinnerte, überwältigt gewesen: ein schwacher Duft nach Flieder und Heckenrosen.
Aber seine Mutter war unbedeutend gewesen.
Sie hatte nie etwas geleistet. Nichts bewirkt. Nichts getan. Sie war seinem Vater ein Klotz am Bein gewesen. Sein Vater hatte seine faszinierenden Spiele, und sie behinderte ihn dabei. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater sie einmal angebrüllt hatte: Ich arbeite, ich arbeite, und du bleibst gefälligst draußen, wenn ich arbeite! Ich muß mich konzentrieren, und das kann ich nicht, wenn du hier reinkommst und jammerst, jammerst ... Die faszinierenden Spiele in Gerichtsgebäuden und Gefängnissen.
Der Werwolf war nicht homosexuell. Er fühlte sich nur zu Frauen hingezogen. Für einen Mann kam nur diese Sache – die Sache mit Frauen – in Frage. Er begehrte sie, um ihren Tod zu sehen und zu spüren, wie er in diesem transzendenten Augenblick explodierte.
In Augenblicken der Einsicht hatte der Werwolf seine Psyche analysiert und den Ursprung seiner Geisteskrankheit zu ergründen versucht. Dabei war er zu dem Schluß gelangt, sie sei nicht plötzlich aufgetreten, sondern allmählich gewachsen. Er erinnerte sich an die langen einsamen Wochen, die er mit seiner Mutter auf der Ranch verbracht hatte, während sein Vater in Dallas seine Spiele spielte. Dort hatte der Werwolf mit seinem Kleinkalibergewehr Jagd auf Erdhörnchen gemacht. Traf er eines direkt in die Hinterbeine, so daß es von seinem Bau wegrollte, versuchte es keckernd, sich nur noch mit den Vorderpfoten in sein Loch zurückzuschleppen.
Alle übrigen Erdhörnchen aus den benachbarten Höhlen standen dann auf den kleinen Hügeln, die sie beim Höhlenbau aufgeworfen hatten, und sahen zu. Nun konnte er ein zweites anschießen, das weitere Tiere herauslockte, und danach ein drittes, bis die ganze Kolonie ein halbes Dutzend waidwunder Erdhörnchen beobachtete, die sich in ihre Höhlen zurückzuschleppen versuchten.
Nachdem er sechs oder sieben Tiere mit liegendem Anschlag angeschossen hatte, stand er auf, ging zu den Höhlen hinüber und erledigte sie mit seinem Taschenmesser. Manchmal balgte er sie noch lebend ab und schlug sie aus ihrer Haut, während sie zwischen seinen Händen strampelten. Später begann er. ihre Ohren auf eine Schnur zu fädeln, die er im Dachgebälk des Geräteschuppens versteckte. In einem einzigen Sommer hatte er über dreihundert Ohrenpaare aufgefädelt.
Den ersten Orgasmus seines jungen Lebens hatte er, als er am Rande einer Wiese im Heu lag und auf Erdhörnchen schoß. Der lange krampfartige Erguß war wie der Tod selbst. Danach zog er den Reißverschluß seiner Jeans auf, um die Samenflecken auf seiner Unterhose zu betrachten, und sagte laut: »Junge, das hat’s gebracht ... Junge, das hat’s gebracht.« Das wiederholte er mehrmals. und seit diesem Tag packte ihn die Leidenschaft öfter, wenn er auf der Jagd unterwegs war.
Nehmen wir einmal an. dachte er, alles wäre anders gelaufen. Nehmen wir einmal an, ich hätte Spielgefährten gehabt, auch mit Mädchen gespielt, und wir hätten eines Tages in der Scheune Doktor gespielt. Zeig mir deine, dann zeig ich dir meinen ... Hätte das etwas entscheidend beeinflußt? Er wußte es nicht. Als er dann vierzehn war. war es zu spät. Seine Psyche war unheilbar geschädigt.
Etwa eine Meile von ihm entfernt wohnte ein Mädchen, das fünf oder sechs Jahre älter war als er. Die Tochter eines echten Ranchers. Als sie eines Tages auf einem Heuwagen hinter dem von ihrer Mutter gelenkten Traktor an ihm vorbeifuhr, trug sie ein schmuddeliges, schweißnasses T-Shirt, unter dem sich ihre steifen Brustwarzen abzeichneten. Der Werwolf war damals vierzehn; er spürte leidenschaftliche Erregung und sagte laut: »Ich würde sie lieben und umbringen.«
Er war verrückt.
Während seines Jurastudiums las er von Männern, die ihm glichen, und stellte fasziniert fest, daß er Teil einer Gemeinschaft war. Er hielt sie für eine Gemeinschaft von Männern, die verstanden, welche Ekstase? dieser Augenblick des Ergusses und des Todes auslösen konnte.
Aber es ging ihm nicht nur ums Töten. Nicht mehr. Inzwischen hatte sich ein intellektueller Reiz dazugesellt.
Der Werwolf hatte stets eine Vorliebe für Spiele gehabt. Für die Spiele, die sein Vater spielte, für die Spiele, die er allein in seinem Zimmer spielte. Phantasiespiele, Rollenspiele. Er war ein guter Schachspieler. Das High-School-Turnier gewann er drei Jahre hintereinander, obwohl er außerhalb der Turniere nur selten mit jemandem Schach spielte.
Aber es gab bessere Spiele. Zum Beispiel die, die sein Vater spielte. Aber selbst sein Vater war nur ein Ersatz für den wahren Spieler, der als zweiter Mann am Tisch saß: der Angeklagte. Die wahren Spieler waren die Cops und die Angeklagten. Der Werwolf wußte, daß er niemals ein Cop hätte sein können. Aber er konnte trotzdem mitspielen.
Und jetzt, in seinem siebenundzwanzigsten Jahr, erfüllte sich seine Bestimmung. Er spielte mit, und er mordete, und das Glück, das er dabei empfand, brachte seinen ganzen Körper zum Klingen.
Das höchste Spiel. Der höchste Einsatz.
Er wettete um sein Leben, daß sie ihn nicht schnappen würden. Und er gewann die Leben von Frauen – wie Pokerchips. Männer spielten stets um Frauen: das war seine Theorie. Bei den allerbesten Spielen wurde um Frauen gespielt.
Cops hatten natürlich kein Interesse an Spielen. Cops waren notorisch phantasielos.
Um ihnen zu helfen, den Sinn des Spiels zu erfassen, hinterließ er an jedem Tatort eine der von ihm aufgestellten Regeln. Sorgfältig aus einer Tageszeitung aus Minneapolis ausgeschnittene Wörter ergaben einen kurzen Satz, den er auf ein Blatt Notizpapier klebte. Beim ersten Großstadtmord lautete die Botschaft: Niemals jemanden ermorden, den du kennst.
Das würde ihnen schweres Kopfzerbrechen bereiten. Er legte den Zettel auf die Brust seines Opfers, damit außer Zweifel stand, wer ihn hinterlassen hatte. Aus einem fast scherzhaften nachträglichen Einfall heraus unterzeichnete er die Botschaft mit Der Werwolf.
Auf dem zweiten Zettel stand: Niemals ein Tatmotiv haben. Nun mußten sie wissen, daß sie’s mit einem zielbewußten Mann zu tun hatten.
Obwohl die Cops bestimmt Blut und Wasser schwitzten, gelang es ihnen, die Story aus den Medien herauszuhalten. Aber der Werwolf sehnte sich nach Presseruhm. Sehnte sich danach, beobachten zu können, wie seine Anwaltskollegen den Gang der Ermittlungen in der Tagespresse verfolgten. Und zu wissen, daß sie mit ihm über ihn redeten, ohne zu ahnen, daß er der Täter war.
Der Gedanke daran war erregend. Mit diesem dritten Mord würde er’s schaffen. Die Cops konnten die Story nicht für immer geheimhalten. Polizeipräsidien hatten normalerweise so viele undichte Stellen wie ein Sieb. Er war überrascht, daß die Geheimhaltung so lange geklappt hatte.
Bei seinem dritten Opfer würde die Nachricht lauten: Niemals nach erkennbarem Schema handeln. Er hatte sie auf einem Tischwebstuhl zurückgelassen.
Selbstverständlich lag in dieser Handlungsweise ein Widerspruch. Als Intellektueller hatte der Werwolf viel darüber nachgedacht. Er war geradezu fanatisch sorgfältig bemüht, keine Spuren zu hinterlassen – und trotzdem hinterließ er absichtlich welche. Aus seiner Wortwahl konnten die Polizei und ihre Psychiater bestimmte Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit ziehen. Aus der Tatsache, daß er überhaupt Regeln aufstellte. Aus seinem Spieltrieb.
Aber das ließ sich nicht ändern.
Wäre es nur ums Morden gegangen, hätte er sich zugetraut, selbst als Massenmörder nicht geschnappt zu werden. Dallas hatte ihm gezeigt, wie leicht das war. Er konnte Dutzende ermorden. Hunderte. Nach Los Angeles fliegen, in einem Kaufhaus ein Messer kaufen, eine Nutte erstechen und am selben Abend heimfliegen. Jede Woche in einer anderen Stadt. Sie würden ihn- niemals fassen. Sie würden nicht einmal wissen, daß ein Serientäter am Werk war.
Diese Vorstellung war reizvoll, aber letztlich intellektuell steril. Er wollte sich weiterentwickeln. Er wollte den Wettstreit. Er brauchte ihn.
Der Werwolf schüttelte im Dunkel den Kopf und sah aus dem hohen Fenster. Auf der regennassen Straße zogen Autos Wasserfontänen hinter sich her. Von der 1-94, die zwei Blocks weiter nördlich verlief, kam Verkehrslärm als dumpfes Brausen herüber. Keine Fußgänger. Niemand, der mit Einkaufstüten beladen war.
Er wartete, ging vor den Fenstern auf und ab und behielt die Straße im Auge. Acht Minuten, zehn Minuten. Die Intensität, das Pulsieren, der Druck nahmen zu. Wo blieb sie? Er brauchte sie.
Dann sah er sie so hastig die Straße überqueren, daß ihr schwarzes Haar im Licht der Quecksilberdampflampen flog. Sie war allein und trug nur eine Einkaufstüte. Als sie genau unter ihm außer Sicht kam, trat er an die Mittelsäule und blieb dort stehen.
Der Werwolf trug Jeans, ein schwarzes T-Shirt, Chirurgenhandschuhe aus Latex und eine blaue Sturmhaube. Sobald er sie ans Bett gefesselt hatte und sich auszog, würde die Frau sehen, daß der Angreifer sich rasiert hatte: Er wies so wenig Schamhaar auf wie ein Fünfjähriger. Nicht etwa, weil er komisch veranlagt war, obwohl es sich ... interessant anfühlte. Aber er kannte einen Fall, in dem Spurensicherer auf der Couch einer Frau ein halbes Dutzend Schamhaare eines Mannes gefunden und mit denen eines Verdächtigen verglichen hatten. Die Vergleichshaare hatten sie sich mit Hilfe eines Durchsuchungsbefehls verschafft. Ein cleverer Trick. Von der Berufungsinstanz bestätigt.
Ihn fröstelte. Es war unangenehm kühl. Er wünschte sich, er hätte eine Jacke angezogen. Als er aus dem Haus gegangen war, hatte das Thermometer vierundzwanzig Grad angezeigt. Inzwischen mußte die Temperatur um sieben, acht Grad gefallen sein. Dieses gottverdammte Minnesota!
Der Werwolf war weder groß noch sonderlich athletisch. In seiner Jugend hatte er sich für kurze Zeit für schlank gehalten, obwohl sein Vater ihn als schmächtig bezeichnet hatte. Jetzt war er dicklich, wie er seinem Spiegelbild eingestand. Einssechsundsiebzig, lockiges rotes Haar, leichtes Doppelkinn, beginnender Schmerbauch ... Lippen wie rote Würmer ...
Der Aufzug war alt und für Waren bestimmt. Er ächzte einmal, zweimal, bevor er sich nach oben in Bewegung setzte. Der Werwolf überprüfte seine Ausrüstung: Das Haushaltstuch, das er als Knebel benützen würde, steckte in seiner rechten Hüfttasche. Das Klebeband zur Befestigung des Knebels hatte seinen Platz in der linken. Der Revolver steckte unter seinem T-Shirt im Hosenbund. Die Waffe war klein, aber gefährlich: ein Smith & Wesson Model 15. Er hatte ihn von einem Todkranken gekauft, der kurz danach gestorben war. Vor dem Verkauf hatte der Sterbende erzählt, seine Frau wolle die Waffe zum Selbstschutz behalten. Er bat den Werwolf, ihr nicht zu sagen, daß er den Revolver gekauft hatte. Das solle ihr Geheimnis bleiben.
Das war perfekt. Niemand wußte, daß er diese Waffe besaß. Falls er sie jemals benützen mußte, ließ sich kein Besitzer nachweisen – oder nur der längst tote Vorbesitzer.
Er zog den Revolver, hielt ihn an sich gedrückt und ging in Gedanken nochmals den Ablauf durch: packen, die Waffe ans Gesicht halten, zu Boden drücken, mit dem Revolvergriff auf den Kopf schlagen, sich auf ihren Rücken knien, den Kopf nach hinten ziehen, das Tuch in den Mund stopfen, mit Klebeband befestigen, zum Bett schleppen, Arme am Kopfteil und Füße am Fußteil mit Klebeband fixieren.
Danach entspannen und zum Messer überwechseln.
Der Aufzug hielt, und die Schiebetür öffnete sich. Die Magennerven des Werwolfs verkrampften sich. Ein vertrautes, sogar angenehmes Gefühl. Schritte. Schlüssel im Türschloß. Sein Herz hämmerte. Tür offen. Licht. Tür zu. Der rauhe Revolvergriff in seiner Hand schien zu glühen. Jetzt kam die Frau an ihm vorbei ...
Der Werwolf katapultierte sich aus seinem Versteck.
Sah augenblicklich, daß sie allein war.
Umklammerte sie von hinten, drückte ihr die Revolvermündung ans Gesicht.
Die Einkaufstüte platzte auf. Rot-weiße Büchsen mit Campbell’s Soup rollten wie Würfel über den Holzboden; beige-rote Tiefkühlpackungen mit Hähnchenbeinen und Mikrowellen-Lasagne knirschten unter ihren Füßen.
»Wenn du schreist«, knurrte er mit barscher, am Kassettenrecorder eingeübter Stimme, »bring’ ich dich um!«
Wider Erwarten entspannte sich die Frau und sank ein wenig zurück, und der Werwolf folgte unwillkürlich ihrem Beispiel.
Im nächsten Augenblick stampfte ihr Absatz auf seinen Innenrist. Der Schmerz war unerträglich, und als er den Mund öffnete, um aufzuschreien, drehte sie sich in seinen Armen um, ohne auf den Revolver zu achten.
»Aaaiii!« rief sie halblaut in einer Mischung aus Angst und Empörung.
Dann schien die Zeit für sie fast stillzustehen, als würden die Sekunden zu Stunden. Der Werwolf beobachtete, wie sie ihre Hand hob. Er hatte den Eindruck, sie sei ebenfalls bewaffnet, und spürte, wie seine Hand mit dem Revolver von ihrem Körper weggedrückt wurde, und dachte: Nein! Im nächsten kristallklaren Zeitfragment erkannte er, daß sie keine Schußwaffe, sondern einen schlanken silbernen Zylinder in der Hand hielt.
Sie sprühte ihm die chemische Keule ins Gesicht, und der Zeitstrom ging mit einem Ruck in irrsinniges Zeitraffertempo über. Er schrie auf und schlug mit dem Smith & Wesson nach ihr, wobei ihm der Revolver aus der Hand glitt. Er holte mit der anderen Hand aus, schlug und traf sie mehr aus Zufall am Unterkiefer. Sie ging zu Boden, rollte sich aber geschickt ab.
Der Werwolf suchte seinen Revolver: halbblind, die Hände vors Gesicht geschlagen, keuchend nach Atem ringend – er hatte Asthma, und die Sturmhaube war mit dem Reizstoff getränkt. Die Frau rollte sich ab, richtete sich mit der chemischen Keule in der Hand auf und kreischte jetzt: »Arschloch, Arschloch ...«
Er trat nach ihr und verfehlte sie, und sie besprühte ihn erneut. Er trat wieder zu. Sie stolperte und fiel und rollte sich ab, ohne die Sprühdose zu verlieren, und er konnte den Revolver nicht finden und trat sie noch einmal. Zum Glück traf er die chemische Keule in ihrer Hand, so daß die kleine Sprühdose davonflog. Aus einer Platzwunde an der Stirn, wo er sie mit dem Korn des Revolvervisiers getroffen hatte, sickerte Blut und lief über ihr Gesicht bis in den Mund und färbte ihre Zähne, während sie kreischte: »Arschloch, Arschloch!«
Bevor er sie erneut angreifen konnte, bekam sie ein glänzendes Edelstahlrohr zu fassen und schwang es wie eine geübte Softballspielerin. Er wehrte den Angriff ab, wich dabei zurück und suchte weiter seinen Revolver, aber er war verschwunden. Sie drang weiter auf ihn ein, und der Werwolf traf die Entscheidung, die für ihn die natürlichste war.
Er flüchtete.
Er flüchtete, und sie verfolgte ihn und traf nochmals seinen Rücken. Er stolperte halb, drehte sich um und versetzte ihr mit der Innenfaust einen Hieb an den Unterkiefer – ein schwacher, wenig wirkungsvoller Schlag. Sie wich federnd zurück und griff erneut mit dem Stahlrohr an – mit aufgerissenem Mund und gefletschten Zähnen Blut und Speichel versprühend, während sie kreischte. Er schaffte es. durch die Tür zu kommen, und knallte sie hinter sich zu.
» ... Arschloch ...«
Er lief den Korridor entlang zur Treppe, während er unter der Maske beinahe erstickte. Sie verfolgte ihn nicht, sondern blieb an der geschlossenen Tür stehen und stieß den durchdringendsten Schrei aus, den er jemals gehört hatte. Irgendeine Tür ließ sich öffnen, und er stolperte blindlings die Treppe hinunter. Unten riß er sich die Maske vom Gesicht, stopfte sie in eine Tasche und trat ins Freie.
Schlendern, dachte er. Spazierengehen.
Es war kalt. Dieses gottverdammte Minnesota! Hier konnte man im August erfrieren. Er hörte sie wieder kreischen. Zuerst nur leise, dann lauter. Die Schlampe hatte das Fenster aufgerissen. Und gleich gegenüber war ein Polizeirevier. Der Werwolf zog die Schultern hoch, ging etwas rascher zu seinem Wagen, setzte sich ans Steuer und fuhr davon. Auf halbem Wege zurück nach Minneapolis – noch immer in Todesangst und vor Kälte zitternd – fiel ihm ein, daß Autos Heizungen haben, und er stellte seine an.
Er war in Minneapolis, bevor er merkte, daß er verletzt war. Gottverdammtes Stahlrohr. Das gibt große blaue Flecken, dachte er, am Rücken und auf den Schultern. Wegen des Revolvers war nichts zu befürchten; der ließ sich nicht zu ihm zurückverfolgen.
Gott, diese Schmerzen!
Kapitel 2
Der Ladenbesitzer war hinter einem Wall aus Girlie-Magazinen verborgen. Zigaretten, Schokoriegel und Klarsichtpackungen mit Käsestangen, Taco-Chips, gerösteten Schweineschwarten und weiteren Karzinogenen gaben ihm Flankenschutz. Neben der Registrierkasse war ein Drehständer mit weißen Buttons behängt; jeder Button trug eine Botschaft, die das Credo jedes einzelnen Käufers verkünden sollte. Save the Whales – Harpoon a Fat Chick war ein großer Renner. Auch No More Mr. Nice Guy – Down on Your Knees, Bitch verkaufte sich glänzend.
Der Ladenbesitzer würdigte sie keines Blickes. Er hatte es satt, sie anzusehen. Er starrte aus zusammengekniffenen Augen durch das von Fliegen verdreckte Schaufenster und schüttelte den Kopf.
Lucas Davenport kam mit einer Daily Racing Form vom Zeitungsstand herübergeschlendert und legte zwei Dollar zwölf auf den Zahlteiler.
»Scheißkids«, murmelte der Ladenbesitzer vor sich hin und verrenkte sich den Hals, um mehr von der Straße überblicken zu können. Dann hörte er das Geld auf den Zahlteller fallen und drehte sich um. Sein Basset-Gesicht versuchte zu grinsen und begnügte sich mit noch mehr Falten. »Wie geht’s immer?« ächzte er.
»Was gibt’s?« fragte Lucas und sah an ihm vorbei auf die Straße hinaus.
»’n paar Kids auf Skateboards.« Der Ladenbesitzer hatte Wasser in der Lunge und konnte nur in kurzen Sätzen sprechen. »Hängen sich an 'nen Bus.« Pfeifen. »Wenn da ’n Gullydeckel hochsteht ...« Keuchen. »Dann sind sie tot.«
Lucas sah erneut hinaus. Auf der Straße waren keine Kids zu sehen.
»Längst weg«, sagte der Ladenbesitzer mürrisch. Er griff nach der Racing Form und las den ersten Absatz des Leitartikels. »Schon am Wühltisch gewesen?« Ächzen, »’n Kerl hat Gedichte gebracht.« Er sprach das Wort wie »Gediehe« aus.
»Echt?« Lucas trat auf die andere Seite der Theke und begutachtete die Reihen abgegriffener Bücher auf dem Wühltisch. Zwischen zwei Hardcover-Bänden über die Literatur des 20. Jahrhunderts entdeckte er zu seinem Entzücken einen schmalen Leinenband mit Gedichten von Emily Dickinson. Lucas fahndete niemals nach Gedichtbänden; er kaufte auch niemals neue, sondern wartete auf Zufallsfunde, die sich überraschend oft einstellten: Findelkinder in halben Fachbibliotheken über Biochemie oder Elektrotechnik.
Diese Emily Dickinson hatte einen Dollar gekostet, als sie 1958 in einem obskuren Verlag in der Sixth Avenue in New York City erschienen war. Über drei Jahrzehnte später kostete sie in einem Zeitungsladen in der University Avenue in St. Paul nur noch 80 Cent.
»Wie steht’s mit diesem Pony?« Gurgeln. »Diesem Wabasha Warrior?« Der Ladenbesitzer tippte auf die Racing Form. »In Minnesota gezüchtet.«
»Das ist’s eben«, sagte Lucas.
»Was?«
»In Minnesota gezüchtet. Den sollten sie gleich zu Hundefutter verarbeiten. Aber die Sache hat natürlich einen Vorteil ...«
Der Ladenbesitzer wartete. Für längere Dialoge war er zu kurzatmig.
»Falls viele auf Warrior setzen, weil er von hier stammt«, fuhr Lucas fort, »wird die Quote für den Sieger höher.«
»Und der ist ...?«
»Versuchen Sie’s mit Sun und Halfpence. Keine Garantie, aber die Zahlen stimmen.« Lucas schob die Emily Dickinson mit den 80 Cent und fünf Cent Verkaufssteuer über den Ladentisch. »Lassen Sie mich draußen sein, bevor Sie Ihren Buchmacher anrufen, okay? Ich hab’ keine Lust, als Tippgeber geschnappt zu werden.«
»Wie Sie meinen.« Schnaufen. »Lieutenant.« Der Ladenbesitzer nickte dankend.
Lucas nahm die Emily Dickinson mit nach Minneapolis zurück und stellte seinen Wagen im Parkhaus gegenüber dem Rathaus ab. Er ging um den deprimierend häßlichen alten Bau aus rötlichem Granit herum, überquerte eine Straße und gelangte an einer Wasserfläche vorbei ins Hennepin County Government Center. Dort fuhr er mit der Rolltreppe in die Cafeteria hinunter, zog einen roten Apfel aus einem Verkaufsautomaten, fuhr wieder nach oben und betrat die Rasenfläche hinter dem Gebäude. Er setzte sich in der warmen Augustsonne unter weiße Birken ins Gras, verzehrte den Apfel und las:
...but no man moved me till the tide
Went past my simple shoe
And past my apron and my belt
And past my bodice too,
And mode as he would eat nie up
As wholly as a dew
Upon a dendelion’s sleeve
And then I started too.
Lucas lächelte und biß in den Apfel, daß es knackte. Als er aufsah, überquerte eine schwarzhaarige junge Frau mit einem Zwillingskinderwagen die Plaza. Die Zwillinge trugen identische rosa Strampelanzüge und schwankten von einer Seite zur anderen, so energisch schob ihre Mutter den Wagen. Mama hatte große Brüste und eine schmale Taille, und ihr rabenschwarzes Haar glitt bei jedem Schritt wie ein seidener Vorhang über ihre rosigen Wangen. Zu einem pflaumenfarbenen Rock trug sie eine beige Seidenbluse und war so schön, daß Lucas, der eine Woge des Vergnügens in sich spürte, erneut lächelte.
Dann ging eine andere junge Frau in Gegenrichtung an ihm vorbei: eine Blondine mit punkigem Kurzhaarschnitt, die ein offenherziges Strickkleid trug und aufreizend flittchenhaft wirkte. Lucas beobachtete ihren wiegenden Gang und seufzte im Rhythmus dazu.
Lucas Davenport trug ein weißes Tennishemd, eine Khakihose, halblange blaue Socken und Bootsschuhe mit Lederschnürsenkeln. Das Tennishemd trug er über der Hose, damit seine Dienstwaffe nicht zu sehen war. Lucas war schlank und dunkelhäutig;
er hatte ungewelltes schwarzes Haar, das an den Schläfen grau zu werden begann, und eine lange Nase über vollen Lippen. Einem seiner oberen Vorderzähne fehlte eine Ecke, aber er hatte den Zahn nie Überkronen lassen. Wären seine blauen Augen nicht gewesen, hätte er ein Indianer sein können.
Sein Blick war freundlich und verständnisvoll. Unterstrichen wurde diese Wärme durch eine senkrechte Narbe, die am Haaransatz begann, zum rechten Auge hinunterführte, die Augenhöhle übersprang und erst am Mundwinkel endete. Die Narbe verlieh seinem Gesicht einen ordinären Zug, hinter dem trotzdem noch eine gewisse Unschuld zu ahnen war – wie bei Errol Flynn in Captain Blood.
Lucas wünschte sich, er könnte jungen Frauen erzählen, die Narbe sei ein Andenken an eine Schlägerei in einer Bar in Subic Bay, wo er noch nie gewesen war, oder Bangkok, das er ebenfalls nicht kannte. Tatsächlich verdankte er die Narbe einem Reusendraht, der sich im St. Croix River unter Wasser verfangen hatte und bei zu großer Belastung gerissen war. Das erzählte Lucas freimütig. Einige der jungen Frauen glaubten ihm. Aber die meisten dachten, er wolle damit etwas kaschieren – zum Beispiel eine Schlägerei in einer Bar östlich von Suez.
Obwohl sein Blick freundlich war, verriet ihn sein Lächeln.
Einmal besuchte er mit einer Frau – zufällig eine Zoowärterin – einen Nachtclub in St. Paul, in dessen Kellertoiletten Kokain bereits an Kinder abgegeben wurde. Auf dem Parkplatz des Clubs stand Lucas plötzlich Kenny McGuinness gegenüber, den er im Gefängnis glaubte.
»Scheiße, lassen Sie mich in Ruhe, Davenport«, sagte McGuinness und trat einen Schritt zurück. Der Parkplatz schien plötzlich unter Hochspannung zu stehen: Alles, von Kaugummipapieren bis zu weggeworfenen leeren Kokainbriefchen, sprang in nadelspitzen Fokus.
»Ich hab’ nicht gewußt, daß du draußen bist, Scheißkopf«, antwortete Lucas lächelnd. Die Zoowärterin beobachtete ihn aus weit aufgerissenen Augen. Lucas beugte sich etwas nach vorn, hakte zwei Finger in die Hemdtasche des anderen und zog leicht daran, als seien sie alte Freunde, die Erinnerungen austauschten. »Sieh zu, daß du verschwindest«, flüsterte er dabei heiser. »Geh nach New York. Geh nach Los Angeles. Wenn du nicht verschwindest, kriegst du’s mit mir zu tun.«
»Ich bin zur Bewährung entlassen, ich darf den Staat nicht verlassen«, stammelte McGuinness.
»Dann gehst du eben nach Duluth. Oder nach Rochester. Ich gebe dir eine Woche Zeit«, flüsterte Lucas. »Red mit deinem Vater. Red mit deiner Oma. Red mit deinen Schwestern. Dann haust du ab, verstanden?«
Er drehte sich noch immer lächelnd nach der Zoowärterin um und schien McGuinness bereits vergessen zu haben.
»Du hast mir verdammte Angst eingejagt«, bekannte die junge Frau, als sie im Club waren. »Worum ist’s überhaupt gegangen?«
»Kenny liebt kleine Jungen. Er tauscht Crack gegen zehnjährige Ärsche ein.«
»Oh.« Sie hatte von solchen Dingen gehört, glaubte sie jedoch nur, wie sie an ihre eigene Sterblichkeit glaubte: als entfernte Möglichkeit, mit der man sich noch nicht näher zu beschäftigen brauchte.
Später sagte sie: »Dieses Lächeln hat mir nicht gefallen. Dein Lächeln. Es hat mich an eines meiner Tiere erinnert.«
Lucas grinste sie an. »Tatsächlich? An welches denn? An einen Lemuren?«
Sie knabberte an ihrer Unterlippe. »Ich habe eher an einen Luchs gedacht«, antwortete sie.
Dieses eisige Lächeln, das die Wärme seines Blicks überlagerte, erschien nicht so häufig, daß es Lucas gesellschaftlich behindert hätte. Als er jetzt beobachtete, wie die punkige Blondine um die Ecke des Government Centers bog, sah sie sich im letzten Augenblick nach ihm um und lächelte ihm zu.
Verdammt noch mal! Sie hatte gewußt, daß er sie beobachtete. Das wußten Frauen immer. Steh auf, sagte er sich, und sieh zu, daß du sie einholst! Aber er tat es nicht. Es gab so viele Frauen – eine hübscher als die andere. Er ließ sich seufzend ins Gras zurücksinken und griff wieder nach Emily Dickinson.
Lucas war ein Bild der Zufriedenheit. Mehr als ein Bild.
Ein Foto.
Das Foto wurde durchs Heckfenster eines olivgrünen Lieferwagens gemacht, der auf der anderen Seite der South Seventh Street parkte. In seinem engen, stickig heißen Laderaum mit den von außen undurchsichtigen Scheiben bedienten zwei Cops aus dem Internal Affairs Department auf Stativen aufgebaute Foto- und Videokameras.
Der dienstältere Cop war fett. Sein Partner war mager. Ansonsten sahen sie sich ziemlich ähnlich: Bürstenhaarschnitt, rosa Gesicht, gelbes Uniformhemd mit kurzen Ärmeln. Drillichhose von J. C. Penney. Alle paar Minuten sah einer von ihnen durch das 300-mm-Teleobjektiv. Die dazugehörige Kamera, eine Nikon F3, war mit einem Data Back ausgerüstet – einer speziellen Rückwand, die auf jedem Negativ Datum und Zeitpunkt der Aufnahme festhielt. So konnte das Foto als Beweismittel für die Aktivitäten eines Verdächtigen vorgelegt werden.
Bei Beginn der Überwachung vor fast zwei Wochen hatte Lucas die beiden schon nach einer Stunde entdeckt. Obwohl er nicht wußte, weshalb er überwacht wurde, hörte er sofort auf, mit anderen Cops, seinen Freunden und seinen Spitzeln zu reden. Er lebte völlig isoliert, ohne zu wissen, warum. Aber das würde er noch herausbekommen. Unvermeidlich.
Bis dahin verbrachte er möglichst viel Zeit im Freien, um die Beobachter dazu zu zwingen, in ihrem stickig-heißen Fahrzeug zu bleiben, in dem sie weder richtig essen noch pissen konnten. Lucas grinste vor sich hin – wieder sein unangenehmes Lächeln, das Luchslächeln -, legte Emily Dickinson weg und griff nach der Daily Racing Form.
»Glaubst du, daß der Hurensohn ewig dort hocken bleiben will?« fragte der dicke Cop. Er krümmte sich unbehaglich.
»Sieht fast so aus.«
»Ich muß pissen wie ’n russisches Rennpferd«, klagte der Dicke.
»Hättst nich’ soviel Coke trinken sollen. Das kommt vom Koffein.«
»Vielleicht kann ich mich kurz rausschleichen ...«
»Haut er plötzlich ab, muß ich hinterher. Bleibst du dabei zurück, schneidet Bendl dir die Eier ab.«
»Nur wenn du petzt, Arschloch!«
»Ich kann nicht gleichzeitig fahren und fotografieren.«
Der dicke Cop wand sich unbehaglich und versuchte, seine Chancen auszurechnen. Er hätte gehen sollen, als Lucas sich auf dem Rasen niedergelassen hatte – aber da war es noch nicht so dringend gewesen. Jetzt, wo Lucas jeden Augenblick abhauen konnte, fühlte sich seine Blase wie ein Basketball an.
»Sieh dir den bloß an!« sagte er, während er Lucas durch ein Fernglas beobachtete. »Er sieht den Muschis nach. Glaubst du, daß wir ihn deswegen beobachten? Wegen der Muschis?«
»Keine Ahnung. Verdammt komische Sache. Schon wie wir den Auftrag gekriegt haben – ohne die geringste Erklärung.«
»Ich hab’ gehört, daß Lucas irgendwas gegen den Chief in der Hand hat.«
»Muß er wohl. Ansonsten tut er nichts. Fährt mit seinem Porsche in der Stadt spazieren und geht jeden Tag zum Pferderennen.«
»Seine Akte sieht gut aus. Mit Belobigungen und allem.« »Er hat ’n paar gute Fälle gelöst«, gab der magere Cop zu. »Massenhaft«, sagte der Dicke.
»Yeah.«
»Hat auch ’n paar Kerle erschossen.«
»Fünf. Damit hält er bei uns den Rekord. Von den anderen hat keiner mehr als zwei.«
»Lauter einwandfreie Fälle von Notwehr.«
»Die Reporter sind ganz wild nach ihm – ’n gottverdammter Wyatt Earp.«
»Weil er Geld hat«, stellte der Dicke nachdrücklich fest. »Reporter haben ’ne Vorliebe für Leute mit Geld, für reiche Kerle. Hab’ noch keinen Reporter kennengelernt, der nicht scharf auf Geld gewesen wäre.«
Sie dachten kurz über Reporter nach. Reporter hatten viel Ähnlichkeit mit Cops, aber ihr Mundwerk war schneller.
»Wieviel verdient er deiner Meinung nach? Davenport?« erkundigte sich der Dicke.
Der magere Cop schob die Lippen vor, während er über diese Frage nachdachte. Gehälter waren nicht unwichtig. »Bei seinem Dienstgrad und seinem Dienstalter dürfte er von der Stadt zweiundvierzig, vielleicht sogar fünfundvierzig kriegen«, meinte er. »Dazu kommen die Spiele. Soviel ich gehört hab’, verdient er an jedem, das ein Renner wird, kühle hundert Mille.«
»So viel?« fragte der Dicke erstaunt. »Mit soviel Geld würd’ ich aufhören und mir eine Restaurant, vielleicht ’ne Bar an einem der Seen kaufen.«
»Aussteigen«, bestätigte der Magere. Sie hatten schon so oft über dieses Thema gesprochen, daß ihre Antworten ganz automatisch kamen.
»Warum ist er nicht zum Sergeanten degradiert worden? Als er aus dem Raubdezernat versetzt worden ist, mein’ ich.«
»Soviel ich gehört hab’, hat er mit Kündigung gedroht. Er wolle sich nicht zurückentwickeln, hat er gesagt. Und da sie ihn halten wollten – er hat in jeder Bar und bei jedem Friseur seine Informanten -, haben sie ihm seinen Dienstgrad lassen müssen.«
»Als Vorgesetzter ist er echt schlimm gewesen«, fuhr der Dicke fort.
Der dünne Cop nickte. »Alle sollten perfekt sein. Und keiner ist’s gewesen.« Er schüttelte den Kopf. »Lucas hat mir selbst erzählt, daß das der schlimmste Job seines Lebens gewesen ist. Er hat gewußt, daß er’s übertrieben hat, aber er hat nichts dagegen machen können. Jede geringste Verfehlung hat ihn auf die Palme gebracht.«
Sie machten eine Pause und beobachteten den Mann, von dem sie sprachen, durch die außen verspiegelte Scheibe. »Aber kein übler Bursche – wenn er nicht gerade dein Boß ist«, sagte der Dicke und wechselte das Thema. Für Überwachungsaufgaben eingesetzte Cops verstanden sich darauf, Konversation zu machen. »Mir hat er mal eines seiner Spiele geschenkt. Für meinen Jungen, das Computergenie. Auf der Packung sind außerirdische Lebewesen wie drei Meter große Küchenschaben abgebildet gewesen, die sich mit Strahlern bekämpft haben.«
»Hat’s deinem Jungen gefallen?« fragte der magere Cop ohne wirkliches Interesse. Er hielt den einzigen Sohn des Dicken für verzogen und vielleicht sogar für schwul, obwohl er das niemals ausgesprochen hätte.
»Yeah. Ich hab’s wieder mitgenommen und ihn um sein Autogramm gebeten. Gleich auf die Packung: Lucas Davenport.« Der Dicke wand sich unbehaglich. »Hör zu, ich muß wirklich dringend raus! Falls Davenport irgendwohin fahren will, muß er seinen Wagen holen. Wenn du nicht mehr hier bist, renn’ ich los, und wir treffen uns vor der Rampe.«
»Na ja, mein Arsch ist’s nicht«, sagte sein Partner mit einem Blick durchs Teleobjektiv. »Er hat gerade mit der Racing Form angefangen. Vielleicht hast du ’n paar Minuten Zeit.«
Lucas sah den dicken Cop aus dem Lieferwagen klettern und hastig im Pillsbury Building verschwinden. Er grinste in sich hinein. Am liebsten wäre er davongeschlendert, damit der andere Cop ihm nachfahren und den Dicken zurücklassen mußte. Aber das hätte nur Komplikationen mit sich gebracht. Ihm war es lieber, wenn er wußte, wo die beiden steckten.
Als der dicke Cop vier Minuten später zurückkam, war der Lieferwagen noch immer da. Sein Partner nickte ihm zu und sagte: »Nichts.«
Da Lucas bisher nichts unternommen hatte, waren die von ihm gemachten Fotos nie entwickelt worden. Sonst hätten sie auf vielen der Bilder seinen hochgereckten rechten Mittelfinger gesehen und daraus vermutlich geschlossen, er habe sie entdeckt. /Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr, weil diese Filme niemals entwickelt werden würden.
Als der dicke Cop schnaufend in den Wagen zurückkletterte und Lucas mit dem schmalen Gedichtband im Gras lag, waren sie dem Ende der Überwachungsaktion sehr nahe.
Lucas las ein Gedicht mit dem Titel Die Schlange, und der Dicke beobachtete ihn durchs Teleobjektiv der Nikon, als der Werwolf ein weiteres Opfer ermordete.
Kapitel 3
Zum ersten Mal hatte er sie vor etwa vier Wochen im Grundbuchamt des County Clerk’s Office gesehen. Sie hatte rabenschwarzes Haar, das sie kurz trug, und braune Augen. An ihren zarten Ohrläppchen baumelten große Ohrringe. Sie trug einen Hauch Parfüm und ein rotes Kleid.
»Ich möchte die Akte Burkhalter-Mentor einsehen«, erklärte sie einem Angestellten. »Die Nummer habe ich leider nicht. Sie muß letzten Monat ergänzt worden sein.«
Der Werwolf beobachtete sie aus dem Augenwinkel heraus. Sie war fünfzehn bis zwanzig Jahre älter als er. Attraktiv.
Damals hatte der Werwolf noch nicht versucht, sich der Malerin zu bemächtigen. Gedanken an sie beherrschten seine Tage, und nachts standen ihm ihr Gesicht und ihr Körper vor Augen. Er wußte, daß sie ihm gehören würde; die Liebesmelodie hatte bereits eingesetzt.
Aber auch diese hier war interessant. Mehr als interessant. Er spürte, wie sein Bewußtsein sich erweiterte, und genoß das Spiel von Licht und Schatten im Flaum ihres schlanken Unterarms ... Und nach der Malerin mußte es wieder eine geben.
»Wollen Sie die Akte wegen einer Grundschuldeintragung sehen?« fragte der Angestellte die Schwarzhaarige.
»Es handelt sich um Pfandrechte an einer Wohnanlage. Ich möchte sichergehen, daß sie abgelöst worden sind.«
»Okay. Das war Burkhalter ...«
»Burkhalter-Mentor.« Sie buchstabierte ihm den Doppelnamen, und der Angestellte ging nach hinten ins Archiv. Sie ist Immobilienmaklerin, dachte der Werwolf. Die Schwarzhaarige fühlte seinen Blick und erwiderte ihn kurz.
»Sind Sie Immobilienmaklerin?« fragte er.
»Ja, das bin ich.« Ernsthaft, neutral, professionell. Nur ein Hauch rosa Lippenstift.
»Ich bin erst seit kurzem in Minneapolis«, sagte der Werwolf und trat etwas näher an sie heran. »Ich bin Anwalt in der Kanzlei Felsen-Gore. Hätten Sie ein paar Sekunden Zeit, mir eine Immobilienfrage zu beantworten?«
»Natürlich.« Das klang merklich freundlicher, interessierter.
»Ich habe mich an den Seen südlich von hier umgesehen – Lake of the Isles, Lake Nokomis und so weiter.«
»Oh. das ist eine sehr nette Wohngegend«, bestätigte sie enthusiastisch. Sie hatte volle Lippen, die perlweiße Zähne sehen ließen, wenn sie lächelte. »Dort sind im Augenblick viele Häuser zu verkaufen. Auf dieses Gebiet bin ich spezialisiert.«
»Nun, ich weiß eigentlich nicht, ob ich eine Eigentumswohnung oder ein Haus will ...«
»Ein Haus verliert weniger leicht an Wert.«
»Ja, aber ich bin ledig, wissen Sie, und möchte keine Arbeit mit einem großen Garten haben ...«
»Ideal für Sie wäre ein Bungalow auf einem kleinen Grundstück – ohne großen Garten. Dann hätten Sie mehr Platz als in einem Apartment und könnten für dreißig Dollar im Monat einen Rasenmäherdienst kommen lassen. Das wäre billiger als die Wartungsgebühr der meisten Eigentumswohnungen, und Sie würden sich den Wiederverkaufswert erhalten.«
Der Werwolf ließ sich seine Akte geben und wartete, bis sie ihre Fotokopien hatte. Sie gingen miteinander zum Aufzug und fuhren ins Erdgeschoß hinunter.
»Nun. äh, wissen Sie, in Dallas haben wir eine Mehrfachliste oder so ähnlich gehabt«, sagte der Werwolf. »Jedes Objekt ist gleich von mehreren Maklern angeboten worden ...«
»Ja, das ist hier auch üblich«, bestätigte sie.
»Wenn ich also herumfahren und ein Haus sehen würde, das mir gefällt, könnte ich Sie anrufen, um es mir von Ihnen zeigen zu lassen?«
»Klar, so was mache ich dauernd. Augenblick, ich gebe Ihnen meine Karte.«
Jeannie Lewis. Er steckte ihre Geschäftskarte in seine Geldbörse. Sobald er sich abwandte und sie nicht mehr körperlich vor sich hatte, sah er wieder die Malerin vor sich: ihr Gesicht und ihren Körper, während sie durch St. Paul schritt. Er lechzte nach ihr, und die Immobilienmaklerin geriet fast in Vergessenheit. Aber nicht ganz.
Eine Woche lang sah er jedes Mal ihre Karte, wenn er seine Geldbörse aufklappte. Jeannie Lewis mit dem rabenschwarzen Haar. Ganz entschieden eine Kandidatin.
Und dann das Fiasko.
Am Morgen danach wachte er mit blauen Flecken und wie zerschlagen auf. Er schluckte ein halbes Dutzend Aspirin extrastark und verrenkte sich im Bad den Hals, um seinen Rücken im Spiegel betrachten zu können. Die Male waren schlimm: Sie zogen sich als lange blauschwarze Striemen über Rücken und Schultern.
Seine Besessenheit, die der Malerin gegolten hatte, war erloschen. Als er aus der Dusche kam, sah er im Spiegel ein fremdes Gesicht, das hinter der Kondenswasserschicht zu schweben schien. Er wischte den Spiegel mit einem Zipfel seines Handtuchs ab. Dabei kam die Lewis zum Vorschein, die ihn anlächelte und sich für seine Nacktheit interessierte.
Sie hatte ihr Büro im South Lake Distrikt in einem ehemaligen Laden mit großem Schaufenster. Fr fuhr dort vorbei und hielt Ausschau nach einem Beobachtungsort. Als bester Platz erwies sich die vorderste Ecke des Parkstreifens gegenüber dem Ladenbüro der Immobilienmaklerin. Dort konnte er in seinem Wagen sitzen und durchs Schaufenster beobachten, wie sie telefonierte.
Er beobachtete sie eine? Woche lang. Außer am Mittwoch kam sie jeden Tag zwischen zwölf Uhr dreißig und dreizehn Uhr und brachte sich ein Lunchpaket mit. Sie aß während der Arbeit am Schreibtisch und verließ ihr Büro selten vor vierzehn Uhr dreißig. Sie war wirklich bezaubernd. Am besten gefiel ihm ihr stolzer und trotzdem geschmeidiger Gang. Nachts träumte er davon, wie Jeannie Lewis nackt durchs Wüstengras auf ihn zuschritt ...
Er beschloß, sich an einem Donnerstag Erleichterung zu verschaffen. Zuvor machte er ein hübsches Haus ausfindig, das sechs Blocks von ihrem Büro entfernt in einem wieder aufgewerteten Wohngebiet stand. Das Haus hatte kein direktes Gegenüber. Seine Einfahrt war etwas abgesenkt, und vom Garagentor aus führte eine Treppe hinter einer immergrünen Hecke zum Eingang hinauf. Wenn er bei der Lewis mitfuhr und in der Einfahrt nach rechts ausstieg, war er von der Straße aus praktisch unsichtbar.
Das Haus selbst schien unbewohnt zu sein. Er informierte sich in den Grundstückslisten, die die Ermittler bei Felsen-Gore benützten, und schrieb sich die Namen der Nachbarn heraus. Als er den ersten anrief, geriet er an einen schwatzhaften Alten, dem er erklärte, er wolle ein direktes Angebot für das Haus abgeben, um die Maklergebühr zu sparen. Ob der Nachbar wisse, wo die Eigentümer zu erreichen seien? Gewiß, in Arizona. Der Alte gab ihm ihre Telefonnummer und fügte hinzu, sie seien erst zu Weihnachten wieder da – und auch dann nur für zwei Wochen.
Der Werwolf erkundete die nähere Umgebung des Hauses und fand wenige Blocks weit entfernt einen kleinen Supermarkt gegenüber einer Standard-Tankstelle.
Am Donnerstag packte er seine Ausrüstung in den Kofferraum seines Wagens und schlüpfte in eine weite Tweedjacke mit großen Taschen. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß die Lewis im Büro war, fuhr er zum Supermarkt, stellte seinen Wagen auf dem belebten Parkplatz ab und rief sie aus einer Telefonzelle an.
»Jeannie Lewis«, meldete sie sich. Ihre Stimme klang angenehm kühl.
»Miss Lewis, wir haben uns vor vier, fünf Wochen im County Clerk’s Office kennengelernt«, erklärte der Werwolf. Er spürte sein Herz gegen die Rippen pochen. »Wir haben über Häuser im Seengebiet geredet ...«
Kurzes Zögern am anderen Ende, so daß der Werwolf schon fürchtete, sie habe ihn vergessen. Aber dann sagte sie: »Oh ... ja, ja, ich erinnere mich. Wir sind zusammen im Lift gefahren, stimmt’s?«
»Ganz recht. Nun, um’s kurz zu machen: Ich bin mit dem Wagen unterwegs gewesen, um mir ein paar Häuser anzusehen, und habe eine Panne gehabt. Ich bin gerade noch in eine Tankstelle gekommen, und dort haben sie gesagt, daß es ein paar Stunden dauern wird, weil die Wasserpumpe ausgewechselt werden muß. Deshalb habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht und bin auf ein sehr interessantes Haus gestoßen.«
Er warf einen Blick auf den Zettel mit der Adresse, den er in der Hand hielt, und las sie ihr vor. »Ob wir wohl einen Besichtigungstermin vereinbaren könnten?«
»Sind Sie noch immer an der Tankstelle?«
»In einer Telefonzelle gegenüber.«
»Ich habe gerade nichts Dringendes zu erledigen und bin keine fünf Minuten von Ihnen entfernt. Ich könnte bei dem anderen Makler vorbeifahren – hat sein Büro ganz in der Nähe? -. den Schlüssel mitnehmen und Sie dann abholen.«
»Ich möchte Ihnen keine Mühe machen ...«
»Nein, kein Problem. Ich kenne dieses Haus. Es befindet sich in sehr gutem Zustand. Mich wundert’s eigentlich, daß es nicht längst verkauft ist.«
»Nun ...«
»Ich bin in zehn Minuten da.«
Sie brauchte eine Viertelstunde. Er kaufte sich im Supermarkt ein Eis, setzte sich damit auf die Bank an der Bushaltestelle neben der Telefonzelle und aß es langsam. Als die Lewis mit ihrem braunen Kombi vorfuhr, erkannte sie ihn sofort. Er sah ihre Zähne blitzen, als sie ihm hinter der getönten Windschutzscheibe zu lächelte.
»Hallo. wie geht’s?« fragte sie, als er die Beifahrertür öffnete. »Sie sind Rechtsanwalt, nicht wahr? Das ist mir eingefallen, als ich Sie eben gesehen habe.«
»Ja. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, daß Sie sich sofort Zeit für mich genommen haben. Habe ich mich übrigens schon vorgestellt? Ich bin Louis Vullion.« Der Werwolf sprach den Nachnamen französisch aus, obwohl seine Eltern ihn amerikanisch betont hatten, als reime er sich auf »Onion«.
»Freut mich, Sie kennenzulernen.« Das klang aufrichtig.
Auf der dreiminütigen Fahrt zum Haus machte die Lewis ihn auf die Vorzüge dieses Wohngebiets aufmerksam. Die Seen waren so nahe, daß er abends zu ihnen hinunterjoggen konnte. Aber auch wieder so weit entfernt, daß keine Verkehrsbelästigung zu befürchten war. Die Schulen in der Nähe garantierten, daß der Wiederverkaufswert des Hauses hoch blieb. Andererseits waren sie nicht so nahe, daß Kids zu einem Problem werden konnten. Und die Nachbarschaftsverhältnisse waren so stabil, daß die Hausbesitzer einander kannten – und daß Fremde auffallen mußten.
»Im Vergleich zu anderen Wohngebieten der Stadt ist die Kriminalitätsrate hier ziemlich niedrig«, versicherte die Lewis ihm. In diesem Augenblick röhrte ein Verkehrsflugzeug tief über sie hinweg, um auf dem Minneapolis – St. Paul International Airport zu landen. Die Maklerin erwähnte es mit keinem Wort.
Auch Vullion ignorierte die Düsenmaschine. Er hörte gerade gut genug zu, um an den richtigen Stellen nicken zu können. Innerlich war er wieder dabei, sich den Tatablauf vorzustellen. Diesmal durfte ihm keine Panne wie bei der Malerin passieren.
O ja, diesen Mißerfolg mußte er sich selbst zuschreiben; daran führte kein Weg vorbei. Er hatte sich getäuscht und konnte von Glück sagen, daß ihm die Flucht geglückt war. Eine sportliche Frau mit etwa sechzig Kilogramm konnte eine ernst zu nehmende Gegnerin sein. Diese Lektion würde er nicht vergessen.
Was die Lewis betraf, durfte er sich keinen Ausrutscher erlauben. Sobald er sie angegriffen hatte, mußte sie sterben, weil sie sein Gesicht gesehen hatte und seinen Namen kannte. Deshalb hatte er den Angriff so gut wie möglich mit einem in seiner Wohnung an der Badezimmertür aufgehängten Basketball geübt – der Ball stellte ihren Kopf dar.
Und nun war er bereit. In der rechten Jackentasche hatte er eine Sportsocke, in der eine große Idaho-Kartoffel steckte. Sie beulte die Tasche etwas aus, aber das konnte auch ein dicker Terminkalender oder ein Sandwich sein. Ein Haushaltstuch, das Klebeband und die Chirurgenhandschuhe aus Latex hatte er in der linken Tasche. Bevor er die Handschuhe übergestreift hatte, würde er nichts berühren, an dem Fingerabdrücke haften konnten. Er dachte darüber nach, probte in Gedanken den genauen Ablauf und sagte zwischendurch »Interessant!« oder »Tatsächlich?«, wenn es ins Verkaufsgespräch der Lewis paßte.
Während sie weiterfuhren, fühlte er, daß seine Wahrnehmungsfähigkeit zunahm, und erkannte mit gewissem Widerwillen, daß die Lewis anscheinend rauchte. Sie hatte einen ganz leichten Nikotingeruch an sich.
Als sie in die Einfahrt abbogen, spürte er, wie seine Magennerven sich verkrampften – wie bei der Malerin und den anderen. »Von außen sieht’s jedenfalls hübsch aus«, stellte er fest.
»Warten Sie nur, bis Sie’s von innen sehen. Küche und Bad sind vollständig erneuert worden.«
Sie führte ihn zum Eingang, der zur Straße hin von einer immergrünen Hecke abgeschirmt war, sperrte auf und öffnete die Tür. Das Haus war vollständig eingerichtet, aber das Wohnzimmer machte den allzu aufgeräumten Eindruck, der auf lange geplante Abwesenheit schließen ließ. Die Luft war still und ein wenig moderig.
»Möchten Sie sich erst ein bißchen allein umsehen?« fragte die Lewis.
»Gute Idee.« Er warf einen Blick in die Küche, schlenderte durchs Wohnzimmer, ging die drei Stufen zur Schlafzimmerebene hinauf und besichtigte dort alle Räume. Als er zurückkam, stand die Lewis im Wohnzimmer und betrachtete interessiert eine Kristalllampe auf dem Kaminsims.
»Wieviel verlangen sie dafür?«
»Hundertfünf.«
Er nickte und sah zur Kellertür neben der Küche hinüber.
»Geht’s dort in den Keller?«
»Ja, das nehme ich an.«
Als sie sich nach der Tür umdrehte, zog er die Socke mit der Idaho-Kartoffel aus seiner Jackentasche. Die Lewis machte einen Schritt auf die Tür zu. Er schwang die Socke wie eine Keule und knallte sie ihr dicht über dem linken Ohr seitlich an den Kopf.
Der Schlag ließ sie torkelnd zu Boden gehen, und Vullion kniete sofort auf ihr und schlug nochmals zu. Die Lewis war nicht so sportlich wie die verdammte Malerin. Durch ihre Bürotätigkeit hatte sie keine Kraft in den Armen. Sie stöhnte benommen, aber dann packte er sie an den Haaren, riß ihren Kopf nach hinten und stopfte ihr das Tuch in den Mund. Als nächstes zog er seine Latexhandschuhe an, nahm das Klebeband aus der Jackentasche und befestigte damit den Knebel.
Als die Lewis sich endlich zu wehren versuchte, wälzte er sie auf den Rücken, legte ihre Handgelenke übereinander und fesselte sie mit Klebeband. Sie kam allmählich wieder zu Bewußtsein und hatte die Augen halb geöffnet, als er sie die Treppe hinaufschleppte und im ersten Schlafzimmer aufs Himmelbett warf. Ihre Handgelenke befestigte er mit Klebeband am Kopfende des Betts; danach fixierte er ihre gespreizten Beine an den Bettpfosten des Fußendes.
Er atmete keuchend, aber er spürte seine Erektion pochend wachsen, während Erregung ihm die Kehle zuschnürte.
Er trat einen Schritt zurück und blickte auf sie hinab. Ein Messer! dachte er. Hoffentlich finde ich ein gutes. Er ging hinunter, um in der Küche nachzusehen.
Auf dem Bett hinter ihm stöhnte Jeannie Lewis.
Kapitel 4
Die Pferderennbahn der Twin Cities sieht wie ein von einem Zuckerbäcker entworfener Busbahnhof aus. Dem dicken Cop, der kein Architekturkritiker war, gefiel sie. Er saß mit einer Peperoni-Pizza auf den Knien, einem Diät-Cola in einer Hand und einem Handfunkgerät in der anderen in der Sonne. Der Funkspruch kam unmittelbar vor dem zweiten Rennen.
»Gleich jetzt?«
»Gleich jetzt.« Trotz des Rauschens war die Stimme schneidend scharf und unverkennbar.
Der Dicke sah zu seinem mageren Partner hinüber.
»Scheiße, der verdammte Chief. Am Funkgerät.«
»Na ja, vorschriftsmäßig ist das nicht gerade.« Der magere Cop stopfte sich den Rest eines Hamburgers in den Mund. Er hatte sein Sportjackett mit Senf bekleckert und versuchte jetzt den Fleck mit der winzigen Serviette wegzuputzen.
»Er will Davenport sprechen«, brummte der Dicke.
»Dann muß was passiert sein«, sagte der Magere. Die beiden saßen auf der nicht überdachten Tribüne. Lucas hatte sich für den überdachten Teil schräg unter ihnen entschieden. Dort lümmelte er auf einer Bank genau vor dem Totalisator und keine zehn Meter vom dunklen Geläuf der Bahn entfernt. Am anderen Ende seiner Bank saß eine hübsche Frau mit Cowboystiefeln und trank Bier aus einem Plastikbecher. Die beiden Cops stiegen die Tribüne hinauf, folgten der Mitteltreppe nach unten und drängten sich durch die Menge am Fuß der Treppe.
»Davenport? Lucas?«
Lucas drehte sich um, erkannte sie und lächelte. »He, wie geht’s? Mal beim Pferderennen ausspannen, was?«
»Der Chief will Sie sprechen. Sofort!« Bisher hatte der Dicke nicht darüber nachgedacht, aber jetzt fiel ihm ein, daß das nicht leicht zu erklären war.
»Die Überwachung ist aufgehoben?« fragte Lucas. Er grinste schief.
»Sie haben davon gewußt?« Der dicke Cop zog die Augenbrauen hoch.
»Schon seit einiger Zeit. Aber ich hab’ mir keinen Grund dafür vorstellen können.« Er starrte sie erwartungsvoll an.
Der magere Cop zuckte mit den Schultern. »Wir wissen auch nicht mehr.«
»Hören Sie zu, wenn Sie mich verarschen wollen, Dick ...« Lucas stand mit geballten Fäusten auf, und der Magere trat hastig einen Schritt zurück.
»Ehrlich, Lucas, wir wissen’s nicht«, versicherte ihm der dicke Cop. »Alles ist streng geheim gewesen.«
Lucas drehte sich nach ihm um. »Gleich jetzt, hat er gesagt?« »Richtig! Und das scheint sein Ernst gewesen zu sein.« Lucas wandte sich ab und starrte blicklos übers Bahnoval zur Startmaschine für die 1200-Meter-Strecke hinüber. Jockeys trieben ihre Pferde ans Gatter heran, und die ersten Wetter versammelten sich an der Ziellinie.
»Es geht bestimmt um diesen Werwolf-Mörder«, sagte Lucas nach kurzer Pause.
»Yeah«, bestätigte der dicke Cop. »Das könnte möglich sein.«
»Muß so sein. Den will ich aber nicht, verdammt noch mal!« Er überlegte noch einige Sekunden, bevor er plötzlich lächelte. »Habt ihr schon Pferde für dieses Rennen, Jungs?«
Der dicke Cop zog ein unbehagliches Gesicht. »Äh, ich hab’ zwei Dollar auf Skybright Avenger gesetzt.«
»Mein Gott, Bucky!« rief Lucas aufgebracht. »Sie riskieren zwei Dollar, um zwei Dollar vierzig zu gewinnen – falls sie siegt. Und das tut sie nicht.«
»Na, ich weiß auch nicht ...«
»Wenn ihr nichts davon versteht ...« Lucas schüttelte den Kopf. »Hört zu, ihr geht jetzt hin und setzt zehn Dollar auf Pembroke Dancer. Auf Sieg.«
Die beiden Cops starrten sich an.
»Echt?« fragte der Magere. »Das Pferd ist hier erst einmal gelaufen. Wie willst du da wissen, daß ...«
»He, ob ihr meinen Tipp befolgt oder nicht, ist eure Sache! Ich bleibe jedenfalls hier, bis das Rennen gelaufen ist.«