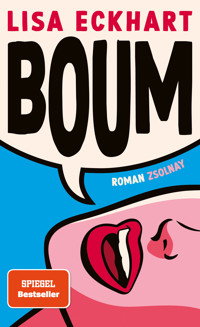
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem Bestseller „Omama“ nimmt Lisa Eckhart ihre Leser mit nach Paris – eine sprachgewaltige und bitterböse Satire.
Der Liebe wegen kommt Aloisia, eine junge Österreicherin, nach Paris, während die französischen Zeitungen unermüdlich über einen Serienmörder berichten. Le Maestro Massacreur bringt scheinbar wahllos Straßenmusiker um. Ein melancholischer Kommissar und der angesehene Terrorexperte Monsieur Boum ermitteln. Doch mit Clopin, dem König der Bettler, in dessen zwielichtigem „Turm der Wunder“ Aloisia rasch Anschluss findet, hat niemand gerechnet.
Lisa Eckharts neuer Roman ist Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi, Comic und Computerspiel in einem. Und er ist eine bitterböse Satire, vor der nichts und niemand sicher ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der Liebe wegen kommt Aloisia, eine junge Österreicherin, nach Paris, während die französischen Zeitungen unermüdlich über einen Serienmörder berichten. Le Maestro Massacreur bringt scheinbar wahllos Straßenmusiker um. Ein melancholischer Kommissar und der angesehene Terrorexperte Monsieur Boum ermitteln. Doch mit Clopin, dem König der Bettler, in dessen zweilichtigem »Turm der Wunder« Aloisia rasch Anschluss findet, hat niemand gerechnet. Lisa Eckharts neuer Roman ist Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi, Comic und Computerspiel in einem. Und er ist eine bitterböse Satire, vor der nichts und niemand sicher ist …
Lisa Eckhart
Boum
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Teil I
Boum
Quand notre cœur fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Et c’est l’amour qui s’éveille
Charles Trenet
1
Frankreich strotzt nicht vor Serienmördern. Es kursieren zwar Listen, die das Gegenteil behaupten, doch gilt es, diesen zu misstrauen. Sieht man etwas genauer hin, entdeckt man darin rasch die vielen ordinären Kriegsverbrecher und ungeschickten Mediziner. Wahre Serienmörder dagegen, die dieses Titels würdig scheinen, hat die Grande Nation kaum zu bieten.
Dementsprechend beseelt war das Land, als er endlich auftauchte. Le Maestro Massacreur. Von den beiden großen Gazetten Paris-Matin und Paris-Soir bald nur mehr Maestro genannt. Anders als viele seiner Kollegen legte er keinen Wert darauf, sich sein Pseudonym selbst auszudenken. Das überließ er Boulevardjournalisten. Überhaupt ist er sehr wortkarg im Umgang mit der Presse und den Behörden. Er beschmiert weder den Tatort mit kryptischen Sentenzen, noch verfasst er romantische Briefchen an den ermittelnden Kommissar.
Der Maestro bleibt stumm. Seine Morde sprechen für sich, jedoch kaum für den Mörder. Über diesen weiß man nichts. Bis auf die Auswahl seiner Opfer. Diese folgt einem klaren Muster. Straßenmusikanten. Der Maestro tötet einzig und allein Straßenmusikanten. Darüber hinaus ist er mitnichten mäkelig. Das Geschlecht scheint ihm egal. Ebenso das Instrument. Vom Geiger bis zum Trommler nimmt er, was er kriegen kann. Daher auch sein Pseudonym. Ein mörderischer Dirigent, der sich ein Orchester aus Toten erschafft. Vier hat er schon rekrutiert. Und das binnen eines Monats.
Nun mag mancher vielleicht kontern, tote Straßenmusikanten fand man in Paris schon immer, und hätte damit sicher recht. Ein langhaariger Trommler, welcher berauscht und beraubt in der Seine treibt, ist in der Tat nicht ungesehen. Ungesehen war bislang einer, welcher direkt über dem Haupteingang zum Musée du Louvre prangt. Gepfählt von der Spitze der Glaspyramide. Der Trommler auf dem Louvre. Opfer Nummer vier und somit das jüngste Mitglied im Orchester des Maestros. Wie die anderen traf es auch ihn am helllichten Tag. Und wie die anderen an einem der bekanntesten und demnach auch belebtesten Plätze von Paris. Trotzdem wollte niemand etwas gesehen haben. Nicht einmal die Überwachungskameras. Was die Aufnahmen zeigten, deckte sich mit den Zeugenaussagen. In einem Moment ist der Trommler noch da und im nächsten jählings fort. Der Verdacht lag äußerst nahe, die Bänder seien manipuliert. Als hätte jemand kurzerhand einen Teil herausgeschnitten. Die Bänder aber waren intakt. Und die Zeitanzeige der Aufnahmen wies überdies keinen Sprung auf, der diese These stützen würde. Also sahen die Kameras exakt das gleiche wie die Passanten. Nämlich nichts. Doch im Gegensatz zu den Kameras hörten die Passanten etwas. Sie hörten die Trommeln. Die Trommeln, mit denen der Tote seit Jahren neben der Pyramide aufschlug und die Touristen unterhielt, die hier oft Stunden Schlange stehen. Was auch immer danach passiert war, der Trommler hatte bis Sekunden vor seinem Tod auf den Trommeln gespielt.
Ebenso verhielt es sich beim Geiger unterm Eiffelturm. Opfer Nummer drei. Unzählige Touristen hatten ihm eben noch gelauscht. Da plötzlich war sein Spiel verstummt und der Geiger selbst verschwunden. Das Einzige, was von ihm blieb, war das Körbchen voller Geld, das stets zu seinen Füßen stand und nun allein die Stellung hielt. Denn der Maestro ist kein Dieb. Die Körbchen, Koffer, Becher, Hüte der Opfer lässt er unberührt. Die Touristen wunderten sich darüber nicht schlecht, aber auch nicht lange. Sie hatten schließlich noch so viel zu sehen. Zu viel, um ihren Blick an Unsichtbares zu verschwenden. Also zuckten sie mit den Schultern und gingen ihres Weges. Wenige Minuten später, als der Geiger längst vergessen und sein Korb geplündert war, entdeckte ihn ein kleines Mädchen, dem ihr Luftballon entglitt. Sie sprang mehrmals in die Höhe, um den Ausreißer zu fassen. Bald gab sie auf. Grimmig schaute sie ihm hinterher. Was für ein dummer Luftballon! Ausgerechnet hier zu fliehen. Hier unter dem Eiffelturm. Jetzt wird er immer weiter steigen. Hoch und höher und am Ende wird er an die Decke stoßen. Wo es keine Kinder gibt, welche sich an ihm erfreuen. Wo nichts ist außer Eisenstangen. Dort muss er dann bleiben. Einsam in alle Ewigkeit. Aber das geschieht ihm recht. Dieser dumme Luftballon! Auf einmal hielt er an. Und das mitten in der Luft. Er blieb stehen und stieg nicht weiter. Das kleine Mädchen lachte. »Schau mal, Mama, dieser Mann hat meinen Luftballon gefangen.« Das Schreien der Mutter vernahm man angeblich noch am Trocadéro. Paris-Matin titelte am nächsten Morgen »Der vitruvianische Geiger«. Darunter ein Bild des Toten. Wie er zwischen den Säulen hing. Nur wenige Meter über dem Boden. Mit seinem Gesicht nach unten. Arme und Beine von sich gestreckt. Die Geige auf der Brust befestigt. Wie Paris-Soir am nächsten Abend preisgab, hatte der Maestro Klaviersaiten verwendet, um ihn dort oben aufzuspannen.
Im Übrigen die gleichen, die er schon eine Woche zuvor benutzt hatte, um den toten Saxophonisten ans Centre Pompidou zu fesseln. Wie sich bald schon herausstellen sollte, keine sonderlich gute Idee. Zwischen all den bunten Rohren, die das Centre Pompidou gleich metallenem Efeu umranken, war der Leichnam nämlich nur mit Mühe zu erkennen. Drei volle Tage harrte der Ärmste an der Fassade festgezurrt aus, ehe ihn jemand entdeckte. Nein, das ist so nicht ganz richtig. Entdeckt hatten ihn einige, allerdings nicht recht verstanden. Was sich als Kriminalfall entpuppte, hielt man drei Tage lang für Kunst. Keine, die Gefallen erregte. Doch wer stellte an die Kunst noch den Anspruch des Gefallens? Somit empörte sich auch niemand ob der lebensgroßen Puppe, welche das Museum zierte. Zumal man wusste, dass das Innere weitaus Seltsameres birgt. Die bittere Erkenntnis hätte noch länger auf sich warten lassen, wäre es nicht so heiß gewesen. Säfte traten aus dem Toten, als wollten sie Hilfe holen. Die ersten Tropfen stürzten sich vergebens in die Tiefe. Sie sickerten in den Asphalt und stanken nicht genug, um auf sich aufmerksam zu machen. Es verging ein halber Tag, bis endlich eine passende Landebahn gefunden war. Ein dicker Glatzkopf mit Sonnenvisier. Als dieser einen Tropfen auf seinem kahlen Haupt verspürte, ahnte er bereits das Schlimmste. Der Glatzkopf fasste sich an die Stirn. Schnell musste er sich eingestehen, gleich doppelt geirrt zu haben. Zum einen war es kein Vogelkot. Zum anderen ist Vogelkot beileibe nicht das Schlimmste von all dem, was einem aufs Haupt tropfen kann.
Der Saxophonist am Beaubourg war das Opfer Nummer zwei.Hätte der Maestro es dabei belassen, wäre er wohl nie zu seinem schmeichelnden Titel gekommen. Denn seine ersten beiden Morde waren alles, nur nicht meisterlich. Höchstwahrscheinlich hätte man sie gar nicht erst miteinander in Verbindung gebracht. Nummer eins und Nummer zwei. Oder waren es null und eins? Serienmörder heißt man gemeinhin einen, der mindestens zwei Morde begeht. Somit könnte man sich fragen, welcher der wahre erste Mord eines Serienmörders ist. Sein Debüt sozusagen. Wenn ihn doch erst der zweite zu einem Serienmörder macht — was ist dann der erste? Eine kleine Fingerübung?
Opfer Nummer eins fand man am Morgen des 22. Juni. Dem Tag nach der famosen Fête de la Musique. Sie lag auf der Wiese des Place des Vosges. Verschüttet unter einem Berg aus Konfetti und Papierschlangen. Sie wurde zertreten und ausgedämpft wie eine Zigarette. Das war kein Mord aus Leidenschaft. Mehr einer aus Langeweile. Der Maestro tötete diese junge Sängerin mit derselben Beiläufigkeit, wie man beim Warten an der Kasse ein Päckchen Kaugummi aufs Band legt. Alles daran wirkte lieblos. Alles bis auf ein Detail. Etwas steckte ihr im Rachen. Etwas Schmales, Längliches. So groß wie die Puppe des Totenkopfschwärmers. Unmöglich, dass sie es verschluckte. Dafür steckte es zu tief. Der Mörder muss es dort platziert haben, nachdem er sie getötet hatte. Erwürgt. Wie die Opfer nach ihr auch. Mit zitternden Händen zieht der Pathologe die Pinzette aus dem Hals. Er lässt den geborgenen Schatz in eine Nierenschale fallen. Ein helles Klimpern. Metall auf Metall. Vor einem halben Jahr noch hätte er nicht die geringste Ahnung gehabt, was in dieser Schale liegt. Seine Tochter hat dasselbe. Seine Gattin trägt eines aus Plastik in der Handtasche herum. Und sogar seinen Sohn hat er bereits mit so einem Ding erwischt. Ein Kazoo. Diese quäkende Tröte, deren Klang man zu jener Zeit nirgendwo entfliehen konnte.
Losgetreten wurde der Trend durch eine junge Sängerin, die in den Straßen von Paris musizierte, bis sie Anfang des Jahres unverhofft zu Ruhm gelangte. Ihre Hymnen an das Leben ohne Geld brachten ihr Millionen ein. Die Tote auf dem Obduktionstisch sieht ihr zum Verwechseln ähnlich. Zierlich, aber nicht zerbrechlich. Das lange braune Haar zwanglos in ein Tuch gewickelt. An den zarten Handgelenken vielerlei bunte Ketten und Bänder. Jedes erzählte die Geschichte einer anderen Rucksackreise. Man könnte meinen, sie wäre es. Die berühmte Sängerin. Dabei war es nur irgendwer. Irgendeine junge Frau, der ein Kazoo im Rachen steckte. Sie hatte in ihrem kurzen Leben wenig erreicht, von dem, was sie wollte. Ihr Tod allerdings sollte etwas Großes bewirken. Zusammen mit der unbekannten Sängerin starb nämlich auch der Kazoo-Trend. Sie selbst hätte das nie gewollt, doch nicht wenige waren ihr dankbar, dass in den Straßen und Métros nun wieder etwas mehr Ruhe einkehrte. Die berühmte Sängerin trug ebenfalls ihren Teil dazu bei. Nur wenige Tage nach dem Fund am Place des Vosges gab sie im Gedenken an die unbekannte Sängerin ein großes Benefizkonzert. Die Erlöse gingen an Opfer aller Art. Die berühmte Sängerin sang davon, dass man sich selbst immer treu bleiben sollte und auf keinen anderen hören. Hunderttausend sangen mit. Ganz am Schluss gab sie ihren größten Hit zum Besten. Den, der sie so berühmt gemacht hatte. Sie und ihr Kazoo. Doch Letzteres kam nicht zum Einsatz. Die Stimme der unbekannten Sängerin werde nimmermehr erklingen. Darum wolle nun auch ihre Tröte schweigen. Die berühmte Sängerin erzählte, sie hätte ihr Instrument früher an diesem Nachmittag deshalb in der Seine versenkt. Danach zog eine Lichterkette durch den Boulevard Bourdon bis hinunter zur Pont d’Austerlitz. Vier Bootspassagiere wurden bei dem Hagel aus Kazoos am Kopf verletzt.
Diese Form der Trauerfeier sollte sich nicht wiederholen. Keinem der drei weiteren Toten wurden solche Ehren zuteil. Ganz zu schweigen von Opfergaben. Nach dem Fund am Centre Pompidou flogen keine Saxophone. Es trieben auch keine Trommeln im Wasser. Und in der Pariser Philharmonie legte man nicht die Geigen nieder. Im Gegenteil. Es wurde sogar mehr getrommelt, gegeigt und gedudelt als jemals zuvor. Nach jedem Mordfall explodierten die Verkaufszahlen des jeweiligen Instruments, welches der Tote bei sich hatte. In der ersten Juliwoche waren es die Saxophone. In der zweiten waren es die Geigen. Und in der dritten eben die Trommeln. Die Musikgeschäftsinhaber spekulierten eifrig, wen es wohl als Nächstes träfe. Einen Trompeter? Einen Cellisten? Die Schöne mit dem Tamburin auf dem Place Dalida? Oder einen der vielen Gitarristen im Jardin du Luxembourg? Ihre gesamte Existenz hing vom nächsten Toten ab. Wenn der nun Kastagnetten spielt, doch ihr Geschäft solche nicht führt? Sie wären ruiniert! Wären sie dagegen die, die Kastagnetten auf Vorrat gekauft haben, hätten sie ewig ausgesorgt. Viele nahmen Kredite auf, um diverse Instrumente zu hamstern. Jene, von denen sie glaubten, sie gingen demnächst durch die Decke. Je seltener, desto besser. Einer beispielsweise deckte sich mit fünfzig Didgeridoos ein. Und das, obzwar sich in Paris lediglich ein einziger Didgeridoospieler herumtreibt.
Doch nicht nur in Musikgeschäften drückte man sich selbst die Daumen. Auch Eltern verfolgten die Auswahl seiner Opfer mit größtem Interesse. Denn es waren nicht zuletzt die horroraffinen Teenies und Kids, die den Maestro anhimmelten. Da dieser jedoch kein offizielles Merchandise vertrieb, mit dessen Kauf sie überlicherweise die Liebe zu ihren Idolen beweisen, stürzten sie sich auf die Instrumente seiner Opfer. Insbesondere ärmere Familien hofften daher, der Maestro möge bitte keinen Pianisten meucheln. Eher einen Flötisten. Am besten einen Triangelspieler. Nicht, dass man einem Triangelspieler etwas Schlimmes wünscht — Gott bewahre! —, doch man muss auch an sich selbst und seine Familie denken. Schließlich will man den Sprösslingen keinen Wunsch verwehren müssen. Erst recht nicht einen so noblen wie jenen nach musikalischer Bildung. Serienmörder hin oder her. Das musste man ihm lassen: Der Maestro entfachte in allen Schichten und Generationen eine völlig neue Begeisterung für die Musik. Selbst der französische Kultusminister gestand in einem Interview mit Paris-Soir: »Für seine Verbrechen gebührt ihm der Tod. Für seinen Dienst an der Kultur eine Statue.«
Seit nunmehr einem Monat aber gab es keinen weiteren Mord. Ein Monat ist nicht lange. Oft lassen Serienmörder Jahre verstreichen, ehe sie erneut zuschlagen. Doch die Öffentlichkeit war verwöhnt. Ein Mord pro Woche. Das war das Pensum, das der Maestro vorgelegt und fortan zu erfüllen hatte. Kurze Zeit ging das Gerücht um, es gäbe ein fünftes Opfer. Ein Didgeridoospieler. Durch den Fleischwolf gedreht und mithilfe eines Spritzsacks in sein Instrument gefüllt. Rasch stellte sich heraus, dass dies kein Werk des Maestros war, sondern der Pastiche eines simplen Musikgeschäftsinhabers. Verraten hatten ihn sowohl sein großer Didgeridoo-Aktionstag als auch seine Ausbildung als Patissier.
In den Büros der großen Gazetten Paris-Matin und Paris-Soir brach allmählich Panik aus. Eine Phantomzeichnung jagte die andere. Da keiner jemals etwas sah, griffen die Journalisten zur Gänze auf ihre Phantasie zurück. Immer kruder wurden die Thesen. Immer ordinärer die Umfragen. »Angenommen, Sie werden ermordet … Welche Rolle spielte die Ethnie Ihres Mörders für Sie als Opfer?« Wenig überraschend: Die meisten fänden ihre Tötung durch einen Landsmann akzeptabler. »Mit welchem Tatmotiv könnten Sie besser leben? Beziehungsweise sterben (Reporter lacht)? Weltlich oder religiös?« Auch hier eine klare Antwort: Ein weltliches Motiv, bitte schön. Das wünschten sich vor allem die Religiösen. »Von wem würden Sie lieber ermordet? Von einem Christen, einem Juden oder einem Muslim?« Und da Straßenmusikanten zu den beliebtesten Figuren des Pariser Personals zählen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Umfrage erschien: »Wen sollte es eher treffen?« Auf der Eins landeten die Clochards. Dicht gefolgt von Polizisten. Immerhin noch auf Platz fünf schafften es die Mannequins. Und sogar die Dezimierung des Stadtbestands an Pantomimen wäre den Befragten lieber als der Verlust von weiteren Musikanten.
Unermesslich war die Erleichterung, als in den Redaktionen endlich der ersehnte Anruf einging: »Canal Saint-Martin. Ein Akkordeonist.«
2
Paris-Charles-de-Gaulle wurde einst — und das völlig zu Recht — zum verwirrendsten Flughafen Europas gekürt. Die Pfeile, welche die Richtungen weisen, drehen sich ununterbrochen. Dafür stehen die Uhren still. Auf allen ist es Punkt zwölf. Denn die Pfeile sind hier Zeiger und die Zeiger Kompassnadeln. Die einzigen Pfeile, die sich nicht drehen, sind jene, die zur U-Bahn weisen. Die sind am Boden aufgeklebt und haben auch dieselbe Farbe.
Des Weiteren gibt es hier Türen, die sind vier Meter hoch und zwei Zentimeter breit. An den Türklinken und -griffen steht auf der einen Seite Ziecken und auf der anderen Seite Drühen. Denn um eine Tür zu öffnen, muss man gleichzeitig drücken und ziehen. Wer nur drückt oder nur zieht, öffnet damit nicht die Tür, sondern ein tiefes Loch im Boden, durch das man wieder zurück an den Start, an den Check-in-Schalter, fällt. Planen Sie also ausreichend Zeit ein. Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, seien Sie zwei Tage vor Abflug vor Ort.
Von Terminal 1 zu Terminal 2 gelangen Sie mit einem Shuttle. Doch auch das ist schwer zu finden. Sollten Sie es eilig haben, nehmen Sie besser gleich ein Flugzeug. Fliegen Sie beispielsweise von Terminal 1 mit der EgyptAir nach Kairo und von dort mit der Air France zu Terminal 2. Sollten Sie sich denn verirren, gehen Sie bloß nicht zur Information. Welche Frage Sie auch stellen, das Personal dort wird Sie mustern und Ihnen mitteilen, dass Sie nicht so aussehen, als hätten Sie sich einen Urlaub verdient. Stellen Sie dann eine weitere Frage, schickt man Sie umgehend zu Gate 72. Was dort passiert, lässt sich nicht sagen. Bislang kehrte niemand je von Gate 72 zurück.
Bei der Sicherheitskontrolle werden Sie regelmäßig gebeten, die Unterhose auszuziehen. Ohne dabei ihre Hose zu berühren. Wem das nicht gelingt, der wird verhaftet. Oder er darf weitergehen. Das hängt allein davon ab, was er nach der Kontrolle würfelt. Im Handgepäck mitführen darf man ausschließlich Flüssigkeiten unter hundert Millilitern. Alles andre wird entsorgt. Es sei denn, Sie können die Harmlosigkeit der Flüssigkeit beweisen, indem Sie einen Schluck davon trinken. Dann darf sie auch ins Handgepäck.
Viele Duty-free-Geschäfte nehmen nur Monopoly-Geld. Zum Glück kann man solches am Flughafen kaufen. Doch, das versteht sich wohl von selbst, nur gegen Monopoly-Geld. Wechseln kann man leider nicht. Die Wechselstuben wechseln zwar, allerdings nicht Dollar oder Franken in Rubel, sondern lediglich Scheine in Münzen beziehungsweise umgekehrt.
Ein letzter Tipp: Unzählige Passagiere verpassten bereits ihre Flüge, weil sie den Schalter 31 nicht fanden. Einige bezweifeln gar, dass es diesen Schalter überhaupt gibt. Das ist natürlich Humbug. Selbstverständlich gibt es ihn. Er befindet sich logischerweise zwischen dem Schalter 30 und dem Schalter 32. Aber anders als die beiden steht der Schalter 31 nicht einfach da, sondern hängt von der Decke. Wer das nicht weiß, hat Pech gehabt. Zwar ruft die Check-in-Dame den Suchenden am Boden immer zu, doch die Halle ist zu hoch, als dass man sie hören könnte.
3
Die Milchglastüren öffnen sich. Sie holt ein letztes Mal tief Luft und macht einen Schritt nach vorne. Ihr Grinsen breiter als ihr Gesicht. Als hätte es seinen Rahmen durchbrochen. Gleich einem langen gezwirbelten Schnurrbart ragt es über ihre Wangen hinaus. Das wird sicher höllisch wehtun, sobald sie mit dem Grinsen aufhört. Womöglich müssen die Backen genäht werden. Oder gestopft wie zwei löcherige Socken. Doch warum sollte sie je damit aufhören? Sie ist schließlich in Paris! Sie ist endlich hier bei ihm. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, reckt das Köpfchen in die Höhe und durchwühlt die Ankunftshalle.
»Casse-toi, conasse!«, brüllt sie ein Mann im Anzug an, der es gar nicht eilig hat und fürchtet, dass man ihm das ansehen könnte. Das Wort conasse verstehen Sie nicht? Umso besser. Es ist ein ziemlicher garstiger Ausdruck. Den müssen Sie nicht kennen. Sie hier kennt ihn schließlich auch nicht. Sie versteht kein einziges der garstigen Wörter, mit denen sie gerade von den Fluggästen bedacht wird. Leute lernen in fremden Sprachen mit Vorliebe Beschimpfungen. Sie hat solche stets gemieden. Weniger um sie nicht zu verwenden, denn um sie gar nicht erst zu verstehen. Sie lernt nur, was sie hören will. Und vieles will sie eben nicht hören. So auch den Groll der Passagiere, denen sie ungeniert im Weg steht.
Wie ein mäkeliges Kind stochert ihr Blick in der Menge herum. Wo ist er nur? Hier sind viel zu viele Menschen. Wie soll sie ihn denn da je finden? Können sich alle, die nicht er sind, bitte auf den Boden legen? Das wäre sehr freundlich, danke. Wieso ruft er ihr nicht zu? Seine Stimme hört sie nicht, dafür schnauzt sie ein weiterer Herr im Anzug von der Seite an. »Vas-y, bouge, putain!« Auch dieser tut nur so, als wäre er in Eile. Sie runzelt verständnislos die Stirn. Dass jedermann mit seinem Geld protzt, doch niemand mehr mit seiner Zeit! Zeit ist schließlich Geld, nicht wahr? Wieso also schämen sich alle für Armut, doch niemand für Hektik?
Allmählich wird sie selbst nervös. Sie hat ihm doch gestern spätnachts noch geschrieben, wann und wo sie heute ankommt. Er hat geantwortet, dass er sich freut. Dass er es kaum erwarten mag. Dass er es fast nicht fassen kann. Sie ist endlich hier bei ihm. Und nun sollte er nicht da sein? Sie schüttelt ungläubig den Kopf. Still und heimlich sammeln sich Tränen in der Kanalisation ihrer Äuglein. Sie selbst hat diese nicht geordert. Sie ist schließlich frohen Mutes, dass er gleich um die Ecke springt mit Blumen und Küssen und vielen Je t’aime. Die Tränen kamen auf eigene Faust. Reine Vorsichtsmaßnahme. Sie halten sich für den Notfall bereit. Damit dann auch genügend da sind. Nicht, dass sie auch noch die Tränen versetzen.
Moment! Vielleicht hat er ja einen Fahrer bestellt. Da er selbst nicht kommen kann. Weil er indessen für sie kocht. Und will, dass alles fertig ist, wenn sie vor der Türe steht. Hungrig von der weiten Reise. Das wird es sein. Sie liest die Namensschilder, die sich die moppeligen Taxifahrer zwischen Bauch und Kinn geklemmt haben, sodass sie sie nicht halten müssen. Mittlerweile sind nur mehr drei von ihnen übrig. »Monsieur B. Dubois.« »Fatih Kutlutürk.« »France 2.«
Die Tränen drängen sich unruhig im Starthaus. Der Auflauf ist riesig. Seit Ostern 1998 haben sich hier nicht mehr so viele versammelt. Höchstens hie und da ein paar Tröpfchen. Beim Zahnarzt oder Zwiebelschneiden. Aber das ist nicht dasselbe. Damals tränten nur die Augen. Jetzt gleich aber tränt das Mädchen. Da wollen sie freilich alle dabei sein und sich mit Karacho über die Lidkante stürzen. Zumal sie sich extra geschminkt hat. Das macht sie ansonsten nie. Sie hat es auch gar nicht nötig. So schön, wie ihre Haut, und so selten, wie sie heult. Vielen Mädchen ihres Alters dient ja kosmetische Glasur als Staudamm für die Tränen. Die benutzen Camouflage als Ersatz für Contenance. Weil sie so oft und gerne weinen. Gar nicht gerne aber haben sie es, wenn Schlieren gleich Schnitten ihre Wangen zerfetzen. Tränen dagegen rodeln mit Freude über gepuderte Gesichtchen. Das ist für die wie durch Neuschnee zu gleiten. Und dieser hier auf ihren Backen ist besonders dick und pulverig. Lange können sie sich nicht mehr gedulden. Die erste lugt schon vom Unterlid hinunter.
Moment! Sie liest die Schilder ein zweites Mal durch. Das mögen nicht ihre Namen sein, aber vielleicht ist sie trotzdem gemeint. Ein Kosename, von dem sie nichts weiß. Oder ein Rätsel. »Monsieur B. Dubois«. Du bois. Das heißt so viel wie aus dem Wald. Sie kommt aus Österreich. Das passt! Das B steht wohl für Bienvenue. Und das Monsieur? Könnte ein Schreibfehler sein. Da sollte stehen »Mlle B. Dubois«. »Willkommen, Fräulein aus dem Wald!« Na bitte, das ist es! Das ist sicher ihr Chauffeur.
Oder ist es der andere? Der mit dem Schild »Fatih Kutlutürk«. Die Türken. Die Türken vor Wien. Ihre Maschine kam aus Wien. Aber was soll »Fatih« heißen? Meint er damit vielleicht »Vati«? Weil er ein bisschen älter ist? Oder meint er damit »Fatty«? Weil sie ein bisschen mollig ist? Wahrscheinlich beides. Was für eine kunstvolle Doppeldeutigkeit. Daran ist er gewiss lange gesessen. Oder auch nicht. Schließlich ist er Künstler. Romancier-Chansonnier-Poète-Philosophe. Der schüttelt sich so etwas doch aus dem Ärmel. Also ist es beschlossen. »Fatih Kutlutürk«. Der muss es sein.
Abermals befallen sie Zweifel. Ist es etwa doch der Dritte? Auf dessen Schild steht aber lediglich »France 2«. Ein großer Fernsehsender. Abends laufen dort oft Filme. Filme. Er mag Filme. Sie hat mit ihm schon mehrmals einen Film gesehen. Mit ihm zusammen. Also zu zweit. Zu zweit in Frankreich. France 2. Verflixt! Das könnte der Richtige sein. So wie die anderen beiden auch. Oder eben keiner. Die Tränen klappen ihr Visiere hinunter.
Moment! Wahrscheinlich hat er alle drei Fahrer bestellt. Um auf Nummer sicher zu gehen. Falls sie eines oder gar zwei der Rätsel nicht lösen kann. So wird es sein. Er hat wirklich an alles gedacht. Ihr Grinsen breitet sich noch weiter aus. Hoffentlich überdehnt sie es nicht. Was passiert wohl, wenn es reißt? Schnellt es dann einfach zurück in die Fassung? Wie ein losgelassenes Maßband? Oder schnalzt es ihr vom Antlitz wie ein gerissener Gummiring? Die Leute ringsum gehen besser in Deckung.
Wenn man in Ankunftshallen wartet, schaut man meistens nur auf jene, die sich freudig um den Hals fallen oder in die Arme springen. Man hört das Kreischen der glücklich Vereinten oder das Quietschen von Teenagergören, die auf einen Prominenten warten. Dabei übersieht man leicht das viel größere Spektakel. Jene, die nicht abgeholt werden, doch fest damit gerechnet haben. Sie wurden nicht versetzt und nicht vergessen. Keiner versprach sie abzuholen und sie baten auch keinen darum. Warum denn auch? Sie wollten ja schließlich nicht abgeholt werden, sondern überrascht. Sie haben fest mit einer Überraschung gerechnet. Der Paranoiker hält Ausschau nach verlassenem Gepäck, in dem Bomben stecken könnten. Der Feinspitz aber schaut derweil nach verlassenem Gemensch. Denn dieses kann ebenfalls hochexplosiv sein.
Ein dritter Herr im Anzug pöbelt und rempelt sie von hinten an. Mit solcher Wucht, dass sie beinahe bäuchlings auf die Fliesen kracht. Sie kämpft verzweifelt dagegen an und rudert wild mit den Armen. Graziler hätte es ausgesehen, wäre sie einfach hingefallen. Stattdessen fuchtelt sie sich in die Höhe zurück. Endlich steht sie wieder aufrecht. Allerdings nur für einen Moment. Im nächsten schon zieht sie ihr riesiger Rucksack, der ihr bis zu den Kniekehlen reicht und sie überragt, unwiderstehlich von hinten zu Boden. Das war ein Ruderschlag zu viel. Nun hilft auch kein Fuchteln mehr. Alles rumpelt, klirrt und scheppert. Insbesondere die Flasche Chianti, welche sie im Duty-free-Shop gekauft hat, zerbirst mit eindrucksvollem Lärm.
Die Leute ringsum zucken zusammen. Sie möchte vor Scham vergehen und zieht ihre Hände übers Gesicht, als wären sie ein Leichentuch. Für einen Augenblick ist es vollkommen still. Ratlos blickt ein jeder in der Halle umher. Auf den Boden, an die Decke. Der eine oder andere sieht sogar unter seinen Achseln nach. Nichts. Was kann das bloß gewesen sein? So ein lauter Knall. Zügig sind sich alle einig. Das hier ist ein Terroranschlag.
4
»Keine Panik, chers amis! Nur keine Panik …« Die Stimme des Mannes legt sich wie ein mit Chloroform durchtränkter Lappen über die brüllenden Münder der Menschen. Vergessen scheinen sogleich der Knall, der Anschlag und die Angst. Anstelle des Gebrülls macht sich ein leises Tuscheln breit. Ab und zu sogar ein Kichern. »Ist er das wirklich?« »Sacrebleu!« »Das kann nicht sein!« »Mon Dieu!« »Er ist es!«
Der Mann ist groß, aber nicht zu groß. Genau richtig, sagen Frauen, die sich bereits an ihm festhalten durften. Er trägt einen verlebten Trenchcoat und schulterlanges dunkles Haar. Rauchend zieht er seine Runden. Geschmeidig und gebieterisch. Brüsk bleibt er stehen. Er zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette. Dann lässt er sie zu Boden fallen. Wehmütig blickt er ihr hinterher und beobachtet, wie sich das Feuer in das dünne, weiße Kleid seiner Gitane frisst. Wenn nicht bald jemand eingreift, wird sie noch ganz von den Flammen verzehrt. So schutz- und filterlos, wie sie ist. Wie leicht könnte er sie retten. Er bräuchte nur die Glut mit seiner Schuhsohle ersticken. Doch er trägt Richelieu Zizi. In Weiß. Weißer noch als das Kleid der Gitane. Er macht sich oft die Hände schmutzig. Aber niemals seine Schuhe.
Ein älterer Herr tritt tapfer aus der Menge hervor. »Es wäre mir eine Ehre, Monsieur …« Er salutiert und hält die Spitze seines alten Budapesters über die glimmende Gitane. Der Mann im Trenchcoat nickt. Feierlich tritt er dem Herrn auf den Fuß. Sein weißer Zizi drückt den alten Budapester auf die Zigarette nieder.
Dann dreht er sich jählings um. Sein Trenchcoat und sein Haar peitschen durch die Luft und fegen den älteren Herren um, der seine Sohle für ihn gab. »Gestatten Sie, mein Name ist …« Er muss sich nicht vorstellen. Ihn kennt jedes Kind und jeder Greis des Hexagons. Frankreichs berühmtester Terrorexperte. Und selbstverständlich auch der beste. Ihm reicht schon ein Bekennerschreiben, um zu wissen, wer es war. Wer dagegen er ist, das weiß niemand. Er meidet die grellen Lichter der Öffentlichkeit. Er tappt lieber im Dunkeln. Gewiss, man kennt die Heldensagen seiner Schläue, seiner Stärke. Die Spatzen pfeifen sie von den Dächern und die Schwalben stöhnen sie aus den Boudoirs. Doch wie es in seinem Inneren ausschaut? Man kennt nicht einmal seinen echten Namen. Auf der Straße nennt man ihn Monsieur Boum. Und im Bett nennt man ihn Jacques.
Monsieur Boum greift in seine Manteltasche und holt ein frisches Softpack hervor. Er klopft mit seinem Zeigefinger zweimal bestimmt gegen die Packung. Den Damen schaudert vor Wonne. »Das sind diese neuen Geschosse«, flüstert er fast unhörbar und sieht sich dabei argwöhnisch um. »Die klingen, als ob Glas zersplittert.« Dann raucht er schweigend. Für mehrere Minuten ist es vollkommen still. Alle lauschen Monsieur Boums eindringlichen Atemzügen. Wie heftig er den Rauch ausbläst. Dicke, schwere Schwaden, die den Himmel perforieren. Ob ihn jemals eine Frau so erfüllen kann wie eine Gitane?
»Sind diese neuen Geschosse gefährlich?«, piepst eine junge Frau in die Stille und klammert sich bang an den Arm ihres Gatten. Sie hasst Terroristen und liebt Monsieur Boum. Doch dieser wirkt verärgert. Wer wagt es, ihn aus seiner Rêverie zu reißen? Finster blickt er in die Richtung, aus welcher das Piepsen drang. Als er die junge Frau erblickt, glättet sich sogleich sein Zorn. Er schnipst die Zigarette fort, welche er erst halb geraucht hat. Der Mülleimer, in dem sie landet, nimmt für ihn die restlichen Züge. Monsieur Boum setzt sich geruhsam in Bewegung. Er lässt sich Zeit mit jungen Pferden. Sonst scheucht er sie auf und sie galoppieren davon. Schon aus der Ferne kann er erkennen, wie der Leib der jungen Frau schlottert. Sicher vor Furcht und noch mehr vor Erregung. Nun steht er vor ihr und sie vor der Ohnmacht. Er holt erneut das Softpack hervor. »Die töten Sie, ohne Sie auch nur zu berühren«, säuselt er der Frau ins Ohr. Am Ende des Satzes beißt er ihr ins Läppchen. Er hätte gern daran geknabbert, doch dies ist nicht die Zeit für Spielchen. Hier wimmelt es von Terroristen und es gibt nur einen, der ihnen das Handwerk legen kann.
Er lässt von ihrem Läppchen ab und füllt die Leere zwischen den Lippen mit einer weiteren Gitane. Die junge Frau fasst sich ans Ohr. Es ist noch feucht. Verschämt steckt sie sich die Finger in den Mund. Monsieur Boum bläst ihr Rauch ins Gesicht. Die junge Frau geht in die Knie. Ächzend reibt sie sich die Augen. Monsieur Boum tut das nicht leid. Sie will es doch auch. Will auch, dass er frei ist. Er lässt sich nicht fassen vom Kescher der Weiber, in dem sich schon gute Männer verfingen. Während die junge Frau mit dem Rauch ringt, zwinkert er ihrem Gatten zu. Dieser zwinkert begeistert zurück und hält ihm einen Daumen hoch. Seine eigene Frau. Befeuchtet von Monsieur Boum höchstpersönlich. Heute Nacht wird er sie nehmen. So heftig wie jetzt der Stolz in seine Brust fährt, so will er dann in ihren Schoß fahren. Sofern er aus dieser Hölle heil herauskommt, versteht sich.
Frankreichs berühmtester Terrorexperte hat sich derweil abgewandt und spricht nun wieder zur Menge. »Mesdames, Messieurs, attention, s’il vous plaît!« Er klopft zweimal auf das Softpack. »Wir befinden uns ganz offensichtlich inmitten eines Attentats.« Mit den Zähnen greift er sich die vorstehende Zigarette. »Ein Attentat auf unsere Freiheit.« Er justiert sein Gemächt. »Auf unsere Werte.« Ein Mädchen mit blondem Bubikopf reicht ihm Feuer. »Und unsere unantastbare Würde.« Er zwickt dem Bubikopf zum Dank ins Gesäß. »Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie tun, was ich Ihnen sage.« »Was immer Sie wollen, Monsieur Boum«, haucht ihm der Bubikopf entgegen.
Monsieur Boum greift nach seinem Flachmann und nimmt einen kräftigen Schluck. Er drückt den Bubikopf fest an sich. »Falls Du hier heute sterben solltest …« »Sagen Sie doch sowas nicht!« Der Bubikopf gräbt sich in seinen Trenchcoat. »Doch! Du musst es hören!«, mahnt Monsieur Boum und zieht ihn wieder aus dem Mantel. »Falls Du hier heute sterben solltest … sage ich meiner Mutter, dass ich sie liebe.« Der Bubikopf schluchzt. »Bleiben Sie bei mir.« Lächelnd zeichnet Monsieur Boum den Verlauf der Träne nach, die ihr über die Wange floss. »Ich werde dich nie verlassen.« Dann stößt er sie von sich. »Ich werde keinen von Euch hier verlassen!« Die Menge jubelt. »Ehe ich nicht jede einzelne dieser feigen Knalltüten …« Das Jubeln schwillt an. »… zu Allah befördert habe!« Champagnerkorken fliegen durch die Luft. »Ich ziehe ihnen die Haut vom Kinn!« Champagnerflaschen fliegen zu Boden. »Auf dass fortan ihre Bärte die Glatzen der Franzosen schmücken!« Die Menge stimmt die Marseillaise an. Niemanden kümmert das Splittern von Glas. Die Schüsse der Korken. Der Gestank verbrannten Plastiks. Nicht einmal der dunkle Rauch, der aus einem der Mülleimer aufsteigt und längst durch die Halle wabert. Dieser trübt zwar die Sicht, aber keineswegs die Stimmung.
Monsieur Boum erstarrt. »Seht nur, dort!«, schreit er entsetzt und zeigt durch den Qualm hindurch auf das reglose Mädchen am Boden. »Da liegt schon die Erste! In ihrem Blut!« Da schmeißt er seinen Flachmann weg und rennt so schnell er kann davon. Sogleich ertönt ein lauter Knall. Dutzende Dinge wirbeln kreuz und quer durch die Halle. Dosen, Flaschen, Apfelbutzen. Ein brennendes Pappschild mit der Aufschrift »Monsieur B. Dubois«. Anscheinend war der Whiskey im Flachmann genau das, wonach der qualmende Mülleimer gierte.
Die Ersten fangen an zu brüllen. Andere wiederum halten das Brüllen für Kampfgeschrei von Terroristen und brüllen darum umso lauter. Sogar den beiden Terroristen, die hier nur auf Urlaub sind, ist die Sache nicht geheuer. Haben sie etwas nicht mitbekommen? War hier heute etwas geplant? Warum gab es dazu kein Rundschreiben? Es gibt für Terroristen kein schlimmeres Los, als zufällig bei einem Anschlag von Kollegen umzukommen.
Ein tapferer Jungspund hechtet zu dem reglosen Mädchen, um ihr vom Boden aufzuhelfen. Er bangt um sein Leben. Trotzdem kann und möchte er sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Erleichtert stellt er fest, dass sie noch bei Bewusstsein ist. Er reicht ihr seine Hand. Sie streckt ihren Arm aus. Gleich hat sie ihn. Nur noch ein bisschen. »Lass sie liegen. Die ist tot!«, brüllt jemand und packt den Jungspund an der Schulter. Dann rennen beide Richtung Ausgang. So tun es die meisten. Nur wenige verstecken sich. Manche öffnen ihre Koffer, leeren sie aus und kriechen hinein. Einige kauern sich still aufs Gepäckband und drehen darauf ihre Runden, um selbst als Koffer durchzugehen. Wiederum andere stellen sich tot. Wenn es ums Überleben geht, kennt die Phantasie keine Grenzen. Eine ältere Dame versucht sich in einer Art Mimikry. Sie hält ihren Gehstock wie ein Sturmgewehr in Händen und imitiert lautmalerisch ein Dauerfeuer. Sie fühlt sich dadurch sicherer. Die Panik aller anderen schmälert sie so freilich nicht. Zumal ihr die Toneffekte dank ihrer losen Zahnprothese leider täuschend echt gelingen.
Nach einigen Minuten kehrt Ruhe in die Halle ein. Nur draußen wird noch getobt und geschrien. Da liegt sie nun. Auf ihrem Rucksack aufgebahrt wie ein umgewehter Käfer auf seinem Panzer aus Chitin in einer Lache aus Chianti. Völlig allein. Unfähig sich zu erheben. Das geschieht ihr recht, denkt sie sich. Sie muss dem Wüstling dankbar sein, der ihren Sturz verschuldet hat. Der hat sie vor der Schmach bewahrt, einem Franzosen einen Rotwein als Präsent mitzubringen. Noch dazu einen aus Italien. Was hat sie sich dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Wie so oft.
In die Ruhe rammen sich die Absätze von Stöckelschuhen. Wahrscheinlich eine, die sich versteckt hat und nun schnell nach draußen rennt. Na, hoffentlich steigt sie ihr nicht auf die Finger. Das müssen ganz schöne Kaliber sein, die die da an den Füßen trägt. Wieso wird das Geklapper denn immer lauter? Sie dreht ihr Köpfchen zur Seite. Neben ihr steht ein roter Stöckelschuh, aus dem ein stark behaartes Bein ragt. Auch das Bein daneben ist behaart. Allerdings endet dieses nicht in einem Schuh. Zumindest in keinem herkömmlichen. Ein dicker Stapel Zeitungen. Mit Unmengen von Klebeband am bloßen Fuß befestigt. Die Spitze des roten Stöckelschuhs hebt sich und tritt nun von hinten sachte gegen ihren Rucksack. In Zeitlupe kippt Gepäcksstück samt Mädchen.
Sie rappelt sich auf. Ihre Mundwinkel haben sich zurück in ihren Rahmen verzogen. Sie senkt den Kopf und räumt endlich die Ankunftsschneise. Beschämt sinkt sie auf einen der Stühle, die für die Abholer gedacht sind. Dort wartet sie und macht sich Sorgen. Was, wenn ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist? Vielleicht stürzte er vor lauter verliebter Hast die Treppe hinunter. Vielleicht kam er schon viel früher, um sie nur ja nicht zu verpassen, schlief in der Halle ein und wurde entführt. Vielleicht kaufte er ihr Blumen, auf die er allergisch ist, woraufhin er schwindlig auf die Gleise fiel, als die Métro in die Station fuhr und sie ihn unter sich zermalmte. Sie läuft zum nächsten Münztelefon. Es klingelt. »Allô?«
5
Es gibt auf der Welt zwei Dinge, die den Charakter verlässlich verderben: Reichtum und Armut. Aloisia blieb von beidem verschont. Sie hatte eine unbeschwerte, eine geradezu schmerzfreie Kindheit. Nirgendwo an Leib und Seele leuchten schlecht verheilte Narben ehemals offener Wünsche und Wunden. Sie begehrte wenig und das bekam sie. Ihr eigenes Blut sah sie zum ersten Mal mit dreizehn und nicht einmal das tat weh. Mit verständnisloser Neugier verfolgte sie die Leiden ihrer Altersgenossen. Knaben schürften sich die Knie auf, als ob sie keine Schmerzen kannten. Mädchen schnitten sich die Arme, als ob sie nichts als Schmerzen kannten. Knaben prahlten, sie seien unverwüstlich. Und dass sie sich verletzen könnten, ohne dabei etwas fühlen zu müssen. Mädchen seufzten, sie seien hochsensibel. Und dass sie sich verletzen müssen, um dabei etwas zu fühlen. Aloisia hatte Glück. Die ominöse Pubertät — wenn Knaben beginnen, sich Gefühle auszutreiben, und Mädchen, sie sich einzureden — ging spurlos an ihr vorüber. Aloisia wurde im selben Jahre aufgeklärt, in dem sie auch entjungfert wurde. So etwas ist äußerst selten und wird immer seltener. Zwischen diesen Ereignissen liegen oftmals viele Jahre. Nicht jeder erlebt mehr beides. Manche werden entjungfert und wissen nie, was sie tun. Manche werden aufgeklärt und tun nie, was sie wissen.
Nach der Volksschule schickten ihre Eltern Aloisia auf ein städtisches Gymnasium. Dieses lag vom ländlichen Heim vierzig Kilometer entfernt, was jeden Tag drei Stunden Busfahrt verhieß. Aloisia nahm das bereitwillig auf sich, um nicht ins Internat zu müssen. Auch die Eltern waren froh, die Tochter nachts im Haus zu wissen. Sie hatte liebevolle Eltern. Zum Streit senkten sie die Stimmen und zur Versöhnung ebenso.
Aloisia ging gern zur Schule. Sie tat sich beim Lernen leicht, und die Lehrer mochten sie. Enge Freunde hatte sie nicht, doch das nahm sie nicht persönlich. Sie wurde schließlich nicht gemieden, sondern nur einfach nicht bemerkt. Sie war nicht hässlich genug für die Spötter und nicht schön genug für die Neider. Sie war weder dick noch dünn. Ihre Figur schien unentschlossen. Und genauso unentschlossen waren dadurch die Lästermäuler. Über der Frage, womit man sie hänseln solle, gerieten sich diese oft gegenseitig in die Haare.
Aloisia war kein Bücherwurm wie die anderen ohne Freunde. Diese fraßen sich in Papier oder gaben sich Tagträumen hin. Aloisia tat nichts dergleichen. Sie floh nicht in fremde Welten. Ihr gefiel es gut in dieser. Wo es derart viel zu sehen gibt. Und sogar noch mehr, wenn man selbst nicht gesehen wird. Manche Lehrer, die es besonders gut mit ihr meinten, rieten ihr, sie solle nicht so schüchtern sein. Aloisia war das sehr peinlich. Schließlich war sie ja nicht schüchtern. Es gab einfach nichts, was sie die anderen fragen wollte. Nichts, was sie ihnen sagen wollte.
Aus dem Spagat zwischen Stadt und Land sind schon kuriose Mischwesen gekrochen. Der hoffnungslose Katholik. Der wählerische Hurenbock. Bedauerlicherweise saugen die meisten das Schlimmste beider Sphären auf. Keine Zentauren mit tierischer Kraft und menschlichem Sinn. Sondern eher Minotauren mit dünner Haut und dicken Schädeln. Aloisia dagegen erhielt von beiden Sphären nur das Beste. Das war freilich nicht ihr Verdienst. Sie war eben immer zur rechten Zeit am rechten Ort.
Wenn sie abends heimkam, sah sie, wie sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Sie sah nicht, wie tagsüber Fuchs und Hase die Flinte des Jägers entwendet und diesen totgeschossen hatten. Sie sah nicht, wie der Bürgermeister mit hartem Schweif der Jägersfrau sein Beileid ausgesprochen hatte. Sah nicht, wie sich die Jägersfrau hierfür die Tränen von den Wangen in ihren trockenen Schoß gewischt hatte.
Wenn sie morgens ankam, sah sie, wie sich die Schüler für die Lehrer erhoben, wenn diese in die Klasse traten. Sie sah nicht, wie sich nachts die Schüler für die Lehrer niederknieten. Wie sie sich erst erheben durften, wenn der Lehrer nicht mehr stand. Sie sah Mädchen die Ohren spitzen. Sie sah sie nicht die Schenkel spreizen. Sie sah nicht, mit welchen Säften die Aufseher des Internats den Wissensdurst der Schüler löschten. Sie sah nicht, wie die drei Maturanten diesen Unterstufler packten, ihn hinaus vom Schulgelände ins benachbarte Laufhaus zerrten, um ihn dort von der billigsten Dirne deflorieren zu lassen.
Wahrscheinlich ist es egal, wo man aufwächst. Stadt oder Land — das nimmt sich nichts. Die Städter, die tun, als wüssten sie alles. Die Ländler, die tun, als wüssten sie nichts. Die Ländler verbreiten Lügen über andere. Die Städter Lügen über sich selbst. Manche Laster heißen anders und bezeichnen doch das Gleiche. Andere Laster heißen gleich und bezeichnen etwas gänzlich anderes. Blutschande schimpft man in der Stadt Verkehr mit der Familie. Am Land Verkehr mit Farbigen. Hier sündigt man bevorzugt tagsüber. Draußen im Licht. In der Stadt dagegen nachts. Drinnen im Dunkeln. Als könne das Laster nie an zwei Orten gleichzeitig sein. Ebenso wenig wie die Tugend. Sie laufen voreinander fort und einander hinterher, ohne sich je zu erwischen.
Aloisia schultert ihren riesigen Rucksack. In den Augen ihrer Eltern flimmert nur die eine Frage: Wird das Kind je wiederkehren? Aloisia wäre gerührt, wäre es nicht dieselbe Frage, die sie sich jeden Morgen stellen, wenn sie den Bus zur Schule nimmt. Es ist sogar derselbe Blick. Mit derselben Menge Kummer und derselben Menge Angst. Nicht mehr und auch nicht weniger. Für Aloisia dagegen ist es ganz und gar nicht dasselbe. Sie nimmt nicht nur den Bus nach Graz. Sondern auch den Zug nach Wien und das Flugzeug nach Paris. Ihren Eltern scheint das einerlei. Sie machen zwischen Paris und Graz ebenso wenig Unterschied wie zwischen Sodom und Gomorrha. Stadt bleibt Stadt. Sie steigt in den Bus. Die Eltern ziehen ab, noch ehe sich die Türen schließen. Aloisia winkt ins Leere. So ist das wohl mit Eltern, die immer übertrieben besorgt sind. Wenn es wirklich einmal ernst wird, haben sie keine Reserven mehr. Dann wirken sie so sorglos, dass es kränkend ist. Macht ja nichts, denkt sich Aloisia. Das war nicht der perfekte Abschied. Dafür wartet in Paris das perfekte Wiedersehen.
6
Einem Mann soll man nichts nachtragen. Weder den Koffer noch einen Fauxpas. Nach einer halben Stunde Fahrt in der RER B ist sie ihm also schon gar nicht mehr böse. Junge Leute vergeben schnell. Viel schneller als die Alten. Denn vergeben heißt vergessen. Die Alten vergessen genug aus Versehen. Das wollen sie nicht auch noch vorsätzlich tun. Sie aber vergisst noch gerne. Wie etwa die Tatsache, dass er sie bisher niemals vom Flughafen abgeholt hatte. Dass sie bisher jedes Mal in der Ankunftshalle stand. Erst rätselte, dann zweifelte, dann bangte, kurz danach grollte und schlussendlich die RER nahm. Allein. Doch dieses Mal ist etwas anders. Dieses Mal will sie ihm noch schneller verzeihen als sonst. Denn dieses Mal kommt sie ja nicht zu Besuch.
Anstelle der Treppe nimmt sie die Tür zum Innenhof. Wobei das Wort Innenhof gewiss falsche Vorstellungen weckt. Es ist eher ein quadratischer Schacht. Gerade einmal zwei Armlängen breit. Ohne sich weit aus den Fenstern zu lehnen, könnten sich die Bewohner derselben Etage die Hand geben. Das tun sie selbstverständlich nicht. Die meisten hier würden ihre Fenster niemals öffnen, weil sonst der Gestank der Mülltonnen in ihre Wohnungen kriecht. Die stehen nämlich im Innenhof. Dafür ist er da und mehr hat auch nicht Platz. Eine Person, die ihren Müll entsorgt, passt gerade noch mit rein. Sofern sie nicht allzu dick ist. Aloisia zwängt sich in den Innenhof und stellt ihren Rucksack ab. Ihr fällt der Gestank nicht auf, weil sie ja selber ganz fürchterlich nach Chianti riecht. In der RER B war sie die Hauptattraktion. Die Blicke sind ihr nicht entgangen. Sie war sich jedoch sicher, dass es nicht am Wein per se, sondern am Chianti lag. Was hat sie sich dabei nur gedacht?
Sie klappt eine der Mülltonnen auf und beginnt darin zu wühlen. Dann entledigt sie sich eilig ihrer Schuhe, ihrer Socken, ihrer Hose, ihres Hemds. Die Sachen stopft sie allesamt in den großen Plastiksack, den sie aus dem Müll gefischt hat. Indessen blickt sie immer wieder an den Mauern empor. Sämtliche Fenster sind geschlossen. Keiner schaut hinaus, nicht hinauf und nicht hinunter. Was gäbe es da schon zu sehen? Ein quadratisches Stück Himmel, überquellende Mülltonnen und ein nacktes Mädchen. Doch Letzteres stellt eine Ausnahme dar und selbst das klingt noch zu häufig. Damit rechnet wirklich keiner, weswegen auch keiner rausschaut. Man will sich schließlich nicht unglücklich machen. Und Tag um Tag das Fenster öffnen, in der hoffnungsvollen Erwartung, ein nacktes Mädchen zu erblicken, ist ein Schleichweg zum Unglücklichsein. Sogar heute. Denn völlig nackt ist es ja nicht. Dieses Mädchen, das gerade ein Paar schwarzer Pumps mit roter Sohle aus ihrem Rucksack hervorkramt. An deren Stelle stopft sie nun den Plastiksack mit ihrer Kleidung, macht den Rucksack wieder zu, quetscht ihn zwischen zwei Tonnen und verdeckt ihn mit ein paar Kartonagen aus der Altpapiertonne. Dann huscht sie ins Haus.
Im dritten Stockwerk hält sie inne, um in ihre Lungen Luft nachzufüllen. Sie will ihm nicht hechelnd wie ein Pflugvieh erscheinen. Sie will lediglich erscheinen. Deswegen trägt sie die Pumps in der Hand, um sich durch den Lärm nicht zu verraten. Erst im letzten, sechsten Stockwerk wird sie in die Schuhe schlüpfen und an seiner Türe klopfen. Und er, er wird seinen Augen nicht trauen, weil er keinen Schritt gehört hat. Weder von oben noch von unten. Auf Zehenspitzen zieht sie los ins vierte Stockwerk. Ein Schrei geht durch das Treppenhaus. Aloisia bleibt stehen und horcht. Nichts. Sie wartet ab, dann schleicht sie eine Stufe höher. Da ist er wieder. Dieser Schrei. Der gleiche Schrei wie gerade eben. Wieder bleibt sie stehen und horcht. Und wieder ist da nichts.
Sie schüttelt amüsiert den Kopf. Das war sicher nur da drinnen. In ihren Ohren. Dort hat sich vorhin am Flughafen etwas von dem Geschrei verfangen. Wie Wassertropfen nach dem Tauchen. So schwappen ihr jetzt kleine Schreie durch den Gehörgang. Aloisia hält sich Mund und Nase zu und versucht dann auszuatmen. Just erklingt der nächste Schrei. Das hat also nicht geklappt. Sie klopft sich fest auf beide Ohren. Sie schluckt, sie gähnt, sie kaut. Endlich kommt es ihr. Die Treppe. Es ist die Treppe, die da schreit. Das tut ihr jetzt leid. Wie aber sollte sie das ahnen? Gewöhnlich knarzen Treppen doch. Sie ächzen, krächzen, seufzen, stöhnen. Aber dass eine schreit wie am Spieß? Als wären ihre Stufen Zehen, auf die man nicht zu treten hat. Das hat sie noch nie erlebt. Aber gut. Aloisia nimmt zwei Stufen auf einmal. Die Treppe schreit. Sie stützt sich auf das Geländer. Die Treppe schreit. Lauter noch als zuvor. Sie schlüpft mit ihren bloßen Füßen zwischen die Sprossen des Geländers und klettert daran empor, ohne die Stufen zu berühren. Das Geländer schreit. Aloisia schüttelt ärgerlich den Kopf. Das wird so nichts. Sie holt tief Luft und sprintet los. Drei Stufen auf einmal. Sprung auf Sprung auf Sprung auf Sprung. Schrei auf Schrei auf Schrei auf Schrei. Immer heller, immer schriller. Die Treppe schreit eine Tonleiter des Schmerzes.
Im fünften Stockwerk hält sie inne. Die Treppe wimmert noch ein wenig nach. Aloisia überkommt die große Lust zurückzuschleichen. Nach unten in den Innenhof. In die RER B. In das Flugzeug. Nach Hause. »Il y a quelqu’un.« Eine Stimme. Aus dem sechsten Stockwerk. »Vas-y, rentre!« Eine Frauenstimme. »Mais pourquoi?« Eine Männerstimme. »T’as honte ou quoi?« Nein, keine Männerstimme. Seine Stimme. Aloisia schlüpft entschlossen in die Pumps und bricht zum Gipfel auf. Die Treppe schreit, und trotz des schicken Schuhwerks alles andere als lustvoll. Diese verräterische Schlange. Zu gern würde Aloisia die Bretter erhobenen Hauptes bezwingen. Aber das vermag sie nicht. Wie Steigeisen rammt sie ihre Blicke in die Stufen. Das hält sie fest. Schaut sie vom Boden weg, stürzt sie. Selbst auf ebenstem Asphalt. Sie muss sehen, was vor ihr liegt. Es lediglich zu wissen, reicht nicht.
Die Tür zu seinem Appartement ist offen. Er selbst lehnt im Türrahmen. Nackt bis auf die Seidenshorts, die sie ihm letztes Mal geschenkt hat. In einer Haltung, die man wohl am besten als lässig beschreibt. Vor ihm ein Wesen. Eine Erscheinung. Ausgerechnet an der Stelle, wo sie ihm gern erschienen wäre. Nun aber scheint da etwas anderes. So hell, dass es wehtut. Sie scheint dagegen gar nicht. Sie ist. Sie ist nur ein Batzen plumpes, dunkles Sein. Das Wesen dreht sich zu ihr um. Aloisia blinzelt. Es spricht. »C’est elle?« Er grinst voller Stolz. Ohne eine Spur von Häme. »Ta petite Autrichienne?« Das Wesen spricht, ohne die Lippen zu bewegen. Gleich einem Bauchredner. Nur ohne Puppe. Ihr Mund steht stets einen Spalt geöffnet. Ein staunendes Kind. Ein gelangweilter Gott. Von allem entzückt und von allem enttäuscht. Aloisia fühlt sich wie Ramsch. Das Wesen schwebt auf sie zu. Billigster Ramsch, der froh sein kann, wenn er auf dem Grabbeltisch abschätzig befingert wird, ehe man ihn liegen lässt. »C’est joli, ça«, haucht ihr das Wesen fast stimmlos entgegen und deutet auf Aloisias rosa Bustier, das natürlich auch Ramsch ist. Vermutlich von einem Kind genäht, das noch nicht einmal Brüste hat und gar nicht wusste, was es da herstellt. Das Wesen hat Brüste, wenngleich sehr kleine. Man kann sie ganz deutlich durch ihre weiße Bluse sehen. »Alors, je vous laisse.« Unter dem Wesen schreit die Treppe freilich nicht. Das Wesen ist fort. Doch man kann es noch riechen. Scheinbar zieht es seinen Duft wie eine endlose Schärpe hinter sich her. Sie dagegen stinkt. Nach altem Schweiß und schwerem Wein. Sie riecht vergoren. Dabei dürfte sie jünger sein als dieses Wesen. Ein paar Jahre mindestens. Vielleicht sogar ein paar hundert. Er verlässt seinen Türrahmen und schlendert grinsend auf sie zu. Wie lange er nur küssen kann, ohne dabei Luft zu holen. Sie ringt nach Atem. Nun hechelt sie erst wie Pflugvieh. Er schnappt sich eins der rosa Bändchen, die von ihrem Bustier baumeln, und zieht sie wie ein entlaufenes Tier in den Stall.
Er rückt den Träger ihres Bustiers zurecht, der ihr von der Schulter rutschte, als sie rücklings auf ihm saß, sowie das lose baumelnde Strapsband, das sich von den Strümpfen löste, als sie auf allen vieren kniete. »Elles sont où, tes affaires?« Sie schaut ihn verständnislos an. Er zeigt auf ihren halbnackten Körper. Sie öffnet ihr Bustier. Er lacht laut auf und schließt es wieder. »Ton sac à dos.« Er tut so, als schultere er einen Rucksack. Sie zeigt auf den Boden. Er runzelt die Stirn. Sie zeigt erst auf den Mülleimer und dann wieder auf den Boden. Wieder lacht er auf und küsst sie. Er küsst sie so lange, bis ihre Fingerspitzen taub werden. Dann kocht er Kaffee aus Pulver. Nach zwei Tassen Cappuccino und drei weiteren Orgasmen (zwei für ihn und einer für sie) zieht er sich wortlos an und verlässt das Studio.
Aloisia entledigt sich eilig ihrer Strümpfe, ihrer Strapse, ihres Bustiers und erhebt sich aus dem Bett. Der Parkettboden beißt die Zähne zusammen. Sie schleicht auf Zehenspitzen ins Bad, öffnet dort das Fenster und schaut in den Innenhof zu den Mülltonnen hinunter. Er zerrt gerade ihren Rucksack unter den Kartonagen hervor. Es ginge wohl schneller, würde er beide Hände nehmen. Doch die eine braucht er, um sich die Nase zuzuhalten. Aloisia erschrickt. Das Fenster gegenüber ist offen. Darin lehnt ein alter Mann, der in den Innenhof hinabblickt. Sie verschränkt sofort die Arme, um ihre Brüste zu verdecken, und will soeben das Fenster schließen, da zischt plötzlich jemand: »Pst!« Das muss sie selbst gewesen sein. Der alte Mann blickt zu ihr hoch. Sie lässt ihre Arme sinken.
7
In seinen Zwanzigern hatte Romain eine spezielle Technik, um eine Frau für sich zu gewinnen. Und zwar nicht nur irgendeine. Die schönsten Mädchen von Paris haben sich so auf seiner Matratze verewigt. Dabei hatte er kaum Geld. Es reichte gerade, um zweimal pro Woche einen Nachtclub aufzusuchen. Zwanzig für den Eintritt und zwanzig für die Taxifahrt. Mehr brauchte er nicht. Romain suchte sich stets ein Plätzchen, von dem aus er den gesamten Club überblickte. Nie gab er einem Mädchen ein Getränk aus. Er trank nicht einmal selbst etwas. Das hätte sowohl sein Portemonnaie als auch seine Konzentration strapaziert. Ihm durfte schließlich nichts entgehen in diesem grellen Wimmelbild aus Gefingere und Gefummel. Wachsam verfolgte er das Turteln auf der Tanzfläche oder das Poussieren an der Bar. Je nachdem, worauf er an diesem Abend Gusto hatte. Die Mädchen in den Clubs besitzen einen guten Körper oder ein gutes Gesicht. Beides haben die wenigsten. Und die mit nichts trauen sich nicht her. Die mit den guten Körpern tummeln sich vorzugsweise auf der Tanzfläche. Da fliegen ihre langen Haare und verdecken zuverlässig überschüssiges Gesicht. Die mit den Engelsmienen sitzen lieber an der Bar und spielen mit den Teelichthaltern, um sich perfekt auszuleuchten, während ihre dicken Schenkel unter der Theke verschwinden.
Romains Aufmerksamkeit galt allerdings nicht den Mädchen, sondern ausschließlich den Männern. Sie waren es, die er beobachtete. Und irgendwann, manchmal schon nach zehn Minuten, manchmal erst in den Morgenstunden, fand er seinen Mr. Right. Den Filou, der einem Mädchen heimlich Rohypnol ins Glas mischt. Meistens geschieht das, während die Mädchen auf dem Klo sind. Das Risiko ist vielen bekannt. Deswegen versuchen sie die Getränke mitzunehmen. Der versierte Filou weiß dies freilich zu verhindern, indem er den Mädchen krankhaftes Misstrauen oder Trunksucht unterstellt. »Was? Du hältst es keine zwei Minuten ohne einen Wodka aus? So eine bist du?« Und schon lässt sie ihr Glas am Tresen. Wenn sie zurückkommt, soll es schnell gehen. Der Filou animiert das Mädchen zügig auszutrinken. Am besten mit einem flotten Spruch: »Du warst aber lange am Klo. Warst du groß?« Man würde meinen, es wäre der Mann, der sich hierfür schämen würde. Stattdessen ist es stets das Mädchen, das vor Scham den Cocktail ext. Von da an dauert es zwanzig Minuten, bis sie anfängt sehr laut, sehr lustig oder anderswie seltsam zu werden. Der Filou will möglichst vorher mit ihr abhauen. Sie sollte noch bei Sinnen sein, ihren vielen Freundinnen und dem Barkeeper brav winken, damit sich keiner Sorgen macht.
Hier aber kam Romain ins Spiel. Kaum, dass die beiden aufbrechen wollten, verließ er seinen Ausguck und flitzte leise auf sie zu. Er polterte der Maid nicht reckenhaft zu Hilfe. Er schlug ihr nicht das Glas aus der Hand oder dem Filou einen Zahn aus. Das hätte zu großes Aufsehen erregt. Romain wollte lediglich der Held eines Mädchens sein und nicht der des ganzen Clubs. Das hätte das Ende seiner genialen Methode bedeutet. Die Mädchen wären ihm zugeflogen. Ihm — dem Schutzpatron der Flittchen. Doch um die Flittchen ging es ihm nicht. Es war ihm ein Bedürfnis, diesen Filous einen Coup zu versauen. Sie widerten ihn aufrichtig an. Diese Männer, die ein Mädchen nicht aus eigener Kraft ins Bett kriegen. Besonders verabscheute er jene, die die Drogen gar nicht brauchten. Jene, die das Mädchen schon nüchtern in der Tasche hatten. Warum es also benebeln? Um sich beim Sex nicht bemühen zu müssen? Damit sie sich am nächsten Morgen nicht an seinen kleinen Schweif erinnert? An die ekelhafte Wohnung? Ist das die Frage, die sich diese Männer stellen? Die Wohnung aufräumen oder die Gäste einschläfern? Romain täte beides nicht. Er war nie ein Freund des Aufräumens und auch nie ein Freund von Drogen. Sowie jeder Form von Doping. Vor allem nicht beim Liebesspiel. Sowohl für sie als auch für ihn. Kein Rohypnol und kein Viagra. Wenn er nicht kann und sie nicht will — Pech gehabt. Eine Frau nicht zu betäuben hat nichts mit Respekt zu tun, sondern allein mit Selbstrespekt.
Der Filou zog einige Scheine aus seiner Geldspange und legte sie dem Barmann hin. »Sie haben dieser jungen Dame eine Substanz ins Glas gemischt.« Romain sprach gerade so laut, dass es auch das Mädchen hörte. Dieses erschrak. Sogleich inspizierte es sein halb geleertes Glas. Erst hielt sie es gegen das Licht. Dann roch sie an der Flüssigkeit. »Das riecht ganz normal. Bist du sicher, dass er mir …?« Romain nickte. Das Mädchen erschrak erneut. Der Filou blieb ruhig. Wenigstens nach außen hin. Er musterte Romain. Ein schmächtiger Kerl. Nicht sonderlich groß. Ein, zwei Schläge und der liegt am Boden. Doch bis dahin liegt auch sein Mädchen, das soeben einen weiteren Schluck genommen hatte. »Das schmeckt aber normal«, lallte es fröhlich. »Da, koste mal …« Sie hielt Romain das Glas hin. Dieser lehnte ab. »Dann koste du!« Sie drehte sich zu dem Filou, doch dieser war bereits verschwunden. Romain dirigierte sie nun schleunigst in Richtung Ausgang. »Glaubst du wirklich, dass er mir …?« Mädchen sind schon etwas Liebes. Sie halten fest an der Unschuldsvermutung. Auch wenn der Filou enttarnt und bußfertig geflüchtet ist. Und unter Drogen sind sie gleich doppelt tolerant. Zum Glück konnte Romain noch jeder versichern, was für ein Riesenglück sie hatte, soeben durch ihn gerettet zu werden. Noch dazu in letzter Sekunde. »Haarscharf war das. Haarscharf.«
»Hab keine Angst. Ich bring dich nach Hause«, hauchte Romain, während er ihr ins Taxi half. Und selbstverständlich hielt er Wort. Gleichwohl war jedes der Mädchen verblüfft, wenn sie letztlich nicht vor ihrem, sondern seinem Zuhause standen. Den Drogen sei Dank machte keine je eine Szene. Jede suchte die Schuld verlässlich bei sich. Sicher hat er es ihr gesagt. Sie womöglich gar gefragt. Für das Kleingedruckte war sie jedoch zu weggetreten. Ihr Fehler. Und seien wir uns ehrlich. Selbst wenn er sie hätte heimbringen wollen, wäre sie außerstande gewesen, ihm die korrekte Adresse zu nennen. Dann wären die zwei stundenlang im Taxi durch Paris gegurkt. Hoffend, dass sie die Fassade ihres Hauses wiederfindet. Sie wäre wie ein Hund aus dem Fenster gehangen, hätte sich abwechselnd daraus erbrochen und »Das hier ist es! Ganz sicher!« gerufen.
Bei sich zu Hause rührte Romain zunächst für seinen Gast einen Muntermacher zusammen. Ein Spezialmix aus Kiwis, Milch und polnischen Brausetabletten für Fernfahrer. Diese Mädchen kamen vielleicht nicht ganz aus freien Stücken mit, doch den Sex sollten sie schon wollen. Ihm lag nichts an ihrem Einverständnis, doch sehr viel an ihrem Einsatz. Romain lehnt sich gern zurück. Dafür muss ein Mädchen nicht nur bei Bewusstsein, sondern auch bester Laune sein. Männer, die Frauen zum Oralverkehr zwingen — die sind doch lebensmüde! Jedenfalls sind sie keine Genießer. Wie Romain. Und als solcher kann er warten. Meistens sah er einen Film, während die Mädchen delirierten. Nach etwa zwei Stunden waren sie wieder auf dem Damm und bereit sich zu bedanken.
Doch all das war früher. Inzwischen ist Romain Ende dreißig und präferiert Eroberungen bei Tag und an der frischen Luft. Es war also blanker Zufall, dass er sich damals ebenfalls im Club Silencio aufhielt. Am selben Abend wie sie. Aloisia war in Begleitung eines amtlichen Perversen, welcher sie erst Stunden vorher in der Cité des Sciences angesprochen hatte. Erwachsenen Männern, die sich dort herumtreiben, ist grundsätzlich zu misstrauen. Vor allem vormittags unter der Woche. Zu dieser Zeit findet man dort nur Schulklassen auf Exkursion. Auch sie war dort als Schülerin mit ihren Klassenkameraden. Er sprach sie im Planetarium an. Sie wusste sofort, dass er ein Filou war. Gekommen, um ein Schaf zu reißen. Es zunächst von der Herde zu trennen und es sich später einzuverleiben. »Tu fais quoi ce soir?« Der Filou schien nicht unglücklich darüber, dass sie kein Französisch sprach. Er zückte ein Notizblatt, reichte es ihr und verschwand. Sie blickte sich um. In ihrer Klasse gab es sehr schöne Mädchen. Weitaus schönere als sie. Dass der Perverse ausgerechnet sie ansprach — darauf war sie mächtig stolz. Deshalb log sie an dem Abend ihre Gastfamilie an und schlich sich ins Silencio.
Man kann es wohl nur Liebe nennen, dass Romain in dieser Nacht einschritt, noch bevor sie einen Schluck von dem vergifteten Getränk nahm. Das hatte er noch nie getan. Sonst hatte er stets abgewartet. Das erschien ihm heldenhafter. So befreite er die Mädchen aus den Fängen des Filous und dank seines Muntermachers auch aus den Fängen des künstlichen Tiefschlafs. Er ließ erst das kleine Verbrechen geschehen und vereitelte dafür das große.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























