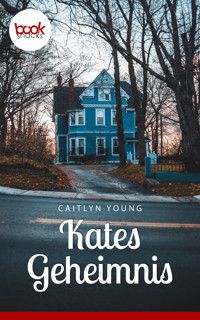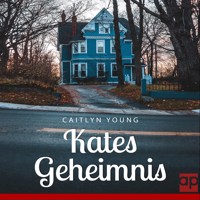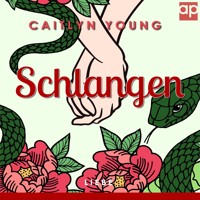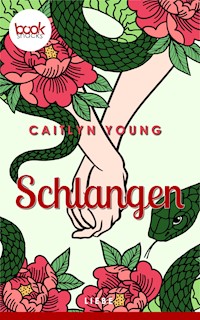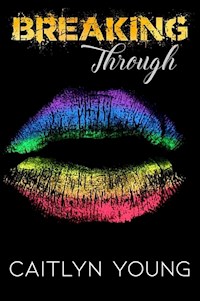
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elysion Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 26-jährige Celeste Myers startet hochmotiviert ihren Traumjob als Journalistin in Chicago. Dort wohnt auch ihr Bruder Milo, von dem sie sich seit vielen Jahren entfremdet hat. Er ist auf den legendären Partys des Kunst- und Drogenhändlers Keith Howards auf Abwege geraten. Auch die aus einfachen Verhältnissen stammende, dunkelhäutige Jamila Smith ist Keiths Machtspielen zum Opfer gefallen. Als sich die Wege der beiden jungen Frauen bei Celestes Recherche zu Überfällen im Umfeld des Kunsthändlers kreuzen, entwickelt sich zwischen den beiden ungleichen Frauen rasch eine Freundschaft – und mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Breaking Through
Caitlyn Young
Breaking Through
Caitlyn Young
Elysion-Books, Leipzig
ELYSION-BOOKS
1. Auflage: Mai 2022
VOLLSTÄNDIGE AUSGABE
ORIGINALAUSGABE
© 2022 BY ELYSION BOOKS, LEIPZIG
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert
Coverbild: Francessca´s PR & Designs
LAYOUT &WERKSATZ: Hanspeter Ludwig
www.imaginary-world.de
ISBN (vollständiges Ebook) 978-3-96000-209-3
ISBN (vollständiges Buch) 978-3-96000-208-6
www.Elysion-Books.com
In Träumen, die mich wecken, jagen,
erfahre ich, was mich befreit.
Nur dann, allein, in andren Welten,
spür ich in mir die Ewigkeit.
Celeste Myers
Teil eins: Der Aufbruch
Celeste
Ich hatte nie einen Mann geliebt. Jedenfalls nicht so, wie man es aus Filmen kannte. Vielleicht war mein acht Jahre älterer Bruder Milo schuld daran, dass ich ein negatives Bild von den Männern hatte und mein Interesse an ihnen schon zu Schulzeiten gedämpft gewesen war. Ein Junge in meiner Englischklasse war damals in mich verliebt gewesen und hatte mir klein gefaltete Zettel über drei Mitschüler hinweg zugeschoben, auf denen immer schlüpfrigere Zeilen standen, aber ich war kalt geblieben wie ein Stein.
Wir gehörten zu den wenigen Familien in der ländlichen Gegend von Madison, Wisconsin, die nicht alle drei Jahre umzogen. Das lag daran, dass mein Vater zusammen mit seinem Zwillingsbruder eine erfolgreiche Anwaltskanzlei führte. So blieb ich da, wo ich mich pudelwohl fühlte: in meinem gewohnten Umfeld in unserem zweistöckigen Haus mit der weißgetünchten Veranda und den hellgrauen Fensterladen, mit dem runden Teich mit einem Springbrunnen neben der hufeisenförmigen Einfahrt und den Gänsen, die dort badeten. Wenn es im Sommer schwülheiß wurde, saß ich abends oft auf der blauen, schattigen Bank hinter dem Haus und hing meinen Gedanken nach.
Zur Schule ging ich gern, der Schulbus hielt direkt vor dem Haus. Ich war die Königin des Debattier-Clubs, turnte bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr ausgiebig und spielte später Lacrosse, verfiel jahrelang der Seidenmalerei und besuchte sonntags andächtig mit meiner Familie die Messe. Das Leben war schön und wenigen Veränderungen unterworfen.
Meine beste Freundin Liz fragte mich eines Tages nach dem Sexualkundeunterricht, der für ihren Geschmack zu theoretisch war, ob ich ihr erzählen könne, wie ein nackter Mann aussah, denn bei ihnen zu Hause blieben Bade- und Schlafzimmertüren stets verschlossen.
»Ich habe nur Milo gesehen«, gab ich zu, denn meine Eltern waren wohlhabend, konservativ und somit prüde. »Zwischen seinen Beinen hängen sein Ding und seine Hoden wie ein ausgedienter Luftballon. Und er rasiert sich die Haare unten ab.« Es war für mich nicht weiter interessant.
»Ehrlich?« Liz machte große Augen und kicherte wie schon im Kindergarten, nachdem wir den großen Jungs einen Streich gespielt hatten.
»Es ist nicht sonderlich attraktiv«, sagte ich, um das Thema abzuhaken, und Liz verstand es sofort.
Ich hatte schon mit zwölf Jahren das bestimmte Gefühl, dass zwischen den Frauen und Männern dieser Welt unterschwellig ein erbitterter Krieg ausgefochten wurde. Das Klirren der Klingen drang nur manchmal an die Oberfläche. So zum Beispiel, wenn Mom sich mit einer Wärmflasche auf dem Unterbauch auf dem Sofa in ihre Lieblingsdecke einkuschelte und Dad einen vorwurfsvollen Blick zuwarf, weil er nicht daran dachte, die Küche aufzuräumen. Wenn Tante Esther, Moms jüngere Schwester, zum Sonntagsbrunch aus Chicago kam und Dad wie ein Gepeinigter in seine Man Cave im Untergeschoss verschwand und am Abend vor sich hin brummte, Mom habe immer nur Zeit für andere. Wenn ich merkte, dass Mom Kummer hatte, Dad sie aber nicht in den Arm nahm. Die beiden führten keine schlechte Ehe und es gab nur selten Krach, aber ich empfand sie nicht als Einheit. Es schien, als stieße vieles, was der eine tat oder nicht tat, auf Unverständnis auf der Seite des anderen, und ich fragte mich, warum sich Menschen das antaten. Am wenigsten Krach gab es dann, wenn Mom und Dad unabhängig voneinander beschäftigt waren. Ich wollte niemals heiraten.
Bis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr schaffte ich es, Jungfrau zu bleiben. Nicht, weil ich unattraktiv war, sondern weil ich das widerliche Verhalten meines Bruders Milo in vielen Vertretern der männlichen Rasse wiederfand und mich sofort angeekelt abwandte. Milo brachte schon mit fünfzehn seine erste Freundin nach Hause, die drei Jahre älter und zwei Köpfe größer war als er. Ich spähte neugierig durch den Türspalt meines Zimmers. Wenn sich beim Abendessen unsere Blicke trafen, dann lächelten wir beide. Sie gekonnt, ich mit Mühe. Mom führte gewieft Smalltalk, während Dad schweigsam seinen Eintopf löffelte. Milos Flamme hatte stark geschminkte, braune Augen, war gertenschlank und trug einen so kurzen Rock, dass man ihren schwarzen Schlüpfer sah, wenn sie sich hinsetzte. Sie saß nur ein einziges Mal am Esstisch und auf der Ledercouch unserer Eltern, danach traf sich Milo nur noch woanders mit ihr. Es war klar, dass weder ihre Optik, noch ihre etwas raue Wortwahl die Zustimmung unserer Eltern finden würden. Der Gedanke, eines Tages selbst einen Partner nach Hause bringen und vorführen zu müssen, erfüllte mich mit Unwohlsein. Vielleicht tat es Milo nur, weil er uns alle provozieren wollte.
Milo war schlau und ein gerissener Geschichtenerzähler. Er ließ meine Eltern glauben, dass er nicht rauchte, bis eines Morgens ein heftiger Sturm hunderte von Zigarettenkippen von dem Dachvorsprung vor seinem Zimmer direkt auf unsere Einfahrt wehte. Dad stand knöcheltief inmitten der Beweise und Milo beteuerte immer noch, er sei es nicht gewesen. Er ließ sich mit sechzehn heimlich von dem Onkel eines Kumpels ein Tattoo von einer nackten Brust auf das Schulterblatt stechen, das er nur mir zeigte.
Als er ein bisschen älter war, ließ er sich jeden Freitagabend von einer anderen Frau abholen. Ich war neugierig, ging oft an die Tür und da standen sie. Mal waren sie dünn, mal molliger, aber immer auf dieselbe klischeehafte Art sexy mit engen Jeans oder kurzen Röcken, Brüsten, die von Push-up-BHs nach oben gedrückt wurden und lasziv aus dem Ausschnitt lugten und diesem Blick, der sagte: Fick mich. So hatte es mir Milo erklärt, dass es diesen Mädchen auf die Stirn geschrieben stand und dass es ihn scharf machte, wenn es so war. Ich war damals viel zu jung, um mit solchen machohaften Ansichten konfrontiert zu werden, aber was hätte ich tun sollen? Milo trug sein Herz auf der Zunge und ließ mich an seiner Welt teilhaben, ob ich es wollte oder nicht. Eines aber wusste ich recht bald: Dass ich niemals, unter keinen Umständen und nur über meine eigene Leiche so werden würde wie diese Frauen, weil es mich anwiderte, wie sie sich benutzen ließen.
Später erlebte ich Milo bei Familienfeiern oder Partys, zu denen auch ich eingeladen war, mit seinen sogenannten festen Freundinnen. Ich ekelte mich davor, Zeugin dessen zu werden, wie Milo eine Frau nach der anderen an sich zog, um sie wenig später rücksichtlos von sich zu stoßen. Als ich ihn eines Tages, als er wieder mit einer Freundin, die annähernd sympathisch auf mich gewirkt hatte, Schluss gemacht hatte, darauf ansprach, sagte er nur: »Sie hat gut geblasen, das ist alles.«
Sex war etwas, das ich so lange wie möglich vor mir herschob. Manchmal glaubte ich, allmählich eine krankhafte Angst davor zu haben, mich das erste Mal vor einem Mann nackt ausziehen zu müssen. Was wurde von mir erwartet? Wollte ich die Berührung durch einen Mann? Würde ich Lust empfinden können? Liz, die auch nach dem Studium der Psychologie und Literatur meine beste Freundin blieb, machte sich große Sorgen um mich und schlug vor, ich solle zur Therapie gehen. Aber ich glaubte nicht daran, einem Wildfremden meine Seele auszuschütten. Meine Eltern stellen nie Fragen, denn so waren sie erzogen worden. Man sprach nur über angenehme Dinge, die einem nicht die Stimmung vermiesten.
Also führte ich ein enthaltsames Leben und verdrängte die eigene Sexualität, bis ich für meinen ersten richtigen Job bei einer renommierten Tageszeitung nach Chicago zog. Ich durfte Dads Zweitwagen nehmen, um die Reise in meine neue Wahlheimat anzutreten. Milo würde ihn etwa eine Woche später wieder zurück nach Wisconsin fahren, wenn er zu einem wichtigen Termin mit unserem Dad anreisen würde. Es ging um irgendwelche Unterschriften, die mit Dads und Uncle Bens Anwaltskanzlei zu tun hatten. Uncle Ben (Er hieß wirklich so, hatte aber rein gar nichts mit dem bekannten Reis zu tun!) hatte nur eine Tochter, die Jura für stinkend langweilig hielt, und es war klar, dass Milo die Kanzlei eines Tages übernehmen würde.
»Pass auf dich auf, ja?« Mom zupfte den Kragen meiner Bluse zurecht. Ich war schick gekleidet, mit einer anthrazitfarbenen Stoffhose, die unten etwas weiter wurde, einer türkisen, leicht taillierten Bluse und einer grauen Strickjacke mit Silberknöpfen, denn ich hatte gleich als erstes am frühen Nachmittag einen Termin bei meinem neuen Chef, der das Ressort für aktuelle Themen betreute. In meiner Verkleidung fühlte ich mich nicht sonderlich wohl, denn mein Mantra lautete: Jeanshosen, T-Shirts, Kapuzenpullover und Turnschuhe, mehr braucht niemand!
»Geht klar, Mom!« Ich drückte meiner Mutter einen Kuss auf die Stirn. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch, mein Schatz. Fahr vorsichtig und melde dich, sobald du heute Abend in deiner Wohnung bist, ja?«
Dad zog mich in eine lange, feste Umarmung und wünschte mir viel Erfolg.
Milo lebte zu der Zeit schon seit drei Jahren in Chicago. Dass es mich auch dorthin zog, war reiner Zufall.
Vor mir lag eine fast dreistündige Autofahrt und ich ließ das Hörbuch eines aktuellen Bestsellers laufen. Es ging um Liebe, Leidenschaft, Betrug und Versöhnung und das eigene Leben schmeckte plötzlich fad und langweilig. Gerade, als die Protagonistin ihre Scheidung einreichte und das Happy End mit ihrem Lover hell am Horizont zu leuchten begann, knurrte mein Magen. Ein Blick auf die Uhr auf dem Dashboard verriet mir, dass es erst elf Uhr war, aber mein Hungergefühl war schon immer unberechenbar gewesen. Also fuhr ich beim nächsten gelben M über eine langgezogene Rampe vom Highway ab und bog auf den weitläufigen Parkplatz ab, an den neben dem Fastfood-Restaurant auch ein kleiner Supermarkt, eine Tankstelle und ein Second-Hand-Laden grenzten.
Außer einer hübschen, dunkelhäutigen Bedienung, einem schlaksigen Typen, der mit der Zubereitung der Pommes sichtlich überfordert war, und jetzt mir war nur noch eine einzige Person in dem Restaurant. Hätte mir jemand erzählt, dass ich meinen ersten Sexualpartner in einem Fastfood-Restaurant kennenlernen würde, ich hätte es nicht geglaubt! Nick saß jedenfalls an dem Tisch in der hintersten Ecke, war über sein Menü gebeugt und versuchte, einigermaßen gesittet zu essen, während die orangene Soße aus seinem Burger auf einen Berg von Servietten und Einpackpapieren tropfte. Er schielte sofort zu mir hinüber, während er in sein Brötchen biss, und ich spürte, dass er mich gedanklich auszog.
Ich überlegte kurz, ob ich das Essen mitnehmen sollte, aber dann hätte ich gleich den Drive-Through nehmen können und außerdem hatte ich Angst, ich könnte im Auto meine schicken Klamotten verkleckern. Um zwei Uhr war mein Vorstellungstermin bei der Zeitung, ich hatte weder Zeit noch eine Gelegenheit, mich umzuziehen. Also bestellte ich das Menü Nummer drei, auch wenn ich am liebsten das Kinder-Menü genommen hätte, bei dem man ein Einhorn aus Plastik mit Regenbodenschweif dazubekam. Dann nahm ich an dem Tisch ganz vorn Platz und mied den Blickkontakt mit dem Fremden, obwohl ich weiterhin seine Blicke spüren konnte. Nachdem der Typ seinen Müll von seinem Tablett in den gigantischen Abfalleimer gekippt hatte, machte er den Schlenker zu meinem Tisch und stellte sich mir als Nick vor, der auf dem Weg nach Chicago war. So ein Zufall, ich hätte glatt gefragt, ob ich mitfahren könne, wäre da nicht das Auto meines Dads gewesen. Denn Nick war mit seinem etwas rundlichen Gesicht, den grünbraunen Augen und dem perfekt sitzenden Kurzhaarschnitt seiner pechschwarzen Haare ein Hingucker! Wir stellten fest, dass wir beide bei derselben Zeitung zu arbeiten anfangen würden (Was kein supergroßer Zufall war, weil es wirklich eine sehr, sehr große Firma war!), dass wir beide niemanden in Chicago kannten (Milo zählte nicht!) und dass wir am Wochenende gemeinsam essen gehen würden (Das war Nicks Idee, er schien sich sehr sicher zu sein, dass ich zusagen würde!). Ich weiß nicht warum, aber bei Nick schalteten sich all meine Vorurteile gegenüber der Männerwelt aus und ich vertraute ihm meine Handynummer an. Vielleicht weil mich schon in jenem Restaurant das Gefühl beschlich, bald einsam zu sein. Ich war ein Familienmensch und meine besten Freunde hatten sich allmählich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Aussicht auf eine Bekanntschaft war tröstlich, selbst wenn sie männlich war.
Nachdem wir uns ein wenig steif voneinander verabschiedet hatten, verließ Nick das Restaurant. Ich tunkte meine nächste Fritte in einen See aus Ketchup und überlegte, ob es falsch gewesen war, mich zu verabreden. Dann verscheuchte ich die Zweifel und biss in meinen doppelten Burger mit Extra-Bacon. Ich würde auch in Chicago weiterhin regelmäßig joggen gehen, um nicht unnötige Pfunde anzusetzen. Während ich kaute, dachte ich an all das, was vor mir lag: Ein neuer Job, eine neue Wohnung, die ich mit zwei Mitbewohnerinnen teilen würde, die ich nur virtuell kannte, ein Date mit diesem Nick, der vielleicht ganz nett war und noch so vieles mehr, das ich mir gar nicht ausmalen wollte. Mein Leben war eine Wundertüte! Fing es jetzt erst so richtig an?
Jamila
Fuck! Mein Atem war ein nervöses Röcheln. Draußen fuhr laut ein Rettungswagen vorbei, den ich hier hätte brauchen können. Wahrscheinlich war er nach Downtown Chicago unterwegs. Auf dem dunklen, geölten Parkettboden zwischen Schlafzimmer und Flur lag das Schwein vor mir, mit seitlich ausgestreckten Armen und der halb heruntergelassenen Skinny-Jeans, die ich am Vorabend aufgeknöpft hatte. Meine Handteller waren nass, während in meinem Inneren alle Alarmglocken schellten. Fuck, was mach ich nur? Ist der Kerl etwa tot?
Da klingelte das Telefon. Es stand auf einer kirschfarben gebeizten Kommode mit vielen Schubladen. In meinem Kopf hämmerte es. In meinem Mund wohnte immer noch Luc McGoverns bitterer Atem, gemischt mit dem Geschmack kalter Asche.
Das Schellen wollte nicht aufhören. Auf dem Display las ich Mom mobil. Ich stand im Flur, gelähmt wie ein Reh im Scheinwerferlicht, und der Gedanke, dass Luc eine Mutter hatte, kam mir absurd vor. Natürlich war jeder irgendwann einmal aus dem Leib einer Frau gekrochen, die er anschließend Mom nannte. Aber die Vorstellung im Zusammenhang mit Luc war für mich grotesk.
Reiß dich zusammen! Ich dachte an die letzten Worte meiner Mutter, als sie vor bald einem Jahr gegangen war. Vor meinem geistigen Auge tauchte ihr schmales Gesicht mit den dunklen Augen auf, deren Blick leer war. Mein Gott, ich kann sie nicht einmal lieben, wenn sie kurz davor ist, zu sterben. Dieser Gedanke hatte mich damals durchbohrt und tat es heute noch.
»Es geht immer weiter, Jamila«, hatte sie gesagt und mir die Hand auf den Unterarm gelegt. Ich hatte auf die fleischfarbene Haut unter ihren langen Fingernägeln gestarrt, die im Kontrast zu ihrer Kakao-Haut geleuchtet hatten. Dann hatte ich meiner Mutter in die Augen gesehen und nicht verstanden, was sie mir damit hatte sagen wollen. »Und du musst weiterkämpfen.« Nach diesen Worten hatte sie die Augen geschlossen, für immer und kampflos, vom Leben gezeichnet und als unglücklicher Mensch. Aber glücklich zu sein war in meiner Familie niemals auf dem Programm gestanden.
Lucs Mutter ließ das Telefon weiterklingeln, bis der Anrufbeantworter anging. Hey-ho, hier spricht der berühmte Luc McGovern. Ich freue mich über jeden Anruf, kann aber gerade nicht ans Telefon gehen, erklang Lucs angenehm sonore Stimme. Eingebildet klang er, genau wie am Abend zuvor, als Keith Howards ihn mir neben dem Vorspeisenbuffet vorgestellt hatte.
Ja, dachte ich, während ich begann, eine Schublade nach der anderen aufzuziehen. Du kannst nicht rangehen, weil du vollgekifft und vielleicht sogar mausetot bist. Mein Hals schnürte sich zu. Ich war die letzte Person, die Luc gesehen hatte, also steckte ich bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wäre ich doch schon kurz vor Sonnenaufgang abgehauen! So wie ich es immer tat. Er hatte mit den Geldscheinen gewedelt und mir den Schlüpfer erneut ausgezogen, diesmal aber anders als das erste Mal. Ich musste hier weg sein, lange bevor ihn jemand fand!
In der obersten Schublade lagen nur ein paar ungeöffnete Brief, Werbeprospekte, Schlüssel und Kaugummis. In der zweiten fand ich ein wenig Bargeld, das ich hastig in die Gesäßtasche meiner Jenas stopfte. In der dritten lagen Feuerzeuge, eine Schere, Zigaretten, eine Tüte mit mehr weißem Höllenpulver. Ich schob sie wieder zu. In der untersten lagen zwischen Taschentuchpackungen schwarze Lederhandschuhe, eine Krawatte und bunte Kondome. Ganz nach hinten geschoben fand ich eine kleine schwarze Box mit Silberrand. Ich öffnete sie. Aus einem Bett aus schwarzem Samt blitzte mir ein Diamantring entgegen, den ich sofort in meine Tasche steckte. Wer hätte dieses Schwein schon geheiratet?
»Hallo Luc!« Ich erschauderte, als eine kratzige Stimme durch den Flur hallte. »Ich bin’s, deine Mom. Du wolltest dich letzte Woche bei mir melden, weißt du noch?« Eine lange Pause. »Nun ja, ich habe inzwischen mit Penelope gesprochen und sie hat nichts dagegen, dass du ihre Gemälde diesem Keith Howards zeigst.«
Ich vergaß zu atmen. Stieg mit bleischweren Beinen über Lucs reglosen Körper und stürmte ins Schlafzimmer. Die Bettwäsche lag in einem wilden Knäuel auf dem Boden. Ich riss das Fenster auf und streckte den Kopf hinaus. Die Feuerleiter war mir schon am Abend aufgefallen, aber das Schwein hatte mich ja ans gusseiserne Bettgestell gefesselt. Ich rieb mir die Handgelenke. Ohne lange zu überlegen schwang ich mich aus dem Fenster und begann, nach unten zu klettern. Dort schoben sich Autos, die wie Spielzeug wirkten, durch die Straßen. Ich verbot mir, den Kopf zu heben. Eine Stufe nach der nächsten. Einmal rutschte mein Fuß ab, aber meine Finger reagierten schnell und umklammerten ängstlich das Geländer. Wohin nur? Ich würde zu Sam ins Café gehen, dort fühlte ich mich am sichersten auf dieser Welt. Und diesem elenden Keith würde ich bei der nächsten Gelegenheit den Marsch blasen! Wenn ich nur den Mut dazu hätte. Mich mit so einem Kerl mitgehen zu lassen, bei dem der Tod schon mehrmals angeklopft hatte! Er war ein Wrack, geistig und körperlich, und ich hatte mich gewundert, mit welcher Gewalt er mich trotzdem gegen den harten Boden gedrückt hatte. Seine Arme waren drahtig, seine Brust eingefallen und voller roter Flecken, ebenso wie seine Oberschenkel. Er musste dort seine Zigaretten ausgedrückt haben. In meinem Kopf hörte ich noch meine Schreie: »Lass mich los! Du Schwein! Behalt dein beschissenes Geld!« Aber er dachte nicht daran, mich gehen zu lassen. Je mehr ich mich wehrte, desto härter wurde er und als ich den Kopf zur Seite drehte und in seinen Unterarm biss, bestrafte er mich mit einer Ohrfeige, die immer noch auf meiner Wange brannte.
Endlich die letzte Stufe! Ich riss mir die Pumps von den Füßen. Hätte mir auch früher einfallen können! Kaum spürte ich den Asphalt unter den Sohlen, begann ich zu rennen, so schnell ich konnte. Und das war schnell. Ich war die schnellste Kurzstreckenläuferin an meiner High School gewesen.
Sams Café lag nur fünf Blocks weiter und ich war erleichtert, als ich unter den blauen Neon-Buchstaben eintrat.
»Jagt dich der Teufel?« Sam lächelte mich an, kaum hatte ich die Schwelle übertreten. In seinem weißen Kittel sah er immer aus wie ein Arzt. Ein unrasierter Arzt.
»Ich brauch einen Kaffee.« Ich durchquerte den Raum mit den kleinen bunten Tischen und ließ mich in der Ecke auf einen der viel zu harten Stühle fallen. »Mit Schuss.«
»Um die Uhrzeit?« Sam hob mahnend die buschigen Augenbrauen, wischte mit seinem gelben Lappen über den Tresen und hängte ihn anschließend über den Wasserhahn. Seine Zähne leuchteten hell in seinem dunklen Gesicht.
»Ist mir egal, wie viel Uhr es ist.« Ich kramte in meinen Taschen nach einer Zigarette, fand aber keine. Hatte ich die bei Luc vergessen? Ich hatte mir vor wenigen Tagen eine Packung geleistet, von Keiths großzügigem Lohn. Am selben Tag, an dem ich mir diese sündhaft teure Jeanshose gekauft hatte, in der ich laut Keith jeden Typen abschleppen konnte. Als ob ich das wollte!
»Du siehst beschissen aus!« Sam stellte eine winzige Tasse vor mir ab, die aber nicht nach Alkohol roch. »Du solltest besser auf dich aufpassen, mein Herz!« Er tätschelte meine Schulter und ging zu dem einzigen anderen Gast hinüber, einem dunkelhäutigen Greis, der zahlen wollte.
Ich starrte vor mich hin, mein Kopf war gedankenleer und ich wünschte mir, es könnte immer so sein. Wie ein Roboter hob ich die Espressotasse an meine Lippen. Ließ das bittere Getränk eine Weile in meiner Mundhöhle. Schluckte mit Mühe. Wieso nur hatte ich mich auf die Geschäfte mit Keith Howards eingelassen? Mein Dad kannte einen Typen, der nicht so sehr in der Gosse lebte wie wir und der mit einer Künstlerin befreundet war. Die hatte den Kontakt hergestellt.
»Kann ich dir noch was Gutes tun, mein Herz?« Ich hatte gar nicht gemerkt, dass Sam wieder an meinem Tisch stand. Seine großen Hände mit den breiten Fingern lagen auf der Tischplatte, der blaue Putzlappen baumelte aus seiner Hosentasche.
»Nein, danke.« Ich hob den Kopf und sah Sam in die Augen. Seit bald zwanzig Jahren kannten wir uns. Seine Frau, die letztes Jahr an Krebs gestorben war, hatte damals an der Kasse meines Stamm-Supermarktes gearbeitet.
»Sieh zu, dass du was lernst.« Sam presste die Lippen zusammen und nickte ermutigend. »Du hast Grips, Mädchen.« Er legte mir eine seiner Pranken auf die Schulter und lächelte mich an. Er war der Einzige, der an mich glaubte.
Milo
Die Blonde hatte ihren schwarzen, dünnen Ledergürtel vergessen. Er war immer noch an dem gusseisernen Gestell meines Kingsize-Bettes festgeschnallt. Eine schöne Erinnerung, die ich nur widerwillig löste, während ich grinsen musste. Sie hatte die beste Figur gehabt, die man sich als Mann wünschen konnte. Und nicht nur das. Vielleicht würde ich sie nächstes Wochenende wieder in meiner Stammkneipe sehen, wer weiß. Dort könnte ich ihr das Teil zurückgeben. Oder sie wieder zu mir locken, damit sie es persönlich bei mir abholte. Sie hatte mir gefallen. Auch wenn es nicht mein Ding war, dieselbe Frau zweimal in meine Wohnung in Chicago Downtown einzuladen. Die meisten traf ich nie wieder.
Ich legte den Gürtel auf den Schuhschrank im Flur. Dann betrat ich mein lichtdurchflutetes Wohnzimmer und blinzelte durch das Fenster im zwölften Stock in Richtung des Chicago Rivers. Diese Aussicht hatte es mir damals sofort angetan! Mom und Dad hatten nicht einmal gefragt, warum ich diese sündhaft teure Bleibe mieten wollte, es war ihnen, wie so vieles, egal.
Mein Handy begann zu klingeln. Lemon Tree, dieses dämliche Lied, das so viele Zuhörer begeistert hatte und das ich für Celestes Anrufe reserviert hatte. Sie war schon immer auf den Song, der für mich eher wie ein Kinderlied klang, abgefahren.
»Hey, Schwesterherz!« Die Verwunderung in meiner Stimme konnte ich nicht unterdrücken, denn Celeste rief eigentlich nie bei mir an. Ich stellte mich mit dem Handy am Ohr ans bodentiefe Fenster, betrachtete den babyblauen Morgenhimmel mit den vereinzelten Wattewolken und die Sonne, die dabei war, den Zenit zu erklimmen.
»Du hast meine neue Nummer schon eingespeichert?« Das war eine typische Celeste-Frage. Sie sagte nicht einmal Hallo, sondern sprach das aus, was ihr als Erstes in den Sinn kam. Ich liebte meine kleine Schwester, trotz all unserer Unterschiede!
»Hallo erst mal, wo bleibt dein Benehmen?« Ich lachte laut auf und strich mir mit der freien Hand durch das in alle Richtungen abstehende Haar. Die Blonde hatte es zerwühlt. Sie musste sehr früh gegangen sein, ich hatte es nicht einmal mitbekommen. »Mom hat mir deine Nummer geschickt«, sagte ich. »Du weißt doch, die Zentrale funktioniert immer.«
»Hallo, lieber Milo. Wie ist dein Tag bisher gelaufen? Gut so?« Ich sah Celestes Blick vor meinem geistigen Auge, den gespielten Vorwurf, die sanfte Empörung. Sie hatte ein gutes Herz! »Hör zu, ich hab in einer halben Stunde nen Termin bei meinem neuen Chef aber hier gibt es keinen einzigen Parkplatz!«
»Willkommen in Chicago!«
»Hör auf damit, wo kann ich den Wagen abstellen?«
»Such dir am besten etwas außerhalb. Alles andere ist zu teuer. Und dann nimm einen Uber bis zu deinem Ziel. Oder den El Train.«
»Ich hab kein Ticket.«
»Celeste, wie alt bist du?« Das Lächeln gefror auf meinen Wangen. Manchmal war meine kleine Schwester tatsächlich noch wie ein hilfloses Schulmädchen.
»Vergiss es einfach, Milo. Ich steh hier an einer roten Ampel, da vorn stehen zwei Polizisten, die auf einen Bettler einreden, vor mir läuft jemand über die Straße, der wild gestikuliert und laut singt, überall sind so viele Menschen, das ist mir grad alles zu viel! Ich bin ein Mädchen vom Lande, schon vergessen?«
Anstatt weiter mit Celeste zu diskutieren, beschrieb ich ihr den Weg zum nächstgelegenen, größeren Parkgelände. Sie würde drei Kreuze machen, sobald sie Dads Zweitwagen loshatte! Kein Mensch brauchte in Chicago ein Auto.
»Danke, Milo.« Celeste klang erleichtert. Im Hintergrund ertönte die Ansage der Hochbahn, sie war tatsächlich mitten in die Stadt reingefahren!
»Keine Ursache, immer wieder gern. Und wenn du mal Anschluss finden willst ...« Ich sprach nicht weiter, denn mir war klar, dass mein Freundeskreis nicht Celestes Erwartungen entsprechen würde. Sie hatte sich schon als Teenager für etwas Besseres gehalten.
»Ich komm dann bei Bedarf auf dein Angebot zurück«, antwortete sie wenig überzeugend.
Wir verabschiedeten uns und ich legte auf. Dann ließ ich mir einen Espresso aus meiner neuen Maschine laufen, den ich nach jedem langsamen Schlürfer eine Weile herb auf meiner Zunge liegenließ, während ich meilenweit auf Instagram nach unten scrollte. Da ich nur selten frühstückte, schaltete ich den überdimensionalen Flachbildschirm-Fernseher an, der in der mattweißen Schrankwand integriert war, die mir mein Vormieter-Ehepaar verkauft hatte. Weil nichts Interessantes in der Glotze kam, griff ich erneut nach meinem Handy, um Dads letzte Nachricht noch einmal zu überfliegen. Er schrieb mir mit sachlichen, emotionslosen Worten, als sei ich ein Fremder. Als solch einer hatte ich mich in meiner Familie oft gefühlt. Und jetzt sollte ich eines Tages die Kanzlei übernehmen, wenn Dad und Uncle Ben keine Lust mehr hatten? Ich rieb mir die Stirn. Hatte ich mir das wirklich gut überlegt? Hatten die beiden es sich gut überlegt oder war es nur eine Notlösung für sie?
Jemand klingelte an der Tür. Der Ton war nervig und erinnerte mich an die Musik aus einem Cartoon-Film meiner Kindheit, dessen Titel ich vergessen hatte. Überhaupt hatte ich meine Kindheit vergessen, manchmal kam es mir so vor, als habe es sie nie gegeben.
»Sheryl hier.« Die Stimme klang vertraut. Mein Hirn begann zu arbeiten, auch wenn es morgens lange Zeit träge war, vor allem, wenn ich am Vorabend zu viel getrunken hatte. Gut, dass ich mir heute freigenommen hatte. Sheryl musste der Name der Blonden sein.
»Ich glaub ich hab meinen Gürtel bei dir vergessen.« Sie klang gehetzt, also drückte ich schnell auf den Knopf, um sie hereinzulassen. Nach einem raschen Blick in den bodentiefen Spiegel im Flur holte ich mir meinen dünnen, beigen Bademantel aus dem Bad. Gerade rechtzeitig kehrte ich zurück, denn die Blonde stand schon im Türrahmen, mit einem herausfordernden Blick und in die Hüften gestemmten Händen.
»Und glaub bloß nicht, dass ich wiedergekommen bin, um dich noch einmal zu sehen.« Sie lächelte auf die fiese Art, die mir wohlbekannt war. Keine Frau mochte mich wirklich, höchstens, wenn sie ausreichend angetrunken war. War mir egal.
»Kein Problem, ich hab deinen Gürtel.« Ich hielt ihr das Teil entgegen und sie nahm es wortlos an, steckte es mit einer zügigen Bewegung in ihre schwarze Handtasche. Sie war schicker gekleidet als am Vorabend, wahrscheinlich war sie auf dem Weg zur Arbeit.
»Und du musst nicht zur Arbeit?« Ihr gefühlloser Blick glitt an mir hinunter und blieb eine Weile auf meinen nackten Füßen haften. Etwas unsicher sah auch ich automatisch nach unten, schämte mich für meine schlecht geschnittenen Zehennägel. Sie sahen zu eckig aus.
»Ich hab heute frei«, sagte ich so locker wie möglich und hob den Kopf wieder. »Weise Entscheidung, nach gestern Abend und der schlaflosen Nacht, was?«
Die Blonde verzog das Gesicht und winkte mir zu. »Mach’s gut, Macho!« Dann war sie weg. Ich lauschte noch eine Weile dem Klappern ihrer Absätze auf den Treppenstufen, bevor ich wütend die Tür schloss. Wieso war ich zornig? Weil ich mir eingebildet hatte, sie könnte mich mögen? Oder weil ich wieder einmal der war, für den mich alle hielten und der ich eigentlich nicht sein wollte? In die Rolle war ich mit vierzehn hineingerutscht, mit der ersten Zigarette und den falschen Kumpels. Wer konnte mir da etwas vorwerfen? Wir waren doch alle Opfer unseres Umfeldes, oder etwa nicht?
Ursprünglich hatte ich mir freigenommen, um die Dokumente durchzulesen, die mir Dad und Uncle Ben geschickt hatten und um noch einmal am Ufer des Chicago Rivers in mich zu kehren. Bei dieser Entscheidung, die bedeutend für mein Leben war, fühlte ich mich einsam und verlassen. Keiner meiner Kumpels würde mir einen Rat geben können. Mein Job in Chicago war mir schon längst über den Kopf gewachsen. Dad hatte ihm mir über seine zahlreichen Beziehungen zu einflussreichen Anwälten und Richtern besorgt, aber das, was mich dort erwartete, war die Hölle. Es gab Tage, an denen war es unmöglich, nach achtzehn Uhr noch einen klaren Gedanken zu fassen. Jeder Mandant schien zu glauben, er sei der einzige auf der Welt, und die Erwartungshaltung meines Chefs war eiskalt.
Aber würde mich die Leitung einer Kanzlei im ländlichen Wisconsin erfüllen? Sie wäre die logische Konsequenz in meinem Lebenslauf, ich hatte an einem sündhaft teuren College Jura studiert. Trotzdem haderte ich mit mir selbst. Celeste war die Einzige, mit der ich über die Übernahme von Dads und Uncle Bens Firma hätte reden können, aber Celeste hatte andere Themen. Zunächst einmal hatte sie kein Interesse an juristischen Themen. Dann einen neuen Job in ihrem Traumberuf als Journalistin, einen aufregenden Lebensabschnitt in Chicago vor sich und jede Menge Potenzial. Celeste war genial, nur hatte ich ihr das noch nie gesagt. Der Gedanke ließ eine trübe Stimmung meinen Körper durchfluten, während ich mich zwang, unter die heiße Dusche zu stehen. An manchen Tagen wäre ich am liebsten auf der Couch liegengeblieben. Mein Handy und ich. Endlich Ruhe.
Ich liebte meine ultramoderne Duschkabine mit so viel Platz, dass ich darin Walzer hätte tanzen können. Wenn ich es denn gekonnt hätte. Und eine Partnerin gehabt hätte. Das heiße Wasser und der Massagestrahl taten gut, so dass ich für einige Zeit die Augen schloss, den Strahl auf mein Glied richtete und versuchte, an nichts zu denken. Es gelang mir sofort. Celeste sagte immer, es sei unmöglich, an rein gar nichts zu denken, aber Celeste war eine Frau.
Während ich mich abtrocknete, betrachtete ich mich im Spiegel. Das tat ich, seit mir die ersten Achselhaare gewachsen waren, weil ich meinen Körper liebte. Wenn ich mich leicht zur Seite drehte, konnte ich das Brust-Tattoo auf meinem Schulterblatt sehen. Die Frauen mochten es nicht, fanden es unpassend. Aber warum? Ich selbst hatte keine nennenswerten und eine Schwäche für Busen, weshalb durfte ich mir da keinen auf meine Haut tätowieren lassen? Es war meine Haut! Was war es für eine Erleichterung gewesen, mir mit achtzehn nicht mehr Moms und Dads Anweisungen anhören zu müssen! Ich rubbelte mir mit dem Ende des Handtuchs, das kein Etikett hatte, die Haare, mit dem anderen Ende die Füße trocken. Der Rest des Handtuchs war für die Mitte des Körpers bestimmt. Ich hatte noch den Abdruck meiner Bade-Shorts vom Sommer, mein Hintern leuchtete weiß. Es war nicht zu übersehen, dass ich jede Woche viermal im Fitness-Studio war. Außerdem gab es kein Haar an meinem Körper, das fehl am Platz oder zu lang war. Die Hülle war perfekt, aber die Täuschung, dass sich in diesem perfekten Körper auch ein harmonischer Geist befand, gelang nicht. Jedenfalls glaubte ich nicht, dass mich jemand für einen ausgeglichenen Menschen hielt. Und es gab Tage, an denen sehnte ich mich danach, so stark zu sein wie Celeste. Dass sie Probleme bei der Parkplatzsuche hatte, das war unerheblich, denn dass es im Leben um mehr ging, das hatte ich schon längst begriffen. Spätestens nach der ersten durchgezechten Nacht mit Luc McGovern. Der Kerl war ein Wrack! Ich hatte ihn letzten Sommer auf einer Party kennengelernt und wusste bald, dass ich niemals so werden wollte wie er, obwohl ich die Zeit mit ihm genoss. Er hatte das weiße Pulver verharmlost, ebenso die Nacht mit drei verschiedenen Frauen. Während er Alkoholnachschub oder Zigaretten bei der Tankstelle kaufen ging, vergnügte ich mich mit der Frau, die zuvor Luc gehabt hatte. Es schien ihr nichts auszumachen. Oder aber sie war zu betrunken und zugekifft, um es zu realisieren. Wenn ich heute daran zurückdachte, dann war das alles widerlich. Aber in dem Augenblick, als ich in der Situation steckte, war alles in Ordnung und sogar cool. Auf eine böse Art, die mir ab und zu Angst machte.
Mein Handy klingelt erneut, diesmal mit dem Standard-Klingelton. Es war mein Kumpel Kess, der mich zu einem Gig am Abend einladen wollte, doch ich sagte ab. Ich brauchte eine Pause, um mich auf die Kanzlei-Sache zu konzentrieren und vielleicht auch, um mal mit Celeste auszugehen. In ein braves Pfannkuchen-Hause oder so etwas Ähnliches. Sie war kein Typ für dunkle Bars mit Neonlichtern und Alkohol.
Etwas träge schlüpfte ich in meine graue Skinny-Jeans und in ein weißes Marken-T-Shirt mit Logo. Dazu graue Socken, meine beige Cord-Jacke und weiße Sneakers. Die fünf Silberringen, die in einer Holzschale in der Küche lagen, steckte ich an die Finger meiner linken Hand. Meine Wetter-App verriet, dass es ein lauer Spätsommertag werden würde.
Kaum hatte ich die Wohnungstür hinter mir zugezogen, klingelte erneut mein Handy. Es war wieder Kess, der sich zum Mittagessen verabreden wollte. War es so dringend, mich zu sehen? Zugegebenermaßen war die Aussicht, nicht den ganzen Tag allein verbringen zu müssen, angenehm, also verabredeten wir uns gegen halb zwei bei seiner liebsten Imbissbude in der Nähe des Millennium Parks. Die Sache mit der Kanzlei hatte noch ein wenig Zeit.
Gedankenlos schlenderte ich die Straße entlang, vorbei am Willis Tower, der seine Spitze angeberisch in den Himmel streckte, und am Art Institute. Die Fassaden der Hochhäuser glänzten in der Sonne. Beim Yacht Club bog ich auf die Uferpromenade ab und ließ mir den Wind um die Ohren pfeifen. Mein Blick wanderte zu den Segelbooten, deren Masten unruhig im starken Wind zuckten, und anschließend hinaus auf den Lake Michigan. Dann streckte ich die Arme zur Seite aus und drehte mich um, sog die Skyline von Chicago in mich auf und überlegte, ob ich diese Stadt wirklich verlassen wollte. Oder war es ein Lied, das in der fernen Zukunft spielte und das ich mit meinen Unterschriften nur anstimmen würde? Dad würde noch eine Weile arbeiten, es war das, was ihn als Mensch ausmachte.
»Milo!« Die meist verhaltene Stimme von Kess drang ungewohnt laut an mein Ohr und ich drehte mich um. Da stand er, mit seiner Beagle-Hündin Snuffle an einer neongelben Leine neben sich. Sie bellte mich sofort freudig an und wurde ihrem Namen gerecht, als sie ausgiebig an meinen Turnschuhen zu schnüffeln begann. Sie schnupperte mehr als ein normaler Hund und Kess behauptete, ihr Geruchssinn sei gestört und sie müsse sich vergewissern, dass es da tatsächlich etwas gab, das sie riechen konnte.
»Es ist noch nicht halb zwei!«, bemerkte ich und zog Kess in eine kurze, harte Männerumarmung. Snuffle begann, an meinem Schuh zu knabbern.
Kess erwiderte nichts, sondern warf mir diesen Ich-freue-mich-so-dich-zu-sehen-Blick zu. Wir kannten uns seit bald drei Jahren und er war mit Abstand der beste Kumpel, den ich in meinem Leben je gehabt hatte, auch wenn oder vielleicht, weil er so ein Nerd war. Kess lebte nur dann in der realen Welt, wenn er mit Snuffle spazieren- oder mit mir ausging. Ansonsten programmierte er in seinem dunklen, verstaubten Loch von Wohnung für eine gut zahlende Firma Sicherheitssoftware oder zockte stundenlang Fortnite.
»Lass uns ein Stück gehen.« Ich befreite meinen rechten Fuß aus Snuffles Maul und wir bewegten uns zügig die Uferpromenade entlang. Kess trug nur ein löchriges Lakers T-Shirt. Er stammte ursprünglich aus Los Angeles und ich hatte schon längst eine dumpfe Ahnung, dass es ihn irgendwann dorthin zurückziehen würde.
»Und, wie war’s gestern?« Jetzt klang er wieder wie er selbst. Vorsichtig, fast tonlos, als müsse er sich überwinden, etwas zu sagen. Ich glaube, Kess sprach neben mir nicht mit vielen Menschen. Sein Kehlkopf war eingetrocknet.
»Ich hatte die geilste Braut im Bett.« Es musste raus und Kess war derjenige, der mich am besten verstand. Auch seine Liebschaften waren eine Kette katastrophal oberflächlicher Abenteuer, wenngleich die Frequenz bei ihm nicht mit der meinen vergleichbar war. Er war kein Jäger wie ich, sondern der Aasgeier, der sich mit dem begnügte, was die anderen übrigließen.
»Du Glücklicher, erzähl!« Kess zerrte an Snuffles Leine, denn sie hatte sich an einem Strauch verschnüffelt.