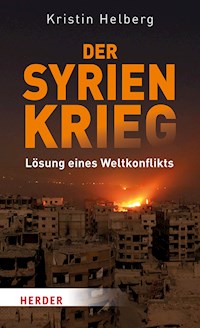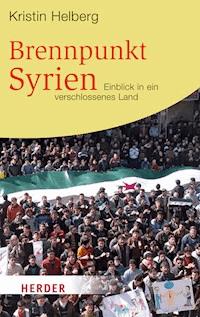
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Kristin Helberg kennt Syrien besser als vermutlich jede andere deutschsprachige Journalistin. Sie bringt uns die Politik, die Kultur und die Menschen Syriens nahe, indem sie von ihren Erlebnissen und Begegnungen in dem Land berichtet, das ihr zur zweiten Heimat geworden ist. Kristin Helberg liefert den Schlüssel zum Verständnis Syriens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kristin Helberg
Brennpunkt Syrien
Einblick in ein verschlossenes Land
Impressum
Titel der Originalausgabe: Brennpunkt Syrien
Einblick in ein verschlossenes Land
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012, 2014
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Agentur RME Roland Eschlbeck
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Demonstration syrischer Regimegegner in Kafranbel, Provinz Idlib, © dpa Picture-Alliance
Autorinfoto: Jan Kulke/www.photoartberlin.de
Karte Syrien: © 2014 Klaus Kühner
www.huettenwerke.de
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80384-0
ISBN (Buch): 978-3-451-06544-6
Den Kindern Syriens
Inhalt
Vorwort
1. Allein unter »Schurken«: Der Alltag als westliche Korrespondentin in Syrien
Damaskus, das Dorf · Die Kunst, allein zu sein · Stunden im Ministerium, Nächte am Flughafen · Die Bürde des Monopols · Von der Freiheit, auf Deutsch und für das Radio zu arbeiten
2. Konfessionelle Hetze gefährdet den Religionsfrieden: Das Mit- und Gegeneinander von Sunniten, Alawiten, Christen und Drusen
Ein Mönch namens Jihad: Mosaik der Konfessionen · Der Papst in der Omayadenmoschee: Syriens Christen · Mittendrin und doch unter sich: Syriens Drusen · Verlorene Identität: Syriens Alawiten · Wertkonservativ, aber offen für andere: Syriens Sunniten
3. Überwacht, gefoltert, lebendig begraben: Syriens Oppositionelle
Jahrzehnte im Untergrund, ein Leben im Gefängnis · Mutig, vorsichtig und zerstritten: Die Opposition heute · Ein toter Scheich, ein toter Politiker und interner Zwist: Die Kurden als innenpolitische Herausforderung · Vor Gericht, hinter Gittern, unter Beobachtung: Der Kampf gegen gemäßigte Dissidenten
4. Unterwegs auf dem Golan: von Blauhelmen, Schafhirten, Studenten und Bräuten
Abwarten und Tee trinken · Schüsse auf Demonstranten und ein uneingelöstes Versprechen · Tränen am Schlagbaum und eine Lösung in der Schublade
5. Gewinner und Verlierer: Syriens sozialistische Planwirtschaft wird zur (un)sozialen Marktwirtschaft
Eine gute Grundausstattung, schlecht gemanagt · Ein Küchenhändler im Verhör · Freier Handel ohne Wandel
6. Drehkreuz Damaskus: Syriens Rolle in der Region und der Westen zwischen Annäherung und Isolation
Assads internationale Verbündete: Russland und China · Syriens regionaler Schulterschluss: Iran · Vom Erzfeind zum instabilen Nachbarn: Irak · Problemfall und Trumpfkarte: Die palästinensische Hamas · Komplizierte Nachbarschaft: Libanon · Assads Comeback in Europa · Vom Feind zum Freund zum Feind: Die Türkei · Von regionaler Zusammenarbeit zu offener Abneigung: Saudi-Arabien und Qatar
7. Verehrt und verflucht: Bashar Al Assad und seine verpassten Chancen
Aus den Bergen an die Macht · Von Lady Di zu Marie Antoinette · Kein arabischer Gorbatschow
8. Weg in die Freiheit oder in den Abgrund? Die syrische Revolution und ihre gesellschaftlichen Spuren
Die Proteste: Dezentral, mitten aus dem Volk und führungslos · Assads Getreue: Armee, Geheimdienste, Geister · Der bewaffnete Widerstand: Deserteure, syrische Freiwillige, Jihadisten · Die Rolle des Westens: Leere Versprechen, ein vermeintlicher Chemiewaffen-Durchbruch und vergebliche Verhandlungen
Vorwort
Dieses Buch ist den Kindern Syriens gewidmet. Sie waren es, die im südsyrischen Daraa den revolutionären Funken gezündet haben, und sie sind es, die seitdem einen furchtbar hohen Preis dafür bezahlen, dass sie in Freiheit aufwachsen wollen. Sie sind es auch, die die Bilder auf meinem Computer immer wieder verschwimmen lassen – die mich zwingen, wegzusehen, die mich wütend, verzweifelt und sprachlos machen und mich dadurch am Ende doch nur zwingen, weiter hinzusehen.
Das Schlimmste sind nicht die blutverschmierten Leichen, die wehklagenden Mütter, die engelsgleichen Gesichter oder die vielen in weiße Tücher eingewickelten kleinen Körper. Nein, die unerträglichsten Bilder sind für mich die der stillen Trauer, der unbeabsichtigten Gesten, der unausgesprochenen Verzweiflung. Der zweijährige Junge, der von einem Granatsplitter getroffen still atmet, bis sich sein kleiner Brustkorb nicht mehr hebt und senkt, und dessen Vater sich kurz darauf vorsichtig an sein Gesicht schmiegt. Der Arzt, der aus Verzweiflung darüber, dass er den Menschen nicht helfen, sondern ihnen nur beim Sterben zusehen kann, das Gesicht wegdreht, um seine Tränen der Wut und Ohnmacht zu verbergen. Oder der 16-jährige von einer Kugel getroffene Junge, der von seinem Vater weggetragen wird und nur noch den einen letzten Satz herausbringt: »Verzeih mir, Papa.«
Alle diese Momente sind dokumentiert, auf Video festgehalten. Wir sind fast live dabei, wenn in Syrien Wohngebiete bombardiert, Proteste beschossen, Verletzte in Untergrundkliniken gebracht und Tote in Massengräbern beigesetzt werden. Selbst Folterszenen gibt es auf YouTube. Mitglieder der Sicherheitskräfte und extremistische Kämpfer filmen sich untereinander beim Quälen von Zivilisten und Schänden von Leichen. Die syrische Revolution am Computer zu verfolgen ist wie ein nicht endender Horrorfilm. Erst recht seitdem sie sich zu einem regionalen Stellvertreterkrieg ausgeweitet hat, der von radikalen ausländischen Kräften befeuert wird – iranischen Milizionären und Hisbollah-Kämpfern auf Regimeseite und Jihadisten in den Reihen der Opposition.
Mir bleibt nichts anderes übrig. Seit Ausbruch der Proteste komme ich nicht mehr ins Land, mein letzter Einreiseversuch im April 2011 endete am Flughafen von Damaskus. Ich könnte es einzelnen Kollegen gleichtun und mich von Rebellen durch den »befreiten« Norden schmuggeln lassen, aber als Mutter von drei kleinen Kindern fühle ich mich privat zu sehr in der Verantwortung. Syrien gilt als derzeit gefährlichstes Land für Reporter, Dutzende sind dort seit 2011 verschleppt oder getötet worden. Als Journalistin muss ich es deshalb ertragen, sieben Jahre aus einem Land zu berichten, dann die Revolution zu verpassen und nun aus der Ferne zu beobachten, wie diese Wahlheimat zugrunde geht.
Das Einzige, was mir hilft, ist dem Konflikt und den Syrern so nahe wie möglich zu kommen – über Kontakte im Land, über das Internet, über Reisen in die Nachbarstaaten. Um dann gegen die Hoffnungslosigkeit und das Grauen anzureden. Zum Beispiel indem ich den Menschen hierzulande erkläre, worum es in Syrien und worum es den Syrern geht. Und dass wir die Leute dort gleich dreifach im Stich lassen, gegenüber der Gewalt des Regimes, in ihrer humanitären Not und in der Auseinandersetzung mit radikal-islamischen Kämpfern.
Dabei greife ich auf Erfahrungen und Kenntnisse zurück, die den Hintergrund dieses Buches bilden. Es ist kein Buch über die Revolution, auch kein Buch über den Krieg. Es ist ein Buch über Syrien. Über ein Land, das dieser Tage nur mit Schreckensmeldungen von sich reden macht und von dem keiner weiß, wohin es steuert. Ein Land, das nicht erst seit Beginn des Aufstandes selbst bei Nahostexperten als schwer durchschaubar gilt und das abzuschreiben wir uns nicht leisten können.
Indem ich von meinem Alltag in Damaskus, dem Verhältnis der Konfessionen untereinander, meinen Begegnungen mit Oppositionellen und Händlern erzähle und die Problematik auf dem Golan, ausländische Verstrickungen und die Person Bashar Al Assads analysiere, möchte ich ein klareres Bild von Syrien schaffen. Ein realistisches und faires.
Wichtige Entwicklungen, die den Syrien-Konflikt seit Erscheinen dieses Buches im September 2012 geprägt haben, sind in die verschiedenen Kapitel eingeflossen: vom Erstarken extremistischer Gruppen bis zur Umstrukturierung der Opposition, von der Diskussion über westliche Militärschläge nach dem Giftgasangriff im August 2013 und der darauffolgenden Vernichtung syrischer Chemiewaffen bis zu den internationalen Bemühungen um eine politische Lösung des Konfliktes. Das Verhalten des Westens, das ich für halbherzig, kurzsichtig und kontraproduktiv halte, analysiere ich in einem eigenen Unterkapitel.
Auch die humanitäre Krise findet Erwähnung, die mit mehr als acht Millionen Flüchtlingen (davon drei Millionen außer Landes), mit verhungernden Kindern, Zehntausenden Witwen und Waisen, traumatisierten Jugendlichen, sexuell missbrauchten Frauen und Mädchen sowie den zigtausenden Verletzten und Versehrten, die in Syrien nicht entsprechend behandelt werden können und unvorstellbare Qualen leiden, längst ein Jahrhundertausmaß erreicht hat.
Um mit meinen Ausführungen niemanden zu gefährden, habe ich die Namen von Freunden, Bekannten und manchem Helden (in Gestalt eines Arztes, eines Aktivisten oder sonstigen Helfers) geändert. Manche dieser Freunde im Land sagen mir schon jetzt: »Syrien ist nicht mehr, wie es war.« Ich hoffe trotzdem, dass ich es wiedererkennen werde. Dass sich am Ende vor allem die politischen Verhältnisse verändert haben – und nicht die Menschen.
1. Allein unter »Schurken«: Der Alltag als westliche Korrespondentin in Syrien
Ich sitze in einem syrischen Taxi – gelb, alt, klapprig, mit einem netten neugierigen Fahrer. Woher ich komme, will der ältere Mann wissen, aus Deutschland, sage ich. Seine Augen leuchten, »ahlan wa sahlan«, herzlich willkommen. Ob ich zu Besuch sei? Nein, ich lebe hier, antworte ich. Ah, mit einem Syrer verheiratet, lächelt der Fahrer. Nein, erwidere ich. Der ältere Mann stutzt. Dann lernst du hier Arabisch, vermutet er. Nein, ich arbeite hier. Der Taxifahrer runzelt die Stirn, denkt kurz nach. Arbeitest du in der Botschaft? Ich schüttele den Kopf und erzähle ihm, dass ich nach Syrien gekommen bin, um über sein Land zu berichten. Er blickt überrascht in den Rückspiegel, verlangsamt das Tempo. Einfach so? Nach Syrien? Wir sind am Eingang der Altstadt angekommen, ich drücke ihm 50 Lira, etwa 80 Cent, in die Hand. Er lacht mich an und lehnt ab. Nach drei Versuchen gebe ich auf und steige aus – »maa salame«, geh mit Frieden.
Meine erste Zeit in Syrien ist geprägt von solchen Begegnungen. Im November 2001 sind westliche Ausländer in Damaskus eine Seltenheit, nach Jahrzehnten der Abschottung freuen sich die Menschen über jeden Kontakt nach außen. Syrien wirkt auf mich wie ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Das Land, das über Jahrzehnte aufseiten der Sowjetunion stand, ist gezeichnet von erstarrter Planwirtschaft und der Einparteienherrschaft der Baath-Partei. Deren arabischnationalistische Parolen klingen längst hohl, und auch sonst ist vom Sozialismus nicht viel mehr als eine ausufernde Verwaltung und marode Infrastruktur übriggeblieben. In den Ministerien trinken gelangweilte Beamte Tee, bis sie am frühen Nachmittag zu ihren Zweit- und Drittjobs als Taxifahrer oder Nachhilfelehrer eilen, Telefonanschlüsse gibt es nur mit Beziehungen oder gegen ein Trinkgeld, Strom- und Wasserrechnungen zahlt man bar an winzigen Häuschen nahe der Wohnung und die vielen kleinen Krämerläden sind vollgestopft mit syrischen Produkten, die so aussehen wollen wie ihre westlichen Vorbilder.
Ich finde das alles aufregend. Ein Land ohne Coca-Cola, amerikanische Fastfoodketten, westliche Markenklamotten und anonyme Supermärkte – wo gibt es das noch außer in Nordkorea? Ich fühle mich erfrischend weit weg von globalen Konsumstandards, genieße syrisches Fastfood in Form von Hähnchen, Falafel und Shawarma (in dünnes Fladenbrot gerolltes Grillfleisch) und kann anfangs sogar dem absurden Spießrutenlauf in der Ausländerbehörde etwas Faszinierendes abgewinnen, wo mich ausschließlich Arabisch sprechende Uniformierte für die notwendigen Stempel, Wertmarken und Unterschriften über drei Stockwerke hoch und runter, hin- und her schicken, um meinen Aufenthalt zu verlängern.
Die Syrer sind von solchen Arbeitsabläufen verständlicherweise genervt, aber nach drei Jahrzehnten so daran gewöhnt, dass sie diese nicht wirklich infrage stellen. Vor allem wissen die meisten nicht, dass öffentliche Verwaltung auch anders funktionieren kann. Anfang des 21. Jahrhunderts fangen sie gerade an, mithilfe ausländischer Satellitensender zu ahnen, wie die Menschen in Europa und den USA leben, welche Produkte und technischen Neuerungen es dort gibt. Gefangen in derart verkrusteten Strukturen interessieren sich die Syrer deshalb sehr für westliche Besucher.
DAMASKUS, DAS DORF
Da ist zum Beispiel die Frau mit dem kleinen Jungen an der Hand, die am Zeitungskiosk all ihren Mut zusammennimmt und mich auf Arabisch anspricht. Ich brauche eine Weile, bis ich verstehe, was sie möchte. Sie will mich einladen und kennenlernen, denn seit Langem wünscht sie sich eine ausländische Freundin. Ich bin irritiert. Die kennt mich doch gar nicht, denke ich, und spüre das typische mitteleuropäische Misstrauen in mir aufsteigen. Es prägt unser Verhalten gegenüber Fremden und sitzt so tief, dass wir uns oft selbst damit im Weg stehen. Instinktiv unterstellen wir solchen Menschen, dass sie entweder unser Geld oder ein Visum nach Deutschland wollen. Und während bei Annäherungsversuchen anderswo in der arabischen Welt durchaus Vorsicht geboten ist, tut man den Syrern im Jahr 2001 mit dieser Skepsis meist Unrecht. Sie sind auf ehrliche und fast naive Weise neugierig und begeistert, eine Deutsche zu treffen.
Mit der Begeisterung einher geht bei vielen ein Gefühl der Verantwortung. Sie empfinden es als natürliche Pflicht, für meine Sicherheit und mein Wohlergehen zu sorgen, schließlich bin ich Gast ihres Landes. Oft werde ich gefragt, ob ich etwas brauche, ob man mir helfen kann, ob alles in Ordnung ist. Vor allem, wenn die Leute erfahren, dass ich als Frau alleine gekommen bin und keine Verwandten vor Ort habe. In einer Mischung aus Mitleid und Respekt schreiben mir Menschen dann ihre Telefonnummer auf für den Fall, dass ich doch noch Unterstützung brauche. Schon bald trage ich in meinem Geldbeutel so viele Zettel mit arabischen Namen und Telefonnummern herum, dass ich sie mit Stichworten wie »Frau am Kiosk« oder »Taxifahrer spricht Englisch« versehen muss, um noch zu wissen, wer sich dahinter verbirgt.
Auch in meiner Nachbarschaft erwartet mich eine Überdosis Freundlichkeit. Anfang 2002 ziehe ich in eine geräumige Wohnung in Shaalan, dem modernen Stadtzentrum von Damaskus. In keiner Gegend der Hauptstadt lassen sich die Veränderungen im Land so eindrücklich mitverfolgen wie hier, Shaalan entwickelt sich zum Gratmesser der Modernität in Syrien. Im Laufe der fünf Jahre, die ich dort lebe, werden aus Bäckereien Benetton-Läden, eröffnet alle paar Monate ein neues Café, in dem man Cappuccino zu deutschen Preisen trinken kann, und verkauft jedes vierte Geschäft irgendwann Mobiltelefone. In den immer schicker anmutenden Krämerläden finden sich zunehmend westliche Produkte wie Müsli, Camembert, Vollkornbrot und Sojamilch. Und während junge Männer im Jahr 2002 noch schüchtern zu Boden sehen, wenn ihnen auf der Straße eine Ausländerin entgegenkommt, wagen ihre Altersgenossen fünf Jahre später die üblichen Pfiffe oder Sprüche.
2007 ergreife ich die Flucht und ziehe ein paar Straßen weiter in einen ruhigeren Teil der Neustadt. Die Altstadt mit ihren engen Gassen und dicken Mauern lockt mich nur besuchsweise. Viele Ausländer suchen sich dort traditionelle arabische Hofhäuser als Bleibe, in deren beschaulichen Innenhöfen man an plätschernden Brunnen unter Orangenbäumen sitzt und dabei die Welt um sich herum vergessen kann. So herrlich das inmitten der lauten, anstrengenden und abgasverpesteten Millionenmetropole Damaskus ist – als Journalistin fühle ich mich in der Altstadt zu weit weg von der syrischen Realität, vom politischen Alltag und dem pulsierenden Leben der Hauptstadt. Für mich ist die Neustadt zwischen dem Botschaftsviertel Al Malki und dem Marjeplatz, auf dem Syriens Freiheitskämpfer 1946 die syrische Fahne hissten und damit den Sieg über die französischen Besatzer feierten, der perfekte Standort. In Laufnähe befinden sich wichtige Institutionen wie das Parlament, diverse Ministerien, die Zentralbank, die staatliche Radio- und Fernsehanstalt, viele Botschaften und einige ausländische Kulturzentren wie das Goethe-Institut, das British Council und das französische Centre Culturel Français.
Obwohl die europäischen Kulturinstitute seit 2011 verwaist sind, gilt genau dieses Gebiet im aktuellen Konflikt als Damaskus’ stabiles Zentrum, in dem die Hauptstädter noch immer Cappuccino trinken und Partys feiern. Das dunkle Grollen der Raketen, mit denen das Regime die von Rebellen gehaltenen Vororte beschießt, ist hier zu einem alltäglichen Klangteppich geworden – bedrohlich, aber fern. Auch Präsident Bashar Al Assad hält sich vermutlich die meiste Zeit hier auf, zwischen seinem Stadthaus, das nur 300 Meter von meiner ersten Wohnung entfernt liegt, dem angrenzenden Gästehaus der Regierung und dem Präsidentenpalast, der etwas außerhalb auf einem Hügel über der Stadt thront.
Wer hier wohnt, hat Angst vor dem, was noch kommt. Denn abgesehen von vereinzelten Anschlägen, den vielen Straßensperren, den Preissteigerungen und gelegentlichen Stromausfällen lebt es sich in Damaskus’ Zentrum vergleichsweise normal. Um mit der Schizophrenie des Krieges fertig zu werden, der zwar allgegenwärtig ist, aber dennoch weit weg scheint, haben sich manche Damaszener in Assads Parallelwelt eingerichtet. Darin toben vor den Toren der Stadt radikal-islamische Terroristen, die der Westen geschickt hat, um ein unliebsames anti-imperialistisches Regime zu beseitigen. Die meisten meiner syrischen Freunde, die damals im modernen Zentrum von Damaskus wohnten, sehen das anders. Sie halten still oder sind ins Ausland geflohen – sunnitischer Mittelstand mit Verwandten in den USA, Europa oder am Golf.
Vor zehn Jahren sind wir uns hier ständig über den Weg gelaufen. Bei Einkaufstouren oder sonstigen Erledigungen begegnen mir von Anfang an oft Bekannte. »Was für ein Zufall!«, denke ich, schließlich leben in Damaskus fünf Millionen Menschen, von denen ich vielleicht gerade mal 20 kenne. Doch dann fällt mir der Spruch eines syrischen Freundes ein, den ich anfangs nicht ernst genommen hatte. Er meinte, Damaskus sei bis heute ein Dorf, und tatsächlich hat der Alltag in der syrischen Hauptstadt oft etwas Dörfliches. Um viele Ecken herum kennt jeder jeden, denn die ursprünglichen Bewohner von Damaskus entstammen einigen wenigen bekannten Damaszener Familien. Nachnamen spielen deshalb bei neuen Bekanntschaften eine viel größere Rolle als in Deutschland. In Damaskus gilt: Der Neffe deines Nachbarn könnte jederzeit mit der Cousine meiner Schwägerin verheiratet sein. »Beit mien?«, fragen die Damaszener deshalb, wenn sie jemanden kennenlernen, und erkundigen sich damit, zu welchem Haus, also zu welcher Großfamilie, die entsprechende Person gehört.
Nach Verhaltens- und Bewegungsmustern, die sich über die Jahrhunderte eingeschliffen haben, laufen die Menschen in Damaskus auf ausgetretenen Pfaden. Töpfe kauft man im Küchensuq, Gold bei den christlichen Juwelieren nahe der Omayadenmoschee, Gewürze im Kerne- und Gewürzsuq, bereits ausgehöhlte Auberginen und geschälte Kartoffeln bekommt man im Suq der faulen Hausfrauen in Shaalan, zum Kaffeetrinken geht man entweder ins Café Rawda oder Café Havana (wenn man wenig Geld ausgeben und Intellektuelle treffen möchte) oder in die erwähnten Hochglanzcafés von Shaalan, Flüge bucht man in einem der beiden zentral gelegenen Syrian-Airlines-Büros, Musik-CDs kauft man für ein bis zwei Euro in den etablierten Raubkopie-Läden der Neustadt, und wer in traditionellem Ambiente lecker essen möchte, begibt sich in eines der vier bis fünf stadtbekannten Restaurants in der Altstadt. Genügend Gelegenheiten also, sich über den Weg zu laufen.
Einsamkeit stellt sich bei mir deshalb nicht ein. Im Gegenteil. Mein ohne großes Zutun rasant wachsendes soziales Netzwerk und das intensive gesellschaftliche Miteinander werden mir eher zu viel. Zum Glück herrscht in der arabischen Welt ein anderes Zeitverständnis – man trifft sich viel unverbindlicher und spontaner als im Westen. Deshalb kommt selbst dann kaum Terminstress auf, wenn man sich ständig verabredet fühlt.
Bezeichnend für diesen anderen Umgang mit Zeit ist das Telefonverhalten der Damaszener. Ruft mich eine Freundin an, fragt sie spätestens im zweiten Satz »Wenik?«, »Wo steckst du?«. Ich könnte schließlich zufällig in ihrer Nähe sein, sodass man sich lieber schnell persönlich trifft, statt lange zu telefonieren. Langwieriges und kompliziertes Planen von Zusammenkünften, wie es in Deutschland üblich ist und dort oft gar nicht anders geht, findet in Syrien nicht statt. Wo bist du, was machst du, lass uns doch in einer halben Stunde im Café treffen – so geht Verabreden auf Syrisch.
Einzige Gefahr dabei ist, dass man als in Deutschland sozialisiertes Wesen Ankündigungen zu wörtlich und verbindlich nimmt. Der dahingesagte Satz »Lass uns Donnerstag treffen« bedarf noch mindestens dreier Anrufe, bis man zusammensitzt. Meldet sich niemand, sollte ich mir den Donnerstag nicht weiter freihalten.
Als Journalistin bedeutet diese andere Form der Terminplanung ebenfalls eine Umstellung. Rufe ich Politikwissenschaftler XY an und bitte um ein Interview, schaut dieser nicht lange in seinen Kalender, sondern erwidert entschuldigend, heute sei es etwas ungünstig, aber ich solle doch morgen um 11 Uhr zu ihm kommen. Hoppla, denke ich und gewöhne mich schnell an diese spontane Art des Arbeitens. Natürlich kann es passieren, dass ich dann am nächsten Tag pünktlich um 11 Uhr bei Herrn XY im Büro sitze und ewig warte, weil ihm noch irgendetwas dazwischengekommen ist. Besser also um zehn vor elf nochmal anrufen und immer schön flexibel bleiben.
DIE KUNST, ALLEIN ZU SEIN
Um mich zurückzuziehen und meine Ruhe zu haben, nutze ich den Freitag. Denn Freitag ist der muslimische Feiertag, der Beginn des syrischen Wochenendes und traditionell Familientag. Zwar werde ich regelmäßig von befreundeten syrischen Familien eingeladen oder weiß, dass ich dort jederzeit willkommen bin, doch meistens freue ich mich auf das Alleinsein. Die Straßen von Damaskus liegen am Freitagvormittag wie ausgestorben da. Mittags gehen viele Syrer zum Gebet in die Moschee, danach öffnen die ersten Händler ihre Geschäfte. Nur Schulen und Behörden bleiben das ganze syrische Wochenende, also Freitag und Samstag, geschlossen.
Das Alleinsein zu genießen ist eine ziemlich westliche Angewohnheit. Syrer sind wie alle Orientalen selten und meist ungern alleine. Zu Hause leben sie im Kreis einer großen Familie, das Verhältnis zu Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen ist eng. Wer dem verwandtschaftlichen Beziehungsgeflecht entkommen möchte, trifft sich mit Freunden, Nachbarn, Kollegen. Das Konzept von Privatsphäre, von individuellem Eigentum, von materieller Besitzstandwahrung und persönlichen Rückzugsräumen – sei es in Form eines eigenen Handtuchs, eines eigenen Kleiderschrankes oder eines eigenen Zimmers – entstammt dem Materialismus und Individualismus der westlichen Welt und ist der arabischen Kultur ursprünglich fremd.
Mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Handtuch. Während in deutschen Badezimmern jedes Familienmitglied sein eigenes Handtuch an einem bestimmten Ort hat (am besten an einem namentlich gekennzeichneten Haken), hängt in Syrien an jedem Waschbecken ein Handtuch, das von allen Familienmitgliedern benutzt wird. Aus Hygienegründen wird dieses Handtuch dann mindestens einmal am Tag, wenn nicht öfter, durch ein frisches ersetzt. Ein Deutscher wird es als unangenehm empfinden, dass außer ihm noch andere ihr Gesicht und ihre Hände mit dem gleichen Handtuch abtrocknen, ein Syrer ekelt sich bei dem Gedanken, eine Woche lang das gleiche Handtuch benutzen zu müssen.
Ähnlich ist es bei der Kleidung. Das T-Shirt des Bruders und die Jacke der Schwester zählen zum Allgemeingut, sie zu tragen ist unter Geschwistern oder Freunden selbstverständlich und bedarf keines expliziten Einverständnisses. Lobe ich den Schal einer Freundin, nimmt sie ihn ab und will ihn mir schenken – im Westen undenkbar, zu sehr hängen wir an materiellem Eigentum.
Die meisten syrischen Familien wohnen, essen und schlafen in ein und demselben Zimmer. Statt möblierter Wohn- und Schlafzimmer haben geschätzte 70 Prozent der Bevölkerung zwei bis drei größere Räume, die mit Sitzpolstern auf dem Boden tagsüber zum Wohnen und Essen genutzt werden und abends mit Matratzen zum Schlafen hergerichtet werden. Zwar gibt es in den Wohnungen der städtischen Mittel- und Oberschichtsfamilien durchaus Wohn-, Schlaf- und zunehmend auch Kinderzimmer, aber die meisten Jugendlichen in Syrien leben, spielen, schlafen und lernen in Gemeinschaft. Mein liebevoll hergerichtetes Gästezimmer, in dem sich Besucher aus Deutschland durchaus wohlfühlen, weckt deshalb bei syrischen Gästen eher Befremden. Sie fühlen sich dort abgeschoben, weil sie gar nicht das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Stattdessen schlafen sie lieber auf dem Sofa im Wohnzimmer – also dort, wo sich das Leben in der Wohnung abspielt.
Besonders deutlich wird der Unterschied zwischen westlichem Ruhebedürfnis und orientalischem Gemeinschaftssinn im Umgang mit Kranken. Muss ein Syrer ins Krankenhaus, zieht seine Familie gleich mit ein. Eltern und Geschwister versorgen und pflegen ihn, die weitere Verwandtschaft kommt regelmäßig vorbei. Auch für Nachbarn oder entferntere Bekannte schickt es sich, den Kranken zu besuchen – der Patient ist deshalb nie allein. Auch nachts nicht, denn mindestens ein Angehöriger schläft vor dem Krankenbett auf dem Boden. In einem deutschen Krankenhaus wäre diese familiäre Rundum-Dauerversorgung reiner Psychoterror und würde den Genesungsprozess in jedem Fall erschweren. In Syrien ganz das Gegenteil: Einen Verwandten im Krankenhaus sich selbst bzw. dem Pflegepersonal zu überlassen gilt als ungebührlich und schwere Vernachlässigung.
Die Tatsache, dass ich freiwillig alleine lebe und damit ganz zufrieden bin, ist für viele Syrer folglich schwer nachzuvollziehen. Generell ist es in der arabischen Welt ungewöhnlich, als unverheirateter junger Mensch alleine zu wohnen. In Syrien bleiben Männer und Frauen normalerweise bis zur Hochzeit bei ihren Eltern, weil eine eigene Wohnung schlicht zu teuer ist. Einzige Ausnahme sind Studierende, die zum Studium in eine andere Stadt ziehen und dort keine Möglichkeit haben, bei Verwandten unterzukommen. Auf dem Campus der Universität Damaskus zum Beispiel teilen sie sich dann zu sechst ein Zimmer im Wohnheim.
Als alleine wohnende Frau, noch dazu aus Deutschland und Journalistin, bin ich in meiner Nachbarschaft nach kurzer Zeit bekannt wie ein bunter Hund. Krämer, Handwerker und Internetcafé-Besitzer nicken und winken mir im Vorbeigehen zu. Im Saftladen bekomme ich jedes Mal eine Gratis-Kostprobe der neuesten Erdbeer-Limone-Minze-Mischung und der Bäcker gegenüber meiner Wohnung holt die Brotfladen für mich immer direkt aus dem Ofen. Nach drei Monaten fühle ich mich in Damaskus nicht nur zu Hause. Ich fühle mich willkommen, gut aufgehoben, umsorgt.
Verwandte, Freunde und Kollegen, die mich besuchen, sind von diesem sozialen Miteinander beeindruckt. Die meisten kommen, um meinen mutigen Überlebenskampf unter arabischen Schurken zu verfolgen, und sind dann überrascht bis enttäuscht, wie leicht, fröhlich, sicher und angenehm mein Alltag abläuft.
Am ersten Morgen muss jeder meiner frisch angereisten Besucher eine Mutprobe bestehen. Mit einem Fünf-Lira-Stück (umgerechnet damals etwa acht Cent) in der Hand schicke ich die Person nach unten, um beim Bäcker gegenüber frisches Fladenbrot zu kaufen. Ich verfolge das Geschehen belustigt von meinem Wintergarten im zweiten Stock aus. Der alte Bäcker wirft mir ein verschmitztes Lächeln zu und führt den Gast aus Deutschland in seine kleine, schummrige, heruntergekommene Backstube, die aus einer einfachen Arbeitsfläche, dem runden Steinofen und ein paar Säcken Mehl besteht. Sein Gehilfe schiebt einige runde Teigklumpen in den Ofen, die darin innerhalb von Sekunden zu knusprigen Fladen aufgehen. Dann nimmt er drei davon, wickelt sie in Zeitungspapier und drückt sie meinem staunenden Besucher in die Hand. Mit einem gewissen Stolz bringen die meisten dann das warme Brot nach oben – Mutprobe bestanden. Die eigentliche Kunst besteht jedoch darin, sich das Brot nicht schenken zu lassen, denn meist weigert sich der alte Bäcker, die fünf Lira zu nehmen. Das gehört in Syrien jedoch zu einem Höflichkeitsritual: Der Verkäufer tut so, als wolle er für seine Ware kein Geld, der Käufer muss so lange insistieren, bis er bezahlen darf. Aus deutscher Sicht ein seltsames Spiel, das Besucher anfangs nicht durchschauen.
Die erste Freundin, die sich im Sommer 2002 zu mir nach Syrien traut, kommt tatsächlich mit dem Brot und den fünf Lira zurück und versichert mir leutselig, der Bäcker habe das Geld nicht nehmen wollen. Beim nächsten Einkauf begleiche ich diese »Schulden« unauffällig, dem nächsten Besucher schärfe ich dann ein, dem Bäcker die Münze energisch in die Hand zu drücken oder auf den Tresen zu legen. Nach nur zwei Tagen erkennt besagte Freundin: »Um dich in Damaskus muss man sich echt weniger Sorgen machen als um mich in Hamburg.«
Tatsächlich habe ich mich noch nirgends so sicher gefühlt wie in Syrien – als Mensch, als Frau, erst recht als Frau alleine. Ich trage das Gleiche, was ich in Deutschland anhabe: respektvolle Kleidung, eher lang als kurz. Ich kann mich frei bewegen, komme zu Fuß, im Minibus oder Taxi überall hin. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne mich um meine Tasche oder mein Wohlergehen sorgen zu müssen. Überfälle, Vergewaltigungen und sexuelle Belästigung sind selten, im Straßenbild begegnen mir weder Betrunkene noch sonstige Drogensüchtige oder gebrochene Menschen, wie ich sie aus deutschen Großstädten kenne. Natürlich gibt es viele Arme, auch Bettler, aber sie strahlen Würde aus und haben sich keineswegs aufgegeben.
Allgemein herrscht auf der Straße, in den Läden der Neustadt und den Suqs der Altstadt eine entspannte heitere Atmosphäre (mit Ausnahme des Autoverkehrs!). Der Nächste, der einem über den Weg läuft, ist in Syrien potenziell mein Freund, nicht mein Feind bzw. Konkurrent. Hier denken die Menschen nicht sofort »Der will mir etwas wegnehmen« – statt mit grundsätzlichem Misstrauen begegnen sich die Syrer mit instinktivem Vertrauen. In der Altstadt klemmen viele Händler noch heute einen Holzstock in die geöffnete Ladentür, um zu signalisieren, dass sie mal eben beten oder Geld wechseln sind. Bei meinem ersten Versuch, eine syrische Tageszeitung zu kaufen, stelle ich fest, dass diese positive Grundhaltung auch für Fremde gilt. Ich gehe zum Kiosk, habe aber nicht genug Kleingeld und der Verkäufer kann nicht wechseln. Ohne zu zögern, drückt er mir die Zeitung in die Hand und sagt »bukra inshaAllah«, »Morgen, so Gott will, bringst du mir das Geld«. Der Mann hat mich noch nie gesehen, aber vertraut erst mal auf meine Ehrlichkeit.
STUNDEN IM MINISTERIUM, NÄCHTE AM FLUGHAFEN
Die persönlichen Begegnungen und netten Gesten des Alltags entschädigen für die vielen Stunden, die ich im Informationsministerium mit Warten und Teetrinken verbringe. Dort weiß man nicht recht, wie man mit mir umgehen soll. Eine westliche Journalistin, die nicht nur für eine gezielte Recherche kommt und die nicht nach ein bis zwei Wochen das Weite sucht, hat es in Syrien bislang nicht gegeben. Einerseits will man mir helfen, andererseits bin ich gesetzlich nicht vorgesehen, es gibt für die Verantwortlichen schlicht keine Handhabe. Zwar berichten chinesische, iranische und russische Korrespondenten aus Damaskus, aber sie stammen aus verbündeten Staaten oder den ehemaligen sozialistischen Bruderländern. Der »Westlichste« der Kollegen ist bis zu meiner Ankunft ein Bulgare.
Der für ausländische Medien zuständige Herr im Informationsministerium behandelt mich freundlich und zuvorkommend, macht mir aber irgendwann klar, dass er keine Chance auf eine offizielle Akkreditierung sieht. Ohne Akkreditierung bekomme ich jedoch keine Aufenthaltsgenehmigung und so muss ich alle drei Monate mit einem Brief des Informationsministeriums zur Ausländerbehörde traben, um mein Journalistenvisum verlängern zu lassen. Das freudige Hallo mancher Uniformierten dort entschädigt leider irgendwann nicht mehr für den erwähnten Spießrutenlauf. Sobald ich das Land verlasse, muss ich wie jeder andere deutsche Journalist ein neues Visum beantragen, immer verbunden mit dem Risiko, dieses Mal keines zu bekommen. Die Tatsache, dass Damaskus längst mein Lebensmittelpunkt ist mit eigener Wohnung, Freunden und Bekannten, interessiert die Bürokratie herzlich wenig.
Mehrfach gibt es bei meiner Ankunft am Flughafen von Damaskus Probleme mit meiner Wiedereinreise. Das erste Mal im März 2003 habe ich als besonders schrecklich in Erinnerung. Die Visumsbestätigung des Informationsministeriums, die manchmal aus Zeitgründen nicht über das Außenministerium an die syrische Botschaft in Berlin, sondern direkt an die Passkontrolle des Flughafens geschickt wird, ist dort nicht angekommen bzw. nicht aufzufinden. Die Grenzbeamten lassen mich nicht ins Land.
Es ist Donnerstagabend, das Wochenende hat begonnen, im Informationsministerium ist niemand mehr zu erreichen. Ich fühle mich elend, so als hätte mir jemand meine eigene Wohnungstür vor der Nase zugeschlagen. »Ich will doch nur nach Hause, ich wohne hier«, erkläre ich den Grenzern in meinem Damaszener Gossenarabisch, aber die zucken nur hilflos mit den Schultern. Vorschrift ist Vorschrift.
Die längsten Stunden meines Lebens beginnen. Irgendwann sitze ich im vollgequalmten Büro des Chefs der Einwanderungsbehörde in einem tiefen schwarzen Sessel, um mir von dem Offizier mit den vielen Sternen auf den Schulterklappen erzählen zu lassen, dass ich natürlich willkommen sei in Syrien und lediglich etwas Geduld bräuchte. Verzweifelt telefoniere ich mit Freunden und Verantwortlichen, die auf verschiedenen Wegen versuchen, mir zu helfen. Resigniert lege ich mich irgendwann auf die Stühle im Transitbereich und versuche zu schlafen. Den Gang zur Toilette vermeide ich so lange wie möglich, denn die Sanitäranlagen des Flughafens sind damals eine Zumutung. Ich warte ab, was passiert, frage zwischendurch bei den Grenzsoldaten nach, ob es etwas Neues gibt, und verliere irgendwann das Zeitgefühl. Die Beamten der Spätschicht gehen nach Hause, als sie 24 Stunden später wiederkommen und mich immer noch durch die Hallen schleichen sehen, ernte ich mitleidige Blicke. Irgendwann am Samstagmittag kommt das ersehnte Okay, von wem genau ist mir inzwischen egal, ich bin am Ende meiner Kräfte und will nur noch nach Hause.
Im Vergleich dazu ist meine Abschiebung im April 2011 geradezu erträglich. Die Rahmenbedingungen sind inzwischen ganz andere, die offiziellen wie die privaten. Ich wohne mit meinem syrischen Mann und zwei Kindern in Berlin und fliege regelmäßig zu Recherchen und Familienbesuchen nach Syrien. Seitdem ein Artikel von mir aus dem Jahr 2009 über die Machtfolge der Assads in fehlerhaftes und teilweise beleidigendes Arabisch übersetzt wurde, habe ich Ärger mit den syrischen Behörden und offiziell Berufsverbot. Als Ehefrau eines Syrers bekomme ich trotzdem ein Besuchervisum, mit dem ich noch im Februar 2011 problemlos nach Damaskus reisen kann. Zwei Monate später jedoch hat der arabische Frühling Syrien erreicht, seit Mitte März gehen die Menschen demonstrieren, westliche Medien sind unerwünscht.
Das gilt auch für mich, merke ich, als ich dem Grenzbeamten mit einer freundlichen arabischen Bemerkung meinen Pass mit dem Touristenvisum hinüberschiebe und mit Spannung verfolge, wie er die Daten in den Computer eingibt. Erwartungsgemäß erscheine ich auf seinem Bildschirm als deutsche Radio-Korrespondentin und seine Augen beginnen, nervös zu flackern. Er holt einen Kollegen, der holt seinen Vorgesetzten und am Ende lande ich im gleichen Büro wie damals, nur die Ledergarnitur und der Offizier sind neu. Letzterer erklärt mir, dass sie strikte Anweisung haben, Journalisten nur mit Genehmigung des Informationsministeriums ins Land zu lassen. Mein Einwand, nicht als Journalistin vor ihm zu stehen, sondern als Ehefrau eines Syrers, die lediglich ihre Schwiegermutter besuchen wolle und dafür ein gültiges Touristenvisum vorweisen könne, bringt mich nicht weiter.
Ich nutze die Wartezeit, um mir die Bilder von meinem ersten unfreiwilligen Aufenthalt am Damaszener Flughafen ins Gedächtnis zu rufen. Die schäbigen Hallen von damals haben sich in marmorglänzende Abfertigungs- und Aufenthaltsbereiche verwandelt, im gesamten Flughafengebäude herrscht Rauchverbot. Die Büros des Grenzschutzes wurden frisch gestrichen und die Soldaten tragen modern geschnittene schwarze Uniformen statt der dunkelgrünen im 80er-Jahre-Look. Die Neuerungen sind jedoch oberflächlich, bei genauerem Hinsehen merke ich, dass sich an den Arbeitsabläufen kaum etwas geändert hat. Angerostete Aktenschränke quellen über, auf den Schreibtischen stapeln sich zusammengeheftete Papiere und Mappen, Grenzbeamte tragen Dokumente hin und her, telefonieren mit Vorgesetzten, trinken Tee und zünden sich direkt unter dem »Rauchen verboten«-Schild eine Zigarette an.
Einige Stunden und Telefonate später ist klar, dass das Informationsministerium dieses Mal nichts für mich tun kann und niemand das Risiko eingehen wird, eine Journalistin zum Besuch ihrer Schwiegermutter ins Land zu lassen. Die Grenzbeamten nehmen mir meinen Pass ab und schicken mich in den Transitbereich, bis die nächste Maschine der von mir gebuchten Fluggesellschaft zurück nach Deutschland fliegt. Auch dieses Mal will die Zeit nicht vergehen, aber der Aufenthalt ist deutlich angenehmer als acht Jahre zuvor. Die Sanitäranlagen sind geräumig und in vorbildlichem Zustand. Es gibt einen großen Duty-free-Shop, ein Café, einen Imbiss und diverse Filialen von Herstellern arabischen Gebäcks.
Die Mitarbeiter am Flughafen erweisen sich als hilfsbereit. Ein Vertreter des Geheimdienstes begleitet mich zur Gepäckaufbewahrung, damit ich aus meinem dort gestrandeten Koffer einen Pulli und meine Zahnbürste herausholen kann, ein Keksverkäufer lädt mein Handy an seinem Ladegerät hinter dem Tresen auf. Als mir am nächsten Morgen der alte Mann, neben dessen Laden ich die halbe Nacht auf einer Bank lag, einen süßen heißen Tee bringt, bin ich froh, dass sich an der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen bei aller Grausamkeit des Regimes noch nichts geändert hat.
Meinen formalen Durchbruch als deutsche Journalistin in Syrien erlebe ich im September 2004. Nach drei Jahren des Hoffens und der Enttäuschungen, der Unsicherheit und Einreiseschwierigkeiten erhalte ich endlich einen syrischen Presseausweis. Damit bin ich offiziell beim Informationsministerium akkreditiert und kann eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Zwar muss ich sowohl die Akkreditierung als auch die Aufenthaltsgenehmigung jedes Jahr erneuern lassen und dafür mindestens drei Tage Behördengänge einplanen, aber egal.
Zu verdanken habe ich diese Entscheidung personellen Veränderungen und glücklichen Umständen innerhalb des Ministeriums. Trotz der Zustimmung der Geheimdienste (ohne die in Syrien gar nichts geht) hatte sich jahrelang keiner der Informationsminister getraut, seine Unterschrift unter meinen Journalistenausweis zu setzen, aus Angst, für die Berichterstattung einer westlichen und damit potenziell gefährlichen Journalistin verantwortlich gemacht zu werden. Die Absegnung meines Antrags war schließlich eine der letzten Amtshandlungen eines scheidenden Ministers, der dadurch nichts mehr zu befürchten hatte. Im September 2004 feiern mich meine syrischen Kollegen also als erste westliche Korrespondentin in Syrien – Geduld und Hartnäckigkeit hatten sich gelohnt.
DIE BÜRDE DES MONOPOLS
Die Einzige zu sein hat auf den ersten Blick viele Vorteile. In der ohnehin überschaubaren Gemeinschaft der Damaszener Journaille kennt man sich schnell, bei Pressekonferenzen schwenken die Kameras immer irgendwann auf mich, damit der Eindruck entsteht, auch internationale Medien interessierten sich für das Thema. Freunde erzählen mir dann, sie hätten mich mal wieder »im Fernsehen gesehen«.
Termine zu bekommen ist relativ unkompliziert – vor allem in den ersten Jahren bis 2005, in denen sich wirklich kaum ein westlicher Kollege nach Damaskus verirrt. Syrische Minister freuen sich damals fast über Interview-Anfragen. Allerdings treffe ich offizielle Regime-Vertreter nur selten, wichtiger sind für mich kluge Analysten, gut informierte Kollegen und die wenigen im Westen ausgebildeten syrischen Politikwissenschaftler. Auch diese haben meist kurzfristig Zeit für mich, weil kaum jemand sonst auf ein persönliches Interview wartet – keine amerikanischen, keine französischen, keine britischen Kollegen.
Doch die Position als einzige deutsche Syrien-Korrespondentin bringt auch eine große Verantwortung mit sich, mit der ich anfangs nicht gerechnet hatte. Bewusst wird mir diese erst bei Interviews mit deutschen Radiosendern. Moderatoren des Deutschlandfunks beispielsweise fragen gerne mal Grundsätzliches wie »Ist Syrien ein terroristisches Land?«, »Hat Syrien ein Kurdenproblem?« oder »Wer hat die Macht in Damaskus?«. Anfangs fühle ich mich unbehaglich. Wer bin ich, den Deutschen zu sagen, dass Syrien – Daumen rauf oder runter – ein terroristisches Land ist oder nicht?
Die Tatsache, dass außer mir keine anderen deutschsprachigen Journalisten aus Damaskus berichten, gibt meinen Worten eine solche Bedeutung, dass ich diese mit großer Vorsicht wählen muss. Natürlich berichten die Hörfunkkollegen des ARD-Studios Amman und die Nahost-Korrespondenten großer deutscher Zeitungen von Kairo oder Istanbul aus gelegentlich über Syrien. Und natürlich haben internationale Nachrichtenagenturen wie Reuters, AP, AFP und dpa syrische Mitarbeiter in Damaskus, die sie mit schnellen Informationen versorgen. Aber wenn es darum geht, unvorhergesehene Ereignisse wie den Angriff israelischer Militärflugzeuge auf ein angebliches Trainingslager für Terroristen nördlich von Damaskus im Oktober 2003 zu kommentieren, haben deutsche Radiosender kaum Möglichkeiten, meine Aussagen vom Ort des Geschehens zu überprüfen.
Gerade im Falle Syriens – einem Land, das schwer zugänglich ist und selbst Nahost-Kennern viele Rätsel aufgibt – ist es hilfreich, über einen längeren Zeitraum dort zu leben. Denn politische Entwicklungen und gesellschaftliche Sichtweisen lassen sich umso besser durchschauen und verstehen, je tiefer man in die Regime-Strukturen eindringt und je näher man den Menschen ist. Gleichzeitig wächst dadurch die Lücke zwischen mir und meinen Rezipienten. Eine selbst unter Deutschlandfunk-Hörern weitverbreitete Ahnungslosigkeit in Sachen Syrien erschwert meine Berichterstattung. Grundsatzfragen wie die oben genannten bieten sich vielleicht für eine halbseitige Zeitungsanalyse an. Aber in einem dreiminütigen Live-Interview zu erklären, wer die Macht in Syrien hat, und dabei nicht einmal davon ausgehen zu können, dass alle Hörer wissen, wo Syrien auf der Landkarte liegt, stellt durchaus eine Herausforderung dar.
Diese Unkenntnis verstärkt Syriens ohnehin schon ausgeprägtes Imageproblem, das zum Teil selbstverschuldet, zum Teil aber auch unberechtigt ist. Wer nie dort war, neigt zu negativen Pauschalurteilen, wer hinfährt, ist begeistert von den gastfreundlichen, offenen Menschen, die so gar nicht zum Bösewicht-Image passen wollen. In jedem Fall reagieren die Menschen in Europa überraschend emotional auf das Land.
Für viele klingt Syrien nach Schurke und Damaskus nach Tausendundeiner Nacht. Ich habe es oft getestet, anfangs unbewusst, irgendwann gezielt – auf Flughäfen, im Zug, bei offiziellen Anlässen oder privaten Einladungen. Antworte ich auf die Frage nach meinem Wohnort mit »Syrien«, sind die Leute besorgt bis entsetzt (»Ist das nicht gefährlich?«, »Können Sie als Frau denn da so alleine leben?«). Antworte ich dagegen mit »Damaskus«, ernte ich mindestens ein anerkennendes »Ah«, wenn nicht ein neidvolles »Wie spannend« oder ein verzaubertes »Da wollte ich schon immer mal hin«.
Natürlich komme ich gegen jahrzehntelang etablierte Klischees von der unterdrückten verschleierten Frau und dem fanatischen muslimischen Gotteskrieger nicht an. Aber mir reicht es schon, den einen oder anderen Hörer nachdenklich zurückzulassen, indem ich am Ende einer Reportage erwähne, dass diese erfolgreiche wortgewandte Architektin, mit der er sich gerade identifizieren wollte, Kopftuch trägt. Oder dass der junge Mann, der sich so rührend um seine kranke Mutter und die kleinen Geschwister kümmert, dessen Auftreten so gar nichts von einem Macho oder einem Waffennarr hat, am nächsten Tag als freiwilliger Kämpfer in den Irak ziehen wird.
Das bedeutet nicht, dass es die unterdrückte Frau und den Gotteskrieger nicht gibt – natürlich gibt es sie. Aber nicht in dem Umfang, wie uns die Berichterstattung westlicher Massenmedien glauben macht, denn die überwiegende und deshalb nicht ganz unwesentliche Mehrheit der Menschen in der arabischen Welt lebt, denkt und fühlt gar nicht so anders als wir. Das ist nur leider keine journalistische Nachricht und folglich keinen Bericht wert. Ich führe den Kampf gegen Klischees deshalb möglichst subtil und entlarve Vorurteile am liebsten nebenbei. Mein Ziel ist es, die verschiedenen Facetten dieser Gesellschaften aufzuzeigen, die vielschichtigen Ursachen für Hass und Gewalt darzulegen und den Menschen mit seinen überall auf der Welt ähnlichen Gedanken und Gefühlen in den Mittelpunkt der Geschehnisse zu stellen.
Damit handele ich mir jedoch regelmäßig Ärger ein – nicht in Syrien, sondern in Europa. Denn in kaum einer Weltregion herrschen so oberflächliche Freund-Feind-Schemata wie im Nahen Osten. In den palästinensischen Gebieten gilt Fatah als gut, Hamas als böse. Im Libanon ist Ex-Ministerpräsident Saad Hariri der Good Guy, Hisbollah der Bad Guy. Saudi-Arabien und Ägypten unter Mubarak waren stets Verbündete des Westens und damit gut (unabhängig davon, dass saudische Frauen weder Auto fahren noch lebensrettende Medikamente ohne das Einverständnis eines männlichen Verwandten bekommen dürfen und dass Mubaraks Regime jahrzehntelang Oppositionelle verfolgte), Syrien und Iran kritisieren Israel (das auf dem Golan bis heute syrisches Land besetzt und im Westjordanland und in Ost-Jerusalem völkerrechtswidrig Siedlungen baut) und sind folglich böse.
Die innenpolitische Lage spielte bei dieser Kategorisierung jahrelang eine völlig untergeordnete Rolle, bis 2009 im Iran und 2011 in Syrien Proteste ausbrechen und das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten das negative außenpolitische Bild bestätigt. Manchmal gibt es Bewegung im Schurkenkarussell: Libyens Staatschef Gaddafi ist zunächst ein echter Schurke, darf die Achse des Bösen aber verlassen, als er im Dezember 2003 ankündigt, auf Massenvernichtungswaffen und sein Atomprogramm zu verzichten. Dass in Libyen die Dinge innenpolitisch deswegen trotzdem nicht zum Besseren standen, wissen wir spätestens, seitdem libysche Rebellen mithilfe der NATO den ungeliebten Despoten im August 2011 stürzten und zwei Monate später töteten.
Mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei versuchen Journalisten, die komplexen Zusammenhänge in Nahost einem breiten Publikum in Europa verständlich zu machen. Ihre vereinfachende Darstellung hilft dabei, emotional Partei zu ergreifen nach dem Motto: Wer so denkt, redet, aussieht oder handelt wie wir, muss ja gut sein. Alle anderen wirken auf uns fremd und machen folglich Angst. Dem Fremden das Furchterregende zu nehmen, indem ich ihn wieder vermenschliche, ohne ihn dabei zu verklären, ist mein Anliegen. Denn erst wenn ich den vermummten Hamas-Kämpfer und den ultraorthodoxen jüdischen Siedler als Menschen mit bestimmten Überzeugungen, Ängsten und Absichten wahrnehme und darstelle, kann ich Verständnis für seine Positionen entwickeln, auch wenn ich diese nicht teile. Und nur so komme ich den wahren Problemen dieser Region auf den Grund.
Natürlich muss auch ich vereinfachen. Aber das unreflektierte Zuordnen bestimmter Attribute wie »gemäßigt«, »prowestlich«, »radikal-islamisch«, »fundamentalistisch« oder »terroristisch« schafft in den Köpfen der Menschen ein unzulässiges Bild von Gut und Böse, das mit der Realität vor Ort nichts zu tun hat. Dass wir uns damit selbst keinen Gefallen tun, zeigt sich immer dann, wenn das von den Journalisten gezeichnete Bild mit der Wirklichkeit kollidiert wie beispielsweise im Januar 2006 beim Wahlsieg der Hamas in den palästinensischen Gebieten. »Wie kann eine Bande von Selbstmordattentätern demokratische Wahlen gewinnen?«, fragte sich mancher Zeitungsleser in Deutschland. Dass die Hamas eine ernst zu nehmende politische Kraft mit wachsender Popularität unter den Palästinensern geworden war, hatten die Medien im Vorfeld nicht zur Genüge vermittelt.
Im Falle Syriens gleicht der Umgang des Westens mit dem Assad-Regime einer wenig überzeugenden Achterbahnfahrt, die Präsident Bashar Al Assad jahrelang erfolgreich ausgesessen hat. Vom aufgeschlossenen, aber unerfahrenen Technokraten, der im Jahr 2000 das Erbe seines Vaters Hafiz Al Assad antrat und auf den Europas Staatschefs große Hoffnungen setzten, wurde Bashar zwischen 2003 und 2007 zur Persona non grata. Die Hintergründe dafür waren Syriens Ablehnung des US-geführten Krieges im Irak sowie Damaskus’ bis heute ungeklärte Rolle beim Mordanschlag auf Libanons ehemaligen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri. Als sich in den Jahren 2008 und 2009 das syrisch-libanesische Verhältnis entspannte, stieg Bashar Al Assad wieder zum begehrten Gesprächspartner westlicher Staatschefs auf, die in ihm einen Mittelsmann zu international mehr oder weniger geächteten Gruppierungen wie Hamas und Hisbollah sahen. Seit Ausbruch der zunächst friedlichen Proteste gegen das syrische Regime im März 2011 ist der Westen dann wieder schrittweise auf Distanz zu Assad gegangen. Aus dem jungen, hoffnungsvollen Modernisierer wurde der brutale Diktator, mit dem die USA und Europa nichts mehr zu tun haben wollen. So weit die Wahrnehmung von außen.
Für meine Arbeit bedeuten dieser schizophrene Umgang mit dem Assad-Regime und die vorgefertigten Meinungen über Syrien, dass ich als Journalistin stets auf einem schmalen Grat wandele. In Zeiten offener Feindseligkeit gegenüber Damaskus zu versuchen, Syriens außenpolitische Positionen zu erklären – wohlgemerkt nicht zu verteidigen, lediglich zu erklären –, macht mich in den Ohren mancher Radiohörer schon zu einer Sprecherin des Regimes. Und auf die vielen vermeintlichen oder echten Islamisten hinzuweisen, die infolge juristischer Willkür für Jahre im Gefängnis verschwinden und in Syrien die Mehrheit der politischen Gefangenen stellen, während Europäer und Amerikaner gerade den säkularen Charakter des Assad-Regimes als Bollwerk gegen den gefürchteten Islamismus loben, macht mich mindestens zur Spielverderberin.
VON DER FREIHEIT, AUF DEUTSCH UND FÜR DAS RADIO ZU ARBEITEN
Wie also kann ich als deutsche Journalistin in Syrien arbeiten? Zensur, Überwachung, Geheimdienste – alles kein Thema? Erstaunlicherweise lässt man mich weitgehend gewähren. Das Informationsministerium interessiert sich insgesamt wenig für meine Arbeit, nur für manche Recherchen brauche ich eine Genehmigung, beispielsweise für eine Fahrt auf den Golan oder eine Reportage über irakische Flüchtlinge in Syrien. Meistens fragt mich niemand, woran ich gerade arbeite, und niemand verlangt, meine Texte zu sehen – zensiert werde ich in den sieben Jahren als Journalistin in Syrien tatsächlich nie.
Diese relative Freiheit hat nicht nur Kollegen, sondern auch mich selbst oft überrascht. Inzwischen denke ich, dass mir eine große Portion Glück sowie bestimmte Umstände und Verhaltensweisen geholfen haben. Zum einen habe ich stets mit offenen Karten gespielt und nie etwas bewusst verheimlicht. Von Anfang an betrete ich Syrien als Journalistin und versuche nie, mich als etwas anderes auszugeben. Nachfragen bezüglich meiner Arbeit beantworte ich stets offen und ehrlich. Das gilt auch für den Umgang mit Geheimdiensten.