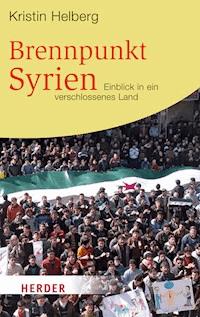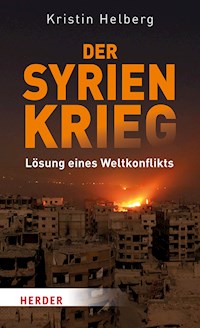Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wegschauen funktioniert nicht mehr – zumindest nicht in Syrien. Das Land hat sich zum Schlachtfeld regionaler und internationaler Interessen entwickelt. Die Menschen vor Ort werden im Stich gelassen – politisch, militärisch und humanitär. Und es ist kein Ende in Sicht. Das rächt sich: Hunderttausende suchen Schutz in Europa - Sunniten, Alawiten, Christen, Kurden. Vor allem kommen sie nach Deutschland. Kristin Helberg hat sieben Jahre in Syrien gelebt und ist über ihre syrische Familie und viele Freunde eng mit dem Land verbunden. Sie weiß, wie es jenen geht, die bis heute in Syrien ausharren, und jenen, die versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Sie kennt die syrische Geschichte, Politik und Mentalität wie kaum jemand sonst. Warum haben so viele Angst vor den Syrern? Was erwarten wir von ihnen - und was erhoffen sie sich von uns? Die Zeit der Kuscheltiere am Bahnhof ist vorbei. Niemand klatscht mehr, wenn Geflüchtete aus dem Zug steigen. Was muss jetzt getan werden, damit die syrische Katastrophe nicht zu einer deutschen wird? Endlich das erste Buch zum Thema "Syrer bei uns".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kristin Helberg
Verzerrte Sichtweisen
Syrer bei uns
Von Ängsten, Missverständnissen und einem veränderten Land
»Syrien ist die Wiege der Zivilisation
und das Grab der Menschlichkeit,
der Beginn der Kultur
und das Ende der Moral.«
Firas Lutfi, deutsch-syrischer Aktivist auf Facebook
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Christian Langohr
Umschlagmotive: © Getty Images / Westend61 / Michelle Fraikin – © Lev Fedoseyev/ITAR-TASS Photo/Corbis
Karte Syrien: © 2016 Klaus Kühner, www.huettenwerke.de
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (E-Book) 978-3-451-80756-5
ISBN (Buch) 978-3-451-31157-4
Inhalt
Vorbemerkung – Ein verändertes Land
Damaskus, Aleppo, al-Raqqa – Ein Staat löst sich auf
Wie ich von einer Nahostkorrespondentin zur »Syrien-Expertin« und »Expertin für Syrer« wurde
Syrien historisch. Ein kurzer Blick zurück
Stabilität durch Grabesruhe – Vater Assad
Wirtschaftliche Öffnung und politische Denkverbote – Bashars erstes Jahrzehnt
Außenpolitischer Druck, Zusammenhalt im Innern
Von der Revolution zum Stellvertreterkrieg
Verlassenes Volk, zerfallendes Land – Syrien heute
Zivilisten schützen und versorgen – Eine Lösung ist möglich
Syrer bei uns – Warum wir Angst haben und uns missverstehen
Tücken des Alltags – Aufeinander zu oder aneinander vorbei?
Ein Griff in die Klischeeschublade: Vorurteile, Rassismus und Schwarz-Weiß-Denken
Umarmen, küssen oder Hand aufs Herz: Wie viel Nähe wollen wir?
Ich und wir – Der Einzelne und die Gemeinschaft
Von Familiengefügen und Kindererziehung, Großzügigkeit und moralischer Flexibilität
Wie eine Gesellschaft aus Individuen entsteht
Gerne alleine oder unfreiwillig einsam
Meins oder unseres: Wem gehört was?
Zu Hause viel los: Privatsphäre und Gastlichkeit
Mülltrennung, Tierliebe und die Missachtung des öffentlichen Raumes
Planlose Orientierung: Nur nicht unter die Räder kommen
Männerherrschaft, selektive Korantreue und Feministinnen mit Kopftuch
Liebe, Sex und Doppelmoral
Auch wir sollten ehrlich sein
Medial vermittelte Bilder und der Westen als Projektionsfläche
Respekt vor dem »Nein« muss gelernt werden
Die Frau als Objekt und Sexismus im Alltag
Mit patriarchaler Interpretation brechen, den Koran zeitgemäß auslegen, neue Allianzen knüpfen
Ausbeutung und Missbrauch, Teilhabe und Solidarität – Unser Verhältnis zum Staat
Die Angst vor Uniformierten, wasta und der Traum von Gerechtigkeit
Studieren und arbeiten: Steine auf dem Weg
Föderalismus und Verteilung: Wer kriegt was und geht wohin?
Das Missverständnis vom reichen Deutschland und die Entdeckung des Sozialstaats
Dazugehören: Sprache lernen und Geld verdienen
Mut zum Bekenntnis: Was jetzt zu tun ist – und was nicht
Germanen-Gen oder Grundgesetz-Deutsche?
Wo Panikmache auf fruchtbaren Boden fällt
Freiheit braucht Toleranz
Das »jüdisch-christliche Abendland« als Kampfbegriff
Gemeinsame Wurzeln: vergessen und verdrängt
Warum wir den Islam überschätzen
Vom Terror nicht erschüttern lassen
Syrer bei uns – Ein 7-Punkte-Programm
Punkt 1: Probleme ehrlich benennen
Punkt 2: Einwanderung, aber richtig
Punkt 3: Weg vom Gesetz, hin zum Vertrag
Punkt 4: Zauberformel Patenschaft und viele gute Ideen
Punkt 5: Normalisieren und sichtbarer machen
Punkt 6: Auf dem Kopf und in der Schule
Punkt 7: Mutig voran mit »Vielfalt in Einheit«
Syrienkarte
Weiterführende Literatur
Über die Autorin
Vorbemerkung – Ein verändertes Land
Die Zeit der Kuscheltiere am Bahnhof ist vorbei. Niemand klatscht mehr, wenn Geflüchtete aus Zügen steigen. »Wir sind das Volk« – dafür gibt es inzwischen mehr Applaus, für das deutsche Volk, dessen Identität in Gefahr zu sein scheint. Unkontrollierte Massenzuwanderung, Asylchaos, Obergrenzen, Terroranschläge und immer wieder »Flüchtlingswellen«, die uns »überfluten«. Darunter Hunderttausende Syrer, die stets eine Masse bilden: im Boot auf dem Mittelmeer, in Trecks auf dem Balkan, als Gestrandete am Grenzzaun, als Wartende in der Notunterkunft. Unsere Augen sehen Massen, keine Menschen. Und deshalb haben wir Angst. Zu viele, dazu überwiegend junge Männer und dann auch noch Muslime kommen nach Deutschland – das Ende des Abendlandes scheint nah. Mindestens der Untergang der deutschen Kulturnation – was immer das sein soll.
Wie geht es weiter? Wie können so viele Geflüchtete versorgt, ausgebildet, integriert werden? Noch dazu in ihrem Zustand: oftmals erschöpft, mittellos und traumatisiert. Dieses Buch handelt von uns und den mehr als 500.000 Syrern, die seit 2011 nach Deutschland gekommen sind. Die alles riskiert haben und endlich aus den Albträumen erwachen wollen, die sie seit Jahren verfolgen. Darin geht es um Bomben und Folter, um Verfolgung, Zerstörung, Vertreibung und Hunger. Um Perspektivlosigkeit, Entbehrung und Ablehnung. Und um Angst, große Angst. Womit wir eine erste Gemeinsamkeit gefunden hätten: Wir haben Angst und die Syrer haben Angst. Keine gute Ausgangsposition, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber und der beste Nährboden für politische Manipulation und Agitation.
Für mich ist mit den Syrern auch Vertrautheit nach Deutschland gekommen. Nach sieben Jahren in Damaskus empfinde ich Syrien als zweite Heimat, deren Menschen und Alltagskultur ich immer wieder vermisse. Während ich mich also über Damaszener Slang im ICE freue, klingt dieser für die anderen mindestens fremd, vielleicht bedrohlich. Deshalb will ich versuchen, mit diesem Buch ein paar Pfeiler in den Boden zu rammen – auf dass wir gemeinsam darauf Brücken bauen.
Vielerorts werden aus Massen wieder Menschen. Kinder erzählen von neuen syrischen Mitschülern, der Chef stellt einen syrischen Praktikanten vor, ins Nachbarhaus oder in die Wohnung nebenan zieht eine syrische Familie, Bäckermeister und Maler freuen sich über syrische Lehrlinge, Kitas nehmen syrische Kinder auf, Zeitungen, Magazine und Verlage suchen syrische Journalisten und Autoren und in deutschen Großstädten finden syrische Literaturtage, Ausstellungen zeitgenössischer syrischer Künstler und Konzerte syrischer Musiker statt. Manche Fluchtgeschichte ist am Küchentisch erzählt und die eine oder andere Hand nicht geschüttelt worden. Wir haben gemeinsam Hummus angerührt und uns nach Terroranschlägen gegenseitig misstrauisch beäugt. Wir haben diverse Syrer in die richtigen Züge gesetzt, unsere Kleiderschränke nach brauchbaren Winterjacken und Kinderschuhen durchforstet und uns gelegentlich an die Moralvorstellungen und Erziehungsmethoden unserer Großeltern erinnert gefühlt.
Und wir stellen fest: Es gibt uns noch! Deutschland und die Deutschen, ein Fünftel von ihnen mit ausländischen Wurzeln, längst »integriert« und anerkannt – nicht nur als Gemüsehändler, Restaurantbesitzer und Facharbeiter, sondern auch als Oberbürgermeister, Germanistikprofessor, Fernsehmoderatorin, Parteichef, Kabarettist und Bundestagsabgeordneter. Ein Einwanderungsland, das lange keines sein sollte und wollte. Das den Kinderschuhen entwachsen ist und nun mitten in der Pubertät steckt, mit all den dazugehörigen Sinnfragen und Identitätskrisen: Was ist deutsch? Wer ist deutsch? Und warum gibt es darauf so viele Antworten?
Tatsächlich können uns die Syrer bei der Suche nach uns selbst helfen. Denn die Geflüchteten sollen sich in etwas integrieren, von dem wir selbst nicht so genau wissen, was es ist. Indem wir uns also fragen, worauf wir im Zusammenleben mit den Ankommenden besonderen Wert legen, könnten wir herausfinden, wo der Kern unseres deutschen Selbstverständnisses liegt, welche Herausforderungen das mit sich bringt und wo es Berührungspunkte oder Überschneidungen gibt. In den durch die Geflüchteten ausgelösten Debatten taucht eine diffuse Mischung aus Oktoberfest und Homoehe, Gleichberechtigung und Berufsverbot für Kopftuchträgerinnen, säkularem Staat und Kirchensteuer, veganem Schweinebraten und laktosefreier Kaffeesahne auf. Verwirrend nicht nur für die Menschen in Vorpommern und Sachsen, Ostfriesland und Oberbayern, sondern erst recht für die Syrer – DIE Syrer, die es so natürlich nicht gibt.
Das Problem dieses Buches liegt auf der Hand. Es lebt von Klischees und Verallgemeinerungen, die es eigentlich auflösen und entlarven möchte. Für jede Aussage gibt es Gegenbeispiele. Die Syrer sind religiös und wertkonservativ, schreibe ich, dabei aber tolerant und offen für andere. »Nein«, ruft ein syrischer Freund (Theaterregisseur), »die jungen Leute haben die Religion satt«. »Doch«, sagt meine syrische Bekannte (Kinderärztin mit Kopftuch), »in Syrien hat jeder Sunnit christliche Schulfreunde oder alawitische Arbeitskollegen«. »Ja schon«, wirft mein syrischer Verwandter (Mathematiker) ein, »aber sie sind alle in einer rückwärtsgewandten Kultur gefangen.« Alle Syrer, jeder Sunnit, die jungen Leute – es gibt sie nicht, die homogene Masse. Aber es gibt Tendenzen und offensichtliche Unterschiede, die eine Mehrheit betreffen. Von denen will ich erzählen – nicht um zu spalten und zu pauschalisieren, sondern um Verständnis und Verständigung zu ermöglichen.
Das bringt uns zum nächsten Problem: HATTE der syrische Sunnit diese christlichen Freunde und alawitischen Kollegen, oder HAT er sie noch immer? Können Syriens Araber und Kurden noch miteinander über Politik diskutieren oder vergiftet ihr Nationalismus jede Facebook-Freundschaft? Schreibe ich hier über etwas Vergangenes oder bis heute Bestehendes? Gehören die Verhältnisse, die ich während meiner sieben Jahre in Syrien erlebt habe, einer unwiederbringlichen Etappe der syrischen Geschichte an oder unterstelle ich, dass sie bis heute eine gewisse Gültigkeit haben, auch wenn das Land am Krieg zerbricht und die Menschen verzweifelt, hoffnungslos oder voller Hass sind?
Ich habe es ausprobiert. Ich habe Sätze im Präsens formuliert, sie als falsch empfunden und in die Vergangenheit gesetzt. Aber so klang es noch schlimmer, als hätte ich das Syrien, das ich und andere kennen und an das sich viele Menschen gedanklich klammern, einfach abgeschrieben. Als würde ich ein Land, ein Volk und seine Besonderheiten zu Grabe tragen, »nur« weil in Teilen Syriens apokalyptische Zustände herrschen. Natürlich spielt die Willkommenskultur gegenüber Touristen gegenwärtig keine Rolle, da der Suq von Aleppo in Schutt und Asche liegt, der Baaltempel in Palmyra vom IS gesprengt wurde und viele Moscheen und Kirchen des Landes durch die Luftangriffe des Regimes beschädigt oder zerstört sind. Leider leben auch die meisten meiner Freunde und Bekannten nicht mehr in den Wohnungen und Häusern, in denen ich sie früher besuchte.
Dennoch gehe ich davon aus, dass vieles wieder so sein wird, wie es war, wenn der Krieg vorbei und das Land befriedet ist. Das politische System hoffentlich nicht. Aber der Umgang miteinander, die Herzlichkeit und Offenheit, das soziale und unternehmerische Geschick, die Gastfreundschaft und Solidarität der Syrer – sie lassen sich nicht kaputtbomben, so meine Annahme. Ich werde also von Syrien und seinen Bewohnern in der Gegenwart schreiben – allen Untergangsszenarien zum Trotz.
Außerdem nutze ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit meist die männliche Form, obwohl ich damit ausdrücklich auch Frauen meine. Angesichts der Tatsache, dass wir uns die Syrer ohnehin meist als junge Männer vorstellen und dabei die Frauen aus dem Blick verlieren, ist das ein ziemlich fauler Kompromiss. Aber eine gendergerechte Sprache behindert den Lesefluss, finde ich. Deshalb vertraue ich darauf, dass der Leser »die Syrer« immer auch als »Syrerinnen« liest.
Bleibt ein letztes Dilemma. Meine syrischen Verwandten, Freunde und Bekannten. Durch sie erlebe ich das ganze Thema – Syrer in Deutschland, Deutsche bei Syrern, Syrer unter Deutschen, Deutsche gegen Syrer – ziemlich hautnah mit. Ihre Erfahrungen sind manchmal frustrierend, manchmal lustig und auch mal erschütternd, aber immer aufschlussreich und erhellend. Deswegen möchte ich gerne erzählen, wie es ihnen in Deutschland ergeht und den Deutschen mit ihnen, was mir mit ihnen in Syrien und hierzulande widerfahren ist und wie es denjenigen geht, die noch immer mitten im Krieg ausharren. Aber natürlich haben auch Angehörige von Buchautorinnen ein Recht auf Privatsphäre – erst recht wenn sie hier leben und identifiziert werden könnten. Ich habe ihnen deshalb versprochen, dass sie unerkannt bleiben. Zu diesem Zweck anonymisiere ich persönliche Erlebnisse, indem ich sie mal einem Neffen oder einer Nichte, mal einem Freund oder einer Bekannten, mal einem Schwager oder einer Schwägerin und mal einem Onkel oder einer Tante zuschreibe. Tatsächlich habe ich einige syrische Schwäger und Schwägerinnen und viele syrische Freunde. Und mein Mann hat Dutzende syrische Neffen, Nichten, Onkel und Tanten. Sie alle müssen nun herhalten als Protagonisten dieses Buches, damit sich kein Einzelner vorgeführt oder bloßgestellt fühlt. Ihnen als Leser verspreche ich, dass die erzählten Geschichten und Anekdoten tatsächlich so passiert sind. Ich hoffe, damit können alle leben.
Damit Sie nachvollziehen können, wo sich die von mir erwähnten Begebenheiten oder Ereignisse in Syrien zutragen, findet sich am Ende dieses Buches eine Landkarte. Zwar wissen die meisten inzwischen, wo Aleppo liegt, denn die Schreckensnachrichten von dort reißen nicht ab. Aber andere Städte, Orte oder Provinzen sind vielen Menschen hierzulande unbekannt – es sei denn, sie treffen einen geflüchteten Syrer aus al-Raqqa, Deir al-Zor oder Daraa und suchen seine Heimatstadt gemeinsam auf der Landkarte. Auch dafür können Sie dieses Buch dann gerne zur Hand nehmen.
Eines steht fest: Durch die vielen hunderttausend Geflüchteten, die zu uns gekommen und von denen die meisten Syrer sind, verändert sich Deutschland schon jetzt. Nach wie vor gibt es große Hilfsbereitschaft, die sich in privaten Initiativen und zivilgesellschaftlichem Engagement zeigt. Doch gleichzeitig wachsen Sorgen und Ängste. Um die geht es in diesem Buch. Was macht den Deutschen Angst, worüber sorgen sich die Syrer? Warum entstehen immer wieder Missverständnisse auf beiden Seiten und wie können wir diese vermeiden?
Wollen wir in diesem Land auch weiterhin gut miteinander auskommen, müssen wir für den sozialen Frieden jetzt etwas tun. Haltung zeigen ist das eine, den anderen verstehen das andere. Dafür müssen wir den Ängsten und den verzerrten Sichtweisen auf den Grund gehen. Denn nur dann können wir die Richtung des Wandels, den unser Land derzeit durchläuft, in unserem Sinne beeinflussen, politisch und im täglichen Zusammenleben.
Damaskus, Aleppo, al-Raqqa – Ein Staat löst sich auf
Wie ich von einer Nahostkorrespondentin zur »Syrien-Expertin« und »Expertin für Syrer« wurde
Journalisten sind Kriegsgewinnler. Je schrecklicher die Nachrichten, desto mehr haben wir zu tun. Das ist einerseits zynisch, andererseits eine Chance – je nachdem, ob die Kriegsberichte nur Grauen erregen und Voyeurismus bedienen oder vor allem aufklären und insofern zum Frieden beitragen wollen. Ich möchte mit meiner Arbeit Verständnis erzeugen und versuche dies mit Blick auf Syrien in doppelter Hinsicht: Wegen des Krieges erkläre ich Syrien und wegen der vielen Geflüchteten erkläre ich die Syrer. Zwei Krisen machen mich also zur Expertin – eine ziemlich frustrierende Arbeitsgrundlage. Geplant hatte ich das so nicht.
2001 ging ich nach Damaskus, um von dort aus über die arabische und islamische Welt zu berichten. Syrien hatte durch die Machtübergabe von Vater Hafiz al-Assad an Sohn Bashar ein Jahr zuvor meine Neugierde geweckt und galt als rätselhaft und unzugänglich – ein weißer Fleck auf der Landkarte des Nahen Ostens. Für die Korrespondenten in Kairo, Amman, Beirut oder Istanbul war Syrien schwer zu erreichen und kaum zu durchdringen, deshalb schien es mir ein geeigneter Standort für eine freie Journalistin wie mich zu sein.
Die Entscheidung erwies sich als richtig. Jahrelang spielte Syrien als Nebenkriegsschauplatz anderer Konflikte – im Irak, Libanon und in Israel-Palästina – eine wichtige Rolle. Ich berichtete für verschiedene deutsche, österreichische und Schweizer Medien über Damaskus’ regionale Interessen, außenpolitische Positionen und den innenpolitischen Kurs. Daneben recherchierte ich andernorts in der Region, um den Überblick nicht zu verlieren und nicht alles durch die syrische Brille zu sehen. Dass mich das Land irgendwann derart in Beschlag nehmen würde, ahnte ich damals nicht.
Als im März 2011 die syrische Revolution begann, lebte ich wieder in Deutschland – in Berlin –, zusammen mit meinem syrischen Mann und unseren Kindern. Ich reiste regelmäßig in die Region, hatte 2009 jedoch wegen eines fehlerhaft ins Arabische übersetzten Artikels über Bashar al-Assad meine Akkreditierung als Journalistin verloren. Die Behörden ließen mich nur noch ins Land, weil ich mit einem Syrer verheiratet war – für Familienbesuche, nicht zum Arbeiten. Im April 2011 war auch damit Schluss. Die Proteste hatten sich ausgebreitet, Assads Soldaten schossen scharf und ich stand als deutsche Korrespondentin am Flughafen von Damaskus und gab vor, lediglich meine Schwiegermutter besuchen zu wollen. Man glaubte mir nicht und schickte mich mit dem nächsten Flugzeug zurück nach Deutschland. Seitdem verfolge ich die Ereignisse aus der Ferne, aber nicht weniger intensiv.
Die Revolution entwickelte sich zum brutalen Krieg, zu einem regionalen und internationalen Konflikt und zur größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. Ich war fast nur noch damit beschäftigt, die Geschehnisse in Syrien zu erklären und zu kommentieren – und wurde deshalb immer häufiger als »Syrien-Expertin« bezeichnet. Als dann ab 2015 jeden Monat Tausende Syrer nach Deutschland flüchteten, ging es nicht mehr nur um Fluchtursachen, sondern zunehmend um die Menschen, die kamen – ihre Mentalität, ihre Kultur, ihre Religiosität. So wurde ich zur »Expertin für Syrer«. Beide Bezeichnungen klingen ziemlich anmaßend, finde ich. Was macht jemanden überhaupt zum Experten? Der Alltag in einem Land oder ein ethnologisches Studium? Eine Woche beim IS oder ein Forschungsstipendium zum Thema Terrorismus? Im besten Fall ergänzen sich Theorie und Praxis über einen längeren Zeitraum, aber dafür haben die wenigsten Journalisten und Redaktionen Zeit und Geld. Ich bin weder Arabistin noch Islamwissenschaftlerin, weder Ethnologin noch Soziologin, sondern Politikwissenschaftlerin und Journalistin, die nebenbei Arabisch gelernt hat. Das Wort Experte suggeriert Neutralität. Dabei hat jeder Experte seinen eigenen Blick auf ein Thema. Natürlich muss er sämtliche Aspekte und Meinungen zu seinem Spezialgebiet kennen und verständlich erklären können, aber er gewichtet. In Bezug auf Syrien erlebe ich es oft, dass auf der Metaebene analysiert wird, regionale und internationale Bezüge in den Vordergrund gestellt werden und die Realität vor Ort nur holzschnittartig dargestellt wird – also stark vereinfacht und dadurch mitunter falsch.
Manche Experten erklären im Nahen Osten alles mit der hegemonialen Interessenpolitik des Westens, andere mit dem Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, wieder andere mit Terrorismus und radikalem Islamismus. All das greift zu kurz – gerade in Syrien. Syrien ist nicht Afghanistan, nicht der Irak und nicht Libyen (wo im Übrigen genauso viele Aspekte vernachlässigt werden), weswegen wir mit festgefahrenen Erklärungsmustern nicht weiterkommen, sondern nur mit Präzision und Differenzierung. Wir sollten aufhören, Syrien mittels Schablonen begreifen zu wollen, und uns die Mühe machen, genauer hinzuschauen.
Bei diesem Konflikt geht es nicht in erster Linie um Religion oder Terrorismus, um Regimewechsel von außen, Ressourcen oder westliche Interessen. All das spielt eine Rolle, aber nicht die für Syrien entscheidende. Denn im Kern geht es bis heute darum, dass Menschen in Würde und Freiheit mit wirtschaftlicher Chancengleichheit leben wollen. Das klingt banal, bringt aber sehr konkrete Forderungen mit sich, auf die ich zurückkommen werde.
Solange wir die Syrer und ihre Lebenssituationen nicht ins Zentrum unserer Berichterstattung und Bemühungen stellen, werden wir den Konflikt weder verstehen noch lösen, davon bin ich überzeugt. Deshalb lege ich in meiner Analyse großen Wert auf den Blick nach innen: Wie geht es den Bewohnern der abgeriegelten Gebiete, den Gefangenen und den intern Vertriebenen, den Ärzten in den Untergrundkliniken, den zivilgesellschaftlichen Gruppen, und wie ist das Verhältnis zwischen Rebellen, Aktivisten und Bewohnern? Was denken und fühlen die Syrer – die in den Regime-Regionen und die in den von der Opposition kontrollierten Gebieten, die unter kurdischer Verwaltung und die unter IS-Herrschaft?
Auch ich habe als Expertin folglich einen Fokus – ich versuche, die Wahrnehmungen und Meinungen der Syrer verständlich zu machen. Dafür werde ich gelegentlich als »Aktivistin« oder »Kritikerin des Regimes« bezeichnet oder sogar beschimpft. Aber in einem Konflikt wie dem syrischen auf die Arbeit der Zivilgesellschaft hinzuweisen erscheint mir nicht einseitig, sondern grundlegend. Und das Regime für seinen systematischen Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Zivilisten zu kritisieren, ist wohl das Mindeste, was man von einem Syrien-Experten erwarten kann. Nein, ich bin weder Aktivistin noch Oppositionelle, denn ich mache keine Politik, sondern berichte darüber.
Von vielen in Deutschland lebenden Syrern weiß ich, dass ich ihnen aus dem Herzen spreche, wenn ich über Syrien rede – das ist für mich die Bestätigung, die ich brauche, um mit dem Titel »Syrien-Expertin« oder »Expertin für Syrer« zurechtzukommen. Ich werde mich also bemühen, im Folgenden nicht nur Syrien zu erklären, sondern vor allem die Syrer – in ihrer ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit.
Syrien historisch. Ein kurzer Blick zurück
Um das syrische Selbstverständnis zu ergründen, sollten wir zurückblicken. Über 5000 Jahre hinweg haben verschiedene Hochkulturen auf dem Gebiet des heutigen Syriens ihre Spuren hinterlassen: Sumerer, Akkader, Amoriter, Hethiter, Babylonier, Assyrer, Aramäer, Perser, Griechen, Römer, Byzantiner, Umayyaden, Abbasiden, Fatimiden, Ayyubiden, Mamluken und Osmanen. Syrien ist folglich auf den Ruinen mehrerer Zivilisationen erbaut, wer anfängt zu graben, stößt auf Tongefäße, Werkzeuge und Schmuck, Mauerreste, Schrifttafeln und Grabstätten. Das meiste davon ist noch nicht archäologisch erfasst, sondern liegt unter unzähligen Hügeln (sogenannten tells) verborgen, in denen sich menschliche Siedlungsgeschichte Schicht um Schicht aufeinandergelegt hat. In den Bereichen Architektur und Städtebau, Landwirtschaft, Handwerk und Sprache haben die Bewohner der Region jahrhundertelang Standards gesetzt. Das erklärt den Stolz manches Syrers auf sein Land als »Wiege der Menschheit«. Deshalb Vorsicht: Wer einem Geflüchteten aus Aleppo die Verwendung von Seife erklären will, wird Verachtung ernten.
Ein historischer Aspekt, der die syrische Mentalität mit am meisten geprägt hat, ist der Handel. Damaskus und Aleppo waren über Jahrhunderte wichtige Handelszentren zwischen China, Indien, der arabischen Halbinsel, Europa und Afrika, denn in Syrien kreuzten sich gleich zwei antike Handelsrouten: die Seidenstraße von Ost nach West und die Weihrauchstraße von Süd nach Nord. Produkte aus aller Welt kamen hier zusammen, verschiedene Kulturen und Traditionen vermischten sich – daher die grundsätzliche Offenheit, Toleranz und Weltläufigkeit syrischer Stadtbewohner.
Im östlichen Mittelmeerraum haben sich alle drei abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) entwickelt. Syrien ist deshalb seit jeher geprägt von einem Wettbewerb religiöser, konfessioneller und politischer Ideen, die nicht selten von Eroberern, Militärführern oder politischen Herrschern zur eigenen Machterweiterung missbraucht wurden. Dass die junge Generation 2011 bei Protesten auf religiöse und ideologische Bezüge weitgehend verzichtet, ist ein Hinweis darauf, dass sie der einfachen Parolen überdrüssig ist. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte sind Ideologien für die Jugend im Nahen Osten zu leeren Worthülsen verkommen. Die politisch aktiven 18- bis 35-Jährigen begeistern sich nicht wie ihre Eltern oder Großeltern für den Nationalismus, Sozialismus, Kommunismus oder Islamismus, sondern wollen – ganz pragmatisch – ein gutes Leben, das sie selbst gestalten können. Dafür brauchen sie keine Ideologie, sondern Freiheit und Gerechtigkeit.
Bis heute wirkt sich auch die Neuordnung des Nahen Ostens durch Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. Nachdem Syrien 400 Jahre zum Osmanischen Reich gehört hatte, teilten Franzosen und Engländer dessen Überreste 1916 im geheimen Abkommen von Sykes-Picot in koloniale Einflusszonen auf. Neben dem Libanon als ursprünglich maronitischem Staat waren auch alawitische und drusische Kleinstaaten angedacht – konfessionelle Gebilde, die den Köpfen imperialistischer Kolonialherren entsprangen, in der Realität jedoch keinen Bestand hatten. Gleichzeitig übersahen die Europäer ein ganzes Volk: die Kurden, die kein eigenes Staatsgebiet bekamen und fortan als benachteiligte Minderheiten in Syrien, der Türkei, dem Irak und Iran lebten. Ein großes Versäumnis. Bis heute kämpfen die etwa 30 Millionen Kurden um kulturelle und politische Anerkennung in Form von Selbstbestimmung, Autonomie oder einem eigenen Staat.
Das historische Großsyrien (bilad al-sham), das sich aus den Ländern Syrien, Libanon, Jordanien, Israel-Palästina und Teilen der südlichen Türkei zusammensetzte, wurde durch die kolonialen Grenzen zerteilt – für die Syrer ein Trauma. Das heutige Staatsgebiet war für sie künstlich beschnitten, weswegen auch nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1946 andere Zugehörigkeiten eine Rolle spielten: die arabische Nation, die islamische Umma oder die Rückbesinnung auf den Kulturraum bilad al-sham. Dass Letzterer bis heute identitätsstiftend wirkt, sieht man an einzelnen Rebellen- und Islamistengruppen, die in ihrem Namen den Begriff al-sham führen. Ein Selbstverständnis als Syrer, also als Staatsbürger einer Syrischen Republik – losgelöst vom arabischen Nationalismus, von der Ideologie der Baath-Partei und von religiösen Zugehörigkeiten – ist kaum ausgeprägt.
Die Bevölkerung des heutigen Syriens ist gemischt, besteht aber (anders als der Irak und der Libanon) aus klaren Mehrheiten. Ethnisch betrachtet sind die meisten Syrer Araber, daneben gibt es einen großen kurdischen Bevölkerungsanteil von etwa zehn Prozent sowie kleinere Volksgruppen wie Armenier und Tscherkessen. Unter den Religionen überwiegen die sunnitischen Muslime mit etwa 75 Prozent, Christen und Alawiten machen jeweils etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus, die übrigen sind Drusen, Ismaeliten und Schiiten.
Die größte Gesellschaftsgruppe sind in Syrien also die sunnitischen Araber – sie bilden jedoch weder politisch noch sozial oder religiös eine Einheit. Unter ihnen gibt es reiche Geschäftsleute und arme Vorstadtbewohner, konservative Akademiker, kaum gebildete Olivenbauern und traditionelle Beduinen, einflussreiche Regimevertreter und mächtige Rebellenführer, verfolgte Oppositionelle, Assad-treue Beamte und säkular eingestellte Aktivisten. So wenig wir sämtliche Deutsche christlichen Glaubens als homogene Gesellschaftsgruppe begreifen – zum Beispiel bei der Frage, welche Partei sie wählen – können wir folglich Syriens sunnitische Araber zu einem einheitlichen Block stilisieren. Verallgemeinerungen sind manchmal notwendig, bilden die Wirklichkeit jedoch stets nur ungenügend ab, das sollten wir im Hinterkopf behalten.
Stabilität durch Grabesruhe – Vater Assad
Auf die Unabhängigkeit Syriens von Frankreich 1946 folgte eine Zeit politischer Instabilität, ideologischer Erneuerung und militärischer Selbstermächtigung. Händler und Großgrundbesitzer, die während der Mandatszeit noch wohlhabender und einflussreicher geworden waren, übernahmen als politische Elite des Landes die Macht. Dagegen regte sich Widerstand. Nationalistische, sozialistische oder kommunistische Parteien forderten Bauern und Arbeiter auf, gegen die Oligarchen des Landes aufzustehen, die Bewegung vereinigte nationalistische Ideen mit Klassenkampf. Gleichzeitig folgte ein Militärputsch auf den anderen (der erste 1949 wurde von der amerikanischen CIA unterstützt), und auch wenn es während der 1950er- und 1960er-Jahre noch ein zum Teil demokratisch funktionierendes Parlament gab, konzentrierte sich die Macht zunehmend bei der Armeeführung. Der Baath-Partei (baath bedeutet Wiedergeburt, Auferstehung, Erneuerung) gelang es, mit Hilfe ihrer spirituell verklärenden Vorstellung von der arabischen Nation, Massen zu mobilisieren. Sie verband religiös besetzte Begriffe mit dem Kampf gegen Feudalismus und Oligarchie und dem Ruf nach einem einheitlichen arabischen Staat von Marokko bis Irak, vom Sudan bis nach Syrien. So konnten sich viele Syrer mit der Bewegung identifizieren: Muslime und Christen, Stadt- und Landbewohner, Angestellte, Beamte und Bauern, Mittelständler und Kleinunternehmer – nur die Kurden blieben per Definition außen vor.
1963 putschte sich die Baath-Partei mit militärischer Unterstützung an die Macht, aus gewaltsam ausgetragenen Flügelkämpfen innerhalb der Partei ging Hafiz al-Assad 1970 als Sieger hervor. Politische Gegner, ehemalige Weggefährten und militärische Konkurrenten wurden inhaftiert, ins Exil geschickt oder getötet. Hafiz al-Assad gehörte der über Jahrhunderte benachteiligten Minderheit der Alawiten an, einer späten Abspaltung im schiitischen Islam, die vor allem in den Bergen des Küstenhinterlandes lebt. Er hatte den für Alawiten damals einzigen Weg des sozialen Aufstiegs gewählt: das Militär. In den 30 Jahren seiner Herrschaft stabilisierte er Syrien innenpolitisch und machte es zu einer bedeutenden Regionalmacht, unter seiner kompromisslosen Führung legte sich jedoch Grabesstille über das Land.
Kaum an der Macht, vollzog Hafiz al-Assad eine Revolution von oben. Aus dem demokratisch-pluralistischen Chaos der jungen Republik wurde ein autoritär geführtes Einparteienregime. Die Baath-Partei wandelte sich von einer Massenbewegung zu einem staatlich gelenkten Vollzugsorgan. Sozialistische Ideale wurden durch Korruption und Bereicherung ad absurdum geführt, auf Landreformen und die Stärkung von Arbeitern und Bauern folgten planwirtschaftlicher Stillstand und Vetternwirtschaft.
Politische Vielfalt, Meinungsfreiheit und gesellschaftliche Kritik wurden von den Geheimdiensten erstickt. Die Medien wurden gleichgeschaltet, an Schulen und Universitäten wurden die Parolen des arabischen Nationalismus und Sozialismus eingeübt. Die Zivilgesellschaft wurde von der Baath-Partei vollständig vereinnahmt – Berufsverbände, Arbeiter- und Bauernvereinigungen, die Frauenunion und verschiedene Jugendorganisationen arbeiteten unter ihrem Banner. Ein System totaler Überwachung ließ den Syrern keine Luft zum Atmen, jeder bespitzelte jeden, auf der Straße, bei der Arbeit und in den Behörden drohte staatliche Willkür. Die Menschen duckten sich weg, machten sich klein und sprachen über Politik nur noch im Flüsterton. Eine allgegenwärtige Angst lähmte ihr Denken und Handeln. Syrien entwickelte sich zum »Assad-Land«. Darauf wiesen entsprechende Schilder schon an der Grenze hin: »Willkommen in Assads Syrien«. Ein Land im Privatbesitz eines mafiaähnlich organisierten Clans mit einem gewieften und unnachgiebigen Präsidenten an der Spitze, der alle Fäden fest in der Hand hielt und für den nur eines zählte: Loyalität. Sie war und ist bis heute das wichtigste Prinzip der Assad’schen Herrschaft.
In der Praxis wurde daraus Totalitarismus. Wer Assads Macht bedingungslos stützte, wurde belohnt – mit politischen Ämtern, militärischen Führungspositionen, wirtschaftlichen Freiheiten, geschäftlichen Deals. Und das unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit. Zum engsten Führungskreis zählten neben Alawiten auch Sunniten und Christen. Wer wie die Mehrheit der Syrer Assads Herrschaftsanspruch akzeptierte und sich damit arrangierte, konnte ein zwar unfreies, aber geordnetes Leben führen. Die städtische Mittelschicht fand Beschäftigung in einem überdimensionierten Verwaltungsapparat, das Leben auf dem Land verbesserte sich, weil Straßen, Schulen, Strom- und Wasserversorgung ausgebaut und landwirtschaftliche Flächen neu verteilt wurden. Wer jedoch die Führung Assads grundsätzlich infrage stellte, wurde verfolgt, verhaftet und mundtot gemacht – egal ob Kommunist oder Liberaler, Sunnit, Alawit oder Christ, säkularer Aktivist oder Islamist, Araber oder Kurde.
Unter Syriens politischen Gefangenen, Revolutionären und Oppositionellen finden sich deshalb auch heute Vertreter aller Gesellschaftsgruppen. Sie verbindet jedoch nur eines: die Gegnerschaft zum Regime. Wenn Bashar al-Assad in der aktuellen Krise vorschlägt, »loyale Oppositionelle« an seiner Regierung zu beteiligen – also Kritiker, die seine Herrschaft im Kern nicht anzweifeln – bringt er die Maxime seiner Macht auf den Punkt: Es geht um Loyalität, nichts anderes.
Doch zurück zu seinem Vater. Ende der 1990er-Jahre drohte Syrien den Anschluss an die Moderne zu verpassen. Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hielt Hafiz al-Assad am real existierenden Sozialismus fest (neben Kuba, Nordkorea und China). Händler und Kleinunternehmer kämpften mit umfassenden Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, ohne Satellitenfernsehen und Internet lebten die meisten Syrer abgeschottet von der Welt und hatten nur eine vage Ahnung davon, wie es in Europa oder anderswo aussah. Als Assad senior im Juni 2000 starb, war vom Ende einer Ära die Rede. Sohn Bashar, damals 34 Jahre alt, weckte mit seiner zurückhaltenden Art und seiner Begeisterung für Computer und Internet die Hoffnung, dass sich Syrien unter seiner Führung öffnen würde. Bald zeigte sich jedoch, dass sich Bashars Veränderungswille auf die Wirtschaft beschränkte und dass das Erbe seines Vaters noch lange nachwirken würde.
Wirtschaftliche Öffnung und politische Denkverbote – Bashars erstes Jahrzehnt
Die Machtübergabe vom Vater an den Sohn vollzog sich im Sommer 2000 reibungslos, Syrien wurde gewissermaßen zur »monarchischen Republik«. Bashar war in entscheidende Bereiche (Militär, Libanonpolitik) eingearbeitet, hatte mit Anti-Korruptions-Kampagnen und der Gründung der Syrian Computer Society von sich reden gemacht und war umgeben von wohlmeinenden Gefährten seines Vaters. All diejenigen, die ihm hätten gefährlich werden können, waren rechtzeitig beseitigt worden.
Aufbruchsstimmung erfasste das Land. Intellektuelle, Oppositionelle und politisch Interessierte fühlten sich ermutigt, die Zukunft des Landes mitzugestalten, und gründeten Debattierclubs. Dort stritt man über Ideologien, politische Konzepte und Wirtschaftsreformen und testete nebenbei die neuen roten Linien des Regimes. Diese erwiesen sich jedoch als ähnlich restriktiv wie die alten. Bevor aus dem sogenannten Damaszener Frühling eine nationale Bewegung mit einer nicht zu stoppenden Eigendynamik werden konnte, zog das Regime die Notbremse. Private Diskussionsforen wurden verboten, ihre führenden Köpfe verhaftet und der Damaszener Frühling damit im Keim erstickt.
Als ich Ende 2001 von Hamburg nach Damaskus zog, war von Aufbruch nichts mehr zu spüren. Zwar setzten führende Oppositionelle nach wie vor auf einen Dialog mit Bashar al-Assad und hofften, das syrische System könne sich von innen heraus reformieren, aber die Euphorie der Anfangszeit war verflogen und wich wachsender Skepsis und Ernüchterung. Der Umgang des Regimes mit seinen Kritikern ließ in den folgenden Jahren keinen Zweifel daran, dass grundlegende Veränderungen nicht beabsichtigt und Initiativen aus der Zivilgesellschaft unerwünscht waren.
Mehrfach trafen sich Oppositionelle, Anwälte, Angehörige von politischen Gefangenen und Journalisten an öffentlichen Orten im Stadtzentrum von Damaskus, um für Menschenrechte zu demonstrieren und die Freilassung von inhaftierten Mitstreitern zu fordern. Anlässe waren der Jahrestag der Verhängung des Ausnahmezustands (8. März 1963) oder der Internationale Tag der Menschenrechte (10. Dezember). Ich ging dorthin, um zu beobachten was passierte – mit einem mulmigen Gefühl, aber ohne Angst, denn als akkreditierte ausländische Journalistin fühlte ich mich sicher. Im schlimmsten Fall würden die Behörden mich ausweisen, dachte ich. Die Demonstranten standen unter dem Generalverdacht, Agenten des Westens und Volksverräter zu sein. Um zu zeigen, wie national sie eingestellt waren, stimmten sie deshalb in kritischen Momenten gerne die syrische Nationalhymne an. Ich hielt Abstand und bewegte mich am Rande, schließlich wollte ich nicht als politische Aktivistin wahrgenommen werden und die Oppositionellen nicht zusätzlich in Gefahr bringen (wegen »Kontakten zu westlichen Journalisten«). Also grüßte ich die mir bekannten Regimekritiker nur von Weitem und erklärte anrückenden Spezialeinheiten oder nervenden Geheimdienstmitarbeitern, ich würde lediglich zuschauen und das sei in der Öffentlichkeit ja wohl erlaubt. Tatsächlich war jeder dieser Mini-Proteste eine logistische Meisterleistung, denn damit sich ein paar Dutzend Regimekritiker vor dem Justizpalast oder Parlament versammeln konnten, mussten sie sich heimlich verabreden und unauffällig dem Treffpunkt nähern, um nicht sofort von Sicherheitsleuten bedrängt, mit Schlagstöcken vertrieben oder abgeführt zu werden.
Meist eskalierte die Lage. Und einmal war ich doch mittendrin. Im März 2005 versammelten sich etwa 50 Oppositionelle zu einem Sitzstreik vor dem Justizpalast. Das Regime schickte statt schwer bewaffneter Soldaten Hunderte »Gegendemonstranten« der Studentenunion der Baath-Partei und mischte bezahlte Schläger darunter. Eine Strategie, die Assad im Laufe der Zeit perfektionierte. Er ließ sich von »syrischen Bürgern« verteidigen, die jedoch von seinen Vertrauten in Partei und Verwaltung generalstabsmäßig ausgewählt, organisiert und angeleitet wurden. Für gezielte Provokationen und eine beabsichtigte Eskalation – vor allem bei Zusammenstößen mit kurdischen Aktivisten – wurden gewalttätige Agenten angeheuert.
Mit diesen bekam auch ich damals zu tun: Die aufgebrachte Menge beschimpfte die Oppositionellen als Verräter und trieb sie ein paar Straßen weiter zum Marje-Platz (wo Syriens Freiheitskämpfer 1946 den Sieg über die französischen Besatzer gefeiert hatten). Dort wurden einige Assad-Kritiker angegriffen und verprügelt. Unbeirrt führte ich mit meinem Aufnahmegerät Radiointerviews, bis die Menge um uns herum immer aggressiver wurde. Ich erklärte den Gegendemonstranten, auch mit ihnen reden zu wollen, da riss mir ein Mann plötzlich das Mikrofon aus der Hand und warf meinen Rekorder auf den Boden. Als ich mich bückte, fiel mein Handy aus der Tasche, ein anderer Mann schnappte es und rannte davon. In dieser Sekunde waren meine gesamten Kontakte nicht nur verloren, sondern auch beim Geheimdienst. Der offizielle Vertreter der Studentenunion entschuldigte sich bei mir für den Übergriff und erwirkte eine finanzielle Entschädigung für mein zerstörtes Arbeitsgerät. Aber ich hatte meine Lektion gelernt. Wann immer sich das Regime bedroht fühlte, würde es mit perfiden Strategien und ohne Skrupel gegen seine Feinde vorgehen.
Zweierlei sollte die inländische Opposition unter Bashar in jedem Fall unterlassen: Kontakte zum westlichen Ausland (auch zu Syrien-kritischen Politikern und Journalisten im Libanon) und eine Annäherung an Vertreter eines politischen Islam. Solange ein paar Intellektuelle untereinander diskutierten, ließ man sie gewähren. Aber wer den Schulterschluss mit verschiedenen anderen Regimegegnern wagte und sich öffentlich zu Wort meldete, bekam Ärger.
Jeder Versuch, ein breiteres Bündnis aus Linken und Liberalen, Konservativen und Kommunisten, arabischen Nationalisten und Kurden, Säkularen und Islamisten zu schließen und als Opposition sichtbar zu werden, scheiterte an der Repression des Regimes. Mit Bespitzelung und Verfolgung, Verhaftungen, Misshandlungen und Folter, erzwungenen Geständnissen, Schauprozessen und Ausreiseverboten verhinderte Assad jahrelang das Entstehen einer nationalen oppositionellen Bewegung.
Dabei formulierten die Kritiker des Regimes stets die gleichen Forderungen (zuletzt im Oktober 2005 in der Damaszener Erklärung für Demokratischen Nationalen Wandel): die Aufhebung des Ausnahmezustands (der Verfassung und Gesetze aushebelte und juristische Willkür ermöglichte) und ein neues Parteiengesetz. Die Vormachtstellung der Baath-Partei sollte einem Mehrparteiensystem weichen, um politische Teilhabe zu ermöglichen. Rechtsstaatlichkeit und die Anwendung bestehender Gesetze sollten die staatliche Willkür beenden und an die Stelle von Korruption und Vetternwirtschaft sollten Transparenz und soziale Gerechtigkeit treten. Viele Oppositionelle und Intellektuelle, die ich im Laufe der Jahre für meine Reportagen und Features interviewt habe, zahlten einen hohen Preis für ihr mutiges Engagement und ihre kompromisslose Haltung. Ob kritische Vordenker wie Michel Kilo und Yassin al-Haj Saleh, ob die Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Razan Zaitouneh und ihre Kollegen Anwar al-Bunni, Khalil Maatouk und Haitham al-Maleh, ob Politiker wie Riad Turk, Riad Seif, George Sabra und Suheir al-Atassi, ob Kurdenführer wie Mashaal Tammo und Mohammed Mashuq Khaznawi oder Autoren und Aktivisten wie Mazen Darwish, Ali al-Abdallah und Habib Saleh – sie durften jahrelang nicht ausreisen, wurden Tag und Nacht überwacht oder vom Geheimdienst verfolgt, einige wurden verhaftet, gefoltert und für Jahre ins Gefängnis gesperrt, manche sind tot oder verschwunden.
Aus der inländischen, säkular orientierten Opposition erwuchs deshalb auch unter Bashar keine ernsthafte Bedrohung für das Regime. Die mehrheitlich älteren Herren versäumten es, die Jugend für ihren demokratischen Kampf zu gewinnen (über die Hälfte der Syrer ist jünger als 25) und die drängenden wirtschaftlichen Fragen in den Vordergrund ihrer Arbeit zu stellen. Mit ihren politischen Forderungen ließen sich keine Massen mobilisieren und so blieben Assads Kritiker unter sich.
Von der Revolution im Frühjahr 2011 wurden die meisten der etablierten Oppositionellen überrascht. Ungläubig und voller Hochachtung vor dem Mut der Demonstranten verfolgten sie, wie die syrische Gesellschaft aus ihrer Angststarre erwachte und sich gegen das Regime erhob. Auf unterschiedliche Weise beteiligten sich die Dissidenten daraufhin an der Revolution, wobei die meisten früher oder später ins Exil fliehen mussten. Manche arbeiteten am Aufbau lokaler Komitees mit, andere gründeten im Ausland oppositionelle Vertretungen oder kommentieren als unabhängige Intellektuelle die Entwicklungen im Land. Sie, die das Herrschaftssystem der Assads jahrzehntelang kennengelernt und kritisiert hatten, ahnten, wie blutig ein Machtkampf in Syrien werden würde. Und sie sollten recht behalten.
Bis 2011 fühlte sich das Regime im Inneren von zwei anderen Gruppen bedroht: den Kurden und den Islamisten. Beide nutzte Damaskus über Jahre als außenpolitische Trümpfe gegenüber seinen Feinden in Ankara und Bagdad. Kurdische Politiker, die in der Türkei und im Irak verfolgt wurden, fanden in Syrien sichere Rückzugsräume (Abdullah Öcalan, Führer der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, etwa lebte bis 1998 in Damaskus). Und radikale Islamisten, die sich ab 2004 im Irak formierten, konnten über Syrien ungehindert ihren Nachschub organisieren. Sobald jedoch die syrischen Kurden ihren Unmut äußerten oder Islamisten innerhalb Syriens aktiv wurden, läuteten beim Assad-Regime die Alarmglocken.
Die knapp zweieinhalb Millionen Kurden des Landes wurden unter dem radikalen arabischen Nationalismus der Assads von Anfang an unterdrückt. Sie durften weder Kurdisch unterrichten noch kurdische Texte verfassen. Wer sich als Kurde politisch oder kulturell engagierte, wurde verfolgt. Bei einer Volkszählung 1962 entzog die Regierung 120.000 Kurden die syrische Nationalität und machte sie und ihre Nachkommen dadurch zu Staatenlosen. Zwei Generationen später waren es etwa 300.000 Kurden, die deshalb unter massiver Diskriminierung litten. Sie durften nicht studieren, nicht wählen, nicht reisen, kein Land erwerben, nicht für den Staat arbeiten und kein Gewerbe anmelden. Doch auch Kurden, die syrische Staatsbürger waren, kämpften mit einem institutionalisierten Rassismus. Die kurdisch geprägten Gebiete im Nordosten des Landes wurden durch die Ansiedlung von Arabern und Umbenennung von Dörfern zwangsarabisiert. In überwiegend von Kurden bewohnten Städten und Orten stellte der Staat bevorzugt Araber ein – ob in der Verwaltung oder im Sicherheitsapparat, ob als Lehrer oder in der Ölindustrie.
Als es 2004 im Zuge eines Fußballspiels in der nordsyrischen Stadt Qamishli zu Ausschreitungen zwischen kurdischen und arabischen Fans kam, demonstrierten innerhalb von Tagen mehrere Tausend Kurden in verschiedenen Städten des Landes. Die Proteste waren nicht politisch organisiert, sondern eher spontane Wutausbrüche einer frustrierten und benachteiligten Gesellschaftsgruppe – und insofern ein Vorgeschmack auf die Ereignisse sieben Jahre später. Damals zeigte sich, dass die Kurden die am schnellsten zu mobilisierende Bevölkerungsgruppe waren. 2011 unternahm Bashar deshalb alles, um zu verhindern, dass sich die Kurden mit ihrem ganzen Gewicht der Revolution anschlossen.
Bei den Islamisten galt es, aus Sicht des Regimes, zweierlei zu verhindern: einen massentauglichen und moderaten politischen Islam und eine Destabilisierung durch islamische Extremisten. Eine wirtschaftsliberale islamische Partei hätte viele konservative Syrer angesprochen. Die syrischen Muslimbrüder, die Anfang der 1980er-Jahre bereits das Regime von Hafiz al-Assad herausgefordert hatten und dafür fast vollständig zerschlagen und vertrieben wurden, waren deshalb weiterhin verboten, Mitgliedern drohte die Todesstrafe.
Die extremistische Gefahr schien deshalb realer, denn ab 2004 richteten sich dschihadistische Kräfte in der Region ein. Im Zuge der US-Besatzung wurde der benachbarte Irak zum Sammelbecken von Salafisten aus aller Welt. Obwohl ihnen das Regime in Damaskus freie Durchreise gewährte und Versorgungswege eröffnete, duldete es Aktivitäten auf syrischem Boden nur, solange diese unter der Kontrolle der eigenen Geheimdienste stattfanden. Die meisten politischen Gefangenen waren in Syrien deshalb Islamisten – neben religiösen Fundamentalisten und al-Qaida-Sympathisanten auch Menschen, die lediglich zum falschen Zeitpunkt in der falschen Moschee gebetet hatten.
Für die Mehrheit der Syrer waren es jedoch nicht politische, sondern wirtschaftliche Gründe, die Bashar al-Assad vom Hoffnungsträger zu einer Enttäuschung werden ließen. Die an ihn gestellten Erwartungen wurden enttäuscht, während der Westen einem Missverständnis aufsaß: Bashar wollte Syrien nicht reformieren, er wollte das Land lediglich modernisieren. Die Syrer sollten mit EC-Karten und Handys umgehen können, ihr Geld in Syrien investieren und vermehren, um den Konsum anzukurbeln und dank Internet und Satellitenfernsehen wissen, was in der Welt passiert (soweit es ihnen die Regierung erlaubte, denn der Internetzugang wurde staatlich kontrolliert, viele Seiten waren gesperrt und private Medien mussten sich in grundsätzlichen Fragen an die offiziellen Linien der Berichterstattung halten). Bashar öffnete das Land wirtschaftlich, das offiziell formulierte Ziel einer sozialen Marktwirtschaft entwickelte sich allerdings in eine unsoziale neoliberale Richtung. Private Banken wurden zugelassen, Handelsströme liberalisiert, Staatsbetriebe privatisiert, ausländische Investitionen erleichtert und staatliche Subventionen abgebaut. Die syrische Gesellschaft zerfiel in Gewinner und Verlierer. Geschäftsleute und Unternehmer profitierten von den neuen Chancen, verdienten gut und wurden noch reicher. Beamte und Angestellte, die bis dahin finanziell gut klargekommen waren, mussten sich wegen der steigenden Lebenshaltungskosten zusätzliche Nebenjobs suchen. Und wer schon vorher wenig hatte – als Arbeiter, Bauer, Kleinunternehmer, Handwerker oder Tagelöhner – kämpfte um die schiere Existenz und für die Zukunft seiner Kinder.
Auf dem Land verschärfte eine mehrjährige Dürre zwischen 2006 und 2011 die Lage zusätzlich. Eine Landflucht setzte ein, Hunderttausende zogen in die Stadt. Dort hofften sie auf Arbeit und ein besseres Leben, fanden sich jedoch im Elend informeller Siedlungen wieder, die im Umland von Damaskus und anderer großer Städte entstanden. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnete sich – in einem Land, das seit über 40 Jahren mit sozialistischer Planwirtschaft dafür gesorgt hatte, dass es allen Bewohnern in etwa gleich gut oder gleich schlecht ging.
Es sind diese Verlierer der Bashar-Ära, die im Frühjahr 2011 den Mut haben, auf die Straße zu gehen. Weil sie nichts mehr zu verlieren, sondern nur einiges zurückzugewinnen haben, allen voran ein Leben in Würde.
Außenpolitischer Druck, Zusammenhalt im Innern
Dass aus der Unzufriedenheit der Unterprivilegierten nicht schon früher öffentlicher Widerstand erwuchs, hat vor allem mit Syriens außenpolitischer Lage zu tun. Unter US-Präsident George W. Bush landete Damaskus 2002 auf der amerikanischen »Achse des Bösen«. Nach dem Mordanschlag auf den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri 2005 wurde Bashar auch für die Europäer zur Persona non grata.
Geostrategisch saßen die Machthaber in Damaskus zunehmend in der Klemme: Im Osten die Amerikaner als Besatzer im Irak, von denen manche meinten, man sollte das syrische Regime nach dem Sturz von Saddam Hussein gleich mitbeseitigen. Im Westen der sich emanzipierende Libanon, den die Syrer nach fast 40 Jahren Einflussnahme und Besatzung 2005 verlassen mussten. Und im Südwesten das hochgerüstete Israel, das seit 1967 völkerrechtswidrig den syrischen Golan besetzt hält und mit seiner Strategie der gezielten Tötung politischer Feinde und dem Sommerkrieg im Libanon 2006 Ängste und Wut unter den Syrern förderte.
Je größer die Bedrohung von außen, desto enger rückten die Syrer im Inneren zusammen. Wer dem Regime aus innenpolitischen und wirtschaftlichen Gründen kritisch gegenüberstand, stellte sich zumindest hinter den Präsidenten. Denn Bashar galt als derjenige, der die positiven Veränderungen im Land herbeigeführt hatte, während alles, was schlecht lief, auf das Konto des Regimes ging – so die Wahrnehmung der meisten Syrer. Sie machten die alte Garde in der Partei, im Militär und Sicherheitsapparat verantwortlich für die erwähnten Missstände, sodass sich Bashar lange Zeit als moderner und volksnaher Staatsmann inszenieren konnte.
Tatsächlich sind Institutionen und Präsident in Syrien jedoch nicht voneinander zu trennen. Bashars Macht basiert auf den gleichen drei Säulen, auf denen sein Vater sie einst errichtet hat: dem Militär, den Geheimdiensten und der Baath-Partei. Weil sie von den Assads über Jahrzehnte als loyale Stützen der eigenen Herrschaft etabliert wurden, fungieren sie in der aktuellen Krise als persönliche Machterhaltungsinstrumente Bashars. Weder das Militär (wie in Ägypten) noch die Polizei (wie in Tunesien) oder die Geheimdienste sind in Syrien so unabhängig und einflussreich, dass sie den Präsidenten absetzen könnten, um Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie dienen allein dem Herrschaftsanspruch Assads. Auch deshalb ist der syrische Präsident noch immer im Amt.
Bis zum Ende seiner ersten Amtszeit 2007 hatte sich Bashars Selbstdarstellung weit über Syriens Landesgrenzen hinaus etabliert. Er galt als letzter Vorkämpfer der arabischen Nation. In den Augen vieler einfacher Bürger – von Marokko über Ägypten bis in den Irak – war er der einzige Herrscher, der westlichen Hegemonialbestrebungen etwas entgegensetzte und das vertrat, was auf arabischen Straßen gedacht wurde. Während andere Staatschefs wie Ägyptens Hosni Mubarak, Tunesiens Zine el-Abidine Ben Ali und die jungen Könige in Marokko und Jordanien als korrumpierte Vasallen der Amerikaner und Europäer galten, führte Bashar den Widerstand gegen den imperialen Westen an – so schien es. In Wahrheit waren es nichts als leere Floskeln, mit denen Assad den arabischen Nationalismus und den Widerstand gegen Israel beschwor, während seine Außenpolitik durch und durch pragmatisch und opportunistisch war. Das Regime redete, handelte und kooperierte mit jedem, der den eigenen Interessen dienlich war.
Am Vorabend der arabischen Aufstände hatte Bashar das Land gespalten. Während sein Vater es verstanden hatte, über konfessionelle, soziale und wirtschaftliche Grenzen hinweg eine Unterstützerbasis zu gewinnen und Menschen an sich zu binden, hatte Bashar mit dem neoliberalen Kurs, seiner politischen Kompromisslosigkeit und der staatlichen Unterdrückung entscheidende Gesellschaftsgruppen abgehängt, verloren und gegen sich aufgebracht. Standen zu Hafiz’ Zeiten zumindest Teile der Arbeiter und Bauern, Beamten und Angestellten, Mittel- und Unterschicht hinter seiner Führung, hatten genau diese Syrer nach zehn Jahren Bashar die Hoffnung auf Besserung verloren. Mehr noch: Es ging ihnen zunehmend schlechter. Sie mussten zusehen, wie eine korrupte Elite ihr Geld nun auch in Damaskus ausgeben konnte – für Designermode, teures Essen, Luxusautos und die neuesten Smartphones – während die eigene Familie kaum über die Runden kam.
Der jahrzehntealte Gesellschaftsvertrag in Syrien – politische Unfreiheit gegen eine gesicherte Existenz – war somit außer Kraft. Das Regime verlangte nach wie vor Loyalität und Unterordnung, ohne im Gegenzug etwas dafür zu bieten. Aber warum sollten Syrer, deren Alltag ein einziger Überlebenskampf geworden war, weiterhin staatliche Willkür, Korruption und tägliche Erniedrigungen ertragen? Bashar selbst hatte den Boden für gesellschaftlichen Unfrieden bereitet.
Von der Revolution zum Stellvertreterkrieg
Anfang 2011 begann in der arabischen Welt ein historischer Umwälzungsprozess, der Jahrzehnte andauern wird und – wie wir sehen – mit Fortschritten und Rückschlägen einhergeht. So wie sich gesellschaftliche Umbrüche schon immer und überall innerhalb von Generationen vollzogen und nicht binnen weniger Jahre oder gar Monaten (weswegen der Begriff »Arabischer Frühling« irreführend ist). In Europa etwa dauerte es 200 Jahre von den Ideen der Aufklärung bis zur gesetzlichen Gleichberechtigung aller Gesellschaftsmitglieder – darauf komme ich im Verlauf des Buches noch zu sprechen.
Die Tatsache, dass das Assad-Regime auch Jahre nach dem Ausbruch der Revolution noch an der Macht ist, bedeutet also nicht, dass diese bereits gescheitert ist oder besser gar nicht begonnen hätte. Hunderttausende Syrer sind tot, Millionen vertrieben – nicht wegen der Revolution, sondern wegen Assads Reaktion darauf. Systematisch Menschen zu massakrieren, um sich am Ende als einzig wahre Alternative zu präsentieren, funktioniert nicht. Genauso wenig wie einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung zu beginnen und sich dieser dann als Schutzpatron und Friedensstifter anzudienen. Nein, Assads Überlebenskampf um jeden Preis zeigt nur, wie notwendig der Aufstand gegen seine Herrschaft war und immer noch ist. Denn Totalitarismus kann keine echte Stabilität hervorbringen, er lebt von der Unterdrückung der Menschen und wird deshalb zwangsläufig irgendwann Widerstand auslösen.
In Tunesien und Ägypten, im Jemen, in Bahrain, Libyen, Syrien und anderswo war dieser Moment 2011 gekommen. Jahrzehntelang hatten kleptokratische pseudo-säkulare Herrscher die Länder wirtschaftlich ausgebeutet, ihre Bürger erniedrigt, sich mit Hilfe von Militär, Geheimdiensten und Polizei an der Macht gehalten und die Jugend chancen- und perspektivlos gelassen. Das Fass war voll, deshalb reichten einzelne Tropfen, um es zum Überlaufen zu bringen.
In Tunesien zündete sich ein junger Gemüsehändler an, in Ägypten verabredeten sich zivilgesellschaftliche Gruppen in den sozialen Medien zum Demonstrieren – Massenproteste waren die Folge, die innerhalb von Tagen beziehungsweise Wochen die verhassten Despoten Ben Ali und Mubarak stürzten. Das motivierte auch Syrer. Am 28. Januar 2011 übergoss sich Hasan Ali Akleh in der nordöstlichen Stadt al-Hasaka mit Benzin und zündete sich an. Für Anfang Februar riefen Aktivisten auf Facebook und Twitter zu »Tagen des Zorns« auf – doch große Demonstrationen blieben aus. Syrien, das »Königreich des Schweigens«, hielt den Atem an, so kam es mir vor, als ich im Februar 2011 zu Besuch in Damaskus war. Alles war möglich, aber die Zeit schien noch nicht reif für einen Aufstand.