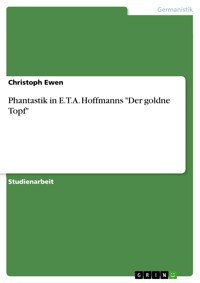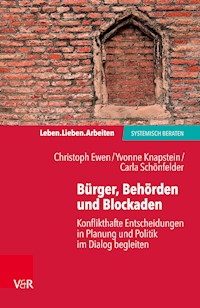
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben. Lieben. Arbeiten: systemisch beraten
- Sprache: Deutsch
Wenn es um die Beeinträchtigung von Gesundheit, Natur oder das persönliche Lebensumfeld geht, melden sich Menschen oft lautstark zu Wort. Entscheidend ist dann der Dialog – auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Über Konflikte im öffentlichen Raum entscheiden Politik, Verwaltung und Gerichte. Damit der Weg bis zur Entscheidung keine verbrannte Erde hinterlässt, ist Dialog wichtig. Drei »Dialogbegleiter« im öffentlichen Raum geben in diesem Band Einblicke in ihre Praxis – im Dorf, in der Region und auf nationaler Ebene. Sie beschreiben, welche Konfliktdynamiken und systemische Lösungsansätze bei öffentlichen Konflikten beachtet werden sollten. Sie stellen ihre Werkzeuge vor, reflektieren ihre Haltung und benennen offene Fragen, denn Beteiligung bedeutet nicht, dass nur die Lautesten zu Wort kommen, es muss möglichst allen Beteiligten und allen Perspektiven Raum gegeben werden, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Politik und alle andere Beteiligten müssen die Belange und Argumente der Gegenseite genauso kennen wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann kann man auch mit Entscheidungen leben, die anders sind, als man es sich erhofft hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Jochen Schweitzer und
Arist von Schlippe
Christoph Ewen/Yvonne Knapstein/Carla Schönfelder
Bürger, Behörden und Blockaden
Konflikthafte Entscheidungen in Planung und Politik im Dialog begleiten
Mit 9 Abbildungen und 2 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: ulleo/Pixabay
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6088
ISBN 978-3-647-90145-9
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Vorwort von Jochen Schweitzer
IDer Kontext
1»Sie haben alle recht« – Konfliktsysteme im öffentlichen Raum
1.1Einführung
1.2Fallbeispiel: Windenergie im Dorf
1.2.1Die Geschichte
1.2.2Der Dialog wird angebahnt
1.2.3Information und Dialog finden statt
1.3HINTERGRUND: Das Konfliktsystem im öffentlichen Raum
1.3.1Nachbarschaft oder öffentlicher Raum
1.3.2Mit der Atomkraft fing es an
1.3.3Debatten und Schweigespiralen im Dorf
1.3.4Rolle und Haltung von Beratern im öffentlichen Raum
1.3.5Und die Behörden?
1.4Systemische Zugänge
1.4.1Eskalationsstufen im öffentlichen Raum
1.4.2Zeit und Raum
1.4.3Zuschreibungen im Drama-Dreieck
II Die systemische Beratung
2Lösungssuche auf regionaler und nationaler Ebene
2.1Fallbeispiel: Eine neue Straße für den nördlichen Bodenseeraum
2.2Elemente systemischer Beratung im öffentlichen Raum
2.2.1Der Auftraggeber
2.2.2Eine Bühne bauen
2.2.3Das System einbeziehen
2.2.4Ökologie der Politik
2.2.5Rollen und Aufgaben des Beraters
2.2.6Ohne große Veranstaltungen geht es nicht
2.2.7Ohne geschützte Gruppen geht es ebenso wenig
2.2.8Zufällig ausgewählte Bürgerinnen
2.2.9Wahrnehmung im Raum
2.2.10Fakten und Interessen
2.3Fallbeispiel: Die neue Asbestproblematik gemeinsam angehen
2.4Ausblick
2.4.1Was ist Erfolg?
2.4.2Soll Dialog verpflichtend sein?
2.4.3Wie inklusiv sind die Dialoge?
III Am Ende
3Literatur
4Sonstige Materialien zum Thema
5Die Autoren
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe »Leben. Lieben. Arbeiten: systemisch beraten« befasst sich mit Herausforderungen menschlicher Existenz und deren Bewältigung. In ihr geht es um Themen, an denen Menschen wachsen oder zerbrechen, zueinanderfinden oder sich entzweien und bei denen Menschen sich gegenseitig unterstützen oder einander das Leben schwermachen können. Manche dieser Herausforderungen (Leben.) haben mit unserer biologischen Existenz, unserem gelebten Leben zu tun, mit Geburt und Tod, Krankheit und Gesundheit, Schicksal und Lebensführung. Andere (Lieben.) betreffen unsere intimen Beziehungen, deren Anfang und deren Ende, Liebe und Hass, Fürsorge und Vernachlässigung, Bindung und Freiheit. Wiederum andere Herausforderungen (Arbeiten.) behandeln planvolle Tätigkeiten, zumeist in Organisationen, wo es um Erwerbsarbeit und ehrenamtliche Arbeit geht, um Struktur und Chaos, um Aufstieg und Abstieg, um Freud und Leid menschlicher Zusammenarbeit in ihren vielen Facetten.
Die Bände dieser Reihe beleuchten anschaulich und kompakt derartige ausgewählte Kontexte, in denen systemische Praxis hilfreich ist. Sie richten sich an Personen, die in ihrer Beratungstätigkeit mit jeweils spezifischen Herausforderungen konfrontiert sind, können aber auch für Betroffene hilfreich sein. Sie bieten Mittel zum Verständnis von Kontexten und geben Werkzeuge zu deren Bearbeitung an die Hand. Sie sind knapp, klar und gut verständlich geschrieben, allgemeine Überlegungen werden mit konkreten Fallbeispielen veranschaulicht und mögliche Wege »vom Problem zu Lösungen« werden skizziert. Auf unter 100 Buchseiten, mit etwas Glück an einem langen Abend oder einem kurzen Wochenende zu lesen, bieten sie zu dem jeweiligen lebensweltlichen Thema einen schnellen Überblick.
Die Buchreihe schließt an unsere Lehrbücher der systemischen Therapie und Beratung an. Unsere Bücher zum systemischen Grundlagenwissen (1996/2012) und zum störungsspezifischen Wissen (2006) fanden und finden weiterhin einen großen Leserkreis. Die aktuelle Reihe erkundet nun das kontextspezifische Wissen der systemischen Beratung. Es passt zu der unendlichen Vielfalt möglicher Kontexte, in denen sich »Leben. Lieben. Arbeiten« vollzieht, dass hier praxisbezogene kritische Analysen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ebenso willkommen sind wie Anregungen für individuelle und für kollektive Lösungswege. Um klinisch relevante Störungen, um systemische Theoriekonzepte und um spezifische beraterische Techniken geht es in diesen Bänden (nur) insoweit, als sie zum Verständnis und zur Bearbeitung der jeweiligen Herausforderungen bedeutsam sind.
Wir laden Sie als Leserin und Leser ein, uns bei diesen Exkursionen zu begleiten.
Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe
Vorwort
Dieses Buch öffnet den Blick auf ein Beratungsfeld zwischen Bürgern und Behörden, das vielen systemischen Beraterinnen und Beratern noch unvertraut ist. Es wird aber in wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern mit starken Zivilgesellschaften möglicherweise immer bedeutsamer werden. Denn dort treffen wirtschaftliche Investitionen und staatliche Planungen immer öfter auf artikulationsstarke Gruppierungen in der Bevölkerung, die diese Investitionen und Planungen infrage stellen und dagegen Proteste organisieren. Dies führt mitunter zur Verhinderung, häufiger zu einer Verzögerung oder kostspieligen Änderung geplanter Projekte. Auch deshalb schalten Behörden oder Investoren zunehmend kompetente Beraterinnen oder Berater ein, die in der Planungs- und Umsetzungsphase einen im Idealfall sachlichen Dialog zwischen Behörden, Investoren, Protestierern und der übrigen Bevölkerung anbahnen und moderieren sollen.
Um solche kompetenten Beraterinnen und Berater handelt es sich bei dem Autorenteam Christoph Ewen, Yvonne Knapstein und Carla Schönfelder. Ausgestattet mit technischer Fachexpertise und beraterischer Prozessexpertise zugleich gehen sie an Standorte, an denen Konflikte zwischen Technik, Natur und Menschen bereits ausgebrochen sind oder demnächst ausbrechen könnten: an Flughäfen, Umgehungsstraßen, Windparks, asbesthaltige Gebäude, Flüchtlingswohnheime etc. Dort treffen häufig konkurrierende Wertsysteme aufeinander – z. B. Energiewende versus Artenschutz, Innenstadtentlastung versus Flächenverbrauch, Verkehrsfluss versus Lärmbelästigung, menschenwürdige Unterbringung Geflüchteter versus Erhaltung des Verkaufswertes von Immobilien. Beauftragt werden die Autoren zumeist von aufgeschlossenen kommunalen Landes- oder Bundesbehörden, die durch die Finanzierung und Planung solcher Dialogprozesse verhindern wollen, dass Bürger im Extremfall Blockaden errichten oder sich die Projekte durch unbearbeitete Konflikte weiter verzögern.
In außerordentlich kompakter, präziser und anschaulicher Form beschreibt dieses Büchlein die Praxis solcher Beratung. Die drei Fallbeispiele handeln von Windkraftparks, einer Umgehungsstraße und einem nationalen Plan zur Asbestentsorgung. Sie beschreiben, wie man solche Dialogprozesse plant sowie vorbereitet und wie man einzelne Veranstaltungen dann konkret moderiert. Geschildert wird, auf welcher Konflikteskalationsstufe welche Dialogpraxis sinnvoll ist. Aufschlussreich zu lesen ist, wie zufällig ausgewählte Bürger, die am Konflikt zunächst gar nicht beteiligt sind, gefunden und geworben werden können, um zwischen den aufgeregten Konfliktparteien eine gewisse Interessensneutralität ins Spiel zu bringen. Beschrieben wird auch, wie und wann ein Wechselspiel zwischen öffentlichen Großgruppenveranstaltungen und kleinen, geschützten, vertraulichen Meetings sinnvoll ist. Liebhaber von Systemaufstellungen werden im Buch unerwartete Anwendungen ihrer Methode auch in nationalen Planungsprozessen entdecken.
Es imponiert mir, wie die drei Autoren es in diesen Konflikten trotz und mit ihrer – von mir vermuteten – »Öko-Sozialisation« schaffen, die Sichtweisen aller beteiligten Parteien nachzuvollziehen, als irgendwie begründet wertzuschätzen und damit ein hohes Maß an Allparteilichkeit in die Dialogprozesse zu bringen. Ich denke, die Lektüre dieses Buches wird unser Verständnis davon erweitern, wann, wo und wie systemische Beratung überall angewendet werden kann.
Jochen Schweitzer
Der Kontext
1 »Sie haben alle recht«1 – Konfliktsysteme im öffentlichen Raum
1.1 Einführung
Wer im Film »Gasland« (2010) gesehen hat, wie das Wasser aus dem Hahn anfängt zu brennen, für den ist klar: Fracking ist ein Übel, das es zu bekämpfen gilt.
Die neue Umgehungsstraße soll ein wunderschönes Landschaftsschutzgebiet durchschneiden. Und wozu? Damit letztlich noch mehr Menschen Auto fahren und die kleine Stadt links liegen lassen?
Bei solchen Fragen mischt sich jeder ein, dem es wichtig ist. Wozu Moderation?, fragt dann der eine oder andere Aktivist2: Die Fakten liegen auf dem Tisch, und wenn die Politik statt auf die Bürgerinnen zu hören vor den mächtigen Lobbys einknickt, wird sie es bei einem Bürgerbegehren oder den nächsten Wahlen spüren.
Doch so einfach ist es nicht: Natürlich wäre es am besten, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien auszubauen. Solange Maßnahmen dazu noch nicht greifen, ist die Alternative zu Erdgas aus deutschen Fracking-Feldern sibirisches Erdgas oder Flüssiggas aus den USA, gewonnen durch Fracking. Und was ist mit den Menschen, die an der bisherigen Ortsdurchfahrt leben? Wer schützt sie vor Lärm?
Oft sind es die lauteren, sozial besser gestellten und sich besser artikulierenden Menschen, die solche Konflikte für sich entscheiden. Gegen die Umgehungsstraße protestieren die Bewohner der Häuser im Grünen, die sozial Schwächeren in der Innenstadt kommen kaum zu Wort – ganz zu schweigen von den Menschen in Sibirien oder Pennsylvania.
Teilhaben lassen bedeutet für uns, allen Beteiligten und allen Perspektiven Raum zu geben. Nur so kann das für Entscheidungen zuständige System, die Politik, gut und möglichst ohne einseitigen Druck entscheiden. Teilhaben lassen bedeutet auch, den Beteiligten dabei zu helfen, zu verstehen, was die jeweils andere(n) Seite(n) will bzw. wollen und welche Argumente sie hat bzw. haben – und was die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind.
Dabei die eigene politische Einstellung zu Hause zu lassen, ist für die Moderatorin unabdingbare Voraussetzung. Das fällt auch den erfahrensten Beraterinnen nicht immer leicht. Dann hilft es, wenn wir auf bestimmte Regeln achten, z. B. dass im Dialog fremdenfeindliche Äußerungen verboten sind, wenn es um neue Flüchtlingsunterkünfte geht. Aber wir nehmen besorgte Menschen ernst – und konfrontieren sie gleichzeitig mit der Wahrnehmung einer Geflüchteten.
Mit diesem Buch geben wir einen Einblick in unsere Praxis als systemische Beraterinnen und Moderatoren in öffentlichen Konflikten. Wir tun das anhand von drei Beispielen, die jeweils in allgemeine Überlegungen und Erörterungen der Hintergründe eingebettet sind. Es beginnt mit einem Dorf, in dem die geplanten Windenergieanlagen für Unfrieden sorgen (Abschnitt 1.2). Im zweiten Beispiel geht es um eine neue Straße, deren genauer Verlauf Gegenstand langjähriger Auseinandersetzungen in der Region ist (Abschnitt 2.1). Das letzte Beispiel dreht sich um den Ansatz, auf nationaler Ebene gemeinsam mit den Akteuren eine Strategie im Umgang mit dem neuen Asbestproblem zu finden (Abschnitt 2.3).
Ist bei lokalen Konflikten anfangs das ganze Dorf involviert, nehmen bei regionalen und dann bei nationalen Dialogen die sogenannten Stakeholder oder Interessenvertreter sowie die unter dem Titel »Träger öffentlicher Belange« firmierenden Behörden und Institutionen