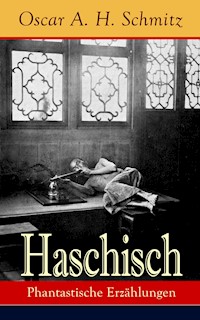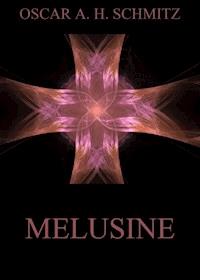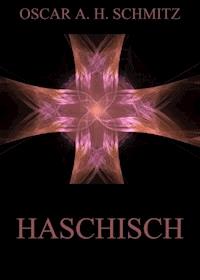Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Roman zeichnet Schmitz, lange Zeit selbst ein Mitglied dieser Gesellschaft, ein satirisches Sittenbild der Münchner Oberschicht seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bürgerliche Bohème
Oscar A. H. Schmitz
Inhalt:
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Bürgerliche Bohème
Erster Teil
Ein Mädchen aus guter Familie
Flirt oder Erlebnis?
Das Dionysosfest
Fürst Casimir Kraminsky
Zweiter Teil
»Schwabinger Eros«
Faschingsehen
Hölle
»Wenn wir Frauen erwachen ...«
Bürgerliche BohèmeA. H. Schmitz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635459
www.jazzybee-verlag.de
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Deutscher Bohéme-Schriftsteller, auch bekannt als Oscar A. H. Schmitz, geboren am 16. April 1873 in Bad Homburg vor der Höhe, Hessen, verstorben am 17. Dezember 1931 in Frankfurt am Main. Schulische Ausbildung am Städtischen Gymnasium in Frankfurt, das Abitur legte er allerdings am Philippinum in Weilburg ab. Studierte anschließend u.a. Jura, Philosophie und Kunstgeschichte in Heidelberg, Leipzig, München und Berlin. Ab 1894 lebte er in München. Brach 1895 sein Studium ab und widmete sich, dank guter finanzieller Ausstattung durch den Tod seines Vaters, dem Reisen und Schreiben. In München geht er auf im Leben der Bohème in Schwabing und interessiert sich immer mehr für esoterische Themen, aber auch Satanismus und Sadismus. Auch kommt er in Kontakt mit Drogen. Immer wieder zieht es ihn auch auf Reisen durch ganz Europa, Teile von Afrika und Russland. Die letzten Jahre seines Lebens interessiert er sich auch zunehmend für Psychologie und Psychoanalyse. Er stirbt an einer Leberkrankheit.
Wichtige Werke:
Orpheus,1899Haschisch, 1902Der weiße Elefant, 1902Halbmaske, 1903Der Herr des Lebens, 1905Don Juanito, 1908Brevier für Weltleute, 191Wenn wir Frauen erwachen, 1912Der hysterische Mann, 1914Die Kunst der Politik, 1914Das wirkliche Deutschland: Die Wiedergeburt durch den Krieg, 1915Ein deutscher Don Juan, 1917Menschheitsdämmerung, 1918Das rätselhafte Deutschland,1920Bürgerliche Bohème
Ein deutscher Sittenroman aus der Vorkriegszeit
Motto (aus einem alten Vogelbuch):
»Das Lied des Männchens hat ungefähr folgende Strophe: »zirri zirri zirri
1
Ein sonniger Frühling verklärte die alte mitteldeutsche Stadt an dem breiten, glänzenden Flusse in dem Jahre, als Mely Sanders vierzehn Jahre alt geworden war. Welch ein Entzücken erfüllte die Morgengänge nach der Schule durch die zartbegrünten Straßen und Promenaden! Noch fröstelte sie in der Frühe etwas im Freien, ihre weißen, mageren Fingerchen, die aus den Halbhandschuhen hervorkamen, waren kalt und etwas starr, während sie die Schulbücher umfaßten; die Schauer, die manchmal den dünnen, doch schon knospenden Mädchenkörper in dem Sommerkleid erfüllten, mischten sich aus den Empfindungen des Frierens und der Freude darüber, daß es jetzt von Minute zu Minute immer wärmer wurde. Auf dem Weg zur Schule schlossen sich ihr andere Mädchen, manchmal auch Buben, an, und plötzlich sah sie auf der großen Turmuhr, die ernst wie das Schicksal über die heitere Stadt ragte, daß sie sich beeilen mußte. Wie oft hatte sie den goldenen Zeiger auf dem schwarzen Zifferblatt befragt, und sie wußte genau, daß sie, wenn er mehr als fünf Minuten vor sieben stand, bequem Zeit hatte, um recht zum Unterricht zu kommen. Zeigte er nur eine halbe Minute später, so mußte man eilen. Dann schlugen die Kinder einen Laufschritt an, und als sie vor das große Schulhaus kamen, schien alle Morgenkühle verschwunden; es war ihnen so heiß, daß die Gänge mit dem etwas dumpfen Geruch eine angenehme Erfrischung boten. Die Mädchen stürzten in die Klasse, und noch klopfte Mely das Herz, wenn der Lehrer zur ersten Stunde hereintrat.
Die im leisen Maiwinde rauschenden Platanenkronen des Schulhofes hingen fast in die offenen Fenster des Raums, in dem etwa dreißig Mädchen von vierzehn Jahren in hellen Kleidern ungeduldig flüsterten, kicherten, auf den Sitzen hin und her rückten, sich stießen, hie und da ein Wort hinkritzelten, heimlich sich Gegenstände zuschoben oder auch Süßigkeiten kauten. Einige starrten wie geistesabwesend auf den Lehrer, einen bieder aussehenden Herrn von noch nicht dreißig. Seine knochige Männlichkeit, der aufgebürstete, braune Schnurrbart, ein vernarbter Schmiß über der Wange, die viereckige, etwas plumpe Stirn, alles das erschien schwerfällig, ja manchmal hilflos gegenüber dem unruhig prickelnden Element, das er zu beherrschen hatte. Es ist schwer zu sagen, was ihn mehr in Verlegenheit brachte, das unbotmäßige Schwatzen und die nicht zu besiegende Unaufmerksamkeit der einen Hälfte oder das verhimmelnde Anschmachten der anderen.
»Also bitte, die Jugenddramen Schillers in der Reihenfolge ihrer Entstehung,« sagte Dr. Brieskorn mit einer gewissen Energie, und fast schien es, als fühle er selbst, daß diese Frage, eines lichten Frühlingsmorgens an einen summenden Haufen vierzehnjähriger Mädchen gestellt, etwas Lächerliches hatte.
Niemand meldete sich, kaum hatte jemand hingehört. Er rief Mely Sanders auf. Ein Haufe wirren, blonden Haars, das über einer Tischplatte lag, erhob sich, darunter ein keckes, helles Gesichtchen mit graublauen Augen, die weit aufgerissen schienen und ein Gemisch von kindlichem Staunen und Aengstlichkeit vor etwas Unbestimmtem, nicht Gegenwärtigem ausdrückten. Dies wurde noch dadurch verstärkt, daß sich über diesen Augen die nicht sehr starken Brauen in auffallend runden Bogen wölbten. Die Unterlippe war etwas stärker entwickelt als die obere, und das gab der Miene immer etwas leise Unzufriedenes, Fragendes, ja hie und da Spöttisches, so daß man ganz und gar nicht daraus klug werden konnte, ob Mely ernst oder lustig war und wie sie die Dinge meinte, die sie im Augenblick sagte. Aber so wenig man auch darüber wissen konnte, so sicher wurde man von diesem noch vollkommen unbeherrschten Mienenspiel, dessen Stimmung wechselte wie ein Apriltag, unendlich angezogen. Als Mely von Dr. Brieskorn aufgerufen war, zappelte sie mit den Händen und stieß mit den Füßen gegen ihre Umgebung. Man sollte ihr vorsagen. Sie hatte die Frage gar nicht gehört. Da beugte sich ihre Nachbarin, ein fuchsrotes sommersprossiges Dirnchen, über Melys Pult und platzte in lautes Lachen heraus.
»Was ist denn da los?« fragte Dr. Brieskorn in einem Anflug von Strenge; mit einer vor Lachen erstickten Stimme rief die Fuchsrote patzig:
»Sie hat ein F in die Platte geschnitten.«
Dieses Wort entfesselte allen Uebermut, den ein Rest von Ehrfurcht bisher noch in den Mädchen niedergehalten hatte. Gelächter, Zurufe erfüllten die Klasse.
Dr. Brieskorn war feuerrot geworden, denn dieses F bedeutete den Anfangsbuchstaben im Vornamen seines Kollegen und Rivalen Friedrich Pulvermacher, für den die Mädchen schwärmten, welche mehr auf zierliche Hübschheit, als auf robuste Männlichkeit sahen. Dr. Brieskorn war, wie man sagt, eine gediegene Erscheinung. Er kleidete sich solid und hatte eine gewisse militärische Straffheit, deren er sich bewußt zu sein schien. Friedrich Pulvermacher dagegen oder der Fritz, wie er allgemein in der Schule genannt wurde, trug im Sommer oft Waschanzüge, hatte ein blondes Schnurrbärtchen und krauses Haar und liebte es, sich lässig hinzusetzen, das linke Bein über das rechte zu legen und bei der Gelegenheit zwischen dem gelben Schuh und der scharfgebügelten Hose eine gestickte Socke sehen zu lassen, über die seine gepflegte Hand mit dem Brillantring strich. Die Frage wurde allgemein erörtert, ob sein Haar natürlich oder künstlich gewellt war, und ob an dem Gerücht etwas Wahres sei, daß er Fräulein Mordtmann, die herzige Naive des Stadttheaters, wirklich persönlich kenne. Das Bild seines eleganteren Rivalen mußte plötzlich vor dem braven Dr. Brieskorn auftauchen, als die kecke Rothaarige ihm zurief, daß Mely ein F in die Tischplatte gegraben hatte. Die frühreife Schar dieser jungen Großstädterinnen weidete sich an seiner Verwirrung, und es war wohl keine unter ihnen, die nicht aus der ganzen Tiefe der instinktiven Weiblichkeit heraus genau zu fühlen glaubte, was Dr. Brieskorn in diesem Augenblicke »litt«. Die einen weideten sich an dem Gedanken, wie sehr er, der Kleinstädter in seinen schweren Schuhen und breiten Röcken, diesen bezaubernden Fritz hassen mußte. Die anderen aber empfanden, daß der ernsthafte, männliche Dr. Brieskorn es doch wirklich nicht nötig habe, sich hinter so einem Modegecken zu verkriechen. Seine Anhängerinnen jauchzten daher innerlich, als sich Dr. Brieskorn aufraffte und, zwar rot im Gesicht und mit unruhigen Augen, energisch rief:
»Dummes Zeug! Ich will Antwort auf meine Frage haben.«
»Wie grob er wird,« hörte man eine zierliche schwarze Jüdin flüstern.
»Was habe ich überhaupt gefragt?« rief der Lehrer.
Niemand wußte es, auch seine Anhängerinnen nicht, denn obgleich sie mit den Blicken an ihm hingen und alle seine Bewegungen und jedes Fältchen seiner Gesichtshaut verfolgten, so kümmerten sie sich doch recht wenig um die den Unterricht betreffenden Fragen.
»Ich werde dir einmal einen Tadel einschreiben,« fuhr Dr. Brieskorn, zu Mely gewandt, fort, »damit du aufpassen lernst.«
Mit erstaunlicher Plötzlichkeit brach Mely in ein lautes, markerschütterndes Schluchzen aus. Dr. Brieskorn richtete seine Frage an eine andere und erhielt einige notdürftige Antworten; aber der Unterricht konnte zunächst nicht fortgesetzt werden, da Mely ihr herzzerreißendes Schluchzen nicht einzustellen gedachte.
»Ach, verzeihen Sie ihr doch noch einmal, Herr Doktor,« rief Melys rothaarige Nachbarin und streichelte den Haufen blondes Haar, der wieder über der Tischplatte lag.
»Ueberhaupt, das geht gar nicht so, Herr Doktor,« rief die kleine Jüdin, »zuerst gibt es immer einen schlechten Strich, und drei schlechte Striche machen erst einen Tadel.«
»Ja, das ist überhaupt wahr,« stimmten einige bei.
Dr. Brieskorn war ratlos. In diesem Augenblick läutete es. Die Stunde war zu Ende. Alle dreißig Mädchen verließen ihre Plätze, umströmten den Lehrer, und einige baten:
»Ach, Herr Doktor, seien Sie doch nicht so bös, sie hat es ja nicht so schlimm gemeint.«
Andere schwiegen und standen dicht bei dem Lehrer, als wollten sie ihn verteidigen, aber sie sagten nichts, denn soviel Klassengeist war in ihnen, daß sie den Lehrer, wenn es ernst wurde, nicht gegen eine Mitschülerin aufzuhetzen versuchten. Mely Sanders lag, weiter brüllend, mit dem Oberkörper über ihrem Pult, und das war gewiß das Klügste, was sie tun konnte, denn Dr. Brieskorn nahm ärgerlich den Hut, man brachte ihm bereitwillig seinen Stock, und er verließ die Klasse, ohne den Tadel eingeschrieben zu haben. Man tanzte nun vor Freude umher, zog Mely, die sofort unter Tränen ihr Lachen wiederfand, aus der Bank, und alle wollten nun natürlich das F sehen. Die Anhängerinnen des Dr. Brieskorn verließen mit Protest den Raum. In der Tür begegnete ihnen der Fritz. Mit Erobererlächeln blickte er auf die Mädchenschar.
»Ach, der Fritz, der Fritz!« riefen einige keck.
Dieser tat zwar, als ob er es nicht höre, war aber von der Vertraulichkeit offenbar angenehm berührt. Die Anhängerinnen des Dr. Brieskorn blickten ihn mit schnippischem Lächeln von oben bis unten an, und eine blasse Blonde sagte halblaut, indem sie ihm auf die Füße sah, halb keck, halb schmachtend:
»Lila gestreifte Socken, das ist gewiß jetzt das Neueste!« –
Auf dem Heimweg von der Schule trennten sich die Mädchen voneinander. Bei Mely war nur Therese Berger geblieben, ein hochaufgeschossenes, bleiches Wesen mit unreiner Gesichtshaut, Rändern um die stechenden Augen, einer starken Nase, langen, knochigen Händen mit Knotengelenken und unsauberen Nägeln. Im Gegensatz zu dem süß-albernen, fast ganz unbewußten Ding, das Mely noch war, sah sie trotz ihrer vierzehn Jahre weder kindlich noch jung, höchstens minderjährig aus. Sie hatte Melys Arm untergefaßt, und beide lachten und stießen sich, gingen im Zickzack, rannten auch manchmal an Vorübergehende an. Mely tat das aus reinem Uebermut; sie wußte, daß es ungezogen war, aber sie hatte offenbar keine Ahnung davon, wie sie wirkte, wie sie aussah, was die Leute von ihr denken mochten. Therese war selber viel weniger ausgelassen, ihre Augen blickten aufmerksam umher, sie beobachtete bewußt die Mienen der Vorübergehenden und tat so, als versuche sie, Melys Uebermut zu bändigen, um die Verantwortung dafür von sich abzuwälzen. Dabei aber freute sie sich heimlich, wenn Mely ungezogene Dinge tat. Oh, ihr konnte man nichts nachsagen, sie hatte der Mely in einem fort zugeflüstert: »Aber Mely, sieh doch, wie die Leute schauen,« und dergleichen, aber Mely hatte es durchaus nicht hören wollen.
Die Mädchen bogen in eine grüne Straße ein, vor deren Häusern Vorgärten lagen. An einem offenen Fenster im ersten Stock stand ein bartloser Mensch mit verwittertem Milchgesicht und aschblonden Löckchen, Arthur Idali, der erste Liebhaber am Schauspielhaus. Er war in Hemdärmeln und spiegelte sich in der Scheibe, während er sich eine mattgrüne Krawatte umband.
»Ach, wie süß!« rief Mely in einem plötzlichen Anfall von Uebermut, wie sie es dem Fritz gegenüber gewohnt war.
Dann genierte sie sich auf einmal sehr und wollte fortrennen, aber Therese hielt sie fest.
»Weißt du schon, die Mordtmann hat den Fritz hinausgeschmissen, jetzt hat sie den Idali.«
Mely blickte Therese fragend an.
»Die haben doch ein Verhältnis zusammen,« sagte diese, »du, denk' dir bloß, mein Bruder hat auch schon eins gehabt. Er sagt, wenn es ein Kind gibt, dann geht er ins Wasser. Er will auch Elektrotechniker werden und nach Amerika gehen, weil dort alles so frei ist.«
Thereses Worte wirkten auf Mely wie ein plötzlicher Donnerschlag an einem Frühlingstage. Sie fühlte einen Stich durch ihr ganzes Innere, sie zitterte und glaubte, sie müsse umfallen.
»Du, sei doch still,« sagte sie fast flehend und voll Angst, als die andere weitererzählen wollte. Sie verstand eigentlich gar nicht, was diese meinte, aber sie wußte genau, daß Therese eben mit frevelhafter Hand an eine Welt des Grauens, der Sünde, des Unheils gerührt hatte, von der sie ihre sonnige Jugend in der Ferne umgrenzt fühlte. Therese letzte sich an ihrer Verwirrung.
»Du, du weißt wohl noch nicht, woher die kleinen Kinder kommen?« fragte sie weiter.
Mely riß sich nun plötzlich von ihr los und rannte, so schnell sie konnte, davon.
»Dumme Gans,« flüsterte Therese beleidigt.
Mely bog in eine stille, alte Straße ein. Dort stand das Haus Sanders im Herzen der Stadt. Es unterschied sich von den anderen Giebelhäusern durch die roten Sandsteinumfassungen der Tür und der Fenster: ein behaglicher Bau aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts mit übereinandergeschobenen Stockwerken. Mely betrat durch die breite Tür das einfache Patrizierhaus, in dem sie geboren war und bis jetzt gelebt hatte. Im Erdgeschoß lagen hinter bauschig vergitterten Barockfenstern Kontore. Eine etwas ausgetretene Sandsteintreppe mit geschnitztem, durchbrochenem Holzgeländer führte zu dem von der Familie bewohnten Stockwerk. An den Wänden des Treppenhauses hingen alte Stiche von Festungen und Kirchen. Mely, die sonst gewohnt war, bei ihrer Ankunft die Bücher in eine Ecke zu werfen, durch die Zimmer zu toben, um zu sehen, wer zu Hause war, und alle Neuigkeiten des Vormittags zu erzählen, ging heute still in ihr kleines, bunt geblümtes Zimmer mit den weißen Vorhängen, das an die Schlafstube der Mutter grenzte, setzte sich auf eine Stuhlkante vor den tintebeklecksten Tisch, an dem sie sonst ihre Schulaufgaben machte, und stützte sinnend den Kopf in die heißen Hände.
Nach einiger Zeit kam Frau Friederike Sanders herein, Melys Mutter, eine zierliche, einfache Frau von etwa fünfundvierzig Jahren mit altmodisch glattgescheiteltem Haar über einem liebenswürdigen Gesicht von großer Bescheidenheit des Ausdruckes und mit fast kindlichen, hellgrauen, auch etwas verdutzt in die Welt blickenden Augen. Sie war kaum größer als Mely, und wenn man sie beide nebeneinander sah, so verriet der erste Blick, daß Melys lachende, aufrechte Art nicht von der Mutter stammen konnte, daß sie dieser vielmehr schon jetzt über den Kopf gewachsen war.
Frau Sanders war die Witwe des früh verstorbenen Sanitätsrats Dr. Clemens Sanders. Sie entstammte einer angesehenen Familie der Stadt, war nach den dort herrschenden Begriffen gut erzogen, hatte aber niemals durch Beziehungen zu anderen als den gewohnten Lebenskreisen ihren Gesichtskreis erweitern können. Sie war ganz in ihrem Gatten aufgegangen, der durch Bedeutung im Beruf, wie durch eine gewisse weltmännische Art über seine Mitbürger etwas hervorgeragt hatte. Nach seinem Tode war Frau Sanders zu viel mit ihren Kindern beschäftigt gewesen, als daß sie über sich hätte nachdenken können. So verwuchs sie immer mehr mit dem Hause, in dem sie wohnte, und sah altmodisch aus, wie die Kommoden und Truhen, die rings in den etwas weinähnlich nach trockenen Rosen duftenden Zimmern standen. Ja, der lebendig erregten Mely gegenüber wirkte sie selbst fast wie ein Stück altes Gerät, das an dem Platze stand, wohin es einmal vor vielen Jahren gestellt worden war.
»Mely, du bist da?« sagte die Mutter erstaunt und besorgt. »Ich habe mich schon geängstigt, wo du steckst, und nun sitzest du hier, man hört dich ja heute gar nicht. Was ist denn mit dir?«
Mely war noch unfähig, ein Wort zu sprechen. In ihrer Verlegenheit legte sie den Arm um den Hals der Mutter, küßte sie auf ihre trockene magere Wange und schmiegte sich an ihre Brust. Die stets besorgte, selbst hilfsbedürftige Mutter gab Mely immer schnell die verlorene Sicherheit zurück.
»Ach, Mama, denke nur, eben habe ich geglaubt, ich könnte dich gar nicht mehr liebhaben und überhaupt niemand mehr auf der Welt,« erwiderte Mely noch unter Tränen, aber schon wieder beruhigt.
Mely küßte ihre Mutter, die es verständnislos geschehen ließ.
In diesem Augenblick sprang die Zimmertür auf. Hermann Sanders, ein fünfzehnjähriger Bub mit ebenso blondem, wirrem Haar wie Mely kam lärmend in seinem braunen Schulanzug herein.
Auch er hatte die grauen unentschlossenen Augen der Mutter und darüber wölbten sich wie bei Mely dünne Brauen, welche die Augen verwundert aufgerissen erscheinen ließen.
»Heute haben wir die Volksschüler aber vermöbelt,« rief er, »denkt euch, der Kofler hat ein wirkliches Rehhorn zum Boxen gehabt, aber wir haben ihn entwaffnet. Jetzt ist nur Waffenstillstand, heute nachmittag findet die Entscheidungsschlacht am Domplatz statt.«
»Aber Hermann,« sagte die Mutter, »wie siehst du denn aus?«
Sie nahm seine blasse, beschmutzte Hand, die aus einem langen Riß blutete. Mit Stolz zeigte er seine Wunden.
Mely vergaß plötzlich all ihren Schmerz, sie hüpfte vor Freude.
»Oh, Hermann, da muß ich dabei sein! Nach der Schule am Domplatz, nicht?«
»Aber, Mely, schäm' dich doch, ein Mädchen!« sagte die Mutter.
»Und jetzt werden auch Torpedos angekauft,« rief Hermann, von Melys Teilnahme angefeuert, »aber das ist noch ein Geheimnis.«
Auch in seinem Gesichte bemerkte man die etwas vorstehende Unterlippe wie bei Mely, aber während sie bei dieser mehr eine spielerische Schnippigkeit verriet, war sie bei ihm trotzig, fast herausfordernd.
Das alte Lenchen trat ein, ein mageres, verhutzeltes Geschöpf, das die Geburt der beiden Kinder im Hause miterlebt hatte. Ihre Anhänglichkeit wurde freilich seit einiger Zeit erkauft durch einen unaufhörlichen Wechsel der Köchinnen, da keine allzulange Lenes Gewaltherrschaft aushielt.
»Die Suppe ist auf dem Tisch,« rief sie kurz in eine Ecke, als mißbillige sie etwas.
Frau Sanders ging mit ihren beiden Kindern in das Eßzimmer, einen großen, etwas niedrigen Raum mit altertümlicher Stuckdecke und tiefen Fensternischen. Die Möbel und das Gerät verrieten einen soliden, seit Geschlechtern vererbten Wohlstand. Ueber dem eingelegten Schreibtisch aus hellem Birnbaumholz hing ein großes mattes Oelbild, das in etwas steifer Feierlichkeit einen Mann mit hellen, offenen Augen, etwas selbstbewußtem, breitem Mund und viereckigem, blondem Vollbart darstellte. Die Auffassung war konventionell: ein schöner würdevoller Vertreter seines Geschlechtes, dem Kaiser Friedrich nicht unähnlich; die rechte Hand hielt er gewichtig im Brustausschnitt seines Gehrocks. Es war das Bildnis des vor einem Jahrzehnt infolge einer Erkältung, die er sich auf der Jagd geholt hatte, plötzlich verstorbenen Sanitätsrats Clemens Sanders, des Vaters von Mely und Hermann. Die beiden Kinder entsannen sich seiner kaum mehr.
»Du, wie ist denn das mit den Torpedos?« fragte Mely bei Tisch.
»Sehr einfach,« erklärte Hermann überlegen, »die Obersekunda hat Geld zusammengelegt und beim Antiquar Hosp eine alte Ausgabe von Meyers Konversationslexikon gekauft; das sind zwölf Bände Munition, die benutzen wir als Torpedos, d. h. wir binden sie an Riemen und schmeißen sie auf den Feind.«
So sehr Mely auch an diesen Taten Anteil nahm, sie konnte nicht ganz über das Unbehagen hinauskommen, das sie doch in der Tiefe empfand, sobald sie heute an die Schule dachte. Sonst ging es nach ihrem Geschmack dort höchst vergnüglich zu, selbst der Unterricht war ihr nur ein angenehmes Gesellschaftsspiel, aber heute schien ihr der Gedanke unerträglich, Therese Berger wiederzusehen, vor der sie eine wahre Angst fühlte. Warum? Sie wußte es nicht. Vielleicht fürchtete sie heimlich, dieses Mädchen würde nun immer wieder von dem bewußten Thema unaufgefordert beginnen. Sie konnte sich nicht dagegen schützen, und sie wollte doch nichts davon hören, denn das, was sie heute morgen so plötzlich erfahren, war schon mehr, als ihre Kinderseele auf einmal vertragen konnte. Nach Tisch sagte sie darum halb verlegen zu Hermann:
»Du, hol mich doch heute von der Schule ab.« »Aber du weißt doch, ich kann nicht,« erwiderte er, »ich muß eine ganze Kompagnie zum Domplatz führen. Komm lieber allein hin.«
Mely gelang es am Nachmittag, Therese auszuweichen. Kaum war die letzte Stund« geschlossen, als sie voll Angst ihre Bücher ergriff und, so schnell sie konnte, durch die Straßen davonrannte. Sie eilte durch Gassen, die sie kaum kannte, aus deren Kellerlöchern kühle, etwas muffige Gerüche emporstiegen und rannte zum Domplatz. Dort standen schon die Gymnasiasten. Als sie plötzlich der vielen Buben ansichtig wurde, blieb sie stehen. Sie genierte sich. Die Jungen machten einen ungeheuren Lärm. Manche standen in Reih' und Glied, wie in der Turnstunde. Sie hatten ihre Bücher an Riemen gebunden, so daß sie sie als Schleuder benutzen konnten. Mehrere liefen lebhaft vor der Front hin und her. Eine Anzahl blasser, bebrillter Obersekundaner hielt wirklich die beim Antiquar gekauften Torpedos unter den Armen. Die Mannschaften sahen aber mehr aus, wie Kandidaten zu einem Examen, als wie einer Schlacht gewärtige Helden. Nach einiger Zeit hörte man einen gellenden Pfiff aus der Seitengasse. Die Volksschüler, meist in dunkle Strickanzüge gehüllt, brachen hervor wie eine Schar von Hunnen, viel wildere und furchtbarer aussehende Kerle als die Gymnasiasten. Sie schwangen ihre Ranzen und zerstörten im Nu die geordnete Schlachtreihe. Es entstand ein wildes Handgemenge, aber schon mischten sich Vorübergehende ein, packten einige Jungen am Kragen und trieben sie auseinander. Ein Haufe Gassenbuben hatte sich eingefunden – Franktireurs, mit denen man kurzen Prozeß machen müsse, nannte sie Hermann –, auch ein Schutzmann mit Notizblock ließ sich blicken, die Volksschüler wurden zerstreut, die Gymnasiasten hoben ihre auf dem Platze liegenden Torpedos auf und schlugen den Weg zur Schwimmanstalt ein.
Mely hatte mit Entzücken zugesehen und gedacht: bei den Buben geht's doch anders zu, als bei den dummen Gänsen in der Mädchenschule. Hermann kam nach der Schlacht auf sie zu, vollkommen zerzaust und mit verbogenem Strohhut, das Torpedo »Astrachan bis Beulenpest« unterm Arm. Erwin Dorn war bei ihm, ein großer, etwas stiller Junge, der für einen Sonderling galt, weil er sich nur wenig an den Schlachten beteiligte, aber gerade in dem trotzigen Hermann stets einen Verteidiger fand. Sein brünettes Gesicht mit den starken Backenknochen gab ihm etwas Fremdartiges. Er war Primaner, so daß sein Verkehr, der sich auf den gemeinsamen Schulweg beschränkte, dem jüngeren Hermann sehr schmeichelte. Der Flaum auf seiner Oberlippe ließ sich, wenn er sich einige Mühe gab, an den Enden bereits ein ganz klein wenig in die Höhe zwirbeln. Obwohl auch in seinem Blick noch etwas Kindliches lag, schienen seine Augen doch schon in Geheimnisse zu dringen, die den anderen noch verborgen blieben. Er war auch sorgfältiger gekleidet als jene. Mely wurde in seiner Gegenwart stets etwas befangen. Als sie ihn heute sah, mußte sie einen Augenblick an das denken, was ihr Therese Berger zugeraunt hatte, aber plötzlich schüttelte sie es gewissermaßen von sich ab. Nein, damit hatte der Dorn nichts zu tun.
Erwin hatte viel gelesen, und davon ließ sich Hermann gern erzählen, obwohl er sich nie dazu entschlossen hätte, selber einmal ein Buch zu öffnen; auch Mely hörte ihm gern zu, besonders wenn er über fremde Länder sprach, als sei er selbst dort gewesen. Während die meisten Klassengenossen Hermanns eine sichtliche Verachtung für das weibliche Geschlecht zur Schau trugen, hatte Erwin Mely manchmal Veilchensträußchen geschenkt und ihr auf dem Schulwege die Bücher getragen. Sie fand das bald komisch, bald aber auch sehr nett. Jedenfalls freute sie sich immer, wenn sie ihn sah, und sie fühlte sich von einer Art Huldigung, die er ihr zukommen ließ, geschmeichelt. Niemand behandelte sie so sehr als Erwachsene wie er.
Hermann, Erwin und Mely gingen nun hinter den anderen her. Hermann sprach die ganze Zeit von den Möglichkeiten im weiteren Verlauf des Krieges mit den Volksschülern. Am Flußufer verabschiedete er sich, er wollte mit den anderen schwimmen gehen. Dies war auch anfangs die Absicht Erwins gewesen, nun aber wurde er unsicher und schwankte in seinem Entschluß. Er geriet etwas in Verlegenheit, als er Hermann sagte, er würde heute lieber nicht schwimmen. Dann begleitete er Mely allein nach Hause. Er sprach zunächst fast gar nicht. Auf einmal sagte er:
»Soll ich dir vielleicht das >Buch der Lieder< leihen?«
»Was ist das?«
»Gedichte.«
»Ach, Gedichte,« sagte Mely wegwerfend, »von wem denn?«
»Von meinem Lieblingsdichter Heinrich Heine.«
»Von dem? Den haben wir ja selbst im Bücherschrank, den brauchst du mir nicht zu leihen.«
Mely war enttäuscht, daß sie das so bequem zu Hause haben konnte. Sie hoffte immer, Erwin würde ihr einmal etwas ganz anderes sagen, etwas, was überhaupt gar niemand sonst wußte, als er. Sie waren an dem alten Hause angekommen. Erwin verabschiedete sich, wobei er Schwierigkeiten hatte, den Hut mit der linken Hand zu fassen, da er unter dem Arm seine Schulbücher trug. Den rechten Arm aber mußte er frei haben, denn er hatte sich schon die ganze Zeit darauf gefreut, Melys kindliche, etwas gebräunte Hand, die jetzt entblößt war, zu fassen. Er hielt sie ein wenig lange in der seinen. Mely kämpfte heimlich mit dem Lachen. Auf der Treppe dachte sie: was mögen das für Gedichte sein? Sie wollte gleich an den Bücherschrank gehen, aber dann dachte sie: nein, nicht gleich, soviel liegt mir überhaupt gar nicht daran.
Oben wartete das Lenchen mit dem Kaffee. Frau Sanders war ausgegangen. Mely erzählte der alten Dienerin die Heldentaten, denen sie eben beigewohnt hatte, aber von dem »Buch der Lieder« sagte sie nichts. Die neuen Eindrücke gaben ihr das Gleichgewicht wieder, das sie durch Therese Bergers Worte einen Augenblick verloren hatte. Es war für sie ein ereignisreicher Tag gewesen. Mit Entzücken sah sie den nachmittäglichen Sonnenstrahlen zu, die durch die nicht ganz schließenden, grünen Läden in das Zimmer drangen und auf dem Kaffeetisch das Geschirr und das Silber blitzen ließen.
»Weißt du, Lene,« rief sie plötzlich, »heut war es wirklich schön, und nun wird es immer schöner.«
Dabei sprang sie auf, fiel der alten Lene um den Hals und zog die erstaunt Widerstrebende ein paarmal um den Tisch herum.
2
Zweimal in der Woche ging Mely in den Konfirmandenunterricht bei dem Propste Nothaft. Ohne zu wissen, warum, nahm sie das doch etwas ernster als die Schule. Die Lehrer waren Menschen, für die man Schwärmerei oder Spott hegte. Was aber dieser ältliche, hüstelnde Mann mit den dünnen Lippen sagte, die sich oft wie Deckel eines Etuis über einer überraschenden Perlenkette falscher Zähne auseinanderschoben, das klang so weltfern und außermenschlich, daß sie ihm ehrfürchtig zuhörte, wenn er mit seinen dicken Zugstiefeln vor den Sitzreihen in der langen kahlen Stube auf und ab ging. Sie mußte ihm innerlich recht geben, daß er den Mädchen Flatterhaftigkeit, Eitelkeit und weltlichen Sinn vorwarf, und auf die Pflichten der Nächstenliebe, besonders gegen die Armen, hinwies. Aber der Gedanke, daß man nach diesen schönen Worten sein Handeln wirklich einrichten könne, war ihr niemals gekommen. Was sie hier Erbauliches hörte, gefiel ihr, aber es gewann nicht die mindeste Wirkung auf ihr Leben, während sie draußen war. Sie hatte sozusagen eine platonische Liebe zu allem Guten; so kam sie nicht ungern in den Konfirmandenunterricht und unterwarf sich willig dem augenblicklichen Bann, den die Atmosphäre der ärmeren und ganz armen Mädchen aus Mittel- und Volksschule auf sie ausübte, ja, sie scheute nicht einmal so sehr den dumpfigen Kleineleutegeruch, den jene ausströmten, denn sie empfand ihn als Gegensatz zu ihrer eigenen, heiteren Welt und ihn einzuatmen ein bißchen als Sühne dafür, daß es ihr sonst so gut ging. So schlimm aber war diese Sühne nicht, daß sie darunter ernstlich gelitten hätte, und darum fand sie es in der Ordnung, ja angenehm, sie auf sich zu nehmen.
Die Bevorzugte des Pfarrers, Elisabeth Schlosser, die wohl auch außerhalb des Unterrichts in seinem Hause aus- und einging, machte auf Mely einen großen Eindruck. Sie war ein ernstes, schon ziemlich entwickeltes Mädchen von etwas breiter und gedrungener Gestalt. Das glatt gescheitelte Haar über einem nicht unregelmäßigen, aber gar nicht reizvollen Gesicht gab ihr den Anschein einer angehenden Krankenpflegerin. Der dünne Mund war herb und sprach von Pflicht und Verantwortlichkeitsgefühl, das vielleicht frühe Lebenserfahrungen in ihr entwickelt haben mochten, aber die braunen Augen waren doch nicht ohne eine gewisse Sanftheit. Sie gab rasche und knappe Antworten. Mely betrachtete sie immer wie ein Ideal (so drückte sie sich aus), obwohl sie in eine geringere Schule ging als sie.
Eines Tages verließen Elisabeth und Mely zusammen das Pfarrhaus. Elisabeth fragte ein klein bißchen von oben herab:
»Wo gehst du jetzt hin?«
»Schwimmen. Und du?«
»Ich will eine arme Familie besuchen gehen.«
Mely wurde etwas verlegen.
»Unsere frühere Aufwärterin«, fuhr Elisabeth fort, »hat sich wieder verheiratet, jetzt ist der Mann im Spital und sie sitzt mit zwei kleinen Kindern da.«
Mely fühlte, daß sie jetzt irgend etwas sagen müsse.
»Wir haben ein Mädchen schon seit Mamas Hochzeit und die ist immer noch bei uns.«
»Das ist schön,« erwiderte Elisabeth, »aber die meisten meinen eben, sie müßten unbedingt heiraten, dann läßt das Unglück nicht lange auf sich warten.«
»Schrecklich dumm eigentlich,« meinte Mely aus tiefster Ueberzeugung, und sie kam sich außerordentlich erwachsen vor, denn mit niemand hatte sie bisher in dieser Art über Dienstboten gesprochen.
»Wenn ihr zu Haus alte Kleider habt oder hie und da etwas übriggebliebenes Essen, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es mir für die arme Frau geben wolltest.«
»Ach ja,« rief Mely plötzlich, wie befreit von dem Druck, den das zu ernste Gespräch auf ihr nicht an dergleichen gewöhntes Gemüt ausgeübt hatte.
Der Gedanke entzückte sie, sich auf diese Weise tätig zu sehen. An so etwas hatte sie noch gar nicht gedacht.
»Sicher haben wir alte Sachen und auch etwas zu essen. Ich will es der Mama gleich sagen, dann schicken wir die Lene hin.«
»Bring's doch selbst,« sagte Elisabeth streng, »hier sind wir übrigens angekommen.«
Sie blieb vor der Tür eines ärmlichen Hauses stehen, dessen graue Mauern auch in diesen Frühlingstagen nicht ganz trocken wurden.
»Willst du gleich einmal mit hereinkommen?« fragte Elisabeth prüfend, als überlege sie, ob Mely eine für ihre Zwecke geeignete Persönlichkeit sei.
Mely ging mit. Sie zitterte, so etwas hatte sie noch nie erlebt. Sie folgte Elisabeth durch einen Hof. In einem dunklen Raum schlug ein Schmied glühendes Eisen, im Freien arbeitete ein Schuster. Es roch aus verschiedenen Küchen nach gekochtem Kohl. Sie gingen eine enge, gewundene Treppe hinauf.
Oben wurde die Luft immer dumpfiger. Elisabeth klopfte in der Dunkelheit an eine Holztür. Mely mußte den Atem anhalten. So unangenehm ihr manches hier war, sie fühlte sich wie im Märchen und hätte sich nicht gewundert, wenn hinter der Tür eine alte Hexe am Spinnrocken gesessen wäre. In dem Raum stand eine dürftig angezogene Frau vor einem Kochofen, ein Kind spielte am Boden, ein anderes war in eine Kiste geklemmt. Auf einem schmutzig überzogenen Sofa, das wohl gleichzeitig als nächtliche Lagerstätte diente, häufte sich allerlei ärmliches Zeug. Elisabeth sprach mit der Frau, die zwar fast unterwürfig, aber so grobe Mundart redete, daß Mely kaum ein Wort verstand. Sie mußte sich erst an die ungewohnten Eindrücke gewöhnen. Dann rief sie aus:
»Ach Gott, wie süß ist doch das Kleine!«
Sie hob eine Rassel vom Boden und spielte mit dem schmutzigen Kind in der Kiste. Elisabeths Zeit war knapp bemessen. Sie sagte, sie müsse noch in andere Häuser gehen. Beim Abschied erinnerte sie Mely daran, die arme Frau ja nicht zu vergessen.
Als Mely nach Hause kam, erzählte sie gleich der Mutter das Geschehene. Frau Sanders war gerne bereit zu helfen. Am Nachmittag trug Lene die Sachen zu der Frau. Mely ging mit, aber sie hätte sich nicht allein hingetraut. Als die Frau die alten Kleider sah und die Würste, die Lene auspackte, wollte sie das ältere der Kinder zwingen, sich schon zu bedanken, aber es brach in unartiges Weinen aus. Mely fiel auf, in einem wie anderen, unbefangenen Ton die Frau heute nachmittag redete im Vergleich zu der etwas gedrückten, schüchternen Art, wie sie mit Elisabeth gesprochen hatte. Sie war eigentlich ganz gut gelaunt und machte Scherze, so daß Mely bei sich dachte, so schrecklich arm könne sie doch wohl gar nicht sein. Sie nahm z.B. eine der Würste, hielt sie dem Kinde in der Kiste vor die Nase und rief:
»Hast de Dorscht, beiß' in die Worscht.«
Darüber mußte Mely laut lachen, und sie freute sich schon darauf, wenn sie diese Redensart in der Schule gebrauchen würde.
Auf dem Heimweg sagte das Lenchen zu Mely:
»Wer weiß, das sind vielleicht ganz schlechte Leut'. Eine ordentliche Frau läßt ihre Kinder nicht so im Schmutz verkommen.«
»Aber sie hat doch kein Geld.«
»Wasser kost' nix,« sagte Lene entschieden.
»Warum sie bloß heiraten mußte?«
»Ja, das weiß der liebe Herrgott! Das weiß selber keine, aber jede muß hineintappen, und dann ist's zu spät.«
Mely stand vor einem Rätsel.
3
An einem der nächsten Tage nahm Mely doch das »Buch der Lieder« aus dem Bücherschrank. Sie las erst im Stehen hie und da ein Gedicht, dann setzte sie sich auf einen Stuhl – nach ihrer Gewohnheit nur auf die Kante –, las und las, und schließlich ließ sie das Buch sinken, ihre Schläfen schmerzten, die Glieder waren schwer und müde, in ihr wühlte eine unbekannte Erregung. Zuletzt hatte sie kaum mehr auf den Sinn geachtet, sich nur dem betäubenden Rhythmus der Verse hingegeben, aus denen ihr Blumennamen und Düfte, Worte wie Liebessehnsucht, Mondschein und Geheimnis, Erinnerungen an Stelldichein und Küsse im Gedächtnis blieben. Das war ja das Wundervollste, was sie je erfahren. Sie hätte gleichzeitig jauchzen und weinen können, und plötzlich fiel ihr Erwin mit den sonderbaren Augen ein, der ihr das Buch genannt hatte. Also auch er kannte diese süßen, berauschenden Gefühle, die sie jetzt kostete, und das war es vielleicht, was sie immer geahnt hatte, und was ihn ihr so ungeheuer interessant machte. Oh, sie mußte mit ihm über diese Dinge sprechen, so bald wie möglich. Während sie noch träumte und das Buch in den Händen hielt, hörte sie die Vorplatztür gehen und die Stimmen Lenes und der Mutter, die von einem Ausgang heimkehrte. Mely fühlte sofort, daß sie sich in ihrem Zustand nicht überraschen lassen dürfe, schnell stellte sie das Buch in den Bücherschrank zurück und ging in ihr Zimmer.
Am folgenden Sonntag traf sie Erwin beim Kirchgang. Von der Predigt hörte sie kaum ein Wort. Manchmal suchten ihre Blicke den brünetten Primaner, der sehr aufmerksam auf den Pfarrer zu hören schien. Ob ihn das, was er sagte, wirklich so sehr fesselte? Gewiß verschloß er in sich eine sehr große Liebe. Was mochte das wohl für ein Mädchen sein, das dieser fremdartige Junge liebte? Eigentlich war er gar kein Junge mehr, sondern wirklich ein junger Herr.
Nach dem Gottesdienst sagte ihr Erwin guten Tag. Sie gingen nebeneinander her, aber wie gewöhnlich sprach er nicht viel. Mely konnte es nicht mehr aushalten und sagte plötzlich, während sie zwischen den feuchten Rasen der Promenade gingen, die von sonntäglichen Spaziergängern belebt war:
»Das ›Buch der Lieder‹ ist aber sehr schön.«
Erwins Augen wendeten sich zu ihr und blitzten auf.
»Hast du's gelesen? Ich dachte es mir, daß du auch zu denen gehörst, für die es ist.«
Sie duzten sich, da sie sich noch vor jenem Lebenseinschnitt gekannt hatten, an dem junge Leute voreinander die Unbefangenheit verlieren. Für Mely war das belanglos, er aber genoß bereits die Vertraulichkeit, die darin lag. Lernte er ein Mädchen in Melys Alter jetzt kennen, so redete er sie unwillkürlich mit Sie an.
Mely hatte bei seinen Worten aufgehorcht. Es gab also offenbar auserwählte Menschen, die Dinge wußten und fühlten, die den anderen verschlossen waren, Erwin gehörte zu ihnen und schien nun nach einer Prüfung auch sie dazu zu rechnen. Sie bebte.
»Woher hast du das gewußt?« fragte sie, und es kam ihr fast keck vor, diese Frage zu stellen.
»Nun, das hast du wohl schon gemerkt, für die meisten ist doch das ›Buch der Lieder‹ nicht.«
»Das ist wahr, woher kennst du es denn?«
»Oh, ich interessiere mich doch überhaupt für Literatur,« erklärte Erwin mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, »ich kann dir auch einen Roman leihen, wenn du willst: ›Liechtenstein‹ von Hauff.«
»Von dem Hauffs Märchen sind? Ist der auch so schön?«
»Fast noch schöner.«
»Den haben wir auch zu Hause, aber es ist wirklich schrecklich lieb von dir, daß du mir so etwas sagst.«
»Ich spreche sonst mit gar niemand davon,« erwiderte Erwin, als habe er schon seine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht.
»Ich werde es auch nicht tun, die anderen sind ja viel zu dumm.«
»Da hast du recht,« seufzte Erwin.
»Mit dir kann man sich wirklich furchtbar nett unterhalten,« erwiderte Mely voll Bewunderung.
Hermann hatte inzwischen die beiden eingeholt.
»Der Kofler kommt in eine Besserungsanstalt,« berichtete er, »weil er mit seinem Rehhorn einem Volksschüler ein Auge ausgestochen hat.«
Mely sagte: »Ach, Hermann, laß uns doch mit diesen langweiligen Geschichten zufrieden.«
»Seit wann sind sie dir denn langweilig? Hat dich der Dorn vielleicht mit seinen Ansichten angesteckt?«
Erwin wurde rot. Mely zuckte nur die Achseln:
»Als ob ich nötig hätte, mich anstecken zu lassen, ich habe doch meine eignen Ansichten.«
Erwin fand sich von jetzt ab häufig, bald jeden Morgen, schließlich zweimal täglich auf Melys Schulweg ein. Er trug ihr die Bücher und sie sprachen zusammen über Heine, Liechtenstein und Liebe. Er erzählte ihr, wie unglücklich Heine war, und wie schrecklich es ist, wenn man liebt ohne Gegenliebe. Einmal fragte Mely:
»Hast du eigentlich schon geliebt, Erwin?«
»Ach nein, wen hätte ich denn lieben sollen, ich kenne ja niemand!«
Das enttäuschte Mely. Sie hatte geglaubt, er würde sie nun in das Geheimnis einer großen Leidenschaft blicken lassen, nun aber tat er ihr fast leid, gleichzeitig war aber auch etwas in ihr, das sich darüber freute, daß Erwin noch nicht geliebt hatte.
Am andern Tage drückte Erwin Mely beim Abschied ein Briefchen in die Hand, sie solle es oben lesen. Voll Neugier rannte sie hinauf in ihr Zimmerchen. In dem Briefe stand ein Liebesgedicht. Mely gefiel es sehr gut. Woher er es wohl hatte? Ob es auch von Heine war? Sie las es im Tage mehrmals durch und abends konnte sie es auswendig. Bei ihrem nächsten Zusammentreffen fragte sie Erwin:
»Woher ist denn das schöne Gedicht?«
»Von mir.«
Mely schaute ihn erstaunt an. War das möglich? Jetzt schwindelte er aber.
»Wirklich von dir selbst gemacht? Woher kannst du denn Gedichte machen?«
»Oh, ich dichte sehr viel,« erwiderte er, »fast jeden Tag eine Stunde. Ich habe ein ganzes Heft für dich, ich wollte nur erst einmal sehen, ob dir das eine gefällt.«
»Ach, laß mich alle lesen, das eine gefällt mir sehr!«
Erwin zog aus seiner Tasche ein kleines gelbes Heft, das mit einem blauseidenen Faden umwunden war. Mely konnte kaum erwarten, bis sie zu Hause war, und nun las sie Gedichte »An Mely«, »Als ich sie zum erstenmal sah«, »Eine Friedhofsphantasie im Falle von Melys Tod«. Er nannte sie Grausame, Engel, Geliebte, Ungetreue. Dann verfiel er plötzlich in einen frivolen Ton. »Ich habe soviel mit Herzen gespielt«, begann ein Gedicht. Fieberhaft durchlas Mely das Heftchen. Sie konnte es kaum glauben. Das waren Gedichte, mindestens so gut wie die von Heine, und sie waren an sie selbst gerichtet, von jemand, der sie liebte. Vor dem Einschlafen war sie, wie noch niemals, von den widersprechendsten Gedanken erfüllt. Der Gedanke an eine Liebe zwischen ihr und Erwin war ihr bisher noch nie gekommen, überhaupt schien ihrer Phantasie der Gegenstand einer Liebe niemals greifbar. Nur die Liebe als solche lockte sie, und mit Erwin hatte sie nur davon geplaudert, wie man zu jemand spricht, mit dem man eine gemeinsame Reise in ein fremdes Land unternehmen will; ja, es hätte sie fast mehr gereizt, ihn über irgendeine Liebe, die er hegte, sprechen zu hören, als daß er sie selber liebte. Und nun liebte er sie doch selbst, da konnte sie in ihm auf einmal nur den Jungen, den Gymnasiasten sehen. Aus seiner romantischen Ferne war er ihr nun ganz nahe gerückt. Vorher hatte sie bewundernd zu ihm aufgeschaut, er war ihr geheimnisvoll erschienen. So ein Junge ist doch tausendmal interessanter, hatte sie oft gedacht, als so eine Gans von einem Mädel und selbst als die strenge Elisabeth Schlosser. Aber jetzt fühlte sie sich auf einmal überlegen, und während ihr bisher alles, was sie mit Erwin, seit sie das Buch der Lieder kannte, gesprochen hatte, als etwas Ernstes, Edles, fast Heiliges erschienen war, fand sie auf einmal auch ihm gegenüber ihr sonst so leicht zu erregendes Lachen wieder. Die Verwirrung, in die ihn beim Hutabnehmen immer die Schulbücher brachten, war doch auch zu komisch. Sie schalt sich selbst, daß sie darüber lachen mußte. Wie gerne hätte sie alles feierlich genommen! Immerhin fand sie es wunderschön, so geliebt und besungen zu werden. Zum ersten Male vermißte sie es, daß sie keine nahe Freundin hatte. Mit Entsetzen erinnerte sie sich an Therese Berger. Es wäre eine Beschmutzung dieser Dinge gewesen, wenn sie sie ihr anvertraut hätte. Nein, mit so etwas hatten ihre Gefühle und auch die Erwins gewiß gar nichts zu tun. Dennoch aber mußte sie immer wieder an die Worte denken, die Therese zu ihr gesprochen, und an die grausige Welt, vor der sich einen Augenblick der Vorhang gelüftet hatte. Oder sollte sie sich gar Elisabeth Schlosser anvertrauen? Um Gottes willen, wenn die davon etwas wüßte! Die stand ja hoch und unnahbar über solchen Dingen.
Am Nachmittag konnte sie kaum erwarten, Erwin zu sehen. In den letzten Tagen hatten sie den Heimweg immer mehr ausgedehnt. Da Frau Sanders um diese Zeit ausging, blieb Melys Fernbleiben unbeachtet. Erwin war blaß, als er ihr entgegenkam. »Wie leidenschaftlich muß er mich lieben,« dachte sie und sie nahm sich ernstlich vor, diese schönen Gefühle zu erwidern. Nachdem sie in eine etwas stillere Straße gelangt waren, fragte er fieberhaft:
»Hast du's gelesen?«
»Ja.«
Seine Augen schienen sie verschlingen zu wollen, und sie fühlte, wie wundervoll das war, diesen Augenblick auszudehnen und ihn noch eine Zeitlang in Unkenntnis über ihre Meinung zu lassen. Dann tat er ihr leid, weil er so zitterte, aber sie sagte doch nichts und freute sich heimlich.
»Nun,« drängte er, »haben dir die Gedichte irgendeinen Eindruck gemacht?«
»Ja,« erwiderte Mely langsam, »sie sind wundervoll!«
Und nun weidete sie sich daran, zu sehen, wie diese Worte plötzlich sein starr gespanntes Gesicht lebendig machten, wie seine Augen wieder einen ganz unbefangenen, jungen Ausdruck annahmen und unter einem glücklichen Lächeln seine blanken Zähne sichtbar wurden.
Sie kamen an dem Stadtpark vorbei, einem um die Zeit wenig besuchten Garten, der nur den Abonnenten und ihren Familien geöffnet war. Erwin und Mely waren gewohnt, dort aus- und einzugehen. In der Ferne erklang die Nachmittagsmusik zwischen den rauschenden Wipfeln.
»Komm ein bißchen mit an den Schwanenteich,« sagte er.
Sie war einverstanden. Schweigend gingen sie die sauberen Kieswege. Eine Viertelstunde schlenderten sie an dem Teich umher, starrten die Schwäne an und sprachen kaum. Beide waren etwas gedrückt, sie fühlten, daß irgend etwas gesagt werden müsse. Aber was? Hinter dem Teich befand sich eine künstliche Felsgrotte mit Bänken.
»Setzen wir uns vielleicht dort in die Grotte?« fragte Erwin, fast ganz sicher.
Sie setzten sich in den dämmerigen Raum. Vor dem Eingang spielte die Nachmittagssonne im Gras, man hörte hie und da einen Ruderschlag vom See. Erwin sprach zunächst noch immer nicht. Da durchzuckte Mely ein Gedanke, und sofort sprach sie ihn aus:
»Ich bin sicher, hier hast du schon einmal mit einem anderen Mädchen gesessen, weil du den Ort so genau kennst.«
»Niemals, ich schwöre dir,« erwiderte Erwin und sank vor ihr auf die Knie. »Aber ich habe hier oft allein gesessen und davon geträumt, die künftige Geliebte einmal hierherzuführen, und nun ist dieser Augenblick gekommen.«
Mely kam es vor, als ob sie den plötzlich vor ihr Knienden wirklich sehr gern hätte.
»Erwiderst du eigentlich meine Gefühle?« fragte er plötzlich.
Sie fand keine Worte und blickte auf den erdigen Boden der Grotte, wo ein dünner schwarzer Käfer kroch. Erwin wußte erst nicht, was er nun tun sollte, aber dann erinnerte er sich, gehört und gelesen zu haben, daß das immer so geht: auf solche Fragen gibt ein Mädchen keine Antwort, und er fühlte: das ist der Augenblick, jetzt oder nie. Er gab sich innerlich einen Ruck, um seine Schüchternheit zu besiegen, und wollte Mely auf den Mund küssen.
»Nein, nicht,« sagte sie und wehrte sich.
»Aber Mely,« flüsterte er, »wenn wir uns doch lieben.«
Da hatte er nun eigentlich recht, wenn sie sich liebten, mußten sie sich auch küssen. Das gehörte dazu. So stand es ja auch in allen Gedichten. Nach einiger Zeit des Schweigens versuchte er wieder einen Kuß, und sie wehrte sich nur noch zum Schein.
»Wir lieben uns doch,« sagte er wieder.
Ja, sie liebten sich doch. Was war das anderes als Liebe, dachte sie, und schließlich ließ sie sich küssen; aber sie hörten Tritte und mußten sich bald entfernen.
Von jetzt ab gingen sie täglich in die Grotte und blickten durch die Gräser, die davorstanden, auf den in der Nachmittagssonne glitzernden See mit den grünen, hügeligen Ufern darum. Sie fand das Küssen ganz schön, aber wenn sie abends im Bett lag, dann war ihr doch oft, als sei das nicht richtig, auch mußte sie immer wieder lächeln, wenn sie daran dachte, wie verliebt Erwin in sie war. Es gefiel ihr, und sie machte es mit, aber manchmal warf sie sich vor, daß es sich eigentlich nicht gehörte. Anfangs mochte sie sich nicht gestehen, daß sie ihn gar nicht liebte, sie wollte das Traumbild wach erhalten, eine wahre Liebe zu fühlen, aber dann brach die Wahrheit zu deutlich hervor. Sie konnte nicht anders, sie mußte Erwin manchmal ein bißchen necken und ärgern. Es kam ihr vor, als ob er sie für sich ganz in Beschlag legen, gewissermaßen als zu ihm gehörig betrachten wolle, und dagegen wehrte sich etwas in ihr. Er rechnete ganz sicher damit, daß sie ihn ebensosehr liebe, wie er sie. Das reizte sie zum Widerspruch. Sie eilte sich nun bald nicht mehr so sehr, ihn zu treffen, schwatzte oft noch eine Zeitlang mit den Freundinnen. Anfangs machte er ihr keine Vorwürfe, sondern sah sie nur mit schmerzlichen Augen an. Ihre Ankunft freute ihn so, daß er allen Aerger über das lange Warten im Augenblick vergaß, wenn sie schließlich kam. Nun reizte es sie, einmal zu erproben, wie lange er wohl warten würde. Einmal kam sie eine halbe Stunde zu spät, und nun machte er ihr Vorwürfe. Jetzt gefiel es ihr, ihm zu widersprechen. Sie müsse doch aufpassen, daß man sie nicht sähe, überhaupt, es würde schon über sie geschwatzt; ihre Unterlippe schob sich vor und in ihrem Gesicht lag eine Mischung spielerischer Schnippigkeit und ernster Entschlossenheit. An manchen Tagen hatte sie aber auch gar keine Luft, sich küssen zu lassen, dennoch freute es sie, wenn er sie darum anflehte. Manchmal fand sie nun auch Gedichte von ihm schlecht. Das sei doch immer wieder dieselbe Leier, behauptet sie sogar eines Tages. Dann versuchte er ein verzweifeltes Hohnlachen, dem sie sich aber überlegen fühlte. Kurz, sie gewöhnte sich an ihn und seine Ergebenheit und schließlich bekannte sie sich offen, daß das alles nur eine Spielerei war, nicht die wahre Liebe. Ueberhaupt ein Gymnasiast! dachte sie.
4
In einem nahen Badeort lebte Madame Amélie Sanders, die Witwe des Großkaufmanns Hermann Sanders und Großmutter von Mely und Hermann. Die Männer der Sanders, die zu den ältesten Kaufmannsfamilien der Stadt gehörten, pflegten durch ihren Beruf weit herumzukommen, hatten aber dann, nach Hause zurückgekehrt, die Lebensgefährtin stets aus dem engen Kreise der angesehenen städtischen Familien gewählt. Eine Ausnahme machte in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Hermann Sanders. Während er in Paris in einem befreundeten Geschäftshause tätig war, lernte er eine junge Elsässerin, Amélie Lemaire, kennen, die ihm in der schlanken Ueppigkeit einer »fausse maigre« und mit den lebhaften braunen Augen unter dem dunklen Haar als das vollendete Bild einer Französin erschien. Gleichzeitig war sie ihm lange nicht so fremd wie die anderen Pariser Damen, die er kennenlernte, denn als Elsässerin war sie des Deutschen völlig mächtig. Die junge Dame weilte in Paris bei Verwandten auf Besuch. Nachdem sie zu ihren Eltern nach Straßburg zurückgekehrt war, erreichte es der zähe, junge Mann, der alles das durchsetzte, was er sich einmal in seinen etwas viereckigen Kopf gesetzt hatte, daß er in einem dortigen Filialhause seines Pariser Chefs eine Anstellung erhielt. Amélie freute sich, in dem jungen Mann, der ihr in Paris wohl etwas schwerfällig vorgekommen sein mochte, nun einen Menschen zu finden, mit dem sie über gemeinsame glänzende Erinnerungen reden und über die Enge des Provinziallebens seufzen konnte. Wenn er sie aber von seiner Liebe unterhielt und gar von Heiraten sprach, dann schob sie ihre schnippisch-kokette französische Unterlippe etwas vor und blickte ihn aus ihren leidenschaftlichen Augen rätselhaft an, als wollte sie fragen: Hast du wirklich den Mut, mein lieber Junge, mit deinen etwas plumpen Händen so einen Tausendsasa wie mich festzuhalten? Aber Hermann Sanders hatte keine Angst, und als er das Geschäft seines Vaters in der mitteldeutschen Stadt übernahm, wurde Amélie Lemaire seine Frau. Sie verstand es, dem gemeinsamen Eheleben einen leichten, etwas französischen Ton zu geben, die Behaglichkeit des abendlichen pot au feu und der Plauderstunden am Kamin in der mitteldeutschen Stadt einzuführen, und der biedere Hermann war stolz auf das reizende, verfeinerte Heim, das er besaß. Das alles geschah von Frau Amelies Seite ohne jede Spitze gegen deutsche Art, die sich ohnehin in der etwas weltbürgerlichen Handelsstadt ziemlich abgeschliffen hatte. Auch der deutsch-französische Krieg änderte nichts an diesem Zustand. Der Ehe entsprang ein Sohn namens Clemens. Erst nachdem dieser, der Sanitätsrat Clemens Sanders, unerwartet dahingerafft worden war, begannen sich in der alten, schon vorher Witwe gewordenen Mme. Amélie Sanders ihre französischen Gewohnheiten und Anschauungen mehr zuzuspitzen. Sie stieß zwar niemals auf Widerspruch. Die überlebende Gattin ihres Sohnes, Frau Friederike Sanders, war viel zu schwach und zu bescheiden, um dazu fähig zu sein, auch war es ihr selbstverständlich, daß sie der hinterbliebenen Mutter ihres tief betrauerten Gatten Verehrung und Anhänglichkeit zollte, die sie auch ihren Kindern einzuflößen ehrlich bemüht war. Aber die alte Dame fühlte sich von der Familie ihres Sohnes wenig verstanden, und so zog sie sich ganz in eine Villa zurück, die sie, anfangs nur für die Sommermonate berechnet, in einem nahen Landstädtchen besaß. Dort lebten auch noch Abkömmlinge französischer Refugiéfamilien, in deren Verkehr sie sich ihrer Muttersprache bedienen konnte. Die Villa glich einem kleinen englischen Landsitz und lag, mit einem sechseckigen Turm geschmückt, an einem Bergabhange. Eine gotische Zinnenbekrönung und gotisch zugespitzte Fenster gaben dem Bau etwas ritterlich Mittelalterliches, und die alte Dame lebte in den etwas düsteren, gewölbten Räumen, von einem alten Diener namens Lorrain bedient, wie eine Schloßfrau aus alter Zeit. Ihre Unzufriedenheit mit dem heutigen Zeitalter, die über ihren etwas scharfen Zügen lag, dazu aber eine gewisse Großartigkeit ihrer Gebärden und die Leidenschaftlichkeit der immer noch schönen Augen verstärkten den Eindruck, daß Mme. Sanders, wie man sie allgemein nannte, eine nicht ungewöhnliche Persönlichkeit war. Jährlich fuhr sie einmal über Straßburg nach Paris, besuchte dort Verwandte und machte Einkaufe, denn »in Deutschland bekommt man nichts«. In den Sommerferien wohnte Frau Friederike Sanders mit den Kindern bei der Großmutter, sonst kam diese wöchentlich einmal in die Stadt herüber. So lebte jeder auf seine Art, in leichter Entfremdung gegen den andern, aber ohne ernstliche Gegnerschaft.
Die Besuche der Großmama bedeuteten für die Kinder stets eine anregende Unterbrechung des täglichen Einerleis, obgleich sie manchmal auch recht störend empfunden wurden. Die Großmutter war nämlich viel strenger als die Mutter, und es war sehr schwer, ihr etwas vorzumachen. So kümmerte sie sich z. B. immer eingehend um Melys Fortschritte, besonders im Klavierspiel. Sie wünschte nicht, daß durch ihren Besuch Melys Ueben gestört würde, und sie hörte sie gern aus der Ferne ihre sauberen Tonleitern spielen. Da hatte sich nun einmal ein sehr betrübender Zwischenfall ereignet. Nach dem Tee war Mely in den alten, mit hellen Biedermeiermöbeln eingerichteten Salon gegangen, und man hörte sie auch mit ungewohnter Ausdauer kleine, sehr primitive Fingerübungen machen. Als das gar nicht aufhören wollte und die Großmutter vom Eßzimmer aus vergeblich auf Tonleitern und Etüden gewartet hatte, ging die alte Dame nach dem Salon hinüber, und zu ihrem nicht geringen Staunen saß nicht Mely am Klavier, sondern die alte Lene, die mit ihren knotigen Fingern fortgesetzt c d, c d, d e, d e, d e, e f, e f usw. spielte. Der Adlerblick der Mme. Sanders schien das alte Wesen niederzuschmettern. Mely hatte vorgezogen in den Garten zu gehen, und die gute Alte, die sich von ihr um den Finger wickeln ließ, veranlaßt, an ihrer Stelle die von der Großmutter erwarteten musikalischen Geräusche auf dem Klavier hervorzubringen.
Ihrem Enkel Hermann blieb Mme. Sanders innerlich besonders fremd, zumal es ihm lästig war, daß er mit ihr französisch sprechen sollte. Manchmal kam ihr vor, daß der trotzige Hermann seinem verstorbenen Großvater, ihrem Gatten, in vieler Hinsicht glich, doch war er lange nicht so einfach und übersichtlich, und darum nicht so ohne weiteres zu behandeln und zu beherrschen wie einst jener gutmütige, schwerfällige, wenn auch zähe Mann. Die alte Dame verhehlte sich nicht, daß die Mischung mit ihrem Blute die biederen Sanders bedeutend widerspruchsvoller gemacht hatte, als sie in früheren Geschlechtern waren.
Mely schmiegte sich gern an die Großmutter, weil ihre schwarzen Seidenkleider so angenehm knisterten und dufteten. Die alten Wangen der Großmutter waren kühl und rochen nach Puder. Sie trug eine weiße Perücke, deren kleine Löckchen in gerader Linie die obere Hälfte der Stirn bedeckten. Die Augenbrauen der Großmutter über den höchst lebhaften, manchmal etwas stechenden Augen waren schwarz und buschig geblieben (ob sie sie wohl färbte?) und sie konnte sie so hoch ziehen, daß sie auf der Stirn einen Winkel bildeten. Davor hatte sich Amelie als Kind geradezu gefürchtet. Das kräftige alte Gesicht war dennoch des liebenswürdigsten Ausdrucks fähig, und auf den dünnen Lippen wechselten die Züge einer gewissen selbstsicheren Härte und menschenfreundlichen Nachsicht gegenüber den Schwächen der anderen. Mely fühlte sich geschmeichelt, von der Großmutter als fast Erwachsene behandelt zu werden. Ihre Vorschriften über die Art, wie sich eine junge Dame zu benehmen habe, hörte sie mit derselben platonischen Bewunderung an, wie die Ermahnungen des Probstes Nothaft, aber ebensowenig kam ihr hier der Gedanke, daß man diese Vorschriften wirklich befolgen könnte.
Meist kündigte die Großmutter ihren Besuch vorher an, aber eines Tages geschah es, daß sie unerwartet um sechs Uhr nachmittags erschien. Nur Hermann war zu Hause, er befand sich bei den Schularbeiten. Mme. Sanders ließ sich von Lene Tee machen und rief Hermann ins Eßzimmer. Daß ihre Schwiegertochter um diese Zeit ausgegangen war, wunderte sie nicht, aber wo konnte nur Mely stecken? Die Lene wußte es nicht. Hermann sagte ahnungslos:
»Sie wird mit dem Dorn irgendwo herumstrolchen.«
»Qu'est-ce que ça veut dire herumstrolchen?« rief die Großmutter lebhaft und ihre schwarzen Brauen hoben sich.
»Sie gehen doch jeden Tag zusammen.«
»Qui est ce Dorn?«
Hermann wollte das Gesagte abschwächen:
»Oh, ein netter Kerl, dagegen ist nichts zu sagen. Ein bißchen komische Ideen hat er manchmal, aber sonst ...«
Die Großmutter ließ ihn nicht ausreden.
»Also sie gehen jeden Tag zusammen?«
»Ach nein, ich glaube nicht jeden Tag, es ist mir so herausgefahren. Sie wird wohl schwimmen gegangen sein. Es ist ja möglich, daß er sie bis zur Schwimmanstalt begleitet hat; was wäre denn auch dabei?«
Hermann fühlte, daß er sich verrannt hatte, und das gerade machte ihn herausfordernd gegen die Großmutter und ihre Grundsätze.
Es klingelte. Mely kam nach Hause, es war fast halb sieben. Sie hatte also beinahe anderthalb Stunden zu ihrem Schulweg gebraucht. Als sie hörte, die Großmutter sei da, stürmte sie herein und umarmte und küßte sie.
»Sag mal, mein Kind, wo bist du denn solange gewesen?« fragte diese ruhig.
»Ach, im Stadtpark.«
»Mit wem warst du denn dort?«
Hermann wollte der Schwester heraushelfen und sagte:
»Habt ihr die Schwäne gefüttert? Das ist nämlich sehr hübsch, Großmama; Karpfen sind auch da, die Mely geht oft hin mit der Gertud Henschel und anderen aus ihrer Klasse.«
»On ne te dernande pas,« verwies ihn die Großmutter streng, »Mely soll mir selbst sagen, mit wem sie dort war.«
Mely wurde glühendrot.
»Nun, ich weiß es,« erwiderte die Großmutter, »avec ce Dorn bist du dort gewesen. Schämst du dich denn nicht? C'est scandaleux.«
»Ich habe ihn unterwegs getroffen,« stammelte Mely, »was kann ich dazu, wenn er mitkommt. Manche Buben sind schrecklich frech.«
»Du hast aber diesen Buben schon öfter getroffen, nicht?«
Jetzt wurde Lene hereingerufen. Die Großmutter fragte mit fast stechendem Blick:
»Sagen Sie, Lene, um wieviel Uhr kommt denn das kleine Fräulein hier gewöhnlich aus der Schule?«
»Ach, das weiß ich wirklich nicht, Madame, ich seh' nicht immer auf die Uhr. Ich könnt's ja auch gar nicht sehen, ich hab' meine Brille seit ein paar Tagen verlegt.«
»Oft wird es wohl sechs oder halb sieben, wie heute, nicht?«
»Ich kann's wirklich nicht sagen, Madame, ich muß, um auf die Uhr zu sehen, immer erst meine Brille aufsetzen, und die ist zerbrochen.«
»Also zerbrochen und verlegt,« erwiderte Mme. Sanders, »das ist viel Unglück auf einmal.«
Sie schickte Hermann und Lene hinaus, nahm Mely an der Hand und zog sie zu sich aufs Sofa.
»Ich muß einmal ein ernstes Wort mit dir sprechen, Mely. Du bist bis jetzt noch ein Kind gewesen, und deshalb kann man dir so etwas verzeihen, aber es muß jetzt aufhören, wo du eine junge Dame zu werden beginnst.«
Melys Angst schwand bei diesen ruhigen Worten; sie begann sogar das Gespräch riesig interessant zu finden.
»Mon enfant,« fuhr die Großmutter fort, plötzlich in einen gütigen Ton verfallend und Melys Händchen streichelnd, »jedes Mädchen will, wenn es erwachsen ist, einmal heiraten. Was soll sonst aus ihr werden, wenn ihre Eltern tot sind? Dann braucht sie einen Mann und Kinder, damit sie weiß, wo sie hingehört. Verstehst du das?«
»Ja, Großmama.«
Sie schmiegte sich dicht an das knisternde Seidenkleid der Großmutter und lauschte aufmerksam, wie sie als Kind einem Märchen zugehört hatte.
»Und nun ist es so, daß ein junges Mädchen sich sehr zurückhalten muß im Verkehr mit Buben und später mit Herren, denn eine, die mit vielen lacht und schwatzt und sich begleiten läßt, die will keiner mehr.«
»Warum, Großmama?«
»Ah, c'est difficile à expliquer, vielleicht denkt er: wenn sie meine Frau ist, wird sie es so weiter treiben, anstatt sich um das Haus und um die Kinder zu bekümmern.«
»Das seh' ich aber gar nicht ein, Großmama, später, wenn man verheiratet ist, ist das doch etwas ganz anderes.«
»Also glaube mir, Kind, ich kann dir das jetzt nicht alles erklären, du bist noch zu jung. Jedenfalls darf ein Mädchen mit keinem jungen Mann allein spazierengehen. Bei uns in Frankreich kommen die Mädchen gar nicht in Versuchung, denn man läßt sie überhaupt nicht ohne Begleitung hinaus. In Deutschland ist das anders, und deshalb muß hier eine junge Dame allein wissen, was sie zu tun hat.«
»Weißt du, die armen französischen Mädchen können mir aber leid tun.«
»Nun, jedes Ding hat seine zwei Seiten. Wenn eine junge Dame den nötigen Charakter hat, kann man ihr ja ein bißchen mehr Freiheit lassen, aber du bist noch zu jung und zu unerfahren. Es hat keinen Zweck, länger darüber zu sprechen. Jedenfalls mußt du mir versprechen, daß du nicht mehr avec ce Dorn ...«
»Aber wenn er immer von selber kommt?«