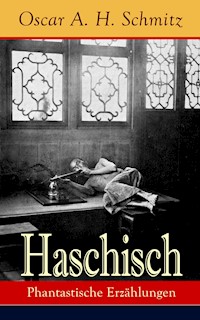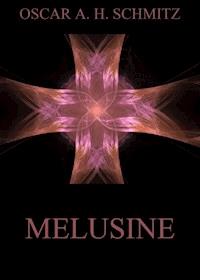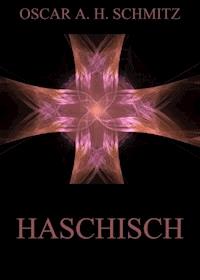Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Philosophie unserer Zeit hat aufgehört Weltweisheit zu sein und ist dadurch für weltliche Menschen unfruchtbar, ja bedeutungslos geworden. Die Weltweisheit hat aufgehört philosophisch zu sein und ist dadurch zur flachen Fertigkeit gewöhnlicher Streber hinabgesunken. In diesem Buch soll das leichte Thema der gesellschaftlichen Sitte mit der Philosophie der Form in Verbindung gebracht, bei der Erörterung des Sittengesetzes niemals die Buntheit der Welt und das Fließende der menschlichen Natur aus dem Auge gelassen werden. Ein Buch voller Essays über Gesellschaft, Mode, Frauen, Reisen, Lebenskunst, Kunst, Philosophie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brevier für Weltleute
Oscar A. H. Schmitz
Inhalt:
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Brevier für Weltleute
Vorworte
Gesellschaft
Der Wert der Konventionen
Natürlichkeit
Geschmack
Das Schamgefühl
Der Künstler in der Gesellschaft
Weltverbesserer
Was ist ein Barbar?
»Rückkehr zur Natur«
Mode
Zur Psychologie der Mode
Eleganz
Nacktheit und Kleidung
Herren- und Frauenkleidung
Die Magie des Anzuges
Frauen
Was den Frauen gefällt
Das weibliche Genie
Die männliche Dummheit
Charakterologie der dummen Gans
Ritterlichkeit
Die junge und die alte Dame
Der Zwiespalt der geschiedenen Frau
Zur Psychologie der Curtisane
Die Frauen und das Geld
Der Stolz der Frau
Was den Frauen erlaubt ist
Der Umgang mit Frauen
»Der enigmatische Mann«
Einfälle und Gespräche
Dialoge
Reisen
Der Baedeker oder die Technik des Reisens
Deutsche auf Reisen
Das Trinkgeld
Lebenskunst
Lebenskunst
Der Wille und das Glück
Der Rhythmus des Alltaglebens
Zur Technik des Lernens
Fingerzeige
Kunst
Theaterblut
Das heitere Theater
Die Wirkung der Kritik
Was kann man an einem Kunstwerk erklären?
Die Verstandesmenschen und die Kunst
Gespräch zweier Weltleute über Kunst
Die Überschätzung der Musik
Genie und Genialität
Die graue Gefahr
Philosophie
Die Macht der Unlogik
Aphorismen und Glossen
Der Aphorismus
Zur Philosophie der Form
Brevier für Weltleute, Ockar A. H. Schmitz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635466
www.jazzybee-verlag.de
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Deutscher Bohéme-Schriftsteller, auch bekannt als Oscar A. H. Schmitz, geboren am 16. April 1873 in Bad Homburg vor der Höhe, Hessen, verstorben am 17. Dezember 1931 in Frankfurt am Main. Schulische Ausbildung am Städtischen Gymnasium in Frankfurt, das Abitur legte er allerdings am Philippinum in Weilburg ab. Studierte anschließend u.a. Jura, Philosophie und Kunstgeschichte in Heidelberg, Leipzig, München und Berlin. Ab 1894 lebte er in München. Brach 1895 sein Studium ab und widmete sich, dank guter finanzieller Ausstattung durch den Tod seines Vaters, dem Reisen und Schreiben. In München geht er auf im Leben der Bohème in Schwabing und interessiert sich immer mehr für esoterische Themen, aber auch Satanismus und Sadismus. Auch kommt er in Kontakt mit Drogen. Immer wieder zieht es ihn auch auf Reisen durch ganz Europa, Teile von Afrika und Russland. Die letzten Jahre seines Lebens interessiert er sich auch zunehmend für Psychologie und Psychoanalyse. Er stirbt an einer Leberkrankheit.
Wichtige Werke:
Orpheus,1899Haschisch, 1902Der weiße Elefant, 1902Halbmaske, 1903Der Herr des Lebens, 1905Don Juanito, 1908Brevier für Weltleute, 1911Wenn wir Frauen erwachen, 1912Der hysterische Mann, 1914Die Kunst der Politik, 1914Das wirkliche Deutschland: Die Wiedergeburt durch den Krieg, 1915Ein deutscher Don Juan, 1917Menschheitsdämmerung, 1918Das rätselhafte Deutschland, 1920Brevier für Weltleute
Essays über Gesellschaft, Mode, Frauen, Reisen Lebenskunst, Kunst, Philosophie
Vorworte
Vorwort zur zehnten Auflage
Nicht ohne Bangen habe ich mich mitten im Krieg daran gemacht, dieses Buch vor der Ausgabe der zu meiner Überraschung gerade jetzt notwendig gewordenen zehnten Auflage noch einmal durchzusehen. Würde ich in dieser Zeit alles aufrechterhalten können, was ich in jenen heute versunkenen, ja gerichteten Jahren vor dem Weltkrieg über Gesellschaft und Lebenskunst gesagt habe? Aus dem Wirrwarr der unzufriedenen Meinungen suchte ich damals ein grünes Eiland heiterer Weltlichkeit zu retten. Zwar will ich bekennen, daß ich mich selbst schon in der letzten Zeit vor dem Krieg nicht mehr zu den Weltleuten rechnete, an die sich die folgenden Ausführungen wenden. Mir ist das Buch so fremd geworden, wie der Baedeker eines vielbereisten Landes, das ich nun nicht mehr besuchen werde. Für die neue Generation von Reisenden aber bleibt er der Baedeker. Ich glaube nicht, daß sich das neue Geschlecht im Hochmut der Unerfahrenheit von Welt und Gesellschaft abwenden wird, ehe es sie kennen gelernt hat. Wem aber die Gesellschaft noch erstrebens- oder erkennenswerte Wirklichkeit ist, für den behält das hier Gesagte seine Gültigkeit.
Einiges wenige habe ich freilich doch gestrichen, und zwar solche Sätze, die in der Relativität aller Lebenswerte eine absolute Weltanschauung sehen wollten. Diese Auffassung, zu der ich hie und da neigte, ohne sie jemals wirklich ganz zu teilen, habe ich als falsch erkannt. Vielmehr gibt es absolute seelische und geistige Werte. Alles aber, was außerhalb ihrer liegt, behält, da wir es nun einmal nicht missen können, nur relativen Wert. Wer überhaupt einwilligt mit der »Gesellschaft« zu leben, der erkenne ihre Gesetze und Spielregeln und übe Lebenskunst. So kann ich den relativen Wert des in diesem Brevier Gepriesenen neben absoluten Werten auch heute noch gelten lassen, ohne länger selbst auf dem Standpunkt dieses Buches zu stehen, noch es widerrufen zu müssen. Freilich habe ich darin manches scharf betont, woran ich heute gleichgültig vorübergehe.
So ist denn das Bangen verschwunden, mit dem ich an die Durchsicht des Buches gegangen bin. Es ist und bleibt, was es war: Ein Brevier für Weltleute.
Berlin, April 1916.
Vorwort zur ersten Auflage (1910)
Die Philosophie unserer Zeit hat aufgehört Weltweisheit zu sein und ist dadurch für weltliche Menschen unfruchtbar, ja bedeutungslos geworden. Die Weltweisheit hat aufgehört philosophisch zu sein und ist dadurch zur flachen Fertigkeit gewöhnlicher Streber hinabgesunken. In diesem Buch soll das leichte Thema der gesellschaftlichen Sitte mit der Philosophie der Form in Verbindung gebracht, bei der Erörterung des Sittengesetzes niemals die Buntheit der Welt und das Fließende der menschlichen Natur aus dem Auge gelassen werden.
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis wird den Titel des Bandes rechtfertigen, ein Blick auf die eine oder die andere Seite mag vielleicht auf eine Stelle fallen, wo die Weltlichkeit von der Theorie erstickt zu werden droht, aber diese Gefahr ist nur scheinbar. Eine unglückliche Denkrichtung unserer Zeit hat alle Gebiete des weltlichen Lebens – Kunst, Bühne, Gesellschaft, Sitten, die Fragen der Frau – in ein Netz von Abstraktionen verwebt. Um seine Knoten zu entwirren, bedarf es manchmal derselben Werkzeuge, die sie geknüpft haben. Nur mit dem Rüstzeug der Logik bewaffnet kann man Irrtümern der Unlogik erfolgreich entgegentreten. Wenn der Leser an einigen Stellen dieses Buches auf Dialektik oder Analyse zu stoßen meint, so vertraue er dem Versprechen des Verfassers, der ihn nicht in die Wüsten der Abstraktion verlocken, sondern vielmehr aus den ästhetisch und ethisch zerschwatzten Fragen der Zeit in eine heitere Weltlichkeit zurückführen will. Unsere Epoche hat die Insel der Weltlichkeit verlassen. Viele sind des Hinausschwimmens müde und halten sich nun, verzweifelt die Fluten tretend, mühsam über Wasser. Mancher Blick sehnt sich nach dem verlassenen Grün der Weltlichkeit zurück. Die logischen Bemühungen dieses Buches sind nichts anderes, als die paar Schwimmbewegungen, die das verlassene Eiland wieder erreichen wollen.
Gesellschaft
Der Wert der Konventionen
Kultur ist ein Komplex von Werten, die nicht erworben, nicht erlernt, allenfalls entwickelt werden können. Sitte, Gebärden, Geschmack, Takt, Sensibilität, Welterfahrung usw. gehören dazu.
Zivilisation ist ein Komplex von Werten, die man sich aneignen, erlernen, kaufen, nachmachen kann; zu ihr gehören alle materiellen Vervollkommnungen des Lebens, – Hygiene, Wissen, Gesetze u. a.
Die Konventionen sind gleichzeitig Erzeugnisse der Kultur und der Zivilisation. Soweit sie ein äußeres Tun und Lassen regeln wie Grüßen, Besuche machen, Tageseinteilung, Kleidervorschriften, überhaupt soweit sie auf irgendwelchen Erwägungen und auf Ökonomie beruhen, gehören sie der Zivilisation an. In seinen Gruß Distanz oder Grazie legen, sich mit dem Modezwang anmutig auseinandersetzen, das erfordert Kultur.
Die Konventionen sind gewissermaßen die Spielregeln der Kultur. Wer bei ihrer Erfüllung dies nicht vergißt, wird niemals unter ihnen leiden. Nichts ist unkultivierter, als sie zu ernst zu nehmen, sei es als ihr gefügiger oder empörter Sklave, sei es als ihr feindseliger Freigelassener. Es gibt freilich Gesellschaftsklassen, für welche die Konvention ein Fetisch ist, dem alles geopfert wird, Geschmack, Behagen, Gefühle, ja das Glück. »Was werden die Leute zu meinem Leben sagen?« Die Leute! Ein Götze, ein Ungeheuer, das im Dunkeln wirkt, und sich höchstens von Zeit zu Zeit durch seinen unwillkommenen Geruch bemerkbar macht; will man es fassen, so entgleitet es, denn niemand will zu den »Leuten« gehören. Man selbst denkt ja ganz vernünftig, aber die Leute! Die jüngere Generation sucht sich nun diese Mittelstandsfurcht abzugewöhnen. Die moderne Literatur des gebildeten Bürgertums kämpft an gegen den Zwang solcher Konventionen, die sie als lügnerische Nachahmungen aristokratischer, in der Hoflust, meist in französischer gewachsener Formen empfindet.
Diese Formen werden von vielen nicht mehr als eine Erleichterung, sondern als eine Hemmung des auf Vernunft zu gründenden Lebens empfunden. Darin liegt ein zweifellos gesunder Kern. Was sollen die Urteile und Sitten einer »société polie« für den, der ihre Wohltat nicht genießt? Für ihn werden sie Vorurteile und Unsitten. Warum soll sich jemand einen ihm unbequemen Ehrenkodex aneignen, wenn er von den Vertretern dieses Kodex doch nicht für ganz voll genommen wird? Warum soll in engen Verhältnissen die strenge Bindung des Liebeslebens gelten, die nur vom Standpunkt starker Familieninteressen aus berechtigt ist? Warum muß ein besitzloses Mädchen verkümmern, um nicht gegen die Familienüberlieferungen zu verstoßen, von denen sie ganz und gar nichts hat, während das voraussetzungslose Geschöpf aus dem Volke wie ein Singvögelchen den Frühling seiner Jugend genießt? Warum soll man den Luxus eines Salons bezahlen, wenn man nicht empfängt, warum auf Reisen, Schauspiele und dergleichen verzichten, weil die allein standesgemäßen Gasthöfe, die höheren Klassen der Eisenbahnen, die vornehmen Theaterplätze teuer sind? Nichts ist echter und aufrichtiger als das Abschütteln solcher Konventionen durch einen Stand, für den sie nicht gemacht sind. Nur glaube man nicht, daß damit irgendein objektives Urteil über den Wert der Konventionen an sich gewonnen ist; denn alle diese abgeschüttelten Konventionen sind dadurch nicht als schlecht, sondern nur für bestimmte Menschen als unfruchtbar erkannt. Die, denen zur Erleichterung oder zur Stilisierung des Lebens Konventionen wertvoll sind, werden ganz von selbst jenes alte aristokratische Erbe antreten und es ihren heutigen Bedürfnissen entsprechend verwalten und wohl auch umformen. Nur der aber wird sich vernünftigerweise einem solchen Gruppenzwang unterwerfen, dem die Gruppe dafür alle Vorteile der Zugehörigkeit gewährt, denn für ihn ist dies kein Zwang, sondern ein natürlicher sozialer Trieb. Leider gehen die Bekämpfer der Konventionen so weit, das für sie nicht Passende als überhaupt schlecht abschaffen, entwurzeln zu wollen und begehen damit den Fehler, in den jeder geistige oder praktische Radikalismus verfällt. So recht sie für ihre kleinen Privatverhältnisse haben, so unrecht tun sie, wenn sie den einen Heuchler nennen, der sein Privatleben fremden Blicken nur in einer verallgemeinernden Stilisierung darbieten will, wie er es, ohne sich vor Hinz und Kunz rechtfertigen zu müssen, jeden Augenblick vertreten kann. Diesem Zweck dienen die Konventionen. Es gibt viele Handlungen, die man vor sich und dem, den sie wirklich angehen, zu verantworten vermag, die aber so persönlicher, zarter Natur sind, daß man sie dem Urteil der Leute nicht aussetzen darf. Es gibt Dinge, die, durch das vergröbernde Prisma der Öffentlichkeit gebrochen, ihren Charakter gänzlich verändern. Darum ist es eine große Erleichterung, daß die Konventionen davon entbinden, den Leuten unsere Liebe zu Fräulein X. oder den Grad dieser Liebe anzuzeigen, indem sie uns die Pflicht auferlegen, einfach die eindeutige Tatsache einer Verlobung oder Vermählung den Bekannten mitzuteilen. Dadurch wird der persönliche Charakter unseres Schrittes vor neugierigen Augen verhüllt. Wir und Fräulein X. werden schon Bescheid wissen, die Welt aber erfährt nur, was sie angeht, nämlich, daß wir von jetzt ab zu zweit erscheinen werden. Wer allzu harmlos seine Handlungen und die ihnen zugrunde liegenden Empfindungen der Kritik seiner Umgebung aussetzt, wird sich regelmäßig über die Gemeinheit und Dummheit der Welt zu beklagen haben. Die Schuld liegt aber allein an ihm; er kann nicht verlangen, daß jedes Wesen auf ihn eingeht und ihn versteht. Die Menschen, die durch Mißverständnis und Entstellung einen bösartigen Klatsch brauen, brauchen noch nicht sehr bösartig zu sein. Etwas Schwatzhaftigkeit, Freude am Flunkern, an witzigen Übertreibungen, ironischen Wortspielen genügen häufig, ohne die Beihilfe von Neid und Ränken, um einen guten Ruf langsam zu untergraben. Um sich gegen die Entstellungen zu schützen, die nach einem Naturgesetz die Tatsachen erleiden, wenn ihr Bericht durch den Mund mehrerer gegangen ist, hat man zum Schutz die Konventionen erfunden, welche die persönlichen Angelegenheiten für die Allgemeinheit so stilisieren, wie man sie aufgefaßt zu sehen wünscht. Dadurch werden die Konventionen gerade nicht zum Hemmnis, sondern zum Schutz des persönlichen Lebens. Wenn jemand erzählt: ich liebe Fräulein X., so gibt er jedem das Recht, über seine Liebe zu urteilen, zu lächeln, zu spotten usw. Wenn er dagegen sagt, ich heirate Fräulein X., so mag man über die Vernunft eines solchen Schrittes reden soviel man will, die Zartheit der Empfindungen kann in keiner Weise berührt werden. Wie aber, wenn man Fräulein X. liebt und sie nicht heiratet? Dann hat man erst recht die Verpflichtung, die Konventionen aufs Äußerste zu beachten, um Fräulein X. vor allen Unannehmlichkeiten zu schützen, die diese gewagte Situation für sie hat. Die Liebe ist bekanntlich der Punkt, wo die göttliche und die tierische Natur des Menschen am engsten zusammenstoßen. Nichts ist entsetzlicher, als wenn über die Art dieses Zusammenstoßes die Öffentlichkeit sich ein Urteil erlaubt. Es ist einfach nicht möglich, die zartesten Liebesbeziehungen in einer rohen Umgebung aufrecht zu erhalten, die davon nur oberflächlich weiß, sie als Schmutz betrachtet, dies Tag für Tag äußert und dadurch eine Luft der Unreinheit und des Hasses um diese Beziehungen schafft. Nicht als ob eine solche Liebe dadurch unrein würde, aber sie verliert ihre Unbefangenheit, ihre Blumenhaftigkeit, ihren Schmelz. Sie sucht sich vor sich selbst anzuerkennen, zu rechtfertigen, was sie vorher nicht nötig hatte, sie wird zum Grundsatz, womöglich zur kriegerischen Forderung; so wird sie häßlich oder sie erstickt in Dornen.
Warum sind aber die Menschen so schlecht? fragen harmlose Gemüter, daß sie in dieser Vereinigung des Göttlichen und Tierischen, genannt Liebe, immer mit Vorliebe das Tierische sehen? Ach, das ist eine sehr einfache Geschichte: Die Liebe zweier Menschen wirkt nun einmal auf Unbeteiligte immer mehr oder weniger humoristisch oder fordert zum mindesten zu Scherzen heraus, deren Grenze je nach Temperament und Bildung sehr weit gezogen ist. Darum haben auch die besten Witze meist eine erotische Beziehung. Gewöhnlich kann man sie gar nicht einmal in Damengesellschaft erzählen. Ernstgemeinte Theaterstücke stürzen am leichtesten über den häufig unfreiwilligen Humor einer Liebesszene. Der ungeheuere Gegensatz, in dem die Liebe häufig zu dem ganzen übrigen Ich eines Menschen steht, zu seiner Haltung, seiner Stellung, seinem Alter, seinem Äußeren, seinen Grundsätzen, seinem Beruf, alles das war, seit die Welt besteht, eine Fundgrube menschlichen Witzes und Humors. Die heitere Literatur aller Völker beruht darauf. Das Allerkomischste ist vielleicht, daß die beiden von der Liebe selbst betroffenen Wesen ihren für jeden andern auf den ersten Blick erkenntlichen Ausnahmezustand nicht sehen. Dazu kommt, daß die Liebe meist mit derjenigen Leidenschaft verknüpft ist, die in unserem zivilisierten Leben vielleicht noch als die derbste, ursprünglichste gelten kann, mit der Eifersucht. Kein Besitz wird rücksichtsloser gehütet, beneidet und geraubt, als der eines geliebten Wesens. Selbst wenn wir ganz absehen wollen von dem Schamgefühl, das heute manche nur für eine Konvention halten, schon die zweifellos unschönen körperlichen Dinge, die mit der Liebe häufig zusammenhängen und nur für die Liebenden selbst unsichtbar werden, werden jederzeit, wie auch Sitte und Recht sich immer gestalten mögen, die Geheimhaltung der Liebesbeziehungen verlangen. Der Schutz durch Konventionen ist jedenfalls bereits eine sehr gesittete Milderung gegenüber dem durch Haremsmauern. Die Konventionen sind oft Lügen, gewiß; aber diese Lügen beeinträchtigen den Charakter weniger als die Entstellungen, welche die Tatsachen durch das Geschwätz der Umgebung erfahren. Daß man andere über seine Privatangelegenheiten, sei es durch Worte, sei es durch Gebärden, belügt, muß erlaubt sein. Es gibt nur eine Lüge, die unbedingt unsittlich ist, weil sie den Charakter verdirbt: die Lüge gegen sich selbst. Sonst hat niemand uns gegenüber ein bedingungsloses Recht auf Wahrheit. Die Wahrheit ist meistens so verwickelt, daß man sie unmöglich jedem Außenstehenden klar machen kann. Um sich vor mißverstehenden Anmerkungen zu schützen, muß man die Wahrheit häufig verhüllen. »Wenn ich etwas, was ich tue, für gut halte, dann kann ich es auch in der Öffentlichkeit vertreten.« So sagen viele Schwärmer der Aufrichtigkeit und vergessen das eine: Wären die Dinge so einfach, daß man sie in ihrem Wesen jederzeit der Öffentlichkeit klar machen könnte, wie sie wirklich sind, dann sollte man allerdings, was man vor sich selbst verantworten kann, auch vor der Öffentlichkeit verantworten. Aber welches noch so anständige Privatleben ist nicht leicht zu beschmutzen, wenn z. B. im Falle eines Rechtsstreits ein gegnerischer Anwalt ohne Tatsachenentstellung nur das Was und nicht das Wie darlegt? Was aber nützt es, die Wahrheit zu sagen, wenn sie so verwickelt ist, daß sie notgedrungen eine falsche Auffassung hervorrufen muß? Wieso ist sie dann besser als eine Lüge? Gerade die psychologische Erkenntnis unserer Zeit sollte das anerkennen. Wäre mit dem öffentlichen Zugeständnis einer ungesetzlichen Liebe z. B. tatsächlich etwas Wesentliches zugestanden, so könnte man es vielleicht sittlich begründen, daß man sich ihrer nicht schämen und nicht heucheln soll. Weil aber damit gar nichts über das Wie gesagt ist, sondern nur dem Spottbedürfnis, der Eifersucht, dem Neid oder der Bosheit Nahrung gegeben wird, wollen wir uns der Konventionen freuen, die uns, besonders aber den Frauen, verbieten, andere als eheliche Beziehungen der Geschlechter zuzugeben. Da wir nun schon einmal von Sittlichkeit sprechen: es gehört häufig eine sehr viel stärkere sittliche Kraft dazu, ein nicht alltägliches Privatleben hinter den Konventionen von Besudelung und Hemmung unberührt zu halten, als zu jener Allerweltstreuherzigkeit und dem Bedürfnis nach Geständnissen und Aussprache, die gerade schwächliche und oft auch innerlich verlogene Menschen so häufig haben. Ein selbstbewußter Charakter, der die Konventionen beherrscht, ist eine höhere Blüte der Menschlichkeit, als der unzufriedene Intellekt, der sie mit billigen Einwänden bekrittelt. Man darf freilich kein pedantischer Sittenrichter sein, um in einer gewissen gesellschaftlichen Heuchelei, die manches verschweigt, eine tiefere Achtung vor eigener und fremder Menschlichkeit zu erkennen, als in haltloser Offenheit. Wer die Formen beherrscht, wird sie nicht mehr als Hemmnisse, sondern als Stützen erkennen. Er wird lernen, sich mit Hilfe der Konventionen, ohne anzustoßen, abzusondern, wenn es ihm paßt, und ohne ihr Sklave zu werden, sich der Geselligkeit zu erfreuen, wenn sein Herz danach begehrt. Nur die Unfähigkeit, die Konventionen zu meistern, läßt viele Leute sich in der Gesellschaft unbehaglich fühlen, sie als eine Last empfinden. Sie verfallen darum einer Einsamkeit, die sie auch eigentlich nicht wollen und die sie deshalb verbittert. Würden sie sich zu kleinen befreienden Unwahrheiten verstehen, so könnten sie leicht den Strom freundlicher und feindlicher Besuche, die an ihre Tür klopfen, regeln. Jene anspruchsvolle Weltfernheit findet sich in zahllosen neuen Romanen verherrlicht.
In Deutschland findet man noch zu viele kleinliche Sklaven der Übereinkömmlichkeiten, und darum als notgedrungenes Gegengewicht wildgewordene Sanskulotten. Ganz anders als ihre grobe Beweisführung muten die Scharmützel an, welche die skeptischen französischen Moralisten des achtzehnten Jahrhunderts, z. B. Chamfort, den Vorurteilen des »monde« lieferten. Jedes Wort dieses die Gesellschaft höhnenden Schriftstellers setzt feinste gesellschaftliche Kultur als selbstverständlich voraus und wird seines ganzen Wertes beraubt, wenn es ein Barbar für seine Zwecke anführt. Dasselbe Urteil ist ein anderes im Mund eines Zugehörigen und eines Draußenstehenden. Diejenigen aber, welche die Konventionen angreifen, sind meistens solche, die ihren Wert zu erproben zu wenig Gelegenheit hatten.
Der Haupteinwand gegen die Konventionen wird im Namen der Überzeugung gemacht, die man angeblich immer auszusprechen habe. Dieser Irrtum ist der Grund, warum deutsche Geselligkeit so leicht in Zank ausartet. Aber ist es denn wirklich sittlich wertvoll, wenn jemand auf die Frage, ob er Geschwister habe, antwortet, in Preußen müsse das allgemeine Wahlrecht eingeführt werden, oder auf die Frage nach dem Wetter sich für einen Republikaner erklärt? Daraus ließen sich übrigens Beispiele für eine neue Ollendorfgrammatik zusammenstellen. »Gehen Sie diesen Sommer aufs Land?« »Nein, aber meine Großmutter lebt in wilder Ehe mit einem Tenor.«
Natürlichkeit
Mitten in einer geselligen Veranstaltung, die sich bisher in den üblichen Formen bewegt hatte, wird in plötzlich entstehender Faschingslaune beschlossen, einmal alle Gesetze mutwillig zu brechen. Im Nu lagern alle auf dem Fußboden, Herren und Damen duzen sich, einige Frauen entfalten in dieser Freiheit eine Grazie, die es bedauern läßt, daß es überhaupt Stühle und Sofas und »steife« Formen gibt. Andre stehen oder hocken etwas linkisch herum und passen sich schwer der ungewohnten Freiheit an. Sie sind die Aufrichtigen, die ihre eigne Gebundenheit schmerzlich empfinden und sich darum diese Freiheit verbieten müssen. Sie sind rührend und werden in ihrer etwas schweren Art so lange natürlich und sympathisch bleiben, bis ihnen eines Tages eine wohlmeinende Individualistin einredet, sie müßten ihrer Bescheidenheit einen Stoß versetzen, ihre Persönlichkeit entwickeln, sich »entfalten«. So weit ist bereits eine dritte Gruppe von Frauen fortgeschritten, die, ebenso schwer und linkisch wie jene, die Aufrichtigkeit ihrer Natur vergessen haben und nun Dinge tun, die zu ihnen nicht passen. Sonderbarerweise sind gerade unter ihnen mehrere Künstlerinnen. Wie plötzlich entfesselte Tiere wälzen sie sich am Boden, ahnungslos, wie fern ihnen die Grazien geblieben sind. Es ist kein Zweifel: die erste Gruppe der wirklich Freien, ganz Natürlichen besteht aus den kultivierten Frauen, die im Alltagsleben nicht Sklavinnen, sondern vollkommene Herrinnen der Konvention sind und mit und ohne Konventionen immer aus echter Natur handeln, diese beiden Worte enthalten für sie keinen Widerspruch. Die Frauen der zweiten Gruppe sind nicht Herrinnen, sondern Dienerinnen der Konvention, aber ihr echter Instinkt läßt sie dieses Dienstverhältnis als das ihnen allein zukommende nicht aufgeben. Die dritten sind barbarisch, geschmacklos und vertreten, indem sie ihre zuchtlose Persönlichkeit vordrängen, die Weltanschauung des Individualismus. Kaum ist die Lustigkeit vorbei, so finden die Freien ihre gewohnte Gehaltenheit im Augenblick wieder und erscheinen den wieder Gefesselten wie immer »steif und heuchlerisch«. Diese »Heuchlerinnen« sind dieselben Frauen, die im Karneval mit einem wildfremden Manne scherzen und plänkeln können, ohne sich etwas zu vergeben, die königlich mit der Konvention zu spielen vermögen.
Warum ist diese wahre, stolze Natürlichkeit so selten? Weil man aus der Natur einen starren theoretischen Begriff gemacht hat, der etwas bedeuten soll, was gewissermaßen vor oder im Gegensatz zu aller Kultur und Zivilisation besteht. In Wahrheit ist Natur überall, auch in den verwickeltesten Verhältnissen der Zivilisation zu finden. Es gibt eben eine natürliche Art, auch auf das Verwickelte zu antworten, nicht indem man es verneint und ihm den theoretischen, das heißt unnatürlichen Naturbegriff Jean Jacques Rousseaus entgegenstellt, sondern indem man es lebendig erfaßt und zu einem Teil seines Lebens macht oder aber ihm instinktiv (nicht theoretisch) aus dem Wege geht, wenn es einem nicht zusagt. Sich in Felle zu hüllen und von rohen Früchten zu leben war im Urwald natürlich und wäre am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein unnatürlicher Narrenstreich. Grobheit ist im Bauernwirtshaus natürlich, der Natur eines gebildeten Hauses aber widersprechen schlechte Manieren; darum wirkt hier jede Art von Grobschlächtigkeit »deplaciert«, das heißt der Natur des Ortes widersprechend. So ist Natürlichkeit nichts andres als ein sicheres Erfassen des Charakters einer Umgebung oder einer Lage und die Fähigkeit, sich diesem Charakter entsprechend zu verhalten. Kultur ist die Form, mit der bewußt gewordene Persönlichkeiten, Gruppen oder Zeiten den unbewußten Gesetzen des Lebens folgen, Natürlichkeit ist unbewußte Kultur, aber darum ist freilich noch nicht alles unbewußte Handeln natürlich. Durch die intellektuelle, theoretische Verbildung unsrer Zeit ist nämlich sehr vielen Menschen eine künstlich gezüchtete Unkultur zur zweiten unbewußten Natur geworden. Diese zweite Natur ist Unnatur. So ist Unnatur der größte Feind der Kultur.
Man lernt in Deutschland, falls man eine Kinderstube gehabt hat, sich knapp bewegen und mit Mäßigung reden, das ist als allgemeiner Erziehungsgrund gut, man kann lernen Fehler zu vermeiden, aber Natürlichkeit lernt man nicht, man findet sie vielleicht einmal. Der freie Wettbewerb macht Menschen zu Befehlenden, denen diese Gebärde durchaus unnatürlich ist. Die sogenannten einfachen Leute sind aber heute auch fern davon, Natürlichkeit zu besitzen; ihr sozialer Ehrgeiz läßt sie etwas andres zu scheinen wünschen als sie sind. Der Intellektualismus unsrer Zeit hat die natürliche Ungleichheit der Menschen einfach wegdekretiert, theoretisch gleiches Recht für alle verkündet und ermutigt damit jeden, das zu tun, was ihm nicht zukommt, das heißt das Unnatürliche. Echte Natürlichkeit ist heute das seltenste Kulturgut einzelner Unverdorbener, Unentwurzelter geworden und kann sich so gut im Palast wie in der Hütte finden.
Das beste Beispiel für das Gesagte ist der Zustand, in dem sich unsre Umgangssprache befindet. Die gebildete Sprache war immer der Gefahr ausgesetzt, sich in höfische Zierlichkeit oder abstrakte Farblosigkeit zu verlieren, dagegen war das Volk lange Zeit eine unverfälschte Quelle sprachlicher Neubildung. Sein naiver Bilderreichtum, den die ewig verjüngende Berührung mit der Scholle und den Werkzeugen, die Abhängigkeit von den Jahreszeiten im Wechsel von Glück und Unglück schuf, hat unsrer Sprache das Beste ihres Gehalts gegeben. Was ist aber heute das Volk? Eine von theoretischen Meinungen und halber Bildung verwirrt, materialistisch und respektlos gewordene Masse. Seine Sprachquelle fließt trüb, es spricht weniger Mundart als Kauderwälsch, statt Volksliedern singt es Brettellieder, statt an derben Sprichwörtern und Parabeln erfreut es sich an Kalauern und dem traurigen Humor der Witzblätter. Darum ist die Neigung unsrer Wissenschaft und Literatur zum »Populären« etwas ganz andres als die Neigung früherer Dichterschulen zum Volkstümlichen. Das »Populäre« ist heute das Triviale. Es liegt auf einer Ebene, wo sich zwei Entwurzelte treffen: halbgebildetes Volk und halbgelehrte, halbliterarische Schriftsteller. Ich will die Frage offen lassen, ob die alten Volkslieder wirklich von Leuten aus dem Volk gedichtet worden sind. Jedenfalls sind sie aus dem Geiste des Volks geschaffen und von dem Volke verstanden worden, vielleicht von manchem fahrenden Scholasten bäuerlicher Herkunft, dem seine junge, aber echte Bildung die ursprünglichen Gefühle nicht zerstört, sondern dichterisch geformt hat. Ganz anders jene neueren, meist aus dem Kleinbürgertum stammenden Dichter, die einen populären Ton anschlagen. Hier ist nichts mehr von Natürlichkeit, sondern die Form- und Stillosigkeit dieser modernen Lyrik ist reine Unnatur. Sie ist voll von Erinnerungen an frühere Dichter, an Zeitungsphrasen, an Rotwälsch aller Art. Am betrübendsten zeigt den Mangel an Natur die Singspielhalle. Aus dem fast ausgestorbenen wundervollen Volkssänger, wie der Münchener Papa Geis einer war, ist dieses elende Geschöpf von »Salonhumoristen« geworden, diese Ausgeburt von Unnatur, von Halbheit, von Geschmacks- und Gemütsroheit, der das Volk zujubelt. Ja, der Begriff der Natur selbst hat eine Wandlung erfahren, er ist gleich geworden mit Formlosigkeit. Man vergißt, daß die straffste Form einem zuchtvollen Geist vollkommen Natur sein kann. Dante und Petrarka sind natürlich, der Volkston wäre ihnen unnatürlich gewesen. Die Volksdichterin Johanna Ambrosius dagegen ist ein Gemisch von verblasener Sehnsucht, halber Bildung und Vergreifen in der Form. Laßt heute einen einfachen Menschen ein paar Verse machen, sie werden oft nicht etwa holprig und rauh ausfallen, im Gegenteil, sie sind meistens anspruchsvoll glatt, denn er beherrscht dieses abgegriffene Kauderwälsch der Zeitungen und Singspielhallen, das heute überall in der Luft liegt. Niemand redet mehr, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, jeder schämt sich dessen, weil er von tausend intellektuellen und sozialen Mißverständnissen umsponnen ist.
Natürlichkeit ist heute hier und da wieder das Ergebnis feiner, erfahrener Kultur, die kritisch durch alle Irrtümer der Zeit hindurchgegangen ist, um schließlich bei der einfachen Echtheit anzukommen. Diese wahre Natürlichkeit hat nichts zu tun mit jener begrifflich ideologischen Rückkehr zur Natur, wie sie die Naturapostel und »simple lifers« verlangen.
Nichts scheint heute schwerer als die Natürlichkeit, als zu reden und zu wissen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Meist erfährt es erst der, der ihn wie ein Specht an zahllosen Rinden gewetzt hat.
Geschmack
Man hört öfters sagen: wir Deutsche stehen an gesellschaftlicher Kultur und Geschmack den Franzosen nach, dafür haben wir größere Natürlichkeit. Aus dieser Ansicht spricht die Meinung, Geschmack sei eine Gabe, ein Talent wie jedes andere, das man haben könne oder nicht. Das ist richtig, wenn man den besonderen künstlerischen Geschmack meint, sei es, daß er sich nur wählend oder urteilend oder aber schöpferisch verhält. Das aber, was man im alltäglichen Leben Geschmack nennt, ist etwas ganz anderes, etwas eher zum Charakter als zum Geist Gehörendes, was ebenso unbedingt erforderlich ist wie körperliche Sauberkeit. Es ist kein schöpferischer Geschmack nötig, um sogenannte Geschmacklosigkeiten zu vermeiden, sondern nur wahre Natürlichkeit, das instinktive Erkennen der eigenen Art, die einen nichts tun läßt, was einem unnatürlich ist. Zu wissen, daß Manet besser ist als Thumann, beweist jenen natürlichen Geschmack noch lange nicht. Man kann sogar einen »Kitsch« in seinem Zimmer haben und in »unpersönlichen« Möbeln wohnen, und doch mehr Geschmack in seinem Leben und Verhalten beweisen als manche Künstler und von »Kultur« Besessene. Der natürliche Geschmack kennt keine ästhetischen Regeln, die bestimmen, ob man modernes Kunstgewerbe anerkennt oder nicht. Da aber die wenigsten Menschen mehr diese angeborene Natürlichkeit besitzen, sind die konventionellen Regeln heute notwendiger als je.
Unter geschmacklosen Menschen versteht man nicht etwa solche, die keinen Wert aufs Äußere legen, sondern gerade solche, die es tun, aber nicht aus ästhetischen Gründen, sondern um aufzufallen, Besitzunterschiede zu bezeichnen und dgl. Hier hängt das Ästhetische eng mit dem Ethischen zusammen. Sagen: ich richte mein Leben einfach nach meinen Bedürfnissen ein, das ist weit davon entfernt, das zu sein, was man Geschmacklosigkeit nennt. Dieses scheinbar nur ein Fehlen ausdrückende Wort meint vielmehr ein positives Übel. Erst der wird geschmacklos, der Ansprüche macht, die ihm nicht zukommen, ohne es in seiner verbildeten Unnatur zu ahnen. Man sollte etwas weniger auf den guten einfachen deutschen Reisenden schimpfen, so lange er wirklich keinen Wert aufs Äußerliche legt, sich von eleganten Orten fernhält und keinen Menschen stört. Aber leider legen manche Deutsche einen übertriebenen Wert aufs Äußere, und gerade das macht sie geschmacklos. Gewisse groteske Auswüchse in den Sitten und den Formen der Kleidung, in kleinstädtischen Konventionen, in überladenen Gebrauchsgegenständen und nicht minder die dagegen verkündeten Reformen drücken nicht etwa eine harmlose Gleichgültigkeit gegen das Äußere aus, sondern eine nur allzu bewußte Absichtlichkeit. Zu diesen Ansprüchen kommt seit einiger Zeit die des deutschen Snob, der den Leuten in die Ärmel schielt, ob sie keine »Röllchen« tragen, von dem Bade erzählt, das er neuerdings täglich nimmt, im Einhalten der englischen Vorschriften englischer ist als der »King«. Dies geht heute schon so weit, daß man sicher sein kann: sitzt irgendwo in einem Gasthof, der kein Luxushotel ist, ein einzelner Mann im »Smoking« unter einer internationalen Gesellschaft in Touristen-Kleidung, so ist er ganz gewiß ein Deutscher, der kürzlich gelernt hat, was »evening-dress« ist und noch eine allzu sichtliche Freude daran hat. Er ist genau so geschmacklos, wie sein größter Feind, der Herr im Jägerhemd, der laut für Deutschtum und Turnfahrten eintritt. Beide sind gleich absichtlich und unnatürlich. Was man dem heutigen jungen Deutschen wünschen möchte, ist, daß er wieder harmloser werde; fühlt er sich etwas ungelenk und bäurisch, nun, so überlasse er den Smoking und den Frack andern. Will er ihn aber tragen, so frage er sich erst, ob seine ganzen Lebensgewohnheiten diesem Stil entsprechen. Sonst setzt er sich der Gefahr aus, die neuen Formen des Weltmannes falsch zu gebrauchen und am hellichten Tage mit tief ausgeschnittener Weste zu erscheinen. Je mehr Wert jemand aufs Äußere legt, desto mehr positiven Geschmack muß man von ihm verlangen; wer aber bescheiden auftritt, braucht keinen besonderen Geschmack zu besitzen, um Geschmacklosigkeit zu vermeiden.
Das Schamgefühl
Das echte Schamgefühl bezieht sich nicht auf die Nacktheit, sondern auf die Begierden. Der Nacktheit schämt man sich nur mittelbar, indem sie Begierden zu entfachen vermag oder zeigt. Darum besitzen wirklich unschuldige Kinder, d. h. solche, die noch nichts von Begierden wissen, von Natur kein Schamgefühl, und Adam und Eva schämen sich erst in dem Augenblick, da sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Etwas ganz anderes ist das konventionelle, auf Moral beruhende Schamgefühl. Es findet sich naturgemäß in dem moralistischeren Norden mehr als in dem harmloseren Süden. Dieses konventionelle Schamgefühl kann gleichzeitig mit vollkommener natürlicher Schamlosigkeit vorkommen. Man hat oft das Betragen gewisser Brautpaare und Hochzeitsreisenden der anständigen Haltung der Kurtisanen französischen Stils entgegengehalten. Diese erlauben öffentlich keinerlei Freiheiten, während jene Brautpaare in dem Irrtum befangen sind, ihre öffentlichen Liebkosungen seien darum nicht schamlos, weil sie gesetzlich sind, d. h. der bestehenden Moral nicht widersprechen. Hier ist die Moral vollkommen an Stelle des Schamgefühls getreten, und nirgends wird der Unterschied der beiden Begriffe klarer. Man hat manche etwas verwahrloste Karnevalsbälle dadurch entschuldigen wollen, daß die Öffentlichkeit dieser Verwahrlosung sie eigentlich ungefährlich mache. Das Schamgefühl hat aber mit Gefährlichkeit gar nichts zu tun. Eine Frau kann nach dem siebenten Geliebten noch Schamgefühl besitzen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß eine Jungfrau ein schamloses Geschöpf ist. Ja, gerade eine allzu bewußte Keuschheit kann einen Mangel an Scham verraten. Wahre Unschuld und körperliche Keuschheit können bei manchen Temperamenten nicht lange nebeneinander bestehen, denn eines Tages wird sich die Keuschheit zu sehr ihrer selbst bewußt. Dann wäre es manchmal unschuldiger, nicht mehr keusch zu sein. Wer in einer der großen Tanzhallen der Halbwelt seine Hände nicht hinreichend beherrschte, würde wahrscheinlich von der belästigten Schönen etwas Gründliches zu hören, wenn nicht zu fühlen bekommen. Wer dasselbe auf einem unserer »harmlosen« Künstlerfeste tut, wo man viele ihrer Keuschheit sehr bewußte Mädchen trifft, dem wird seine Freiheit oft genug durch ein beglücktes Lächeln gedankt. Man beachte den Unterschied zwischen der Pariser und der Münchener Unmoral: Jeder hat von dem Bal des quat'z' arts der Künstler und Modelle in Paris gehört. Eine Inschrift über der Garderobe erläßt folgende Bitte an die Weiblichkeit: Les dames sont instamment priées de laisser leurs chemises au vestiaire. Dieser Aufforderung wird von vielen mit Freuden gefolgt. Trotzdem Jugend, Tanz und Alkohol dort zu allen möglichen Bejahungen des Lebens verführen, würde doch niemand wagen, eine der Damen, die so vertrauensvoll ihre Schönheit dem Schutze des Publikums empfehlen, irgendwie zu belästigen. Dagegen betrachte man die Szenen auf gewissen von jungen Damen besuchten Karnevalsfesten in München. Ein Knäuel von unbeherrschten Menschen mit unbefriedigten Sinnen. Eine Provinzfrau ruft neckisch: »Ein Küßchen in Ehren kann niemand verwehren« und versinkt mit irgendeinem Epheben in einer halbdunklen Nische. Was würden die Freundinnen in Braunschweig oder Koburg sagen, wenn sie solchen »heidnischen Lebenskult« sähen und das kleine Gänschen mitten darin! Einer ist sogar so dionysisch, das Licht auszudrehen. Was ist denn dabei? Das ist doch so harmlos. Was Ernstes kann ja gar nicht geschehen, dazu sind viel zu viele Menschen da. In einer Ecke brüllt eine etwas derber veranlagte Schar von Kunstakademikern das schöne Lied:
Menschen, Menschen san's ma alle, Föhla hat a jedes gnua.
Brüderchen und Schwesterchen liegen umher, zu lieblichen Klumpen geballt, und finden das alles so poetisch. Sie wissen ja kaum, wie ihnen geschieht, und nach Wochen noch findet man: Wie man sich doch in Süddeutschland menschlich so viel näher kommt als in dem kalten Norden.
Niemals wird sich eine bessere Halbweltlerin öffentlich in Lagen begeben, wie sie im Fasching viele Frauen aufsuchen, die in dem grotesken Irrtum befangen sind, sie seien Damen und stünden sittlich höher als die Halbwelt, weil sie billiger und weniger gründlich sind. Nur die wirklich gute und die wirklich schlechte Gesellschaft (monde und demi-monde) wissen, was sich ziemt; was dazwischen liegt, ist meistens unsicher, das Kleinbürgertum sowie die heute vorwiegend aus ihm stammende Bohême. Das Kleinbürgertum kennt nur die Bindung der landläufigen Moral, die dem Brautpaar gegenüber im Hinblick auf die künftige Gesetzlichkeit seiner Beziehungen etwas gelockert wird. Die Bohême zieht dagegen unerschöpfliche Freuden aus der Beleidigung dieser von ihr abgeworfenen Moral. In beiden Schichten findet das echte Schamgefühl nur vereinzelt seinen Boden. Beide erklären es, wo es sich in seiner Zurückhaltung zeigt, oft für Heuchelei. Sie verachten den Menschen als Heuchler, der nach außen stets seine Haltung bewahrt, obwohl ihm die Lästerchronik allerlei geheime Geschichten nachsagt, anstatt ihm dafür dankbar zu sein, daß er die Welt mit dem Anblick seiner Privatangelegenheiten verschont. Dagegen ist man nachsichtig gegen das formlose Wesen, das sich rückhaltlos in allerlei halbe Beziehungen eingelassen hat, dem Gerede durch jeden Schritt Nahrung gibt, von alledem gar nichts hat und schließlich in der Meinung, etwas erlebt zu haben, sich bloß »unmöglich« macht und wie ein Fetzen herumgeschmissen wird. Gewiß, es mag ganz harmlose Gemüter geben, die in solchen zweideutigen, unklaren Beziehungen ein paar Wochen lang ahnungslos bleiben. Sehr bald aber müssen sie fühlen, was für Begierden hier im Spiele zu sein pflegen, und wer unter ihnen natürliches Schamgefühl besitzt, zieht sich bald angeekelt von solchem Brüderchen-und-Schwesterchen-Spielen zurück, dessen betonte Harmlosigkeit viel eher den Vorwurf der Heuchelei verdient. Der Mangel an Schamgefühl hält sich oft selbst für gerade offene Ehrlichkeit. Es gibt aber eine ganze Menge von Dingen, die man allerdings heimlich, aber nicht offen tun darf.
Vor einigen Jahren ging die Erzählung durch die Blätter, irgendwo im Orient sei eine Reisegesellschaft in die Hände von Räubern gefallen, Herren und Damen seien entkleidet und in eine Höhle eingesperrt worden, bis das erwartete Lösegeld eingetroffen war. Die Herrschaften sollen sich sehr bald an ihre Nacktheit gewöhnt und sie nicht mehr anstößig empfunden haben, während in dem Augenblick, als ihnen die Kleider zurückgegeben wurden, die Damen entschieden eine Wand verlangten, da sie sich nicht vor den Herren anziehen wollten. Das ist keinesfalls lächerlich oder frauenzimmerhaft, sondern es zeigt ein feines Schamgefühl dafür, daß Halbangezogensein ein zweideutiger Zustand ist, während die Nacktheit, von den Umständen bedingt, natürlich sein kann, aber freilich nur dann.
Altmodische Leute sind oft von der »Schamlosigkeit« der modernen Kunst entsetzt, die jüngere Generation verhöhnt diesen Standpunkt. Beide haben recht und unrecht. Zur Erklärung dieses Widerspruchs ist eine kleine Abschweifung auf das Gebiet der Ästhetik nötig. In der Kunst steigert sich das feine Schamgefühl, das alle körperliche Notdurft zu verhüllen trachtet, zum Ästhetischen. Ein Irrtum unserer Zeit ist, die Nacktheit sei an sich schön. Sie kann geradesogut häßlich sein. Nun ist zweifellos auch die Häßlichkeit ein berechtigter Gegenstand künstlerischer Darstellung. Kein künstlerisches Auge wird sich vor der prächtigen Derbheit z. B. Jordaensscher Leiber entsetzen. Der Grund ist der, daß hier die Nacktheit gar nicht schön sein soll, daß sie ohne jedes Pathos auftritt. Ebenso hat eine Dirnenszene von Goya das Vorrecht der Häßlichkeit im künstlerischen Sinne, denn hier soll ja gar nicht das Verführerische einer Aspasia, sondern gerade das an Tragik grenzende Groteske des Dirnendaseins dargestellt werden, und die Frage ist nur, ob dies wirklich herauskommt. Hier von Schamlosigkeit sprechen, ist ein psychologischer Irrtum. Ganz anders ist es, wenn jemand eine Idealgestalt auf ein Einhorn setzt und durch einen fabelhaften Wald reiten läßt, oder wenn einer eine nackte Frau auf eine Wiese stellt. In beiden Fällen benutzt er schöne Gestalten als Stoff, im einen Fall mit symbolischem, im anderen mit rein ästhetischem Anspruch. Der Künstler will in diesen Fällen Schönheit darstellen, und das muß ebenso herauskommen wie bei jenen anderen die Darstellung des Grotesk-Häßlichen. Wirken solche Gestalten dann kümmerlich oder aufgeschwemmt oder gemein sinnlich, dann fragt man mit Recht: Warum werden uns solche Häßlichkeiten enthüllt? Das künstlerische Schamgefühl ist verletzt. Das ist etwas ganz anderes als die sattsam abgedroschene Phrase, das Leben sei an sich häßlich genug, der Künstler solle daher nur das Schöne bilden. Alles vielmehr darf der Künstler bilden, das Häßliche, das Bizarre, das Lächerliche, nur soll man ihm auch deshalb das objektiv Schöne nicht verbieten. Wenn uns ein Frühlingsreigen nackter Mädchen dargestellt wird, so ist die Darstellung objektiver, schon im Stoff liegender Schönheit bezweckt, und wir können verlangen, daß uns nicht Aktstudien ausgemergelter Betschwestern oder aufgedunsene Köchinnen zugemutet werden. Solche Nacktheit wirkte in solchem Falle schamlos. Warum soll aber der Künstler, fragt man vielleicht, wenn er alles bilden darf, nicht auch ausgemergelte Betschwestern oder aufgedunsene Köchinnen darstellen? Gewiß darf er auch das, aber nicht unter dem Vorwand eines Frühlingsreigens, sondern in der Absicht, das Kümmerliche oder das Derbe, vielleicht als Zerrbild, auszudrücken. In diesem Falle hebt die künstlerische Form den Stoff auf eine Stufe, die jenseits der individuellen Scham steht. Die Alten haben die Darstellung der Nacktheit immer dadurch der Sphäre der Begierden entrückt, daß sie sie irgendwie begründeten, meistens durch Attribute, die auf das Bad oder auf das Gymnasium hinwiesen. Erst in sehr bewußten Kulturen wagt man die Nacktheit um ihrer Schönheit willen darzustellen. Dies ist in allen Zeiten, auch in Athen, ein ungeheurer Durchbruch der Sitte gewesen. Nur die Schönheit der nackten Form konnte eine solche Tat rechtfertigen. Ein häßlicher weiblicher Akt sann im Hinblick auf ein Schicksal – z. B. eine Hagar in der Wüste – durch diese Beziehung zu einem starken Mittel künstlerischen Ausdrucks werden. Wo es aber einfach heißt: nackte Frau, badendes Mädchen oder dergleichen (übrigens nicht nur heißt, sondern auch nichts anderes dargestellt ist), wirkt die beziehungslose Ausbreitung der Häßlichkeit schamlos. Daß die Schönheit eine große Reihe von Verstößen gegen die Sitte loszukaufen vermag, ist ganz zweifellos. Daß unzeitgemäße oder dem Ort widersprechende Freiheiten des Verhaltens oder Entblößungen bei häßlichen Menschen doppelt schamlos wirken, ist so klar, daß man fast versucht sein könnte, das ganze Problem leichthin zu lösen, indem man sagt: Alles ist erlaubt, wenn es sich nur durch seine Schönheit rechtfertigt. Nun, das verallgemeinert zu sehr, zumal die Meinungen darüber sehr verschieden sein können, bis zu welcher Grenze das Verhalten eines Liebespaares noch schön ist. Eine wie große Rolle aber das Ästhetische hier spielt, geht besonders hervor aus der ganz verschiedenen Scham südländischer und nordländischer Mütter. Nordische Frauen entsetzen sich oft darüber, daß die Frauen des Südens ihre Kinder vor den Blicken aller säugen. Den Südländerinnen dagegen fällt wiederum auf, mit welcher Unbefangenheit viele Frauen des Nordens bis in die letzten Tage vor ihrer Niederkunft in der Öffentlichkeit erscheinen. Die südliche Schamhaftigkeit ist bei weitem feiner, weil von dem Schönheitsgefühl eingegeben, denn während der Anblick schwangerer Frauen zweifellos leicht an Tiere in ähnlichem Zustand erinnert, gemahnt die nährende Mutter unfehlbar an die Madonna.
Der Künstler in der Gesellschaft
Die moderne Kunst und die moderne Gesellschaft sind im Grund Feinde. In den Kreisen der Industrie, des Handels, der Bank, der Technik, ja der Wissenschaft finden die Künstler (ich rechne die Dichter dazu) heute keinen natürlichen Platz mehr. Trotzdem ist ihre Anzahl, wohl auch verhältnismäßig, größer als in jenen Zeiten, da ihr Beruf und das Bedürfnis nach ihnen anerkannt und ihre gesellschaftliche Stelle bestimmter war. Ein anderer, eng damit zusammenhängender Zug der modernen Künstler ist, daß ihre Werke sich nicht an die Gesellschaft der tätigen Menschen wenden, daß ihre Probleme häufig genug abseits von ihr liegen, ja sehr oft sogar eine Spitze gegen sie zeigen.
Niemals wurden so viele Bücher geschrieben, in denen der Stoff aus dem Leben der Künstler und Schriftsteller selbst genommen ist, in denen Kämpfe und Leiden der sogenannten Schaffenden dargestellt sind. Oft findet man darin den Standpunkt eines »höheren« Menschentums vertreten und den Anspruch, die Gesellschaft der Tätigen verachten oder belehren zu dürfen. Dieser halbversteckte Ärger der Künstler, dieses »Beleidigtsein« wird von der Gesellschaft nicht im selben Grade erwidert. Sie fühlt sich vielmehr selbst ein wenig getroffen und zeigt ein nicht ganz gutes Gewissen. Durch die Geselligkeit schlägt sie eine Brücke in das feindliche Lager, und man sieht nun zunächst diejenigen, welche einen Frack besitzen, zu Gastereien und Bällen herüberkommen. Aber auch gerade die, welche keinen Frack haben, die eigentliche Bohême holt man sich bisweilen, staunt über ihr seltsames Gebaren und ihr scheinbares Erhabensein über die Konventionen. Besonders die Lästerchronik dieser Klasse reizt heftig, und die Frauen, ja viele junge Mädchen sind genau unterrichtet, mit wem gerade der Maler X. oder der Schriftsteller Y. in »freier Ehe« lebt. Dieser Reiz aber beseitigt nur scheinbar die Feindschaft der beiden Klassen. In allen wesentlichen Fragen, sowie es sich um Familien- oder Vermögensangelegenheiten handelt, zeigt sich die Kluft. Das Vorhandensein der Überläufer bestätigt die Regel. Die Teilnahme der Gesellschaft für den Künstler gleicht der für den zoologischen Garten. Es ist seltsam und manchmal schauerlich zu sehen, wie sonderbare Tiere fressen, lieben und sich verständigen. Dieses fast perverse Interesse der Gesellschaft, sowie die wachsende Anzahl der Künstler, die sie, genau wie die modernen Arbeiter, selbst zu einer beträchtlichen Konsumentenklasse macht, läßt sie leben, häufig gut leben. Bei weitem die größere Zahl, und unter ihnen sind vielleicht gerade die Sonderbarsten, bleiben der Gesellschaft überhaupt fern, verhöhnen oder hassen sie und kennen sie nicht. Die Folge von alledem ist, daß wir nur wenige Dichter haben, welche die Probleme der Zeit umfassend zu begreifen und zu gestalten wissen, sondern nur solche, die sich für die Kämpfe der mit der Zeit nicht Mitkommenden einsetzen. Natürlich spielt auch hier immer die Zeit hinein, aber meist als die mißverstandene Feindin. Ich denke an jene Romane, in denen Schuster, Schneider, Nachtwächter, Pfarramtskandidaten und andere Pächter der Ideale im Kampfe mit den Forderungen der Zeit scheitern. Ich denke ferner an die Malerei der Heimatskünstler, der modernen Präraffaeliten usw., ohne zu vergessen, daß die bildende Kunst in ihren hervorragenden Vertretern doch dem modernen Leben bei weitem kühner zu Leibe gegangen ist als die Literatur. Der Grund mag darin liegen, daß das einmal erzogene Künstlerauge sich nicht um soziale, moralische und ähnliche Probleme der Zeit zu kümmern braucht, um vortreffliche Bilder ihrer Menschen sowie von deren Umgebungen und Vorfällen hervorzubringen. Der Schriftsteller hingegen muß die zentralen Fragen erlebt und durchdacht haben, um zu gestalten. Das tut er jedoch heute selten, sondern er begnügt sich meist mit einer ablehnenden Sonderstellung mit mehr oder weniger revolutionärer Note. Alle die aus dem Lager der Künstler gegen die moderne Gesellschaft erhobenen Vorwürfe gipfeln in dem einen, daß sie überaus unkünstlerisch sei. Dieser Vorwurf ist ebenso zweideutig wie der eines Vaters, der seinen erwachsenen Sohn unerzogen schelten wollte. Damit trifft er nur sich selbst, warum hat er ihn nicht erzogen? Kein Mensch hat irgendwelche Verpflichtung, künstlerisch zu sein, außer dem Künstler selbst. Dessen Aufgabe ist es, das Künstlerische in die Welt zu tragen, es ihr zu deuten, den Alltag selbst künstlerisch zu sehen. Wo dies nicht gelungen ist, ist es Schuld des Künstlers, der, statt an der Brust des Lebens zu liegen, sich in verstiegene Träumereien verspinnt, deren Niederschlag in Werken kein Mensch des tätigen Lebens begreifen kann. Vielmehr hat die Gesellschaft ein Recht, zu klagen: Warum ist das Dasein so eintönig, warum ist aller Reiz des Märchens von uns geflohen, warum haben wir keine Geschichtenerzähler, die uns den Sinn unseres Daseins deuten?
Wenn wir genauer zusehen, so ist es selten die Kunst, sondern meist etwas Persönliches, was den modernen Künstler von der Gesellschaft scheidet. Die Künstler sind in der Regel Söhne des großen oder des kleinen Bürgertums. Im ersten Falle sind ihre Brüder, Vettern und Schwäger Ärzte, Juristen, Industrielle usw. Sie selbst sind oft schon als Kinder nervenmüde und für praktische Berufe unfähig gewesen. Solche Menschen finden nun häufig im Betrachten von Kunstwerken und im Grübeln über Probleme einen Ersatz für die ihnen fehlenden Befriedigungen der Tätigkeit. Sie studieren allerlei, wozu die Tätigen keine Zeit haben. Nachdem sie jahrelang unter ihren Knüffen gelitten haben, entwickelt sich leise ein kritisches Überlegenheitsgefühl in ihnen, und damit ist schon fast alles gegeben, woraufhin sich ein moderner junger Mann einbilden mag, er habe das Zeug zum Künstler. Noch deutlicher wird das bei jungen Mädchen. Sich mit den Eltern über Liebe und Heirat nicht verstehen können ist gleichbedeutend mit Talent für Malerei oder mindestens für Buchschmuck. Die Hoffnung, sich in Künstlerkreisen »auszuleben«, womöglich in München, ist die verbindende Vorstellung. Nun ist heute die Gelegenheit ungewöhnlich leicht, technisch einiges zu lernen und dann ein Werk hervorzubringen, das die künstlerisch unerzogene Gesellschaft nicht versteht. Ist gar irgendein origineller Wurmstich darin, so ist die Möglichkeit zur Berühmtheit gegeben. Bisweilen äußert sich ein atavistischer Rückschlag auf einen schon »entarteten« Onkel, von dem die Familie ungern spricht, als moderne Kunst. Vielleicht hält man mir jetzt vor, daß ich nicht vom Dilettanten, sondern vom Künstler sprechen wollte. Nun, ein Drittel der heutigen Künstler, wenn nicht mehr, sind solche Dilettanten. Die berühmtesten Ausstellungen, die bekanntesten Verlage