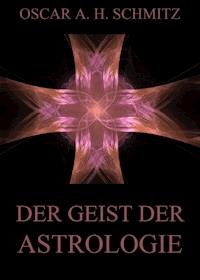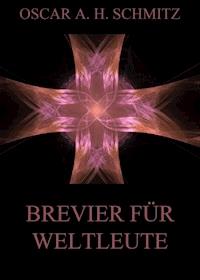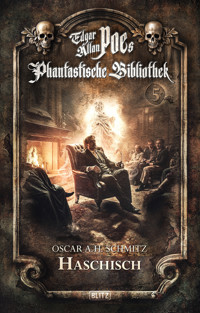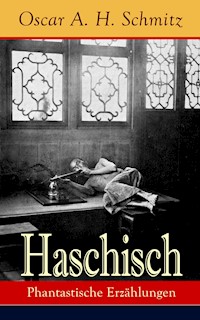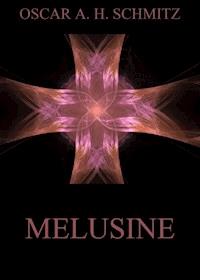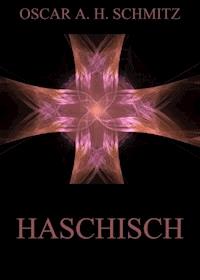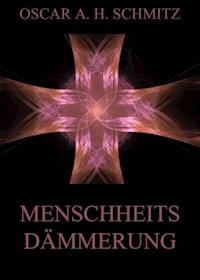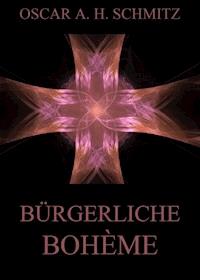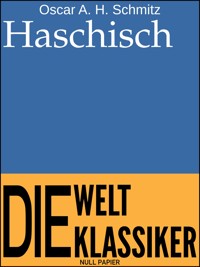
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Oscar Adolf Hermann Schmitz war ein erfolgreicher, aber auch umstrittener deutscher Schriftsteller und Gesellschaftskritiker des frühen 20. Jahrhunderts. Als Mitglied der »Münchner Bohème« brach er so manches Tabu des wilhelminischen Standesdünkel auf und entlarvte nur zu gerne die Bigotterie der damaligen Zeit. Neben seinen kritischen Schriften veröffentlichte er ebenso zahlreiche Reise- und Ratgeberbücher. Zu den populärsten Werken ist die Geschichtensammlung »Haschisch« zu zählen. In dessen gleichnamiger Titelgeschichte berichtet er - offensichtlich im Drogenrausch - aus verschiedenen Perspektiven von verrückten Liebensabenteuern, ketzerischen Priestern und anderen bizarren Situationen, die sich nur zu leicht der Realität entziehen. Was ist echt, was nicht? Was passiert wirklich? Dabei wanderte Schmitz auf den im Deutschen noch wenig beschrittenen Pfaden der phantastischen Literatur. In »Haschisch« spielt er mit damals unerhörten und ungehörten Themen wie Erotik, Sadismus, Religion, Tod und Drogen. Obwohl Thomas Mann ihn für einen »hervorragenden gescheiten Schriftsteller« hielt, ist er heute in Vergessenheit geraten. Bringen wir ihn wieder zurück in den Lichtkegel der Literaturwahrnehmung. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar A. H. Schmitz
Haschisch
Erzählungen
Oscar A. H. Schmitz
Haschisch
Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: G. Müller, München, 1913 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-81-1
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Haschisch
Der Haschischklub
Die Geliebte des Teufels
Eine Nacht des Achtzehnten Jahrhunderts
Karneval
Die Sünde wider den Heiligen Geist
Die Botschaft
Der Schmugglersteig
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Oscar Adolf Hermann Schmitz war ein erfolgreicher, aber auch umstrittener deutscher Schriftsteller und Gesellschaftskritiker des frühen 20. Jahrhunderts. Als Mitglied der »Münchner Bohème« brach er so manches Tabu des wilhelminischen Standesdünkel auf und entlarvte nur zu gerne die Bigotterie der damaligen Zeit. Neben seinen kritischen Schriften veröffentlichte er ebenso zahlreiche Reise- und Ratgeberbücher.
Zu den populärsten Werken ist die Geschichtensammlung »Haschisch« zu zählen. In dessen gleichnamiger Titelgeschichte berichtet er - offensichtlich im Drogenrausch - aus verschiedenen Perspektiven von verrückten Liebensabenteuern, ketzerischen Priestern und anderen bizarren Situationen, die sich nur zu leicht der Realität entziehen. Was ist echt, was nicht? Was passiert wirklich? Dabei wanderte Schmitz auf den im Deutschen noch wenig beschrittenen Pfaden der phantastischen Literatur.
In »Haschisch« spielt er mit damals unerhörten und ungehörten Themen wie Erotik, Sadismus, Religion, Tod und Drogen. Obwohl Thomas Mann ihn für einen »hervorragenden gescheiten Schriftsteller« hielt, ist er heute in Vergessenheit geraten. Bringen wir ihn wieder zurück in den Lichtkegel der Literaturwahrnehmung.
Die Damen sahen traurig ein, daß sie zu spät gekommen waren, und nun traten gar Diener mit Schaufeln in den Saal. Die nackten Marquisen drückten sich verschämt in die Ecken und hielten die Hände über Brust und Schoß. Die Diener öffneten die Fenster und schaufelten die Überreste dieser Feierlichkeit hinaus. Unten im Hofe sah man im ersten Morgenlicht bleiches Menschengebein, das von früheren ausgelassenen Stunden des Grafen Gilles de Laval zeugte. Die Marquisen aber schlichen betrübt und verschämt durch ein Seitenpförtchen hinaus. Sie bereuten, sich ungeschickt benommen zu haben. Die armen Damen hatten sich umsonst entblößt.
Oh! là là que d’amours splendides j’ai rêvées! (Arthure Rimbaud)
Oh! là là. Ich habe von der glänzenden Liebe geträumt!
Haschisch
Ich würde und könnte dieses 1897 und 1900 entstandene und 1902 zum ersten Mal erschienene Buch -- also lange bevor der Satanismus und das »groteske« Genre in Deutschland Mode waren -- heute nicht mehr schreiben. Vielleicht weil meine Phantasie in weniger übermütiger Fülle blüht, vielleicht weil eine universellere Weltbetrachtung das rein ästhetische Flattern von Reiz zu Reiz etwas hemmt. Dennoch freue ich mich, dieses Buch als ein Vierundzwanzigjähriger geschrieben zu haben. Man hat mir die Notwendigkeit nahegelegt, sein Neuerscheinen in Einklang zu bringen mit meinen in der letzten Zeit gelegentlich geäußerten und heftig angegriffenen Ansichten über die Grenzen zwischen Kunst, Sittlichkeit und Religion. Nun, ein Kunstwerk kann, wie ja heute bis zum Überdruß gepredigt wird, allerdings in sich weder unsittlich noch irreligiös sein. Vielmehr hat es als Kunstwerk mit Sittlichkeit und Religion überhaupt nichts zu tun. Wohl aber kann ein unsittlicher Gebrauch davon gemacht werden, und beschränkte Gemüter mögen in ihrem Glauben daran Anstoß nehmen. In diesem Buche nun unterfange ich mich nicht, an den Grundlagen der Familie und Ehe zu rütteln, wenn ich mir auch als Künstler herausnehme, meine Stoffe unter den Merkwürdigkeiten zu suchen, die außerhalb der Familie liegen. Ebensowenig drücke ich eine Mißachtung vor der Religion aus -- was ganz und gar meiner eigenen religiösen Gesinnung widersprechen würde --, wenn ich zeige, wie eine gotteslästerliche Schar verruchter junger Leute in dem Augenblick, wo sie glaubt, die Sünde wider den Heiligen Geist zu begehen, vor der Allmacht Gottes anbetend in die Knie sinkt. Ein Monsignore in Rom hat mir einmal versichert, daß meine Darstellung, wenn sie auch den Teufel recht eingehend konterfeit, in nichts gegen die katholischen Dogmen verstößt. Ein Gläubiger wird sogar von dem Gedanken erbaut sein, daß Gott die größte der Sünden, die wider den Heiligen Geist, kaum zuläßt. Immerhin ist das Buch nur für gebildete Erwachsene geschrieben. Sein Äußeres wird es aus der Kinderstube fernhalten, sein Preis muß es für die halbwüchsige Jugend unzugänglich machen, und sein Stil dürfte kaum das Interesse der Halbgebildeten erwecken. Damit ist den berechtigten Forderungen der sozialen Sittlichkeit genug getan.
Ich wende mich zunächst an erfahrene Männer. Wenn ihnen das Büchlein solcher Ehre würdig scheint, mögen sie es ihren Geliebten, die es doch in dieser christlich-moralischen Welt nun einmal gibt, und deren Los ist, außerhalb der Schranken der gesellschaftlichen Moral in wilder Anmut zu blühen, auf den Toilettentisch legen. Es jungen Schwestern und Töchtern zu geben, die sich ihr Schicksal innerhalb dieser Schranken aufbauen sollen, wäre tadelnswert. Es seiner Frau zu schenken, ist meist überflüssig, oft gefährlich, doch kommt es natürlich immer auf die Frau an.
Und dir, schöne Müßiggängerin, die du zufällig durch diese Vorrede gerade zur Lektüre gelockt wirst, sage ich dies: Wenn du nicht anders kannst, lies es heimlich, so wie du dich einmal gelegentlich auf einen nicht ganz einwandfreien Ball, wohin du nicht gehörst, stehlen magst. Solange du selber weißt, daß du nur eine Eskapade begehst, deren man sich nicht rühmen soll, um kein schlechtes Beispiel zu geben, magst du es in des Teufels Namen lesen. Stellst du dich aber auf den Standpunkt heuchlerischer Liederlichkeit, deren drittes Wort lautet: »es ist ja nichts dabei«, oder aber, gehörst du zu jenen schwatzhaften Gänsen, die immer wieder betonen, die Frau sei in erster Linie Mensch und von derselben sittlichen Natur wie der Mann, dann haben wir uns beide nichts zu sagen.
Nach der Aufführung eines Stückes von mir, welches das Don-Juan-Problem behandelt, kam eine moderne Mutter auf mich zu und erzählte mir, wie entzückt ihr achtzehnjähriges Töchterchen aus der Vorstellung gekommen sei und wie erregt man am Familientisch die von mir berührten Fragen erörtert habe. Ich war sehr erschrocken, zumal sich mir nun das Kind selber näherte, und warnte die gute Dame aufrichtig davor, meine Werke jungen Mädchen zu geben. »Oh, wir sind vorurteilslos«, erwiderte sie. »Aber ich nicht«, sagte ich in peinlicher Verlegenheit, »bitte, hindern Sie Ihr Töchterchen, mit mir über mein Stück zu sprechen. Ich wüßte kein Thema, das ich nicht mit einer Frau behandeln könnte, aber zu sexueller Aufklärung fühle ich mich nicht berufen.«
Warum werden diese einfachen Fragen heute so verwirrt? Es gehen auch in einer gesund funktionierenden Gesellschaft eine Menge von Gesetzgebern und Moralphilosophen unvorhergesehene Dinge vor. Gerade sie werden ihrer bunten Abenteuerlichkeit wegen den Künstler besonders reizen. Sie zu verbieten ist heuchlerisch, philisterhaft und außerdem zwecklos. Darum sollen sie noch lange nicht öffentlich ausgeschrien werden. Auch von dem Künstler ist daher zu verlangen, daß die Form, in der er solche Stoffe behandelt, und von dem Verleger, daß die Art, wie er sie auf den Markt bringt, die Distanzen zu der herrschenden Sittlichkeit wahrt. Man erzählt sich nicht am Familientisch, daß man gestern mit einer interessanten Dame soupiert hat. So wird man verhindern müssen, daß Bücher, die heikle Themen behandeln, in falsche Hände geraten. Ganz verkehrt, weil kunstmordend, ist das englische System, das dem Künstler einfach die Darstellung solcher Dinge verbietet und dem jungen Mädchen alles zu lesen und zu sehen erlaubt, statt dem Künstler die Freiheit der Darstellung zu lassen, aber jungen Mädchen bisweilen den Zugang zu verbieten. Die französische Gesellschaft war darum so frei und geistreich, weil junge Mädchen streng ausgeschlossen wurden. Die englische ist deshalb so langweilig und monoton, weil die spinsters bei allem dabei sein müssen.
Der Autor, der sich auf gewagte Pfade begibt, muß sich eines besonders gepflegten Stils befleißigen, und damit hat er die Pflichten der Sittlichkeit und des Taktes erfüllt. Alles weitere ist Sorge der Verleger, Buchhändler, Eltern und Vormünder.
Also, Ihr lachenden Kurtisanen, Euch lege ich dieses Büchlein meiner Jugend offen ans Herz, und Ihr, selbstsichere und kluge Damen, Euch stecke ich es vielleicht heimlich unter das Kopfkissen!
Frankfurt A. M., Januar 1913 O. A. H. S.
Der Haschischklub
An einem Abend des Winters 189✳ befand ich mich in einem wenig besuchten Pariser Speisehaus. Während ich, ohne meiner Umgebung zu achten, ausschließlich mit der Mahlzeit beschäftigt war, hörte ich neben mir eine halblaute Stimme, die sich an den Kellner wendete. Die trotz des fremdländischen Akzents gewandte Ausdrucksweise, welche Vertrautheit mit den Boulevards verriet, fesselte meine Aufmerksamkeit, und ich erkannte in dem schlanken, diskret blonden, schon etwas alternden Dandy den Grafen Vittorio Alta-Carrara. Ich beobachtete, während er, ohne mich zu sehen, sein Menü zusammenstellte, daß sich die vertikale Tendenz seiner Linien seit unserem letzten Zusammentreffen noch verstärkt hatte und eine unübertreffliche Kunst des Anzugs dieser Veranlagung durchaus gerecht wurde. Die schmalen langen Beine ließ er in die schlanksten Stiefel auslaufen, während die fast entfleischten Finger in spitzbogigen Nägeln endigten. Seine dünnen Lippen, die keine Sinnlichkeit merken ließen, hatten neben dem ennui eine gewisse Bitterkeit angenommen, die seine kühle Persönlichkeit fast menschlicher und etwas nahbarer erscheinen ließ.
»Ah, Sie sind in Paris«, sagte der Graf und zeigte sich nur aus Liebenswürdigkeit erstaunt, obgleich zwischen unserem letzten Zusammentreffen und diesem Abend in Paris mehrere Jahre und Länder lagen.
Wir hatten uns einmal in einem römischen Salon kennengelernt, wo wir eines Abends nach dem Brauch des Landes, jeder mit einer Teetasse in der Hand, zwischen seltenen Statuen eine Stunde lang nebeneinander standen. Später erfuhr ich, daß er einen kalabrischen Vater hatte, der ihn in einer geheimnisvollen Schwärmerei für die großen, blondhaarigen Frauen des Nordens mit einer ziemlich untergeordneten Norwegerin gezeugt hatte, die immerhin blond und schlank genug war, um dem phantastischen Südländer den Duft der Freiaäpfel wenigstens von weitem wittern zu lassen.
Ein anderes Mal sah ich den Grafen in einem abgelegenen niederländischen Museum, wo er nach den Fragmenten eines unbekannten Kupferstechers, Allaert van Assen, suchte. Dieser Meister -- so versicherte er -- hatte in Höllenszenen sehr sinnreiche Foltern dargestellt, die beweisen sollten, daß der Schmerz eine gesteigerte Lust sei, daß nur törichte Menschen nicht nach den Genüssen einer ewigen Verdammnis lechzen könnten. Die Inquisition hat diesen Satanisten, der sich nach Spanien verirrte, mit Schneeumschlägen auf Herz und Hirn, wohlweislich und langsam verbrannt und seine Werke vernichtet oder entstellt. Zum letzten Male hatte ich den Grafen im Handschriftenkabinet einer kleinen deutschen Stadt gesehen, wo er einen arabischen Kodex auszog, der, wie er schwur, die ganze erotische Literatur der Europäer überflüssig machte.
Heute abend war Alta-Carrara wenig mitteilsam. Seine Aufmerksamkeit schien von den Speisen gefesselt zu sein, die ihn, nach seiner besonderen Anweisung zubereitet, durchaus zu befriedigen schienen. Plötzlich unterbrach er sich bei einer Kastaniensuppe, als ob sie in ihm eine Erinnerung wachrufe: »Haben Sie nicht einmal einen Vers gemacht -- so etwas wie...
... und eine Lust, gepflückt in tausend Lenzen, der sich die Seele wie aus früherem Sein entsinnt, verklärt mit gelbem Morgenschein die Tiefen, die das Leben schwarz umgrenzen...?
Sehen Sie, diese Lust aus tausend Lenzen, dieses Haschischparadies darstellen, das wäre große Kunst, aber wir alle reden nur davon, wir schaffen es nicht. Die neue Kunst müßte den Haschisch, das Opium entthronen!«
Ich war überrascht. Niemals hatte ich diesen blassen Menschen so eindringlich mit dem Ton unverkennbarer Aufrichtigkeit reden hören. Und das geschah wegen einer Strophe, die ihn unbefriedigt ließ. Ich war bisher geneigt gewesen, ihn nur für einen gebildeten ästhetischen Dandy zu halten. Nun aber kam es mir fast vor, von ihm einen Schrei nach der Unendlichkeit zu hören aus jenem seltsamen Schmerz heraus, der heute manche Geister verwirrt, die früher in gewissen feineren Richtungen des Christentums Genugtuung fanden, vielleicht heute noch finden würden, wenn nicht bestimmte Kapellen -- wer weiß auf wie lange -- verschlossen wären.
Ich hatte an diesem Abend noch keine Gelegenheit gehabt, den Augen Alta-Carraras zu begegnen, und beobachtete erst jetzt jenes beinahe angestrengte Starren, das außermenschliche Horizonte zu berühren sich abmüht, Ausblicke in künstliche Paradiese sucht, zu denen nur die satanischen Drogen, die der Graf bereits genannt, den Übergang gestatten.
Wir hatten ungefähr gleichzeitig die Mahlzeit beendet, während der Alta-Carrara wieder in die bewußte Zurückhaltung eines einsamen Menschen getreten war, der glaubt, sehr höflich gewesen zu sein, weil er ein paar Worte gesprochen hat.
»Ich werde diesen Abend mit Freunden verbringen«, sagte er plötzlich. »Vielleicht haben Sie Lust und Zeit, an unserer Gesellschaft teilzunehmen?«
Ich war wieder überrascht. Alta-Carrara kannte mich kaum. Er konnte von mir nicht viel mehr mit Sicherheit beurteilen als die Qualitäten meines Schneiders. Eine unüberlegte Höflichkeit war diesem stets bewußten Menschen nicht zuzutrauen. Ich mußte also eine Beziehung annehmen zwischen jener Strophe, die er vielleicht für ein Pantakel meiner Persönlichkeit hielt, und dem Charakter der Gesellschaft, in die er mich einführen wollte.
Wir fuhren nach dem Viertel Batignolles. Unterwegs hoffte ich, einige vorbereitende Bemerkungen über den Freundeskreis Alta-Carraras zu hören. Er sprach indessen mit oberflächlicher, fast graziöser Leichtigkeit über die verschiedensten Dinge, ohne gerade Dummheiten zu sagen. Ich fühlte, daß es ihm nur darum zu tun war, ein neues Stillschweigen zu vermeiden.
Nachdem wir die sechs Treppen eines modernen Mietshauses erstiegen hatten, wies man uns in einen weiten, atelierartigen Raum. In dem dämmerigen Licht rotverschleierter Kerzen gewahrte ich mehrere Männer, die in bequemen, orientalischen Kleidern auf niederen Polstern lagen. Zwischen den Ruhebetten standen Taburetts mit Nargilehs und dampfende Duftschalen. Ein sanfter Geruch brennender Harze vermengte sich mit dem Rauch leichter englischer Zigaretten. An den dunkelroten Wänden hingen tiefschwarze Radierungen und Stiche, deren kaum erkennbare Darstellungen wie die Gesichte eines Alpdrucks auf uns niederstarrten. In den Ecken unterschied ich zwischen fremdartigen Gewächsen altmodische musikalische Instrumente wie seltsame Reptilien. Man bewegte sich kaum bei unserem Eintreten. Leichte Grüße wurden getauscht. Alta-Carrara machte schweigend eine Handbewegung, als stelle er mich vor. Dann ließen wir uns auf Kissen nieder. Von einem zwischen uns stehenden Tischchen nahm der Graf einige Haschischpillen und bot mir lächelnd die Schale.
»Die Umherliegenden«, erklärte er halblaut, »befinden sich in einem Zustand der Angeregtheit, den man nicht Rausch nennen kann. Sie haben nur sehr geringe Dosen Haschisch geschluckt. Sie werden sie in logischen Wortfolgen reden hören, nur vielfachere, seltsamere Zusammenhänge finden sehen, als sie sich sonst erkennen lassen. Wenn wir Glück haben, können wir uns wie in einer Versammlung plötzlich erleuchteter Künstler befinden, denen fabelhafte Worte von den Lippen fließen, von deren Glanz sie morgen kaum selbst noch etwas ahnen. Andere verzichten auf den Genuß des Haschischs und bewundern die Wirkung, die er in den übrigen hervorbringt. Wer dazu imstande ist, wird durch Musik oder seltsame Erzählungen den Vorstellungen der übrigen besondere Richtungen zu geben suchen. Werfen Sie einmal einen Blick durch diese offene Tür in die Nebenräume: Dort befinden sich die, welche völlig in die Abgründe der Unbewußtheit versinken wollen.«
Ich sah in der Dämmerung schlafende Menschen vor venezianischen Spiegeln ausgestreckt.
»Durch die bunten Glasblumen der Spiegel glauben sie in fabelhafte Wasserteiche unterzutauchen«, sagte der Graf. »Die beiden auf Zehen herumgehenden Männer sind geschickte Diener, die sie gegen Kälte und Durst schützen, da sie in ihrer Willenslähmung vorziehen würden, die Lippen verbrennen zu lassen, als das vor ihnen stehende Getränk selbst an den Mund zu führen.«