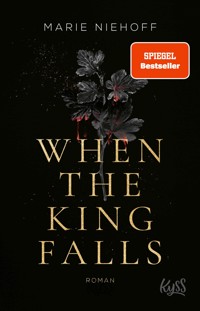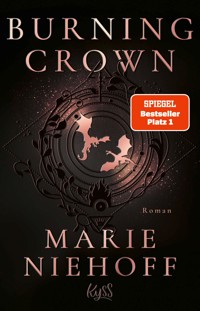
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dragonbound-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine Drachenreiterin liebt nicht – erst recht nicht ihren Drachen. Der Auftakt zur neuen großen Romantasy-Trilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Marie Niehoff. In der Armee von Eldeya sind Beziehungen zwischen Reitern und Drachenwandlern streng verboten. Zuwiderhandlungen werden mit dem Tod bestraft. Doch als Captain Yessa Hayes ein neuer Drache zugeteilt wird, ist ihr sofort klar, dass es schwer wird, diese Regel zu befolgen. Cassim übt eine ungeahnte Anziehungskraft auf sie aus. Und je mehr sie hinter seine verschlossene, misstrauische Fassade blickt, desto heftiger wird das verbotene Knistern zwischen ihnen. Yessa kämpft mit aller Macht gegen ihre wachsenden Gefühle an, denn schon ein falscher Blick könnte ihr Schicksal besiegeln. Nur ahnt sie nicht, dass die größte Gefahr für ihr Leben von Cassim selbst ausgeht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marie Niehoff
Burning Crown
Roman
Über dieses Buch
Eine Drachenreiterin liebt nicht. Erst recht nicht ihren Drachen …
In der Armee von Eldeya sind Beziehungen zwischen Reitern und Drachenwandlern streng verboten. Zuwiderhandlungen werden mit dem Tod bestraft. Doch als Captain Yessa Hayes ein neuer Drache zugeteilt wird, ist ihr sofort klar, dass es schwer wird, diese Regel zu befolgen. Cassim übt eine ungeahnte Anziehungskraft auf sie aus. Und je mehr sie hinter seine verschlossene, misstrauische Fassade blickt, desto heftiger wird das verbotene Knistern zwischen ihnen. Yessa kämpft mit aller Macht gegen ihre wachsenden Gefühle an, denn schon ein falscher Blick könnte ihr Schicksal besiegeln. Nur ahnt sie nicht, dass die größte Gefahr für ihr Leben von Cassim selbst ausgeht …
Verbotene Liebe und dunkle Geheimnisse. Der epische Auftakt der Dragonbound-Trilogie.
Vita
Marie Niehoff, geboren 1996, hegt schon seit ihrer Kindheit eine Faszination für fantastische Geschichten. Diesen darf vor allem eines nicht fehlen: Romantik. Wenn sie nicht gerade schreibt, malt sie, kreiert Moodboards, kümmert sich um ihre unzähligen Zimmerpflanzen oder legt Tarotkarten. Unter anderem Namen hat sie bereits Bücher im New-Adult-Genre veröffentlicht, mit «When The King Falls» und «The Queen Will Rise», der Vampire-Royals-Dilogie, legte sie ihr Fantasy-Debüt vor. Beide Bände stiegen unmittelbar nach Erscheinen auf die Spiegel-Bestsellerliste ein, Band 2 erreichte sogar Platz 1. In ihrer neuen Dragonbound-Trilogie, beginnend mit «Burning Crown», ist auch sie dem Drachen-Hype verfallen. Auf Instagram und TikTok ist sie unter @marienie.schreibt zu finden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Mottozitat aus «Sin» von Forugh Farrokhzad, Selected Poems of Forugh Farrokhzad – Edited and Translated by Sholeh Wolpé, Fayetteville, 2010
Sensitivity-Reading Nora Bendzko
Sensitivity-Beratung Anya Omah
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01945-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/burningcrown eine Content-Note.
Für Emy,
die mich auch ohne Worte versteht.
I have sinned a rapturous sin
in a warm enflamed embrace,
sinned in a pair of vindictive arms,
arms violent and ablaze.
Forugh Farrokhzad, Sin
Playlist
Tommee Profitt, Fleurie – Soldier
UNSECRET, MØØNWATER – Only The Beginning
Klergy, Valerie Broussard – The Beginning of the End
BEGINNERS, Klergy – Dangerous Game
Ganyos – Cross My Heart (Hope to Die)
Ely Eira – Secrets Kill
Jonathan Buchanan, Michael Lister – Arise Like Fire
Astyria – The Games We Play
2WEI, Edda Hayes – Blindside
Isamar – Set Us Free
Christian Reindl, Power-Haus, Dream Harlowe – Fighter
Forts, 2WEI, Tiffany Aris – Still Here
UNSECRET, Erin McCarley – Feels Like Falling
Kendra Dantes – Insane
Rachel Taylor – Light A Fire
Saint Middleton, PYPR, UNSECRET – Time Is Running Out
Klergy – World on Fire
Astyria – Illuminate
Ursine Vulpine, Annaca – Without You (Extended)
Generdyn, Ruth Simard – Let It Burn
Kapitel 1
Soldier
Cassim
Vielleicht gibt es wirklich keine beschissenen Götter mehr. Zumindest keine, die mir gnädig sind.
Schon mein ganzes Leben lang versucht das Schicksal, mir dieses Wissen einzuprügeln, und auch heute erinnert es mich wieder mit ausgestrecktem Zeigefinger daran. Es hält mir meine Machtlosigkeit vor, als hätte ich vergessen, dass sie existiert. Als läge sie mir nicht schon seit meiner Geburt wie eine Schlinge um den Hals, bereit, mir jeden Moment die Luft abzudrücken.
Kalter Nieselregen peitscht mir ins Gesicht, mischt sich mit dem Angstschweiß in meinem Nacken. Der Wind zerrt an meiner Kapuze, und das Bedürfnis, mir die zu enge fremde Uniform vom Leib zu reißen, wird immer stärker.
Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Das konnte ich noch nie.
Hinter mir ist das Armeecamp in die Stille der Nacht gehüllt. Es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Ein letzter Moment des Friedens, bevor meine Taten sich wie ein Inferno durch die tristen braunen Zelte brennen werden. Sofern ich erfolgreich bin. Denn es ist nicht mehr lang bis Sonnenaufgang. Mir läuft die verdammte Zeit davon.
Zum wiederholten Mal löse ich meinen Blick vom Lagerfeuer vor mir und starre in die Dunkelheit dahinter. Noch immer regt sich nichts, und allmählich wird meine Unruhe unerträglich. Sie hätten schon vor Stunden hier sein sollen. Wenn sie nicht bald kommen, ist unser gesamter Plan ruiniert. Noch eine Chance wie diese werden wir so schnell nicht kriegen. Wie soll ich das den anderen erklären? Nachdem ich ihnen Hoffnung gemacht, ihnen Freiheit versprochen habe?
Ein Geräusch lässt mich erstarren. Ich lausche angestrengt und versuche, das Knacken des Feuers und das Heulen des Windes um mich herum auszublenden. Habe ich es mir nur eingebildet? Oder war das wirklich …
Ja.
Da ist es wieder. Lauter jetzt, weil es stetig näher kommt. Das vertraute Schlagen von Schwingen.
Ich stehe auf, und just in diesem Moment erhellt eine Feuerfontäne den Nachthimmel. Die karge Mooslandschaft vor dem Camp wird in orangefarbenes Licht getaucht. Nasse Schuppen blitzen in der Dunkelheit auf.
Mein Herzschlag beschleunigt sich, doch ich bemühe mich um Ruhe. Jedes Anzeichen von Nervosität könnte mich verraten. Und dann stirbt nicht nur unser Plan, sondern ziemlich sicher auch ich.
Links und rechts in der Ferne erheben sich zwei weitere Feuerfontänen. Es sind unsere Wachen, die etwas außerhalb des Camps stationiert sind und mit ihrem Signal dem nahenden Boten die Erlaubnis zur Landung geben.
Langsam trete ich um das Lagerfeuer herum, sodass ich das Licht der Flammen im Rücken habe. Dann ziehe ich mir die Kapuze tiefer ins Gesicht. Die Jacke der fremden Uniform spannt an meinen Schultern, sodass ich bei jeder Bewegung Angst habe, sie könnte reißen. Ich kann nur hoffen, dass der schwere Wollumhang und die Dunkelheit reichen, um alles Verräterische zu verbergen.
Die Flügelschläge sind nun so nah, dass ich trotz des Windes den Luftstoß spüren kann, den sie verursachen. Trotzdem sehe ich den Drachen erst, als er fast direkt vor mir ist.
Der Feuerschein bricht sich auf den Schuppen und lässt es aussehen, als würde ein Funkenregen vor mir niedergehen. Ein Kopf mit langen gewundenen Hörnern löst sich aus der Dunkelheit. Ledrige schwarze Schwingen stemmen sich gegen den Wind. Orangerote Augen fixieren mich. Und dann setzen zwei gigantische krallenbesetzte Pranken fast geräuschlos auf dem Boden auf.
Mit einem Mal ist die Luft wie geladen. Magie vibriert zwischen uns – eine Urgewalt, die nur darauf wartet, entfesselt zu werden. Aber jedes noch so kleine Körnchen von ihr liegt in den Händen des Mannes, der soeben aus dem Sattel steigt.
«Entschuldige die Verspätung», brummt er zur Begrüßung und zieht so meine Aufmerksamkeit auf sich. Er klettert ungelenk über einen der Flügel und bleibt dabei mit dem Stiefel an der empfindlichen Membran hängen. Der Drache kneift vor Schmerz die Augen zu, doch der Reiter scheint es nicht einmal zu bemerken. Ich beiße mir auf die Zunge und verbiete mir jeglichen Kommentar.
Wie so oft.
Wie immer.
Gehorsam ist das Einzige, was uns momentan am Leben hält. Aber Wut und Hoffnung halten uns zusammen. Also konzentriere ich mich weiterhin auf Letztere. Stelle mir vor, wo ich morgen sein könnte, wenn ich jetzt Ruhe bewahre.
«Der verdammte Gegenwind hat mich Stunden gekostet», faselt der Fremde weiter und kommt endlich auf dem Boden an – zum Glück, ohne seinem Drachen noch irgendwelche ernsthaften Verletzungen zuzufügen. «Heute verzichte ich mal auf den Met, Daryn. Ich will hier weg, bevor das Wetter noch schlechter wird.»
Er lacht. Ich hingegen versuche, mir mein Zähneknirschen nicht anmerken zu lassen. Sie trinken zusammen? Verdammte Scheiße. Ich dachte, ich könnte mich ohne größere Probleme als der übliche Bote ausgeben. Ich habe nicht erwartet, dass sie mehr als ein paar Worte wechseln. Warum bin ich davon ausgegangen, diese Dumpfbirnen würden ihre Aufgaben ernst nehmen?
So wird das nichts. Kurswechsel.
«Alles klar», erwidere ich, und der Fremde, der sich soeben zu mir umgedreht hat, stockt mitten in der Bewegung.
«Du bist nicht Daryn», stellt er überrascht fest. Er mustert mich und kommt näher, sodass ich im Schein des Feuers sein Gesicht erkennen kann. Blaue Augen, buschige Brauen und ein schlecht gestutzter Bart, durch dessen Lücken seine weiße Haut durchschimmert.
«Daryn liegt flach», erkläre ich schlicht. «Hat vermutlich zu viel gesoffen. Ich übernehme heute für ihn, und nichts für ungut, aber ich würde es ebenfalls begrüßen, wenn wir das schnell hinter uns bringen könnten.»
«Scheiße.» Der Bote runzelt die Stirn und stiert mich weiter an. Im Halbdunkel kann er vermutlich nicht viel erkennen, aber es macht mich dennoch nervös. Ist er misstrauisch geworden? Oder habe ich ihn mit meiner leicht ruppigen Antwort verunsichert? «Mit wem trinkt der Hund mir denn fremd?», fragt er jetzt und lacht. Es klingt unecht. «Richte ihm aus, dass ich nächstes Mal eine Entschädigung erwarte.»
Bei den Göttern, kann dieser Typ nicht einfach die Klappe halten und wieder abhauen? «So gut kenne ich ihn nicht», erwidere ich genervt. «Die Nachricht?» Ich strecke auffordernd meine Hand aus.
«Nicht so zum Scherzen aufgelegt, was?», witzelt er weiter, doch ein leicht verlegener Ton schleicht sich in seine Stimme. Er öffnet seinen Umhang und holt einen Umschlag aus seiner Jackentasche. «Hast noch was vor heut Nacht?», fragt er. «Wartet jemand Besonderes im Zelt auf dich?» Er zwinkert mir zu.
«Das geht dich nichts an», weise ich ihn zurecht. «Primär habe ich keine Lust, vom General für die verspäteten Informationen verantwortlich gemacht zu werden.» Ich nehme ihm den Umschlag ab, bevor er es sich anders überlegen kann, und stecke ihn ein.
«Ich kann nichts dafür», verteidigt er sich. «Wie gesagt, der Gegenwind war …»
«Ich weiß», unterbreche ich ihn. «Schon gut. Dafür bist du immerhin umso schneller wieder zurück in deinem Lager. Guten Flug.»
Er zieht empört die Brauen zusammen, als ich ihn so abkanzle, geht jedoch nicht darauf ein. Stattdessen schüttelt er nur den Kopf. «Na dann. Sag Daryn einen Gruß. Ich hoffe, er ist schnell wieder auf den Beinen.»
«Mhm», brumme ich nur, und endlich gibt er Ruhe. Ich salutiere zum Abschied und sehe zu, wie der Soldat wieder auf seinen Drachen steigt. Er mustert mich noch einmal von Kopf bis Fuß, als läge ihm noch etwas auf der Zunge. Dann erhebt er sich ohne ein Wort des Abschieds in die Lüfte und verschwindet in die Dunkelheit der Nacht.
Tief atme ich durch. Jetzt, wo die erste Anspannung von mir abfällt, spüre ich das Hämmern meines Herzens mit unangenehmer Deutlichkeit. Das hier war der einfache Teil, und schon er lief nicht so, wie ich es gedacht hatte. Ich habe ein ungutes Gefühl, was den Rest meiner Pläne angeht. Aber wenigstens einen Lichtblick gibt es – es hat aufgehört zu nieseln.
Ich warte einen Moment, bis ich mir sicher bin, dass der Bote nicht zurückkommt, und lausche dann nach unseren eigenen Wachtposten. Ich kann sie nicht hören, und das muss für den Moment reichen. In der Dunkelheit ist es unmöglich, ihre Position auszumachen, mehr Sicherheit werde ich nicht kriegen.
Ich umrunde das Lagerfeuer und hebe die Decke über der Gestalt an, die hinter einigen größeren Steinen im Schatten liegt. Der Typ, der dann wohl Daryn sein muss, rührt sich nicht. Er hat die Augen geschlossen, und Speichel rinnt ihm aus dem halb geöffneten Mund.
«Fuck», murmle ich und taste nach seinem Puls. Das sieht nicht gut aus. Falls er an dem Betäubungsmittel verreckt, war alles umsonst. Aber seine Haut ist noch warm, und ich spüre ein stetiges, wenn auch schwaches Pulsieren unter meinen Fingerspitzen. Glück gehabt.
Ich hole meinen Beutel aus dem Versteck und ziehe die Decke wieder über Daryns Kopf. Dann gehe ich vor dem Lagerfeuer auf die Knie und besehe mir den Brief, den der Bote eben gebracht hat. Es ist schlichtes Papier, genau wie der andere, den ich vor fast zwei Monaten aus dem Zelt des Generals gestohlen habe. Der einzige Unterschied ist, dass hier das Siegel noch nicht gebrochen ist. Es besteht aus tiefem, mattschwarzem Wachs, in das eine Hand mit einer Flamme eingeprägt wurde. Das Emblem unserer Armee.
Mit der freien Hand hole ich ein sauberes Leinentuch aus meinem Beutel und breite es auf meinem Schoß aus. Dann ziehe ich das Taschenmesser aus meiner Brusttasche und schiebe die Klinge vorsichtig unter die Kante des Siegels.
Die Hitze des nahen Feuers mischt sich mit der meiner Nervosität. Binnen Sekunden bin ich nass geschwitzt, aber ich konzentriere mich auf meine Aufgabe. Das Siegel ist eine weitere Variable, die den ganzen Plan zerstören könnte. Bricht es, ist es vorbei. Und zwar nicht nur für heute Nacht, sondern womöglich für Monate. Wenn sie bemerken, dass jemand die Nachrichten sabotiert, werden sie wachsamer.
Ich versuche, mit der Klinge das Wachs vom Papier zu trennen, doch es hat sich in die Fasern gefressen, und auf der rechten Seite will es sich einfach nicht lösen. Noch dazu wird der Wind immer stärker und reißt an dem Brief. Verfluchte Scheiße.
Plötzlich gibt das Wachs nach. Ich rutsche mit der Klinge ein Stück ab, und mein Herz macht einen unangenehmen Satz.
Einen Moment lang bin ich wie erstarrt, sehe mich schon alles wieder einpacken, meine Spuren verwischen und den anderen gestehen, dass ich es ruiniert habe.
Aber das Siegel bleibt ganz. Es landet unversehrt auf dem Leinentuch, und ich atme keuchend auf. Den nächsten Fluch verkneife ich mir.
«Können wir einen Deal machen?», murmle ich stattdessen und fixiere die Flammen vor mir. Bisher waren die Götter zwar nie sonderlich hilfsbereit, aber man kann es ja mal versuchen. «Ihr hört auf, mir alles so schwer zu machen, und ich höre auf, euch eure Existenz abzusprechen. Wie wär’s?»
So funktioniert das nicht, Cassim, tönt mir die Stimme meiner Mutter in den Ohren. Sie klingt gutmütig, und gleichzeitig schwingt Schmerz in ihr mit. Genau dieser Tonfall ist es, den ich bis heute jedes Mal höre, wenn ich an sie denke. Den ich unwiderruflich mit ihr verbinde. Du kannst die Götter nicht erpressen, erklärt sie weiter, und ich bin wieder zehn und stehe mit einem Eimer Wasser vor unserem bröckelnden Kamin.
Warum nicht?, frage ich, und noch heute spüre ich die Wut, die damals durch meinen Körper gerauscht ist. Mutters warme Hände legen sich an meine Wangen. Sie steht hinter mir, beugt sich zu mir herunter und drückt mir einen Kuss aufs Haar. Ihr Flüstern jagt Gänsehaut über meine Arme.
Wenn sie uns helfen könnten, hätten sie es längst getan, mein Glutjunge.
Ihre Worte machten mich nur noch wütender. Brachten mich umso mehr in Versuchung, die Flammen in unserem Kamin zu ertränken. Denn lieber hatte ich gar keine Götter als welche, die uns leiden ließen.
Ich schüttle die Erinnerung ab. Schlucke sie herunter, gemeinsam mit all dem Schmerz, dem Hass, der Verbitterung. Und der Frage, was meine Mutter wohl denken würde, wenn sie wüsste, dass von ihrem Glutjungen nichts als Asche übrig ist.
Mit zitternden Fingern öffne ich den Brief, und mein Blick fällt zuerst auf die Unterschrift. Ich erwarte bereits die nächste Komplikation. Stattdessen durchströmt mich Erleichterung. Es ist dieselbe Signatur wie die, die ich seit Wochen heimlich übe.
Immerhin.
Alles andere wäre jetzt auch reichlich beschissen gewesen.
Missmutig werfe ich einen Blick zum Feuer und hebe eine Braue. «Das heißt noch gar nichts», lasse ich die Flammen wissen.
Ich komme mir lächerlich dabei vor, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es wenigstens versuchen zu müssen. Und sei es nur für meine Mutter, die bis zu ihrem Tod mit jeder Faser ihres Seins an unsere alten Götter geglaubt hat. Vergeblich.
Kopfschüttelnd widme ich mich wieder dem Papier und lese den Rest der Botschaft. Mit jedem Wort zieht sich mein Magen weiter zusammen.
Wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen. Aber mir war nicht klar, wie groß es wirklich ist. Die Zahlen so zu sehen, schwarz auf weiß, und zu wissen, dass wir uns freiwillig dieser Gefahr aussetzen, lässt mich unweigerlich an meinen Plänen zweifeln. Vielleicht machen wir doch einen Fehler. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fühlt es sich an, als würde ich uns direkt ins Verderben führen. Der Preis, wenn wir scheitern, ist zu hoch.
Und dennoch … es ist der einzige Weg in die Freiheit. Der einzige Weg, meine Versprechen zu halten.
Ich öffne wieder meinen Beutel und hole die restlichen Utensilien heraus. Ein leeres Blatt Papier, Tinte und einen Federkiel – alles innerhalb der letzten Wochen nach und nach aus dem Zelt des Generals entwendet. Ich beschwere die Originalnachricht mit einem Stein, damit der verdammte Wind sie nicht wegweht, und beginne, eine neue Version zu fälschen.
Es ist nicht perfekt, dafür hatte ich viel zu wenig Zeit zum Üben. Manche der Buchstaben sehen nicht ganz so aus, wie der eigentliche Verfasser sie geschrieben hätte, und an einer Stelle verschmiert die Tinte leicht, weil der Sturm mir Dreck über den Brief weht. Aber die Unterschrift sieht ihrem Vorbild täuschend ähnlich, und ich hoffe einfach, dass das reicht.
Es muss reichen.
Ich warte einen schier endlosen Moment, bis die Tinte getrocknet ist. Dann falte ich den Brief und widme mich dem Wachssiegel. Missmutig betrachte ich die Flammen vor mir, die wild im Wind tanzen. Soll ich es riskieren …?
Ich schaue mich noch einmal um, suche die Dunkelheit nach Bewegungen ab. Seit Stunden begehe ich ein Verbrechen nach dem anderen, aber das hier ist schlimmer. Gefährlicher. Niemand in Eldeya darf je erfahren, dass ich meine eigene Magie besitze.
Tief atme ich durch. Eine kleine Flamme erscheint auf meiner Fingerspitze, und sofort beginnt der Boden zu vibrieren. Wie immer fühlt es sich an, als würde irgendetwas tief unter der Erde zum Leben erwachen. Ein Ungetüm, das weder ich noch irgendjemand sonst kontrollieren könnte. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist ein zusätzlicher guter Grund, meine Magie verborgen zu halten. Ich habe Angst davor, was ich wecken könnte, würde ich weiter gehen.
Eilig schmelze ich die Unterseite des Siegels an, bis es weich und biegsam ist. Dann drücke ich es fest auf das Papier, halte kurz inne und stelle dann erleichtert fest, dass es tatsächlich hält. Das Vibrieren im Boden ebbt ab. Es war so leicht, dass vermutlich nur ich es gespürt habe, aber ich schaue mich trotzdem noch einmal um und lausche.
Stille.
Nur mein Puls pocht mir unangenehm laut in den Ohren.
Eilig verbrenne ich die Originalnachricht und stopfe den Rest meiner Utensilien zurück in den Beutel. Ich schiebe ihn wieder unter die Decke, werfe einen letzten prüfenden Blick auf Daryn und eile mit der gefälschten Botschaft ins Camp.
Der Wind weht mir jetzt entgegen und reißt an meinem Umhang. Ich nehme es als Anlass, mir die Kapuze tiefer ins Gesicht zu ziehen und meinen Gang zu beschleunigen. Am Horizont ist schon ein heller Schleier zu erahnen, aber noch regt sich zwischen den Zelten nicht viel. Nur hin und wieder jagen mir entfernte Schritte Gänsehaut über die Arme.
Auf halbem Weg zum Zelt des Generals beginnt es erneut zu regnen, diesmal heftiger. Donnergrollen erklingt in der Ferne, und vereinzelt durchzucken Blitze die Dunkelheit. Ein paar der Soldaten kommen aus ihren Zelten, um einen prüfenden Blick in den Himmel zu werfen, aber niemand hält mich auf. Ich bin nur ein Bote, der eine Nachricht überbringt. Zumindest wirkt es so. Der General muss mir lediglich ins Gesicht schauen, um zu bemerken, dass das nicht stimmt. Gleich wird sich entscheiden, ob heute andere ihr Leben lassen oder nur ich.
Das Zelt kommt in Sicht, und ich senke den Kopf. Mein Herz rast, und ich muss mich bemühen, meine Atmung zu kontrollieren. Wenigstens gibt mir der immer stärker werdende Regen einen guten Grund, die Kapuze aufzulassen, während ich auf die beiden Wachen am Eingang zugehe.
Vor ihnen bleibe ich stehen und salutiere. Aus den Augenwinkeln nehme ich wahr, wie sie es erwidern, doch ich wage es trotz der Dunkelheit nicht, den Kopf zu heben. Stattdessen öffne ich meinen Umhang ein Stück weit, sodass sie das Papier mit dem schwarzen Siegel sehen können.
«Eine Botschaft für den General», verkünde ich knapp.
Sie geben den Eingang frei, und ich zögere nicht. Eilig schiebe ich die Zeltklappen beiseite, ziehe dabei gezwungenermaßen meine Kapuze ab und trete ein. Den dunklen, bitterkalten Vorraum durchquere ich mit zwei zielsicheren Schritten, aber ich kann nicht anders, als dabei einen Blick zur Seite zu werfen. Zu dem schmalen Schlaflager in der Ecke, aus dem mich ein Augenpaar beobachtet.
Meine Brust wird eng. Noch eine Person, die sich auf mich verlässt.
Ich betrete den Hauptraum und werde sofort von wohliger Wärme empfangen. Das Zelt des Generals ist deutlich größer als die der niederen Ränge. Zusätzlich zu dem für Armeeverhältnisse beinahe luxuriös anmutenden Schlaflager aus dicken Fellen und den fein säuberlich aufgeschichteten Basaltsteinen, mit denen der Raum beheizt wird, findet sich hier auch ein Schreibtisch. Eine Öllampe wirft ein schummriges Licht auf die Wände und erhellt General Harlows Gesicht, der am Schreibtisch sitzt und gerade eine Karte studiert. Er sieht nicht auf, als ich hereinkomme, und ich senke eilig den Blick.
«General», grüße ich mit leicht verstellter Stimme und salutiere. Dann ziehe ich den Brief aus meiner Tasche. «Eine Botschaft für Sie.» Ich trete an seinen Tisch und lege das dicke Papier darauf ab.
Der General hebt leicht den Kopf, und ich erstarre unweigerlich.
Ich sollte mich umdrehen, bevor er mein Gesicht sieht und fragt, was mit dem eigentlichen Boten passiert ist. Doch ich will keine hektische Bewegung machen und so sein Misstrauen wecken.
Mein Herz rast. Panik rauscht durch meine Adern und verhindert, dass ich normal atmen kann.
Beruhig dich. Er kennt nicht jedes Gesicht im Camp.
Und wenn doch?
Langsam mache ich einen Schritt rückwärts. Ich rechne fest damit, dass der General jeden Moment zu mir aufsieht. Stattdessen greift er nur nach dem Brief und bedeutet mir mit einer müden Handbewegung, zu gehen.
Ich unterdrücke ein erleichtertes Aufatmen. Wieder salutiere ich, wende mich ab und verlasse zügigen Schrittes das Zelt. Im Vorraum folgt mir erneut ein Blick aus braunen Augen. Wir tauschen ein flüchtiges Nicken, bevor ich mir die Kapuze wieder über den Kopf ziehe und nach draußen trete.
Die beiden Wachen halten mich nicht auf, und ich schaue mich auch nicht noch einmal nach ihnen um. Es gibt keinen Grund, noch mehr zu riskieren, nur um irgendwelchen Höflichkeiten Genüge zu tun. Meinetwegen können sie sich morgen bei Daryn beschweren. Bis dahin sind wir längst über alle Berge. Wortwörtlich.
Aber obwohl das Schwierigste jetzt geschafft ist, will sich keine Erleichterung bei mir einstellen. Wie auch, wenn nach wie vor so viel schiefgehen kann?
In der Ferne erklingt erneut dumpfes Donnergrollen. Ich beschleunige meine Schritte ein letztes Mal, ignoriere meine zitternden Knie.
Als ich wieder am Lagerfeuer ankomme, hat der Regen die Flammen gelöscht. Im Schutz der Dunkelheit reiße ich mir Daryns Uniform vom Leib, tausche sie mit meiner eigenen und ziehe sie ihm wieder an.
Er wacht nicht auf, aber sein Puls hat sich normalisiert. Ich mache mir eine gedankliche Notiz, nächstes Mal eine etwas geringere Dosis des Betäubungsmittels zu verwenden, und drapiere eine halb leere Schnapsflasche in seiner Hand. Mit einem letzten prüfenden Blick versichere ich mich, dass ich nichts liegen gelassen habe. Dann schnappe ich mir meinen Beutel und verschwinde zwischen den Zelten.
Wenn Daryn in ein paar Stunden aufwacht, wird er hoffentlich denken, er hätte zu viel gesoffen und seine Schicht deshalb verschlafen. Natürlich wird er sich fragen, was mit der Botschaft passiert ist, die er in Empfang nehmen sollte, aber er wird sich zu sehr vor den Konsequenzen fürchten, um jemanden darauf anzusprechen – erst recht nicht den General. Bis herauskommt, dass der Brief abgefangen wurde, ist es längst zu spät.
Mittlerweile ist der Himmel deutlich heller geworden. Der Sonnenaufgang kommt viel zu schnell, was sich in einem nervösen Flattern in meiner Magengrube niederschlägt, aber eine letzte Station habe ich noch vor mir.
Auf halbem Weg zu meinem eigenen Zelt bleibe ich an einem heruntergebrannten Lagerfeuer stehen und rüttle den Soldaten an der Schulter, der dort völlig durchnässt an einen Zeltpfeiler gelehnt im Sitzen eingeschlafen ist. Ich würde ja sagen, sie hätten ihn ablösen sollen, aber so, wie ich ihn kenne, hat er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
«Ruben.»
Er öffnet müde die Augen und blinzelt mich an. Kaum dass er mich erkennt, beginnt er zu strahlen, und mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen.
Ruben ist gerade mal siebzehn und so voller Hoffnung, dass es wehtut. Als er vor einem Monat neu in unsere Einheit kam, waren sich die anderen nicht sicher, ob wir ihm trauen können. Aber mir war vom ersten Moment an klar, dass ich ihn nicht opfern kann. Für keine Freiheit der Welt. Er ist so verdammt unschuldig. Er erinnert mich daran, wofür wir kämpfen.
Wenn ich Ruben ansehe, ist da nichts mehr von dieser lodernden Wut, die mich immerzu begleitet. Keine Rachegelüste mehr, kein Hass auf die Götter oder unseren Hochstapler von einem König.
Wenn ich Ruben ansehe, dann verspüre ich wieder Hoffnung. Ein Gefühl, von dem ich dachte, es wäre mit meiner Mutter gestorben.
Er ist so schnell hellwach, dass selbst ich mit meinen acht Jahren Armeeerfahrung beeindruckt bin. Der Junge wird ein großartiger Soldat. Für einen anderen König. «Du bist da!», flüstert er aufgeregt. «Scheiße, ich dachte, sie haben dich erwischt! Hast du es geschafft? Hat alles geklappt? Fliegen wir?»
Normalerweise würde ich ihm jetzt sagen, dass er die Klappe halten soll. Nicht weil er mich nervt, sondern weil uns wer weiß wer hören könnte. Aber nicht heute. Aus irgendeinem Grund bringe ich es nicht über mich, ihn zurechtzuweisen. Ich sehe die Botschaft aus dem Nachbarcamp wieder vor mir. Die Gefahr, die ich so bereitwillig für unsere Freiheit akzeptiert habe, nur um mich jetzt immer wieder zu fragen, ob es die richtige Entscheidung war.
«Wir fliegen», bestätige ich leise. «Ich habe nur so lange gebraucht, weil der Bote zu spät kam. Gib den anderen Bescheid. Sag ihnen, sie sollen besonders vorsichtig sein. Es werden mehr Soldaten da sein, als wir dachten.»
Rubens Augen werden groß. «Noch mehr?»
Meine Kehle wird eng. Ich bin für diesen Jungen verantwortlich. Aber ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren. Das wusste er von Anfang an, und dennoch …
«Wenn du es doch nicht riskieren willst …»
Ich bin mir nicht sicher, was genau seine sonst hellbraunen Wangen nun rot färbt – ob es Scham ist oder doch Empörung. So oder so, Ruben scheint nicht daran zu denken, mein Angebot anzunehmen. «Auf gar keinen Fall! Ich komme mit.»
«In Ordnung.» Es steht mir nicht zu, seine Entscheidung zu hinterfragen. Also nicke ich nur hinüber zum Rest des Camps. «Dann gib den anderen Bescheid. Wir sehen uns auf dem Rüstplatz.»
Ruben steht auf, zögert jedoch. Ich sehe, wie er schluckt. Weil unter all der Überzeugung eben doch eine dicke Schicht Angst verborgen liegt. Ich kenne das Gefühl nur zu gut.
«Glaubst du, wir schaffen es alle?», haucht er kaum hörbar.
Einen Moment lang schweige ich und lasse nur das Prasseln des Regens die Stille zwischen uns füllen. Was soll ich darauf schon antworten? Ich bezweifle, dass die Wahrheit es besser macht. «Ich glaube, manche Dinge sind es wert, für sie zu sterben», erwidere ich schließlich ehrlich.
Ruben presst die Lippen zusammen und nickt. Ich klopfe ihm auf die Schulter, und dann bleibt meine Hand dort liegen. Will sich nicht ganz von ihm lösen. Ihn noch nicht ganz seinem Schicksal überlassen, wie auch immer es aussehen mag.
Unsicher schaut er zu mir auf, und kurz entschlossen ziehe ich ihn an meine Brust.
Sofort schlingt er beide Arme um meine Mitte. Ich kann spüren, wie angespannt sein gesamter Körper ist. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, wer diese Umarmung gerade mehr braucht – er oder ich.
«Wir schaffen das», flüstere ich ihm zu. «Für die Krone.»
«Für die Krone», wiederholt er heiser und löst sich wieder von mir. «Bis später.» Er wendet sich ab, ohne mir noch einmal ins Gesicht zu sehen. Vermutlich will er seine Tränen verbergen. Dabei würde ich ihn nicht für sie verurteilen. Eher beneiden. Meine eigenen habe ich so effektiv zu unterdrücken gelernt, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, irgendwann an ihnen ersticken zu müssen.
Ein letzter Blick gen Himmel sagt mir, dass ich viel zu spät dran bin. Mit zugeschnürter Kehle und schwerem Herzen mache ich mich auf den Rückweg zu meinem Zelt.
Zu meiner Erleichterung brennt drinnen noch kein Licht. Ich habe es tatsächlich geschafft. Meine Aufgabe ist erfüllt. Und was nun passiert, liegt außerhalb meiner Kontrolle.
Leise schiebe ich eine der Zeltklappen auf, husche ins Innere und verstecke den Beutel mit der Feder und dem Tintenfässchen unter meinem Schlafsack. Vermutlich hätte ich diese Beweise verschwinden lassen sollen, aber ich wollte nicht riskieren, dass mich jemand dabei erwischt. Das Versteck hat mir wochenlang gute Dienste erwiesen. Es wird auch heute Nacht noch ausreichen.
Erst als nichts mehr von meinem Beutel zu sehen ist, schäle ich mich aus der triefend nassen Uniform. Der Regen prasselt lautstark auf das Zeltdach und beruhigt meine rasenden Gedanken. Wenn alles gut geht, stehen nur ein paar Stunden zwischen mir und meiner Freiheit. Und eventuell bekomme ich sogar noch ein wenig Schlaf.
«Wo warst du?»
Lieutenant Walshs eisige Stimme lässt mich erstarren. Ich bin schon oberkörperfrei und drehe mich langsam zu ihm um, mein nasses Unterhemd noch in der Hand. Über das Geräusch des Regens muss ich überhört haben, wie er reingekommen ist. Er steht im Durchgang zwischen dem Hauptzelt und dem kleinen Vorraum, in dem ich schlafe, und hält mit einer Hand die Zwischenplane auf.
In der Dunkelheit kann ich sein Gesicht nicht erkennen, doch ich weiß trotzdem, was ihn lenkt. Kann es bereits an seiner Haltung ablesen.
Wut. Abscheu. Der krankhafte Wunsch nach Gewalt.
«Ich konnte nicht schlafen», lüge ich.
Er macht einen Schritt auf mich zu, und ich ziehe instinktiv die Schultern hoch. Die Durchgangsklappe fällt hinter ihm zu, und auf einmal wird der Raum winzig. Erdrückend. Ich kann nicht atmen, wenn Walsh so vor mir steht. Kann nicht denken, wenn sein Blick auf mir ruht.
«Und?», fragt er harsch. «Warum verlässt du dann das Zelt?»
«Ich wollte einfach ein bisschen frische Luft schnappen.»
Walsh baut sich vor mir auf. Er ist ein paar Zentimeter kleiner als ich, doch es tut der Angst, die er in mir schürt, keinen Abbruch. Dabei ist es nicht mal eine Angst im eigentlichen Sinne. Ich empfinde nichts als Abscheu für diesen Mann. Aber mein Körper weiß mittlerweile, wie er auf ihn reagieren muss. Er rechnet mit Schmerzen, wenn er ihn sieht, begibt sich sofort in Abwehrhaltung und wappnet sich für das, was Walsh tun wird.
«Habe ich dir das erlaubt?»
Ich weiß bereits, dass ich verloren habe. Ich wusste es schon in dem Moment, in dem ich seine Stimme gehört habe, aber ein naiver Teil von mir hat noch gehofft, die Nacht ohne einen seiner Ausfälle zu überstehen. Doch spätestens mit seiner letzten Frage ist klar, dass er nicht wieder schlafen gehen wird, ohne mir seine Dominanz bewiesen zu haben.
«Nein», antworte ich durch zusammengebissene Zähne, und der Schmerz ist da, noch bevor ich das Wort ganz über die Lippen gebracht habe. Walshs Faust trifft mich in die Magengrube, und ich krümme mich stöhnend zusammen.
Es gab eine Zeit, da habe ich versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Ich habe jeden Muskel angespannt und mich darauf konzentriert, Walsh so wenig Befriedigung wie möglich zu schenken. Erfolglos. Denn es sorgte nur dafür, dass er immer härter zuschlug, bis ich blutend und röchelnd vor ihm lag und nicht mehr anders konnte, als ihn um Vergebung anzuflehen.
Seit ich mitspiele, tut er das seltener. Aber selten ist nicht nie, und ich muss mich täglich fragen, wann wieder ein Moment kommt, in dem ihm ein paar Schläge nicht mehr reichen. Vielleicht heute. Bei meinem Glück genießt er dieses letzte Mal in vollen Zügen, ohne zu realisieren, dass er mich danach nie wieder anrühren wird.
Wer weiß – womöglich ist das der Preis dafür, dass vorhin alles funktioniert hat. Vielleicht helfen uns die Götter normalerweise nicht, weil sie nicht geben können, ohne auch zu nehmen.
«Es ist alles Teil ihres Plans», würde meine Mutter sagen. «Sie haben dich stark gemacht, damit du für sie kämpfen kannst, mein Glutjunge. Aber kämpfen bedeutet auch leiden.»
Dieser traurige Tonfall in ihrer Stimme … Weil sie jeden Schmerz, den ich empfunden habe, mitempfunden hat.
«Es wird nicht für immer sein.»
Wie oft sie diesen Satz gesagt hat. Wie oft ich ihn mir in Erinnerung rufen musste …
«Verzeihung», knurre ich, richte mich ein Stück weit auf und bekomme prompt noch einen Schlag ab. Fuck.
«Auf die Knie», fordert Walsh hart.
«Aber wir müssen später …»
«Ich sagte, auf die Knie!», brüllt er und schneidet mir damit das Wort ab. Er stößt mich grob an der Schulter, sodass ich über meinen Schlafsack stolpere und rücklings auf dem harten Zeltboden lande. Walsh baut sich vor mir auf und schaut mit starrem Blick auf mich herab. «Dachtest du, du hättest mit dem Einsatz später einen Freifahrtschein? Du wirst fliegen, selbst wenn ich dich blutig schlage. Das passiert, wenn du dich mir widersetzt, Cassim. Es ist nicht mein Scheißproblem, dass du diese Lektion einfach nicht lernst.»
Heiße Wut flutet meinen Körper. Alles in mir schreit danach, diesem Wichser an die Gurgel zu gehen und ihn einfach zu erwürgen. So lang zuzudrücken, bis seine geheuchelte Überlegenheit mit ihm erstickt. Mal sehen, wer dann um Vergebung bettelt.
Stattdessen rapple ich mich widerwillig auf und knie mich vor ihn. Ich sage kein Wort. Ich schaue ihn nicht mal an. Ich sammle meine Kräfte, statt zuzulassen, dass er mir noch mehr nimmt.
Es wird nicht für immer sein.
«Geht doch. Gib mir deinen Gürtel.»
Sämtliche meiner Muskeln spannen sich bei diesen Worten an.
Wir wissen beide, was jetzt passiert. Und obwohl ich diese Folter schon tausendmal über mich ergehen lassen habe, zittern dennoch meine Hände, als ich meinen Gürtel öffne und ihn Walsh reiche.
Es wird nicht für immer sein.
Es wird nicht für immer sein.
Es wird. Nicht. Für immer. Sein.
Doch als das nasse Leder zum ersten Mal meinen nackten Rücken trifft, verliert der Satz jegliche Bedeutung.
Kapitel 2
Only the Beginning
Yessa
Der Regen hält mich wach. Er und meine Sorgen, die ebenso penetrant auf mich einprasseln, immer und immer weiter.
Zum wiederholten Mal wälze ich mich auf dem ungewohnten Schlaflager herum und ziehe mir eines der Felle über den Kopf. Als ich vorhin aufgewacht bin, war es stockfinster. Mittlerweile ist es im Zelt merklich heller geworden. Der Morgen graut, aber ich will noch nicht aufstehen. Der Tag, der uns bevorsteht, macht mir mehr Angst, als er sollte. Und allein ist es noch schwieriger als ohnehin schon, meinen Mut zusammenzunehmen.
Ich schäle mich aus dem warmen Schlaflager und husche mit einem der Felle auf dem Arm durch das halbdunkle Zelt. So leise wie möglich öffne ich die Klappe zum Vorraum, und eisige Luft schlägt mir entgegen.
Unter dem Schlafsack zu meinen Füßen kann ich kaum mehr als einen Umriss ausmachen. Schnell lege ich mich dazu, vergrabe mich wieder unter meinem Fell und atme einen nur allzu vertrauten Duft ein.
Das Bündel bewegt sich, und ein roter Lockenschopf kommt zum Vorschein. Livia blinzelt mir entgegen. «Yessa?», murmelt sie verschlafen.
«Schlaf weiter», flüstere ich.
Sie reibt sich die Augen. «Komm mit in den Schlafsack.»
«Schon gut. Er ist sicher zu eng.»
«Wenn da Typen mit gefühlt zwei Metern Schulterbreite reinpassen, werden wir es wohl zu zweit schaffen.»
Ich protestiere nicht länger. Genau deswegen – um mich von Livs Nähe beruhigen zu lassen – bin ich schließlich hergekommen. Mit klammen Fingern öffne ich den Schlafsack ein Stück weit an der Seite und klettere mit hinein. Sofort umfängt mich Wärme, aber statt zu verschwinden, wächst das merkwürdige bedrückende Gefühl in meiner Brust noch weiter.
Was ist das? Heimweh? Eine Captain hat kein Heimweh. Auch nicht, wenn sie diesen Rang erst seit ein paar Tagen trägt und noch keine Ahnung hat, ob sie ihm wirklich gewachsen ist.
«Du machst dir zu viele Sorgen», behauptet Liv und schlingt einen Arm um mich. Ihr Körper ist spürbar wärmer als meiner. Einer der vielen kleinen Beweise, dass wir nicht gleich sind, obwohl wir es gern wären. Nicht einfach Schwestern, sondern Halbschwestern. Nicht einfach Soldatinnen, sondern Drache und Reiterin.
«Du hättest bei mir schlafen sollen», übergehe ich ihren Kommentar und knöpfe den Schlafsack wieder zu. Es bleibt ein kleiner Spalt, durch den ich die eisige Luft spüren kann, aber mit Livia an meiner Seite ist es eine willkommene Abkühlung.
«Wir wollten kein Risiko eingehen, schon vergessen? Wer weiß, wie die Gepflogenheiten hier im Camp sind. Wenn jemand reinplatzt und uns erwischt, sind wir geliefert. Außerdem war es heute gar nicht so kalt. Den Regen habe ich lieber als den verfluchten Schnee.»
Sie hat ja recht. Es war das einzig Vernünftige, heute den sichereren Weg zu gehen. Mir gefällt es trotzdem nicht.
«Ich kann aber nicht schlafen ohne dich», beschwere ich mich und vergrabe das Gesicht an ihrer Schulter.
Livia schnaubt leise.
«Was?»
«Na ja. Das sah irgendwie anders aus, als ich vor zwei Stunden zu dir ins Bett krabbeln wollte, weil ich auch nicht schlafen konnte.»
Mir entkommt ein ersticktes Lachen. «Wir sind erbärmlich.»
Livia schüttelt vehement den Kopf. «Wir sind der ganze Stolz unserer Mütter!», widerspricht sie mir mit gespieltem Ernst. «Sie werden es lieben, dass ihre Töchter selbst nach sieben Jahren in der Armee kaum eine Nacht getrennt verbringen können.»
«Noch mehr würden sie es lieben, wenn wir wieder nach Hause kämen», erwidere ich seufzend.
«Das wäre auf jeden Fall einfacher», gibt Livia zu. «Aber wir wollten es nicht einfach. Wir wollen etwas verändern. Und mit deinem neuen Rang sind wir diesem Ziel wieder ein Stück näher gekommen.»
«Unserem Rang», verbessere ich sie. «Ohne dich hätte ich das niemals geschafft.»
«Sehr schmeichelhaft», sagt sie schmunzelnd. «Aber nicht wahr. Du gibst nicht auf, bis du erreicht hast, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Deswegen ist es auch einfacher, dir zu helfen, als sich endlos von dir nerven zu lassen.»
«Also bin ich eine Tyrannin», lache ich leise.
«Du hast es erfasst.»
«In dem Fall bin ich ja wie gemacht für den Rang der Captain.»
Ich habe den Satz kaum ausgesprochen, da legt sich ein schweres Gewicht auf meine Brust. Das Wort Tyrannin mag scherzhaft gemeint gewesen sein, aber es fasst nur allzu gut zusammen, was man in der Armee von mir erwartet.
Erbarmungslosigkeit. Brutalität. Hass.
Genau das macht dieses ganze System aus, das König Ylving seit fünfundzwanzig Jahren aufbaut und das nach und nach unsere Heimat befällt wie eine tödliche Krankheit.
Wir wollen dagegen kämpfen, von innen heraus etwas verändern. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Weshalb wir uns überhaupt freiwillig für den Armeedienst gemeldet haben, obwohl unsere Mütter uns angefleht haben, es nicht zu tun. Der Grund, warum ich meine Angst nicht gewinnen lasse und sie jedes Mal aufs Neue herunterschlucke, egal wie groß sie wird. Ich könnte nicht mit dem Gedanken leben, nichts zu tun, während den Drachen im Land alles genommen wird. Erst der Thron, dann ihre Rechte und nun langsam, aber sicher auch ihre Freiheit. Doch dafür muss ich mich dem System erst einmal fügen. Die Rolle der Tyrannin spielen, obwohl ich es hasse, dass Livia in diesem bitterkalten Vorraum schlafen muss, während ich im beheizten Zelt liege. Dass niemand erfahren darf, wie eng unsere Beziehung wirklich ist. Dass ich allein die Kontrolle über die Magie zwischen uns habe, obwohl sie schon immer dafür gedacht war, geteilt zu werden.
Mir wird übel, wenn ich darüber nachdenke, dass ich all das zulasse. Was bringt mein Wunsch nach Veränderung, wenn ich das System auf dem Weg dorthin selbst immer weiter festtrete?
«Du bist nicht wie sie», flüstert Livia, die mal wieder ahnt, was in mir vorgeht.
«Ich weiß», erwidere ich.
Nur bedeutet anders nicht gleich besser.
Schweigen hüllt uns ein. Wir liegen aneinandergeschmiegt da, schließen die Augen und lauschen dem prasselnden Regen. Fast ist es wie früher. Als Kind bin ich bei jedem Unwetter zu Livia ins Bett gekrabbelt, weil ich mich vor dem Donner gefürchtet habe. Nur dass dies nicht unser Zuhause ist, nicht mal unsere gewohnte Umgebung, sondern ein völlig fremdes Armeecamp. Voller fremder Soldaten, vor denen ich mich in nur wenigen Stunden beweisen muss.
Unser erster Tag im neuen Camp, der erste Tag als Captain. Ich wünsche mir fast, ich hätte diese Beförderung nie bekommen.
Allmählich erklingen draußen immer mehr Stimmen. Das Camp wacht auf, und wir sollten aufstehen, damit uns niemand erwischt. Dass Livia meine Halbschwester ist, weiß der General zwar, aber er denkt, unser Vater hätte uns ganz im Sinne der Armee erzogen. Ich gebe die Befehle, Livia befolgt sie. Eine strenge Hierarchie, die niemals gebrochen wird. Denn auf Beziehungen zwischen Reitern und Drachen steht in der Armee die Todesstrafe. Damit sind im engeren Sinne romantische Verbindungen gemeint, aber bereits eine private Unterhaltung könnte uns teuer zu stehen kommen, ganz zu schweigen von unserem Schlafarrangement. Dass wir all das jahrelang verborgen haben, würde vermutlich reichen, um uns zu Verräterinnen zu erklären und uns hinrichten zu lassen.
Uns bei unserer Rekrutierung zu trennen, stand allerdings außer Frage. Lieber riskiere ich mein Leben, als Livia irgendeinem fremden Reiter zu überlassen, der sie behandelt wie Dreck.
Schritte erklingen plötzlich direkt neben dem Zelt, und wir zucken beide zusammen. Doch sie entfernen sich schnell – vermutlich war es einer unserer Nachbarn, der gerade aufgestanden ist. Ich atme einmal tief durch und wappne mich innerlich schon mal für die Kälte draußen. Und für alles, was heute noch auf uns zukommt.
«Hast du Angst?», flüstere ich in das Regenprasseln hinein und löse mich von ihr, um sie ansehen zu können.
Mittlerweile ist es hell genug, dass ich das Grün ihrer Augen erkennen kann. Zusammen mit den goldenen Sprenkeln, die dort schimmern und die nur mir vorbehalten sind. Sie sind ein Zeichen der Bindung zwischen Reiter und Drache. Nur der gebundene Partner kann sie sehen. Und sie erinnern mich seit nunmehr sieben Jahren daran, was wir bereits alles durchgestanden haben.
«Ich muss keine Angst haben», antwortet sie mir lächelnd. «Ich habe doch dich.»
Auf dem Rüstplatz herrscht das reinste Chaos. Dreißig Reiter und ihre Drachen haben sich dort versammelt und stehen sinnlos im Matsch herum. Der Regen hat aufgehört, aber dichter Nebel verbirgt die Berge, die sich unweit des Camps in den Himmel recken, und ein harscher Wind weht über die ungeschützte Fläche.
Trotz des ungemütlichen Wetters unterhalten die Reiter sich angeregt – offenbar ohne dass jemand auch nur auf die Idee kommt, etwas für den bevorstehenden Einsatz vorzubereiten. Die Sättel liegen unberührt auf den Transportwagen, und die Drachen sind allesamt noch in ihren menschlichen Gestalten, sodass nur ihre Kleidung verrät, wer zu ihnen gehört und wer nicht. Denn während die schwarzen Uniformen der Reiter je nach Rang aufwendig mit Goldstickereien verziert sind, sind die der Drachen schlicht gehalten.
Ein weiteres Symbol für unsere angebliche Überlegenheit, die nur deshalb besteht, weil die Drachen weder Zugriff zu Magie noch zu Waffen haben. Sie werden voll und ganz von ihren Reitern abhängig gemacht.
Tausend Jahre lang haben sie dieses Land regiert. Und nun ist von dieser einstigen Macht nicht mehr übrig als eine Erinnerung, die manchmal zwischen den Zelten hindurchweht. Ein Flüstern, das von besseren Zeiten erzählt. Zeiten, in denen Familien wie unsere noch nicht als Abschaum angesehen wurden.
Livia steht neben mir und mustert mit zusammengepressten Lippen das versammelte Banner auf dem Rüstplatz. Sie hat ihren Umhang eng um sich geschlungen, um dem Wind zu trotzen, aber da sie darunter nackt ist, hilft es nicht viel. Für die Verwandlung muss sie ihre Kleidung ablegen, weshalb es gängig ist, dass die Drachen mit so wenig wie möglich auf den Rüstplatz kommen. Normalerweise erspare ich ihr das, besonders bei diesen Temperaturen, aber sie hat darauf bestanden, um den ersten Eindruck von mir so harsch wie möglich zu zeichnen. Jetzt ist ihre sonst weiße Haut rot von der Kälte, und sie reibt sich die zitternden Hände.
Ich wünschte, ich könnte sie mit meiner Magie wärmen. Aber wir stehen so nah bei den anderen, dass es auffallen könnte.
«Erkennst du irgendeinen Plan?», murmle ich ihr zu. Wir stehen am Rand des Platzes neben einem der Ausrüstungszelte – noch unbemerkt von der Truppe. Schon seit ein paar Minuten beobachte ich die Soldaten und frage mich, ob das ein schlechter Witz sein soll.
«Ich glaube nicht, dass es einen gibt», erwidert Livia kaum hörbar. «Sicher, dass das keine Ausbildungstruppe ist?»
Frustriert schüttle ich den Kopf und beobachte zwei der Reiter dabei, wie sie sich lachend in den Schwitzkasten nehmen, als wäre das hier ein verdammter Spielplatz und nicht die Vorbereitung auf einen lebensgefährlichen Auftrag. «Das geht ja gut los.»
«Dann musst du dir Gehör verschaffen.»
Ich werfe ihr einen Blick zu, aus dem sie ohne Frage sämtliche meiner Emotionen herauslesen kann. Sich Gehör zu verschaffen, bedeutet in der Armee, keine Rücksicht zu nehmen, brutal vorzugehen, andere zu erniedrigen. Das ganze System basiert auf einem Machtgefälle, das ich kaum abstoßender finden könnte. Denn nur allzu oft kommen Strafen nicht dort an, wo sie sollen, sondern werden in Frustration weitergereicht – meist an die Drachen.
«Ich vertraue dir», sagt Liv leise, als hätte sie meine Gedanken gehört. «Und wenn du es schaffst, dass die anderen es auch tun, hast du alles richtig gemacht.»
«Ich gebe mein Bestes», verspreche ich ihr. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie man mir vertrauen soll, wenn ich gefühlt nicht weiß, was ich tue.
«Gut. Könnten wir jetzt dazu kommen, dass ich mich endlich verwandele? Ich erfriere.»
Ich atme tief durch. «Ja. Wird auch Zeit, dass jemand dieses Trauerspiel beendet. Was hältst du von einem großen Auftritt?»
Livia verkneift sich ein Schmunzeln. «Nach dir, Captain.»
Ich verdrehe gespielt die Augen, setze mich aber in Bewegung. Livia folgt mir mit den obligatorischen zwei Schritten Abstand. Außerhalb unseres Zelts sind wir nicht mehr gleichgestellt. Hier gibt es kein sanftes Lächeln mehr, keine Zuneigung, nicht einmal ein Mindestmaß an Respekt. Zumindest von meiner Seite aus. Liv muss jedem meiner Befehle Folge leisten und darf keinen von ihnen je hinterfragen. Obwohl das abgesprochen ist und wir es schon seit Jahren so handhaben, fühlt es sich trotzdem jedes Mal an, als würde ich sie verraten. Mich über sie stellen, obwohl ich kein Recht dazu habe.
Wir nähern uns dem Banner, aber selbst jetzt schert sich niemand von ihnen um uns. Ein paar drehen die Köpfe, doch falls sie die Bestickung auf meiner Uniform bemerken, ignorieren sie sie geflissentlich. Vielleicht wirke ich zu nett. Zu unschuldig. Zu jung. Ehrlich gesagt ist mir egal, was der Grund für ihre Ignoranz ist – sie macht mich wütend. Ich habe Jahre damit verbracht, mir diesen Rang zu erarbeiten, und diese Leute treten ihn mit Füßen.
Hinter mir kann ich Livias Verwandlung spüren. Meine Magie flackert auf wie eine Flamme, in die Öl gekippt wurde, und ich lasse eine Hitzewelle explosionsartig über den Rüstplatz rauschen. Sie bringt das Banner abrupt zum Schweigen, und ihre Köpfe fahren genau in dem Moment zu mir herum, in dem ich stehen bleibe und Livias Pranken hinter mir auf dem Boden aufkommen.
Sämtliche Blicke ruhen nun auf uns. Manche wirken irritiert, andere noch belustigt. Doch keiner sagt mehr ein Wort.
«Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit?», frage ich harsch und mustere die Gruppe Soldaten vor mir. «Oder muss ich zu anderen Mitteln greifen?» Ich lasse meine Magie noch einmal aufflackern und merke, wie sich einige der Soldaten versteifen.
Aus den Augenwinkeln sehe ich Livias smaragdgrüne Schuppen aufblitzen. Sie scharrt mit ihren Krallen ungeduldig im Boden und untermauert meine Drohung mit einem Grollen.
Mittlerweile sind wir gut in diesem kleinen Einschüchterungsmanöver. Wir haben früh gelernt, dass man sich in dieser Armee nur Respekt verschafft, wenn man Macht demonstriert. Und vor allem den Eindruck erweckt, diese auch nutzen zu wollen.
Bisher konnte ich es zum Glück immer vermeiden, mich mit irgendwelchen grausamen Bestrafungsmethoden durchsetzen zu müssen, doch das könnte sich mit dem neuen Rang ändern …
Noch immer starrt mich das Banner reglos an. Ich verziehe abfällig den Mund. «Wenn ihr schon nicht zu einer Antwort fähig seid, dann salutiert wenigstens», fordere ich sie auf. «Oder hat mir der General einen Haufen unfähiger Rekruten zugeteilt?»
Endlich kommt Bewegung in die Menge. Sie raffen sich zusammen und schaffen es tatsächlich, vor mir fast synchron zu salutieren. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung …
Ich lasse den Blick über die Männer und Frauen wandern, kann jedoch auch aus der Nähe niemanden mit der Uniform eines Lieutenants erkennen. Als General Harlow mir vorhin unseren heutigen Auftrag erteilte, hat er mir gesagt, dass ebendieser mich dem Banner als neue Captain vorstellen und den ersten Einsatz begleiten wird. Doch offenbar ist in diesem Armeecamp auf nichts und niemanden Verlass. Dann muss ich die Dinge eben selbst in die Hand nehmen.
«Warum stehen Sie hier sinnlos rum, statt mit den Vorbereitungen anzufangen?», will ich mit scharfer Stimme wissen. Ich fixiere einen jungen Reiter mit zerzausten dunklen Locken und hebe erwartungsvoll die Brauen.
Er räuspert sich, offensichtlich überrumpelt davon, dass ich ausgerechnet ihn anspreche. «Lieutenant Walsh ist noch nicht da …» Sein Blick huscht über meine Uniform. «Captain», fügt er dann stockend hinzu.
Ich ignoriere sein Zögern. «Und was tut das zur Sache? Muss er Ihnen erst erklären, wie man eine Truppe abflugbereit macht? Warum liegen die Sättel nicht bereit? Warum ist die Ausrüstung nicht geprüft?»
Wieder ein beklommenes Räuspern von dem Soldaten. Seine eben noch blassen Wangen laufen rot an. «Lieutenant Walsh möchte nicht, dass die Arbeit ohne sein Kommando begonnen wird, Captain.» Diesmal geht ihm mein Rang leichter von den Lippen. Der Rest seiner Aussage hingegen bringt mich zum Schnauben. Was ist das denn für ein Quatsch?
«Dann wird das für Sie alle eine ganz schöne Umstellung», verkünde ich. «Denn ab jetzt bin ich hier verantwortlich. Und ich erwarte, dass eigenständig alle Vorbereitungen getroffen werden, ohne dass ich erst bitten muss. Verstanden?»
«Ja, Captain», tönt es einstimmig.
Geht doch. «Gut. Dann an die Arbeit. Die Erlaubnis zur Verwandlung ist hiermit erteilt. In einer halben Stunde erwarte ich Sie alle abflugbereit.»
Mein Herz rast ein wenig, als ich mich vom Banner abwende und Livias Umhang vom Boden aufhebe, den sie vor ihrer Verwandlung eben abgelegt hat. Ich streiche den Stoff mit den Fingern glatt und atme einmal tief durch. Livia tritt näher zu mir heran, und ich lege eine Hand an ihre Flanke, damit sie mit mir sprechen kann.
«Beeindruckend», tönt ihre Stimme durch meine Gedanken, und ich verdrehe die Augen.
«Verarsch mich nicht», erwidere ich.
«Tu ich nicht. Das war sehr gut.»
«Wir sollen mit diesen Leuten gleich in den Krieg ziehen», erinnere ich sie.
«Es ist nur ein simpler Eliminierungsauftrag», versucht Livia mich zu beruhigen. «Und anscheinend kommen sie ja auf Trab, wenn man sie entsprechend anleitet.»
Missmutig beobachte ich, wie der Rest des Banners alles bereit für den Abflug macht. Ein paar der Drachen haben sich nun verwandelt – wenn auch mit weit weniger Aufhebens als Liv – und werden von ihren Reitern gesattelt. «Das hier wird schwieriger als gedacht», stelle ich fest.
«Ach was. Sie sind auch nicht schlimmer als unser Banner im letzten Camp.» Belustigung dringt zu mir durch. «Das Schwierigste für dich wird wahrscheinlich, dass du ohne deinen Schatz Arschen auskommen musst.»
«Nenn ihn nicht so», beschwere ich mich. Ich lasse Livia los, bringe ihren Umhang ins Ausrüstungszelt und gehe rüber zum Sattelwagen, um mir einen der Ledersättel zu holen. Diese sind zwar so konstruiert, dass man sie allein tragen und aufsatteln kann, wiegen aber trotzdem gefühlte Tonnen. In der Regel helfen sich die Reiter deshalb untereinander, doch ich werde an meinem ersten Tag als Captain sicher nicht diejenige sein, die zu schwach ist, um es allein hinzukriegen.
Ich hieve einen der Sättel aus dem Wagen, trage ihn rüber zu Livia, die sich auf den Boden sinken lässt, und lege ihn nah neben ihr ab. Dann werfe ich die Riemen über ihren Rücken und umrunde sie, um den Sattel von der anderen Seite an ihrem gigantischen Körper hochzuziehen. Leider bin ich ihr so nah genug, dass sie diese nervige Unterhaltung weiterführen kann.
«Arden, Arschen …», säuselt sie in meinem Kopf, während das Leder quälend langsam über ihre schimmernden Schuppen gleitet und ich mir ein angestrengtes Keuchen verkneife. «Ich höre keinen Unterschied.»
«Ich weiß, dass du ihn nicht magst.» Ich ziehe ein letztes Mal an den Riemen, bis der Sattel seinen Platz in der Mulde zwischen Livias Schulterblättern findet und ich meine Arme einen Moment lang entspannen kann. «Aber es tut jetzt sowieso nichts mehr zur Sache, weil ich ihn nicht wiedersehen werde. Und bevor du es sagst – nein, ich vermisse ihn nicht. Ich kannte ihn kaum. Er war nur ein Zeitvertreib.»
«Ein sehr lauter Zeitvertreib …»
«Livia», beschwere ich mich, und ein Kichern hallt durch meine Gedanken.
«Das ist meine Rache für die schlaflosen Nächte.»
«Du bist unmöglich.» Ich widme mich wieder der Vorbereitung, zurre den Sattel fest und überprüfe unsere Ausrüstung. Dabei habe ich stets ein Auge auf den Rest des Banners. In der kurzen Zeit, die mir vor dem Abflug bleibt, ist es unmöglich, die Leute gut genug kennenzulernen, um sie einschätzen zu können. Was auch der Grund ist, weshalb General Harlow mir den eigentlichen Lieutenant an die Seite gestellt hat. Und ausgerechnet der taucht jetzt nicht auf.
«Meinst du, es ist Schikane?», frage ich Livia im Stillen. «Dieser Auftrag. Ganz nach dem Motto: Lassen wir die Neue die Scheißarbeit erledigen?»
Als Captain ist es eigentlich nicht meine Aufgabe, ein einzelnes Banner zu leiten. Auch wenn es nach der Versetzung in ein neues Camp durchaus Sinn macht, um meine Leute kennenzulernen.
«Wirkt zumindest so», bestätigt Livia meine Vermutung. «Vermutlich will der General dich testen.»
«Das fängt ja toll an», brumme ich.
«Lass dich nicht verunsichern, diese Spielchen kennen wir doch. Erledige einfach den Auftrag, dann kannst du den General immer noch zur Rede stellen.»
Mir entweicht ein frustriertes Schnauben. «Klar. Ich lege mich mit dem General an.»
«Nein, er hat sich mit dir angelegt», widerspricht Liv sanft.
«Ich hasse diese Dominanzspielchen», murre ich.
«Ich weiß. Wir beide.»
«Wer hat euch erlaubt anzufangen?», donnert eine wütende Stimme über den Platz. Ein Mann um die vierzig stapft auf das Banner zu. Er hat kurzes sandfarbenes Haar und blaue Augen, die wütend die Truppe mustern. Die Bestickung seiner Uniform zeichnet ihn als Lieutenant aus, und kaum dass die Reiter ihn bemerken, salutieren sie vor ihm. Hier funktioniert das mit der Disziplin also.
«Die Frage ist doch eher, wer Ihnen erlaubt hat, zu spät zu kommen», erwidere ich kurzerhand und gehe zu ihm hinüber. Sein Blick findet nun mich, aber mir ist klar, dass er nur so tut, als würde er mich zum ersten Mal sehen. Sicher hat er mich schon beobachtet, bevor er seine Ankunft so großspurig angekündigt hat.
Ich mustere erst ihn und dann flüchtig den Mann, der mit etwas Abstand hinter ihm stehen geblieben ist. Groß gewachsen, breit, kurz geschorene schwarze Haare. Sein Drache, zweifelsohne. Das verrät bereits der schlichte Umhang. Aber ich bleibe an seinen Augen hängen.
Sind das goldene Sprenkel in dem warmen Braun? Sie erinnern mich unweigerlich an Livia. Nur dass ich sie bei ihr erst seit unserer Bindung sehe. Ich wüsste nicht, dass ich so etwas schon mal bei jemand anderem wahrgenommen hätte.
Der Mann hebt eine dunkle Braue, und ich merke erst jetzt, dass ich ihn einen Moment zu lang angestarrt habe. Wie kann man sich von ein paar Sprenkeln derart aus dem Konzept bringen lassen? Vermutlich ist es einfach seine normale Augenfarbe.
Eilig reiße ich mich von seinem Anblick los und widme mich stattdessen dem Lieutenant. «Walsh, richtig?», frage ich. Aber mein Herz ist verräterisch aus dem Takt geraten. Kleinigkeiten wie diese reichen, um den Leuten Munition gegen mich zu geben. In unserem alten Camp hat sich Livs und mein Familienverhältnis herumgesprochen, und ich bin oft genug deswegen mit Misstrauen oder Spott behandelt worden. Ich sollte es also besser wissen. Ich habe nicht vor, hier schon wieder meine Autorität untergraben zu lassen.
Walsh überragt mich um ein paar Zentimeter und schaut so abschätzig auf mich herab, als wäre ich ein Dreckspritzer an seinem Schuh. «Und Sie sind?», will er wissen.
Sofort wandelt sich meine Verlegenheit in Wut. «Sie wissen genau, wer ich bin», antworte ich eisig. «Noch ein Fehltritt, und ich schließe Sie von diesem Auftrag aus.»
Walsh entweicht ein ersticktes Keuchen, und mir entgeht nicht, dass sein Drache sich bei meinen Worten versteift.
«Wie bitte?», will der Lieutenant wissen.
Unbeirrt halte ich seinen Blick. «Ich kann keinen Reiter gebrauchen, der nicht einmal pünktlich auf dem Rüstplatz erscheinen kann. Ich hoffe, bei Ihren anderen Aufgaben erweisen Sie sich als tauglicher. Abtreten.»
Eben noch hatte sein Gesicht die Farbe von gebleichtem Leinen. Jetzt läuft er verräterisch rot an. Er öffnet empört den Mund, erwidert dann aber doch nichts mehr. Stattdessen wendet er sich schnaubend ab und stapft hinüber zum Sattelwagen, ohne auch nur zu salutieren.
Die Reaktion ist völlig respektlos, doch ich weiß auf Anhieb nicht, wie ich damit umgehen soll. Ihn noch mal zurückpfeifen? Es einfach durchgehen lassen? Ich entscheide mich für Letzteres, gehe zurück zu Livia und verfluche mich selbst dafür, die Situation nicht souveräner gemeistert zu haben.
«Schau nicht den Falschen hinterher», rät Liv mir. «Das kannst du dir nicht leisten.»
Sie hat es also auch gemerkt. Großartig. «Ich war nur irritiert von seinen Augen», murmle ich und zurre den Sattel fest.
«Oje. Vielleicht hast du doch Arschen-Entzug …»
«Ach, halt die Klappe.»
«Ich versuche nur, auf dich aufzupassen.»
«Jaja. Keine fremden Drachen anstarren, ist notiert.»
«Der Lieutenant ist ein Arschloch», wechselt sie das Thema.
Ich halte inne, und gemeinsam beobachten wir, wie Walsh zwei der anderen Reiter anblafft, ihm zu helfen, und dabei konsequent vermeidet, in meine Richtung zu schauen.Sein Drache jedoch dreht sich noch einmal um. Sein Blick findet meinen, und er zieht unzufrieden die Brauen zusammen. Irgendetwas an mir scheint ihn zu stören.
Ich will mich gerade wieder abwenden, als er seinen Umhang fallen lässt, um sich zu verwandeln. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis aus seiner nackten Haut Schuppen geworden sind. Weiß wird zu einem tiefen Schwarz und der junge Mann zu einer Naturgewalt.
Schon in seiner menschlichen Gestalt war seine Statur einschüchternd, aber jetzt ist er riesig. Er streckt seine gigantischen Schwingen dem grauen Himmel entgegen, und das fahle Licht schimmert dunkelrot durch die Flugmembranen. Doch es ist weder der Anblick seines nackten Körpers noch seine Drachengestalt, die diesmal meine Aufmerksamkeit fesselt. Sondern das, was ich während der Verwandlung für den Bruchteil einer Sekunde an seiner Schulter gesehen habe. Einen durchgebluteten Verband.
Bevor ich zögern kann, habe ich mich bereits in Bewegung gesetzt. Vorsicht hin oder her – einige Dinge müssen von vornherein klar sein. Zum Beispiel die Tatsache, dass keine Drachen mit offenen Wunden in einen verdammten Kampfeinsatz geschickt werden. Und primär wüsste ich gern, woher er diese Verletzungen überhaupt hat.
«Was war das?», will ich wissen und stelle mich Walsh und seinen beiden Gehilfen in den Weg, die gerade den Sattel hochgehievt haben.
Der Lieutenant verzieht genervt das Gesicht. «Was war was?»
«Das.» Ich weise auf einen Fetzen des blutigen Verbands, der ein paar Meter weiter auf dem matschigen Boden gelandet ist. «Ihr Drache ist verletzt.»
Ich zucke zusammen, als sich plötzlich die Spitze eines schwarz geschuppten Drachenschweifs um meine Beine legt. Im selben Moment tönt eine Stimme durch meine Gedanken – tief wie ein Donnergrollen und zugleich sanft wie flüssiger warmer Honig, der um meine Sinne fließt. «Mir geht es gut, Captain.»
Gänsehaut jagt mir über die Arme, und ich erschaudere.