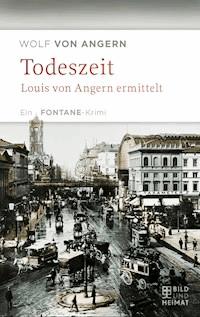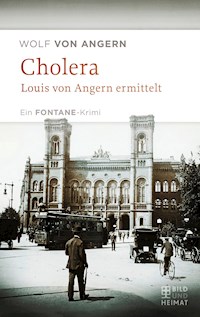
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1892: Als Baron Oscar von Jouquieres, ein reicher Fabrikant und aufstrebender Politiker, von einer Geschäftsreise zurückkehrt, erkrankt er an Cholera. Er hat sich in Hamburg angesteckt, in der Hansestadt grassiert eine Epidemie. Doch dank umfassender ärztlicher Pflege wird von Jouquiere wieder gesund. Einige Tage nach seiner Genesung erleidet er einen Unfall. An seiner Kutsche bricht ein Rad. Wie durch ein Wunder bleibt er unverletzt. Nach einem Theaterbesuch trifft ihn der nächste Schicksalsschlag: Der Baron wird ausgeraubt. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem der Fabrikant mit einem Messer tödlich verletzt wird. Kriminalpolizei-Inspektor Louis von Angern untersucht den Raubmord. Von Anfang an hat er Zweifel, dass die Cholera-Infektion und der Kutschenunfall Zufälle waren. Er vermutet ein politisches Komplott. Theodor Fontane, von Angerns väterlicher Freund, ordnet die Indizien und erkennt schließlich die wahren Zusammenhänge, die weniger erhaben sind, als gedacht … Wolf von Angern, Urenkel des Kriminalinspektors Louis von Angern, hat in Cholera die ihm überlieferten handschriftlichen Notizen des Polizisten in ein romanhaftes Geschehen gekleidet – ein unwiderstehliches Lesevergnügen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf von Angern
Cholera
Louis von Angern ermitteltEin Fontane-Krimi
Bild und Heimat
Wolf von Angern war Rechtsanwalt von Beruf. Unter mehreren Pseudonymen verfasst er seit vielen Jahren Artikel für bekannte Zeitschriften und überregionale Zeitungen. An über dreißig Buchprojekten war er als Autor, Mitautor oder Ghostwriter beteiligt. Er lebt abwechselnd in Berlin oder auf dem Stammsitz seiner Familie in Schweden. Cholera ist nach Todeszeit (2015) der zweite Kriminalroman rund um Wolf von Angerns Urgroßvater, den preußischen Kriminalpolizei-Inspektor Louis von Angern.
Louis Maria Helfricht von Angern (1846 –1936), ein enger Freund Theodor Fontanes, klärte bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1910 zahlreiche schwere Verbrechen auf. Bei einigen Fällen lieferte der berühmte Schriftsteller wichtige Hinweise, die wesentlich zur Überführung des Täters beitrugen.
Von Wolf von Angern liegt bei Bild und Heimat außerdem vor:
Todeszeit. Louis von Angern ermittelt. Ein Fontane-Krimi (2015)
eISBN 978-3-95958-726-6
1. Auflage
© 2016 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © akg-images / PAL / PB
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Für meinen Urgroßvater
Louis Maria Helfricht von Angern (1846 –1936)
und für Peter Paul Baron von Derschau
Namensverzeichnis
Ackermann, Conrad – Leichenbeschauer
Angern, Louis Maria Helfricht von – Kriminalpolizei-Inspektor
Angern, Therese von – seine Ehefrau
Angern, Florentine Therese von – seine Tochter
Angern, Trauthelm Louis von – sein Sohn
Balau, Sebastian von – Stiefbruder des Barons von Jouquiers
Balau, Radomila von – seine Ehefrau
Bärenzung, Paul – Kriminalkommissar
Baudessin, Franz von – Kreisphysikus
Cohn, Max – Hausdetektiv
Fontane, Theodor – Dichter
Fontane, Emilie – seine Ehefrau
Fontane, Mete – seine Tochter
Grolman, Maximilian von – Hochstapler
Gumpert, Albrecht – Stellmacher
Hirschberg, Emil – Droschkenkutscher
Hupka, Margarete – Taschendiebin
Jorbandt, Robert – Assistent des Leichenbeschauers
Jouquiers, Baron Oscar Xaver von – Fabrikant & Möbelhändler
Jouquiers, Philippine von – seine Ehefrau
Klitzing, Theodor von – Cousin des Barons von Jouquiers
Klitzing, Adelaide von – seine Ehefrau
Loewensohn, Julius – Arzt
Maquet, Christoph – Taschendieb und Akrobat
Plonsker, Curt – Kriminalkommissar
Richthofen, Bernhard Freiherr von – Polizeipräsident
Schröter, Hermann – Möbelhändler
Werner, Carl – Page
Einleitung
Meine Vorfahren stammen aus einem Ort namens Angern. Das ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Der Name leitet sich vom Dorfanger her, einem größeren Rasenplatz in der Mitte einer Ansiedlung. Ab dem Jahr 1160 ist die Herkunft meiner Familie durch Urkunden belegt. Einer meiner frühen Ahnen war Theoderich von Angern, der mit dem Markgrafen Heinrich dem Bären in die Altmark gekommen sein soll.
Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Dorf fast völlig zerstört. Der Zweig der Familie, von dem ich abstamme, flüchtete ins Umland und ließ sich später in Brandenburg an der Havel nieder. Dort kam es zu einer Vermischung mit den dort angesiedelten Hugenotten, in deren Folge mein Urgroßvater einen französischen Vornamen erhielt.
Louis Maria Helfricht von Angern wurde am 17. Februar 1846 geboren. Er war von klein auf wissbegierig, lernte bereits mit fünf Jahren Lesen und Schreiben und besuchte später erfolgreich die Ritterakademie in Brandenburg. Nach dem Ablegen der Reifeprüfung gab es für einen verarmten Adligen zur damaligen Zeit nur zwei ernsthafte Möglichkeiten für ein berufliches Fortkommen: entweder eine militärische oder eine geistliche Laufbahn einzuschlagen. Obwohl mein Urgroßvater das ganze Gegenteil von einem sturen Kommiss-Schädel war, entschied er sich für den Offiziersberuf und trat dem Kürassier-Regiment Nr. 6 bei. Dort machte er schnell Karriere. Im Deutsch-Französischen Krieg, in der Schlacht bei Weißenburg am 4. August 1870, wurde er schwer verwundet, ehrenhalber zum Rittmeister befördert und nach seiner teilweisen Genesung am 25. Juni 1871 als dienstunfähig aus dem aktiven Dienst entlassen.
Anders als in den Kriegen danach sorgte sich das Land damals noch um seine malträtierten Helden. Louis von Angern hatte die Wahl zwischen einer Postmeisterstelle in Sangerhausen und dem Polizeidienst in der Reichshauptstadt.
Mein Urgroßvater entschied sich für die zweite Alternative und wurde im Rang eines Kommissars eingestellt. Lange Zeit hatte er sich nur um irgendwelchen Kleinkram zu kümmern, denn Berlin war damals kaum mehr als ein großes Dorf, das aus einem losen Verbund von separaten Ansiedlungen bestand. Ende 1871 lebten im gesamten Stadtgebiet gerade einmal 826341 Einwohner.
Knapp zwanzig Jahre später hatte sich das Blatt radikal gewendet. Berlin drohte aus allen Nähten zu platzen. Der provinzielle Charme war verflogen. Billig gebaute, schnell hochgezogene Mietskasernen begannen das Stadtbild zu prägen. Die offizielle Einwohnerzahl hatte sich verdoppelt. Dazu kam eine große Zahl von illegalen Zuwanderern, Obdachlosen und Stadtstreichern. Eine Nebenerscheinung der Überbevölkerung war eine stetig wachsende Kriminalität, der staatlicherseits irgendwie begegnet werden musste. Eine Präsidialverfügung vom 26. April 1885 hatte bereits die Teilung der Berliner Kriminalpolizei in drei Inspektionen veranlasst.
Mein Urgroßvater wurde zur II. Inspektion versetzt, die sich den Gewohnheitsverbrechern widmete. Die Kriminalpolizei residierte damals am Molkenmarkt in einem Komplex von alten Bauwerken mit schmalen Höfen, düsteren Gängen und niedrigen Zimmern. 1889 zog die Kripo in das königliche Polizeipräsidium an der Südseite des Alexanderplatzes um. Mein Urgroßvater stieg in der Hierarchie weiter auf und wurde zum Dezernatsleiter befördert.
Louis von Angern war ein kulturinteressierter Mensch und ging häufig ins Schauspielhaus. Dort lernte er einen Theaterkritiker kennen, der Theodor Fontane hieß. Mein Urgroßvater freundete sich mit dem Journalisten an, obwohl dieser fast dreißig Jahre älter war als er. Die beiden verband vor allem eine gewisse Gemeinsamkeit des Wesens (sie konnten über die gleichen Witze lachen), und die (wenigstens teilweise) Abstammung von den Hugenotten. So hatte beispielsweise Theodor Fontanes Vater ebenfalls mit Vornamen Louis geheißen.
Die Freundschaft blieb auch erhalten, als Fontane dem Theater den Rücken kehrte, den Journalismus an den Nagel hängte und ein erfolgreicher Schriftsteller wurde. 1892 erkrankte er an Gehirnischämie, einer schweren Durchblutungsstörung. Es bestand die Gefahr einer geistigen Umnachtung. Die unterschiedlichsten Kuren und Behandlungsmethoden wie Elektroschocks und Morphiumgaben blieben erfolglos. Schließlich verordnete der Hausarzt Dr. Wilhelm Delhaes als ultima ratio geistige Übungen, um die Gedanken des Kranken in ständigem Fluss zu halten und auf diese Weise ein Absterben der Gehirnwindungen zu verhindern. Theodor Fontane begann damit, seine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben und schwierige Rätsel zu lösen. Einen Teil der kniffligen Aufgaben steuerte mein Urgroßvater aus seiner täglichen Polizeiarbeit bei. Er weihte seinen Freund in schwierige Fälle ein, in denen es zumeist um Kapitalverbrechen ging und bei denen die Ermittlungen in eine Sackgasse geraten waren.
Theodor Fontane war viel gereist und hatte viel erlebt. Er verfügte über ein großes Allgemeinwissen und einen (immer noch) scharfen Verstand. Er wusste, dass bei der Analyse jeder Schandtat die beiden elementaren Fragen lauteten: Cui bono?Cui prodest? – Gut für wen? Wem nützt es? Auf diese Weise gelang es ihm tatsächlich, mehrere spektakuläre Fälle aufklären zu helfen und in der Folge letztendlich auch die Krankheit zu überwinden.
Mein Urgroßvater schied 1910 aus dem aktiven Polizeidienst aus. Er starb am 12. September 1936 – achtunddreißig Jahre nach seinem Freund – im hohen Alter von neunzig Jahren.
Wie ich von meinen Vater weiß, haben sich in unserem Familienbesitz zahlreiche Bücher mit handschriftlichen Widmungen von Theodor Fontane für Louis von Angern befunden. Sie sind alle im Zweiten Weltkrieg im Feuersturm verbrannt. Aber ein abgeschabter Lederkoffer, in dem sich mehrere Dutzend blauer Kladden mit handschriftlichen Notizen befinden, hat wie durch ein Wunder die Bombenangriffe überlebt. Das lädierte Gepäckstück ist glücklich von meinem Urgroßvater über meinen Großvater und meinen Vater auf mich gekommen.
Die Aufzeichnungen betreffen allesamt Kriminalfälle, an deren Lösung Theodor Fontane aktiv beteiligt war. Die Niederschriften sind nur stichpunktartig abgefasst und schwer zu lesen, weil sie von meinem Urgroßvater in altertümlicher Kurrentschrift zu Papier gebracht wurden. Oftmals fehlen wichtige Abschnitte oder Bezüge, die zum tieferen Verständnis dringend notwendig wären.
Lange Zeit wusste ich nicht, was ich mit dem Inhalt des Koffers anstellen sollte, bis ich eines Tages zufällig meinem Verleger davon erzählte. Er hielt es für eine gute Idee, die vergilbten Texte aufzuarbeiten.
Mein Urgroßvater soll – so hat es mir jedenfalls mein Großvater berichtet – ein begabter Geschichtenerzähler gewesen sein, der Pointen gut zu setzen wusste. Aber er war kein Literat. Er hat keine Romane verfasst. Das habe ich nun für ihn getan. Es handelt sich um keine Tatsachenberichte, weil ich die fehlenden Passagen mit Hilfe der Fantasie ergänzen musste. Dennoch ist das meiste tatsächlich so geschehen, wie ich es beschrieben habe.
Obwohl sämtliche Geheimhaltungsklauseln längst abgelaufen sind und nach über hundert Jahren auch keine Verletzungen von Persönlichkeitsrechten mehr zu befürchten wären, habe ich trotzdem einige Namen verändert. Die Toten, auch wenn sie Schurken waren, sie mögen in Frieden ruhen.
Einige Nebenschauplätze musste ich weglassen, um den Fluss der Handlung nicht zu stören, und aus dramaturgischen Gründen war es sich erforderlich, gewisse zeitliche Abläufe zu verändern. Beispielsweise begann die Cholera-Epidemie in Hamburg am 14. August 1892, und nicht, wie in diesem Buch, ein Jahr später. Vor allem die mit reichlich historischem Wissen gesegneten Leser mögen mir dies bitte nachsehen.
Wolf von Angern, Juni 2016
1. In der Morgue
Die Not lehrt beten, sagt das Sprichwort, aber sie lehrt auch denken.
Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg
HAMBURG, AUGUST1893
Im Jahr 1893 stöhnte das Deutsche Kaiserreich über einen ungewöhnlich heißen Sommer. Seit Anfang August hatten die Tagestemperaturen permanent bei über dreißig Grad Celsius gelegen. Selbst die Nächte brachten kaum noch Abkühlung. In der Freien und Hansestadt Hamburg ging der Wasserstand der Elbe spürbar zurück. Der aufgeheizte Fluss stank faulig und modrig. Tierkadaver, Fäkalien und aller anderer nur denkbarer Unrat trieben in Richtung Cuxhaven und von dort aus weiter in die Nordsee.
Die Geruchsbelästigung nahm beständig zu. Obwohl die Hamburger durch die nur schwer zu ertragenden Miasmen des Fischmarkts und die offenen Abwassergräben einiges gewohnt waren, trauten sich viele Einwohner nur noch mit vor die Nasen gebundenen Tüchern auf die Straßen. Der Pesthauch war zwar schon unangenehm genug, aber das eigentliche Übel lag ganz woanders. Als äußerst verhängnisvoll erwies sich nämlich, dass der Pegel im Hamburger Hafenbecken bei Flut regelmäßig um knapp zwei Meter anstieg.
Diese simple Tatsache führte zu einer tödlichen Kettenreaktion: Das völlig verdreckte und inzwischen hochtoxische Wasser wurde flussaufwärts bis zur wichtigsten Wasserstation der Stadt gedrückt. Dort waren immer noch keine Filteranlagen vorhanden. Bei ihrem seit langem geplanten Bau hatte es Verzögerungen gegeben. Fest eingeplante Gelder waren einem anderen Verwendungszweck zugeführt worden. Doch nun, im glühendheißen Sommer des Jahres 1893, hatten diese menschlichen Unzulänglichkeiten gravierende Folgen. Es gab weder ersatzweise anzapfbare Tiefbrunnen noch irgendeinen Notfallplan. Deshalb musste das Trinkwasser direkt und ungeklärt aus der Elbe in die Leitungen gepumpt werden. Anderenfalls wären große Teile der Stadt von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Die warme, eklig schmeckende Brühe bildete eine perfekte Brutstätte für die verschiedensten Keime und Krankheitserreger. Das städtische Gesundheitsamt forderte zwar die Bevölkerung mit großformatigen Anschlägen an den Litfasssäulen auf, nur noch abgekochtes Wasser zu trinken und für die Speisenzubereitung zu verwenden. Aber längst nicht alle Leute hielten sich daran.
Es kam, wie es kommen musste: Am 14. August 1893 wurde der städtische Rinnenreiniger Albert Sahling ins Spital eingeliefert, weil er unter starkem Erbrechen und Diarrhöe litt. Seine Ausleerungen waren dünnflüssig, beinah farblos und schleimig. Sie erinnerten an Reiswasser oder Mehlsuppen. Das ließ auf Geschwüre des Dickdarms, Tuberkulose, Typhus oder Cholera schließen. Der Kranke wirkte stark benommen. Er befand sich in einem stadium asphycticum mit minimalem Pulsschlag und subnormaler Köpertemperatur. Stunde um Stunde schüttelten ihn immer stärker werdende Krämpfe. Weil die Ärzte die genaue Ursache noch nicht kannten, konnten sie ihm kein geeignetes Gegenmittel verabreichen. Die einzige Möglichkeit bestand in dem Versuch, die lebensbedrohlichen Symptome zu lindern: Um die Durchfallneigung zu vermindern, wurden dem städtischen Arbeiter Klistiere verabreicht. Sie enthielten Tannin als kräftiges adstringierendes Mittel. Gegen den starken Flüssigkeitsverlust verordneten die Doktoren regelmäßige intravenöse Infusionen von physiologischen Kochsalzlösungen. Den eigentlichen Kampf mussten die körpereigenen Abwehrkräfte ausfechten.
Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. In der Nacht zum 15. August verschied Albert Sahling. Sein ausgemergeltes Gesicht hatte sich blaugrau verfärbt und war faltig geworden. Die Augen lagen tief in ihren schwarzumrandeten Höhlen.
Die Ärzte wussten zwar immer noch nicht genau, woran sie eigentlich waren, aber sie befürchteten das Schlimmste. Gleichwohl verhallte ihre Warnung an den Senat und an die Bürgerschaft ungehört. Niemand wollte die Verantwortung dafür übernehmen, einschneidende Maßregeln anzuordnen. Ohnehin wären alle Vorbeugemaßnahmen längst zu spät gekommen. Bereits einen Tag nach dem Tod von Albert Sahling, am 16. August 1893, brach in Hamburg die Cholera mit großer Wucht und Härte aus. Sie griff explosionsartig um sich. Tausende Menschen erkrankten binnen weniger Stunden. Die letale Quote lag bei fünfzig Prozent. Bis zum Februar 1894 starben in der Hansestadt von den amtlich erfassten sechzehntausendneunhundertsechsundfünfzig Cholera-Patienten mehr als die Hälfte, nämlich achttausendsechshundertfünf Personen. Hinzu kam eine nicht unerhebliche Dunkelziffer, weil viele Tote verscharrt oder in Kalkgruben geworfen wurden, ohne den Leichenbeschauer zu benachrichtigen.
Es mussten vor allem arme Menschen daran glauben, weil die hygienischen Verhältnisse in ihren Wohnquartieren am schlechtesten waren. Viele von den Patienten hatten sich bereits auf dem Wege der Besserung befunden. Aber die Seuche war tückisch. Nach einer Phase, in der die Durchfälle und das Erbrechen nachließen, der Pulsschlag wieder fühlbar und der Kranke ansprechbar wurde, die Sekretionen in Gang kamen und leichte Nahrung verabreicht werden konnte, trat urplötzlich die schwere Nierenerkrankung Choleranephritis auf, die erbarmungslos zu schweren Krämpfen und dann zum Tode führte.
*
BERLIN, 25. AUGUST1893
Im weißgekalkten und halbhoch gefliesten Arbeitsraum des Berliner Leichenschauhauses in der Hannoverschen Straße 6, welches nach seinem Pariser Vorbild auch »Morgue« genannt wurde, saßen sich zwei ältere Herren gegenüber, die verschiedener nicht hätten sein können. Der eine war ein vierschrötiger Mann von Anfang fünfzig. Sein glänzender Schädel wurde lediglich von einem schütteren Haarkranz geschmückt. Der Graukopf hieß Conrad Ackermann und hatte tagtäglich mehr mit toten als mit lebenden Menschen zu tun. Als amtlich bestellter königlich-preußischer Leichenbeschauer durfte er nicht feinfühlig sein. Den üblen Geruch, der von den menschlichen Überresten ausging, versuchte er mit dem Paffen von bestialisch stinkenden schwarzen Stumpen zu bekämpfen. Ab und an half ihm ein Schluck aus einer Flasche mit hochprozentigem Kümmel, das flaue Gefühl in der Magengegend zu unterdrücken. Doch gegen die seelischen Verkrustungen, die der ständige Umgang mit der wohl schrecklichsten Form menschlichen Elends hervorrief, halfen weder beißender Tabakrauch noch scharfer Schnaps, noch eine Prise Galgenhumor. Es war eine in diesem Berufszweig allbekannte Tatsache: Die Toten fraßen die Seelen der Lebenden auf, jedenfalls derjenigen, die mit den verwesenden Überresten zu tun hatten. Conrad Ackermann war deshalb im Laufe der Jahre zu einem Misanthropen und Bärbeißer geworden, der gesellschaftliche Konventionen verachtete und nach seiner eigenen Fasson lebte. In einer konstitutionellen Monarchie, in der die Standesvorrechte des königlich-fürstlichen Hauses und die des Reichsadels in der Landesverfassung niedergeschrieben worden waren, war despektierliches Verhalten nicht vorgesehen. Der Leichenbeschauer wurde trotz seiner Schrullen noch im Amt geduldet, weil er auf seinem Gebiet ein exzellenter Fachmann war, für den sich nur schwerlich geeigneter Ersatz finden ließ.
Bei dem anderen älteren Herren handelte es sich um einen Besucher, auf dessen Gesellschaft der Leichenbeschauer nur gar zu gern verzichtet hätte: Der Kreisphysikus Franz von Baudessin war von dürrer, hochaufgeschossener Gestalt. Mit seiner spitzen Nase und den bleichen Gesichtszügen wirkte er wie ein Wiedergänger vom Totenacker. Doch er war ein Mann von großem Einfluss. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die gesundheitlichen Verhältnisse in der gesamten Stadt zu beobachten. Wenn seiner Meinung nach Gefahr im Verzuge war, konnte er die notwendigen Verfügungen erlassen, um beispielsweise gemeingefährliche Krankheiten abzuwehren. Damit hielt er eine große Machtbefugnis in den Händen. Aber er war ein Diener zweier, wenn nicht gar dreier Herren. Er unterstand sowohl dem Polizeipräsidenten als auch dem Regierungspräsidenten. Die Berufung in das Amt wiederum war durch den preußischen Minister für Kultus und Medizinangelegenheiten erfolgt.
Es lag in der Natur der Dinge, dass Franz von Baudessin aufpassen musste wie ein Luchs, wenn er nicht zwischen allen Stühlen sitzen wollte. Der Polizeipräsident, der Regierungspräsident und auch der Minister für Kultus und Medizinangelegenheiten waren in vielen Fragen völlig unterschiedlicher Meinung. Doch allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das bedeutete für das Amt eines Kreisphysikus, dass sich nur ein aalglattes, mit allen Wassern gewaschenes Naturell über längere Zeit auf diesem wohlbestallten Posten halten konnte.
Franz von Baudessin besaß zwar eine Approbation als Arzt und hatte seine medizinische Doktorwürde gemäß den gesetzlichen Vorschriften an einer preußischen Universität erworben, doch seine fachlichen Kenntnisse reichten bei weitem nicht an sein politisches Talent heran. Vor allem sein Hang zum Lavieren war der Grund dafür, dass er nicht zu den Freunden von Conrad Ackermann gehörte. Außerdem stand der Adlige bereits durch seine Herkunft eine gesellschaftliche Stufe über dem Leichenbeschauer. Aber ab und zu berührten sich ihre Kreise – so wie an diesem Tag.
Conrad Ackermann war zwar ein Hagestolz, aber kein Idiot. Als Gastgeber gab er sich Mühe, seinem Besucher alles zur Zufriedenheit zu richten, auch wenn er diesen nicht leiden mochte. Ohne zu zögern hatte der Leichenbeschauer an diesem Mittwoch die Morgengabe – einen Selbstmörder mit einem bösen Loch in der Brust, welches allem Anschein nach von einer Lafayette-Vorderladerpistole herrührte – wieder auf Eis gelegt, den Zinktisch gründlich geschrubbt und ein sauberes, nach Wäschestärke riechendes Laken aufgelegt. An und für sich war das Leinentuch dazu gedacht gewesen, nach getaner Arbeit die schweigsame Kundschaft damit zu bedecken. Aber das Laken erfüllte auch als Tischwäsche seinen Zweck. Nur ein Blumentopf hatte sich nicht so schnell herbeischaffen lassen, denn den Toten im Leichenschauhaus brachte kein Mensch Blumen.
Robert Jorbandt, der junge Assistent von Conrad Ackermann, war derweilen zum nächsten Krämer unterwegs, um frische Semmeln, Knackwürste und einen Krug roten Burgunder zu besorgen.
Der Kreisphysikus kam ohne Umschweife zur Sache: »Habt Ihr schon von den Ereignissen in Hamburg gehört oder gelesen?«
Conrad Ackermann beschloss, sich dumm zu stellen, und antwortete: »Nein, die Hansestadt gehört nicht zu meinem Einzugsgebiet.«
»Wenn Ihr Euch da mal nicht irrt, mein lieber inspector mortuorum. Euer Aufgabengebiet könnte sich schneller erweitern, als Euch lieb sein mag. In den vergangenen Tagen hat es nämlich mehrere ungeklärte Todesfälle an der Waterkant gegeben. Anhand der ausgeprägten Symptome fiel der Verdacht sofort auf Cholera. Dr. Theodor Rumpf, der Direktor des Eppendorfer Krankenhauses, versuchte den entsprechenden Erreger nachzuweisen. Es gelang ihm nicht. Schuld an diesem ictus incassus war jedoch keinesfalls das Nichtvorhandensein des Seuchenbazillus, sondern das Unvermögen meines geschätzten Berufsgenossen. Die Folgen traten sogleich ein und waren schwerwiegend. Es wurde nämlich voreilig Entwarnung gegeben. Dringend notwendige Abwehrmaßnahmen, und seien sie auch nur prophylaktisch gewesen, unterblieben gänzlich. Auf diese Weise verstrich wertvolle Zeit ungenutzt. Mein Hamburger Kollege, der ehrenwerte Medizinalrat Johann Kraus, wiegelte überdies ab und sprach davon, dass es sich um eine relativ harmlose, weil endemische Form der Ruhr handeln würde.«
»Lassen Sie mich raten«, warf Conrad Ackermann ein, »es war nicht an dem?«
»Wohl wahr, wohl wahr. Vor vier Tagen unternahm ein rühriger Arzt namens Dr. Eugen Fraenkel am Eppendorfer Krankenhaus einen weiteren Versuch. Ihm war mehr Erfolg als seinem Vorgesetzten beschieden. Der junge Heilfachmann fand in den Entleerungen eines Kranken den unverkennbaren vibrio cholerae, also den Cholera-Bazillus vor, und zwar in seiner schlimmsten Ausprägung, der asiatischen Form. Aber Doktor Fraenkel konnte mit seiner Entdeckung trotzdem nicht die Aufmerksamkeit erregen, die sie verdient hätte. Senator Gerhard Hachmann verbat sich jede Form von Panikmache. Doch nicht nur das. Der brave Tribun ließ sogar ungehindert mehrere Auswandererschiffe in Richtung der neuen Welt in See stechen, anstatt sie vorsorglich unter Quarantäne stellen zu lassen. Eine solche laxe Haltung wäre für einen preußischen Diener des Staates völlig undenkbar gewesen. – Doch sei dem, wie ihm wolle. Am 23. August, als die Sache bereits völlig aus dem Ruder gelaufen war, erhielt unser Kaiserliches Gesundheitsamt schließlich und endlich die offizielle Bestätigung aus Hamburg, dass tatsächlich eine Cholera-Epidemie ausgebrochen sei. Daraufhin wurde Professor Robert Koch, der Ihnen wohlbekannte Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten und Begründer der modernen Bakteriologie, schleunigst als Beobachter nach Hamburg entsandt. Sein Bericht erreichte mich gestern. Er ist niederschmetternd. In dem Avis heißt es unter anderem: ›Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln, die man mir gezeigt hat am Hafen, an der Steinstraße, in der Spitalerstraße oder an der Niedernstraße.‹ Hier, lest, was das Berliner Tageblatt heute zu berichten weiß.«
Auf der Seite drei der Zeitung fand sich unter der Überschrift »Zur Cholera-Gefahr« eine kleine Meldung, die leicht zu übersehen war, die es aber in sich hatte: »Vom 18. bis 23. d. Mts. sind in Hamburg 219 amtlich erfasste Personen unter choleraähnlichen Symptomen erkrankt, von denen 75 starben. Die Desinfektionsgeschäfte werden von Käufern förmlich umlagert. Die Desinfektionsmittel sind vielfach ausverkauft.«
Nachdem Conrad Ackermann die erschütternde Nachricht überflogen hatte, ergriff er das Wort: »Das ist alles sehr traurig, fürwahr, und mir krampft sich vor Mitleid mit den armen Menschen das Herz zusammen. Aber was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Wird mir demnächst frische Ware aus Hamburg geliefert werden?«
»Wohl kaum. Den dortigen Gesundheitsbehörden soll gebrannter Kalk in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Doch wir sind trotz der besseren sanitären Verhältnisse in Berlin akut gefährdet. Ihnen wird gewiss erinnerlich sein, dass es seit dem Jahr 1823 in Europa sechs große Cholera-Epidemien gegeben hat. Diesen Seuchen sind Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen. Ganze Landstriche wurden entvölkert. Die längste dieser Gottesgeißeln dauerte zehn Jahre, und zwar von 1847 bis 1857. Auch die Reichshauptstadt war mehrfach betroffen, wenn auch in einem wesentlich geringeren Ausmaße.«
»Gewiss, Exzellenz. Wie mir meine Eltern berichteten – der liebe Gott sei ihrer armen Seelen gnädig – wütete die Cholera anno 1831 zum letzten Mal in Berlin. Das ist also noch gar nicht so lange her. Rund tausendfünfhundert Erdgeschöpfe starben damals.«
»Ganz genauso war es. Unter den Toten befanden sich solch berühmte Persönlichkeiten wie der namhafte Philosophieprofessor Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die Stadt war zu jener Zeit in sechzig Cholera-Bezirke aufgeteilt worden. Sämtliche Krankheitsfälle wurden erfasst und die entsprechenden Häuser unter Quarantäne gestellt. Auf alle Formen der Zuwiderhandlung standen schwerste Strafen.«
»Und das steht uns nun bevor?«, wollte der Leichenbeschauer wissen.
»Noch nicht ganz, aber Ihr wisst nun in aller Deutlichkeit, was uns erwarten könnte. Schon das Sprichwort sagt: Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste. Zwischen Berlin und Hamburg besteht ein reger Reiseverkehr. Seit dem Jahr 1846 sind die beiden Städte durch die Eisenbahn miteinander verbunden. Seine Kaiserliche Hoheit hat bislang die Idee verworfen, den Zugverkehr komplett einstellen zu lassen. Die wirtschaftlichen Folgen wären zu gravierend. Die nordischen Königreiche sind da weniger zimperlich. Sie haben sämtliche Landverbindungen gekappt und den Schiffsverkehr nach Hamburg zum Erliegen gebracht.«
»Was wird stattdessen getan?«
»Vorerst werden die Bahnhöfe desinfiziert, und auf Zwischenstationen finden Waggonwechsel statt. Dabei untersuchen Ärzte die Passagiere. Feldscher und Kompagnie-Chirurgen haben darüber hinaus die Aufgabe zur Revision und Desinfizierung des Reisgepäcks übertragen bekommen. Alle diese Maßnahmen werden von der preußischen Landgendarmerie überwacht. Doch es liegt auf der Hand, dass mehrere infizierte Subjekte absichtlich oder zufällig durch die Kontrollen schlüpfen werden. Die Krankheit wird so oder so auch in unsere Stadt gelangen. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um einen massenhaften Ausbruch der Seuche zu verhindern.«
»Deshalb nochmals meine Frage: Was wollen Sie unternehmen, Exzellenz?«
»Zunächst wird seit heute der gesamte Postverkehr überwacht. Sämtliche Briefe aus Hamburg werden aussortiert und mit Chlordämpfen geräuchert, bevor sie die Adressaten zugestellt bekommen. Ihr kennt doch sicherlich die dreigeteilten Räucherkästen: Oben hinein kommen die Briefe. In der Mitte befinden sich hochprozentiger Essig und eine Mischung aus Schwefel, Salpeter und Kleie. Diese Essenzen werden mit glühenden Kohlen im untersten Fach erhitzt. Nach fünf Minuten dürften alle Bakterien abgetötet sein. Dann werden die Poststücke vorsichtig mit einer Federzange herausgenommen und mit einem Sanitätsstempel als unbedenklich gekennzeichnet.«
»Solch eine Apparatur habe ich bereits einmal gesehen.«
»Außerdem habe ich sämtliche Spitäler und alle niedergelassenen Ärzte der Stadt angewiesen, mir jeden Verdachtsfall schleunigst zu melden, damit diese Personen unverzüglich im Seuchenhaus isoliert werden können.«
»Aha, ich verstehe. Aber worin soll meine Aufgabe bestehen? In meinen Räumen Räucherkästen aufzustellen?«
»Nein, natürlich nicht. Nun stellt Euch nicht so begriffsstutzig an! Ihr sollt mir prompt über jeden Toten Bericht erstatten, der hier auf Eurem Tisch zu liegen kommt und bei dem die äußeren Symptome auf Cholera hindeuten.«
Der Leichenbeschauer fand, dass der Kreisphysikus bislang keinerlei Unsinn von sich gegeben hatte. Alles, was er sagte, schien Hand und Fuß zu haben. Vielleicht war Franz von Baudessin doch kein so schlechter Kerl, wie er geglaubt hatte.
Im nächsten Moment kam Robert Jorbandt zur Tür hereingestolpert. Der Assistent des Leichenbeschauers schleppte einen wohlgefüllten Weidenkorb, hievte ihn mühsam hoch und stellte ihn auf dem Tisch ab.