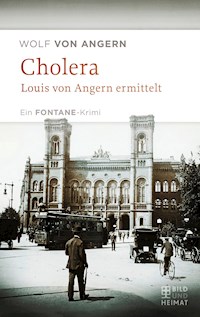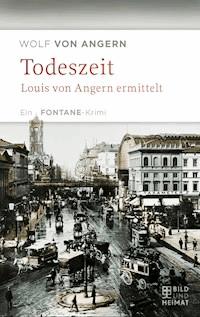
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mörderischer Osten
- Sprache: Deutsch
Am 1. April 1893 wurde im ganzen deutschen Kaiserreich die Mitteleuropäische Zeit eingeführt, und zwar nach den Balkanstaaten, Österreich-Ungarn und Italien, aber vor den nordischen Ländern und weit vor den Benelux-Staaten. Kriminalkommissar Louis von Angern untersucht einen Raubmord, der sich am 15. März 1893, also zwei Wochen vor eben jener historischen Zeitumstellung, in Berlin ereignet hat. Ein Jahr später kann er endlich einen Verdächtigen ausmachen. Er muss ihn aber wieder laufen lassen, weil der Beschuldigte für die Todeszeit ein hieb- und stichfestes Alibi hat, das durch mehrere unabhängige Zeugen bestätigt wird. Sein väterlicher Freund und Ermittlungspartner im Geiste Theodor Fontane gibt den entscheidenden Hinweis, dass die Zeitangaben falsch sein müssen. Sie differieren um die entscheidenden zehn Minuten, weil zum Zeitpunkt des Verbrechens noch die Berliner Zeit galt … Todeszeit beruht auf wahren Tatsachen, die sich als umfangreiches handschriftliches Konvolut im Nachlass des »echten« Louis von Angern fanden und die sein Enkel in ein romanhaftes Geschehen kleidete. Ein rasanter Krimi in der pulsierenden Hauptstadt des wilhelminischen Deutschland, ein vertrackter Fall, ein gewitzter Kriminalist und ein alternder Großschriftsteller als ermittelnder Ideengeber - kurzum: Ein unwiderstehliches Lesevergnügen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf von Angern
Todeszeit
Louis von Angern ermitteltEin Fontane-Krimi
Bild und Heimat
eISBN 978-3-95958-712-9
1. Auflage
© 2015 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © akg-images
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Für meinen Urgroßvater Louis Maria Helfricht von Angern (1846–1936) und natürlich für Claudia von KH
Namensverzeichnis
Ackermann, Conrad – Leichenbeschauer
Angern, Louis Maria Helfricht von – Kriminalinspektor
Angern, Florentine Therese von – seine Tochter
Angern, Therese von – seine Ehefrau
Angern, Trauthelm Louis von – sein Sohn
Altmann-Babzien, Leopold – Gymnasiast
Appuhn, Richard – Landmann
Arnstedt, Julius von – Werkführer
Bärenzung, Paul – Kriminalkommissar
Banck, Hermann – Bahnhofsvorsteher
Baudessin, Franz von – Kreisphysikus
Beguelin, Hugo von – Staatsanwalt
Bismarck, Otto Fürst von – Reichskanzler a. D.
Caprivi, Leo Graf von – Reichskanzler
Dennerlein, Sally – Prostituierte
Depaubourg, Cosima – Hausdame
Eppstädt, Eduard – Gendarm
Fontane, Theodor – Dichter
Fontane, Emilie – seine Frau
Fontane, Mete – seine Tochter
Frankenberg-Ludwigsdorf, Emil von – Richter
Germershausen, Dr. Eugen – Lehrer a. D.
Jorbandt, Robert – Assistent des Leichenbeschauers
Kröchlendorf, Oscar von – Essigfabrikant
Landshoff, Simon – Mörder
Madeheim, Gustav – Pedell
Plettner, Hans – Schaffner, Schutzmann
Richthofen, Bernhard Freiherr von – Polizeipräsident
Schlagenthin, Heinrich Graf von – Sekretär des Reichskanzlers
Seepolt, Georg – Berufsverbrecher
Unruh, Arthur von – Gefängnisdirektor
Wallmeyer, Siegmunde – Vermieterin
Einleitung
Meine Vorfahren stammen aus einem Ort namens Angern. Das ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Der Name leitet sich vom Dorfanger her, einem größeren Rasenplatz in der Mitte einer Ansiedlung. Ab dem Jahr 1160 ist die Herkunft meiner Familie durch Urkunden belegt. Einer meiner frühen Ahnen war Theoderich von Angern, der mit dem Markgrafen Heinrich dem Bären in die Altmark gekommen sein soll.
Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Dorf fast völlig zerstört. Der Zweig der Familie, von dem ich abstamme, flüchtete ins Umland und ließ sich später in Brandenburg an der Havel nieder. Dort kam es zu einer Vermischung mit den dort angesiedelten Hugenotten, in deren Folge mein Urgroßvater einen französischen Vornamen erhielt.
Louis Maria Helfricht von Angern wurde am 17. Februar 1846 geboren. Er war von klein auf wissbegierig, lernte bereits mit fünf Jahren Lesen und Schreiben und besuchte später erfolgreich die Ritterakademie in Brandenburg. Nach dem Ablegen der Reifeprüfung gab es für einen verarmten Adligen zur damaligen Zeit nur zwei ernsthafte Möglichkeiten für ein berufliches Fortkommen: entweder eine militärische oder eine geistliche Laufbahn einzuschlagen. Obwohl mein Urgroßvater das ganze Gegenteil von einem sturen Kommiss-Schädel war, entschied er sich für den Offiziersberuf und trat dem Kürassierregiment Nr. 6 bei. Dort machte er schnell Karriere. Im Deutsch-Französischen Krieg, in der Schlacht von Weißenburg am 4. August 1870, wurde er schwer verwundet, ehrenhalber zum Rittmeister befördert und nach seiner teilweisen Genesung am 25. Juni 1871 als dienstunfähig aus dem aktiven Dienst entlassen.
Anders als in den Kriegen danach sorgte sich das Land damals noch um seine malträtierten Helden. Louis von Angern hatte die Wahl zwischen einer Postmeisterstelle in Sangerhausen und dem Polizeidienst in der Reichshauptstadt.
Mein Urgroßvater entschied sich für die zweite Alternative und wurde im Rang eines Kommissars eingestellt. Lange Zeit hatte er sich nur um irgendwelchen Kleinkram zu kümmern, denn Berlin war damals kaum mehr als ein großes Dorf, das aus einem losen Verbund von separaten Ansiedlungen bestand. Ende 1871 lebten im gesamten Stadtgebiet gerade einmal 826 341 Einwohner.
Knapp zwanzig Jahre später hatte sich das Blatt radikal gewendet. Berlin drohte aus allen Nähten zu platzen. Der provinzielle Charme war verflogen. Billig gebaute, schnell hochgezogene Mietskasernen begannen das Stadtbild zu prägen. Die offizielle Einwohnerzahl hatte sich verdoppelt. Dazu kam eine große Zahl von illegalen Zuwanderern, Obdachlosen und Stadtstreichern. Eine Nebenerscheinung der Überbevölkerung war eine stetig wachsende Kriminalität, der staatlicherseits irgendwie begegnet werden musste. Eine Präsidialverfügung vom 26. April 1885 hatte bereits die Teilung der Berliner Kriminalpolizei in drei Inspektionen veranlasst.
Mein Urgroßvater wurde zur II. Inspektion versetzt, die sich den Gewohnheitsverbrechern widmete. Die Kriminalpolizei residierte damals am Molkenmarkt in einem Komplex von alten Bauwerken mit schmalen Höfen, düsteren Gängen und niedrigen Zimmern. 1889 zog die Kripo in das königliche Polizeipräsidium an der Südseite des Alexanderplatzes um. Mein Urgroßvater stieg in der Hierarchie weiter auf und wurde zum Dezernatsleiter befördert.
Louis von Angern war ein kulturinteressierter Mensch und ging häufig ins Schauspielhaus. Dort lernte er einen Theaterkritiker kennen, der Theodor Fontane hieß. Mein Urgroßvater freundete sich mit dem Journalisten an, obwohl dieser fast dreißig Jahre älter war als er. Die beiden verband vor allem eine gewisse Gemeinsamkeit des Wesens (sie konnten über dieselben Witze lachen), und die (wenigstens teilweise) Abstammung von den Hugenotten. So hatte beispielsweise Theodor Fontanes Vater ebenfalls mit Vornamen Louis geheißen.
Die Freundschaft blieb auch erhalten, nachdem Fontane dem Theater den Rücken gekehrt, den Journalismus an den Nagel gehängt und ein erfolgreicher Schriftsteller geworden war. 1892 erkrankte er an Gehirnischämie, einer schweren Durchblutungsstörung. Es bestand die Gefahr einer geistigen Umnachtung. Die unterschiedlichsten Kuren und Behandlungsmethoden wie Elektroschocks und Morphiumgaben blieben erfolglos. Schließlich verordnete der Hausarzt Dr. Wilhelm Delhaes als ultima ratio geistige Übungen, um die Gedanken des Kranken in ständigem Fluss zu halten und auf diese Weise ein Absterben der Gehirnwindungen zu verhindern. Theodor Fontane begann damit, seine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben und schwierige Rätsel zu lösen. Einen Teil der kniffligen Aufgaben steuerte mein Urgroßvater aus seiner täglichen Polizeiarbeit bei. Er weihte seinen Freund in schwierige Fälle ein, in denen es zumeist um Kapitalverbrechen ging und bei denen die Ermittlungen in eine Sackgasse geraten waren.
Theodor Fontane war viel gereist und hatte viel erlebt. Er verfügte über ein großes Allgemeinwissen und einen (immer noch) scharfen Verstand. Er wusste, dass bei der Analyse jeder Schandtat die beiden elementaren Fragen lauteten: Cui bono?Cui prodest? – Gut für wen? Wem nützt es? Auf diese Weise gelang es ihm tatsächlich, mehrere spektakuläre Fälle aufklären zu helfen und in der Folge letztendlich auch die Krankheit zu überwinden.
Mein Urgroßvater schied 1910 aus dem aktiven Polizeidienst aus. Er starb am 12. September 1936 – achtunddreißig Jahre nach seinem Freund – im hohen Alter von neunzig Jahren.
Wie ich von meinem Vater weiß, haben sich in unserem Familienbesitz zahlreiche Bücher mit handschriftlichen Widmungen von Theodor Fontane für Louis von Angern befunden. Sie sind alle im Zweiten Weltkrieg im Feuersturm verbrannt. Aber ein abgeschabter Lederkoffer, in dem sich mehrere Dutzend blauer Kladden mit handschriftlichen Notizen befinden, hat wie durch ein Wunder die Bombenangriffe überlebt. Das lädierte Gepäckstück ist glücklich von meinem Urgroßvater über meinen Großvater und meinen Vater auf mich gekommen.
Die Aufzeichnungen betreffen allesamt Kriminalfälle, an deren Lösung Theodor Fontane aktiv beteiligt war. Die Niederschriften sind nur stichpunktartig abgefasst und schwer zu lesen, weil sie von meinem Urgroßvater in altertümlicher Kurrentschrift zu Papier gebracht wurden. Oftmals fehlen wichtige Abschnitte oder Bezüge, die zum tieferen Verständnis dringend notwendig wären.
Lange Zeit wusste ich nicht, was ich mit dem Inhalt des Koffers anstellen sollte, bis ich eines Tages zufällig meinem Verleger davon erzählte. Er hielt es für eine gute Idee, die vergilbten Texte aufzuarbeiten.
Mein Urgroßvater soll – so hat es mir jedenfalls mein Großvater berichtet – ein begabter Geschichtenerzähler gewesen sein, der Pointen gut zu setzen wusste. Aber er war kein Literat. Er hat keine Romane verfasst. Das habe ich nun für ihn getan. Es handelt sich um keine Tatsachenberichte, weil ich die fehlenden Passagen mit Hilfe der Fantasie ergänzen musste. Dennoch ist das meiste tatsächlich so geschehen, wie ich es beschrieben habe.
Obwohl sämtliche Geheimhaltungsklauseln längst abgelaufen sind und nach über hundert Jahren auch keine Verletzungen von Persönlichkeitsrechten mehr zu befürchten wären, habe ich trotzdem einige Namen verändert. Die Toten, auch wenn sie Schurken waren, sie mögen in Frieden ruhen.
Einige Nebenschauplätze musste ich weglassen, um den Fluss der Handlung nicht zu stören, und aus dramaturgischen Gründen war es erforderlich, gewisse zeitliche Abläufe zu verändern. Vor allem die mit reichlich historischem Wissen gesegneten Leser mögen mir dies bitte nachsehen.
Wolf von Angern, Sommer 2015
1. Die Farben des Todes
Am Innerlichen mag es gelegentlich fehlen, das Äußerliche habe ich in der Gewalt.
Theodor Fontane 1854in einem Brief an Theodor Storm
Berlin, 15. März 1893
»Mord ist kein leichtes Geschäft. Es gibt viel zu viele Stümper«, dozierte Conrad Ackermann, seines Zeichens amtlich bestellter königlich-preußischer Leichenbeschauer, mit prüfendem Blick auf den ersten Neuzugang des Tages. Die Worte hatte er zwar an seinen Assistenten Robert Jorbandt gerichtet, aber er erwartete weder eine Erwiderung noch eine Frage nach dem Sinn dieser philosophischen Feststellung. Der junge Dachs von knapp zwanzig Lenzen hörte nämlich nur mit einem halben Ohr zu. Seit er der kalten Kundin ansichtig geworden war, hatte er ganz andere Sorgen, als seinen Wissensstand zu verbessern. Seine Nasenflügel bebten. Der Junge kämpfte mit einem heftigen Schluckauf. Auf seiner Stirn standen kalte Schweißtropfen. Die Gesichtsfarbe wechselte von gelb nach grün.
Sterbliche Überreste menschlicher Wesen, die sich im Zustand der Verwesung befanden, boten niemals einen angenehmen Anblick, ganz gleich welchen Alters und welchen Geschlechts sie als lebende Geschöpfe vormals gewesen waren.
Die Dichter verklärten gern das Sterben. Sie sprachen gern vom Heldentod auf dem Feld der Ehre (sofern sie nicht selbst zu den Betroffenen zählten). Aber am Krepieren war nichts Heroisches. Sobald die Seele den Körper verlassen hatte, begann der Knochensack zu verwesen. Er war im selben Moment völlig nutzlos geworden. Alles Menschliche fiel von ihm ab und verwandelte sich in Dreck und Gestank.
Der Prinzipal griente kaum merklich. Er musste an jenen unerfreulichen Moment in seinem Leben denken, als er zum ersten Mal vor einer drei Wochen alten Wasserleiche gestanden hatte. Da hatte er sich so einiges durch den Kopf gehen lassen, unter anderem das Frühstück.
Die meisten Menschen waren bereits den vielfältigen Farben des Todes kaum gewachsen. Dazu zählten das fahle Antlitz der Verblichenen, das tiefe Schwarz geronnenen Blutes, das dunkle Blau der Hämatome und das giftige Violett der Livores, der Totenflecken.
Doch damit nicht genug. Viel schlimmer waren der Kotgestank und jener süßliche Aasgeruch, der entstand, wenn ein Körper in Fäulnis überging und von Gasen aufgebläht wurde. Wer einmal das zweifelhafte Vergnügen gehabt hatte, eine Nase voll davon zu nehmen, der vergaß den Pesthauch sein Leben lang nie wieder.
Conrad Ackermann hatte schon viele Assistenten kommen und gehen gesehen. Die meisten dieser jungen Menschen waren viel zu dünnhäutig und zu sublim gewesen, um diesen unappetitlichen Beruf auf Dauer ausüben zu können. Auch Robert Jorbandts Karriere würde sicherlich enden, bevor sie richtig begonnen hatte. Der Junge war ein Schwärmer, ein Schöngeist. Vermutlich las er sogar Goethe und wollte sich vor lauter Lebensüberdruss umbringen, wie es der junge Werther getan hatte. Es ermangelte ihm eindeutig an der für diesen Beruf notwendigen speziellen Konditionierung. Da konnte auch die wunderbare Aussicht auf ein auskömmliches Einkommen in diesen schweren Zeiten nichts daran ändern.
Conrad Ackermann waren in seinem Berufsleben Dinge vor Augen gekommen, die einen labilen Charakter längst ins Irrenhaus gebracht hätten. Der vierschrötige Mann von Anfang fünfzig stand im Dienste des preußischen Staates, seitdem das Königliche Leichenschauhaus, vom Volksmund zuweilen die »Berliner Morgue« genannt, aus einer alten Bruchbude in einen komfortablen Neubau in der Hannoverschen Straße 6 umziehen konnte.
Der schlichte dreistöckige gelbe Klinkerbau mit seinem rot abgesetzten Giebel machte von außen nicht viel her, aber innen war er nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eingerichtet worden. Der Erfolg hatte nicht lange auf sich warten lassen. Infolge der besseren Untersuchungsmöglichkeiten war die Aufklärungsquote bei den Mordfällen spürbar angestiegen.
Und so wie jeden Tag mussten auch in diesem Fall wieder aus dem Gesamtbild Rückschlüsse gezogen werden, die auf den Täter hinweisen konnten.
Auf dem Zinktisch lag eine nackte weibliche Leiche, die zahlreiche Stich- und Schnittwunden aufwies. An ihrer rechten großen Zehe hing ein karierter Zettel. Er steckte in einer Zelluloidhülle, die ihn vor Körperflüssigkeiten schützen sollte. Auf dem Kästchenpapier stand in akkurater Kanzleischrift vermerkt: Dennerlein, Sally, wbl., 25 J., Schneiderin & Häklerin, Wohnort: Eldenaer Str. 5, Fundort: Mulackstr. 12.
»Schau dir doch nur dieses Pfuschwerk an«, meinte der Leichenbeschauer verärgert und deutete auf den Oberkörper der ermordeten Frau. »Dieses sinnlose Herumgestochere muss jeden Experten grausen. Der eine Stich ins Herz wäre völlig ausreichend gewesen. Ein Kenner der Materie hätte sich sofort damit zufriedengegeben. Aber der hirnlose Schächer wollte sein Opfer nicht nur töten, sondern es auch noch entehren. Deshalb hat er noch fünf weitere Male zugestochen und ebenso täppisch an dem Torso herumgesäbelt. Das war eine völlig überflüssige Kraftanstrengung. Der Bursche hätte stattdessen lieber Fersengeld geben sollen.«
Der Leichenbeschauer hielt einen Moment lang inne, umkreiste die Tote einmal und setzte seine Lektion dann fort: »Die Folge dieser törichten Gewaltorgie war, dass sich dieser Volltrottel von Kopf bis Fuß mit Blut eingesaut haben muss. Es ist wie eine Fontäne aus der linken Herzkammer gespritzt, als er den Dolch wieder aus dem Stich zog.
Unsere preußischen Gendarmen mögen sicherlich nicht die hellsten Kirchenlichter auf der guten Mutter Erde sein, aber einen blutüberströmten Wüstling, der wie von Sinnen die Mulackstraße hinunterhetzt, können auch sie kaum übersehen. Nun hat der Mörder den Salat und sitzt hinter Gittern. Und bald wird er am Halse aufgehängt und hoch oben am Galgen baumeln. Die Raben freuen sich schon auf einen Festtagsschmaus. Die Augäpfel sind ihnen am liebsten. Die picken sie zuerst aus.«
Robert Jorbandt bekam weiche Knie.
Der Leichenbeschauer erinnerte sich: »Früher, als ich jung an Jahren war, da gab es noch Mörder, die ihr Metier verstanden. Das waren echte Virtuosen im Umgang mit dem Stilett. Die hatten eine solide Ausbildung genossen und waren stolz auf ihre Berufsehre. Doch das Handwerk ist verdorben. Inzwischen glaubt jeder dahergelaufene Volltrottel, er sei ein Paganini mit dem Messer.«
Robert Jorbandt spürte, wie ihm ein unangenehmes Gefühl die Speiseröhre heraufkroch. Um sich abzulenken, nahm der Assistent seinen ganzen Mut zusammen und fragte: »Wer ist der Delinquent? Vermutlich ein verschmähter Liebhaber? Was war seine Veranlassung, derartig auszurasten? Eifersucht? Herzensleid?«
»Du siehst, ohne zu begreifen. Was steht auf dem Zettel?«
»Das arme Ding war Näherin.«
»Und wo hat sie gewohnt?«
»In der Eldenaer Straße.«
»Wofür ist diese Gegend berühmt?«
»Keine Ahnung.«
Der Leichenbeschauer seufzte tief. »Mein Jungchen, du hast noch viel zu lernen. Daselbst befindet sich der Berliner Schlachthof. Unter anderem. Außerdem ist in diesem Viertel auch noch der Seuchenhof angesiedelt. Da riecht es nicht ganz so gut wie hier in dieser freundlichen Kemenate. In jenem ungemütlichen Distrikt wohnen nur die Ärmsten der Armen. Sie waschen sich in der Gosse und halten sich Ratten als Haustiere, die so groß sind wie Katzen. Vor den Fenstern liegen verschimmelte Abfallhaufen. Das sind die Speisekammern. Jeder, der Hunger hat, darf sich bedienen. Zwei Berufsstände sind dort vor allem vertreten: Sickergrubenreiniger und Leimkesselrührer aus der Knochenmühle. Der Rest schlägt sich als Almosenempfänger durch. Morgens brocken sie sich zerknackte Kakerlaken in den Frühstücksbrei. Das gibt eine leckere Würze.«
»Na gut, dann wird wohl ein Raubmord ausgeschlossen sein«, entgegnete Robert Jorbandt, inzwischen leicht gereizt ob des unaufhörlich sprudelnden Redeschwalls seines Vorgesetzten. »Gold und Juwelen sind also höchstwahrscheinlich nicht abhanden gekommen.«
»Davon kannst du mit Sicherheit ausgehen«, grummelte Conrad Ackermann. »Das Geschäft einer Schneiderin und Häklerin wird in Sicht- und Geruchsnähe zum Seuchenhof nicht besonders gut laufen. Deshalb musste sich das Fräulein Dennerlein noch etwas dazuverdienen. Das hat sie anderenorts in der Mulackstraße getan. Dort war sie als Bordsteinschwalbe unterwegs. Sieh her, die Zeichen sind überdeutlich: Das liederliche Frauenzimmer ist übermäßig stark geschminkt, seine Augenbrauen sind gezupft, und die Haare wurden gepudert.«
»Wozu dient das Puder?«
»Es soll einen Wohlgeruch verströmen und hält die Läuse fern.«
»Also gut«, konstatierte der junge Assistent, wobei er mit dem ständig stärker werdenden Würgereiz kämpfte, »sie war eine Metze. Das ist noch lange kein Grund, sie umzubringen, denn davon sind in Preußen mehr als genug unterwegs.«
»In London, das ist die Hauptstadt von Engelland, hat es vor fünf Jahren mehrere Morde an Dirnen gegeben. Der Verbrecher wurde nie gefasst. Vielleicht ist er eines natürlichen Todes gestorben, oder er hat sich umgebracht. Die Presse hatte ihn Jack the Ripper genannt. Als unser Berliner Hurenmörder kommt er nicht in Frage, denn er wird wohl kaum nach Deutschland ausgewandert sein. Obendrein hat sich der Schächer von der Spree viel zu dilettantisch verhalten. Aber vielleicht handelt es sich bei ihm um einen Nachahmungstäter. Viele Leute, die auf dem Abort in einem alten Journal blättern, kommen auf die seltsamsten Ideen. Sie wollten schon lange dem irdischen Jammertal entfliehen und wissen nun endlich, wie sie das anstellen können: Sie verabschieden sich mit einem Paukenschlag.«
»Oder der Kerl war sehr wütend.«
»Davon können wir ausgehen.«
»Doch womit kann ein Freudenmädchen einen Freier derart zur Weißglut treiben?«
»Indem sie über einen winzigen Piephahn lacht oder weil sie ihm die Franzosenkrankheit angehext hat.« Der Leichenbeschauer blickte zum Fenster. »Hoffentlich hält sich dieses famose Wetter noch eine Weile. Sobald es nämlich wieder warm wird, fangen die Leichen an, bestialische Odeurs auszuströmen. Im Vergleich dazu riecht es dann in einer Abdeckerei wie in einer Parfümerie.«
Für den Assistenten war damit das Maß des Erträglichen überschritten. Der Inhalt seines Magens drängte nach oben.
Conrad Ackermann sah ihn mitleidig an, ging zu einem braunen Schränkchen an der Wand, holte einen bauchigen Steinkrug hervor und goss drei Fingerbreit einer öligen hellen Flüssigkeit in ein schmieriges Wasserglas. »Trink das, Jungchen. Das ist hochprozentiger Fusel. Der holt dir die Farbe ins Gesicht zurück.«
Robert Jorbandt schaute zweifelnd auf.
»Du musst dir die Nase zuhalten und alles auf einmal hinunterkippen. Dann darfst du auf keinen Fall einatmen, sondern du solltest tief ausatmen und dabei alle Luft aus deinen Lungen pressen.«
Der junge Mann tat folgsam, wie ihm geheißen. Anschließend schüttelte er sich und stöhnte herzzerreißend. Aber das Mittel schien nicht zu helfen. Die bereits kränklich grüne Gesichtsfarbe wich einem noch tieferen Grün.
Robert Jorbandt eilte zum halbrunden Ausguss an der gekachelten Wand und begann sich geräuschvoll zu übergeben. Seine Knie schlotterten. Ihm liefen Tränen des Ekels und des Selbstmitleids über das Gesicht. Er fühlte sich erniedrigt.
Conrad Ackermann genehmigte sich nun selbst ein Gläschen. Allerdings griff er nicht nach dem bauchigen Steinkrug mit dem Brechmittel, sondern nach einer Glasflasche mit einem kräftigen Kümmel. »Willst du auch noch einen Schnaps?«
Conrad Jorbandt konnte nur abwinken, dann brach die nächste Welle der Übelkeit über ihn herein.
Conrad Ackermann beobachtete die Entgleisung seines Assistenten mit dem Interesse eines Schmetterlingssammlers, der einen frisch aufgespießten Fang begutachtete. Der Ärger über den stümperhaften Mörder war verflogen. Der Leichenbeschauer zündete sich einen pechschwarzen Stumpen an, dessen ätzender Qualm nach verkohlten Lumpen roch und welcher dem unerträglichen Gestank, der bereits die Luft verpestete, eine weitere widerliche Komponente beimischte.
*
Der Winter zur Jahreswende 1892/1893 war lang und frostig gewesen. Keinesfalls so kalt wie der harte Winter 1847 – der in Berlin einen Hungeraufstand hervorgerufen hatte, welcher in die Geschichtsbücher als die »Kartoffelrevolution« einging – aber schier endlos und eisig genug. In den Mietskasernen mussten wochenlang unzählige Wohnungen ungeheizt bleiben. Billiges Brennmaterial war knapp geworden. Hungrige Wildtiere auf der Suche nach Nahrung drangen in ihrer Not bis weit in die Stadt vor. Auf den vereisten Feldern und in den tief verschneiten Wäldern gab es für sie schon lange nicht mehr genug zu fressen.
Es hatte bis Anfang März gedauert, ehe die Temperaturen tagsüber wieder leicht über den Gefrierpunkt gestiegen waren. Das dicke Eis auf der Spree begann allmählich zu tauen. Doch mit dem Einbruch der Dunkelheit hatte Tag für Tag erneut beißender Frost eingesetzt und die Straßen in eisige Rutschbahnen verwandelt.
Am Mittwoch, dem 15. März 1893, änderte sich das Wetter abrupt. Passend zum abnehmenden Mond hatte diesmal bereits nachts die Kälte stark nachgelassen. Schon in den frühen Morgenstunden stiegen die Temperaturen weit in den Plusbereich. Es war der erste warme, sonnige Tag seit langem. In der Luft lag ein Hauch von Frühling. Wenn das milde Wetter weiterhin anhielt – und es sah ganz danach aus –, würden bald die schmutzig schwarzen Schneeberge an den Straßenrändern verschwunden sein. In den Fallrohren gluckerte das Tauwasser. Ab und an klatschte nasser Schneematsch von den Dächern auf die Straßen.
Doch von diesen Widrigkeiten ließen sich die Kummer gewohnten Berliner Bürger kaum abschrecken. Die Straßen und Gassen belebten sich schlagartig wieder. Allerorten herrschte ein buntes Gewimmel. Die meisten Leute strömten in Richtung der Stadtteilzentren. Groß-Berlin war im Laufe der Jahrhunderte immer weiter gewachsen und hatte mehrere komplette Städte ringsum geschluckt. Ein Ende dieser Entwicklung ließ sich nicht absehen. 1861 waren Moabit und 1878 ein Teil der Feldmark von Lichtenberg dazugekommen. Mehrere weitere Eingemeindungen, die ganz offiziell »Einverleibungen« genannt wurden, standen an.
Der geografische Mittelpunkt Berlins verschob sich infolgedessen von Jahr zu Jahr. Momentan bildete ihn die Siegesallee mit dem Siegesdenkmal am Königsplatz, wo vis-à-vis seit 1884 das Reichstagsgebäude errichtet wurde. Inzwischen stand das Symbol der Volksvertretung kurz vor seiner Fertigstellung.
Das eigentliche Zentrum der Reichshauptstadt war jedoch der Alexanderplatz. In seiner Mitte schlug das Herz der Großstadt. Dort trafen mehrere breite Boulevards sternförmig aufeinander: die Alexanderstraße im Nordwesten, die Neue Königsstraße im Nordosten, die Landsberger Straße im Osten, die Alexanderstraße im Süden und die Königsstraße im Westen.
Nach den vergangenen ruhigen Wochen war am Alex bereits wieder das Verkehrschaos ausgebrochen. Ein- und zweispännige Kutschen, Droschken, Pferdeomnibusse, Kremser, Fahrradfahrer, Pferdebahnen, Herrenreiter, Journalieren, Kleinhändler mit zweirädrigen Schiebewagen, Eselskarren und andere ländliche Fuhrwerke bildeten ein dichtes, hin- und herwogendes Knäuel, das sich ständig unentwirrbar zu verheddern drohte. Irgendwo mitten im Getümmel ließ sich sogar das laute Knattern eines einzelnen Benz Victoria Motorwagens vernehmen, der lustige blaugraue Qualmwölkchen ausstieß. Die Unfallstatistik würde bald von neuem in die Höhe schnellen, so viel war gewiss.