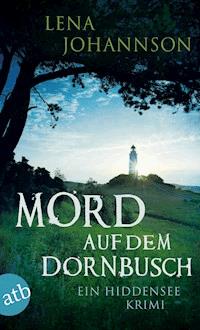Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berühmte Paare – große Geschichten
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, so bewegend wie Rilkes Verse.
Als der umschwärmte Dichter Rainer Maria Rilke die junge Bildhauerin Clara Westhoff das erste Mal sieht, ist er hingerissen: von ihrer Schönheit, ihrer Durchsetzungskraft, ihrer Leidenschaft für die Kunst. Als Clara das erste Mal ein Gedicht aus seinem Mund hört, ist sie ihm erlegen – wider besseres Wissen. Denn Rilke gilt als unstet und macht dazu noch ihrer Freundin und Malerin Paula Becker den Hof. Dennoch entspinnt sich zwischen den beiden eine intensive Liebe, die sich nicht nur über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch Inspiration bietet für einige der bis heute schönsten Liebesgedichte ...
Bestseller-Autorin Lena Johannson gibt spannende Einblicke in die Künstlerkolonie Worpswede und erzählt von einer besonderen Liebe.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
1900: Nach einem längeren Aufenthalt in Paris und Unterricht bei dem großen Meister Auguste Rodin, kommt Clara Westhoff nach Worpswede. Bei ihren Künstlerkollegen hat sie ständig gegen Vorurteile kämpfen müssen: Die Bildhauerei ist und bleibt eine Männerdomäne. Ob sie das in der Künstlerkolonie, die so viele Freigeister versammelt, endlich hinter sich lassen und sich ganz der Arbeit widmen kann? Als Rainer Maria Rilke nach Worpswede kommt, liegen ihm, dem bekannten Dichter, die Frauen zu Füßen. Die Trennung von Lou Andreas-Salomé schmerzt ihn sehr, nun will er hier, in der Einsamkeit und unter Gleichgesinnten Kraft schöpfen, um wieder arbeiten zu können. Doch dann lernt er Clara Westhoff und Paula Becker kennen, zwei Freundinnen, die unterschiedlicher nicht seien könnten und die ihn beide in ihren Bann ziehen …
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie als Reisejournalistin ihre beiden Leidenschaften Schreiben und Reisen verbinden konnte. Sie lebt als freie Autorin an der Ostsee.Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Hamburg-Saga: »Die Villa an der Elbchaussee«, »Jahre an der Elbchaussee« und »Töchter der Elbchaussee«, die Jungfernstieg-Saga: »Die Frauen vom Jungfernstieg – Gerdas Entscheidung«, »Die Frauen vom Jungfernstieg – Antonias Hoffnung« und »Die Frauen vom Jungfernstieg – Irmas Geheimnis«, die ersten beiden Bände der Nord-Ostsee-Saga »Zwischen den Meeren« und »Nach den Gezeiten« lieferbar, die Romane »Die Malerin des Nordlichts«, »Dünenmond«, »Rügensommer«, »Himmel über der Hallig«, »Der Sommer auf Usedom«, »Die Inselbahn«, »Liebesquartett auf Usedom«, »Strandzauber«, »Die Bernsteinhexe«, »Sommernächte und Lavendelküsse« und ihre Kriminalromane »Große Fische« und »Mord auf dem Dornbusch«.Mehr zur Autorin unter www.lena-johannson.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Clara und Rilke
Eine Liebe zwischen Worten und Farben
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Clara: Kapitel 1 — Paris 1899 / 1900
Rainer: Kapitel 2 — Sommer 1900
Clara: Kapitel 3 — Sommer 1900
Rainer: Kapitel 4
Clara: Kapitel 5
Rainer: Kapitel 6
Clara: Kapitel 7
Rainer: Kapitel 8
Clara: Kapitel 9
Rainer: Kapitel 10
Clara: Kapitel 11
Rainer: Kapitel 12 — 26. September 1900
Clara: Kapitel 13
Rainer: Kapitel 14
Clara: Kapitel 15
Rainer: Kapitel 16 — Frühjahr 1902
Clara: Kapitel 17 — Mai 1902
Epilog
Nachbemerkung
Dank!
Personenverzeichnis
Quellenverzeichnis
Nachweis der Zitate
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
»Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn, wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören, und ohne Füße kann ich zu dir gehn, und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand, halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen, und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werd ich dich auf meinem Blute tragen.«
Clara
Kapitel 1
Paris 1899 / 1900
Konnte etwas langweiliger sein, als diese zierliche, auffallend hübsche junge Frau? Große blaue Augen, das kastanienfarbene Haar fiel ihr in einer perfekten Welle über ihre Schulter. Ein weißes Tuch, akkurat in Falten gelegt, lag um ihre Taille und verbarg ihren Schoß. Ausdruckslos starrte sie über die Köpfe der Malschülerinnen hinweg. War sie überhaupt ein Mensch oder eine Skulptur? Claras Gedanken wanderten wehmütig zu ihrer ersten Plastik, dem Gips-Porträt einer hohlwangigen Armenhäuslerin. Die war zweifellos ein Mensch gewesen, eine Frau, der die Arbeit auf dem Land und die Last eines schweren Lebens Spuren in den Körper gemeißelt hatten. Clara unterdrückte ein Seufzen und zeichnete sorgfältig die Linien der anmutig angewinkelten Arme nach. Jedes Modell sollte ihr recht sein, war es auch noch so fade. Es schulte dennoch ihre Beobachtungsgabe. Trotzdem, Clara hätte Paris für moderner gehalten, sie hatte erwartet, dass man sich hier mehr für leer getrunkene Brüste, für gebeugte Rücken und zerfurchte Gesichter interessierte als für das Makellose. Vielleicht war es in den Männerklassen so. Oder es hing mit Valerianes ausgeprägtem Faible für das Erhabene zusammen. Valeriane war die Massière, die Sprecherin der Damenklasse, und hatte über die Auswahl der Modelle zu entscheiden. Nach Rücksprache mit ihren Mitschülerinnen, wohlgemerkt. Clara tauchte die Borsten in den mit Weiß versetzten Umbra-Ton, den sie für einen Schatten brauchte. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Sie hatte Valeriane einmal daran erinnert, dass es nicht um ihre Vorlieben ginge, sondern darum, die Wünsche aller Schülerinnen zu berücksichtigen.
»Dessen bin ich mir bewusst. Aus diesem Grund frage ich euch jede Woche nach euren Vorstellungen. Was ist daran falsch?«, hatte sie geantwortet und überraschte Kulleraugen zu einem Schmollmund gemacht.
»Nichts ist falsch«, hatte Clara entgegnet. »Ich wundere mich nur darüber, dass meine Bitten seit vier Wochen ungehört bleiben.«
Valeriane hatte eine Miene aufgesetzt, in der sie all ihre Abscheu bündelte, und einen Ton angeschlagen, als müsse sie einem Kleinkind eine unumstößliche Regel des Lebens erklären.
»Weil du allein damit bist. Weil deine Vorschläge dem entgegenstehen, was alle anderen an der Akademie zu lernen wünschen. Warum sollten wir uns mit dem Groben beschäftigen, mit dem Hässlichen und Unvollkommenen?«, hatte sie gefragt, und Clara hatte erkennen müssen, dass Valeriane nicht der gute Wille fehlte, sondern wahrhaftig das Verständnis. Es wollte ihr einfach nicht in den Kopf, dass es jemandem nicht um eine ansprechende Darstellung gehen könnte, sondern darum, Ungerechtigkeiten und Missstände einzufangen. »Frankreich folgt, ich möchte sagen: glücklicherweise, nicht dem dummen Pfad des Modernen. Es ist das Hübsche, das unseren Bleistift und unseren Pinsel führen soll, das, was unserem Auge Genuss bereitet, nicht, was es erschreckt.«
Ein Klatschen riss Clara aus ihren Gedanken.
»Schön, schön, das war es für heute und für dieses Jahr.« Bertin steckte seine Uhr in die Westentasche und blickte fröhlich lächelnd in die Runde. »Ich freue mich, Ihre Entwicklung im nächsten Jahr weiter zu beobachten und zu begleiten, meine Damen.« Bertin war ein guter Lehrer. Er lobte viel, kritisierte aber auch. Gerade Letzteres brachte einen als Künstlerin weiter, jedenfalls sofern die Kritik mit konkreten Hinweisen einherging, warum etwas als misslungen betrachtet wurde. Clara rollte ihre Pinsel in einen alten Lumpen, und die Palette bedeckte sie mit einem Stück Zeitungspapier, ehe sie das Stoffbündel mit einem Band an deren Unterseite befestigte. Sie spürte den Zorn zurückkehren. Kurz vor ihrer Abreise nach Paris hatte Clara mit ihrer Freundin Paula und mit Marie Bock in Bremen ausgestellt. Wie ungerecht war die Kritik gewesen! Von Kritik konnte nicht einmal die Rede sein, es war nur das Gejammer eines Mannes gewesen, der das Alte nicht loslassen konnte. Sie schob die Farbtuben unter die Laschen der Ledermappe und rollte diese dann auf. In der Mittagsausgabe des Weserkuriers hatte sich der sogenannte Kritiker darüber echauffiert, dass es Maries und Paulas Studien überhaupt in die Kunsthalle geschafft hatten. Er hatte ausgeführt, wie schmerzlich er es empfunden hatte, dass echte Kunstschätze für etwas Derartiges ihren Platz hatten räumen müssen. Was sollten Marie und Paula damit anfangen? Wie sollten sie vorankommen, wenn sie nur Hohn und Spott ernteten statt fachlicher Ratschläge? Am Ende verstand dieser Schreiberling vielleicht nur nicht den modernen Ansatz, das Neue in ihrer Kunst. Und wenn das so war, wie sollte Clara sich dann darüber freuen, dass er ihr für ihre drei Büsten ausgesprochenes Talent bescheinigt hatte? Sie verstaute ihre Utensilien in ihrer Tasche, jedes Ding hatte seinen festen Platz. So hatte es sich bewährt, nichts purzelte übereinander, alles war geschützt und für den nächsten Einsatz griffbereit. Wie immer am Ende einer Stunde, schwoll das Geplapper um sie herum an. Es kam ihr an diesem Dezembertag besonders laut vor, und Clara sehnte sich nach ihrem stillen Worpswede. Einige ihrer Mitschülerinnen hatten Talent, andere waren durchaus ehrgeizig, keine von ihnen träumte jedoch davon, die Kunst als Beruf auszuüben. Sie ließen sich von ihren Eltern oder Ehemännern die teuerste Privatschule von Paris bezahlen, um ein wenig Zerstreuung zu genießen, um ihren Freundinnen in der Schweiz, in Amerika und Russland später von ihrem Aufenthalt zu erzählen, von den Cafés in Montparnasse und den Museen zu schwärmen. Auch Clara ließ sich die Ausbildung hier von ihren Eltern finanzieren. Sie war von Herzen dankbar, dass Mutter und Vater etwas für Kunst übrig hatten und sie unterstützten.
Das hatten sie schon vor vier Jahren getan, als Clara ihnen erklärt hatte: »Ich werde Malerin, das weiß ich sicher!« Siebzehn war sie da gewesen, wild und ungestüm. Ihre Eltern hatten sie nach München gehen lassen, wo sie an der privaten Malschule von Friedrich Fehr und Ludwig Schmid-Reutte lernen durfte. Aber hatte ihr das gereicht? Sie klemmte ihre Tasche unter den Arm und schob ihren Stuhl unter den Arbeitstisch. Ein letzter Blick, ob sie alles sauber und ordentlich hinterließ. Die anderen Frauen waren schon mit Bertin gegangen, nun schloss Clara die Tür hinter sich.
»Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, Mademoiselle.« Robert tauchte aus der Dunkelheit auf, die sich von einer einzigen Petroleumlampe in dem langen fensterlosen Gang vor dem Damenatelier nicht vertreiben ließ. Clara erkannte ihn trotz der schummrigen Beleuchtung sofort an seiner gebeugten Haltung, als wäre er ein alter Mann. Dabei mochte er kaum älter sein als sie. »Oder besser: ein gutes neues Jahrhundert!« Auch seine Stimme schien jemandem zu gehören, der den Zenit seines Lebens längst hinter sich gelassen hatte. Sie knarzte wie die Stufen im Grand Hôtel de la Haute Loire.
»Danke, Robert, das wünsche ich Ihnen auch.«
Für einen Augenblick hatte sie das Gefühl, er wollte noch etwas sagen, doch er schwieg. Wie immer. Er hätte sich auch sehr beeilen müssen, sie in ihrem Schwung aufzuhalten. Mit entschlossenen, schnellen Schritten durchquerte sie den Korridor an dessen weißen Wänden Aquarelle hingen, und erreichte auch schon das Treppenhaus. Sie sprang die Stufen hinab, manchmal zwei auf einmal nehmend, und trat hinaus auf die Rue du Dragon.
Die Tasche unter dem Arm, und die Hände tief in ihren Manteltaschen, verließ sie die schmale Gasse. Es war nicht weit bis zur Werkstatt, die ebenfalls zur Akademie Julian gehörte. Wie erwartet, trieben sich auch an diesem Tag und bei dieser Kälte auf dem Boulevard Gestalten herum, deren Anblick Clara erschütterte. Gleichzeitig war sie fasziniert. Zerschlissene speckige Mäntel, schmutzige Hände reckten sich Passanten um ein paar Centimes entgegen, die Nägel brüchig und schwarz, die wollenen Handschuhe schienen nur aus Löchern zu bestehen, Finger hatten sie ohnehin keine. Sie gingen gebeugt, ein Mann trug anstelle einer Jacke eine Decke um die Schultern, die über das Kopfsteinpflaster schleifte. Das wäre etwas, das sie malen wollte! Rissige Lippen, kaum Zähne oder nur Stümpfe, Pusteln auf der zu früh gealterten Haut. Plötzlich trat der Mann mit einem Satz auf sie zu und schnitt eine Grimasse. Da erst wurde ihr bewusst, dass sie ihn die ganze Zeit angestarrt hatte.
»Excusez-moi!«, murmelte sie, reichte ihm eine Münze und ging eilig an der Kirche von St.-Germain-des-Prés vorbei, weiter in die Rue de l’École de Médecine und bog auf den Boulevard Saint Michel ein. Erst dort verlangsamte sie ihr Tempo ein wenig und atmete aus. Nur noch einmal links abbiegen, dann hatte sie den Place de la Sorbonne erreicht und war am Ziel. Clara hatte noch Zeit, ehe ihre nächste Stunde begann. Sie überlegte, ob sie sich irgendwo ein Hörnchen kaufen sollte.
»Clara, natürlich, überpünktlich wie immer«, hörte sie da eine vertraute Stimme hinter sich. Sie drehte sich um. Vor ihr stand Karl, die Baskenmütze leicht schief auf dem Kopf, wie die Franzosen sie trugen.
»Guten Tag, Karl. Du bist auch früh dran. Ausnahmsweise.« Sie lächelte. Karl Albiker und sie waren im gleichen Alter und in der gleichen Bildhauerklasse.
»Ich wollte wenigstens noch einmal einen guten Eindruck machen, ehe das Jahrhundert unwiderruflich zu Ende geht.«
»Was nur alle haben?« Clara schüttelte den Kopf. »Es ist auch nur ein Jahreswechsel. Kein Grund, so ein Theater darum zu veranstalten.«
»Ich bitte dich, wir treten ins 20. Jahrhundert ein. Eine schöne runde Zahl. Sie lässt sich viel besser modellieren als die neunzehn.«
Clara lachte. »Aus der Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet.«
»Also, wie wirst du die letzte Nacht des alten Jahr– …« Er stockte kurz, »… des alten Jahres verbringen?«, beendete er den Satz. »Gehst du aus? Mit Robert vielleicht?«
Sie wusste, dass er es nicht böse meinte, trotzdem ärgerte sie sich, dass sie ihm davon erzählt hatte. Ihre Mitschülerinnen des Damenateliers behaupteten, Robert habe ein Auge auf Clara geworfen. Sie kannte gerade mal seinen Vornamen und hatte gehört, er sei der Sohn eines berühmten Malers. Weil er aber nicht die Ergebnisse ablieferte, die sein Vater von ihm erwartete, musste er sich als eine Art Hausmeister in der Rue du Dragon verdingen. Dabei sollte er ein erstaunliches Talent besitzen, erzählten ihre Mitschülerinnen, nur sei sein Stil eben vollkommen außergewöhnlich. Alles nur Gerüchte, wahrscheinlich sogar Märchen. Ihr war es gleichgültig, sie war bestimmt nicht nach Paris gekommen, um einen Mann kennenzulernen. Stadt der Liebe. Damit war sie einverstanden, wenn die Liebe zur Kunst gemeint war.
»Ich kann dir genau sagen, was ich tun werde: Schlafen! Am Neujahrstag wird Paula ankommen. Da will ich ausgeruht sein.« Ein warmes Gefühl flutete bei dem Gedanken an die baldige Ankunft ihrer Freundin durch Claras Brust.
»Der arme Kerl. Hat er dir inzwischen eigentlich seine Liebe gestanden?« Karl konnte es nicht lassen.
»Hör schon auf damit!«, sagte sie streng. »Es ist nur das Geplapper einiger dummer Gänse, das weißt du genau. Sie reden hinter meinem Rücken auch schrecklichen Unsinn über mich, nehme ich an.«
»So? Was denn zum Beispiel? Dass es absonderlich ist, wenn eine Frau mit Hammer und Meißel auf einen Granitblock losgeht und sich freiwillig mit Staub und Lärm umgibt? Haben sie damit etwa nicht recht?«
»Fang du nicht auch noch damit an!« Sie holte tief Luft. »Max Klinger war auch der Meinung, Frauen könnten keine Bildhauerinnen werden, weil sie für handwerkliche Tätigkeiten einfach nicht geeignet seien. Erst als er erfahren hat, dass ich …«
»…, dass du hundertsechzig Pfund wiegst, hat er dich mit Marmor arbeiten lassen. Ich kenne die Geschichte, Clara.«
Sie gingen hinein. Clara zog das Leinentuch von dem rot geäderten Stein, der sie seit zwei Wochen beschäftigte. Sie würde den Gipsabdruck ihrer rechten Hand überlebensgroß in das weiß und rosé schimmernde Material übertragen. Sie sah zu Karl hinüber. Auch er hatte sein Objekt abgedeckt, einen männlichen Akt.
»Ich habe dir aber noch nicht erzählt, dass es Fritz Mackensen war, der mich von der Malerei zur Bildhauerei gebracht hat. Er hat mir das Studium bei Klinger überhaupt erst ermöglicht. Das werde ich ihm nie vergessen.« Allmählich füllte sich das Atelier. »Mackensen hat mich von Anfang an ernst genommen. Das hätte ich mir in München gewünscht.« Sie verdrehte die Augen.
»Wieso, was war da los? Ich dachte, du hättest dort eine gute Schule genossen? Hast du nicht gesagt, du hättest sogar Kurse im Aktzeichnen und der Anatomie gehabt?«
»Schön wär’s gewesen.« Sie schüttelte erbost den Kopf und klemmte sich gleich darauf eine Strähne hinter ihr Ohr, die sie an der Wange kitzelte. »Der Unterricht war ohnehin schon teuer, Akt hat extra gekostet. Zur Anatomie wurde ich nicht einmal zugelassen.« Karl schien diese Tatsache nicht zu beeindrucken. Natürlich nicht, es war so üblich, dass Frauen davon ausgeschlossen waren, weil sie dem Lehrstoff angeblich weder körperlich noch geistig gewachsen waren.
»Denk dir, ich bin sogar beim bayerischen Minister für Cultus und Unterricht vorstellig geworden. Warum erhalten die Herren die Stunden kostenlos, für die wir Damen zahlen müssen, habe ich ihn gefragt. Warum bleiben ihnen einige Bereiche gar vollständig vorbehalten? Das ist nicht gerecht und muss sich ändern!« Zwei Studenten tuschelten miteinander und lachten. Es kümmerte sie nicht. »Dieses Ekel von einem Minister hat mich mit dummen Ausreden abgespeist. Als ob ich nicht gemerkt hätte, dass er keinesfalls gewillt war, sich für mein Anliegen einzusetzen.«
»Du hast ihn hoffentlich nicht in seinem Beisein so tituliert.« Karl lachte. »Besser ich erwähne nicht, dass ich dich kenne, wenn ich nach München gehe.«
Der Lehrer betrat das Atelier und begrüßte seine Schüler.
»Eine Weile bleibst du aber noch in Paris, oder?«, flüsterte Clara. »Du willst dir doch die Weltausstellung nicht entgehen lassen. Ich werde mit Paula ganz sicher hingehen.«
Seit vier Wochen war Clara nun in Paris. Am Vormittag besuchte sie den Zeichenkurs in der Rue de Dragon, danach ging sie in die Bildhauerklasse. Am späten Nachmittag kehrte sie zurück ins Grand Hôtel de la Haute-Loire an der Kreuzung Boulevard Raspail und Boulevard de Montparnasse. Immer der gleiche Ablauf, auch an diesem Freitag. Doch in drei Tagen würde alles anders werden, es würde noch schöner werden. Denn dann kam Paula. Sie war das beeindruckendste Wesen, die talentierteste, mutigste Malerin und beste Freundin, die sich Clara nur vorstellen konnte.
Sie betrat das Hotel, ihre Augen brauchten sich nicht umstellen, drinnen war es ebenso düster wie an einem Dezembertag zu dieser Stunde draußen. Im schwachen Schein der Petroleumlampen, die die ausgetretene schmale Treppe in flackerndes Licht tauchten, stieg Clara die Stufen in den fünften Stock hinauf. In ihrer Kammer zündete sie Kerzen an und rieb sich die eisigen Hände. Sie hatte Paula in Worpswede kennengelernt. Clara liebte den Ort mit seiner Ruhe, seiner herrlichen Natur. Birken, Weiden und Kiefern, die Moorkolonien mit ihren grasbewachsenen Reet-Katen und Rinnsalen, die das ganze Land durchzogen. Und dann natürlich die großen Künstler, in deren Ateliers Clara und die anderen Malschülerinnen stets willkommen waren. Als Paula dort auftauchte, war es, als habe sich das letzte Steinchen in ein Mosaik gefügt. Mit ihr war Claras Welt vollkommen geworden. Was brauchte sie mehr als ihre Kunst, einen so göttlichen Ort und eine Seelenverwandte? Paris war das ganze Gegenteil von Worpswede, laut, hektisch voller Menschen, aber auch voller Inspiration. Sie freute sich auf die gemeinsame Zeit mit Paula hier. Für den Anfang würden sie sogar in derselben Pension wohnen.
Karl hatte sie einmal gefragt: »Wie hältst du es nur aus in dieser Absteige? Sie vermieten noch die Besenkammer als Suite, nur, weil die Bohème das Montparnasse-Viertel für sich entdeckt hat und alle dort wohnen wollen.«
Es stimmte schon. Clara ärgerte sich so manches Mal über die Spinnenweb, die Kälte, die dünnen Wände. Im Zimmer neben ihrem wohnte ein Maler, der angeblich schon mehrere Ausstellungen bestritten hatte und darauf wartete, dass eine hübsche kleine Atelierwohnung in Montparnasse auf der linken Seite der Seine frei wurde. Clara war ihm nie begegnet, sie kannte nur den Geruch seiner Zigaretten, deren Qualm durch die papierdünne Zimmerwand zu ihr herüberzog. Wenn schon! Solange sie sich nur vollständig auf ihre Ausbildung konzentrieren konnte, war ihr alles recht. Und so würde es auch Paula empfinden. Unter den vielen Gemeinsamkeiten, die sie verbanden, war vielleicht diejenige die stärkste, dass sie die Mal- und Bildhauerklassen nicht als nette Episode zur geistigen Bildung für eine dann folgende Ehe sahen, sondern als ebenso notwendige wie aufregende Voraussetzung, um den Beruf ausüben zu können, den sie sich gewählt hatten.
Kunst war für sie kein Zeitvertreib, Kunst war ihr Lebenselixier.
Am Abend des ersten Januar 1900 traf Paula in Paris ein. Obwohl sie in der Nacht zuvor losgefahren war, wirkte sie strahlend frisch, als sie aus dem Zug stieg. Sie lächelte, ihre wachen Augen schienen die ganze Stadt innerhalb der ersten Minute aufnehmen zu wollen. Das kupferrote dicke Haar war im Nacken zu ordentlichen Rollen aufgesteckt, bemerkte Clara, als Paula den Kopf drehte, um nach ihr Ausschau zu halten. Es sah nicht aus, als hätte Paulas Frisur Stunden in einem schaukelnden Abteil überstehen müssen, sondern als seien die Wellen eben erst geformt worden.
Clara riss eine Hand in die Höhe, Paula entdeckte sie und lachte vor Freude. Die beiden fielen sich in die Arme.
»Hattest du eine angenehme Reise? Was gibt es Neues in Worpswede? Was treiben Otto, Fritz und Heinrich? Du musst mir alles erzählen!«
Sie schoben sich durch die Menschen, die den Bahnsteig bevölkerten, in Richtung Ausgang und riefen sich in der Rue de l’Arrivée einen Wagen heran. Sie hätten die paar Meter zwar ebenso gut zu Fuß gehen können, doch für die Koffer und Taschen brauchten sie Hilfe. Während der Kutscher das Gepäck verstaute, machten die beiden es sich also bequem und breiteten ein Fell über ihre Beine aus.
»Es ist alles beim Alten«, antwortete Paula auf Claras Fragen. »Otto Modersohn füllt ein Skizzenbuch nach dem nächsten. Oh, er soll wohl mit Fritz Overbeck Zeichnungen für einen Kölner Schokoladenproduzenten anfertigen. Ich weiß nicht, ob es nur eine Anfrage ist oder schon mehr. Aber du kannst dir sicher vorstellen, was los ist. Während die einen vor Neid kochen, weil sie selbst zu gern einen gewiss lukrativen Auftrag hätten, der ihren Namen obendrein bekannter macht, regen sich die anderen darüber auf, das sei Lohnmalerei, bei der nichts weiter herauskommen könne als dekorativer Tand ohne jegliche weltanschauliche Aussage.«
Clara stutzte, dann musste sie lachen.
»Es scheint wahrhaftig alles beim Alten zu sein.«
»Sage ich doch. Aber jetzt erzähl du«, forderte Paula sie auf, ihre Augen blitzten. »Hattest du schon Zeit, den Louvre zu besuchen?«
»Natürlich! Ich könnte jeden Tag Stunden in der Skulpturenabteilung verbringen. Wir müssen unbedingt zusammen hingehen.«
»Das werden wir! Wir werden Paris auf den Kopf stellen. Ach Clara, ich habe mich so darauf gefreut. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Und was das Wichtigste ist: Wir werden unsere Technik prächtig weiterentwickeln.«
Clara nickte. »Es war die richtige Entscheidung, auf Max Klinger zu hören und herzukommen, so gern ich auch nach Worpswede zurückgegangen wäre.«
Paula regelte in der Pension die Formalitäten, Clara spürte unterdessen diesem dunklen Gefühl nach, das sich auf ihr Gemüt gelegt hatte. Sie musste nicht lange nachdenken, um zu wissen, was die Wiedersehensfreude trübte. Es war die Erinnerung an Vaters Reaktion auf ihren Entschluss, in Paris studieren zu wollen. Er hatte ihr die Lehrzeit in München finanziert und auch ihren Aufenthalt in Leipzig, wo sie in Klingers Atelier nach der Malerei endlich die Arbeit mit Ton und Stein erlernen durfte. Wie stolz war sie gewesen, dass Klinger ihr Relief eines Knaben derartig lobte, das sie ganz ohne Hilfe Abend für Abend nach den offiziellen Lektionen in der drückenden Augusthitze geschaffen hatte. Und dann die Ernüchterung: Ihr Vater war nicht länger bereit, Monat für Monat zu zahlen, wenn ihr Talent am Ende womöglich doch nicht reichte, »um es zu etwas zu bringen«, wie er sich ausdrückte. Wie viel Kraft hatte es sie gekostet, ihn noch einmal umzustimmen. Schließlich hatte sie ihm vorgeschlagen, Porträts auf Bestellung anzufertigen. Um dafür Reklame zu machen, hatte sie eine Plastik nach dem Vorbild von Großmutter Laura geschaffen, das hatte ihn dann wohl überzeugt. Sie war ihr auch ausgesprochen gut gelungen, von der faltigen Haut bis zu ihrer Brosche hatte einfach alles gestimmt. Vor allem war Clara stolz darauf, das Verwelkte der alten Frau ebenso eingefangen zu haben wie ihre Würde, der die Jahre nichts hatten anhaben können. Ihr Vater bezahlte also auch für Paris. Vorläufig. Doch seither fühlte Clara ständig den Druck, nennenswerte Ergebnisse abliefern und mit ihrer Kunst möglichst bald Geld verdienen zu müssen.
Clara besuchte weiterhin die Klassen bei Julian, Paula dagegen lernte bei Colarossi. Gemeinsam gingen sie in die unentgeltlichen Anatomiestunden der École des Beaux Arts. Nach einer solchen nahm Paula Clara bei der Hand. Es war inzwischen März geworden, und die Sonne verwöhnte sie mit einer Ahnung von Neubeginn und baldigem Frühling. Wo mochten sich all die Katzen versteckt haben, die mit einem Mal die Gassen bewohnten, sich mitten im Weg mit abgespreiztem Hinterbein putzten oder auf den sich langsam aufheizenden Steinen wärmten?
»Habe ich nicht schon immer gesagt, dass die größte Schönheit in den einfachsten Bildern liegt? Ich werde dir heute den Beweis erbringen.« Paula klang regelrecht aufgekratzt. Sie mussten einen langen Fußmarsch bewältigen, doch es war herrlich. Alle Welt war auf den Beinen, Jungen pfiffen hübsche Melodien, Haushälterinnen, auf dem Weg zum Markt, summten ein Lied oder grüßten eine alte Dame, die auf einem Balkongeländer lehnte und von oben das Treiben beobachtete.
»Die frische Luft ist eine Wohltat«, erklärte Paula und nahm auf der Pont Royal einen tiefen Atemzug. »An der Leiche kann man die Muskeln natürlich viel besser erkennen als an den lebenden Modellen. Wenn sie nur nicht so unangenehm riechen würde. Ich bekomme jedes Mal Kopfschmerzen.«
»Die lebenden Modelle lassen sich nun mal nicht so gern aufschneiden«, konterte Clara schulterzuckend.
Sie durchquerten den Garten der Tuilerien, bogen ab in die Rue St. Anne, liefen eine Weile geradeaus, bis sie schließlich die Rue Laffitte erreicht hatten. In der Nummer sechs lag die Galerie von Ambroise Vollard. Sie war vor allem für zeitgenössische Kunst bekannt.
»Guten Tag, die Damen«, begrüßte ein junger, ein wenig blutleer aussehender Angestellter sie. »Sehen Sie sich gern um.« Damit zog er sich in eine Ecke zurück und Paula konnte Clara die Werke zeigen, für die sie den Weg gemacht hatten.
»Paul Cézanne«, flüsterte sie. »Es ist, als hätte ich in ihm mein Spiegelbild gefunden.«
»Nur wegen eurer Vornamen? Paula und Paul. So einfach ist das?«, neckte Clara sie.
»Du sollst mich in einem so ernsten Moment nicht auf den Arm nehmen«, beschwerte Paula sich. »Du brauchst nur hinzusehen, um zu wissen, was ich meine.«
Das konnte Clara nicht leugnen. Wirklich, es gab Parallelen zwischen Paulas Porträts einfacher Landfrauen und Cézannes Frau mit Kaffeekanne. Keine perfekt ausgearbeiteten Details, keine Überfrachtung mit Kleinigkeiten, sondern die ganze Konzentration auf den Ausdruck gelegt.
»Vollard hat die ersten Werke von Cézanne aus dem Nachlass eines Farbenhändlers gekauft«, berichtete Paula. Sie sprach leise, ehrfürchtig, als befänden sie sich in einer Kathedrale. »Das musst du dir vorstellen, er hat seine Farben mit Bildern bezahlt. Heute kann Vollard Tausende Francs für ein einziges verlangen.« Dass Paula, deren Stil tatsächlich einiges mit seinem gemein hatte, sich noch immer von manchem Kritiker anhören musste, ihre Bilder seien ein schlechter Scherz, blieb unausgesprochen. Es gab ein Landschaftsbild aus Cézannes Heimat, der Provence, und ein Gemälde, das Clara besonders faszinierte. Lange stand sie vor Junge mit roter Weste und studierte die Körperhaltung des Knaben. Als sie die Galerie verließen, war Paula still. Kein Wort mehr zu Cézanne und seinen Werken. Clara hatte das Gefühl, die Freundin brauchte eine Weile, um ihre Eindrücke in sich aufzubewahren.
Mit jedem Tag wurde die Luft wärmer, Knospen an Bäumen und Sträuchern sprangen wie auf ein geheimes Kommando auf und tauchten die Stadt in einen süßen schweren Duft. Clara und Paula arbeiteten unermüdlich, doch sie genossen auch die Fülle, die das Leben in Paris ihnen bot. Clara empfand manches Mal eine solche Leichtigkeit, dass sie am liebsten über die Boulevards gehüpft wäre wie ein kleines Mädchen. Sie war inzwischen den rauchenden Zimmernachbarn los. Nicht, weil er ausgezogen wäre, sondern weil sie ein kleines Appartement in der Rue Dareau gefunden hatte. Sie ging mit Paula ins Café de Flore, wo sich alle trafen, die in der Kunstwelt einen Namen hatten oder das von sich meinten. Sie aßen kleine Gebäck-Kunstwerke im Café de la Paix am Place de l’Opéra und veranstalteten Atelierfeste mit Mandolinen- und Gitarrenspiel, tanzten unter Lampions, aßen Erdbeerpudding und tranken Wein.
An einem lauen Nachmittag verabredeten sie sich mit Karl Albiker in der Crèmerie von Madame Charlotte, die der Akademie Colarossi gegenüber lag.
»Bonjour, nur herein!«, rief ihnen Charlotte Caron zu. Die Wirtin stammte aus dem Elsass und sprühte vor Temperament. »Hier ist noch viel Platz.« Sie lachte schallend. Die Wahrheit war, dass das winzige Lokal für acht Menschen bequem war, zehn konnte es auch noch gut aufnehmen, es drängten sich aber meist zwanzig oder mehr zusammen. Auch an diesem Tag waren schon über zwölf da, die meisten Kunststudenten, da wäre Clara jede Wette eingegangen. Madame Charlotte betrachtete sich ein wenig als die Mutter aller jungen Künstler und ließ sie anschreiben oder Wein und Pastis mit Bildern bezahlen. Entsprechend zierten Kunstwerke jeden freien Zentimeter vom Fußboden bis hinauf zur Decke. Sogar die Fassade des Hauses, in dem sich das Café befand, war als Bezahlung bemalt worden.
Karl kämpfte sich in eine Ecke vor, wo er noch einen Stuhl ergatterte. Clara und Paula folgten ihm.
»Die Zeit der Impressionisten ist vorüber«, hörte Clara einen jungen Mann mit wilder dunkler Lockenmähne sagen. »Wenn ihr mich fragt, waren sie von Anfang an überschätzt.«
»Mein Reden«, bemerkte Paula lächelnd. »Ich sage schon lange, dass Monet handwerklich gewiss über jeden Zweifel erhaben ist, aber inhaltlich?« Sie sah erst Karl an, dann Clara. »Seine Darstellungen der Natur sind leider allzu oberflächlich.«
Schon wieder ging die Tür auf, und zwei weitere Gäste traten ein. Einer war Alfons Mucha, ein Stammgast. Clara schätzte ihn auf vierzig Jahre, sie hatte ihn schon bei ihrem ersten Besuch in der Crèmerie gesehen. Ein interessanter Mann, der erst spät zur Kunst gefunden und sich als Bühnenmaler erste Sporen verdient hatte. Sein größter Erfolg, hatte Clara gehört, war das Veranstaltungsplakat, das er für ein Theaterstück mit Schauspiel-Diva Sarah Bernhardt entworfen hatte. An diesem Tag kam Mucha in Begleitung einer Frau mit Schnurrbart. Die Dame sah sich um, arrogant, als warte sie nur darauf, angestarrt zu werden. Clara fand das einigermaßen lächerlich. Sie konnte nicht viel mit Menschen anfangen, die durch Äußerlichkeiten von sich reden machten statt durch ihre Arbeit. Das Raunen, das durch die Schar der Gäste ging, galt nicht der Frau mit Bart, sondern dem Mann, der nach ihr das Lokal betrat und zu Mucha aufschloss: Paul Gauguin.
»Sieh einer an, da haben wir Glück«, flüsterte Karl.
»Tatsächlich«, wisperte Paula, »ich dachte, er lebt jetzt irgendwo in der Südsee.«
»So ist es auch. Er ist in der Stadt, um mit Vollard einen Vertrag zu machen«, verriet er leise. »Ich hab da was munkeln hören, dass Vollard ihm zu einem festen monatlichen Betrag eine bestimmte Zahl von Bildern abnimmt. Wäre das erste Mal, dass Gauguin seine finanziellen Sorgen los wäre«, raunte er ihnen zu.
Clara beobachtete den berühmten Mann mit dem dunklen Schnauzer. Seine ebenfalls dunklen Haare trug er nach hinten gekämmt, eine Stirnlocke war augenscheinlich jedoch nicht zu überreden, dort zu bleiben.
»Bitte, Alfons, lass uns woanders hingehen, die Luft ist ja nicht auszuhalten«, schimpfte Gauguin, die Enge machte ihm sichtlich zu schaffen.
»Hoffentlich bleibt er.« Paula war hingerissen. »Von ihm ist mehr zu erwarten als von Monet, da bin ich sicher.«
»In der Kunst möglicherweise, aber nicht in diesem Café«, gab Karl zu bedenken und grinste. »Obwohl … Vielleicht taucht auch noch August Strindberg auf, dann fliegen hier die Fetzen, und wir bekommen ein Schauspiel geboten, das sich gewaschen hat.« Er lachte. Madame Charly, wie sie von allen genannt wurde, stellte ihnen ungefragt eine Karaffe Wein und drei Gläser hin. Clara war es eigentlich noch zu früh für Alkohol, aber das spielte in Paris keine Rolle.
»Strindberg? Ist der nicht unter die Mystiker gegangen?«, wollte Paula wissen.
»Das hält ihn nicht davon ab, Streit zu suchen. Gauguin würde ihm sicher leicht einen Anlass liefern.«
Clara hatte kürzlich gelesen, der Schriftsteller sei mit einer sehr jungen Schauspielerin gesehen worden.
»Auch einer von denen, die Frauen so schnell wechseln wie ihre Oberhemden«, sagte Paula prompt.
»Wer denn noch?« Karl sah sie mit großen Augen an. »Mich kannst du nicht meinen.«
»Dich doch nicht.« Paula lachte fröhlich, dann warf sie Clara einen tiefen Blick zu. »Ich spreche von Rodin.«
»Heißt es nicht, er hat den Frauen abgeschworen, weil er noch immer um seine Geliebte Camille Claudel trauert?«, fragte Clara ernst. Sie hatte den Gedanken an Rodin seit ihrer Ankunft in Paris, so gut es ging, aus ihrem Kopf verbannt. Sie wollte zu ihm gehen, von ihm lernen, gleichzeitig hatte sie große Angst, dass er sie ablehnen könnte, dass sie nicht gut genug für den Meister war.
Karl lachte laut, Madame Charly, die sich gerade wieder durch das Gewühl ihrer Gäste schob, gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»So viele von euch Künstlern sind schwermütig. Ich werde nie verstehen, warum. Das Leben ist schön! Du machst es richtig, junger Mann, du lachst. Wir müssen alle viel mehr lachen.« Sie tat es auf der Stelle und balancierte ein Tablett an ein Tischchen ein paar Schritte weiter. Karl blickte ihr nach.
»Rodin wird den Frauen nie abschwören, der alte Schwerenöter«, sagte er dann. »Er kann nicht ohne Frauen, das hat er selbst oft genug gesagt. Und eine wie Camille findet er gewiss kein zweites Mal. Eine, die mit Tugenden nichts anfangen kann, weil sie davon gelangweilt ist, die sich einen Ehemann nur anschaffen würde, um ihn gehörig zu ärgern.« Wieder lachte er, doch dann verschwand die Fröhlichkeit aus seinem Gesicht. »Man hört, ihr geht es mit der Trennung deutlich schlechter als ihm. Es ist eine Schande, sie soll dem Alkohol mehr zugeneigt sein als ihr guttut. Wenn sie so weitermacht, verwahrlost sie vollkommen. Das sagen jedenfalls die Leute. Schlimm.« Er schüttelte den Kopf. »Ist sie nicht eine deiner Zunft?« Er sah Clara an.
An ihrer Stelle antwortete Paula ihm: »Eine Bildhauerin ist sie, ganz recht. Und Rodins Schülerin. Träumt nicht jede Frau, die zu Hammer und Meißel greift, davon, von Rodin unterrichtet zu werden?«
»Wer weiß, worin er sie unterrichtet hat«, bemerkte Clara leise. Karl hatte es dennoch gehört.
»Ich dachte, dir fehlt das Gespür für Beziehungen, die über das Künstlerische hinausgehen.«
»Wie kommst du darauf?« Paula sah ihn überrascht an. »Die Signale, die der arme Robert aussendet, scheint sie jedenfalls zu übersehen.«
»Es gibt keine Signale«, erklärte Clara ein wenig zu grob. »Selbst wenn, interessieren sie mich tatsächlich nicht. Dafür bin ich nicht hergekommen.«
Glücklicherweise öffnete sich die Tür der Crèmerie und die nächsten Gäste drängten hinein. Clara hoffte, die beiden seien damit von dem Thema abgelenkt, doch so war es nicht.
»Welcher Typ Mann interessiert dich?«, wollte Karl von ihr wissen.
»Keiner«, antwortete sie prompt. »Ich will ungestört arbeiten, dazulernen und mich künstlerisch entwickeln. Um nichts anderes geht es.«
»Aber stell dir vor, es gäbe einen, der dich darin unterstützt«, warf Paula ein. Ihre wachen Augen blickten Clara neugierig an. »Was wäre, wenn ein Mann, selbst Künstler vielleicht, sich erst für deine Skulpturen begeistern würde, ehe er dir den Hof macht?«
Eine interessante Vorstellung. Clara dachte nach: »Einer, mit dem ich über die Bilder von Modersohn, Overbeck, von Picasso und Cézanne reden könnte, der mit mir stundenlang im Louvre stehen und Statuen betrachten würde?«
»Genau so einer!« Paula strahlte. Karl beobachtete die beiden vergnügt.
»Ein Mann, der mit dem verbrauchten Körper einer Bäuerin mehr anfangen kann als mit dem makellosen eines jungen Fräuleins«, schwärmte Clara weiter.
»Einspruch!«, rief Karl und lachte. »Das ist nun wirklich zu viel verlangt.«
»Aus rein künstlerischer Sicht!« Paula kicherte.
»Einer, der das Leben sieht, wie es ist«, erklärte Clara beinahe feierlich. »Jemand, dem die Schattenseiten, das Düstere und Grobe als Motiv dienen und der es auch mir zugesteht. Das ist meine Idee von einem perfekten Mann.«
»Unsere Idee«, korrigierte Paula. »Und unser Traum«, setzte sie leise hinzu.
Am nächsten Tag taten Paula und Clara endlich, was sie sich schon lange gewünscht hatten. Sie fuhren in einem neu eröffneten Aufzug hinauf auf den Eiffelturm.
»Von unten mag er eine scheußliche Säule aus genietetem Metall sein«, stellte Clara fest. »Aber er ermöglicht uns einen unvergleichlichen Ausblick. Sieh dir das an! Als würde man auf eine Spielzeuglandschaft schauen. Wir können von oben auf Dächer und Balkone sehen. Wo gibt’s denn so was?«
Paula nickte, der Wind, der über die Besucherplattform fegte, wirbelte ihre Haare auf, dass sie züngelnden Flammen glichen.
»Es ist atemberaubend. Er überragt alle anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt.«
»Sogar alle anderen Gebäude der Welt!«, ergänzte Clara und ließ den Blick über den Garten vom Trocadéro, über die Seine und auf der anderen Seite bis zum Jardin Luxembourg wandern. Sogar den Friedhof von Montparnasse konnte man von hier oben erkennen.
»Ich glaube, ich sehe sogar das Atelier von Rodin!«, rief Paula plötzlich.
»Wo?« Clara kniff die Augen zusammen. Das war nicht möglich. Angestrengt starrte sie an dem grünen Viereck entlang, das der Cimetière bildete. Doch sie sah nur Dächer, dazwischen Gassen. Eine wie die andere. Fragend wandte sie sich Paula zu. Deren keck-amüsierte Miene war Antwort genug. »Und ich bin auch noch darauf hereingefallen«, sagte Clara seufzend.
»Du warst noch immer nicht bei ihm, stimmt’s?«, wollte Paula wissen. Dabei kannte sie die Antwort doch. »Worauf wartest du? Klinger hat dir nicht nur empfohlen, nach Paris zu gehen, er hat dir dringend ans Herz gelegt, dich bei Rodin vorzustellen.« Als ob Clara nicht selbst ständig daran dachte. Sie trat einen Schritt näher an das Geländer, um Paulas forschendem Blick zu entgehen. Wenn die wüsste, dass sie doppelt ins Schwarze getroffen hatte. Das Institut Rodin lag zwar ein gutes Stück von hier am Boulevard de Montparnasse, sein Atelier im staatlichen Marmordepot dagegen befand sich unweit des Eiffelturms und konnte durchaus zu erkennen sein. »Am Ende fährst du zurück nach Hause, ohne den Meister auch nur einmal getroffen zu haben. Das werde ich nicht zulassen«, behauptete Paula.
»Was ist, wenn ich nicht gut genug bin?«, brach es aus Clara heraus. »Auguste Rodin! Ich würde es nicht ertragen, wenn er mich ablehnt.«
»Das wird er nicht tun«, beruhigte Paula sie.
»Das kannst du nicht wissen.«
»Du auch nicht, Clara. Nicht, ehe du ihm eine Kostprobe deines Könnens gegeben hast.« Sie zwinkerte fröhlich. »Keine Sorge, er wird aus dir schon nicht gleich die nächste Camille machen wollen.«
Gleich am nächsten Sonnabendnachmittag fasste sich Clara ein Herz. Da war Rodins Atelier für jedermann geöffnet. Es stimmte ja, Klinger hatte ihr eingeschärft, sich bei ihm vorzustellen und ihr sogar ein Empfehlungsschreiben mitgegeben. Wenn er erführe, dass sie keinen Gebrauch davon gemacht hatte, müsste sie sich in Grund und Boden schämen. Was noch schwerer wog: Sie würde es sich selbst nie verzeihen, wenn sie sich diese Gelegenheit entgehen ließe. Also besuchte sie klopfenden Herzens das Marmordepot. Es war eine beeindruckende Halle, vollgestellt mit Plastiken, Gipsabgüssen und Tischen, auf denen das Werkzeug lag. An den Wänden hingen Skizzen, Entwürfe. Die Luft schmeckte nach Stein. Die meisten Abdrücke im Staub, der den Boden vollständig bedeckte, stammten von Männerschuhen. Es wurde leise gesprochen und viel gehustet. Clara sah sich um, da entdeckte sie den Meister im Gespräch mit zwei sehr teuer gekleideten Herren. Hätte sie nicht eine unendlich große Ehrfurcht vor dem berühmten Bildhauer, sie hätte laut losgelacht, so absurd war der Gegensatz, den er zu den beiden Männern bildete. Er trug einen ganz und gar von Staub bedeckten Kittel, falsch geknöpft, so, dass er schief über seiner massigen Gestalt hing. Das graue kurze Haar bedeckte den großen, kantig wirkenden Schädel wie dichtes Gras eine Wiese, die Augen ruhten geduldig auf seinen Gesprächspartnern, vielleicht Organisatoren der diesjährigen Weltausstellung. Clara hatte gehört, Rodin war dort mit einem eigenen Pavillon vertreten. Unter der breiten Nase schien es nichts anderes zu geben als einen wilden Bart, der Rodins Wangen, seine Oberlippe und das Kinn vollständig verdeckte und ihm bis auf die Brust reichte. Rodin zeigte den beiden Herren gerade einen kleinen Gegenstand, den er von einem der Arbeitstische genommen hatte. Die Büste eines jungen Mädchens, wenn Clara sich nicht irrte. Sie war automatisch ein paar Schritte näher getreten, um besser sehen zu können. Plötzlich löste sich Rodin aus der Gruppe, kam zu ihr herüber und reichte ihr das kleine Werk aus Gips.
»Ich begrüße sie in meinem Reich, Mademoiselle.« Seine Augen hatten einen warmen, beinahe liebevollen Glanz. »Mir scheint, sie interessieren sich für diese Büste.«
»Ich wollte nicht neugierig erscheinen.« Clara schämte sich schrecklich, sie musste sich dringend abgewöhnen, Menschen anzustarrten. Doch wie sollte sie das, wenn es doch zu ihrem Handwerk gehörte, gründlich zu beobachten?
»Wie schade«, entgegnete er mit einer Stimme, die sie seltsamerweise an Sandstein denken ließ. »Neugier ist die Grundlage für das Lernen und die Entwicklung. Meinen Sie nicht?« Sie wusste nicht, was sie ihm antworten sollte. »Sehen Sie sich um, Sie dürfen alles betrachten und berühren. Ich nehme mir später Zeit für Sie, wenn die Herren fort sind.« Er zwinkerte ihr zu und ging zurück zu seinen beiden männlichen Besuchern.
Clara folgte seiner Aufforderung und sah sich in aller Ruhe um. Sie bewunderte einen männlichen Akt, der so präzise in den Marmor gehauen war, dass er zu leben schien. Allein um solche Knie gestalten zu können, lohnte sich jeder Anatomieunterricht. Die Büste einer langhaarigen Schönheit mit Hut wirkte schon weniger naturalistisch, doch noch immer waren viele Details der Wirklichkeit nachempfunden und exakt ausgearbeitet. Am meisten faszinierten Clara die Werke, die nicht den Körperbau eines Menschen zeigen wollten, sondern dessen Emotionen. Da war eine Bronze, die so viel Brutalität ausstrahlte, dass es ihr graute. In einer anderen erkannte Clara erst auf den zweiten Blick einen knieenden Mann, der die Arme zum Himmel streckte. Welch ein Ausdruck! Die ganze Zeit trug sie die kleine Gipsbüste behutsam in beiden Händen.
»Nun haben Sie doch nichts angefasst«, sagte die Sandstein-Stimme plötzlich neben ihr. »Ich nehme Ihnen das kleine Dings mal lieber ab, dann haben Sie die Hände frei.«
Clara reichte ihm das zerbrechliche Gebilde und griff sofort in ihre Manteltasche.
»Ich bin auf Empfehlung von Max Klinger gekommen«, sagte sie und ärgerte sich, dass ihr nichts Klügeres eingefallen war. Rodin faltete das Schreiben auseinander und warf einen schnellen Blick darauf. Als er nichts sagte, fuhr sie fort: »Ich studiere bei Julian. Eine Freundin und ich besuchen aber auch einen Anatomiekurs in der staatlichen Kunsthochschule.«
Wieder betrachtete er sie mit diesem väterlich-warmen Blick.
»Ach, Mademoiselle, setzen Sie nur nicht aufs falsche Pferd«, sagte er. Clara runzelte die Stirn. »Ich habe die Aufnahmeprüfung dort nicht bestanden. Drei Versuche. Nie hat es geklappt.« Er sah sich kurz um, sein Bart geriet in Bewegung. »Scheint mir nicht sonderlich geschadet zu haben. Aber entscheiden Sie selbst, ob Sie dort richtig sind oder in meiner Privatakademie.«
Rainer
Kapitel 2
Sommer 1900
Konnte jemand perfekter sein als seine Lou? Eine Erscheinung und eine große Frau. Körperlich, aber noch viel wichtiger: geistig. Diese sinnliche Ausstrahlung, gepaart mit Stärke und Strenge. Rilke schloss die Augen. Er durfte nicht an sie denken, das wusste er, es würde ihn umbringen. Ach, wenn es nur so wäre! Er öffnete die Augen wieder. Darauf brauchte er nicht zu hoffen. Er musste weiterleben. Ohne sie. Sein Blick fiel in den schmalen Flur. Auf dem zerkratzten Parkett drängten sich Koffer und Taschen aneinander, als hätten auch sie Angst, die nächste Reise ohne Lou antreten zu müssen. Er ging zum Fenster, zog den Vorhang beinahe zu, nur ein winziger Spalt blieb offen, gerade genug Licht, um Staub in dem erhellten Streifen tanzen zu sehen. Rilke hatte Durst. Er hätte jetzt gern Milch getrunken. Im Bauernhaus des Dichters Droschin hatten sie jeden Morgen mit einem Glas begrüßt, noch ganz warm aus dem Euter der Kuh. Da war doch wieder alles gut gewesen zwischen ihm und Lou, in dem einfachen Haus, zu Gast bei dem einfachen Mann, der Rilke eine angenehm natürliche Bewunderung entgegengebracht hatte. Wenn nur diese gierigen Stechmücken nicht gewesen wären. Und das Stroh war auch nicht so bequem gewesen wie die Betten in den Moskauer Hotels. Er hatte es gern erduldet.
Sein Durst wurde übermächtig, aber es war keine Milch im Haus. Nichts war im Haus, denn er war ja gerade erst selbst wieder in seiner kleinen Wohnung in Berlin-Schmargendorf angekommen. Eben noch waren sie in Russland gewesen. Ein zweiter Besuch bei Tolstoi. Auch daran wollte er lieber nicht denken. Er hatte von dem Grafen und großen Dichter mehr erwartet. Tolstoi hatte sich ihrer ersten Begegnung nicht einmal mehr entsinnen können! Vor seinem geistigen Auge sah Rilke das Gutshaus vor sich, umschlossen von einem ungepflegten Garten. Der Besitz in einem solchen Zustand war der Berühmtheit nicht würdig, die darin lebte. Und doch hatte alles irgendwie zusammengepasst. Die unhöfliche und grobe Art des Grafen, der sie hatte warten lassen. Dann hatte er auch noch über Lyrik hergezogen, obwohl Rilke ihm gerade erklärte, dass es das war, womit er sich beschäftigte. Er trat zum Fenster, presste die Stirn an die Scheibe. Fort mit den schlechten Gedanken. Jeder Mensch hatte eben mehrere Gesichter, auch der große russische Dichter. Gewiss verbarg sich hinter seinem schlechten Betragen eine tiefe Verbundenheit mit Rilke, die Tolstoi einfach nur nicht verständlich war. Deshalb hatte er sich so ungnädig aufbrausend benommen. Das konnte Rilke nachvollziehen. Er selbst war manches Mal ungehalten Lou gegenüber gewesen. Warum hatte sie aber auch kein Verständnis für seinen Drang zu Schreiben? Das war ihm noch heute unbegreiflich. In jeder Minute, in jeder Sekunde wollte er in Worte fassen, was er sah und empfand. Das musste sie doch verstehen. Es war ihr zu viel gewesen. Wie konnte Schreiben je zu viel sein? Ihretwegen hatte er seinen Trieb unterdrückt, sein Verlangen gezügelt, nach seinem Notizbuch zu greifen. Kaum dachte er daran, wie nervös es ihn gemacht hatte, spürte er wieder den Schmerz, den der Verlust in ihm ausgelöst hatte. Er eilte in den Flur, blieb vor dem Gepäck stehen, als hockten dort Fremde, die sich ungefragt Zutritt zu seinem Reich verschafft hatten. Wohin? Immer ängstlicher war er geworden, in Russland. Das war doch kein Wunder. In seinem Kopf hatte sich alles aufgestaut, was nicht über seine Finger und die Feder hatte hinausfließen können. Und dann, bei einem Spaziergang, Himmel, welch eine schreckliche Erinnerung, war er vor lauter Angst nicht in der Lage gewesen, auch nur einen winzigen Schritt vorwärts zu gehen. Jetzt noch jagte ihm der Gedanke an diesen einen unheimlichen Baum eine Gänsehaut über den Leib. Wie der Wächter am Tor zur Hölle hatte er dort gestanden und die Äste ausgestreckt, um Rilke die Wörter aus dem Hirn zu klauben.
Er müsste auspacken, doch er schaffte es nicht. Zu viel Anstrengung. Er ging hinüber zur winzigen Küche, lauschte dem Knarzen des alten Holzes unter seinen Füßen nach. Ihm wurde die Brust eng, er rang nach Luft. Wie hatte sie nur die heilige Zeit beenden können, die sie miteinander geteilt hatten? Auch auf der vierwöchigen Reise auf der Wolga, wo ihn die endlose Weite der Landschaft zu verschlingen gedroht hatte, war Lou ihm Anker und Zuflucht gewesen. Und nun? Sie hatte ihn aus dem Paradies geworfen. Er sah sie noch, wie sie in St. Petersburg den Zug nach Finnland bestieg. Kein Blick zurück, während ihm die Augen überliefen und sein Körper sich schmerzhaft verkrampfte. Der Anfang eines langen Abschieds.