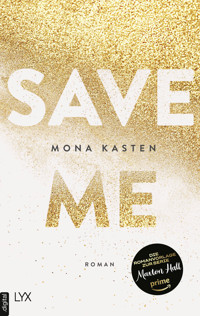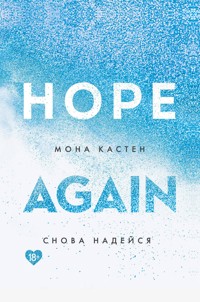9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autorin Mona Kasten mischt coole Superhelden-Action mit einer großen Lovestory. Vor drei Jahren täuschte Raven ihren Tod vor, um der skrupellosen Forschungsorganisation AID zu entkommen. Seitdem ist sie auf der Flucht, denn Raven ist eine Mutantin, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, und AID würde alles tun, um sie wieder in ihre Gewalt zu bringen. Seit ihrer Flucht lebt Raven unerkannt in Coldworth City – bis der verschlossene Wade auftaucht und ihr anbietet, sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten zu unterrichten. Damit ist die Zeit des Versteckens vorüber, denn schon bald sehen sich Raven und Wade einer Verschwörung gegenüber, die nicht nur das Ende der Mutanten bedeuten, sondern auch die ganze Welt ins Chaos stürzen kann. Ein Superhelden-Roman für die riesige Fangemeinde erfolgreicher Serien wie Jessica Jones, Agents of S.H.I.E.L.D., X-Men oder Supernatural.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mona Kasten
Coldworth Ciry
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor drei Jahren täuschte Raven ihren Tod vor, um der skrupellosen Forschungsorganisation AID zu entkommen. Seitdem ist sie auf der Flucht, denn Raven ist eine Mutantin, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, und AID würde alles tun, um sie wieder in ihre Gewalt zu bringen. Seit ihrer Flucht lebt Raven unerkannt in Coldworth City – bis der verschlossene Wade auftaucht und ihr anbietet, sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten zu unterrichten. Damit ist die Zeit des Versteckens vorüber, denn schon bald sehen sich Raven und Wade einer Verschwörung gegenüber, die nicht nur das Ende der Mutanten bedeuten, sondern auch die ganze Welt ins Chaos stürzen kann.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Danksagung
Für all jene, die sich nicht verstecken.
1. Kapitel
Wann?«
Der Mann in dem abgetragenen Ledermantel hatte leise gesprochen, obwohl der Lärmpegel in der Bar ziemlich hoch war. Sein Gegenüber beugte sich über den Tisch, beide Arme angespannt, sodass die Tätowierungen auf seinen Unterarmen deutlich hervortraten. Sie erkannte einen Adler auf seiner gealterten Haut, der mit seinen Klauen eine Schlange in die Luft emporhob. Dabei spritzte Blut aus dem Schlund der Schlange, und die Spritzer reichten bis zum Handgelenk des Kerls. Ein ziemlich hässliches Tattoo.
»Heute Nacht, halb drei, direkt am Hafen. Die Nummer des Containers …« Seine Stimme wurde vom Wechsel der Musik verschluckt, und Raven fluchte leise. Selbst für sie war es schwer, sie über die Entfernung wahrzunehmen, dabei half ihr ihre Gabe manchmal, Dinge zu sehen, die in weiter Ferne geschahen. So hatte sie auch den Bierdeckel bemerkt, den der tätowierte Kerl seit geraumer Zeit zwischen die Finger geklemmt hielt und den er nun dem anderen Mann über den Tisch zuschob. Von der Bar aus konnte Raven nicht sehen, was so interessant daran war, aber nach seinen letzten Worten konnte sie es sich denken. Und sie brauchte die Nummer des Containers. Nun, wie es aussah, würde sie ihrem Glück ein bisschen nachhelfen müssen.
Während sie ein weiteres Bier öffnete und einem Herrn an der Bar ein freundliches Lächeln schenkte, richtete sie ihre Konzentration auf den Tisch, der in einiger Entfernung zum Tresen lag. Sie hielt die Luft an und sammelte sich. Es fiel ihr nicht schwer, den Kern ihrer Gabe zu finden, doch dabei auszusehen, als wäre man eigentlich mit etwas völlig anderem beschäftigt, war eine Herausforderung, selbst nach vielen Jahren Übung.
Sie richtete ihren Geist aus und warf einen Seitenblick zum anvisierten Tisch. Mit der freien Hand strich sie sich eine silberblonde Strähne aus der Stirn, die sich aus ihrem geflochtenen Zopf gelöst hatte, und nutzte die beiläufige Geste, um einen Energiestoß in Richtung der beiden dunkel gekleideten Männer zu schicken. Sofort rutschte ein Glas vom Tisch und zersplitterte am Boden. Whiskey spritzte in alle Richtungen.
Die Flüche der beiden Männer hörte man durch die gesamte Bar – auch ohne telekinetische oder telepathische Kräfte.
Raven schnappte sich Handfeger und Lappen und lief zum Tisch hinüber. Eifrig bückte sie sich und sammelte die Scherben vom Boden, bevor sie anfing, die Flüssigkeit aufzuwischen. Jetzt konnte man die schöne Bernsteinfarbe gar nicht mehr als solche ausmachen. Sie wurde eins mit den Holzdielen der Bar.
»Vielen Dank, meine Hübsche. Ich bin wirklich ungeschickt«, seufzte der Mann im Ledermantel, nachdem sich Raven erhoben hatte. Er starrte sie an, seine harte Miene wurde weicher, als sie ihn bittersüß anlächelte.
»Kein Problem. Soll ich euch dasselbe noch mal bringen?«
Nun drehte auch der Kerl mit dem scheußlichen Tattoo den Kopf, er wirkte deutlich misstrauischer. Er ließ den Blick an ihr herauf- und herabwandern, wobei er einen Moment zu lange an ihrem tief ausgeschnittenen Dekolleté hängenblieb, bis er ihr letztlich in die Augen sah. Inzwischen brauchte sie sich überhaupt nicht mehr um eine undurchdringliche, falsche Maske zu bemühen – sie war zu einem Teil von ihr geworden. Sie wusste ihr wahres Wesen zu verstecken und vor anderen zu vertuschen, was tatsächlich in ihr schlummerte. Die Kerle vor ihr waren darin jedoch nicht so gut. Mit seinem fettigen Haar und den blutunterlaufenen Augen ahnte man schnell, dass der eine Typ abhängig war. Der unterkühlte Blick und die maßgeschneiderten Klamotten ließen vermuten, dass es sich bei dem anderen Mann um ein hohes Tier handelte. Die dunklen Linien seiner Tätowierung standen im Kontrast zu seinem hellen Hemd, und Ravens Vermutung wurde durch das gezackte Symbol an der Unterseite der Schlange bestätigt.
Er arbeitete für einen der Drogenbosse, die Unruhe in Coldworth City stifteten. Genau einordnen konnte sie das Zeichen nicht, bisher war sie ihm noch nicht begegnet. Aber sie wusste, dass manche Dealer ihre Zugehörigkeit durch solche Male deutlich machten. So erkannten sie einander, und wenn man Teil der Branche war, wusste man sofort, wem man trauen konnte. Männer, die solche Symbole auf ihrem Körper trugen, waren gefährlich. Und der hier nutzte das Retox – die Bar, in der Raven seit nunmehr einem Jahr hinter dem Tresen stand – heute Abend für die Planung seiner schmutzigen Machenschaften. Mit einem Nicken bestätigte er ihre Frage, und sie machte sich sofort auf, um seinem Wunsch nachzukommen.
Mit geübten Bewegungen bereitete sie zwei neue Gläser vor, scheffelte Eis aus der Kühlklappe, die unter dem Tresen eingebaut war, und füllte das Glas zu einem Drittel mit Beltmores Darkest auf. Die Musik und Hintergrundgeräusche blendete Raven aus, zu intensiv war das aufgeregte Kribbeln, das unter ihrer Haut tanzte.
Als sie zum Tisch zurückkehrte, hatten sich die beiden wieder ihrem Gespräch zugewandt. Sie nahm die alten Untersetzer vom Tisch und platzierte neue vor den Männern. Dabei spürte sie die gierigen Augen des Junkies auf sich, dem abschätzenden Blick seines Bosses wich sie aus.
»Wie kommt’s, dass ein hübsches Mädchen wie du in einem Schuppen wie dem Retox arbeitet?«
Raven richtete sich gerade wieder auf, nachdem sie das zweite Glas abgestellt hatte. Sie erwiderte den abschätzenden Blick des tätowierten Typen. Die obersten Knöpfe seines weißen Hemds standen offen und gaben den Blick auf sein Brusthaar frei. Innerlich würgte Raven, aber äußerlich begann sie, mit der Spitze ihres langen Flechtzopfs zu spielen. Scheinbar schüchtern wickelte sie sich eine Strähne um den Finger und ließ sie wieder frei. Eine harmlose Geste, die zu ihrem noch viel harmloseren Äußeren passte.
»Ich mag die Gäste, und die Bezahlung ist nicht schlecht«, sagte sie und kam sich dabei ziemlich lächerlich vor. Aber genau das war der Zweck ihres gesamten Auftretens. Das lange Haar, die knappen Shorts, das eng anliegende schwarze Langarmshirt mit dem Aufdruck der Bar und dem tiefen Ausschnitt – all das unterstrich ihre Rolle der treuherzigen Barfrau. Es sorgte dafür, dass sie unterschätzt wurde. Es war auffällig unauffällig und diente nur diesem Zweck. Das rief sie sich vor und nach jeder Schicht im Retox ins Gedächtnis.
Der Typ im Hemd beugte sich vor und griff nach dem neuen Glas. Er schwenkte es und roch kaum merklich an der Flüssigkeit, während er den Blick wieder auf sie richtete. Es war eine vorsichtige Geste, aber Raven sah und spürte sie bis in die hinterste Faser ihres Körpers. Das Misstrauen in seinen Augen ließ ihre Alarmglocken läuten.
»Danke, Kleine«, unterbrach der andere Kerl ihren intensiven Blickkontakt.
Raven nickte wortlos und wollte sich abwenden, doch der Typ im Hemd griff nach ihrem Handgelenk. Augenblicklich versteifte sie sich und fuhr herum. Ein schmutziges Lächeln umspielte die Mundwinkel des zwielichtigen Kerls.
»Falls du Lust auf einen Tapetenwechsel hast – ich kenne ein paar Clubs, in denen du ein halbes Vermögen machen könntest.« Wieder wanderte sein Blick an ihrem Körper auf und ab. Doch statt ihren Impulsen zu folgen und ihm mit ihrer Telekinese den Kehlkopf zu zertrümmern, setzte sie wieder ein höflich-distanziertes Lächeln auf.
»Das Angebot weiß ich zu schätzen, aber mein Chef wäre davon sicher nicht ganz so begeistert«, antwortete sie mit einem Nicken in Richtung Bar, wo Matthew bereits mit verschränkten Armen und hochgezogener Braue wartete.
»Wirklich ein Jammer. Dabei stehen die Leute auf Freaks wie dich.« Er deutete mit dem Kinn auf sie, und sein Grinsen wurde breiter. Dreckiger.
Raven unterdrückte den Impuls, sich in den Nacken zu fassen, wo sich die geometrische Kennung befand, die sie als Mutantin kennzeichnete. Es war ein blauer Kreis, der horizontal von mehreren Strichen durchtrennt war. Mithilfe der Kennung unterschied man normale Bürger von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten – Menschen wie ihr.
Der schmierige Typ beugte sich vor und packte ihr Handgelenk fester. Seine Haut fühlte sich falsch auf ihrer an, so unendlich falsch. Generell ließ sie sich nicht gern anfassen. Die Berührungen Fremder drohten einen Teil in ihr wiederzuerwecken, den sie vor Jahren vor sich selbst und ihrer Umwelt verschlossen hatte.
»Ja, ich habe deine Kennung gesehen. Ich weiß genau, was du bist. Also sieh zu, dass du Land gewinnst.« Ruckartig stieß er sie von sich, und Raven bemühte sich auszusehen, als würde sie straucheln. Wenn sie beim Stoß eines so muskelbepackten Kerls nicht so täte, könnte das Aufsehen erregen. Und das konnte weder sie noch Knox gebrauchen.
Natürlich trug sie die Markierung im Nacken zur Schau – sie schämte sich nicht für das, was sie zu sein vorgab. Doch dieser Typ war ein Mutantenhasser. Einer der schlimmen Sorte. In ihrem Inneren begann es, gefährlich zu brodeln.
Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief sicheren Schrittes zurück hinter die Bar.
»Probleme, Quinn?«, fragte Matthew und beäugte den Tisch, an dem sie bis vor wenigen Sekunden noch gestanden hatte.
Der falsche Name war ihr inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Mittlerweile der dritte, den Knox für sie ausgesucht hatte, nachdem sie wieder einmal umgezogen waren. Ständig auf der Flucht, immerzu eine kalte Klaue im Nacken.
»Nichts Schwerwiegendes. Mach dir keine Gedanken.«
»Ganz sicher?«, hakte Matthew nach.
In ihrem Kopf reihte sich ein mordlustiger Gedanke an den nächsten. Alle drehten sich darum, wie sie diesen Mistkerl zur Rechenschaft zog. Ein mildes Lächeln stahl sich auf ihre Lippen, als sie die Pappuntersetzer vom Tablett nahm. Auf der Rückseite standen in roter Schrift römische Ziffern, direkt daneben das gezackte Symbol, das auch den Unterarm des tätowierten Typen zeichnete. Genau das, was sie vermutet hatte.
»Ja, ich bin mir sicher. Danke, Matt.« Ihre Hand schloss sich um den Pappuntersetzer.
Die Nacht war kühl, aber nicht unerträglich frisch. Trotzdem war Raven froh über den elastischen, weichen Stoff ihres Oberteils. Sie hob die behandschuhten Hände und zog sich die Kapuze tief in die Stirn, sodass die obere Hälfte ihres Gesichts im Dunkeln lag. Anschließend zog sie den schwarzen Schal bis über die Nase hoch, um auch den Rest zu verbergen. Sie durfte keine Spuren hinterlassen. Zwar hatte sie nicht vor, den Kerlen zu nahe zu kommen, aber falls sie doch einen Blick auf sie erhaschten, würden sie kein einprägsames Merkmal an ihr erkennen können – bis auf die schwarze Kleidung und ihre Größe vielleicht.
Raven kauerte auf dem Container und versuchte, mit der Nacht zu verschmelzen. Neben dem sanften Rauschen des Winds war einzig das Schaukeln der Schiffe hinter ihr zu hören. Zwischendurch auch mal das Glucksen von Wasser, das gegen den Bug schwappte, oder das Ächzen von schwerem Eisen, das von den Wellen auseinandergetrieben wurde.
Noch immer haftete der Geruch von Alkohol an Raven, doch darum scherte sie sich jetzt nicht. Das Prickeln, das durch ihren Körper jagte, war viel zu aufregend. So ging es ihr jedes Mal, wenn sie unterwegs war, um dafür zu sorgen, dass die Stadt zu einem besseren, gerechteren Ort wurde.
Das leise Röhren eines Motors riss sie aus der Starre. Gleich darauf war das Zuschlagen von Autotüren zu hören. Sie horchte auf und ging tiefer in die Hocke, um mit Container Nummer dreiundvierzig zu verschmelzen. Die dunkle Kleidung half ihr in der Regel dabei, ein Teil der Nacht zu werden. Erst selten waren Kriminelle auf sie aufmerksam geworden – und nur dann, wenn sie es zuließ.
Da waren sie. Ganz vorne lief der fertige Typ mit dem ranzigen Ledermantel aus dem Retox. Flankiert von zwei anderen Kerlen, die sie nicht kannte, kam er direkt auf den Container zu. Er gab sich keine große Mühe, leise zu sein oder auf seine Umgebung zu achten. Ein halbes Lächeln stahl sich auf Ravens Lippen.
Das würde ein Kinderspiel werden. Eigentlich könnte sie das CCPD – das Coldworth City Police Department – jetzt schon benachrichtigen. Doch sie wollte nicht unbedacht vorgehen und übermütig werden, nur weil sie in den letzten Monaten erfolgreich dabei geholfen hatte, ein paar ziemlich üble Verbrechen zu verhindern.
»Die Lieferung wird gedrittelt«, erklärte der Typ aus der Bar seinen Mitstreitern. »Harrison sagt, ein großer Anteil soll im Green Forest vertickt werden. Der Rest auf den üblichen Routen. Solltet ihr Probleme bekommen, haltet ihn da raus. Schafft ihr das, könnt ihr euch auf einen Bonus in Form von Creeper freuen.«
Raven unterdrückte einen Fluch. Sie hatte zwar schon damit gerechnet, auf eine Lieferung der neuesten Szenedroge gestoßen zu sein, war sich aber nicht sicher gewesen. Creeper war erst seit wenigen Monaten im Umlauf und bei der Einnahme ziemlich unberechenbar. Ein Schluck mehr oder weniger entschied bereits darüber, ob die Droge für einen Höhenflug sorgte oder willenlos machte, ob sie euphorisierte oder der Trip in Lebensgefahr endete.
Die Droge wurde in Form von bunter Flüssigkeit, die als einfache Shots in Clubs verkauft wurde, unter die Menschen gebracht – und das vollkommen unbemerkt. Vor allem in Kombination mit Alkohol sorgte die Flüssigkeit nicht für die erwartete Ekstase, sondern immer öfter für Halluzinationen, Atemlähmung, Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall den Tod. Immer mehr Jugendliche wurden in Krankenhäuser eingeliefert, doch das schreckte die Käufer anscheinend kaum ab, und selbst im Retox wurden Matt, Raven und die anderen Mitarbeiter mittlerweile nach dem bunten Zeug gefragt. Raven hatte auf ihren nächtlichen Streifzügen den einen oder anderen Jugendlichen in der Gasse liegen sehen, völlig gefügig und hilflos. Doch den Höhepunkt hatte ihre Verzweiflung in jener Nacht gefunden, als sie auf ein junges Mädchen gestoßen war, dem nicht einmal mehr ein Arzt hatte helfen können. Raven erinnerte sich an ihre zerrissenen Kleider, an die bleiche, kalte Haut des Mädchens und das Blut, das ihr aus Augen und Ohren gelaufen war. Direkt neben ihr hatten ein paar der Röhrchen gelegen. Mit diesem Bild vor Augen hatte sich Raven fest vorgenommen, alles dafür zu tun, um zu verhindern, dass diese Dealer ihre Lieferung in Umlauf brachten.
Sie schärfte ihren Blick und betrachtete die Typen, die sich inzwischen direkt unter ihr befanden. Es war ein Wunder, dass dieser Kerl – Harrison – Junkies beauftragte, um seine wertvolle Lieferung abzugreifen. Andererseits konnte sie sich keine zuverlässigeren Dealer vorstellen. Leute, die abhängig und noch nicht zu weit abgerutscht waren, konnten sicher am besten beschreiben, wie wunderbar sich der Rausch anfühlte.
Der Container vibrierte unter Raven, und sie krallte die Finger in das kühle, rostige Metall, bevor sie den Nacken kreisen ließ und ihre Schultern ein paarmal rollte. Sie war zu früh dran gewesen und befand sich bereits gut eineinhalb Stunden auf diesem Teil. Es wurde Zeit, der Situation ein Ende zu machen.
Lautlos erhob sie sich und streckte die Glieder. Von unten nahm sie das Murmeln der Dealer wahr, die den Container betraten. Sie nahm Anlauf und stürzte sich über die Kante. Die Luft sauste für wenige Sekunden um ihre Ohren, und der Windstoß hätte ihr beinahe die Kapuze vom Kopf gefegt. Geräuschlos wie eine Katze kam Raven auf dem Asphalt auf und erhob sich geschmeidig. Noch immer bemerkte keiner der Dealer ihre Anwesenheit. Raven wagte sich dichter an den Container heran, flackerndes Licht drang durch die Türen.
Die Typen prüften die Lieferung. Nach und nach rissen sie an den Kartons herum, hielten die schmalen Röhrchen mit der bunten Flüssigkeit ins Licht ihrer Taschenlampen und nickten einander zu, sobald der nächste Schub durchgesehen war. Im Innenraum roch es muffig, ein wenig nach Fisch, gepaart mit der ekligen Süße der Droge. Raven beobachtete die Typen eine Weile und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Rahmen des Eingangs.
»Jungs, ich kann leider nicht zulassen, dass ihr das Zeug in Umlauf bringt«, sagte Raven.
Sofort fuhren die drei Männer zu ihr herum. Zwei der Kerle hielten die bunten Röhrchen wie Waffen in Abwehrhaltung von sich. Der Typ im Ledermantel war wie erstarrt, seine Schultern völlig verspannt.
»Was zur Hölle?«, entfuhr es einem der anderen beiden. Ravens Blick richtete sich auf ihn. Sein Haar war dunkel und mit einer Menge Gel zurückgestrichen, die Kleidung ramponiert und an einigen Stellen eingerissen.
»Ich wünschte, das da«, Raven nickte mit dem Kinn zu den Röhrchen, »wäre tatsächlich Schnaps oder irgendwelches alkoholisches Süßzeug. Dann könnten wir die Situation friedlich enden lassen.«
Der Junkie aus der Bar erwachte aus seiner Starre und machte einen bedrohlichen, langsamen Schritt auf Raven zu. »Dasselbe wollte ich dir gerade sagen. Das hier ist kein Ort für Kinder. Verschwinde, Junge.«
Unter dem Schal kräuselten sich ihre Lippen. Die schwarze, weite Hose, die robuste Jacke, die festen Boots – all das verbarg ihre Figur. Aufgrund ihrer Körpergröße fiel allerdings schnell auf, dass sie kein erwachsener Mann war. Aber immerhin hielten sie sie für einen Jungen. Ein Vorteil.
»Wisst ihr, wie viele Jugendliche allein im letzten Monat an den Folgen von Creeper gestorben sind?«, fragte sie und machte nun einen ebenso bedrohlichen Schritt auf den Kerl zu, der ihr wenige Stunden zuvor in der Bar noch anzügliche Bemerkungen hinterhergerufen hatte. Seine Züge waren jetzt nicht mehr so weich, vielmehr funkelten seine Augen feindselig und alarmiert.
»Es waren mindestens fünfzig.«
Die Presse versuchte zwar, die Zahlen herunterzuspielen, aber Raven kannte die Wahrheit. Es gab genug Gäste im Retox, die Kontakte hatten. Und wenn die genug Alkohol intus hatten, plauderten sie Details aus, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Ein weiterer Grund für ihren Job in der Bar.
»Ist mir scheißegal. Wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du abhauen, und zwar sofort«, knurrte der Typ aus dem Retox.
Erstaunlich, wie schnell sich seine Züge von schmeichelnd in wütend verwandeln konnten, fand Raven. Irgendwie niedlich.
»Ich wiederhole mich ungern«, sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme einen noch tieferen Klang zu verleihen. Sie hatte das Glück, von Natur aus eine raue Stimme zu besitzen. »Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr das Zeug da in Umlauf bringt. Damit zieht ihr die ganze Stadt in den Dreck und sorgt dafür, dass Menschen sterben. Dinge, die moralisch eigentlich nicht vertretbar sind, findet ihr nicht auch?«
Raven sammelte ihre Kraft im Geiste. Sie spürte, wie die Telekinese in ihren Adern prickelte, wie verzweifelt die Energie freigelassen werden wollte aus dem Gefängnis, das ihr Körper darstellte. Es fühlte sich falsch an, wenn man sie zu lange unterdrückte. Sollten sich die Dealer querstellen – wovon sie ausging –, würden sie ein willkommenes Ziel abgeben.
Mit dem, was als Nächstes geschah, hatte Raven jedoch nicht gerechnet. Sie hatte keine Zeit mehr, auf das unangenehme Prickeln in ihrem Nacken zu reagieren und auszuweichen.
Plötzlich wurde sie von einem heftigen Windstoß ergriffen. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, knallte sie mit dem Rücken gegen die Wand des Containers. Ein Keuchen entwich ihr, sie prallte hart auf. Alle Luft wurde ihr aus der Lunge getrieben, und in ihren Ohren dröhnte es. Raven blinzelte mehrmals, bis sie begriff, was gerade passiert war.
Direkt vor ihr stand der Junkie aus dem Retox. Aber seine Augen waren nicht mehr rot und von unzähligen geplatzten Äderchen durchzogen, sondern … weiß. Keine Pupille war mehr zu erkennen, keine Iris und schon gar keine Äderchen. Stattdessen hatte sich ein milchiger Glanz über seinen Augapfel gelegt, der sich rasend schnell bewegte und beinahe vibrierte. Seine Präsenz war nicht mehr schwach, sondern strotzte vor Kraft. Der Innenraum des Containers war von einem Surren erfüllt, und Raven spürte bis in die Knochen, welche Gefahr der Typ verströmte.
Er war ein Mutant.
Sein Mantel flatterte, seine Haare wehten unter den Luftstößen, die ihn umgaben. Alles an ihm strahlte Energie aus, eine aufbrausende Gewalt. Seine Komplizen hielten sich im Hintergrund, rückten dichter zusammen, wirkten allerdings nicht überrascht.
Raven hätte sich am liebsten geohrfeigt.
Natürlich ließ Harrison seine wertvolle Drogenlieferung nicht von wehrlosen Idioten überprüfen. Obwohl er Mutanten verabscheute, hatte er diesen hier auf seine Seite gezogen und beauftragt, über seine Lieferung zu wachen. Wieso hatte sie das nicht kommen sehen?
»Ich sage es ein letztes Mal: Wenn du lebend hier herauskommen möchtest, solltest du verschwinden«, knurrte der Mutant, und als er einen weiteren Schritt auf sie zumachte, schlug Raven eine Woge seines fauligen Atems entgegen. Unter dem Schal zog sie die Nase kraus und rügte sich selbst dafür, nicht daran gedacht zu haben, den Mann zu checken. Sie war viel zu versessen auf die Lieferung gewesen, als dass sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, wem sie gegenüberstand. Woher sollte sie denn auch wissen, dass ein Typ wie Harrison Geschäfte mit Mutanten machte? Vielleicht lag der Grund für ihre Unvorsichtigkeit aber auch in den Erfolgen der letzten Monate – so konnte sie das hier jedenfalls nicht enden lassen. Auf gar keinen Fall. Ein Gesicht flackerte vor ihrem geistigen Auge auf. Eines, das ihrem eigenen so ähnlich war.
Sie hatte eine Verantwortung. Sich selbst ein Versprechen gegeben, um Knox’ willen. Jede Nacht, die sie durch die Stadt streifte, endete damit, dass sie nach Hause zurückkehrte und in sein friedliches Gesicht blickte. Und diese Nacht würde auf keinen Fall eine Ausnahme werden.
»Sonst … was?«, stichelte Raven und krümmte die Finger kaum merklich. Der Wind, der sie an die Containerwand presste, war stark, aber nicht unbezwingbar.
Der Mutant grinste und schüttelte den Kopf. Die Luft umwirbelte sie noch mächtiger. »Sonst werde ich dir mit meiner Gabe jeden einzelnen Knochen brechen und dich anschließend versenken. Der Hafen wäre doch perfekt dafür.«
Raven tat, als würde sie über seinen Vorschlag nachdenken und abwägen. Sie trat vom einen aufs andere Bein, beugte dabei leicht die Knie und beäugte den Mutanten. »Leider habe ich heute noch andere Pläne. Von daher danke, aber nein.«
Das war die einzige Warnung, die sie ihm gab. In der nächsten Sekunde hatte sie die Arme vorgerissen und ließ einen Stoß Energie aus ihrem Inneren frei. Es fühlte sich an, als wäre sie nach langer Zeit unter Wasser endlich aufgetaucht und würde nach Luft schnappen.
Alle Männer wurden zurückgeworfen, einzig der Mutant konnte seine aufrechte Haltung beibehalten. Mit einem Knurren riss er die Arme hoch, und sein Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse. Ein Stoß eisiger Luft schoss durch den Container. Der Wind zerrte an Ravens Kleidung, an ihren Gliedmaßen, und fegte ihr fast die Beine unter dem Körper weg. Wieder stieß sie mit dem Rücken gegen die Wand.
Brüllend warf der Mutant den Kopf in den Nacken. Er beschwor den Wind weiter, ließ ihn stärker werden, und inzwischen konnte Raven das Klirren der unzähligen Röhrchen im Container hören. Wenn er so weitermachte, zerstörte er die Lieferung ganz allein. Allerdings würde er sie alle mit ins Verderben reißen. Seine Komplizen riefen ihm etwas zu, doch der Mutant wirkte wie besessen. Der Wind rauschte so laut, dass Raven nichts hören konnte außer dem Heulen des aufziehenden Sturms.
Sie warf sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die aufblühende Windrose, hob wie in Zeitlupe eine Hand und konzentrierte sich auf den Körper ihres Gegenübers. Normalerweise hätte er schon längst durch den halben Container geflogen sein müssen. Allerdings war Raven noch nie einem Mutanten begegnet, der über Wind herrschte und sich Stürme zu eigen machte.
Sie schloss die Augen, festigte ihren Stand und grub die Fersen in den Boden. Dann sammelte sie sich, fühlte das Pulsieren der Telekinese in ihren Adern und streckte den Arm aus. Sie krümmte die Finger in der Luft, als würde sie ihn packen. Der Mutant riss den Kopf nach vorne und starrte sie mit geweiteten Augen an. Das Weiß darin lichtete sich, wurde immer transparenter.
Raven neigte den Kopf und ballte eine Hand zur Faust. Der Mutant griff sich an den Hals, sah an sich hinab, vollkommen fassungslos. Raven drückte zu, holte weit aus und schleuderte ihren Arm mit voller Geschwindigkeit nach vorne. Nun war er derjenige, der mit Wucht rücklings gegen den Container krachte – allerdings noch heftiger als sie. Das Metall kreischte ohrenbetäubend und ächzte unter seinem Aufprall. Er blieb mit ausgestreckten Gliedern in der rostigen Wand stecken, die Oberfläche nun völlig verformt. Einzig sein Kopf sackte nach vorne. Er war ohnmächtig.
Ravens Blick zuckte zu den anderen beiden Dealern, die sich hinter den Kartons zusammengekauert hatten. Sie hob zwei Finger, griff im Geiste nach den Behältern und schob sie sachte beiseite. Ihre Gabe konnte nicht nur zerstörerisch sein. Auch das hatte sie in den letzten Jahren gelernt.
Die Männer klammerten sich aneinander fest und rutschten auf allen vieren zurück. Raven seufzte. Sie wollte ihnen nicht wehtun, daran hatte sie tatsächlich überhaupt keinen Spaß. Aber sie würde sie auch nicht ungeschoren davonkommen lassen.
Sie sah sich um und entdeckte ein paar morsch aussehende Seile, die mit Sicherheit beim Verschiffen der Ware in den Container gelangt waren. Wieder hob sie die Hand, diesmal pulsierte ihre Kraft ganz sanft, war ein Teil von ihr und keine Naturgewalt. Zwar waren feinfühlige Tätigkeiten mit Telekinese weitaus schwieriger, und sie spürte, wie sich Schweißperlen auf ihrer Stirn bildeten und sich dahinter ein leichtes Pochen meldete. Eindeutig ein Warnzeichen. Aufhören kam trotzdem nicht infrage.
Im Geiste führte sie die Seile um die beiden Typen herum, sorgte dafür, dass sie Rücken an Rücken gelehnt waren. Innerhalb weniger Sekunden war das Seil provisorisch um sie geschlungen und am Ende verknotet.
Sie drehte sich um und wollte nach draußen, um in Ruhe die Polizei zu benachrichtigen, doch einer der Männer ließ sie innehalten.
»Harrison wird dich finden, Kleiner«, krächzte der Typ mit dem schmierigen Haar.
Raven blickte zur Seite und sah aus dem Augenwinkel, wie er an den Fesseln zerrte.
»Mach dich darauf gefasst, dass er dir alles nehmen wird, was dir lieb ist«, knurrte er angestrengt. Anscheinend waren die Seile doch fester um sie geschlungen, als sie beabsichtigt hatte.
Raven verdrehte die Augen. Diesen Spruch hatte sie in den letzten Monaten öfter gehört, als sie zählen konnte. Ohne die beiden weiter zu beachten, schloss sie die Tür des Containers und verkeilte sie mit einem Holzbrett, das sie aus einer der Paletten zwischen den Containern gebrochen hatte. Im selben Atemzug kramte sie das Wegwerfhandy aus ihrer Hosentasche und drückte auf die Kurzwahltaste.
»Coldworth City Police Department«, leierte eine Stimme.
»Am Hafen, Container Nummer dreiundvierzig«, unterbrach Raven die Frau. »Hier ist eine große Drogenlieferung angekommen, das sollten Sie sich ansehen.«
In der nächsten Sekunde legte sie auf und schob das Handy zurück an seinen Platz.
Den Rest würde die Polizei erledigen.
Es war kein Gefühl der Euphorie, das Raven erfüllte, als sie vom North-Point-Hafen in Richtung ihrer Wohnung weiter südlich nach Downtown streifte. Sie würde lange brauchen, bis sie die Stadt durchquert hatte – trotz der Abkürzungen, die sie mittlerweile in- und auswendig kannte. Leider konnte sie sich ein Taxi beim besten Willen nicht leisten, und die Bahn zu nutzen erschien ihr um diese Zeit zu riskant. Nachts war es sicherer, an den Hauptstraßen durch Uptown zu laufen, in denen selbst zu dieser Uhrzeit unzählige Autos an ihr vorbeirauschten. Im Norden von Coldworth City, dort, wo auch der Hafen lag, befanden sich das weitläufige Industriegebiet und ein paar Ecken, in denen man nachts lieber nicht mehr unterwegs sein sollte. Genauso gefährlich waren die dunklen, abgelegenen Gassen, die abseits der Innenstadt lagen. Dagegen leuchtete Uptown geradezu, ganz im Gegensatz zu dem heruntergekommenen Viertel, in dem Raven mit Knox lebte.
Uptown strahlte selbst bei Nacht – das war einer der Gründe, weshalb Raven den Weg bevorzugte, auch wenn er dreimal so lange dauerte. Gläserne Gebäudefronten reflektierten das bunte Licht der Leuchtreklamen, die eine einzige Farbexplosion ergaben. Die wirren Lichter, die rasenden Autos und auch das Treiben auf den Straßen lenkte Raven von ihren dumpfen Gefühlen ab. Schon lange hatte sie keine Angst mehr empfunden. Wenn sie ehrlich war, hatte sie seit geraumer Zeit überhaupt nichts mehr gefühlt. Einzig Knox sorgte dafür, dass sie sich gebraucht fühlte. Knox und die Tatsache, dass sie imstande war, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn sie das tat und ihre Gabe dafür nutzte, Gutes zu tun, dann … schien plötzlich alles einen Sinn zu ergeben. Alles fügte sich zusammen. Wie Puzzleteile, die an ihren richtigen Platz rückten und plötzlich ein Bild ergaben. Während sie tagsüber von unsäglicher Schuld erfüllt war, konnte sie nachts ihrer Bestimmung nachgehen. Was sonst war der Grund für ihre Existenz?
Nach und nach verschwanden die Lichter. Die Gebäude schrumpften geradezu, die Fronten aus Glas wurden durch brüchige Backstein- und Altbaufassaden ersetzt, und auch der Schein der Straßenlaternen nahm einen flackernden Gelbstich an. Je weiter sie sich aus Uptown entfernte, desto finsterer wurde die Stadt. Raven war das Dunkel gewöhnt, aber trotzdem überkam sie stets eine Gänsehaut, sobald die Stille um sie herum zu umfassend wurde. In Downtown wurde ihr Gang zielstrebiger, ihre Schritte trafen fest auf die gepflasterten Straßen. Das Viertel war nicht schön anzusehen. Raven kam auf ihrem Nachhauseweg stets an ein paar zusammengekauerten Menschen vorbei, die am Boden lagen. In Kombination mit dem Geruch nach Erbrochenem und Unrat gab dieser Stadtteil einen eher traurigen Anblick ab. Die niedrigen Mieten sorgten dafür, dass hier vor allem der untere Rand der Gesellschaft ein Zuhause fand. Darunter befanden sich ein paar Studenten, aber vor allem Leute mit geringem Einkommen, die sich in Dinge verwickelt hatten, aus denen sie schwer wieder herausfanden. Und gerade weil nachts die merkwürdigsten Dinge in Downtown geschahen, konnte Raven es gar nicht erwarten, in ihre Wohnung zu gelangen.
Dort angekommen, drückte sie den Seiteneingang des heruntergekommenen Wohnhauses mit der Schulter auf. In ihrem Aufzug wollte sie bloß keinem Nachbarn begegnen – auch wenn man hier für gewöhnlich keine Fragen stellte. Aber sie zog es vor, keine Zeugen für ihre nächtlichen Ausflüge zu haben. Sie schlich die Treppen hinauf in den dritten Stock, vorbei an den unzähligen Graffiti und Kritzeleien an den brüchigen Wänden. Inzwischen wusste sie genau, welche der Stufen knarrten, wie sie ihre Schritte setzen musste, um geräuschlos in ihre Wohnung zu gelangen.
Die Wohnungstür schabte leicht über den Boden, als Raven sie einen Spalt öffnete, um sich unbemerkt hindurchzuschieben. Knox hatte das Licht im Wohnzimmer angelassen, und Raven seufzte. Es war lieb von ihm gemeint, aber dennoch – die anfallenden Kosten für Wasser und Strom waren jetzt schon kaum tragbar.
Sie schälte sich aus der Jacke, wickelte den Schal von ihrem Hals und zog die weichen Lederstiefel aus. Dann verstaute sie alles im Einbauschrank im Flur. Sie hob das Brett an, unter dem sie die Kleidung immer versteckte. Knox sollte nicht wissen, womit sie ihre Nächte verbrachte, und im Glauben bleiben, sie würde bis spät nachts arbeiten. Es war besser so. Sicherer.
Auf Zehenspitzen schlich Raven zu seinem Zimmer. Insgesamt hatte die Wohnung zwei davon – eines, das sie ihrem Bruder so gut es ging eingerichtet hatte, und ein möbliertes Wohnzimmer, das gleichzeitig Essbereich, ihr Schlafzimmer und Aufenthaltsraum in einem war. Dazu kamen noch das kleine Bad am Ende des Flurs und eine Kochnische, die eher einer Abstellkammer ähnelte. Es war keine große Wohnung, nicht einmal annähernd das, was Raven sich für Knox gewünscht hätte, aber für mehr fehlte ihr das Budget. Zwar verdiente sie im Retox nicht schlecht, aber davon musste sie sich und ihn durchfüttern. Dazu die Miete, die Fixkosten und die Schulgebühren für Knox’ Onlinekurse – es reichte bei Weitem nicht aus. Und als gekennzeichnete Mutantin an einen gut bezahlten Job zu kommen war ziemlich schwer. Zumal Raven mit ihren achtzehn Jahren kaum Referenzen oder gar einen ordentlichen Schulabschluss vorzuweisen hatte. Doch an eine Abendschule zu gehen und den Abschluss nachzuholen konnte sie sich nicht erlauben. Das lag nicht nur am Geld, sondern auch an der Tatsache, dass sie kein Risiko eingehen konnte, doch noch gefunden zu werden.
Vorsichtig spähte Raven in Knox’ Zimmer. Augenblicklich glättete sich ihre gefurchte Stirn, und ihre Sorgen verschwanden irgendwo in ihrem Hinterkopf und blieben ungehört.
Knox’ Haar war lang geworden, inzwischen fiel es ihm tief in die Stirn und kräuselte sich an den Spitzen. Damals war es kurz gewesen. Kurz und vom selben satten Braun, das auch Ravens natürliche Haarfarbe war. Allerdings färbte sie auch ihm stets das Haar. Als sie dasselbe Weißblond vorgeschlagen hatte, das auch sie monatlich auf ihrem Haaransatz auftrug, hatte Knox bloß eine Braue gehoben und abfällig geschnaubt. Stattdessen hatte er sich für ein Kupferrot entschieden und es lang wachsen lassen, ebenso wie Raven.
Seine Lippen waren leicht geöffnet, seine Züge ebenmäßig und glatt. Inzwischen bekam er Ecken und Kanten, seine Wangenknochen waren ausgeprägter, wobei Raven es viel zu früh dafür fand. In ihren Augen würde er wohl immer ein kleiner Junge bleiben.
Dieser Anblick verlieh ihr jede Nacht neue Kraft. Wenn sie sah, wie gut es Knox ging, wie friedlich er dalag und schlief, dann wusste Raven, dass sie damals die richtige Entscheidung getroffen hatte. Er verdiente diesen Frieden.
Sie beide verdienten ihn.
2. Kapitel
Frühstück.«
Raven brummte, hob mühsam eine Hand und wischte die Stimme mit einer Bewegung fort.
»Riech mal.« Selbst im Halbschlaf konnte sie Knox’ Grinsen heraushören. »Es gibt Pancakes. Und heißen Kakao.«
Jetzt wurde sie hellhörig und drehte den Kopf ein bisschen. Ihre Lider blieben geschlossen, zu schwer klebten sie zusammen, zu greifbar war der Nachgeschmack ihres Tiefschlafs.
»Wenn du nicht willst, esse ich alles alleine.«
Sie wusste, dass er diese Drohung wahrmachen würde – Knox konnte ganze Berge verdrücken. Raven rieb sich mit den Händen über die Augen und fuhr über ihr Gesicht. Mehrmals blinzelte sie, bis sie Knox’ Schopf dicht neben sich entdeckte. Er lehnte mit dem Rücken gegen das Sofa im Wohnzimmer, auf dem sie stets schlief. Gerade war er dabei, sich eine voll beladene Gabel in den Mund zu schaufeln. Sein Blick hing an dem schweren kleinen Röhrenfernseher, der gegenüber auf einem ramponierten Holztisch stand.
»Her damit«, sagte Raven und richtete sich auf.
Knox drehte sich um. Seit sein Haar länger geworden war, hielt er den Kopf immer leicht schräg, damit ihm die wirren Strähnen nicht in die Augen fielen. Seine blauen Augen, die ein Spiegelbild ihrer eigenen waren, funkelten wach. Er reichte ihr einen kleinen Teller mit einem Haufen Pancakes. Statt Ahornsirup hatte er sie in Schokosauce ertränkt, genau wie sie es mochte. Bevor sie jedoch den Teller greifen konnte, formte Knox mit der Hand eine Muschel an seinem Ohr.
»Ja, ja. Du bist ein guter Bruder. Der beste Frühstückskoch der Welt«, leierte Raven herunter. Sie hatte nur noch Augen für die Pancakes. Ihr Magen rumorte hörbar. Sie konnte sich nicht an ihre letzte Mahlzeit erinnern. Zählten die Erdnüsse, die sie gestern Abend zu Matts Leidwesen vom Tresen geklaut hatte?
»Der allerbeste«, wiederholte er und ließ endlich den Teller los. Danach reichte er ihr Messer und Gabel.
»Danke dir«, murmelte Raven und schob sich die erste Gabel in den Mund. Genüsslich seufzte sie.
»Stets zu Diensten«, sagte Knox und salutierte. Er richtete den Blick wieder auf die Mattscheibe. »Wie war die Arbeit?«
»Ganz gut.« Raven kaute eine Weile und schluckte dann. Als hätte Knox es geahnt, reichte er ihr den Becher mit Kakao. Er wusste um ihre Schwäche für ein süßes Frühstück. Oder Süßes im Allgemeinen. Wenn es nach ihr ging, konnte jede Mahlzeit aus Pancakes, Waffeln oder Cornflakes bestehen. Und dazu Schokosauce. Am besten auf allem.
»Irgendetwas Spannendes passiert?« Automatisch nahm er ihr den Becher wieder ab und stellte ihn auf dem zerkratzten Wohnzimmertisch ab.
»Ein Kerl hat einen dummen Spruch abgelassen.« Vor ihr flackerte das Bild von Harrison und seinem scheußlichen Tattoo auf. Früher oder später würde sie ihn noch zu fassen bekommen. »Aber nicht besonders schlimm.«
»Ich bin immer noch dafür, dass du mal in dieser Bäckerei nachfragst. Oder in der Buchhandlung am East End, die suchen oft nach Aushilfen.«
»Nein.«
Diese Diskussion hatten sie innerhalb des letzten Jahres zu oft geführt. Knox wollte unbedingt, dass sie woanders arbeitete. Ihm gefielen ihre Nachtschichten in der verrufenen Bar überhaupt nicht.
»Irgendwann müssen wir die Gebühren für die Kurse nicht mehr zahlen.« Er blickte über die Schulter und schenkte ihr ein breites Lächeln. Das tat er oft – zu oft. Sie wollte nicht, dass er sich um sie sorgte. Eigentlich sollte sie diejenige sein, die ihn aufbaute und dafür sorgte, dass er lächelte.
»Du solltest dich bald an deine Hausaufgaben setzen. Davor wird dich auch dein Charme nicht bewahren können«, meinte Raven und schob sich eine weitere Gabel voll Pancakes in den Mund.
Knox gab ein gequältes Geräusch von sich und rutschte ein Stück am Sofa hinab, alle Glieder von sich gestreckt. »Englisch ist mein Feind, R. Das weißt du.«
»Es gehört zum Lehrplan, also müssen wir es wohl oder übel durchgehen«, gab sie ungerührt zurück.
»Kann ich nicht einfach nur ein paar Informatikkurse belegen?«, murrte Knox.
Er interessierte sich seit geraumer Zeit für Informatik und alles, was Programmieren und Dinge mit Computern betraf, mit denen Raven sich nicht wirklich auskannte. Aber sie hatte sich vorgenommen, ihm zumindest die normale Schulbildung zu verschaffen. Wenigstens genügend Credits, die einem Highschool-Abschluss gleichkamen, wenn sie sich schon nicht traute, ihn auf eine öffentliche Schule zu schicken.
Mittlerweile war es knapp drei Jahre her, seit sie geflohen waren und ihren Tod vorgetäuscht hatten. Es hatte gedauert, bis sie sich das Leben aufgebaut hatten, das sie jetzt führten, aber Raven war froh, Knox in Sicherheit zu wissen. Wenn der Preis dafür war, ihn mit falschem Namen in gebührenpflichtige Onlinekurse einzuschreiben, zahlte sie ihn bereitwillig.
»Hör sofort auf!« Knox schnippte laut mit den Fingern vor ihrem Gesicht herum.
Irritiert blinzelte Raven.
»Ich sehe es, wenn du wieder in deinem Sumpf da oben versinkst. Aber nicht schon beim Frühstück.«
»Ist ja gut.« Er kannte sie gut. Knox’ intuitive Gabe war beeindruckend, wenn auch nicht übernatürlicher Natur wie die ihre. Eine Tatsache, für die Raven sehr dankbar war.
In den nächsten Stunden machte sie sich an den Abwasch, räumte gemeinsam mit ihrem Bruder auf und setzte sich dann mit ihm ins Wohnzimmer, um die täglichen Einheiten der Kurse zu absolvieren. Es gefiel Raven, die Klassiker mit Knox durchzugehen. Nicht nur, weil sie so das Gefühl hatte, ihm Normalität zu bieten, sondern vor allem, da sie ihren eigenen Geist dadurch fördern konnte. Es machte ihr Spaß, sich mit englischer Literatur auseinanderzusetzen, auch wenn ihre Vorlieben eigentlich woanders lagen. Aber immerhin lernte sie so die Dinge, die sie während der Zeit nach dem Tod ihrer Mutter verpasst hatte.
»So, und wer stirbt nun im fünften Akt?«, fragte Raven und bedeckte die entsprechende Seite von Knox’ Notizen mit den Händen.
»Bei Shakespeare lautet die Antwort grundsätzlich: alle.«
»Knox.«
»Na gut«, seufzte er und raufte sich das Haar. Ein paar Strähnen standen nun ab und ließen ihn aussehen, als stünde sein Kopf in Flammen. »Die Katastrophe endet darin, dass Macbeth getötet und das Land befreit wird – Achtung, Spoiler, falls du es noch lesen wolltest.«
»Sehr gut. Und was ist die Kernaussage des Dramas?«, fuhr sie unbeirrt fort.
Knox runzelte die Stirn und lehnte sich zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkt.
»Ich weiß nicht genau, worauf du hinauswillst.«
Raven lehnte sich vor und griff nach der Karaffe mit Leitungswasser, um ihnen die Gläser erneut zu füllen. »Was wollte dir Shakespeare wohl mit dem Stück mitteilen?«
Er grübelte eine Weile und trank einen Schluck. »Vielleicht konnte er sich nichts Schöneres vorstellen, als mir das Leben zu erschweren?«
Raven funkelte ihn böse an und griff im Geiste nach ihrer Kraft, um damit ein Kissen vom Sofa zu packen. Ein elektrisierendes Prickeln jagte durch sie hindurch, ihr Blick zuckte zum Sofa. Innerhalb eines Sekundenbruchteils traf ihn das Kissen am Hinterkopf.
»Hey! Unfair!«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« Sie blickte hinter sich, um ihre vorgebliche Unschuld zu unterstreichen.
»Hätte ich auch so eine coole Fähigkeit, dann würdest du dein blaues Wunder erleben.«
»Ach ja? Welche hättest du denn am liebsten?«, fragte Raven.
Sie versuchte stets, einen normalen Umgang mit Knox in Bezug auf ihre Fähigkeit und die von anderen Mutanten zu pflegen. Er sollte sich weder benachteiligt fühlen noch eine Abneigung gegen ihresgleichen entwickeln.
»Ich glaube, ich finde deine gar nicht schlecht.«
Ihre Augen wurden groß. »Meinst du das ernst?«
Er nickte kräftig. »Klar, wieso nicht? Ich meine, du kannst unberechenbar sein, aus der Entfernung Dinge bewegen, egal, wie schwer sie sind. Ist doch cool.«
Ernüchterung machte sich in ihr breit. Natürlich meinte er die Telekinese – nicht den anderen, viel gefährlicheren Teil von ihr. Anscheinend las er aus ihrem Gesicht, denn er beugte sich schnell vor und legte ihr die Hand auf den Arm.
»Ich meine, der Rest ist auch toll. Mächtig und so, aber …«
»Ist schon okay«, beschwichtigte Raven ihn und klappte den Block wieder auf, um mit den Aufgaben weiterzumachen.
»R …« Seine Stimme war eindringlich und sanftmütig. Natürlich wollte er sie nicht kränken, das hätte sie niemals von ihm erwartet. Dennoch schmerzte es zu wissen, dass selbst er die verschlingende Macht verdrängt hatte. Obwohl sie es nicht wollte, tat es weh.
»Jetzt hör auf, von der Frage abzulenken«, sagte sie leichthin und kleisterte ein Lächeln auf ihre Lippen. Geschäftig griff sie den Fragenkatalog vom Tisch und öffnete die Datei am Computer, damit sie die nächsten Unterrichtseinheiten abschließen konnten.
Den Rest des Vormittags verbrachten sie mit Englisch, Biologie, Mathe und Informatik, wobei Raven bei Letzterem keine große Hilfe darstellte. Stattdessen ging sie erst eine große Runde Laufen, danach machte sie sich an ihre Trainingseinheiten im Wohnzimmer, wobei sie Knox vermutlich halb in den Wahnsinn trieb. Bei ihren Kickboxübungen trat sie nicht selten gegen Möbel und ließ Dinge zu Bruch gehen. Diese Wohnung war einfach viel zu klein für Kampfübungen, nicht mal einen Boxsack konnte sie aufhängen. Aber die Übungen gehörten zu Ravens Routine. Sie durfte nicht außer Form kommen, wenn jederzeit die Gefahr bestand, dass man sie finden konnte.
Als Knox den Kopf durch die Tür steckte, war sie schweißüberströmt und gerade dabei, einen leichten Ausfallschritt nach hinten zu machen, beide Arme nach oben zu strecken und mit Schwung ihr hinteres Knie hochzureißen.
»Zeig mir, wie das geht«, sagte Knox und betrachtete sie eingehend.
»Nein«, antwortete Raven außer Atem.
Knox seufzte. Er ließ keine Gelegenheit aus, Raven davon zu überzeugen, ihm das Kämpfen beizubringen, aber sie lehnte vehement ab. Sie wollte ihm eine normale Jugend bieten – dazu gehörte definitiv kein Kampftraining.
»Bis auf die paar Selbstverteidigungstechniken, die du mir gezeigt hast, bin ich hilflos, R.«
»Bist du nicht«, gab sie atemlos zurück. Sie machte einen Frontkick mit durchgestrecktem Bein. Dann legte sie eine Pause ein und wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn. »Was gibt’s?«
Knox kam ins Wohnzimmer und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Wäre es okay für dich, wenn ich heute Abend zu Markell gehe? Er hat das neue Dungeon Seeker und gefragt, ob ich Lust hätte.«
Markell war ihr Nachbar, ein Junge, der ein Jahr jünger war als sie selbst, in der Stadt zur Schule ging und ebenfalls allein wohnte. Als sie eingezogen waren, hatte er keine Fragen gestellt oder sie neugierig beäugt, sondern war freundlich und zuvorkommend gewesen. Er hatte ein ruhiges Wesen, war ziemlich introvertiert und hatte sich mit seiner besänftigenden, schweigsamen Art nach ein paar Monaten mit Knox angefreundet. Man konnte sogar behaupten, er war Knox’ einziger Freund und auch der einzige Mensch im Umkreis von hundert Meilen, dem Raven vertraute. »Klar. Aber macht nicht wieder so lange.«
»Würde mir nie in den Sinn kommen.«
Raven hob eine Braue. Beim letzten Mal war sie nachts um drei in eine leere Wohnung gekommen. Nachdem der Schock überstanden gewesen war, war sie nach unten zu Markell gestürmt und hatte die beiden mit geröteten Wangen vor dem Fernseher wiedergefunden.
»Ich komme pünktlich nach Hause«, versprach Knox.
»Du bist vor meinem Schichtende zurück.«
Er presste die Lippen fest aufeinander. »Okay.«
Als er das Wohnzimmer verließ, konnte sie sein Grummeln hören, aber es war ihr gleichgültig. Sie zog Grenzen, die Knox einhalten musste. Dazu gehörte, dass er die Nächte keinesfalls woanders verbringen durfte. Ganz gleich, wie nett Markell auch war. Wenn sie zu Hause war, musste er es auch sein. Sonst würde sie nicht schlafen können, aus Angst, dass ihm etwas zustieß. Die Zeichen der Gefahr trug Raven auf ihrem eigenen Körper. Die Narben, die ihre Wirbelsäule verunstalteten, konnte sie zwar gut verstecken, aber die wulstige Narbe an ihrem Unterarm war eine tägliche Erinnerung an das, was Knox bevorstand, wenn sie sie finden würden. Selbst nach drei Jahren war diese tiefrot, und man sah deutlich, wie nachlässig die Wunde versorgt worden war. Seit sie untergetaucht waren, trug sie nur noch langärmelige Kleidung, um Fragen zu vermeiden.
So schlüpfte Raven in ihre Kluft für ihre Schicht im Retox und verabschiedete sich von Knox. Sie zog die Ärmel des Langarmshirts bis zu den Handgelenken runter, trug das Zeichen ihrer Flucht dicht bei sich und verbarg es vor der Außenwelt.
Das Retox lag oberhalb der Grenze von Downtown in den East Heights. Es war voll auf den Straßen und die Rushhour in vollem Gange. Mit ihren knappen Shorts war es für Anfang September ziemlich kühl, aber die Kälte wurde durch die Menschenmassen verdrängt. Raven fand es erstaunlich, wie viele Menschen sich auf Coldworth Citys Straßen herumtrieben. Auf den ersten Blick konnte man normale Bürger nicht von Mutanten unterscheiden. Erst wenn man einen Blick auf den Nacken warf, konnte man sich sicher sein. Doch jetzt im Herbst trugen die meisten sowieso Schals oder Halstücher. Raven mochte den Schein, der gewahrt wurde. Auch wenn sie wusste, dass es eben genau das war – eine Fassade. Hinter den Fronten sah es deutlich anders aus. Als Mutant in eine gehobene Stellung zu kommen war ein beinahe unmögliches Unterfangen. Ähnlich sah es mit der Wohnsituation aus. Nahezu alle gepflegten Gebäude waren den normalen Bürgern vorbehalten, denn sie fürchtete man nicht. Aber im Getümmel der Straßen am späten Nachmittag merkte man keinen Unterschied. Eine friedliche Illusion, der sich Raven nur zu gern hingab. Es gab viele Tage, an denen sie sich einfach normal fühlen wollte.
Als sie sich gegen die Tür vom Retox stemmte, kam ihr gleich der bekannte Duft nach Holz, Leder und bitterem Alkohol entgegen. Gemischt war das Ganze mit einer Note von gesalzenen Erdnüssen.
»Hey, Matt!«, rief sie im Vorbeigehen und verschwand hinter dem Tresen, um ihre Lederjacke darunter zu verstauen. Im Nu war sie im Arbeitsmodus und verschaffte sich einen Überblick über die Bar. Zwei Kunden befanden sich am Tresen, ihre Gläser waren halb voll und wurden von den lilafarbenen Leuchten über ihren Köpfen beschienen. Insgesamt war das Licht im gesamten Laden dämmrig und in Blau- und Lilatönen gehalten. Die Einrichtung sah im Gegensatz zur extravaganten Beleuchtung eher spartanisch und heruntergekommen aus. Die Barhocker waren größtenteils brüchig und abgenutzt, die Tische brauchten dringend mal wieder eine Politur, aber trotzdem mochte Raven den Laden. Es hatte etwas Beruhigendes an sich, den Leuten zu einem angenehmen Feierabend zu verhelfen – mal abgesehen von den Kriminellen, die sie tagtäglich belauschte.
»Hey.« Matthew knuffte sie in die Seite.
»Was gibt’s Neues?«
»Alles beim Alten.«
Mehr würde sie von ihm nicht bekommen, und darüber war sie froh. Matthew war nicht nur ein guter Arbeitgeber, weil er sofort zur Stelle war, wenn jemand einen dummen Kommentar über ihresgleichen abließ – er war außerdem ziemlich wortkarg, was ihr sehr gelegen kam.