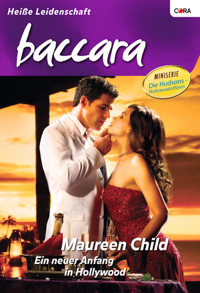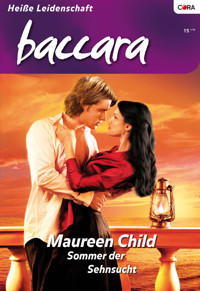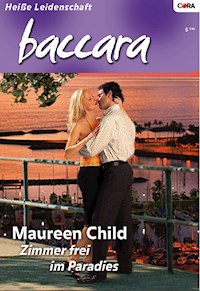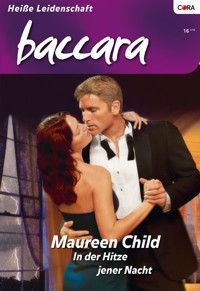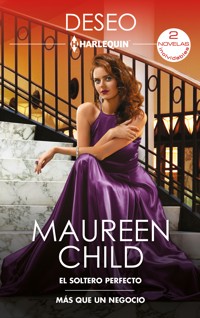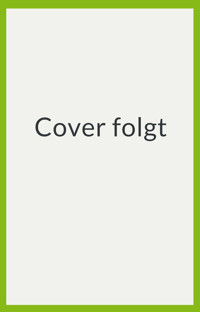5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: CORA Collection
- Sprache: Deutsch
EIN MANN MIT ZU VIEL SEX-APPEAL von MAUREEN CHILD In seiner weißen Uniform sieht Chance beinahe unwiderstehlich aus! Aber eben nur beinahe: Jennifer hat sich geschworen, ihr Herz nie wieder an einen Mann in Uniform zu verlieren! Doch Chances weiche Lippen bringen ihren Vorsatz ins Wanken … EIN OFFIZIER UND HERZENSBRECHER von TAWNY WEBER Admiralstochter Alexia hat eine Regel: Lass dich nie auf einen Mann vom Militär ein! Alle Vorsicht ist vergessen, als sie Blake in einer Bar erblickt - und eine heiße Nacht mit ihm verbringt. Am nächsten Tag will sie ihn wiedersehen. Doch es kommt anders ... TIEF IN UNS von KIRA SINCLAIR Mit einem sexy Navy SEAL auf Schatzsuche zu gehen, ist so ziemlich das Letzte, was Avery will! Noch schlimmer wird es, als sie mit ihm auf einer einsamen Insel strandet. Aber manchmal ist gerade das Schlimmste das Beste …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Maureen Child, Tawny Weber, Kira Sinclair
CORA COLLECTION BAND 26
IMPRESSUM
CORA COLLECTION erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
Neuauflage in der Reihe CORA COLLECTIONBand 26 - 2020 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2002 by Harlequin Books S. A. Originaltitel: „The SEAL’s Surrender“ erschienen bei: Harlequin Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Brigitte Marliani-Hörnlein Deutsche Erstausgabe 2010 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe COLLECTION BACCARA, Band 291
© 2013 by Tawny Weber Originaltitel: „A SEAL’s Seduction“ erschienen bei: Harlequin Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Sandra Roszewski Deutsche Erstausgabe 2013 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe TIFFANY HOT & SEXY, Band 33
© 2015 by Kira Sinclair Originaltitel: „In Too Deep“ erschienen bei: Harlequin Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Alina Lantelme Deutsche Erstausgabe 2015 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe TIFFANY HOT & SEXY, Band 48
Abbildungen: Harlequin Books S. A., Chainarong, Prasertthai doomu, fatihhoca, Michael Burrell, riclefrancais / Getty Images, alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 05/2020 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733728694
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Ein Mann mit zu viel Sex-Appeal
1. KAPITEL
Er hasste Partys.
Gib Chance Barnett ein Maschinengewehr, und er ist ein glücklicher Mensch. Forder ihn auf, sich unter Menschen zu mischen, und er wird zu einem gefährlichen Hund an kurzer Leine.
Aber, so sagte Chance sich, manchmal musste man eben in den sauren Apfel beißen. Und dieser hier war seiner bescheidenen Meinung nach besonders sauer.
Er hielt die Flasche Importbier fest in der Hand und begab sich an den Rand des Geschehens. Kritisch betrachtete er seine neue Familie. Eine verdammt blöde Art, Verwandte kennenzulernen, sagte er sich. Dennoch, er wusste nicht, wie man es hätte besser machen können.
Es gab wahrscheinlich keine gute Form, ihn und seinen Zwillingsbruder Douglas dem Rest der Familie Connelly vorzustellen. Und eines musste man dem Clan lassen: Alle hatten die Nachricht von der Existenz der Zwillinge gefasster aufgenommen, als zu erwarten gewesen war. Schließlich lernte man nicht jeden Tag sechsunddreißigjährige Zwillinge kennen, die zur Familie gehörten.
Und er musste zugeben, dass keiner der Connellys ihm oder seinem Bruder das Gefühl gegeben hatte, nicht gut genug für die Familie zu sein. Selbst Miss Lily und Tobias waren vorzeitig aus Palm Springs zurückgekehrt, um ihn und Douglas zu begrüßen.
Sein Blick wanderte zu dem älteren Paar. Falsch, korrigierte er sich, nicht irgendeinem älteren Paar, seinen Großeltern. Irgendwie seltsam. Schmunzelnd beobachtete er, wie Tobias versuchte, seiner viel kleineren Frau zu entwischen. Doch Miss Lily war trotz ihres Stocks zu schnell für ihren Mann und schnappte sich das Glas Whiskey aus seiner Hand.
Interessanterweise lächelte der groß gewachsene Mann sie nur liebevoll an und gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Wie ist es wohl, fragte sich Chance, das ganze Leben mit einem einzigen Partner zu verbringen? Und diesen einen Menschen so sehr zu lieben, dass dies auch mehr als fünfzig Jahre später noch weithin sichtbar ist.
Diese beiden alten Menschen hatten es geschafft, eine Dynastie aufzubauen. Wirklich erstaunlich, wenn man einmal in Ruhe darüber nachdachte. Sicher, die Connellys waren sozusagen amerikanischer Adel. Aber zur Familie gehörte auch echter Adel.
Und Chance und Douglas Barnett waren Teil dieser Familie.
Er schüttelte den Kopf und bewegte sich weiter durch die Menge. Eine schrille weibliche Stimme erregte seine Aufmerksamkeit. Neugierig verlangsamte er seinen Schritt.
Seine Halbschwester Alexandra, eine große Frau mit rabenschwarzem Haar, wichtigtuerischem Gehabe und scharfen grünen Augen stand im Mittelpunkt des Interesses, in dem sie sich sehr wohlzufühlen schien. „Es ist furchtbar bedauerlich, dass ihr meinen Verlobten nicht kennenlernen könnt“, sagte sie gerade. „Aber Robert ist geschäftlich unterwegs.“
Ihr Publikum nickte verständnisvoll, doch Chance dachte nur, der Glückliche. Zumindest dieser Robert hatte es geschafft, um die Party herumzukommen. Chance beeilte sich weiterzugehen, drehte sich dabei aber etwas zu schnell um, sodass er die Stelle spürte, an der er kürzlich genäht worden war.
Schmerzhaft wurde er daran erinnert, weshalb es ihm überhaupt möglich war, dieser Feier beizuwohnen. Denn wäre er bei seinem letzten Einsatz nicht verletzt worden, könnte er jetzt nicht hier sein, sondern wäre irgendwo mit seiner Truppe unterwegs. Sobald seine Verletzung abgeheilt war, würde er wieder zu den Kameraden stoßen. Sein Seesack war gepackt.
Chance Barnett war ganz und gar zum Abflug bereit. Er musste zurück zu seinem SEAL-Team, einer Spezialeinheit der amerikanischen Marine. Er musste dorthin zurück, wo er hingehörte. Mit finsterem Gesicht sah er in Richtung seines Bruders Douglas, der mit einigen der neuen Verwandten plauderte, und er wünschte beinah, er würde sich unter diesen Menschen genauso wohlfühlen wie sein Bruder.
Verdammt, sein Bruder hatte mit einem ihrer neuen Cousins sogar über seine Exfrau gesprochen und darüber, dass seine Ehe gescheitert war, weil seine damalige Frau im Gegensatz zu ihm, Douglas, keine Kinder wollte.
Klar doch, Chances Bruder fügte sich mühelos in die Familie ein! Und er hatte offensichtlich auch kein Problem damit, den Namen Connelly an ihren Nachnamen Barnett anzuhängen. Aber Douglas war immer schon der Vernünftigere von ihnen beiden gewesen. Deshalb war er wohl auch Arzt geworden, während er selbst dieser Kampftruppe beigetreten war.
Okay, dachte Chance, reine Spekulation.
„Entschuldigen Sie, Sir“, sagte eine tiefe Stimme direkt hinter ihm. Chance drehte sich zu einem elegant gekleideten Kellner um. „Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?“
Chance hielt sein Bier hoch. „Nein danke.“ Er schüttelte den Kopf bei dem Gedanken, dass diese Familie wahrscheinlich ständig von eigenen Kellnern und Butlern umgeben war. „Ich habe noch.“
Vielleicht lag es an seiner Militärausbildung, vielleicht war es auch sein angeborenes Bedürfnis, immer Herr der Lage zu sein, jedenfalls trank Chance auf einer Party selten mehr als ein Bier. Selbst auf einer Feier wie dieser, wo er sich im Grunde völlig deplatziert fühlte.
Wortlos zog der Kellner weiter durch die Gästeschar, und Chance schüttelte wieder den Kopf. Wie bin ich hier nur gelandet, fragte er sich. Und wie konnte er sich möglichst bald einen höflichen Abgang verschaffen? Er flüchtete in eine Ecke des Raumes, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und ließ seinen Blick über die Menschen gleiten, die sich an diesem Abend hier versammelt hatten.
Ein SEAL in einem Herrenhaus direkt am Ufer des Michigansees? Einfach absurd. Chance lächelte in sich hinein. Niemand würde ihm das abkaufen. Er hob sich von der elegant gekleideten Menge ab. Die weiße Ausgehuniform der amerikanischen Navy fiel in dem Meer von lebhaften Farben und schwarzen Smokings auf. Zugleich befand er sich das erste Mal in seinem Leben einem Raum mit Menschen, mit denen er tatsächlich verwandt war.
Douglas und er waren ohne Vater aufgewachsen, ihre alleinerziehende Mutter hatte ihr Bestes getan. Doch sie hatte nicht viel Zeit für ihre Söhne gehabt, und es hatte auch keine Verwandten gegeben, die sich um die Jungs hatten kümmern können. Und jetzt stand er hier, sechsunddreißigjährig, und traf das erste Mal auf seine Cousins, Cousinen und Halbgeschwister.
Es war ziemlich absurd.
Chance trank einen Schluck Bier und gestand sich insgeheim ein, dass es nicht unbedingt schlecht war, eine Familie zu haben. Es würde nur eine Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen. Von der anderen Seite des Raumes warf Douglas ihm lächelnd einen vielsagenden Blick zu. Hättest du das für möglich gehalten, schienen seine Augen zu sagen.
Sofort fühlte Chance sich wohler. Er und sein Zwillingsbruder hatten einander im Laufe der Jahre immer wieder aus der Klemme geholfen. Und solange sie aufeinander zählen konnte, würde der Name Connelly hinter dem Namen Barnett nicht viel ändern.
Dennoch, er könnte etwas frische Luft vertragen.
Schnell entschlossen spazierte er zu der breiten Glasschiebetür, die hinaus auf den Balkon führte. Die Geräusche gedämpfter Unterhaltung und leiser Klaviermusik begleiteten ihn, während er in einem großen Bogen um die vielen Gäste herumging. Als er sich der Tür näherte, wurde ihm klar, dass sich sein Wunsch, allein zu sein, nicht erfüllen würde.
Eine Frau stand im Licht der Abendsonne auf dem Balkon, ihr hellblondes Haar war vom Wind zerzaust. Chance kannte sie. Es war Jennifer Anderson, Emma Connellys Sekretärin. Sie hatten sich in den letzten Tagen ein paar Mal gesehen.
Jennifer war nicht besonders groß, hatte aber eine tolle Figur. Ihr dunkelgrünes Kleid, das kurz über dem Knie endete, brachte ihre schönen Beine wunderbar zur Geltung. Sie hatte herrlich volle Brüste und eine so schmale Taille, dass er sie wahrscheinlich mit seinen Händen umfassen könnte, wenn er die Gelegenheit dazu bekäme. Mit geradem Rücken stand sie da und blickte auf den Michigansee. Chance runzelte die Stirn, als er bemerkte, dass sie eine Hand an den Mund gelegte hatte und die Schultern leicht hängen ließ.
Sofort regte sich etwas in ihm, und sein stark ausgeprägter Beschützerinstinkt trieb ihn nach draußen. Er schob die Glastür auf. Der kräftige Wind, der vom See her blies, drückte ihn fast zurück auf die Party. Aber ein SEAL gab nicht so schnell auf. Chance stemmte sich gegen den Wind, trat leise auf den Balkon und schloss geräuschlos die Tür hinter sich.
„Reiß dich endlich zusammen, Jen“, murmelte die Frau, offenkundig zu sich selbst, bevor Chance sich bemerkbar machen konnte. „Weinen hilft nicht. Du schaust nur furchtbar dabei aus.“
Er konnte nicht widerstehen, darauf eine Antwort zu geben.
„Lady“, sagte er leise, „alle Tränen der Welt würden das nicht schaffen.“
Sie wirbelte herum. Ihre Körpersprache zeigte ihm deutlich, dass sie nicht begeistert davon war, in diesem Zustand erwischt worden zu sein. Doch sie erkannte ihn sofort, und ihre Abwehrhaltung ließ nach.
„Sie haben mich überrascht.“ Sie hob die Hand und wischte sich die verräterischen Tränen von den Wangen.
„Tut mir leid“, sagte er, auch wenn es nicht wirklich stimmte. „Alte Angewohnheit. Ich bin geübt, mich geräuschlos zu bewegen.“
Sie zog eine Augenbraue hoch. „Wir sind hier nicht im Busch, Commander. Hier ist es üblich, dass man anklopft.“
„Ja.“ Er trat näher zu ihr. „Aber man klopft, wenn man irgendwo hineinmöchte. Ich bin hinausgegangen.“
„Wortklauber.“ Jennifer drehte das Gesicht wieder in den Wind. Sie stierte in die Ferne und kümmerte sich nicht weiter um Chance, in der Hoffnung, er würde wieder gehen. Schließlich konnte sie ihm nicht gut vorschreiben zu gehen. Er war immerhin einer der verlorenen Söhne, für die diese Party arrangiert worden war. Also musste er entweder aus eigenem Antrieb wieder gehen, oder sie war gezwungen, sich erneut unter die Gäste zu mischen und so tun, als sei alles in Ordnung.
Bitte, lieber Gott, lass ihn verschwinden.
Ihre Bitte wurde nicht erhört. Chance Barnett Connelly trat neben sie und legte die Hände auf das schmiedeeiserne Balkongeländer. Sie waren kräftig und braun gebrannte, und Jennifer bemerkte, dass die Knöchel weiß wurden, so fest war sein Griff. Offensichtlich war er ebenso angespannt wie sie. Doch die Gründe dafür waren sehr unterschiedlicher Natur.
„Also, was ist das Problem?“ Chance blickte in die Wolken, die tief am Himmel hingen.
„Problem?“ Jennifer richtete sich auf. Das Letzte, was sie wollte oder brauchte, war Mitleid. Vor allem nicht von einem Mann, den sie nicht kannte. Außerdem war er ein Connelly. Wenn sie sich ihm anvertraute, dann wüsste bald jeder Bescheid, und das war nicht in ihrem Sinne. Zunächst musste sie mit Emma Connelly sprechen.
Emma war nicht nur ihre Chefin, sie war auch so etwas wie eine Mutterfigur für Jennifer. Ihre eigenen Eltern waren schon vor Jahren gestorben, und abgesehen von ihrer Tochter Sarah, hatte Jennifer niemanden auf der Welt. Was sie nie sonderlich gestört hatte. Bis gestern.
„Ja.“ Chance warf ihr einen Blick von der Seite zu. „Wenn ich eine wunderschöne Frau allein und weinend auf dem Balkon vorfinde, während keine drei Meter von ihr ein fröhliches Fest gefeiert wird, dann … nun, dann muss wohl ein Problem vorliegen.“
Jennifer atmete tief die kalte Luft ein und schöpfte aus ihr Kraft. Dann legte sie eine Fröhlichkeit in ihre Stimme, die sie nicht verspürte, und antwortete: „Danke der Nachfrage, aber es ist alles in Ordnung.“
„Soso.“
„Wirklich.“ Sie blickte ihn aus den Augenwinkeln an. „Sie glauben mir nicht.“
„Nein.“
„Nun …“, sie stieß sich vom Balkongeländer ab, „… das ist nicht mein Problem.“
Er fasste sie am Arm. „Gehen Sie nicht.“
Seine Berührung hatte irgendwie etwas sehr Tröstliches. Jennifer blieb stehen und blickte in seine hellbraunen Augen. Sie hatten genau den Ton von feinem altem Cognac. Ihr Herzschlag geriet leicht ins Stolpern. Der Mann hatte markante Gesichtszüge, kräftige Kiefermuskeln, und seine Nase war mindestens einmal gebrochen gewesen. Das braune Haar trug er militärisch kurz. Trotzdem weckte es in ihr den Wunsch, mit den Fingern darin zu wühlen.
Und er war unglaublich groß und hatte breite Schultern, die dafür geschaffen schienen, die Last der ganzen Welt zu tragen. An diesem Abend konnte sie gut eine starke Schulter zum Anlehnen gebrauchen. Doch Jennifer war zu sehr daran gewöhnt, auf eigenen Füßen zu stehen, um sich in einem schwachen Moment einfach so gehen zu lassen.
Als könnte er ihre Gedanken lesen, sagte er: „Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber wo ich schon einmal hier bin, kann ich Ihnen doch auch helfen“
Ein verführerischer Gedanke, dachte Jennifer. Absolut verlockend. Aber nein. Sie schüttelte den Kopf. „Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber …“
„… ich bin ein Fremder.“
„Ja.“
„Manchmal ist das besser.“ Er hielt sie immer noch am Arm fest, als rechnete er damit, sie könnte hastig weglaufen. Was sie gern auch getan hätte. Dann lächelte er, und sie verspürte ein Kribbeln im Bauch. „Wenn man einem Fremden seine Probleme anvertraut, dann ist es, als würde man zu sich selbst sprechen. Nur, dass man seine eigenen Fragen nicht selbst beantworten muss und auch nicht Gefahr läuft, sich im Kreis zu drehen.“
Fast hätte er ihr ein Lächeln entlockt. Ihre Mundwinkel zeigten schon leicht nach oben. Doch der Anflug des Lächelns war schnell wieder verschwunden. Seit sie gestern mit den Ärzten ihrer Tochter gesprochen hatte, gab es nichts mehr zu lachen für sie.
Es war, als würde sich eine eisige Hand um ihr Herz schließen. Sie fühlte nichts mehr als Hoffnungslosigkeit und Trauer.
Chance ließ die Hand über ihren Arm zu ihren Schultern gleiten und drückte sie sanft. „Reden Sie mit mir. Vielleicht kann ich helfen.“ Er neigte den Kopf etwas und lächelte ihr aufmunternd zu. „Hey, ich bin ein SEAL. Zum Helden ausgebildet. Lassen Sie mich helfen, okay?“
Jennifer warf einen Blick über die Schulter zu den fröhlich feiernden Menschen direkt hinter der Glastür, dann sah sie Chance ins Gesicht. Was soll’s, dachte sie. Sie konnte wirklich eine starke Schulter gebrauchen.
„Es geht um meine Tochter“, stieß sie hervor, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte.
„Sie haben eine Tochter?“
„Ja.“ Bei dem Gedanken an Sarah hatte Jennifer sofort ihr Bild vor Augen. Sie lächelte in sich hinein. Große braune Augen in einem runden kleinen Gesicht, das immer dreckig war. Süße Rattenschwänzchen, die nicht viel mehr waren als dünne, hellbraune Strähnen, und mit kindlichen Spangen gehalten wurden. Kleine, pummelige Händchen und kurze, stämmige Beine. Klebrige Küsse und stürmische Umarmungen. Kitzeln und herzhaftes Lachen.
Ärzte in weißen Kitteln. Lange, gefährlich aussehende Nadeln. Sarahs Tränen.
„O Gott“, stöhnte Jennifer. Sie legte die Hand an den Mund, nicht sicher, ob sie sich übergeben oder wieder weinen würde.
Es war alles so verdammt unfair.
„Kommen Sie.“ Chance drehte sie zu sich um und zog sie in seine Arme.
Und weil sie Nähe so dringend brauchte, ließ sie es geschehen.
Sie schmiegte sich an seine breite Brust, schlang die Arme um seine Taille und schöpfte neue Kraft aus seiner Stärke. Sie merkte, dass er über ihren Rücken strich, und irgendwie half es. Obwohl sie wusste, dass sich an ihrem Problem nichts änderte, fühlte sie sich getröstet. Und einen Moment lang schien die Welt nicht mehr so angsterregend, wie noch ein paar Minuten zuvor.
„Erzählen Sie es mir.“ Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. „Sagen Sie mir, was Sie bedrückt.“
„Sarah, meine Kleine. Sie muss operiert werden. Am Herzen. Sie hat ein Loch im Herzen.“ Das erste Mal, seit der Arzt die grausame Diagnose gestellt hatte, sprach sie die Worte laut aus.
„Sch.“ Es war ein tröstliches Geräusch, eher wie ein tiefer ausgestoßener Atemzug, aber auch das half. Sie spürte sein Mitgefühl an der sanften Art, wie er sie enger an sich zog. „Wie alt ist sie?“
„Achtzehn Monate.“ Jennifer blickte an ihm vorbei auf den See, doch in Wirklichkeit hatte sie das Bild ihrer Tochter vor Augen. „Sie ist noch so klein. So winzig. Sie dürfte nicht so krank sein.“
„Nein, dürfte sie nicht“, erwiderte er leise. „Das ist echt besch… Entschuldigung.“
Jennifer nickte nur. „Ja“, sagte sie, dankbar, dass jemand anderer aussprach, was sie dachte. „Ist es.“
2. KAPITEL
Chance war wirklich kein Familienmensch. Doch er spürte Jennifers Angst, als ginge es um sein eigenes Kind.
Sein Instinkt befahl ihm, schnell zu handeln und ihr schützend zur Seite zu stehen. Doch seine ganze Ausbildung nützte ihm in diesem Fall überhaupt nichts. Diese Erkenntnis war schwer zu schlucken.
Verflixt, ihm fielen nicht einmal ein paar tröstende Worte ein! Wirklich toll, Chance, deine redegewandte Reaktion.
Er hielt Jennifer weiter in den Armen, in der Hoffnung, dass ihr diese stumme Umarmung irgendwie half. Merkwürdig, vor ein paar Tagen hatte er noch nicht einmal gewusst, dass es all diese Menschen hier überhaupt gab. Und jetzt stand er auf dem Balkon eines Herrenhauses und hielt eine weinende Frau fest umschlungen.
„Was mache ich denn hier?“, murmelte Jennifer, als sie sich aus seiner Umarmung löste und sicherheitshalber noch einen Schritt zurücktrat. „Ich ruiniere ja Ihre weiße Uniform mit meiner Wimperntusche.“
Das ist meine geringste Sorge, dachte er und blickte in ihre dunkelgrünen Augen. Sie waren groß, traurig und schimmerten feucht. Die Wimperntusche war nicht verschmiert. Er sah nur die Tränen, gegen die sie so tapfer ankämpfte, dass er sie dafür bewunderte.
Anstatt sich in der Angst zu verlieren, die ihr fast den Atem nahm, kämpfte sie mit eisernem Willen dagegen an. Sie wollte nicht einmal Mitleid. Was also konnte er überhaupt für sie tun?
„Möchten Sie wieder hineingehen?“
„Um Gottes willen, nein.“ Sie schüttelte den Kopf und trat ans Geländer. Mit dem Rücken zur Glastür und das Gesicht von ihm abgewandt, sagte sie: „Niemand soll sehen, dass ich geweint habe. Ich könnte die Fragen im Moment nicht ertragen.“
Dafür hatte er volles Verständnis. Also gut, wenn er sie schon nicht in das Getümmel an Partygästen geleiten konnte, dann wollte er zumindest dafür sorgen, dass sie später unbelästigt hineinkam. „Okay. Warten Sie hier. Ich bin gleich zurück.“
Bevor sie etwas erwidern konnte, öffnete er schon die Schiebetür und kehrte zur Party zurück. Lärm schlug ihm entgegen, und er vermisste augenblicklich die friedliche Stille auf dem Balkon.
Chance schenkte den Menschen um sich herum keine Beachtung. Konzentriert bewegte er sich durch die Menge, als wäre er im Einsatz. Er behielt sein Ziel im Kopf und machte sich daran, es so schnell wie möglich zu erreichen. Was bei den vielen Partygästen nicht so einfach war, wie er erwartet hatte.
Er warf einen schnellen, fast sehnsüchtigen Blick in Richtung Ausgang, verdrängte dann aber den Wunsch, sich heimlich zu verdrücken und ging unbeirrt weiter.
Als er die Küche betrat, sah das dort beschäftigte Personal überrascht auf.
„Kann ich Ihnen helfen, Mr. Chance?“
Dankbar blickte er zu der Frau rechts von ihm und suchte fieberhaft nach ihrem Namen. Eine Sekunde später fiel er ihm ein.
„Sie sind Ruby, nicht wahr?“, fragte er.
„Allerdings.“ Die Haushälterin nickte so heftig, dass sich eine Strähne ihres ergrauenden roten Haares aus dem Knoten löste.
In den wenigen Tagen, die Chance jetzt in der Stadt war, hatte er gesehen, dass diese Frau den Haushalt der Connellys – und eigentlich die ganze Familie – mit eiserner Hand führte. Grant und Emma glaubten vielleicht, hier das Sagen zu haben, doch in Wahrheit war es Ruby.
Die kleine rundliche Frau mit den freundlichen blauen Augen besaß ein Durchsetzungsvermögen, das Chance sehr zu schätzen wusste. Er hatte gesehen, wie seine Halbgeschwister flitzten, wenn Ruby eine Anweisung gab. Selbst sein Vater Grant akzeptierte widerspruchslos, was sie entschied.
Offensichtlich führte sie hier schon so lange das Regiment, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kam, jemand könnte ihr widersprechen. Beim Militär hätte sie wahrscheinlich den Rang eines Generalstabschefs erreicht.
„Also, was kann ich für Sie tun?“, riss sie ihn abrupt aus seinen Gedanken – mit der gleichen Entschiedenheit, mit der sie nach der Hand eines Kindes geschnappt hätte, das sich aus dem Staub machen wollte.
Chance blickte auf die anderen Angestellten, die sich in Hörweite versammelt hatten. Es widerstrebte ihm, vor so vielen neugierigen Zuhörern zu sprechen. Die Haushälterin bemerkte sein Zögern und klatschte laut in die Hände. „Was steht ihr hier herum? Macht euch an die Arbeit. Die Getränke und Snacks müssen serviert werden.“
Die Küchenbediensteten stoben auseinander wie Blätter im Wind, und einen Moment später war er mit Ruby allein. „Ich bin beeindruckt“, sagte er.
„Weil ich sie fortgejagt habe? Nicht nötig. Die jungen Leute tun mir allerdings leid“, sagte die Frau und schüttelte den Kopf. „Sie sind nur Aushilfskräfte für diese Feier, und ihre Mütter haben offensichtlich vergessen, ihnen Manieren beizubringen.“
Chance lächelte. „Dafür sind Sie ja jetzt da.“
Ruby richtete sich auf und warf sich in die Brust. „Ich werde mein Bestes tun, in der kurzen Zeit, während der ich sie hier habe“, versicherte sie ihm. „Also, was kann ich für Sie tun, Mr. Chance?“
Er stöhnte innerlich bei der Anrede. Es machte ihm nichts aus, Commander genannt zu werden, den Titel hatte er sich erarbeitet. Er konnte auch damit leben, wenn jemand „He, Matrose“ rief, aber „Mr. Chance“? Das klang in seinen Ohren doch sehr merkwürdig. „Nennen Sie mich bitte einfach Chance, einverstanden?“
Die Haushälterin zog einen Mundwinkel hoch, doch dann nickte sie. „Einverstanden, Chance.“ Sie betrachtete ihn einen Moment, dann sagte sie: „Um die Augen herum haben Sie große Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. Mehr als Ihr Bruder.“
Chance war unbehaglich zumute. Er musste nicht unbedingt daran erinnert werden, dass er aussah wie der Mann, der es geschafft hatte, seine beiden Söhne ein Leben lang zu ignorieren.
Da es ihm nicht angebracht schien, der Haushälterin für das zweifelhafte Kompliment zu danken, ging er über ihre Bemerkung einfach hinweg. Schließlich war er nicht mit der Absicht hierhergekommen, eine Familie zu finden. Er hatte bereits eine Familie – Douglas. Nach dem Tod ihrer Mutter hatten sie sich nur noch gegenseitig. Und bisher war ihnen das genug gewesen.
Er war nur wegen seinem Bruder hier. Und hätte ihn dieser hinterhältige, kleine Terrorist auf seinem letzten Einsatz nicht angeschossen, dann müsste er jetzt nicht die Pracht und Herrlichkeit ertragen, mit der sich die Connellys umgaben. Allerdings wäre er dann auch nicht zur Stelle gewesen, um Jennifer zu Hilfe zu eilen.
Der Gedanke erinnerte ihn daran, warum er überhaupt in die Küche gekommen war.
„Könnte ich bitte ein Glas Wasser und eine Packung Papiertaschentücher bekommen?“
Ruby musterte ihn nachdenklich. „Sie fürchten, dass ein Heulkrampf Sie überwältigt?“
Chance stieg auf ihren Scherz ein. „Ja, Ma’am. Ich bin emotional sehr aufgewühlt.“
Sie schnaubte. „Das ist nicht zu übersehen.“ Ohne ein weiteres Wort brachte sie ihm die gewünschten Dinge. Er schickte sich an, die Küche zu verlassen, doch die Stimme der resoluten Dame hielt ihn zurück. „Richten Sie Jennifer von mir aus, dass alles gut werden wird.“
Chance betrachtete Ruby. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dachte er. Er hatte bereits bemerkt, dass es in diesem Haus nicht viel gab, wovon Ruby nichts wusste. „Wie bitte?“
„Ich bin schon länger bei den Connellys, als Sie sich vorstellen können. Mir entgeht so schnell nichts. Und ich weiß es, wenn etwas nicht stimmt.“
Er nickte. „Sie würden einen guten Admiral abgeben.“
„Pah!“ Sie winkte ab. „Admiral! Das ist doch Kinderkram. Ich würde einen guten Präsidenten abgeben.“
„Wissen Sie was?“ Er zwinkerte ihr zu. „Ich glaube Ihnen.“ Dann schlüpfte er schnell aus der Küche, bevor sie ihm noch irgendwelche Befehle erteilen konnte.
„Toll gemacht, Jen“, murmelte Jennifer vor sich hin. Sie umklammerte das Balkongeländer und starrte hinaus auf den Michigansee. „Das ist die beste Art, deine Anstellung zu sichern.“ Sie schüttelte den Kopf und hielt krampfhaft die Tränen zurück. Ich werde nicht mehr weinen, schwor sie sich. Sie hatte schon genug Mist gebaut.
Was hatte sie sich eigentlich dabei gedacht, sich auf der Feier ihrer Arbeitgeber an der Schulter des Ehrengastes auszuweinen? Einmal in ihrem Leben ließ sie sich gehen, und schon wurde sie von einem Mann erwischt, der eine Sünde wert war.
„Reiß dich zusammen!“, murmelte sie und klammerte sich am schmiedeeisernen Geländer fest. Sie hielt das Gesicht in den Wind, der vom See her wehte. Wenn sie Glück hatte, würde das neueste Familienmitglied der Connellys ihren peinlichen Ausrutscher für sich behalten.
Doch das war wahrscheinlich Wunschdenken, denn gerade jetzt war er im Haus und versuchte vermutlich, Emma zu überreden, nach ihr zu sehen und sie zu trösten. Sicherlich übergab er die verrückte Sekretärin nur zu gern in ihre Obhut. Jennifer sah ihn direkt vor sich, wie er sich seinen Weg durch die Partygäste bahnte und auf den Ausgang zusteuerte. Sie konnte es ihm nicht verdenken.
Welcher Mann wollte schon gern ein lebendes Taschentuch für eine weinende Frau abgeben? Und dann auch noch für eine, die er kaum kannte.
Hinter ihr glitt die Glastür auf. Für den Bruchteil einer Sekunde drangen Gesprächsfetzen und leise Klaviermusik auf den Balkon, dann wurde die Tür schon wieder geschlossen, und die wohltuende Stille kehrte zurück.
Sie drehte sich nicht um. Es war nicht nötig. Sie wusste auch so, wer gekommen war. Seine Anwesenheit konnte sie fast wie elektrische Spannung in ihrem Körper spüren. Ein Prickeln überlief sie, und ihre Nackenhaare stellten sich auf.
Kein gutes Zeichen.
„Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.“ Seine tiefe, erotische Stimme strapazierte ihre ohnehin zum Reißen gespannten Nerven.
Reiß dich zusammen, Jen. Er ist der Stiefsohn deiner Chefin. Er ist ein Fremder. Deine Probleme interessieren ihn überhaupt nicht. Zwischen dir und ihm ist nichts außer einem peinlichen Heulkrampf.
Warum also hatte sie plötzlich Schmetterlinge im Bauch und atmete schneller als normal?
Weil du dir etwas einbildest, sagte sie sich, bevor sie sich zu ihm umdrehte.
Sie wäre besser geblieben, wo sie war. Der Mann war einfach zu attraktiv. Er sah aus wie die Rekruten auf den Werbeplakaten der amerikanischen Marine. Oder wie einer der Marineanwälte in dieser Fernsehsendung. Seine Uniform hob sich strahlend weiß vor dem Hintergrund des blauen Sees und des dunklen Abendhimmels ab. Die Abzeichen, mit denen die Uniform dekoriert war, und die SEAL-Nadel, die er so stolz trug, erregten ihre Aufmerksamkeit. Ihr Blick wanderte höher, zu seinen Augen, und sie sah … Sorge.
Damit war es fast um sie geschehen.
Verflixt.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
„Sicher, alles prima“, erwiderte sie und schniefte.
Er reichte ihr die Box mit den Taschentüchern. Dankbar zog Jennifer eins heraus. Sie trocknete sich die Augen, putzte sich die Nase und fühlte sich immer noch nicht besser.
„Hier, trinken Sie etwas.“ Er reichte ihr das hohe, blassblaue Glas.
„Was ist das?“ Jennifer nahm das Glas. „Gift?“
„Nichts, was Sie umbringen könnte.“ Er lächelte. „Es ist nur Wasser.“
Jennifer nahm einen Schluck. Die kühle Flüssigkeit war eine Wohltat für ihre trockene Kehle. Sie sah ihn an. „Danke. Für die Taschentücher und das Wasser.“
„Stets zu Diensten, Ma’am.“
„Sie haben sicher nicht damit gerechnet, auf Ihrer Willkommensparty den Retter spielen zu müssen.“
Er zuckte mit den Schultern. „Hey, ob eine Party oder ein Terrorangriff – ein SEAL wird mit allem fertig.“
„Gut zu wissen“, murmelte sie. Mit dem Glas in der Hand drehte sie sich wieder zum See um. Sie durfte ihn nicht noch länger ansehen. Das war einfach nicht gut für ihr seelisches Gleichgewicht. Weit besser war es, hinaus auf den See zu starren, der die Ausmaße eines Meeres hatte und dessen Wellen gegen die Uferpromenade schlugen.
„Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter“, sagte er ruhig. Jennifer verspürte einen leichten Stich und schloss kurz die Augen. So schwer es ihr im Moment fiel, darüber zu sprechen, sie war ihm eine Erklärung für ihren Weinkrampf schuldig.
„Sarah ist ein aufgewecktes Kind.“ Ihre Stimme bebte anfangs, doch der Stolz auf ihre Tochter ließ sie fester werden. „Noch bevor sie ein Jahr alt war, hat sie angefangen zu sprechen, und jetzt versucht sie schon, ihren Willen durchzusetzen.“ Jennifer lachte heiser. „Wenn sie erst einmal ein Teenager ist …“, sie wird leben, sagte sie sich, an etwas anderes darf ich gar nicht denken, „… dann werden wir uns wahrscheinlich ständig wegen irgendetwas in den Haaren liegen.“
„Vermutlich“, stimmte er zu. „Als Jugendliche haben Doug und ich unsere Mutter fast in den Wahnsinn getrieben. Seien Sie froh, dass Sie eine Tochter haben. Sie wird sich zumindest nicht für Drag Racing, diese verrückten Autorennen, interessieren. Eine Sorge weniger für Sie.“
Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu, sein kleines Eingeständnis überraschte sie überhaupt nicht. Er war schließlich ein SEAL, der seinen Job ganz offensichtlich liebte. Da war es nur natürlich, dass er sich schon als Jugendlicher gefährliche Hobbys gesucht hatte.
Wie Mike, dachte sie und verspürte wieder diesen vertrauten, tiefen Schmerz. Die beiden Männer hätten sich zweifellos hervorragend verstanden. Als könnte er ihre Gedanken lesen, sprach Chance weiter.
„Ihr Mann muss genauso stolz auf Sarah sein wie Sie“, sagte er.
„Mein Mann ist tot.“ Es hatte lange gedauert, bis sie sich daran gewöhnt hatte, diese Worte auszusprechen.
„Oh. Das tut mir leid.“
„Sie wussten es nicht“, sagte sie leise. „Kein Grund für Mitleid. Er ist schon vor fast zwei Jahren gestorben.“ Sie seufzte tief. „Er hat Sarah nicht einmal kennengelernt.“
Es entstand eine unbehagliche Pause, bevor er sagte: „Meine Mutter war auch alleinerziehend. Ich weiß, wie schwer das ist.“
Sie blickte in seine goldbraunen Augen und las darin echtes Verständnis.
Emma war ihr wohlgesonnen, sie war eine gute Arbeitgeberin und Freundin, doch was es bedeutete, allein für ein Kind verantwortlich zu sein, konnte sie nicht wirklich ermessen. Nicht mit einem Mann wie Grant an ihrer Seite, der sie heute noch genauso liebte wie vor vielen Jahren.
„Darf ich fragen, woran Ihr Mann gestorben ist?“
„Mike war Polizist“, sagte sie. „Er kam bei einem Einsatz ums Leben. Ich war mit Sarah schwanger, als er starb. Er hat sie nie gesehen.“
„Vielleicht doch“, sagte Chance, und Jennifer sah ihn an. „Vielleicht sieht er sie jeden Tag.“
„Eine schöne Vorstellung.“
„Ich habe im Laufe der Jahre so viele Dinge erlebt, dass ich alles für möglich halte.“ Er machte eine lange Pause, dann fuhr er fort: „Meinen Vater habe ich auch nicht gekannt.“ Chance lachte kurz auf. „Zumindest bis vor ein paar Tagen.“
Mitfühlend nickte sie, froh, dass Mike nicht länger das Thema war. „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie sich das anfühlt.“ Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. „Den leiblichen Vater nach so vielen Jahren zu finden …“
Er nickte und hielt das Gesicht in den kalten, scharfen Wind. „Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin mir selbst nicht sicher, wie ich mich eigentlich dabei fühle. Aber …“, er warf einen schnellen Blick über die Schulter, „es bedeutet Doug etwas, deshalb bin ich hier.“
„Sie sind nur wegen Ihres Bruders hier?“
„Warum sonst?“
„Um Ihre Familie kennenzulernen?“
„Bestimmt nicht. Meine Mutter lebt nicht mehr, meine Familie ist Doug. Der Rest …“ Er schüttelte wieder den Kopf, als wüsste er nicht, was er noch sagen sollte.
„Die Connellys sind sehr nette Menschen.“ Jennifer lag viel daran, dass er wusste, wie sehr seine neue Familie bereit war, ihn aufzunehmen und willkommen zu heißen.
„Scheint so.“
„Sie waren zu Sarah und mir ganz wundervoll.“
Er lächelte sie an. „Wenn Ihre Tochter Ihnen auch nur ein bisschen ähnelt, dann ist das nicht erstaunlich.“
Oh, oh, das Lächeln ist genauso gefährlich wie der Mann, dachte sie und wich innerlich einen Schritt zurück. Diese Art von Komplikationen konnte sie im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Ihre Welt war Sarah, und sie musste ihre ganze Aufmerksamkeit der Gesundheit ihres Kindes widmen. Um von dieser wichtigen Aufgabe nicht abgelenkt zu werden, war es das Beste, zu diesem Mann auf Distanz zu gehen.
„Ich …“ Sie blickte mit echtem Bedauern auf die Glasschiebetür. Es war höchste Zeit, auf die Party zurückzukehren. Der Gedanke allerdings, Small Talk treiben zu müssen, während ihr gleichzeitig so schwer ums Herz war, hielt sie zurück.
Doch dann rief sie sich in Erinnerung, wie wichtig diese Feier für Grant und Emma war und dass sie die beiden wochenlang bei der Planung unterstützt hatte. Kummer hin oder her, sie musste ihren Job erledigen. „Ich gehe besser wieder hinein“, sagte sie. Sie hörte Widerwillen in ihrer eigenen Stimme.
Chance drückte sich vom Geländer ab und blickte von der Tür zu Jennifer. Sie war noch nicht in der Verfassung, auf die Party und zu der ausgelassen feiernden Menge zurückzukehren. Er sah es ihr an den Augen an. Sie war noch viel zu aufgewühlt und verletzlich.
Natürlich ging es ihn nichts an, doch irgendwie hatte er das Gefühl einer starken Verbindung zwischen ihnen beiden. Genau wie seine Mutter war sie alleinerziehend. Ihr Mann hatte dem Land gedient, genau wie Chance, nur dass er mit seinem Leben dafür gezahlt hatte.
Sein Beschützerinstinkt meldete sich, und bevor er weiter darüber nachdenken konnte, sagte er: „Ich denke, die Party kommt ohne uns aus. Was halten Sie davon, wenn ich Sie stattdessen nach Hause fahre?“
Sie dachte einen Moment über seinen Vorschlag nach, und er konnte an ihren Augen ablesen, wie gern sie sich einfach verdrückt hätte. Doch würde sie es wirklich tun?
„So gern ich möchte“, erwiderte sie schließlich, „ich glaube, ich sollte besser …“
„Bei den vielen Leuten wird uns niemand vermissen.“
„Doch. Emma wird es auffallen.“
Er nickte. „Okay, dann sagen wir ihr, dass wir gehen. Ich sollte mich sowieso bei ihr bedanken.“
Sie sah ihn schweigend und nachdenklich an.
Wenn Jennifers Zweifel nun nicht ausgeräumt waren, konnte es nur noch an einem liegen: Chance war praktisch ein Fremder – ob er nun mit den Connellys verwandt war oder nicht. „Sie können mir vertrauen.“
Sie verzog leicht die Lippen. „Das ist es nicht.“
„Was dann? Ich habe Ihnen nur angeboten, Sie nach Hause zu bringen. Keinen Trip nach Jamaica.“ Warum versuchte er mit allen Mitteln, sie zu überzeugen? Er konnte es sich nicht erklären. Doch er wollte unbedingt derjenige sein, der sie sicher nach Hause brachte.
Jennifer blickte wieder durch die Glastür auf die Partygäste. Der Gedanke, sich unter diese Menschen mischen zu müssen, war ihr offensichtlich zuwider. Chance konnte sie nur zu gut verstehen. Er selbst verspürte auch keine Lust dazu.
„Sie würden mir einen großen Gefallen tun.“
„Wie bitte?“
Er lächelte. „Ich hasse Partys.“
Sie verzog die Lippen. „Wirklich?“
„Definitiv.“
Sie nickte, und er wusste, dass er die Schlacht gewonnen hatte. „Okay.“ Ihre Entscheidung war gefallen. „Dann sollte ich mir diese Chance nicht entgehen lassen.“
3. KAPITEL
Stimmengewirr und Musik schlugen ihnen entgegen, als sie in die Villa zurückkehrten. Kurz spielte Jennifer mit dem Gedanken, sich auf dem Absatz umzudrehen und wieder auf den Balkon zu verschwinden. Doch damit würde sie das Unvermeidliche nur hinauszögern. Um der Party zu entfliehen, musste sie irgendwann durch die Menge hindurch. Besser sie tat es jetzt, mit einem großen, stattlichen Mann neben sich, der ihr den Weg bahnte.
Die Hand auf ihrem schmalen Rücken schob Chance sie durch die Menge. Seine Berührung war warm und tröstlich. Merkwürdig. Sie hatte diese kleine, freundliche Geste seit Mikes Tod nicht mehr erfahren, doch ihr war gar nicht aufgefallen, wie sehr sie sie vermisst hatte. Andererseits hatte sie in den letzten Jahren festgestellt, dass gerade die kleinen Dinge des Lebens die größten Lücken hinterließen, wenn sie plötzlich nicht mehr da waren.
Es gab niemand mehr, der ihr in einem schönen Restaurant den Stuhl zurechtrückte. Niemand, der so laut nach einem Taxi pfeifen konnte, dass gleich mehrere Wagen anhielten. Niemand, der ihre Füße wärmte, niemand, mit dem sie im Kino flüstern konnte. Niemand, um den sie sich kümmern, für den sie kochen oder um den sie sich sorgen konnte.
Ein wehmütiges Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sicher, jede emanzipierte Frau, die etwas auf sich hielt, bekäme einen Herzanfall, wenn sie Jennifers Gedanken lesen könnte. Doch das war ihr egal. Obwohl sie sich selbst immer als freie und unabhängige Frau gesehen hatte, war sie gern verheiratet gewesen. Sie war gern Teil eines Teams gewesen. Und manchmal vermisste sie dieses Gefühl so sehr, dass ihr das Herz schwer wurde.
Ein süßes Lächeln von Sarah genügte in solchen Momenten oft, und alles war wieder gut. Ich werde nie wieder allein sein, hatte sie dann gedacht, jedenfalls nicht völlig. Nicht, solange sie Sarah hatte.
Der Gedanke ließ sie wieder an die bevorstehende Herzoperation ihrer Tochter denken. Tränen traten ihr in die Augen, auch wenn die Ärzte ihr versichert hatten, dass es sich um einen vergleichsweise einfachen Eingriff handelte. Zwar barg jede Operation ein gewisses Risiko, aber Sarah hatte ausgezeichnete Chancen auf eine vollständige Genesung.
Doch all die gut gemeinten und netten Worte konnten sie nicht beruhigen. Sarah war ihr Baby, ihre Familie. Und der Gedanke, sie möglicherweise zu verlieren, war einfach nicht zu ertragen. Sie konnte sich eine Welt ohne ihr kleines Mädchen nicht vorstellen – also tat sie es auch nicht.
Jennifer blinzelte heftig, schob die düsteren Gedanken weg und beschleunigte ihren Schritt. Sie wollte nur noch von hier verschwinden, bevor sie mit besorgten Fragen bombardiert werden konnte.
„Da sind sie“, murmelte Chance dicht an ihrem Ohr.
Sie richtete ihren Blick nach rechts und sah Grant und Emma Connelly, die ein offensichtlich sehr intensives Gespräch mit Seth führten. Jennifer schüttelte den Kopf und sah zu dem Mann an ihrer Seite auf. „Es sieht aus, als seien sie beschäftigt. Wir sollten das Gespräch nicht unterbrechen.“
Chance fasste sie sanft, aber dennoch bestimmt am Oberarm und lächelte sie an. „Wir stören nicht lange. Sie können ihre Diskussion gleich fortsetzen. Den Gesichtern nach zu urteilen, scheint es ein ernstes Thema zu sein.“
Als sie sich den drei Personen näherten, drang Seths Stimme an Jennifers Ohr. „Ich muss einfach zu ihr gehen. Ich will dir nicht weh tun, Mom“, sagte er zu Emma, „aber Angie Donahue ist meine leibliche Mutter. Und ich muss wissen, warum sie mich so plötzlich sehen möchte.“ Er nahm Emmas Hand und drückte sie. „Mach dir keine Gedanken um mich. Ich schaffe das schon. Und ich komme zurück. Versprochen.“
Mit Tränen in den Augen sah Emma zu ihrem Mann, dessen Blick unverwandt auf dem jungen Mann vor ihm ruhte, als könnte er ihm, wenn er ihn nur eindringlich genug ansah, sein Vorhaben austreiben. Schließlich sagte Grant mürrisch: „Tu, was du für richtig hältst, mein Sohn. Wir stehen bei allem hinter dir. Und wir warten hier auf deine Rückkehr.“
Die drei sahen, dass Chance und Jennifer sich näherten, und unterbrachen ihr Gespräch. Emma schenkte den Hinzutretenden ein strahlendes Lächeln und bedeutete Seth mit beiden Händen zu gehen.
„Und, was habt ihr noch vor?“, wandte sie sich an die beiden.
„Ich wollte mich für die Gastfreundschaft bedanken“, sagte Chance. Dann fügte er hinzu: „Und mich verabschieden.“
„Verabschieden?“, fragte Grant. „Jetzt schon?“
Jennifers Blick wanderte vom Vater zum Sohn. Auch wenn Chance es vermutlich nicht gern hörte, die Ähnlichkeit zwischen den zwei Männern war frappierend. Nicht nur äußerlich. Beide strahlten ein Selbstbewusstsein aus, von dem Menschen sich unwillkürlich angezogen fühlten.
Das war einer der Gründe, warum Grant in der Geschäftswelt so erfolgreich war – und weshalb Chance zwangsläufig die Karriereleiter bei der Marine weiter emporklettern würde. Eines Tages würde er zweifellos Admiral sein. Männer wie diese beiden Connellys waren die geborenen Sieger. Auch wenn sie unterschiedliche Ziele hatten.
„Jennifer fühlt sich nicht gut“, erwiderte Chance auf die Frage seines Vaters. „Ich habe ihr angeboten, sie nach Hause zu bringen.“
„Ah …“ Grant nickte nachdenklich, während er seinen Blick von seinem Sohn zu Jennifer und wieder zurück wandern ließ.
Jennifer spürte, dass sie rot wurde, als sie das vielsagende Blitzen in Grants Augen sah. „Ich …“, lass dir etwas einfallen, Jen!, „… habe Kopfschmerzen“, beendete sie den Satz. Tolle Ausrede. Aber sie wollte jetzt nicht über Sarahs gesundheitliche Probleme sprechen. Nicht bei der Feier. „Commander Barnett will mich freundlicherweise nach Hause fahren.“
„Barnett?“ Grant starrte seinen Sohn an.
Ein heikles Thema, wie Jennifer wusste. Chance wollte natürlich den Namen behalten, mit dem er aufgewachsen war. Den Namen, den ihm seine Mutter gegeben hatte. Und Grant wollte, was ebenso verständlich war, dass seine Söhne seinen Namen trugen.
Es wäre interessant mitzuverfolgen, wer als Sieger aus diesem Machtkampf hervorgehen würde.
„Grant.“ Chance hielt seinem Vater die rechte Hand hin. „Vielen Dank. Es war eine sehr schöne Feier.“
Grant schnaubte verächtlich. „Es hat dir überhaupt nicht gefallen.“
„Nun ja …“
„Ich habe geahnt, dass du Partys hasst. Du bist mir sehr ähnlich.“
Chance nickte kurz. „Vielleicht.“
Grant legte den Arm um die Schulter seiner Frau. „Emma ist die Gastgeberin. Sie liebt diesen Trubel. Ich bekomme immer nur Bescheid, wann ich wo zu erscheinen habe.“
Emma schlug ihm spielerisch gegen die breite Schulter, bevor sie Chance ansah. „Es stimmt. Er wäre lieber unterwegs, um Geschäfte zu machen, segeln zu gehen oder … ach, egal … irgendetwas. Hauptsache, keine Party.“
Jennifer sah das leichte Lächeln, das Chances Lippen umspielte. Zu ihrer Überraschung reagierte ihr Körper mit einem angenehmen Prickeln darauf. Das war kein gutes Zeichen.
„Dann sind wir uns vielleicht ähnlicher, als ich dachte“, räumte Chance ein, als Grant seine Hand nahm und sie kräftig schüttelte.
Sein Vater lächelte verschmitzt.
„Also gut“, ergriff Emma das Wort. „Jennifer, ich hoffe, es geht Ihnen morgen wieder besser. Nehmen Sie doch einen Tag frei.“
„Nein, das ist nicht …“
„Sie nehmen einen Tag Urlaub, und damit basta“, sagte ihre Arbeitgeberin bestimmt. Dann wandte sie sich an Chance. „Und du fährst vorsichtig. Ohne Jennifer bin ich aufgeschmissen.“
„Natürlich, Emma.“
Im nächsten Moment schlängelten sich Jennifer und Chance schon durch die Menge in Richtung Ausgang. Ihre Schritte klickten auf dem kalten Marmorboden der Haupttreppe und hallten durch die große Eingangshalle im Erdgeschoss. Die Abendsonne fiel durch die breiten Fenster und brachte den Marmorboden zum Schimmern.
Chance holte ihre Mäntel, und nachdem Jennifer sich warm eingepackt hatte, drängte er sie hinaus in den windigen Chicagoer Abend. Es war kühl geworden.
„Ich habe die Straße weiter hinauf geparkt“, sagte er. „Warten Sie doch hier, während ich den Wagen hole.“
„Danke, aber ich gehe lieber ein paar Schritte.“
„Wie Sie möchten.“ Lächelnd bot er ihr seinen Arm.
Eingehakt liefen sie die wenigen Stufen zur Einfahrt hinunter, überquerten einen schmalen Rasenstreifen und traten auf die Michigan Avenue.
„Nicht zu glauben, dass Sie hier einen Parkplatz gefunden haben.“
Er lächelte sie an, und Jennifer hielt den Atem an. Sein Lächeln war umwerfend. Eine starke Waffe. Glücklicherweise hatte sie in den letzten zwei Jahren eine Schutzmauer um sich herum aufgebaut.
„Ich bin ein SEAL, schon vergessen? Wir machen Unmögliches möglich.“
„Ich werd’s mir merken.“
Während sie zum Wagen liefen, plauderte Chance über belanglose Dinge, als spürte er irgendwie, dass sie nicht in der Stimmung war, an diesem Abend noch weiter über ihre Probleme zu sprechen. Jennifer lauschte den Geschichten über seine und Dougs Kindheit und hörte den Stolz in seiner Stimme, als er über seine Mutter und die Dinge sprach, die sie ganz allein bewerkstelligt hatte. Hoffentlich würde Sarah eines Tages genauso liebevoll von ihr sprechen.
Sie tat ihr Bestes, ihrem Kind Mutter und Vater zu sein. Keine einfache Aufgabe. Obwohl sie einen tollen Job und die beste und verständnisvollste Arbeitgeberin auf der Welt hatte, stand Jennifer täglich unter Druck und fragte sich oft, wie sie eigentlich alle ihre Aufgaben schaffen sollte. Sie hatte keine Ahnung, wie Frauen zurechtkamen, die nicht so viel Glück hatten wie sie.
„Es muss schwer für ihre Mutter gewesen sein“, sagte Jennifer schließlich und blickte zu ihm auf. Der Wind blies ihr die blonden Haare ins Gesicht, und sie schob sie zurück, um Chance besser sehen zu können.
Er blickte in die Ferne, als schaute er zurück in die Vergangenheit, und nickte. „Ja, es war hart. Aber damals war uns das nicht bewusst. Bei ihr sah alles immer so einfach aus. Mom gehörte nicht zu den Menschen, die herumsaßen und jammerten. Oder sich wünschten, dass die Dinge anders lägen. Sie sagte immer: ‚Das Einzige, was man im Leben ändern kann, ist man selbst.‘ Also sollten wir alles so gut machen wie möglich.“
„Kluge Frau.“
„O ja, das war sie.“ Er drehte sich zu Jennifer und blickte auf sie hinab. Wieder schenkte er ihr dieses unwiderstehliche Lächeln. „Sie hätten ihr gefallen.“
„Wirklich? Warum?“
„Weil Ihnen Ihre Tochter so wichtig ist.“
Seine Worte rührten Jennifer, doch sie erwiderte nur: „Ja, sie ist mein Ein und Alles.“
„Das merkt man.“
„Bin ich so leicht zu durchschauen?“
„Man kann in Ihnen lesen wie in einem offenen Buch.“
Jennifer musste lachen. Sie hatte noch nie ein Pokerface gehabt. Mike hat immer gesagt, „der einzige Grund, weshalb ich so ehrlich bin, ist, dass ich nicht lügen kann.“
„Ein Grund wie jeder andere.“ Chance blieb neben einem kirschroten Geländewagen stehen.
„Das ist Ihr Auto?“, fragte sie und überlegte, warum sie überhaupt überrascht war. Schließlich war ein Geländewagen der Traum fast jeden Mannes. Vielleicht nicht gerade in Rot.
„Leihwagen“, sagte er und öffnete ihr die Beifahrertür. Als sie einstieg, fügte er hinzu: „Ich bin nur vorübergehend in der Stadt.“
Sie griff automatisch nach dem Sicherheitsgurt. „Und dann? Wie geht es mit Ihnen weiter?“
„Ich kehre zurück zu meinem SEAL-Team.“
„Wohin?“
„Das erfahre ich erst kurz vorher.“
Chance schlug die Tür zu, ging um den Wagen herum und öffnete die Tür an der Fahrerseite. Er setzte sich hinter das Lenkrad, legte den Sicherheitsgurt an, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und drehte ihn um. Der Motor sprang sofort an.
Eine unabsichtliche ruckartige Bewegung ließ ihn zusammenzucken. Jennifer sah ihn fragend an. „Alles in Ordnung?“
„Ja“, beruhigte er sie. „Ich vergesse nur immer, mich langsam zu bewegen. Und dann spüre ich ziemlich schmerzhaft meine frisch genähte Wunde.“
Frisch genähte Wunde? Die Frage musste ihr ins Gesicht geschrieben gewesen sein, denn er zuckte mit den Schultern und machte ein betont unbekümmertes Gesicht, bevor er sagte: „Mich hat’s beim letzten Einsatz erwischt.“
„Erwischt?“ Ihr Blick fiel auf seine Seite, als könnte sie durch die Uniform hindurchsehen. „Sie meinen, Sie sind angeschossen worden?“
„Es ist nichts Schlimmes. Nur eine Streifschuss.“
„Aha“, murmelte sie und nickte abgeklärt. „Eine unbedeutende Schussverletzung. Was sind Sie doch für ein Held! Wow, ein zweiter John Wayne!“
Er zog die Augenbrauen zusammen und betrachtete sie. „Wo ist das Problem?“
„Ach, ist schon gut.“ Jennifer legte die Hände in den Schoß und starrte durch die Windschutzscheibe. Wie Mike, dachte sie. Die beiden Männer waren aus demselben Holz geschnitzt. Gefährliche Jobs. Ohne Rücksicht auf Verluste. Keine große Sache.
Wie konnte ein intelligenter Mensch behaupten, es sei keine große Sache, sich tagtäglich der Gefahr auszusetzen zu sterben? Was trieb Männer – und auch einige Frauen – dazu, einen Beruf zu ergreifen, bei dem sie ihr Leben aufs Spiel setzten?
„Jennifer“, sagte er über das Motorengeräusch hinweg. „Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie plötzlich so angespannt sind?“
Sie drehte den Kopf zu ihm und musterte seine markanten Gesichtszüge. Sie wirkten hart und gefährlich – trotz der Sanftmut, die sie immer noch in seinen Augen sehen konnte.
„Ich verstehe es einfach nicht“, stieß sie schließlich hervor. „Warum seid ihr Männer so?“
„Wir Männer?“, wiederholte er. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Könnten Sie etwas genauer sein?“
„Männer wie Sie. Und Mike.“
„Ihr Ehemann.“
„Mein verstorbener Ehemann“, korrigierte sie. „Mein Mann ist tot.“
„Jennifer …“
„Nein, ich will es wissen.“ Sie blickte ihn unverwandt an. „Warum sucht sich ein Mann absichtlich einen Beruf, der sein Leben gefährdet? Ist es der Nervenkitzel? Der Adrenalinrausch, der mit der ständigen Gefahr einhergeht?“
Er presste kurz die Lippen aufeinander. „Für diesen Beruf war eine jahrelange, harte Ausbildung nötig. Ich nehme an, bei Ihrem Mann genauso. Man nimmt diese Mühe nicht wegen des Nervenkitzels auf sich.“
„Warum dann?“ Sie wusste, dass er recht hatte. Mike hatte hart gearbeitet, um seinen Traum zu verwirklichen. Er war mit Leib und Seele Polizist gewesen. Der Beruf war sein Lebensinhalt gewesen. Und schließlich sein Tod. Ihn konnte sie nicht mehr nach dem Warum fragen, deshalb wollte sie eine Antwort von diesem Mann, der ein ganz ähnliches Leben führte.
„Um zu dienen“, erklärte er ruhig. „Und zu helfen. Um für mein Land zu kämpfen. Klingt kitschig, nicht wahr? Aber es ist die Wahrheit.“
Seine Worte hallten noch in ihrem Kopf nach, als er fortfuhr.
„Militär oder Polizei, wir tun, was getan werden muss. Hier geht es nicht um den Adrenalinrausch, und ich glaube, das wissen Sie auch. Es ist kein einfaches Leben, aber das einzige, das ich kenne und das ich mir vorstellen kann. Ich möchte nicht anders leben. Und ich vermute, Ihr Mann hat genauso empfunden.“
Jennifer holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Während sie Chance beobachtete und ihm zuhörte, wusste sie, dass er recht hatte. Sie spürte es. Und ein Teil von ihr stimmte ihm sogar zu.
Aber einzugestehen, dass es solche tapferen Männer brauchte, und tatsächlich mit einem von ihnen zu leben – das waren zwei ganz verschiedene Dinge. Sie selbst hatte genug von diesem Leben. Jedes Mal, wenn Mike das Haus verlassen hatte, war sie vor Sorgen fast umgekommen. Doch auch ihre Angst hatte ihn nicht am Leben erhalten.
Jennifer verspürte keine Lust, wieder mit dieser Furcht zu leben.
Nein. In ihrem Leben gab es nur noch einen Menschen. Ihre Tochter. Nur für Sarah wollte sie jetzt da sein, alles andere wäre lediglich eine Ablenkung. Eine Ablenkung, die sie nicht gebrauchen konnte.
Selbst dann nicht, wenn es sich dabei um ein ein Meter neunzig großes Muskelpaket handelte, das in einer schneeweißen Uniform steckte.
4. KAPITEL
„Jetzt rechts“, wies Jennifer ihn an. Chance steuerte den Geländewagen in die Straße, in der sie wohnte, und sie ließ die vertraute Umgebung an sich vorüberziehen. Oak Park, Illinois hat den Namen wirklich verdient, dachte sie nicht zum ersten Mal.
Alte Eichen säumten fast jede Straße des Chicagoer Vororts. Sie streckten ihre langen Äste über die Alleen und spendeten in den heißen, feuchten Sommern wohltuenden Schatten. Jetzt sprossen gerade die ersten zartgrünen Blätter, und die Bäume wogten knarrend im Wind, als würden sie auf ihr neues Frühlingskleid einen Gesang anstimmen.
Jennifer lächelte, als sie die Bodenwellen in den Bürgersteigen betrachtete. Anders als in anderen großen Städten, wo die kleinste Unebenheit in einem Bürgersteig den Tod für den verantwortlichen Baum bedeutete, verteilten die Stadtarbeiter hier nur frischen Zement auf den vorspringenden Wurzeln. Sie schützten ihre Bäume, und der Stadt half es.
„Das ist eine schöne Straße“, äußerte sich Chance. Jennifer warf ihm einen flüchtigen Blick zu.
„Ja“, stimmte sie ihm zu. Wenn sie weiter so einsilbig war, würde sie ihn bestimmt auf Distanz halten. Welcher Mann wünschte sich schon eine langweilige Gesprächspartnerin. Doch ihre Gedanken kreisten ständig um Sarah, sodass sie sich im Augenblick kaum vorstellen konnte, eine interessante oder ernsthafte Konversation zu treiben.
Statt es auch nur zu versuchen, betrachtete sie die Häuser, an denen sie vorbeifuhren. Einige glichen ihrem eigenen. Alt und mit einer breiten Veranda, die von Steinpfeilern gestützt wurde. Andere waren neu und modern, kantige Bauten mit viel Glas. Vor nicht allzu langer Zeit war das Viertel vom Verfall bedroht gewesen, doch in den letzten Jahren hatten junge Berufstätige die Schönheit von Oak Park entdeckt und den Stadtteil mit neuem Leben erfüllt.
Heute war die Gegend trendig und teuer, und wenn Mike das Haus nicht von seiner Tante geerbt hätte, hätten sie es sich nicht leisten können, hier zu leben. „Das Frank-Lloyd-Wright-Haus steht direkt um die Ecke.“
„Ist das dieser Architekt?“
„Ja“, erwiderte sie. „Es ist ein wunderschönes Haus, auch wenn ich manches etwas gewagt finde.“
Er warf ihr einen langen Blick von der Seite zu. „Sie sind also eher altmodisch?“
Sie rutschte auf ihrem Sitz hin und her und faltete die Hände im Schoß. „Bei manchen Dingen ja“, gab sie freimütig zu. „Wie bei diesen alten Bungalows. Sie sind einfach gemütlicher … irgendwie strahlen sie mehr Wärme aus. Sie haben Charakter.“
„Ich weiß, was Sie meinen.“ Jennifer drehte sich zu ihm und sah ihn an. Er lächelte. „Die älteren Gebäude haben den Gezeiten standgehalten. Sie haben ein Recht darauf, hier zu stehen.“
Interessant formuliert, dachte Jennifer. Aber richtig. „Ja, genau das ist es. Einige dieser Häuser sind hundert Jahre alt. Sie haben Familien beschützt, Tornados überstanden – und alles, was sie brauchen, ist ein wenig Pflege. Irgendwie habe ich sogar Mitleid mit den armen Häusern, die abgerissen werden, um diesen schrecklichen Glas-und-Stahl-Bauten Platz zu machen.“
Er lachte. „Sie sind ja eine Romantikerin. Wer hätte das gedacht?“
Romantisch? Nein. Sie nicht. Vielleicht bin ich es einmal gewesen, dachte sie, und erinnerte sich daran, wie jung und naiv sie gewesen war, als sie Mike geheiratet hatte. Sie hatte die Welt durch eine rosarote Brille gesehen. Als sie in den gemütlichen Bungalow seiner verstorbenen Tante gezogen waren, hatte sie gedacht, dass sie in diesem Haus noch mit achtzig zusammen auf der Veranda sitzen würden.
Doch dieser Traum war mit Mike begraben worden. Sie war nun Realistin. „Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende“ gab es nur im Märchen, für sie war diese Hoffnung vorbei. Doch sie sah keine Veranlassung, Chance Barnett all das zu erklären. Er würde nicht einmal lange genug hier sein, um sich dafür zu interessieren. Schließlich hatte er kein Geheimnis daraus gemacht, dass er darauf brannte, bald aus der Stadt zu verschwinden. Noch ein paar Wochen, und er würde sein gefährliches Leben wieder aufnehmen.
Und das ist auch gut so, dachte sie. Denn anders als er würde sie noch hier sein und weiter den alltäglichen Kampf mit den Unwägbarkeiten des Lebens führen und versuchen, ihre Tochter nach besten Kräften zu beschützen.
Der Gedanke an Sarah reichte aus, sie in die entsetzliche Realität zurückzuholen, die jetzt ihr Leben bestimmte.
„Das Haus auf der linken Seite gehört mir.“ Sie deutete mit dem Finger darauf. „Das blaue, mit dem Bobby-Car vor den Stufen.“
Das Herz wurde ihr schwer, als sie sich vorstellte, dass Sarah und ihr Spielzeug – all die Dinge, wegen derer Jennifer immer schimpfte, weil sie überall herumlagen – möglicherweise nicht mehr lange Teil ihres Lebens sein würden. Nein. Daran durfte sie nicht einmal denken. Hatte der Arzt ihr nicht versichert, dass es sich um eine relativ einfache Operation handelte? Hatte er ihr nicht gesagt, dass es sich – obwohl ein operativer Eingriff natürlich immer mit Risiken verbunden war – in diesem Fall praktisch um einen Nullachtfünfzehn-Job handelte?
Nullachtfünfzehn-Job.
Wie konnte eine Operation, bei der die winzige Brust ihrer Tochter geöffnete wurde, als Nullachtfünfzehn-Job betrachtet werden?
Tränen traten ihr in die Augen. Sie blinzelte sie weg, als Chance in die Einfahrt einbog. Direkt vor ihnen stand ihr eigener Wagen. Er hatte Schlagseite, weil ein Hinterrad platt war. Als sie am Morgen aus dem Haus gekommen war, hatte sie den Wagen in dem Zustand vorgefunden. Deshalb war sie diesmal ohne eigenen Wagen bei den Connellys gewesen.
Und aus dem Grund saß sie jetzt neben einem Mann, dessen schiere Gegenwart schon eine Ablenkung war, die sie im Moment nicht gebrauchen konnte.
Chance parkte den Wagen und schaltete den Motor aus. Sofort breitete sich Stille aus. Die einzigen Geräusche kamen nun von einer Gruppe Kindern, die zwei Häuser weiter vor einer Garage Basketball spielten. Das gleichmäßige Aufprallen des Balls beim Dribbeln klang fast wie ein Herzschlag. Der Gedanke schoss kaum durch Jennifers Kopf, da verdrängte sie ihn schon wieder.
„Sieht aus, als hätte Ihr Wagen ein kleines Abenteuer erlebt“, bemerkte er ruhig.
Bei seinen Worten musste sie unwillkürlich lächeln. „Als ich klein war, habe ich mir immer vorgestellt, dass die Autos sich selbstständig machen, wenn ihre Besitzer schlafen. Dass sie den Strand entlangfahren, sich mit anderen Autos an der Tankstelle treffen und dort einen Liter Öl kippen.“
Er lachte.
„Offensichtlich“, fuhr sie seufzend fort, „hatte mein Wagen auf der Rückfahrt ein kleines Missgeschick.“
„Warum haben Sie den Reifen nicht gewechselt?“
„Ja, verdammt“, sagte sie und schlug sich leicht gegen die Stirn. „Warum habe ich daran bloß nicht gedacht?“
„Meine Frage war ganz schön blöd, nicht wahr?“
„Nein, nicht wirklich“, erwiderte sie. Schließlich musste sie sich seit Mikes Tod um viele Dinge selbst kümmern. Verstopfte Abflüsse zum Beispiel oder durchgebrannte Sicherungen. „Eigentlich sollte ich dazu in der Lage sein, leider nur habe ich den Reifenwechselkurs damals verpasst.“
„Soll ich den Reifen für Sie wechseln?“
Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu. Am liebsten hätte sie begeistert „Ja, das wäre toll!“ gerufen. Doch sie war klug genug zu wissen, dass sie sich nicht noch weiter in Chance Barnett Connellys Schuld stellen sollte. Je mehr Abstand sie zwischen sich und einem Mann hielt, der ihr Blut mit einem Blick in Wallung bringen konnte, desto besser. „Nein, es ist schon in Ordnung. Es ist zwar sehr nett von Ihnen, aber das müssen Sie wirklich nicht tun.“
„Ich weiß, dass ich es nicht tun muss“, sagte er, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und ließ ihn in der Hosentasche verschwinden. „Aber es ist wirklich keine große Sache.“
„Klar“, sie legte die Hand an den Türgriff, „und schwarze Schmiere macht sich auf Ihrer weißen Uniform bestimmt besonders gut.“
Ein Moment verging, dann lächelte er sie verlegen an.
Sein Lächeln ließ ihr Herz schneller schlagen und ihren Puls in die Höhe schnellen.
Er zuckte mit den Schultern. „Tja, das hatte ich ganz vergessen. Ich habe wirklich nicht gerade meine Mechanikerkluft an.“
Nein, dachte sie, aber in seiner weißen Uniform sieht er einfach fantastisch aus. Ein unerhört gut aussehender Mann.
Sie schüttelte den Gedanken ab, löste den Sicherheitsgurt und nahm ihre Handtasche. „Vielen Dank, dass Sie mich nach Hause gebracht haben.“
Chance öffnete die Fahrertür und stieg aus. Er ging um den Wagen herum zur Beifahrerseite. Jennifer beobachtete ihn. Offensichtlich hatte er nicht vor, sie einfach abzusetzen und sich dann aus dem Staub zu machen. Sie war nicht sicher, was sie davon halten sollte.
Er tat ihrem seelischen Gleichgewicht nicht gut. Zwar schien er ein netter Mann zu sein, aber, um Himmels willen, sie kannte ihn doch kaum. Dennoch, in den letzten paar Stunden hatte sie sich an seiner Schulter ausgeweint, obwohl sie normalerweise gar nicht weinte. Und sie hatte Gefühlsregungen tief in sich gespürt, an denen sie – verfluchter Mist! – überhaupt nicht interessiert war.
Es war also höchste Zeit, dass sie diesen Marineoffizier aufforderte, das Weite zu suchen … irgendwohin, Hauptsache weit weg. Sie selbst wollte jetzt nur noch ins Haus, allein. Sie würde nach Sarah sehen und sich bei einer Tasse Tee entspannen.
Chance öffnete ihr die Tür und hielt ihr seine Hand hin. Jennifer blickte einen langen Moment auf seine ausgestreckte Hand und überlegte, ob sie sie ergreifen oder allein versuchen sollte, aus dem überdimensionalen Wagen zu klettern. Sofort hatte sie ein Bild vor Augen, wie sie äußerst undamenhaft aus dem viel zu hohen Wagen rutschte und der Rock dabei hoch über ihre Schenkel glitt. Die Entscheidung war gefallen.
„Danke“, sagte sie und legte ihre Hand in seine. Sie spürte seine Wärme. Ein Schauer jagte ihren Arm hinauf, breitete sich in ihrer Brust aus und dann im ganzen Körper. Chance legte die Finger um ihre, und sie fühlte seinen festen Griff.
„Es ist mir ein Vergnügen“, murmelte er und blickte sie unverwandt an.
Oh, oh.
In dem Moment, als ihre Füße den Boden berührten, zog sie ihre Hand zurück, doch es half nicht. Sie spürte seine Berührung immer noch. So intensiv, als würde er sie weiterhin festhalten. Sie ballte die Hand zu einer Faust, ignorierte das erregende Kribbeln und schenkte ihm ihr schönstes, bezauberndstes aber unechtes Lächeln.
„Also …“ Sie schluckte schwer und senkte kaum merklich die Stimme. „Ich denke, ich sollte jetzt hineingehen.“
„Ich bringe Sie an die Tür.“