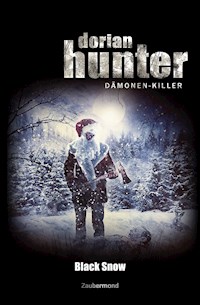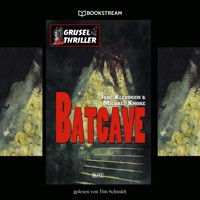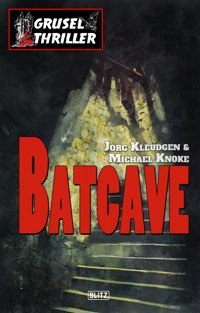Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: ONLY eBook Mystery-Horror
- Sprache: Deutsch
Cathay ist eine merkwürdige Stadt. Europäische Händler und Flüchtlinge aus dem Dreißigjährigen Krieg - unter ihnen vieler deutscher Herkunft - gründeten sie Mitte des 17. Jahrhunderts nach einem Schiffbruch an der Ostküste Indiens in Sichtweite des Himalaja-Gebirges. Von Anfang an war der Ort verflucht. Einen dämonenbeseelten Götzen sollen die Siedler mitgebracht haben. Außerdem verärgerten sie einen ortsansässigen Zaubermeister, der die Stadt daraufhin mit einem Fluch belegte. Auch sonst erwies sich Cathay als unglücklicher Ort. Tiefe Dschungel und schroffe Berge umgeben die Stadt. Ihr Standort ist sumpfig, das Klima feucht, die Kanalisation marode, so dass immer wieder Seuchen die Bürger hinraffen. Schon lange liegt der Handel brach. Cathay verfällt, viele Häuser stehen leer. Dekadenz greift um sich, Melancholie liegt über den vernachlässigten Straßen. Seltsame Kulte treiben ihr Unwesen, mörderische Wesen streifen durch die Nacht. Seit einiger Zeit mehren sich die Anzeichen für eine große Krise. Irgendetwas geht vor in und vor allem unter Cathay in den gewaltigen Höhlen und zu dumpfen Wohnstätten ausgebauten Kanälen. Die Mehrheit der Bürger verharrt in Lethargie, doch immer wieder gibt es einige allzu neugierige Zeitgenossen, die hinter die Kulissen zu blicken versuchen. Sie finden selten eine Erklärung aber stets ein unglückliches Ende. In vielen Gestalten geht das Böse um in Cathay. Verbrecher aus aller Welt fliehen vor ihren Verfolgern hierher. Risse durchziehen die Realität, durch die Kreaturen aus fremden Sphären schlüpfen. Die Stadt und ihre Bewohner scheinen dem Untergang geweiht, doch brennender noch wird die Suche nach der Antwort auf die Frage, ob es überhaupt ein Cathay gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÖRG KLEUDGEN
COSMOGENESIS
Jörg Kleudgen
Cosmogenesis
© 2005, 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Markus K. Korb
Titelbild: Mark FreierUmschlaggestaltung: Mario Heyer
Innenillustrationen: Jörg Kleudgen/Mark Freier
Lektorat: TTT, Mallorca
Satz: MF, München
Alle Rechte vorbehalten
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-894-5
„Der Keller, summende Kohlefadenlampen aus schwarzem Bakelit. Im grünalgigen Ausguß sitzt eine fette Kröte. Der Meister hat sie noch nicht bemerkt. Sein Diener deckt verstohlen seine Hand darüber, führt den unerwarteten Fund zum Mund, und schluckt das Amphibium eilig, fast unzerkaut und noch lebendig hinunter.“
In den verfallenen Gassen der alten Stadt Cathay, in der es nie aufhört zu regnen, begegnen sich die Mysterien des Indischen Subkontinents und die Dekadenz Europas. Diein Vergessenheit geratene Kolonie, umgeben von wilden Urwäldern und himmelstürmenden Bergen, auf denen die Götter einer vor Jahrhunderten untergegangnen Kultur hausen, ist Schauplatz einer Sammlung grotesker Erzählungen, in denen Jörg Kleudgen einen komplexen Kosmos von dunkler Faszination erschaffen hat.
Zu Recht wird „Cosmogenesis“ als die atmosphärischste und düsterste Schöpfung des Autors betrachtet. Der 1999 erschienene Privatdruck war binnen weniger Monate vergriffen. Erst in der gründlich überarbeiteten und erweiterten Neuauflage offenbart sich der große Plan, der das Schicksal Cathays bestimmt.
Der Autor:
1968 geboren in Zülpich bei Köln, begann während eines Architekturstudiums, seine schriftstellerische und musikalische Arbeit in professionelle Bahnen zu lenken. Neben etlichen phantastischen Büchern erschien 2002 in der Reihe „Die Schwarzen Führer“ des Eulen-Verlages sein Band „Eifel-Mosel“, ein Reiseführer zu sagenumwobenen Stätten. Außerdem werden seine Geschichten als Beilage zu den Tonträgern seiner Band THE HOUSE OF USHER veröffentlicht, welche als eine der letzten deutschen Bands einen klassischen authentischen Gothic-Rockstil pflegt. Mit ihr veröffentlichte er fünf Alben und etliche Singles und trat auf bedeutenden Festivals, u. a. in Deutschland, Belgien, Italien, Frankreich, England und dem Libanon auf.
TRANSMUTATION
„Gott erschuf den Menschen mit seinen eigenen Händen, doch als er schlief, säte der Teufel die böse Saat des Unreinen in des Menschen Herz, um Mord, Zwietracht und Laster zu ernten. Und als der Herr sah, was mit seinen mißratenen Zöglingen geschehen, sandte er Feuer, Erdbeben, schreckliche Fluten und Stürme, ihn vom Antlitz der Erde auszulöschen.“
„Evangelium des XX. Jhdt.“
Richard Ernst
WENN ICH IM FOLGENDEN von der Geschichte Cathays berichte, so dürfen Sie, lieber Leser dieses Reports, sich darauf verlassen, daß jedes meiner Worte von mir sorgfältig abgewogen und nach bestem Wissen und Gewissen auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft wurde.
Wenngleich ich den Schwerpunkt meiner Forschung auf die Chemie und deren Randgebiete gelegt habe, so habe ich mir doch im Laufe meines Lebens eine empirische Vorgehensweise angeeignet, die mich dazu zwingt, jede Theorie so lange anzuzweifeln, bis ich den Beweis erbracht habe, daß es nur so und nicht anders sein kann. Und bevor ich auf die Ereignisse zu sprechen komme, die ich als Augenzeuge selbst miterlebt habe, möchte ich über jene Dinge berichten, die meines Erachtens erst den Boden hier bereitet haben.
Ich bin – im Gegensatz zu den meisten Menschen europäischer Abstammung hier – nicht in Cathay geboren. An der Seite meines Lehrmeisters kam ich vor vielen Jahren hierher, auf der Flucht vor einem menschenverachtenden Regime, mit dem wir leichtsinnig geliebäugelt hatten. Auf die näheren Umstände will ich nicht ausführlicher eingehen, denn sie würden lediglich von den Dingen ablenken, wegen derer ich das Wort erhebe. Allein soviel will ich sagen: am Vorabend eines gewaltigen Weltenbrandes hatten wir hoch gepokert und alles verloren, beinahe auch unser Leben.
Während mein Meister, eben erst hier angekommen, wo er sich – für mich unverständlich – sogleich wohlfühlte, mit der Wiederaufnahme seiner Forschungen begann, interessierte ich mich in erster Linie für die Vergangenheit dieses obskuren Ortes.
Leider waren die Quellen, derer ich mich bedienen konnte, äußerst dürftig. Die Universität der Stadt verfügte zwar über einen ansehnlichen Bestand, der vor allem aus den verwaisten Privatsammlungen reicher Kaufleute genährt worden war, doch hatte sich kaum ein Chronist gefunden, die Stadtgeschichte niederzuschreiben.
So erschien es mir wie eine kleine Sensation, als ich, kaum wohnten wir gut zwei Monate in einem ehemaligen Patrizierhaus, das günstig zum Verkauf angeboten worden war, auf einen Bericht stieß, der sich – in einer ledernen Kladde verborgen – in ein verstaubtes Regal mit belletristischer Literatur verirrt hatte.
Der Text, dessen Autor bedauerlicherweise nicht genannt wurde, kündete von der ersten Besiedlung Cathays durch Flüchtlinge aus dem Dreißigjährigen Krieg im Jahre 1636. Nun, es wäre vielleicht falsch, von einer tatsächlichen Besiedelung zu sprechen, denn eine solche setzt den Willen dazu voraus, die ersten europäischen Bewohner Cathays aber waren alles andere als freiwillig gekommen.
Ihr Segelschiff, die Crusade, strandete in der stürmischen und nebligen Nacht vom 10. auf den 11. November 1636 an der zerklüfteten Küste vor der Bucht, die der Stadt heute als natürlicher Hafen dient. Ich bin einmal zu den Klippen hinausgefahren. Wie Haifischzähne wachsen sie aus dem Meer, bedrohlich, messerscharf und eine Gefahr für jedes Schiff, auch heute noch, wenn sie bei Flut knapp unter der Oberfläche der See lauern.
Als ich den Bericht vom Schicksal der Crusade las, begann ich mich für die Nautik zu interessieren. Es gibt drunten am Hafen einen kleinen Laden, der allerlei Schiffahrtszubehör führt, zum Teil auch sehr alte Gerätschaften. Ich stieß dort auf einen verrosteten Sextanten, in den die Jahreszahl „1596“ eingraviert war. Womöglich stammt er noch von dem gekenterten Schiff und wurde irgendwann von eingeborenen Perlentauchern gefunden. Ich erstand ihn für einen lächerlich geringen Geldbetrag und verwende ihn heute als Buchstütze.
Sieben Seeleute, ein deutscher Kaufmann und eine Frau, die als einziger Passagier an Bord zu den weiter östlich gelegenen britischen Kolonien gebracht werden sollte, konnten sich von dem der Länge nach aufgeschlitzten Schiff an Land retten, waren dort aber gleich einer weiteren Gefahr ausgesetzt: jenseits der weitläufigen, felsigen Bucht wartete der Urwald mit wilden Bestien und kannibalischen Ureinwohnern.
Man beschloß, nicht weiter ins Landesinnere vorzudringen, sondern auf einer kleinen Anhöhe eine provisorische Unterkunft, ein Blockhaus, zu errichten, das sich notfalls auch von wenigen Männern verteidigen ließ.
Innerhalb weniger Tage wurde das Gebäude aus den angespülten Trümmern des Schiffes und gefällten Bäumen aus dem nahen Urwald erbaut. Es soll sogar über einen Speicher verfügt haben, auf dem die dürftigen Vorräte gelagert und Fische geräuchert werden konnten.
Von der Ladung hatten die Männer lediglich eine einzige eisenbeschlagene Kiste bergen können. Über ihren Inhalt war nichts bekannt, aber allein die Tatsache, daß sie von dem Chronisten erwähnt wird, läßt eine herausragende Bedeutung erahnen. In der Tat wird dieser Inhalt in Bezug auf die Geschichte, die ich erzählen möchte, noch eine Rolle spielen.
Die wenigen Dinge, die das Meer an Land spülte, waren durch das Salzwasser vollkommen verdorben.
Aber mit der Crusade gelangte etwas Monströses, etwas nicht Greifbares an den Ort, der später Cathay genannt werden sollte. Dieses Etwas manifestierte sich bereits nach wenigen Wochen in Form einer furchtbaren Krankheit, die einen der Seeleute nach dem anderen erfaßte: man hatte vollkommen unbemerkt die Pest an Bord gehabt.
Als erstes erkrankte die britische Passagierin. Es stand außer Frage, daß Rattenflöhe die Krankheit übertragen hatten, aber es war müßig, die Frage der Schuld zu stellen. Die Besatzung der Crusade hatte keine Ahnung, was in einem Fall wie dem nun eingetretenen zu tun war.
Man errichtete an einem höhergelegenen Berghang eine weitere Holzhütte zur Abgrenzung der Kranken – bereits nach einer Woche waren fünf Leute betroffen – und versorgte deren Wunden. Nach zwei Wochen elenden Dahinsiechens starb die Frau völlig entkräftet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch den Letzten erwischte. Der allerdings führte tapfer das Logbuch der Crusade fort bis zu seinem Tode.
Dieses Logbuch mußte wohl auch dem unbekannten Chronisten als Grundlage für seinen Bericht gedient haben.
NEBEN DEN IN ALLEN DETAILS beschriebenen schrecklichen Qualen der verfluchten Seeleute stieß ich auf die Schilderung einer Begebenheit, die der Autor eher beiläufig erwähnte.
Und zwar war hier die Rede von einem Schacht, der in einen Berg unweit der heutigen Stadt getrieben, jedoch kurz nach seiner Fertigstellung mit lockerem Geröll zugeschüttet worden war.
Aus welchem Grund war das geschehen? Was hatten die Schiffbrüchigen dort vergraben? Und wenn die Geschichte stimmte: ruhte das Geheimnis noch immer dort, wo es einst zur Ruhe gebettet worden war?
Neben der Geschichte Cathays im Allgemeinen begann mich nun auch das Schicksal des Stollens brennend zu interessieren.
Auf den gab es auch in der nächsten Quelle, auf die ich zwei Wochen später in einem Antiquariat stieß, einen Hinweis, und zwar in Gottlieb Brekers Historie der Siedlung Kathai von 1878, einem zwar rührig recherchierten, aber insgesamt doch sehr unzulänglichen Werk, das zum größten Teil aus einer Wiedergabe von Frachtschiffstonnagen bestand. Aber immerhin deckte es die Zeit von der ersten geplanten Besiedelung im Jahr 1715 bis zu dem Zeitpunkt, da das Buch verfaßt worden war, ab. Darüber hinaus gab es Auskunft darüber, wann welches Gebäude errichtet worden war und enthielt sogar einige höchst aufschlußreiche Grundrisse.
Das Buch war inzwischen wohl längst von den geschichtlich interessierten Köpfen der Stadt vergessen worden, hatte es doch überhaupt nur in einer Auflage von 175 handnumerierten Exemplaren existiert.
Hierin fand ich eine Bestätigung des Logbuches der Crusade, denn es wurde geschildert, wie der reiche Lübecker Kaufmann Gustav Hansen eine Expedition aussandte, um Spuren seines vor der ostindischen Küste verschollenen Großvaters zu finden, und dabei auf die Reste einer Siedlung und – man beachte dies! – einen Stollen stieß.
Handelte es sich dabei um jenen Stollen, den die Gestrandeten rund achtzig Jahre zuvor in den Fels getrieben hatten? Doch die Expedition ließ den verschütteten Eingang unbehelligt und begnügte sich damit, die sterblichen Überreste des letzten an der Epidemie Gestorbenen zu begraben und einen kleinen Friedhof mit Holzkreuzen zu errichten, der sich an derselben Stelle befand, wo auch heute noch die Toten Cathays ihre letzte Ruhe finden.
Einige Expeditionsteilnehmer – es handelte sich ausnahmslos um Deutsche – ließen sich in der Bucht nieder und begannen, einige niedrige Holzhütten zu errichten. Die Schilderungen des Dschungelfiebers, das immer wieder auf die Siedlung übergriff, sowie der Kämpfe mit den Eingeborenen erweckten in mir den Eindruck eines wenig lebenswerten Daseins, und ich begann zu verstehen, woher die kränkliche Ausstrahlung der Stadt rührte.
Immerhin schien sich die Siedlung soweit zu festigen, daß Hansen im Jahr 1732 selbst nach Cathay zog, um hier eine Handelsstation zu gründen. Es ließ sich tatsächlich mit den Eingeborenen Handel betreiben. Ihre Artefakte aus Elfenbein und Obsidian sowie dem Gold, das im Oberlauf des reißenden Flusses Kar gewaschen wurde, brachten den Europäern in der Heimat gute Profite. Im Tausch brachten sie den Urwaldmenschen ihre europäische Kultur mit all ihren negativen Auswirkungen. Vor allem mit hochprozentigen Alkoholika richteten die ungeladenen Einwanderer großen Schaden unter den Eingeborenen an, die nur das herbe, durch die Gärung verschiedener – von ihren Frauen zerkauter – Baumfrüchte hergestellte, bierartige Getränk kannten, das ausschließlich zu kultischen Anlässen getrunken wurde.
Die Annäherung der Rassen ging nach wenigen Jahren allerdings soweit, daß Gustav Hansen eine der sanften Eingeborenenfrauen heiratete und somit die Bindungen an den mächtigsten Stamm des nahen Waldes festigte. Die vermeintlich Wilden kürten ihn zu einer Art Stammesältesten, dessen Wort neben dem des bisherigen Häuptlings nahezu gleichviel galt.
Virginia Hansen – ihren ursprünglichen Namen konnten die Zungen der europäischen Einwanderer nicht korrekt wiedergeben – gebar ihrem Mann einen Sohn, doch das scheinbare Glück ihrer Schwangerschaft verwandelte sich am Tag der Niederkunft in Abscheu und Entsetzen. Es gab nur wenige Menschen, die das Kind der Frau zu Gesicht bekamen (den Gerüchten nach gehörte noch nicht einmal sie selbst dazu), bevor man es im Dschungel aussetzte, um es seinem Schicksal zu überlassen.
Breker geht in seiner Chronik nicht näher auf dieses Ereignis von 1746 ein, aber die kurz darauf erlassenen Gesetze, die die Ehe zwischen Eingeborenen und Menschen europäischer Abstammung, insbesondere aber das Mischen des Bluts beider verboten, gehen darauf zurück.
Und wenn es später doch zu Bastarden beider Rassen kam, dann stand ihr Leben oft unter einem schlechten Stern, egal ob nun gesund oder mißgebildet.
Die Geschehnisse in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts indes konnten Cathays Aufstieg zum wichtigen Handelsstützpunkt Europas auf dem indischen Subkontinent nicht bremsen.
Das Handelskontor Hansens war Cathays erster Steinbau gewesen. Es steht noch immer an seinem ursprünglichen Platz direkt neben dem alten Hafenkran, der allerdings erst später errichtet wurde. Das Datum auf dem Abschlußstein des gotischen Bogens über dem Eingang nennt das Jahr 1738 für die Fertigstellung. Bald folgten weitere Bauten.
Es hatte sich auch im alten Europa, besonders in Hansens Heimat, herumgesprochen, daß das Leben in Cathay angenehm sei und sich dort der deutschen Depression leicht entfliehen lasse.
Cathay stieg und stieg, wurde zur lebendigen, reichen Stadt, einer Stadt, in der Kultur und Kunst einen Aufschwung erlebten, beeinflußt vom Geist zweier Kontinente.
Doch auch das Dunkle wirkte forthin und erreichte eine Blüte. Dekadenz, Genußsucht und die Inzucht, die in Cathay unaufhaltsam an Macht gewannen, untergruben die blühende Stadt und ließen ihren Fall unvermeidbar erscheinen.
MIR KOMMT ES VOR, als habe sich Cathay seit jenen historischen Tagen kaum verändert, denn so fand ich es vor: eine düstere, von einem unseligen Geist beherrschte Ruine, deren einst blühendes Leben etwas anderem gewichen ist, etwas, das ich bislang nicht habe fassen können.
Von Anfang an suchte ich in der Geschichte Cathays Abwechslung von den immer verwunderlicher werdenden Versuchen meines Meisters, die jeden gelehrten Geist gleichermaßen in Staunen wie Abscheu versetzt hätten, und die alle einem einzigen Ziel dienen.
Bislang ist er nicht erfolgreich gewesen, obgleich auch ich mein Bestes tat, um ihn zu unterstützen. Meine Studien nahmen mich gewiß eine Zeitlang in Anspruch, sicher, doch wenn er mich brauchte, der Meister, so war ich ihm zu Diensten.
Vor zwei Monaten etwa fanden wir das lang gesuchte Blut von Golgatha, ein sirupartiges, zähflüssiges Elixier, das von vielen gelehrten Alchimisten schon oft aufs Genauste beschrieben und doch von keinem heute noch lebenden Menschen je erblickt worden war.
Nach der Beendigung der abscheulichen Zeremonie, während derer wir es generierten, schlief mein Meister noch vor der Versuchsanordnung ein, ich aber schlich mich aus der Mansarde die Treppe hinab und verließ das Haus.
An jenem Tag stieß ich in der Privatbibliothek der Psychiatrischen Abteilung der Universität Cathays, zu der ich mir unter dem Vorwand der Forschung Zutritt verschafft hatte, auf die Kliniktagebücher Doktor Justus Ardenheims, der im Jahre 1871 die Errichtung der Psychiatrie durchgesetzt hatte, nachdem sich die Fälle vererbungsbedingten Schwachsinns in bedrohlichem Maße gehäuft hatten.
Ich erwartete kaum, in diesem Tagebuch etwas über die Stadt oder gar jenen Stollen zu erfahren, der mich in meinen Gedanken stets beschäftigte. Wieviele Wanderungen hatten mich sowohl tagsüber als auch zu nächtlicher Stunde durch die unheimlichen Gassen Cathays und in das umgebende Grenzland zwischen Stadt und Dschungel geführt, ohne daß ich fündig geworden war!
Ich weiß nicht, warum ich das Buch schließlich doch aus dem Regal nahm. Vielleicht, weil es eine Zeit beschrieb, über die ich kaum etwas wußte. Erfreulicherweise stellte sich heraus, daß es zugleich die wissenschaftlichen Ergebnisse von Ardenheims Forschung wiedergab wie auch höchst persönliche und gesellschaftliche Ereignisse. Der Doktor hatte ein wertvolles Dokument über seine Zeit angefertigt. Für mich war es von um so größerem Wert, als ich völlig unverhofft auf einen Eintrag stieß, der einen Patienten betraf, der als einer der ersten in die von Ardenheim geleitete Klinik eingewiesen worden war. Sein Name war Tomasz Waldczeck, und seine Vorfahren waren rund hundert Jahre zuvor mit einer polnischen Auswanderergruppe nach Cathay gekommen, wo sie es als geschickte Handwerker rasch zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht hatten.
Waldczeck war offensichtlich wahnsinnig. Nicht nur die Dinge, von denen er sprach und die teilweise in den Protokollen Ardenheims wiedergegeben waren – schreckliche, gestaltlose Alpträume, die den Mann allnächtlich heimsuchten –, auch seine wiederholte Aussage, er sei tief in den Bauch der Erde vorgedrungen, mehr noch aber sein merkwürdiges Verhalten, wiesen ihn als hochgradig schizophren aus. Man mußte diesen Mann vor sich selbst schützen, das stand für Dr. Ardenheim fest.
Immer wieder fiel in dessen Bericht der Begriff eines Loches, das, uralt und menschenvergessen, nach Ansicht des Psychiaters als einziges Element der verworrenen Geschichte Waldczecks tatsächlich existierte, und das er gefunden zu haben glaubte. Der Doktor hatte gar eine grobe, unbeholfene Erinnerungsskizze des Fundortes gezeichnet, sie jedoch bedauerlicherweise nicht genordet und auch sonst mit Hinweisen gegeizt. Trotzdem kam mir irgendetwas daran bekannt vor.
Ich lieh das Buch aus und begab mich damit auf schnellstem Wege zu dem Haus, das wir bewohnten.
Es war früher Nachmittag, doch als ich die Treppe hinaufstieg, vernahm ich eine Vielzahl von Geräuschen, die besagten, daß mein Meister entgegen seiner Gewohnheit, nachts zu arbeiten, bereits dabei war, einen neuen Versuch vorzubereiten. Entweder hatte sich das Blut von Golgatha im Nachhinein doch instabil erwiesen, oder aber es war nur ein weiterer Schritt in Richtung des Zieles gewesen, das wir seit vielen Jahren verfolgten: der Transmutation eines unedlen Metalls wie Blei in Gold!
„Ich bin dem Ziel ganz nahe! Diesmal soll’s gelingen!“ stieß der Meister, wie immer in einen schäbigen, weißen Laborkittel gekleidet, mit glasigem, fanatischen Blick hervor, während er einen Erlenmeyerkolben gegen das Licht hob, das gedämpft durch eine verhangene Dachluke fiel.
Wie oft hatte ich das bereits aus dem Mund Franz Tausends gehört? Wie lange hatte er die Geldgeber in der Heimat mit seinen Versprechungen hingehalten. Und auch mich. Ja, ich glaubte an ihn, das muß ich gestehen. Es war ohnehin zu spät, aufzugeben.
„Was hast du denn da, laß sehen!“ Er duldete wie üblich keine Widerrede. „Tagebuch Dr. Ardenheims von 1873 bis 1937’. Hmm, was war der Mann… Psychiater, ha! Willst du mich…“ Franz Tausend war hochgradig paranoid, kein Wunder, wenn man bedachte, was er alles durchgemacht hatte. Sprunghafte Stimmungsumschwünge waren ebenso an der Tagesordnung wie lang anhaltende Phasen der Depression. Dennoch betrieb er seine Wissenschaft äußerst beharrlich.
„An die Arbeit!“ rief er aus und riß meinen weißen Kittel aus dem Spind, um ihn mir zuzuwerfen. Ich konnte nicht anders, als Ardenheims Tagebuch fallen zu lassen. „Wir haben keine Sekunde zu verlieren! Schau, dies erhielt ich heute mittag im Hafen!“
Er hob ein verkratztes Glas gegen das Licht. Es enthielt durchscheinende Steine. Etwas schien darin eingeschlossen zu sein. Bernstein. ,Tränen Gottes‘ stand auf einem vergilbten Etikett geschrieben.
„Wir müssen morgen sehr früh aufstehen und uns zum Taubabziehen auf das Mondfeld am Rande der Stadt begeben“, meinte Tausend und schraubte den Verschluß des Glases auf, um einen Stein in die linke Hand rollen zu lassen. Vorsichtig gab er ihn in eine Retorte, in der eine dickflüssige Substanz siedete.
Dann schwieg er. Widerspruch duldete Franz Tausend nicht.
Während der Arbeit gelang es mir dann doch, ihm von meinen Erkundungen der Cathayschen Geschichte zu berichten. Zuerst schien er mir gar nicht zuzuhören. Als ich von der verschollenen Kiste, der Fracht der Crusade berichtete, wendete er den Blick für einen kurzen Moment von der Versuchsapparatur ab und zog die linke Augenbraue in die Höhe. Er sagte jedoch nichts. Ich fuhr mit meinen Schilderungen fort und hätte kaum geglaubt, daß ich einen Funken des Interesses in ihm geschlagen haben könnte.
ÜBER DIE JÜNGERE GESCHICHTE der Stadt gibt es eine Vielzahl von sicheren Quellen, darunter der glücklicherweise komplett archivierte, wöchentlich erscheinende „Cathay Kurier“.
Vom Niedergang der Stadt berichteten vor allem zeitgenössische Chronisten aus der Zeit nach dem Großen Krieg, in dem Cathay eine unbedeutende Rolle gespielt hatte, als nur wenige Seemeilen entfernt ein deutsches und ein britisches Panzerschiff aufeinandergestoßen waren. Eine Granate hatte sich im Laufe des Gefechtes verirrt und war im Bahnhof eingeschlagen, wo damals noch mindestens einmal pro Woche der Postzug als einzig regelmäßige Verbindung mit dem Rest des Landes eingelaufen war.
Zu Beginn der Zwanziger Jahre, als der Abstieg der Stadt greifbare Form angenommen hatte und sich auch die optimistischsten Naturen nach der Zukunft zu fragen begannen, war die Stadt beinahe an ihrem eigenen Müll erstickt. In der veralteten Kanalisation hatte sich im Lauf der Zeit ein dichtes Schimmelpilzgeflecht ausgebreitet und die engen Gänge vollkommen verstopft. Fett, Pflanzenfasern und Abfälle hatten dem Organismus, der zum Teil durch die giftigen Abwässer eine Mutation durchlaufen hatte, als Nahrung gedient. Nur unter diesen günstigen Bedingungen hatte das amöbenhafte Wesen die Grenzen des natürlichen Wachstums überwinden können.
Schenkte man den Schilderungen der Kommission Glauben, die zur Reinigung der Abwasserkanäle eingesetzt worden war, so war es unwahrscheinlich schwierig gewesen, der botanischen Kreatur beizukommen. Sie war schlichtweg schneller nachgewuchert, als man sie hatte vernichten können.
Irgendjemand war auf die Idee gekommen, das widerstandsfähige Gewächs mit Feuer zu bekämpfen. Tatsächlich hatten sich soviel Petroleum und Fett in den steinernen Röhren angesammelt und im Gewebe des Pilzes abgelagert, daß die Flammen munter durch die Kanalisation gefegt waren. Leider hatten sie durch aufsteigende Schächte auf die marode Bausubstanz Cathays übergegriffen, und bei dem außer Kontrolle geratenen Feuer war beinahe ein Drittel der gesamten Stadt abgebrannt.
Es wäre ein Segen gewesen, hätte die Feuersbrunst Cathay vollkommen vernichtet!
Im Zuge der Industrialisierung war 1935 eine chemische Fabrik am südöstlichen Stadtrand errichtet worden, ferner hatte man stolz eine eigene Straßenbahn eingeweiht, welche die Stadt seither in einer regelmäßigen Acht durchkreiste.
DIE VERSUCHSREIHE WAR FEHLGESCHLAGEN, und weitere folgten ihr. Keines der durchgeführten Experimente hatte den gewünschten Erfolg gebracht, stets war das Ergebnis, das wir unserem Schmelzofen entnahmen, eine amorphe, klumpige Masse von meist bleigrauer Färbung.
Blei war Blei geblieben.
Wie hätte es auch anders sein sollen? Wir jagten einem Phantom hinterher, hatten wertvolle Jahre unseres Lebens einem Traum geopfert, einem Hirngespinst.
Auch Tausend war zutiefst deprimiert. Er schickte mich für eine ganze Woche aus dem Labor, und zuerst glaubte ich, er arbeite fieberhaft an neuen Versuchen, doch dann stellte ich fest, daß das Labor unbeleuchtet war und mein Meister sich in seinen Privaträumen aufhielt. Er mußte in diesen schweren Stunden eine tiefe Sinnkrise durchleben.
NACH VERSTREICHEN dieser von Untätigkeit geprägten Woche trat mir eines Nachmittags ein sichtlich entspannter, wenn auch abgemagerter Franz Tausend entgegen. Ich war gerade im Begriff gewesen, einen Tee aufzubrühen.
„Hanns, komm, wiederhole noch einmal, wovon du letztens im Labor erzählt hast… die Geschichte von der eisenbeschlagenen Truhe…“
Ich war so verwirrt, daß ich die Einzelheiten nicht mehr richtig herausbekam, doch als wir beim Tee die Skizzen Dr. Ardenheims studierten und ich den fiebrigen Glanz in den Augen Tausends sah, wußte ich, daß ich ein Feuer entflammt hatte, so heiß, daß es diesen Menschen verzehren konnte.
Und so kam es, daß wir am nächsten Morgen nach der ersten durchschlafenen Nacht seit Wochen voll neu erwachter Kraft in die Hügelkette nördlich Cathays aufbrachen, die sich stetig höher und höher auftürmte und nur wenig landeinwärts alpinen Charakter gewann. Eine seltsame Expedition waren wir. Ich mit den knielangen Hosen und einem Wollpullover, der meinen untrainierten Körper noch fülliger wirken ließ, einen Rucksack auf den Rücken geschnallt; Tausend, der Grabwerkzeug trug, mit dem pittoresken, fast lächerlichen Tropenhelm, dem dünnen Hemd und der Hose, die um seine Knöchel flatterte.
Unsere Suche richtete sich nach den Karten Dr. Ardenheims – natürlich, denn sie versprachen die größte Trefferquote –, doch wie erwartet erwiesen sie sich als äußerst ungenau. Bald begannen wir, Skizzen der Wege zu zeichnen, die wir bislang beschriften hatten, schmale, felsige Pfade, die durch Täler und über schroffe Grate führten. Aus dem so gewonnenen Muster wollten wir Rückschlüsse ziehen.
Es wurde Abend, wir übernachteten in einer Hütte am Rande der Waldgrenze, wo sich ein Hirte mit indischen Bergziegen niedergelassen hatte, der den wenigen Wanderern, die sich gelegentlich hierher verirrten, Schutz und Unterstand bot.
Und es wurde Morgen. Als wir bei dem Frühstück, bestehend aus dem selbstgebackenen Brot und dem Käse, den der Einsiedler aus der Milch seiner Ziegen gewann, unsere Karten auf dem groben Tisch ausbreiteten, kam der wortkarge Mann hinzu und runzelte die Stirn. Er wies uns darauf hin, daß wir eine der Karten um 90° drehen müßten.
Er hatte sich in einer von Ardenheims Skizzen zurechtgefunden!
Als wir ihm erklärten, daß wir einen Stollen suchten, nickte er wissend und fand sich bereit, uns zu dem Ort zu führen, wenn wir nur abwarteten, bis er seine Tiere versorgt habe.
Die Zeit zog sich endlos dahin. Ich glaube, Tausend war noch ungeduldiger als ich. Hinter vorgehaltener Hand fluchte er über den unzivilisierten Gastgeber und trieb diesen zu größter Eile an.
Der Mann aber meinte nur, der verschüttete Schacht sei ja schon seit Menschengedenken dort, er werde auch in hundert Jahren noch unversehrt sein.
Der Weg war nicht weit. Gut eine halbe Stunde bemühten wir uns, mit dem drahtigen Mann, der nicht die geringste Rücksicht auf unsere städtische Kondition nahm, Schritt zu halten, dann erreichten wir die südlichen Hänge des Kalvarienberges, einen schroffen Abhang, auf dem nur vereinzelt dorniges Gestrüpp wuchs. In weiter Ferne ließ sich im Morgendunst Cathay erahnen. Vermutlich schlief man dort noch.
Die Sonne hatte den Grat zur Rechten noch nicht erklommen. Als wir von der Hütte des Einsiedlers losgezogen waren, hatte diese bereits im wärmenden Schein gelegen, doch hier war es merklich kühler. Erst im Laufe des Tages würde, wie wir bald merken sollten, die sengende Hitze auch diese reflektierende Wand erreichen.
Unser Führer sprach immer noch nicht viel, doch plötzlich machte er Halt.
Der Weg verbreiterte sich so, daß hier eine Gruppe von fünf oder mehr Männern bequem Platz gefunden hätte. Wir hatten unser Ziel erreicht!
Der Ziegenhirte deutete auf ein verschüttetes Loch, das wohl einen Durchmesser von gut anderthalb Metern gehabt hatte. War dies etwa der gesuchte Stollen? Warum so weit von der Stadt entfernt?
Zum ersten Mal überkam mich ein ungutes Gefühl. Hatte man die Kiste wegschaffen wollen, aus der unmittelbaren Reichweite der Siedlung entfernen? Warum, so fragte ich mich, hatte man sie dann nicht einfach im Meer versenkt?
Nun, man weiß, daß gewisse Dinge immer wieder aus dem Meer zurückkehren, und ich stellte mir vor, wie die Kiste von einer besonders stürmischen Flut an Land gespült wurde.
Franz Tausend interessierten solche Fragen in diesem Moment nicht. Er dankte unserem Führer und reichte ihm für seine Dienste einen kleinen ledernen Beutel, in dem sich Tabak befand. Dieses Zahlungsmittel war durchaus nicht unüblich und für den Mann gewiß mehr wert als bares Geld, mit dem er nur in der Stadt etwas hätte anfangen können.
Der Hirte verabschiedete sich rasch mit der Erklärung, er müsse seine Tiere versorgen, und stieg dann in entgegengesetzter Richtung bergauf.
Tausend und ich inspizierten den eingestürzten Stollen.
Offenbar hatten zuerst Waldczeck, dann Ardenheim, die beide vor uns hier gewesen waren, ganze Arbeit geleistet und einen Durchgang geschaffen, der erst später wieder durch die Bodenbewegung verschüttet worden war.
Würden wir die Kiste – wenn es überhaupt eine gab – wohl unversehrt finden? In Ardenheims Tagebuch stand nichts davon, daß er sie gefunden oder gar geöffnet hatte.
Die Spannung stieg ins Unermeßliche, während sich unsere Schaufeln ins lockere Geröll fraßen und der Durchgang mit jedem Stich größer wurde.
Die Luft, die aus der Höhle drang, war frisch, unverbraucht und erfreulich kühl. Wir waren trotzdem bald bis aufs Hemd naßgeschwitzt, denn die Sonne stand nun direkt über der Wand und verdorrte alles, was nicht aus Stein war, aufs Ungnädigste.
Endlich, wir hatten das Geröll so weit zur Seite geschafft, daß ein Nachrutschen nicht zu befürchten war, war der Weg frei.
Ha! Der Weg, sage ich! Es war ein Loch, das sich unserem neugierigen Blick im Licht der mitgefühlten Taschenlampe offenbarte! Die Männer, die einst den Stollen gegraben, hatten seinen Durchmesser gerade so angelegt, daß sie selbst hatten darin arbeiten können. Kein überflüssiger Zentimeter Fels war abgeschlagen worden. Hätte man hier etwas Wertvolles verstecken und vernünftig sichern wollen, so hätte man gewiß mehr Sorgfalt aufgebracht.
Ich wollte in das Loch hineinsteigen, da ergriff Tausend mich an der Schulter und meinte: „Laß mich, Hanns! Ich bin zu gespannt auf das, was uns dort erwartet, und du hast deinen Teil ja schon beigetragen…“
Ich wollte einen Moment lang widersprechen, nickte dann aber nur. Franz Tausend war kein Mann, der den persönlichen Triumph suchte und die Leistung anderer unterschlug.
Schon war er zur Hälfte in dem düstren Schlund verschwunden, da hallte seine Stimme dumpf zu mir heraus. „Reich mir die Taschenlampe, es ist stockfinster hier! Das Tageslicht wird vom Gesteinsstaub in der Luft sofort geschluckt!“
Ich tat das Gewünschte, vernahm ein Husten, dann die schlurfenden Laute des gebückt gehenden Tausend auf dem Schotter, der den Boden der künstlichen Höhle bedeckte.
Minuten vergingen.
Dann ertönte ein ferner Aufschrei… und bald vernahm ich das Rumpeln eines schweren Gegenstandes, der über den Boden geschleift wurde… die Truhe!?
„Hilf mir, Hanns!“ stieß Tausend hervor. Sein Gesicht tauchte als bleiches Oval in der Düsternis des Tunnels auf und verschwand gleich wieder. Ich wollte schon in den Schacht steigen, da schob sich mir der vordere Teil einer kleinen, aber ausgesprochen gewichtigen hölzernen Lade entgegen. „Sie ist verdammt schwer!“
Ich griff mit beiden Händen unter den Boden der Kiste. Mit vereinter Kraft hievten wir sie über die Schwelle aus Geröll, die vor dem Loch im Fels lag, dann setzten wir sie vorsichtig ab.
Tausend sah erbärmlich aus. Sein Anzug, dank der verzehrenden Arbeit der letzten Wochen um den ausgemergelten Körper flatternd, war völlig verstaubt. Die Haare standen wüst in alle Richtungen ab, und der Staub hatte sich in der kurzen Zeit selbst auf seinen Gesichtszügen abgesetzt.
Doch sein Gesichtsausdruck versprach so viel Optimismus, daß ich das Ende des Tals in Sicht hoffte.
Die Kiste bestand aus einem hellen Holz, vermutlich Eiche. Es war gequollen und rissig, wurde jedoch durch die ehernen Bänder vorzüglich eingefaßt und hatte über die Jahrhunderte hinweg seinen Schatz wohl behütet.
Das Schloß allerdings war aufgebrochen, wenn es überhaupt jemals verschlossen gewesen war.
Wir waren Narren gewesen, wenn wir erwartet hatten, die Kiste unversehrt zu finden, nachdem zuerst Waldczeck, dann Ardenheim ihren Aufbewahrungsort gefunden hatten. Doch ihr Gewicht sprach dafür, daß sich noch etwas darin befand. Wir verloren keine Zeit, dies zu überprüfen.
Tausend schob den Riegel beiseite, der Deckel und Kasten verband. Er ließ sich so leicht bewegen, als sei er gerade geölt und stets benutzt worden.
Dann der bange Moment, in dem wir den Deckel aufklappten und brütendes Sonnenlicht den jahrhundertelang in Finsternis verharrten Hohlraum erfüllte.
Ich war von dem Anblick, der sich uns bot, zutiefst enttäuscht.
Es war ein Stein, ein unscheinbarer, etwa kindskopfgroßer Felsklumpen, der nicht den Eindruck machte, als handle es sich bei ihm um ein besonders wertvolles Mineral.
Hatten Ardenheim oder Waldczeck ihn in der Kiste hinterlassen, oder war diese schon lange vorher gefunden und ausgeraubt worden?
Ich wollte ihn aus dem Behälter, der mehr wert schien als er selbst, herausheben, da legten sich Franz Tausends Hände auf meinen Arm: „Nein, berühre ihn nicht, jedenfalls nicht mit bloßen Händen. Wir wissen nicht, um was es sich hier handelt, aber ich habe eine Vermutung, die ich mit Hilfe einiger Versuche gerne bestätigen würde.“
Ich hatte erwartet, daß mein Meister beim enttäuschenden Anblick des Felsbrockens in Tränen ausbrechen würde, doch ihn schien diese Entdeckung weitaus weniger mitzunehmen als mich. Hatte er mit etwas Derartigem gerechnet?
Er hatte es nun plötzlich eilig, klappte den gewölbten Deckel der Kiste zu und wies mich an, sie an einem der seitlichen Griffe zu packen.
Gemeinsam machten wir uns auf den direkten Rückweg nach Cathay, dessen Stadtrand wir kurz vor dem Dunkelwerden erreichten.
FRANZ TAUSEND WURDE in den darauffolgenden Tagen immer schweigsamer und absonderlicher. Er behandelte den Stein sehr sorgfältig, und ich fragte mich, ob er ihn wohl für so außerordentlich wertvoll hielt oder sich davor fürchtete, daß er ihn nur durch doppelwandiges, zentimeterdickes Glas zu betrachten wagte und niemals berührte.
Nachts schloß er ihn gar in den schweren, bleigefutterten Tresor, aus dem er zuvor alle Proben, auch die der bisher vielversprechenden Experimente, entfernt hatte. Früher war es unvorstellbar gewesen, daß ich auch nur Einblick in diesen Schrank hatte, nun räumte er die Ergebnisse jahrelanger Arbeit auf das breite, spinnenverwobene Fensterbrett zur Straße hin, so als habe all das seinen Wert verloren.
Die Versuche, die wir nun machten, waren eher physikalischer denn chemischer Natur. Ständig mußte ich Photoplatten entwickeln, die Tausend in der Nacht mit seltsamen Mustern belichtet hatte.
Einmal nahm er mich zur Seite und meinte: „Mein lieber Hanns! Wir sind dem Stein der Weisen auf der Spur, und ich verspreche dir, ich werde sein Geheimnis lösen, auch wenn es das letzte ist, was mir gelingt.“
Dann hatte er sich wieder an die Arbeit begeben, die er ganz wie ein Besessener vorantrieb, jedoch weniger verzweifelt als zuvor und mit einem scheinbar ganz klaren Ziel vor Augen.
Mir war aber auch seine unbegründete Ahnung eines möglicherweise nahen Todes nicht entgangen. „Wenn es das letzte ist, was mir gelingt“, hatte er gesagt. Das klang so, als bezweifle er, seinen wissenschaftlichen Triumph auskosten zu können.
Ich beschloß, ihn offen und direkt auf diese Sache hin anzusprechen, aber dazu sollte es nicht mehr kommen.
Den Franz Tausend, so wie ich ihn kannte, sollte ich nie mehr sehen.
ICH HATTE DIE GANZE ZEIT über nicht mitbekommen, daß mein Meister seine Versuche sehr erfolgreich abschloß. Was hätte ich auch den Photographien, den wirren Aufzeichnungen und seiner meist bekümmerten Miene entnehmen sollen?
Wie hätte ich ahnen sollen, daß Tausend das letzte Experiment alleine wagen würde, nachts, ohne daß er mich darüber informierte oder meine Hilfe erbat.
Es war eine schwüle Nacht, und die Hitze lag drückend über der Stadt. Auf den Straßen feierte man ausgelassen eines der wilden Feste der Eingeborenen, so daß weder bei offenem noch bei geschlossenem Fenster Erholung zu finden war. Dennoch fiel ich in einen leichten Schlummer, aus dem ich aber gegen Mitternacht erwachte. Geräusche drangen aus dem über meiner Kammer liegenden Geschoß herunter zu mir, das Bersten von Glas, laute, animalische Schreie, der Lärm eines unbändigen Kampfes.
Ich warf mir den leichten Morgenmantel über und lehnte mich weit aus dem Zimmerfenster, von wo aus ich erkennen konnte, daß im Laboratorium noch Licht brannte. Der Schein fiel bis auf die Straße, wo immer noch das Fest im Gange war. Keiner der Tanzenden und Musizierenden nahm wahr, was in unserem Haus geschah.
Ich stürmte aus dem Zimmer, ans andere Ende des Korridors, die Treppe hinauf… hinter der Tür zum Labor war nun Dunkelheit, wie ich durch den Glaseinsatz sehen konnte.
Das jedoch schreckte mich nicht ab. Es war niemand die Treppe hinabgekommen, also mußten der Eindringling und mein Meister noch in den zwei Arbeitsräumen sein.
Ich drückte die Türklinke herunter und stieß die Tür auf. Das einfallende Licht zeigte die grausige Verwüstung, die anstatt des hervorragend ausgerüsteten, von mir liebevoll gepflegten Laboratoriums den Raum ausfüllte.
Von Tausend war nichts zu sehen. Möglicherweise lag er niedergeschlagen im Nachbarzimmer, womöglich war auch sein Gegner dort zu finden.
Ich wollte ihm zu Hilfe eilen, trat in den Raum hinein, da traf mich etwas mit unbarmherziger Wucht im Nacken und Myriaden von Sternen zerplatzten vor meinen Augen.
ICH ERWACHTE ERST AM NÄCHSTEN MORGEN aus der tiefen Bewußtlosigkeit. Die schmerzhafte Schwellung am Hinterkopf erinnerte mich daran, warum ich die Nacht auf dem harten Laborboden verbracht hatte.
Bei Tageslicht betrachtet war das Ausmaß der Zerstörung noch größer als befürchtet. Von Franz Tausend keine Spur. War er entführt worden? War er einem wahnsinnigen Mörder zum Opfer gefallen?
Ich durchsuchte das Laboratorium nach Spuren, konnte jedoch keinen Hinweis auf Tausends Verbleib finden. Und noch etwas: der wohlbehütete Felsklumpen war verschwunden! Ich war mir sicher, daß ich dort, wo ich ihn finden würde, auch auf meinen Meister stieße.
Nachdem ich einen Tag lang gewartet und mich vergewissert hatte, daß der Stein nicht einfach nur versteckt oder weggeschlossen worden war, begab ich mich zur Polizeibehörde und schilderte einem Beamten, was vorgefallen war.
Der Mann nahm alle Daten und Fakten auf und versprach, sich den Ort des möglichen Verbrechens in den nächsten Tagen anzusehen. Das vorangegangene Fest hatte wie stets eine Vielzahl kleinerer Delikte mit sich gebracht, die die Polizei über Gebühr beschäftigten. Und solange Tausends Leiche nicht gefunden worden war, galt der Fall als nicht dringend.
Ich ging nach Hause, ratlos, was ich tun sollte. Es war wenig sinnvoll, auf eigene Faust eine Suche nach dem Verschollenen zu starten. Die verschlungenen Sträßchen und Gassen Cathays mit ihren verfallenen Bauten, die endlosen Kais im Süden und die sich daran aneinanderreihenden Lagerhallen, die vergessenen Katakomben und Zisternen unter der Stadt boten unendlich viele Verstecke.
Es waren eher die tiefe Hoffnungslosigkeit und das Gefühl der unendlich dumpfen Betäubung, die mich durch die Stadt laufen ließen.
Nach drei Tagen verließ ich Cathay und streunte durch die umliegenden Lande, das Mondfeld und die Sümpfe im Osten, die zerklüfteten Felsen im Westen und zuletzt die Berge im Norden. Und es war gewiß keine gelenkte Überlegung, die mich zum Kalvarienberg trieb, sondern ein Zufall. Ohne es recht zu bemerken, stieg ich die schmalen Pfade hinauf, zwischen schroff aufragenden Felsnadeln, durch wilde Schluchten, bis auf das Plateau, auf dem sich die Hütte des Einsiedlers befand, der uns Unterkunft gewährt hatte.
Der Mann war nicht da, die Hütte stand leer. Vermutlich hütete er sein Vieh an einem saftigeren Hang denn diesem.
Ich überlegte, ob ich ihm eine Nachricht hinterlassen sollte, war mir jedoch nicht sicher, ob er des Lesens kundig sei.
Dann folgte ich dem Weg, den wir erst kurz zuvor gegangen waren. Mir war nämlich der Gedanke gekommen, daß Franz Tausend etwas übersehen haben könnte, als er – nur nach dieser suchend – die Kiste aus dem finstren Schacht geborgen hatte.
Doch welche eine Überraschung: der Stollen war zugeschüttet worden – nicht oberflächlich durch einen Erdrutsch, sondern gezielt durch menschliche Arbeit. Wer dies getan hatte, konnte ich nur mutmaßen, eines wußte ich jedoch: ich kam zu spät. Wenn sich noch etwas in der Höhle befunden hatte, so war es nun nicht mehr dort.
Ich ging zur Hütte des Einsiedlers zurück und rief nach dem Mann, erhielt jedoch keine Antwort.
Da hier nichts zu erreichen war und der Grad meiner Verwirrung einen Höchststand erreicht hatte, machte ich mich auf den Heimweg.
Im Dunkeln übte die Wildnis auf einen stadtgewohnten Menschen wie mich einen noch größeren Eindruck der Bedrohung aus. In den Bergen rumpelte und schürfte es unheimlich, als ob gigantische Echsen sich über den Schiefer schöben, in den Tälern rauschten die Bäume, und im dichten Urwald drang von allen Seiten das Geschrei der Affen und Vögel auf mich ein.
Völlig außer Atem, mehr laufend als gehend, kam ich durch einen verfallenen Triumphbogen von Norden in die Stadt. Die wenigen Menschen, die noch auf den Straßen waren, musterten mich, der ich einen gehetzten und völlig verstörten Eindruck machen mußte, von oben bis unten.
Das störte mich nicht. Ich wollte nur möglichst schnell nach Hause.
Dort aber traute ich meinen Augen nicht.
Im Obergeschoß brannte Licht! Das Obergeschoß… hier lagen die Räume des Laboratoriums. Wie war das möglich? Wer hatte hier Zutritt außer Franz Tausend und mir, seinem treuen Gehilfen?
Freude erfaßte mich jäh, und ich nestelte nervös den Schlüssel zur Haustür hervor. Unnötig, denn sie war offen. Es paßte nicht zu Tausend, daß er so nachlässig war, die Tür unverschlossen zu lassen. Andererseits – wer ahnte, in welchem Zustand er sich befand?
Vorsichtig stieg ich die Treppen hinauf, darauf gefaßt, von einem Eindringling niedergeschlagen zu werden, ließ das Erdgeschoß vorerst unbeachtet, auch das erste Stockwerk. Erst als ich vor der Labortür stand, verharrte ich einen Moment und lauschte in die Stille hinein. Das Holz des Dachstuhl arbeitete unter der Hitze und Feuchtigkeit des späten Sommertages.
Äußerst behutsam stieß ich die Tür auf und spähte in den Raum hinein. Er war menschenleer. Das Chaos, das zu beseitigen ich in den vergangenen Tagen noch nicht die Kraft gehabt hatte, schien unverändert. Aber das mit Sicherheit zu sagen war schwierig.
Sollte etwa ich selbst das Licht angelassen haben? Bei Tage geschah dies leicht!
Ich wußte, ich würde darauf keine Antwort finden. Oberflächlich suchte ich auch die unteren Geschosse ab, selbst die privaten Räume Franz Tausends, dann legte ich mich, völlig erschöpft und auch geistig entkräftet, zu Bett, wo ich in einen tiefen, von bunten Alpträumen gehetzten Schlaf fiel.
ICH NAHM MIR VOR, das Labor endlich gründlich aufzuräumen. Die Polizei hatte bislang nichts von sich hören lassen. Die Gefahr, Spuren zu verwischen, erachtete ich als so gering, daß sie zu vernachlässigen war. Nun, ich fand stattdessen selber einige Spuren, die mich in noch größere Ratlosigkeit stürzten. Sie wiesen darauf hin, daß in der Nacht, da ich vom Kalvarienberg zurückgekehrt war, mit ziemlicher Sicherheit doch jemand ins Labor eingedrungen war. Zertretene Gläser, die vorher heil gewesen waren, verschüttete Flüssigkeiten, die längst hätten getrocknet sein müssen…
Ich zweifelte nicht mehr daran, daß wir einen nächtlichen Besucher gehabt hatten.
Von Tausend fehlte derweil zuerst jede Spur. Ich überlegte schon, was ich ohne ihn tun sollte, da stieß ich auf einen schmutzigen, zerknüllten, jedoch kaum lesbar beschriebenen Zettel. Es war die Schrift eines Menschen, der nicht sieht, was er da schreibt, und sie gehörte zweifellos Franz Tausend. Ich kannte seinen Federstrich, und die trotz ihrer Unbeholfenheit anmutigen, geschwungenen Linien konnten nur von ihm stammen. Wichtiger aber war die Feststellung, daß dieser Zettel ganz offensichtlich nach dem schrecklichen Kampf im Labor geschrieben worden war und einen Hilferuf enthielt: „Hanns… hilf, bin in diesem (unlesbar) gefangen, furchtbare Qual, Moment der Freiheit zu kostbar. Wenn nicht bald (unlesbar) zu spät!“
Alle Pläne, Cathay zu verlassen und in die Heimat zurückzukehren, ließ ich augenblicklich fallen. Mein Meister lebte, und er brauchte meine Hilfe. Zu ärgerlich nur, daß sein Hilferuf keinerlei Ortsangaben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort enthielt. Wie auch immer ich die Botschaft las – die fehlenden Worte waren kaum sinnvoll zu ergänzen.
ICH WACHTE NUN NACHT FÜR NACHT auf dem Flur vor dem Labor.
Wer in die beiden Kammern wollte, mußte diesen Weg nehmen, es sei denn, er hätte es verstanden, gleich einer Echse entlang der bloßen Wand vom Nachbarhaus herüberzuklettern.
Und doch geschah es, daß ich in der dritten Nacht meiner Wache für einen kurzen Moment einnickte und durch ein Geräusch aus dem Labor geweckt wurde. Ich schreckte hoch, griff nach einer Jagdflinte, die ich in Tausends Kammer gewußt hatte und die scharf geladen war.
Im Laboratorium brannte Licht. Gott, ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, denn durch die von innen beleuchtete Milchglasscheibe erblickte ich die gräßliche Silhouette einer abnormen Kreatur. Es waren alleine ihre Proportionen, die mich erschreckten, ohne daß ich Genaueres erkennen konnte.
In diesem Augenblick war mein Mut größer, als ich mir jemals hätte vorstellen mögen. Ich mußte ins Labor, wollte ich mehr über den Verbleib Franz Tausends erfahren. Doch als ich die Klinke herunterdrückte, stellte ich fest, daß die Tür abgeschlossen war. Der Schlüssel steckte von innen. Diese Erkenntnis ließ Panik in mir aufkommen. Nicht nur, daß der mysteriöse Fremde lautlos an mir vorbeigekommen war, er besaß tatsächlich einen Schlüssel und nutzte ihn, um mich auszusperren.
Alle Abscheu und meine lähmende Furcht überwindend, bückte ich mich und versuchte, durch das Schlüsselloch genaueres zu erkennen.
Und da stand er, blickte argwöhnisch zur Tür herüber, mußte mich bemerkt haben, zweifellos! Der ungeschlachte, walzenhafte Leib, der knochige, schwere Kopf, der ohne Hals direkt auf die Schlüsselbeine aufgepfropft zu sein schien, die säulenartigen Beine, die viel zu kurz waren und in Klauen anstelle von Füßen endeten – all das sprach dagegen, daß es sich um einen Menschen handelte. Selbst die Dschungelmenschen kamen nicht in Frage. Wer zum Teufel war er also?
Er war in einen schäbigen, schmutzigen Lumpen gehüllt, der den Kitteln nicht unähnlich war, die wir im Labor trugen. Und er schien mit etwas beschäftigt gewesen zu sein. Oder hatte die Bestie lediglich etwas nachgeäfft, das sie bei Franz Tausend beobachtet hatte?
Der Gedanke an meinen Meister verlieh mir neue Kraft. Mit einem einzigen Tritt sprengte ich die altersschwache Tür, sah jedoch nur noch einen durchs Zimmer fliegenden Schatten, der eines der Fenster auf der Gartenseite durchbrach und in einem Scherbenregen zu Boden fiel.
Den Sturz aus dieser Höhe konnte niemand unverletzt überleben. Und die Glasscherben mußten scharf wie Messer sein.
Ich rannte zum Fenster und sah, daß die Kreatur sich gerade aufrichtete. Sie war von einem dichten Distelgebüsch aufgefangen worden, schien jedoch verwirrt und benommen zu sein. Sie zögerte, dann wollte sie sich abkehren und ins Dunkel des rückwärtigen Gartens fliehen. In einer Reflexhandlung hob ich die Jagdflinte und zog den Hahn durch.
Der Knall war ohrenbetäubend, der Rückstoß warf mich zu Boden, und ich wußte nicht, ob ich getroffen hatte oder nicht. Es war in diesem Moment egal. Die Ereignisse forderten ihren Tribut. Ich war in dieser Nacht über mich selbst hinausgewachsen. Gnädige Ohnmacht umfing mich.
ALS ICH ERWACHTE, war es, als hätte ich nur wenige Augenblicke dagelegen. Tatsächlich vermochte ich nicht zu sagen, wie lange ich wirklich bewußtlos gewesen war.
Ich konzentrierte mich auf meine Umgebung. Das Licht strahlte schmerzhaft hell von der Decke, wo eine nackte Birne in der leichten Brise, die durchs geborstene Fenster drang, leicht hin- und herschwang. Die feine Spur einer animalischen Ausdünstung überlagerte den süßen Duft der exotischen Blüten im Garten, der bislang den Raum erfüllt hatte. Aus dem Garten war ein leises Rascheln zu vernehmen, ferner grunzende, tief grollende Laute, unter die sich von Zeit zu Zeit ein markerschütterndes unterdrücktes Heulen mischte.
Die Kreatur lebte noch. Ich mußte sie von nahem sehen, soviel Überwindung mich dies auch kosten mochte. Vom Fenster aus war fast nichts zu erkennen, nur ein Schemen, der sich im kniehohen Gras wälzte und die Halme niederdrückte.
Ich rannte durch den Flur zur Treppe, beachtete nicht, daß ich das Jagdgewehr im Labor fallengelassen hatte. Zu einem weiteren Schuß hätte mir so oder so der Mut gefehlt. Ich stieß die Hoftür auf und stürzte auf die freie Fläche in der Mitte des Gartens. Hierhin hatte sich die Kreatur geschleppt, hier rang sie mit dem Tode, und lange würde ihr Ringen nicht mehr währen, denn selbst der zäheste Organismus vermochte mit einem Loch der Art, wie es der Schuß aus nächster Nähe in die Brust des Wesens gerissen hatte, nicht lange zu überleben. Ein Wunder, daß sie überhaupt zu einer Regung fähig war.
Ich trat näher heran, vielleicht aus einem menschlichen, vielleicht auch aus einem wissenschaftlichen Interesse.
Und plötzlich durchfuhr mich eine furchtbare Erkenntnis. Ja, nun wußte ich, daß es nicht die Pest gewesen war, die jene ersten Einwanderer an Bord der Crusade