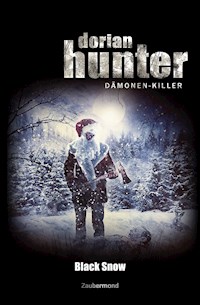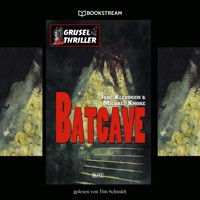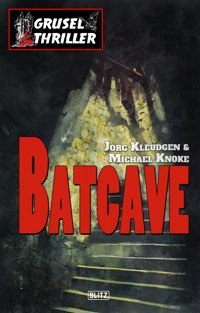
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grusel Thriller
- Sprache: Deutsch
Das Leben von Bat in einem Londoner Vorort ist perspektivlos. Notdürftig hält er sich mit Zeitungsartikeln über Bands der Gothic- und Industrial-Szene über Wasser. Doch als er die hübsche Myriam kennenlernt, scheint sich das Blatt zu wenden. Batcave ist die letzte Zusammenarbeit von Jörg Kleudgen und Michael Knoke vor dessen Tod im Jahre 2010. Der Roman zeichnet sich durch die Szenekenntnis der beiden Autoren und ihre Liebe zur dunklen Phantastik aus und besticht durch faszinierende Authentizität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Kleudgen & Michael KnokeBATCAVE
In dieser Reihe bisher erschienen:
3401 Jörg Kleudgen & Michael Knoke Batcave
3402 Ina Elbracht Der Todesengel
Jörg Kleudgen & Michael Knoke
Batcave
Ein Grusel-Thriller
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/Hein NouwensSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-954-6Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
1. Kapitel: They keep calling me!
Als ich die Augen schloss, hatte ich einen Moment lang das Gefühl, es seien wirklich Joy Division, die da auf der Bühne Dead Souls spielten. Der Bass dröhnte verzerrt, die Gitarren sägten schmerzhaft laut durch die dicke Luft des kleinen Clubs, in dem sich einige hundert bleiche Nachtschwärmer eingefunden hatten. Es war das übliche Publikum, das zusammenströmte, wenn Ligeia‘s Death spielten. Sie alle waren verlorene Seelen … wie ich. Denn auch ich sah die Band an diesem Abend nicht zum ersten Mal. Das Spiel der Musiker hatte gegenüber früheren Auftritten eine neue Qualität gewonnen.
Rod hatte sich im Laufe des Gigs am Bass die Finger blutig gespielt. Er hatte das Blut achtlos an einer Setlist abgewischt, doch das Papier saugte so gut wie nichts davon auf und verwandelte sich stattdessen in ein bizarres Rorschach-Bild.
Der schlanke Sänger der Band, von dem ich nicht mehr wusste, als dass sein Name Valis lautete, war in eine Art Trance versunken. Er intonierte das Stück mit einer Inbrunst, die erschreckend nahe an Ian Curtis, den tragischen Frontmann von Joy Division, herankam. Es war beinahe so, als habe sich das Konzert in diesem Augenblick in eine Séance verwandelt, während derer Valis zum Medium wurde und Kontakt mit dem toten Sänger aufnahm.
Ich bekam eine Gänsehaut. Ian Curtis hatte mich fasziniert, seitdem ich zum ersten Mal den Hit der Band, das phantastische Love Will Tear Us Apart im Radio gehört hatte. So viel Verzweiflung und Melancholie hatte ich nie zuvor aus einem Song herausgehört.
Erst später erfuhr ich, dass Curtis kurz vor der Veröffentlichung der Single einen Suizid begangen hatte. Er hatte sich am 18. Mai 1980 im Alter von dreiundzwanzig Jahren in der Küche seiner Zweizimmer-Wohnung in Manchester erhängt. Wenn man sein Leben mit einer Langspielplatte verglich, so war der Tonabnehmer in diesem Moment mit einem hässlichen Kratzen über die Rillen gezogen worden. Seine Band, die die Aggressivität des Punk mit exzessiv gelebtem Weltschmerz verbunden und somit den Weg für eine neue Musikrichtung geebnet hatte, hätte sich wenige Tage später auf US-Tournee begeben sollen. Curtis’ gewaltsamer Tod und das Cover der Love Will Tear Us Apart-Single, das so einem Grabstein ähnelte …
Das hatte die morbide Anziehungskraft der Band begründet, die sich bald darauf in New Order umtaufte. Doch das ist eine andere Geschichte.
… Another day, another time, the dreams can’t stop or rectify, we’re born into a living scene, it draws me in, keeps calling me, they keep calling me, keep on calling me …
Die letzten Zeilen des Songs verklangen, der Applaus war frenetisch, und auch ich war begeistert.
In diesem Augenblick wurde ich auf einen jungen Mann aufmerksam, der nicht weit von mir entfernt an einen Betonpfeiler gelehnt stand. Seine Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Ian Curtis war absolut verblüffend. Er hatte dieselbe Unfrisur, dieselben großen Augen, denselben verlorenen Gesichtsausdruck und trug dasselbe steif wirkende Hemd.
Ich hatte Lookalikes schon immer gehasst. Aber dieser Junge sah einfach so aus, das spürte ich. Er hatte sich nicht verkleidet. Ich wollte ihn mir aus der Nähe ansehen, doch das Gedränge der verschwitzten und erhitzten Leiber machte es mir beinahe unmöglich, zu ihm zu gelangen. Noch immer spielten Ligeia‘s Death dasselbe Stück, und die Musik hatte einen schamanischen Charakter, so als wolle sie das Publikum in einen Trancezustand versetzen.
Die Tänzer in der Mitte des Saales bewegten sich in Ekstase. Nicht so der Junge. Er stand reglos da und verfolgte das Konzert. Seine traurigen Augen schienen ins Nichts zu blicken, als befinde er sich in einer anderen Welt. Er wirkte so zerbrechlich wie eine Eisblume am Fenster in einer frostkalten Winternacht.
Wie unter Zwang trat ich näher an ihn heran und hob, ohne zu überlegen, meine Spiegelreflexkamera. In diesem Moment trafen sich unsere Blicke. Diese Augen … Ich werde sie in meinem Leben nicht vergessen. Aus ihnen sprach das Leid einer gequälten Seele. Die Gitarre heulte ein letztes Mal passend dazu auf, dann ertönte eine mörderische Rückkopplung, und das Stück war vorbei. Ich drückte auf den Auslöser der Kamera.
Als ich den Film weiterspulte, war der Junge verschwunden, so als habe er sich einfach in Luft aufgelöst. Wohin konnte er so schnell gegangen sein? Ich drängte mich zum Ausgang und lief hinaus auf die Straße. Ein kicherndes Pärchen aus einem der benachbarten Clubs kam vorbei, doch von dem Jungen war nichts zu sehen. Also musste er noch drinnen sein.
Als ich zurückkehrte, wurde mir bewusst, wie stickig und laut es im Konzertraum war. Ich zwängte mich zwischen schwitzenden Besuchern hindurch und erntete ärgerliche Kommentare. Den Jungen aber sah ich nicht mehr. Ich ging zur Bar und bestellte ein Bier, und während ich es in großen Zügen trank, versuchte ich mir darüber klar zu werden, was mich an dieser Begegnung so sehr beschäftigte. Ich hoffte, dass auf dem Foto, das ich geschossen hatte, überhaupt etwas zu erkennen war.
Es war bereits vier Uhr morgens, als ich zu meiner Wohnung gelangte. Obwohl mich eine unwiderstehliche Müdigkeit befiel, bereitete ich die für die Entwicklung notwendigen Chemikalien vor und nahm bei Rotlicht den erst halbvollen Film aus der Kamera. Ich fieberte der Entwicklung entgegen. Als ich die tropfnassen Bilder an einer Schnur aufhängte, die ich zwischen zwei Reißbrettstiften gespannt hatte, zeigten sie zuerst nur verschwommene Schemen. Ich verließ meine provisorische Dunkelkammer für die Dauer einer Zigarette, dann kehrte ich zurück und nahm die fertig entwickelten Bilder ab.
Als ich den letzten Abzug betrachtete, fühlte ich mich, als werde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Alle Bilder waren gelungen, bis auf das von dem Jungen. Ich hatte wie gewöhnlich ohne Blitz fotografiert. Der Film, den ich bei Konzerten benutzte, war hochempfindlich. Aber es war wohl doch zu dunkel gewesen. Die Auflösung war sehr grobkörnig. Das Bild zeigte lediglich eine graue Gestalt fast ohne Gesichtszüge. Es war, als hätte ich einen Geist fotografiert. Wie bei einer Doppelbelichtung schimmerten die Umrisse anderer Konzertbesucher durch den halbstofflichen Körper des Jungen hindurch.
Im Licht des nächsten Morgens wirkte die Fotografie nicht mehr ganz so unheimlich. Noch immer waren die Gesichtszüge verschwommen, aber die starke Ähnlichkeit mit Ian Curtis war nicht zu leugnen, besonders, wenn man zusätzlich Gestik und Mimik berücksichtigte.
Ein Blick auf die Uhr machte mir deutlich, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb, meinen Artikel zu schreiben. Das Honorar brauchte ich dringend, um in den nächsten Tagen über die Runden zu kommen. Obwohl ich mich noch genau an das Set von Ligeia‘s Death erinnerte, fiel es mir schwer, mich auf das Schreiben zu konzentrieren. Stattdessen starrte ich immer wieder auf die verwischte Fotografie.
Dichtes Schneetreiben hatte eingesetzt, und ich sehnte mich nach einem Spaziergang im Park. Die Flocken waren dick und feucht. Sobald sie den Boden berührten, vergingen sie. Die Sonne erhob sich langsam über den grauen, fast unbewohnbar gewordenen Häuserblocks der Londoner Vorstadt. Es waren Geisterhäuser, die niemandem mehr gehörten. Ein Nachbar, der noch eines dieser Löcher bewohnte, hatte mir eines Tages einige der leer stehenden Wohnungen gezeigt. Schimmel zog sich vom Fußboden bis zur Decke. Tapeten hingen in langen Bahnen herab, und in den Bädern fielen die Kacheln von den Wänden. So, wie diese verlassenen Ruinen aussahen, fühlte ich mich tief in meinem Inneren. Ähnlich musste sich auch Ian Curtis am Tag seines Todes gefühlt haben. Doch wenn ich den Redaktionsschluss verpasste, würde ich nicht einmal die Miete für das Loch, das ich bewohnte, bezahlen können. Also schrieb ich: LIGEIA’S DEATH ‒ Die Geburt einer düsteren Rocklegende. Ich brauchte mehr als zwei Stunden für den Artikel, der im Heft schließlich nicht mehr als eine halbe Seite einnehmen würde, und ich hatte das Gefühl, der Band doch nicht gerecht geworden zu sein. Andererseits war es schon ein Zugeständnis des Herausgebers, dass er im Hades-Magazin einer so unbekannten Band überhaupt Platz einräumte.
Als ich fertig war, zog ich die Datei auf einen USB-Stick und machte mich auf den Weg in die Stadt. In einer Konservendose auf dem Tisch fand ich zwischen alten Rasierklingen, Heftzwecken und verbogenen Büroklammern Geld für eine Fahrkarte ins Stadtzentrum.
Je näher mich der Bus der Innenstadt brachte, desto farbenfroher und belebter wurde die Welt vor den Fenstern. Das letzte Stück musste ich zu Fuß zurücklegen. Die Redaktion des Hades lag in einer unscheinbaren Nebenstraße zwischen Strand und Holborn. Redaktion, das klang reichlich hochgestochen. Im Grunde genommen wurde das Magazin von nur drei Leuten produziert, die von einem Heer unterbezahlter Schreiber wie mir mit Material versorgt wurden. Die Honorare waren ein Witz, und als Autor wurde man wie der letzte Dreck behandelt, während gleichzeitig die großen Labels als Anzeigenkunden hofiert wurden.
Die alberne Leuchtreklame mit der Fledermaus hing schief über dem schäbigen Eingang des Gebäudes, in dessen erstem Stock das Hades vier Räume angemietet hatte. Im Hauseingang lungerte zwischen aufgeplatzten Mülltüten ein Obdachloser herum, der mich um ein paar Pennys anschnorrte. Ich hatte jedoch leider nichts zu verschenken und zwängte mich durch die enge Lücke ins Treppenhaus. Vorbei an aufgebrochenen Briefkästen, und vorbei an mit obszönen Graffitis verschmierten Wänden, gelangte ich zu dem dämmerigen Flur, der die Redaktionsräume miteinander verband. Einer der Mitarbeiter kam mir entgegen und gab mir durch ein Handzeichen zu verstehen, dass der Chef heute keine besonders gute Laune hatte. Ich kannte Martin Byrd eigentlich gar nicht anders, er war stets ein missgelaunter Mensch.
Vorsichtig klopfte ich an. Es vergingen einige Sekunden, bis sein ungehaltenes „Herein!“ erklang. Ich öffnete die Tür und betrat das Büro. Die Wände waren mit stark vergilbten Postern bedeckt. Billige Regale bogen sich unter dem Gewicht von Manuskripten, Druckvorlagen und ungehörten CDs.
Martin Byrd drückte eine Kippe in dem überquellenden Totenkopfaschenbecher neben dem Telefon aus. Er nahm einen Schluck Kaffee aus dem schmuddeligen Becher mit aufgedrucktem Hades-Logo und warf mir einen missbilligenden Blick zu. Seine Laune war deutlich im Keller. Er fuhr sich mit seinen kurzen Fingern durch sein Haar, das weder grau noch richtig blond war. „Bat! Sind deine Beiträge für die neue Ausgabe fertig?“, blaffte er mich ohne Begrüßung an.
Ich nickte wortlos und schob ihm meine Fotos und den USB-Stick über den Schreibtisch.
Er blätterte das Material durch. Seine Miene entspannte sich erst, als er die ausdrucksstarken Schwarzweiß-Fotografien von Ligeia‘s Death sah. „Schön! Ich glaube zwar nicht, dass es die Band jemals zu was bringt, aber … Naja.“
Ich spürte die hintergründige Verachtung in seinen Worten.
Da ich keine Anstalten machte, sein Büro zu verlassen, sah er mich verwundert an. „Ist noch was?“
„Ich … Ich brauche einen Vorschuss“, stammelte ich.
„Einen Vorschuss?“ Er knurrte ungehalten. „Wofür denn? Hierfür etwa?“ Er wedelte mit meinen Fotos in der Luft. Dann fragte er lauernd: „Wie viel?“
Ich hasste mich dafür, dass ich auf das Geld so dringend angewiesen war. „50 Pfund. Die Miete …“
„Die Miete, ja, die Miete. Es ist ja immer irgendwas. Aber okay.“ Er dehnte das letzte Wort, als müsse er sich diese immense Summe geistig vor Augen führen. Dann griff er in eine Schublade und entnahm ihr einige Scheine. „Vor Monatsende gibt’s aber keine Sonderzahlungen mehr.“
„Ja, natürlich!“ Ich verließ das Büro fluchtartig. Auf der Straße atmete ich tief ein. Geschafft! Ich konnte meine Schulden bezahlen und hatte sogar noch etwas Geld übrig. Mit einem Mal war ich in Hochstimmung. Spontan beschloss ich, am Abend ins Batcave zu gehen.
2. Kapitel: Heart & Soul
Von der belebten Charing Cross Road zum Eingang des Batcave führte lediglich ein schmaler Durchgang. Der Club befand sich im Keller, und der Hinterhof, zu dem es eine weitere Zufahrt über den Soho Square gab, war von hohen Häusern mit rußgeschwärzten Fassaden umsäumt. Als das ursprüngliche Batcave im Juli 1982 in der Dean Street geöffnet hatte, um der alternativen Szene Londons ein neues Zuhause zu geben, war ich noch nicht geboren.
Es war ein Schmelztiegel für Rocker und Punks geworden, und irgendwie war aus deren Lebensgefühl zusammen mit dem Look aufstrebender Bands wie Bauhaus und Siouxsie & the Banshees eine neue Moderichtung entstanden, die man zuerst als New Wave, später dann als Gothic bezeichnete.
Nach mehreren Ortswechseln und einer Englandtournee hatte der Club allmählich an Glanz verloren und war Mitte der 1980er Jahre einfach verschwunden. Der Eingang des wieder auferstandenen Batcave glich einem schwarzen, weit geöffneten Maul, und als ich eintrat, wurde ich davon verschlungen. Ein schwach beleuchteter Gang endete an einer steil nach unten führenden Treppe. Die Wände hätten dringend eines Anstrichs bedurft. Zerdrückte Bierdosen lagen in den Ecken. Vor der Kasse hatte sich eine Schlange gebildet. Der niedrige Eintrittspreis und das moderne Gothic-Styling des Ladens lockten selbst in der übersättigten Londoner Szene ein außergewöhnlich zahlreiches Publikum an.
Das neue Batcave orientierte sich zwar an seinem legendären Vorläufer, begnügte sich aber nicht damit, ihn zu imitieren, sondern griff bei der Innenausstattung auf die Requisiten diverser Filmstudios zurück. Sargförmige Tische, lebensgroße Aufsteller aus Filmen wie Van Helsing und Addams Family sowie Plakate alter Horrorklassiker gehörten ebenso zur Einrichtung wie eine mit Marmorplatten verkleidete Wand gegenüber der Bar, die wie eine Gruft die Namen der Bands trug, die hier aufgetreten waren.
Die Luft in den unterirdischen Räumen war bereits jetzt zum Schneiden dick. Ich arbeitete mich durch die dicht gedrängt stehenden Besucher zur Bar vor und hoffte, dass ich von Eric Grease verschont bliebe. Er schrieb wie ich für Hades, war dort allerdings mehr oder weniger fest angestellt, und es war eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen uns, dass wir an unterschiedlichen Tagen hierherkamen. Ich konnte ihn nicht ausstehen, und ich wusste, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte.
Ich war froh gewesen, als mit dem Batcave vor einigen Monaten ein Club geöffnet hatte, in dem genau meine Musik gespielt wurde. Hier konnte ich wirklich entspannen. Ich setzte mich auf einen der Barhocker und gab meine Bestellung auf. Von Eric war glücklicherweise nichts zu sehen. Die Bedienung schien sich an mich von einem meiner früheren Besuche zu erinnern. Sie war eines jener hübschen jungen Dinger, die alle mehr oder weniger wie Betty Page aussahen. Zufällig hatte ich mitbekommen, dass sie Suzanne hieß. Ich überlegte, ob ich ihr ein Kompliment machen sollte. Ein Teil von mir hätte sich gerne mit jemandem unterhalten, aber ein anderer Teil wollte einfach in Ruhe gelassen werden. Es war der knurrige Steppenwolf in mir, der seine Wunden leckte. Wenn ich in den fleckigen Spiegel hinter der Theke blickte, sah ich zwischen Gin- und Whiskey-Flaschen sein Antlitz. Das Vierteljahrhundert seines Lebens hatte Spuren hinterlassen, und in seine Züge hatten sich die zahlreichen Entbehrungen eingegraben, doch in seinen Augen glomm noch immer jenes rebellische Feuer. Sein Haar war schwarz und struppig, wie das Fell eines alten Wolfes. Es entsprach keineswegs dem gängigen Schönheitsideal, aber es besaß Charakter.
Ich drehte mich vom Spiegel fort. Dies war einer jener Tage, an denen sich mir die Welt in ihren dunkelsten Farben zeigte. Irgendwann hatte ich begonnen, dieses Leben einfach nur noch zu hassen. Ich gab den Hass, den ich selbst erfuhr, an andere zurück. Doch dadurch änderte sich nichts. Mir war bewusst, dass all die Leute, die sich hier herumdrückten, ähnlich fühlen mussten. Sie hielten sich für Individualisten, doch sie waren im Grunde genommen genauso einsam wie ich. Menschen, die nach etwas suchten, das in dieser Welt nicht mehr vorhanden war. Wahre, bedingungslose Liebe.
Ich nahm einen tiefen Schluck aus meinem Glas und überlegte, ob ich ein zweites Bier bestellen sollte. Ich war in der Stimmung, meinen Weltschmerz zu ertränken. In diesem Moment fühlte ich, dass ich beobachtet wurde, und zwar durch den Spiegel, in dem ich eben noch mich selbst gesehen hatte. Es war eine Frau. Ihre grünen, von dunkler Schminke umrandeten Augen reflektierten das Licht. Ihre schwarzen Haare waren im Siouxsie-Look der frühen Achtzigerjahre geschnitten. Dazu passte auch ihre Kleidung, die sowohl Punk- als auch Gothic-Elemente in sich vereinte. Sie war vermutlich nur wenige Jahre jünger als ich. Ich drehte den Kopf in dem Augenblick, als sie hinter mich trat.
„Hi!“ Sie lächelte zurückhaltend.
Ich brachte keinen Ton heraus. Komm, Bat, sag etwas! Der Wolf in mir witterte seine Chance. Lass dir etwas Nettes einfallen! „Hi!“, sagte ich und rückte ein Stück beiseite. Sollte ich sie auf einen Drink einladen? Nein, das war zu abgedroschen. „Hab dich hier noch nie gesehen.“
„Na, dann scheinen wir uns immer verpasst zu haben. Bin jede Woche hier.“ Sie zündete sich eine Zigarette an.
Die Flamme des Feuerzeugs blendete mich für einen Moment. Faszinierend, wie sie die Zigarette in ihren langen Fingern hielt, und wie elegant ihre Bewegungen waren. Die Fingernägel waren glänzend schwarz lackiert, ihre Hände steckten in Netzhandschuhen, die ihr bis zu den Ellenbogen reichten. „Okay, das ist eigentlich nicht mein Tag. Ich komme immer freitags her.“ Sie war wohl erst Anfang Zwanzig, auf keinen Fall viel älter, und ihr Körper strahlte die Zerbrechlichkeit von schwarzem Glas aus. Ich überlegte noch fieberhaft, wie ich das Gespräch in Gang halten konnte, als sie mir zuvorkam.
„Ich heiße Myriam.“
„Mark. Mark Fate. Aber meine Freunde nennen mich Bat.“
„Mark Fate, interessanter Name.“ Sie streckte mir die Hand entgegen.
Ich ergriff sie und drückte sie leicht. Einerseits verfluchte ich die Musik, die so laut war, dass ich beinahe schrie, damit sie mich verstehen konnte, andererseits zwang sie Myriam so nah an mich heran, dass ich ihr Parfüm riechen konnte. Patchouli. Ich liebte diesen Duft! Allmählich spürte ich die Wirkung des Alkohols in meinem Körper. Er machte mich mutiger. „Darf ich dich einladen?“
„Ja, gerne!“ Sie strahlte.
Die Bedienung war nach wie vor sehr beschäftigt. Es dauerte eine quälend lange Zeitspanne, bis sie meine Bestellung aufnahm. „Noch ein Bier, und einen …?“
„Für mich einen Wodka-O“, fügte Myriam mit einem entschuldigenden Lächeln hinzu.
Cocktails waren auch im Batcave unverschämt teuer. Suzanne brachte unsere Getränke rasch. Irrte ich mich, oder sah sie ein bisschen eifersüchtig aus?
Myriam schien davon nichts zu bemerken. Sie bedankte sich bei mir. „Und was machst du, wenn du nicht gerade im Batcave abhängst?“, fragte sie nach dem ersten Schluck.
„Offiziell studiere ich Soziologie“, antwortete ich. „Aber ich bin ziemlich raus. Weiß nicht, ob ich überhaupt wieder den Anschluss finde. Ehrlich gesagt, ist mir Musik viel wichtiger.“
„Du spielst in einer Band?“
„Nein, nein. Ich arbeite seit einiger Zeit als freier Journalist beim Hades-Magazin. Ich mache die Interviews mit Newcomern.“
„Wow, das klingt super spannend!“, platzte es aus Myriam heraus. Ihr Interesse klang echt.
„Und du?“
„Ach …“ Sie sank in sich zusammen. „Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht. Zuerst habe ich einige Semester Kunst studiert, dann Literatur. Eigentlich geht es mir ähnlich wie dir. Momentan halte ich mich mit einem Job in der Wäscherei über Wasser. Das Trostloseste, was du dir vorstellen kannst. Den ganzen Tag über muss ich mich verstellen, um nicht zu sehr anzuecken. Deshalb genieße ich die Abende im Batcave so sehr.“
Das konnte ich ihr nachempfinden. Im Grunde genommen war das Batcave nur der Versuch, eine längst verlorene Zeit zurückzuholen. Eine verheißungsvolle, bessere Zeit, die es in der Wirklichkeit leider nie gegeben hatte.
Bevor ich etwas dazu sagen konnte, kam vor der Tanzfläche Bewegung auf.
„Weißt du was davon, dass heute ’ne Liveband spielt?“, wollte Myriam wissen.
„Nee, scheint aber so.“ Ich hatte die Jungs, die sich mit ihren Keyboards und Verstärkern durch das Publikum drängten, noch nie hier gesehen. Einzelne Protestrufe ertönten, und zwei Ordner mussten unterstützend eingreifen, um den Weg freizuräumen. Die Tanzfläche wurde zur Bühne umgebaut, elektronische Instrumente verkabelt, Endstufen und Monitore herangeschafft. Dann genügte der Band ein kurzer Line Check. Kurz darauf wallte Kunstnebel mit dem typischen Vanillearoma auf, die Konservenmusik verstummte. Auf der Bühne nahmen vier Gestalten ihre Position ein.
Myriam rutschte von ihrem Barhocker und setzte sich in Richtung Bühne in Bewegung. Na toll, dachte ich. Und schon bist du abgemeldet!Sie drehte sich nicht einmal nach mir um, um zu sehen, ob ich ihr folgte. Hinterherlaufen wollte ich ihr nicht. Ich trank mein Bier in Ruhe leer und näherte mich ihr dann bis auf wenige Schritte. Auf der Bühne brach die Hölle los. Der Krach, den die vier erzeugten, erinnerte mich an einen schrägen Mix aus Whitehouse und Throbbing Gristle. Die Mikros fiepten, und der Sänger, ein hochgewachsener Kerl mit Ledermantel und Sonnenbrille, brüllte sich die Seele aus dem Leib, während die analogen Synthesizer eine Mauer aus rauschendem, ratterndem Lärm erzeugten, die nur vom Pulsieren eines Sequenzers unterbrochen wurden. Gelegentlich bearbeitete einer der Musiker eine Öltonne und verschiedene Metallplatten mit einem Hammer. Die Musik war wahnsinnig laut.
Ich war heute nicht in der richtigen Stimmung für einen solchen Lärm. Zudem war ich sogar eifersüchtig auf die Band, die diese faszinierende Frau offenbar spannender fand, als die schleppende Unterhaltung mit mir. Ich war verärgert, dass der Abend, der so hoffnungsvoll begonnen hatte, nun so unspektakulär zu enden schien. Aber auch beim restlichen Publikum kam die Musik nicht so gut an. Zu viele Bands hatten schon lange vorher einen ähnlichen Sound gemacht; damit setzte man heutzutage einfach keine neuen Akzente mehr.