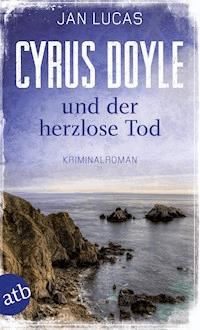8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cyrus Doyle ermittelt
- Sprache: Deutsch
Cyrus Doyle wird auf der Straße von einem Fremden um Hilfe gebeten. Sein Sohn wurde wegen des Mordes an seiner Geliebten verhaftet – zu Unrecht, wie sein Vater glaubt. Als einige Leute Cyrus Doyle dazu bewegen wollen, den alten Fall nicht neu aufzurollen, wird er misstrauisch. Seine Nachforschungen führen ihn hinein in die Vergangenheit der Guernsey Police und decken jahrelang gehütete Geheimnisse auf. Bei den Ermittlungen steht ihm seine Kollegin Pat zur Seite – bis sie plötzlich spurlos verschwindet …
Chief Inspector Cyrus Doyle – charismatisch und eigenwillig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Jan Lucas
Jan Lucas ist das Pseudonym eines Autors zahlreicher erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Er lebt in Deutschland, hält sich aber immer wieder gern auf der Kanalinsel Guernsey auf.
Informationen zum Buch
Chief Inspector Cyrus Doyle – charismatisch und eigenwillig
Cyrus Doyle wird auf der Straße von einem Fremden um Hilfe gebeten. Sein Sohn wurde wegen des Mordes an seiner Geliebten verhaftet – zu Unrecht, wie sein Vater glaubt. Als einige Leute Cyrus Doyle dazu bewegen wollen, den alten Fall nicht neu aufzurollen, wird er misstrauisch. Seine Nachforschungen führen ihn hinein in die Vergangenheit der Guernsey Police und decken jahrelang gehütete Geheimnisse auf. Bei den Ermittlungen steht ihm seine Kollegin Pat zur Seite – bis sie plötzlich spurlos verschwindet …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jan Lucas
Cyrus Doyle
und das letzte Vaterunser
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Jan Lucas
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Tag: Dienstag, 14. Oktober
Kapitel 1
Zweiter Tag: Mittwoch, 15. Oktober
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Dritter Tag: Donnerstag, 16. Oktober
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Vierter Tag: Freitag, 17. Oktober
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Fünfter Tag: Samstag, 18. Oktober
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Drei Tage Später: Dienstag, 21. Oktober
Epilog
Impressum
Für meine wundervolle Frau – danke für Anteilnahme, Ermutigung und Unterstützung
GUERNSEY
Erster Tag Dienstag, 14. Oktober
Kapitel 1
Nichts deutete auf den ungewöhnlichen Vorfall hin, der sich in weniger als fünf Minuten mitten im Zentrum von Guernseys Hauptstadt ereignen sollte. Warmes Sonnenlicht und blauer Himmel ließen die Straßen von St. Peter Port aussehen wie im Hochsommer, als Detective Chief Inspector Cyrus Doyle und Detective Inspector Patricia Holburn das aus grauem Guernseygranit errichtete Gerichtsgebäude verließen, die ebenfalls grauen Treppenstufen zur Rue du Manoir hinuntergingen und sich nach links wandten. Die Wärme der Mittagssonne war deutlich zu spüren, und Doyle streifte die Jacke seines anthrazitfarbenen Anzugs ab, um sie sich lässig über die Schulter zu werfen. Pat trug einen Hosenanzug in einem fast identischen Farbton, als hätten sie sich abgesprochen. Sie beide hatten heute im Pfeilmörderprozess, wie die Medien es nannten, ausgesagt, und Doyle war zufrieden mit dem Fortgang des Verfahrens. Es lief ganz offensichtlich auf eine Verurteilung in dem ersten Mordfall hinaus, den Doyle als DCI auf Guernsey aufgeklärt hatte. Ihm war sehr daran gelegen, auch aus persönlichen Gründen.
Doyle schüttelte die Gedanken an das Vergangene ab und schloss zu Pat auf, die zügig ausschritt und schon fast die Kreuzung erreicht hatte. Wären sie geradeaus in die Hirzel Street gegangen, hätte sie das zum Polizeihauptquartier geführt, aber das war nicht ihr Ziel.
»Du hast aber ein ganz hübsches Tempo drauf, Pat.«
Sie wandte den Kopf zur Seite und sah ihn lächelnd an. Auch wenn es nur ein kollegiales Lächeln war, ging ihm dabei das Herz auf.
»Ich habe Hunger, Cy. Und wenn ich dich vorhin in der Verhandlungspause richtig verstanden habe, hast du mich zum Mittagessen bei Christie’s eingeladen.«
»Das hast du«, bestätigte Doyle. »Ich finde, wir haben uns eine Stärkung mehr als verdient.«
Nebeneinander gingen sie die Smith Street hinunter in Richtung High Street, inmitten von Geschäftsleuten in dunklen Anzügen und Flaneuren, die für den goldenen Oktober noch einmal ihre leichte Sommerkleidung aus dem Schrank geholt hatten.
»Viel los heute«, stellte Pat dann auch fest. »Vielleicht hätten wir einen Tisch reservieren sollen.«
»Für zwei Personen auf der Terrasse mit Meerblick.«
»Ganz genau.« Pat blieb abrupt stehen und starrte ihn an. »Hast du etwa …«
Er nickte.
»Ich habe.«
»Wann hast du bei Christie’s angerufen?«
»Heute Morgen, gleich nach dem Wetterbericht.«
»Aber da hattest du mich noch gar nicht gefragt.«
Doyle lächelte wie ein ertappter Sünder.
»Da habe ich wohl einfach auf mein Glück gehofft.«
Sie setzten ihren Weg fort, und schon zwanzig Sekunden später wusste Doyle, dass sein Glück ihn verlassen hatte. Es würde nichts werden mit dem Lunch bei Christie’s, mit dem Tisch auf der sonnenüberfluteten Terrasse, mit der Aussicht auf den Hafen von St. Peter Port, mit einer entspannten Stunde zusammen mit Pat. Er wusste es in dem Moment, als sein Blick den eines Mannes im teuren Nadelstreifen-Dreiteiler kreuzte. Wahrscheinlich Mohair, dachte er. Der Mann war groß, um die fünfundfünfzig und schlank. Das sorgfältig geschnittene Haar war dunkelbraun, an den Schläfen schon grau. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, wie es an dem internationalen Finanzplatz Guernsey so viele gab, vermutlich mit einer leitenden Position im Bank- oder Versicherungswesen. Der Mann starrte Doyle an wie hypnotisiert und trat dann mit langsamen Schritten auf ihn zu.
Doyle war seit mehr als zwanzig Jahren Polizist. Er spürte, dass der Unbekannte etwas von ihm wollte, aber er spürte genauso, dass von ihm keine Gefahr ausging. Kannten sie sich vielleicht von früher? Doyle überlegte scharf, aber ihm wollte nichts einfallen.
Da hatte der Mann im feinen Zwirn ihn und Pat auch schon erreicht und sank zu Doyles Verwunderung vor ihm auf die Knie. Notgedrungen blieb Doyle stehen, Pat ebenso. Auch einige Passanten hielten an, weil die merkwürdige Szene ihre Neugier geweckt hatte. Doyle bemerkte das nur am Rande, sein Blick war auf das längliche Gesicht des Unbekannten gerichtet, und in dessen Zügen las er pure Verzweiflung.
Seinen Blick unverwandt auf Doyle geheftet, faltete der andere die sehnigen Hände wie zum Gebet und sagte mit zittriger Stimme: »Haro! Haro! Haro! A l’aide, mon Prince, on me fait tort.«
Auch wenn Doyle nicht so gut französisch gesprochen hätte, hätte er die Bedeutung dieser Worte gekannt wie jeder, der auf Guernsey zur Schule gegangen war: »Hör mich an! Hör mich an! Hör mich an! Komm mir zu Hilfe, mein Prinz, weil mir ein Unrecht angetan wird.«
Für einen Augenblick war Doyle, als schwankte der Boden unter seinen Füßen. Er fühlte sich um Jahrhunderte in die Vergangenheit versetzt. In jene Zeit, als der Clameur de Haro, den der Fremde an ihn richtete, noch häufig gebraucht wurde. Es war ein altes normannisches Recht, das auf den Kanalinseln galt, da sie einmal zum Herzogtum Normandie gehört hatten. Das Recht eines Menschen, dem Unrecht getan wird und der keine andere Möglichkeit mehr sieht, als sich mit der Bitte um Aufschub und Hilfe an seinen Prinzen zu wenden. Ein Recht, das man oft auch als das letzte Vaterunser bezeichnete, weil zum Erbitten der letztmöglichen Hilfe auch das Aufsagen des Vaterunsers auf Französisch gehörte.
Und genau das tat der Unbekannte jetzt: »Notre Père qui est aux cieux. Ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal.«
Aber das war noch nicht alles, wie Doyle aus seiner Schulzeit wusste. Auf Guernsey war ein Clameur de Haro erst dann wirksam, wenn sich an das Vaterunser ein französisches Gnadengebet anschloss.
Da fuhr der kniende Mann vor ihm auch schon fort: »La Grâce de Notre Seigneur Jésus Christ, la dilection de Dieu et la sanctification de Saint Esprit soit avec nous tous éternellement. Amen.«
Inzwischen hatte sich eine dichte Menschentraube um Doyle, Pat und den Unbekannten gebildet. Die Leute hatten Handys und Kameras gezückt, um die ungewöhnliche Szene festzuhalten. Für all das hatte Doyle nur einen kurzen Blick übrig, dann sah er wieder den verzweifelten Mann, der immer noch vor ihm kniete und dem jetzt Tränen über die Wagen liefen.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?«
Das Einzige, was der Mann über die Lippen brachte, waren ein paar gestammelte Worte: »Helfen … Sie mir … bitte …« Dann versagte ihm die Stimme, und er begann zu schluchzen.
Pat legte eine Hand auf Doyles Schulter und sagte leise: »Ich fürchte, Cy, du hast jetzt mächtig Ärger am Hacken.«
Verwundert blickte er Pat an.
»Du kennst den Mann?«
Sie nickte.
»Wie wohl jeder Polizist auf Guernsey. Außer dir, weil du da noch in London warst. Vor dir kniet Julian Prideaux, der unglücklichste Mann auf der ganzen Insel.«
Prideaux! Doyle hatte den Namen schon gehört, erinnerte sich aber nicht, in welchem Zusammenhang. Die anschwellende Menschenmenge um sie herum, Dutzende und Aberdutzende von neugierigen Blicken, das unaufhörliche Klicken der Kameras – all das ging ihm auf die Nerven, widerte ihn geradezu an, als sein Blick auf den verzweifelten Mann fiel, dem Tränen in den Augen standen.
Noch hatte Doyle nicht die geringste Ahnung, was dieser Julian Prideaux von ihm wollte und ob er ihm helfen konnte. Aber eins wusste er: Sie mussten ihn von hier wegschaffen, so schnell wie möglich.
Kaum eine Viertelstunde später waren sie der aufdringlichen Menge entkommen, und Julian Prideaux saß im Besprechungsraum des Kriminaldienstes, von der stets aufmerksamen Mildred Mulholland mit Tee und Sandwiches versorgt. Doyle hatte ihm versprochen, ihn gleich anzuhören, aber vorher war er mit Pat in sein Büro gegangen und hatte sie gefragt, wer dieser Mann sei.
»Aus welchem Grund ist er so verzweifelt?«
Doyle hatte schon einiges im Polizeidienst erlebt, aber er war nicht abgebrüht. Der Vorfall mit Mr Prideaux hatte ihn verstört, und dieses Gefühl dauerte an.
»Es geht um seinen Sohn«, erklärte Pat. »Er sitzt seit ein paar Monaten im Gefängnis, lebenslänglich. Der letzte Mordfall, den Charlie Mourant aufgeklärt hat.«
Doyle erinnerte sich an ein Gespräch mit Charlies Frau Barbara. Sie hatte einen jungen Mann namens Prideaux erwähnt.
»Cameron Prideaux, nicht wahr? Er soll seine Freundin ermordet haben, wenn ich mich nicht täusche.«
»Ja, Cameron heißt der Sohn. Und er hat seine Freundin getötet, Anne Corbin. Jedenfalls hat das Gericht ihn für schuldig befunden und wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt.«
»Wann war das?«
»Der Mord geschah am dritten Januar dieses Jahres, im März fiel das Urteil.«
»Dann habt ihr nicht lange zur Aufklärung gebraucht. Oder war Prideaux junior von Anfang an geständig?«
»Im Gegenteil, er hat die Tat bis zum Schluss geleugnet.«
»Aber ihr habt ihn festgenagelt?«
»Sagen wir, Charlie hat ihn an der Angel gehabt und ihn so lange zappeln lassen, bis er reif war, sich von DCI Mourant pflücken zu lassen.«
Doyle horchte auf.
»Höre ich da einen missbilligenden Ton heraus? Warst du nicht einverstanden mit Charlies Vorgehen?«
»Ich an seiner Stelle hätte mir etwas mehr Zeit gelassen.«
»Warum? Die Beweise gegen Cameron Prideaux haben offenbar ausgereicht, um das Gericht zu überzeugen.«
»Davon spreche ich nicht. Ich hätte auch in andere Richtungen ermittelt, aber Charlie hat das nicht zugelassen. Für ihn stand von vornherein fest, dass der junge Prideaux der Täter ist.«
»Gab es denn andere Richtungen, in die man hätte ermitteln können?«
Pat hob seufzend die Schultern und ließ sie wieder sinken.
»Wie gesagt, Charlie hat die Ermittlungen mit sehr strenger Hand geführt.«
»Verstehe«, murmelte Doyle, dem die Sache in Wahrheit eher nebulös erschien. »Aufgrund welcher Beweise wurde Cameron Prideaux verurteilt?«
»Nennen wir es lieber Indizien«, sagte Pat und versank für einen Augenblick in Gedanken, um sich den Fall noch einmal vor Augen zu führen. »Es hat Streit gegeben zwischen Cameron Prideaux und Anne Corbin, mächtigen Streit. Er hatte sie in Verdacht, eine Affäre mit einem anderen zu haben, vermutlich einem wohlhabenden Mann, älter als sie.«
»Wie kam er darauf?«
»Anne kam aus eher einfachen Verhältnissen. Ihre Eltern lebten getrennt, und sie wohnte bei ihrer Mutter. Liz Corbin hatte ein gutes Einkommen als Sekretärin in einem Maklerbüro, konnte sich aber keine großen Sprünge leisten. Der Vater hatte sich schon vor ein paar Jahren nach Neuseeland abgesetzt und sich so seiner Unterhaltspflicht entzogen. Er galt damals als nicht auffindbar. Anne hatte einiges an neuem Schmuck und neuer Kleidung, beides nicht von ihrer Mutter bezahlt.«
»Wer hat es bezahlt?«
»Sie selbst, hatte Anne zumindest zu Cameron gesagt. Sie habe ihr Taschengeld eisern gespart und sich hin und wieder durch Aushilfsjobs etwa dazuverdient. Aber Cameron hat ihr das nicht geglaubt. Jedenfalls hat es ein Riesengeschrei gegeben, das war an einem Dienstagnachmittag. Am nächsten Morgen wurde sie tot in einem Waldstück am Portelet Harbour aufgefunden, dem bevorzugten Treffpunkt der beiden. Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich einem Stein.«
»Cameron Prideaux hatte also ein Motiv«, sagte Doyle leise. »Eifersucht, vielleicht auch eine Tat im Affekt. Welche Indizien sprechen noch gegen ihn?«
»Er wurde zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gesehen, in seinem Wagen. Er sagt dazu, er sei in der Gegend herumgefahren, um seine Freundin zu suchen, aber er habe sie nicht gefunden. Er wollte sich angeblich mit ihr aussprechen.«
»Warum hat er sie nicht einfach angerufen?«
»Nach dem Streit hat Anne Corbin seine Anrufe nicht mehr entgegengenommen.«
Doyle setzte eine missmutige Miene auf und sah in Pats leuchtend blaue Augen.
»Ihr Frauen könnt manchmal echt nachtragend sein.«
»Das können wir, wenn wir einen guten Grund dafür haben.«
Pat sagte das ohne jede Emotion, aber beiden war klar, dass sie von sich selbst sprachen. Vor über zwanzig Jahren hatte Doyle Guernsey verlassen und damit auch Pat. Er konnte nicht erwarten, dass sie ihm das verzieh. Und doch hätte er alles darum gegeben.
Er schnippte mit den Fingern, wie um sich aus den eigenen Gedanken zu reißen.
»Also war es ein reiner Indizienprozess, der Cameron Prideaux hinter Gittern gebracht hat.«
»Ja, aber es gab keine anderen Verdächtigen.« Sie zögerte kurz. »Jedenfalls hat Charlie Mourant nicht nach ihnen ermitteln lassen.«
Doyle blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an.
»Zumindest einen gibt es wohl doch!«
Pat war überrascht.
»Von wem sprichst du?«
»Von dem Mann, der Anne Corbin mit Kleidern und Schmuck beschenkt hat. Möglicherweise hatte sie tatsächlich einen wohlhabenden Liebhaber.«
»Sie hat das noch kurz vor ihrem Tod abgestritten«, erwiderte Pat.
»Vielleicht hat sie gelogen.«
»Aber wir haben keine Hinweise auf einen Liebhaber gefunden.«
»Sagtest du nicht eben, Charlie Mourant hätte sich mehr Zeit lassen sollen? Und er habe in keine anderen Richtungen ermittelt?«
»Ja, schon, aber …«
Pat brach mitten im Satz ab und seufzte schwer.
»Aber?«, hakte Doyle nach.
»Du willst doch nicht wirklich DCI Mourants letzten Fall neu aufrollen? Er wurde auf grausame Weise ermordet, und du bist sein Nachfolger. Es würde irgendwie schäbig aussehen, als wolltest du dich auf seine Kosten profilieren.«
»Da hast du recht, Pat, andererseits …«
»… muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss«, beendete sie den Satz. »Richtig?«
»Julian Prideaux hat mich um Hilfe angefleht.«
»Aus seiner Sicht ist das verständlich, aber der Clameur de Haro verpflichtet dich zu nichts. Er hat in der heutigen Zeit kaum noch Gültigkeit, und ganz sicher nicht bei Mordfällen.«
»Hören wir uns doch erst einmal an, was Mr Prideaux uns zu sagen hat«, schlug Doyle vor. »Ich denke, das sind wir ihm schuldig.«
Auf dem Weg in den Besprechungsraum trafen sie Mildred, und Doyle bat sie, ihm alle Unterlagen über den Mordfall Anne Corbin herauszusuchen.
Julian Prideaux wirkte wie ein Häufchen Elend auf ihn. Mit eingefallenen Schultern saß er, in sich zusammengesunken, auf einem Stuhl, das Gesicht grau, die sehnigen Hände ineinander verschränkt, aber immer wieder unruhig zuckend. Von seinem Tee hatte er nur genippt, und die von Mildred liebevoll zubereiteten Sandwiches hatte er gar nicht erst angerührt. Beim Eintreten der beiden Polizisten straffte sich seine Gestalt ein klein wenig. Er blickte Doyle und Pat entgegen, und der Anflug eines Hoffnungsschimmers huschte über seine dunkelbraunen Augen.
»Verzeihen Sie, dass wir Sie warten ließen«, sagte Doyle, als er und Pat ihrem Gast gegenüber Platz nahmen. »Ich wollte mich erst etwas mit der Angelegenheit vertraut machen. Wie Sie wohl wissen, bin ich noch recht neu bei der Guernsey Police.«
Prideaux nickte leicht und sagte mit leiser, aber deutlicher Stimme: »Ich habe mich über Sie erkundigt, Chief Inspector. Ich weiß daher, dass Sie erst vor zwei Monaten auf die Insel gekommen sind. Zurückgekommen, trifft es wohl besser. Sie sind ein echter Gurn, sonst hätte ich mich kaum mit dem Clameur de Haro an Sie gewandt.«
Pat strich eine blonde Haarsträhne aus ihrer Stirn und fixierte Prideaux.
»Wenn Sie so gut informiert sind, Sir, werden Sie auch wissen, dass der Clameur de Haro in der Strafjustiz schon seit langer Zeit keine Anwendung mehr findet.«
Der Mann im Nadelstreifenanzug zuckte mit den Schultern.
»Ich bin ein verzweifelter Mann. Erst die Sache mit Cameron und jetzt auch noch Vera.«
»Vera?«, fragte Doyle.
»Meine Frau.«
»Was ist mir ihr?«
»Sie hätte gestern um ein Haar versucht, sich das Leben zu nehmen.«
Bei diesen Worten klang Prideaux’ Stimme seltsam ruhig, als hätte er einem Geschäftspartner einen Termin bestätigt.
Doyle sah ihn auffordernd an.
»Ja?«
»Ich kam gestern Abend zufällig dazu, als sie im Bad stand und eine ganze Packung Pillen schlucken wollte. Ein starkes Schlafmittel, das ihr unser Hausarzt nach der Sache mit Cameron verschrieben hat. Allerdings mit der Maßgabe, nicht mehr als eine am Tag einzunehmen. Vera ist wohl noch verzweifelter als ich. Ich habe heute Morgen ihre Schwester angerufen, und sie ist jetzt bei meiner Frau. Aber so kann es nicht weitergehen. Es muss etwas geschehen. Und als ich Sie vorhin auf der Straße sah, da …«
Prideaux musste heftig schlucken und sprach nicht weiter.
»Ist Cameron Ihr einziges Kind?«, erkundigte sich Doyle.
»Ja, das macht alles nur noch schlimmer für uns. Besonders für Vera. Ich habe ja noch meinen Job bei English Channel Investments. Aber sie brütet den lieben langen Tag über Camerons Schicksal – über unser Schicksal.«
»Sie beide halten Ihren Sohn für unschuldig?«
»Absolut.«
»Wieso?«
»Weil wir ihn kennen, seit dreiundzwanzig Jahren, seit seiner Geburt. Cameron könnte keinen Menschen töten, schon gar nicht jemanden, den er liebt.«
»Das behaupten die meisten Eltern von ihren Kindern«, sagte Pat. »Und viele haben sich dabei schon geirrt.«
»Vera und ich, wir irren uns nicht!«
»Wenn Sie sich da so sicher sind, weshalb hat Ihre Frau dann anfangs Ihrem Sohn ein falsches Alibi gegeben?« Mit dieser Bemerkung fing sich Pat einen fragenden Blick Doyles ein, und sie fuhr fort: »Vera Prideaux hat gegenüber der Polizei erklärt, ihr Sohn Cameron sei zur Tatzeit bei ihr zu Hause gewesen. Erst als sich mehrere Zeugen meldeten, die ihn zur fraglichen Zeit in der Nähe des Tatorts gesehen hatten, hat sie diese Behauptung zurückgezogen.«
»Eben weil Vera so fest an Camerons Unschuld glaubt, hat sie das gesagt. Für sie, wie auch für mich, ist es einfach unvorstellbar, dass Cameron das getan haben soll.«
Pat wiegte ihren Kopf hin und her.
»Mag schon sein, aber mit dieser Falschaussage hat sie Ihrem Sohn einen Bärendienst erwiesen.«
»Heißt das, Sie wollen nichts für ihn tun?«
»Mr Prideaux, ich werde mir die Akte noch einmal vornehmen«, versprach Doyle. »Aber das bedeutet nicht, dass der Fall neu aufgerollt wird. Es ist vorläufig nur ein informeller Vorgang, nicht mehr. Wenn ich auf etwas Verdächtiges stoße, kann sich das ändern. Kann, verstehen wir uns?«
Prideaux erhob sich schwerfällig, fast wie in Zeitlupe, als müsste er sich gegen eine geradezu erdrückende Last hochstemmen.
»Ich danke Ihnen, Chief Inspector. Ich wusste doch, dass Sie ein echter Gurn sind.«
Doyle blickte ihm nach, als Prideaux den Raum verließ. Er schien etwas Hoffnung geschöpft zu haben, und der Anflug eines schlechten Gewissens beschlich Doyle. Was, wenn er dem Mann ganz zu Unrecht Hoffnung gemacht hatte? Der Umstand, dass Charlie Mourant den Fall zügig abgeschlossen hatte, bedeutete keineswegs, dass er sich in der Person des Täters geirrt haben musste. Ganz im Gegenteil, er war ein erfahrener DCI gewesen und hatte keinen ersichtlichen Grund gehabt, jemanden ans Messer zu liefern, von dessen Schuld er nicht überzeugt gewesen war.
Pat hatte ihn aufmerksam betrachtet.
»Du siehst alles andere als zufrieden aus, Cy. Ich ahne den Grund.«
»Und der wäre?«
»Du hast eine undankbare Aufgabe übernommen. Niemand in der Einheit wird begeistert sein, wenn du an DCI Mourants Denkmal kratzt.«
»Kannst du meine Gedanken lesen?«
»In diesem Fall ist das nicht schwer. Schließlich bin ich auch Polizistin. Wir hätten wohl alle gut auf den Auftritt von Mr Prideaux und auf seinen Clameur de Haro verzichten können, aber besonders du.«
Doyle warf ihr einen fragenden Blick zu.
»Wieso besonders ich?«
»Ich habe den Eindruck, das ist gerade keine einfache Zeit für dich. Auch wenn der Prozess den gewünschten Verlauf nimmt, er ruft doch viele unangenehme Erinnerungen in dir wach. Ich habe es dir während deiner Aussage heute vor Gericht deutlich angesehen. Und jetzt noch Prideaux’ Clameur de Haro …«
»Das ist es nicht allein«, gestand er mit einem Seufzer. »Ich mache mir Gedanken über meinen Vater.«
Der Schatten eines Erschreckens huschte über Pats Gesicht.
»Geht es ihm nicht gut?«
»Nein, das ist es nicht. Aber seine Betreuung ist doch einigermaßen aufwendig und geht mächtig ins Geld, jetzt, wo keine Nachbarin mehr da ist, die sich für ein geringes Entgelt rund um die Uhr um ihn kümmert. Über kurz oder lang muss ich eine andere Lösung finden, besser über kurz.«
»Denkst du daran, deinen Vater in ein Heim zu geben?«
»Natürlich habe ich an diese Möglichkeit gedacht. Dann könnte ich unser Haus verkaufen und mir eine kleine Wohnung nehmen. Das Geld aus dem Hausverkauf dürfte einige Zeit reichen, um den Unterhalt für Dad zu bestreiten.«
»Aber deshalb bist du nicht nach Guernsey zurückgekommen, oder?«
»Ich sage ja, du liest meine Gedanken, Pat. Ich wollte möglichst viel Zeit mit Dad verbringen, mich um ihn kümmern. Deshalb bin ich wieder hier. In unserem alten Haus ist das einfach etwas anderes als in einem Pflegeheim.«
»Weißt du schon, was du machen willst?«
»Nein, ich warte noch auf eine Eingebung.« Doyle straffte sich. »Kommen wir zurück zum Fall Prideaux beziehungsweise zum Fall Corbin. Ich halte es für eine gute Idee, wenn Sergeant Baker und Constable Allisette sich noch einmal sämtliche Akten vornehmen und alles sammeln, was ihnen dabei merkwürdig vorkommt.«
Pat lächelte hintergründig.
»Diese Arbeit werden wir nicht auf die beiden abwälzen können. Sie sind unterwegs. Der Einbrecher von Belle Greve, du erinnerst dich?«
»Natürlich, auch wenn ich es gerade verdrängt hatte. Der Typ, den ihr auch den Monopoly-Dieb nennt. Was genau hat es damit eigentlich auf sich?«
»Vor sechs Jahren gab es eine Reihe von Einbrüchen in Belle Greve. Der Täter nahm nur Bargeld mit, sonst nichts, nicht einmal wertvollen Schmuck oder Uhren. Und er ließ, quasi als Ersatz für das gestohlene Geld, die entsprechende Summe als Spielgeld zurück.«
»Ein Dieb mit Sinn für Humor. Hat er sonst noch etwas hinterlassen, eine Visitenkarte vielleicht?«
»Nein, das nicht.«
»Wäre ja auch zu schön gewesen.« Doyle dachte an die beiden Hauseinbrüche der letzten zwei Tage in der nördlich des Zentrums von St. Peter Port gelegenen Belle Greve Bay. »Und bei den beiden neuen Einbrüchen wurde ähnlich verfahren, ja?«
»Ziemlich ähnlich, um nicht zu sagen, genauso. Wieder wurde nur Bargeld gestohlen, und wieder wurde die entsprechende Summe in Form von Spielgeld zurückgelassen.«
»Geld aus Monopoly-Spielen?«
»Nicht nur, auch aus anderen Brettspielen. Das war schon damals so. Aber die Bezeichnung Monopoly-Dieb hat sich bei uns eingebürgert.«
»Also lautet die Frage: ein und derselbe Täter oder ein Nachahmer?«
»Schon, ja«, sagte Pat zögernd. »Gegen einen Nachahmer spricht aber, dass wir die Sache mit dem Spielgeld nicht publik gemacht haben. Eigentlich weiß nur die Polizei davon.«
»Und wohl auch die damals Geschädigten.«
Pat schnippte mit den Fingern. Stimmt, eine gute Idee. Ich werde das an Baker und Allisette weitergeben. Wäre schon ziemlich kurios, wenn eins der damaligen Opfer jetzt mit derselben Methode auf Diebestour ginge.«
»Wie sagte doch damals, als ich zur Polizei ging, einer meiner Ausbilder: ›Die Kriminalgeschichte ist voll von kuriosen Fällen‹.« Doyle lachte leise, wurde aber schnell wieder ernst. »Und von tragischen, womit wir wieder bei Cameron Prideaux und Anne Corbin wären.«
Sie nahmen sich die Akten vor und – als Ersatz für den ausgefallenen Lunch bei Christie’s – die Sandwiches, die Julian Prideaux nicht angerührt hatte.
Die Sonne war längst im Ärmelkanal versunken, als Doyle nach Hause kam. Nach Hause! Das hatte für ihn, der zweiundzwanzig Jahre in London gelebt hatte, einen besonderen Klang. Er drosselte das Tempo, und die Scheinwerfer seines TVR Tamoras strichen fast andächtig über die halb zerfallene Mauer, die »Le Petit Château« umschloss. Das kleine Schloss, so hatte die Familie Doyle einst, ebenso stolz wie unbescheiden, ihr eindrucksvolles Haus über den Klippen von Guernseys südlicher Küste genannt. Der Brauch, den Häusern eigene Namen zu geben, war auf der Insel weit verbreitet. Und oft waren es französische Namen, da Frankreich viel näher lag als England und da Guernsey lange unter normannischer Herrschaft gestanden hatte. Sonst, schoss es ihm durch den Kopf, hätte es hier auch kein normannisches Gewohnheitsrecht gegeben und keinen Clameur de Haro.
Er lenkte den Tamora durch die Einfahrt und sah, dass mehrere Zimmer beleuchtet waren. Das lag an Ben, dessen Mini Cooper vor dem Haus stand. Früher wäre es abwegig für Doyle gewesen, sich über verschwendetes Geld durch eine unnötige Beleuchtung Gedanken zu machen. Das hatte sich in den vergangenen Wochen geändert. Zum Beispiel durch Ben Everitt, der für einen privaten Pflegedienst arbeitete und nicht an feste Arbeitszeiten gebunden war. Er blieb abends so lange bei Doyles Vater, bis Doyle heimkam, aber das ließ sich der Pflegedienst auch einiges kosten. Dennoch war Doyle froh, Ben angeheuert zu haben. Für den Detective Chief Inspector der Guernsey Police gab es keinen verlässlichen Dienstschluss.
Er fand seinen Vater und Ben vor dem Fernseher, in dem eine Game-Show lief. Leonard Doyle sah zwar auf den Flachbildschirm, wirkte aber geistig abwesend. Ben ließ sich davon nicht entmutigen und animierte Doyles Vater, sich für eine der vorgegebenen Antworten zu entscheiden. Der alte Mann brabbelte etwas, das Doyle nicht verstand.
»Sie meinen also Antwort C, Mr Doyle?«, erwiderte Ben. »Na, wollen mal sehen, ich bin ja mehr für A.«
Doyle machte sich mit einem knappen Gruß bemerkbar und fragte: »Hat mein Vater wirklich C gesagt?«
»Ich glaube, ja, wenn es nicht B oder D war.« Als Ben Doyles in zweifelnde Falten gelegte Stirn sah, fügte er hinzu: »Man muss immer im Gespräch bleiben, das ist der Trick.«
Die richtige Antwort war C, und Leonard Doyle klatschte erfreut in die Hände.
»Also habe ich ihn doch richtig verstanden«, stellte Ben zufrieden fest.
»Und weshalb waren Sie für A?«
»Tja, ein Irrtum. Offenbar kennt sich Ihr Vater mit den Hochwasserphasen der Amazonas-Nebenflüsse besser aus als ich.«
Doyle warf einen irritierten Blick zuerst auf Ben, dann auf seinen Vater.
Ben wuchtete seinen großen, breitschultrigen Körper aus dem Sessel und ging in Richtung Küche.
»Ich mache Ihnen die Reste vom Abendessen warm, Sir. Ihrem Vater und mir hat es gut geschmeckt.«
Doyle sah dem hünenhaften Mann nach und fragte sich zum wiederholten Mal, warum Ben sich ausgerechnet in einen Mini Cooper quetschte.
»Was gibt es denn?«
»Gemüsesuppe mit Rindfleisch, leider nur aus der Dose.«
Doyle sehnte sich für einen kurzen Moment nach Violet Brehauts Kochkünsten zurück, aber das war Vergangenheit.
Er wollte ein Gespräch mit seinem Vater über dessen Tag in Gang bringen, aber Leonard Doyle winkte mit einer seiner knochigen Hände ab und starrte gebannt auf den Bildschirm, wo der auf berufsjugendlich gestylte Moderator gerade nach der Wachstumszeit von Bananen bis zu ihrer Ernte fragte.
»Antwort A: ein Monat. Antwort B: drei Monate. Antwort C: ein Jahr. Antwort D: Bananen werden nicht geerntet, sondern fallen von selbst ab. Entscheiden Sie jetzt!«
»Fallen von selbst ab, dummes Zeug«, murmelte Leonard Doyle.
»Und wie lautet die richtige Antwort?«
»Drei Monate natürlich, Antwort B.«
Da verkündete der Moderator auch schon: »Die richtige Antwort ist B.«
Verwundert rieb Doyle sich den Hinterkopf.
»Woher weißt du so etwas, Dad?«
»Diese Sendungen bilden ungemein, Junge.«
Dieser geistesabwesende Blick trat wieder in die Augen seines Vaters, aber Doyle ahnte, dass er sich vorhin getäuscht hatte. Leonard Doyle war nicht gedanklich abwesend, er konzentrierte sich auf das Fernsehquiz.
Während Doyle aß und dazu ein kühles Randalls Guilty trank – ein Bier, das in St. Peter Port gebraut wurde –, schien sein Vater müde zu werden, und Ben brachte ihn zu Bett. Doyle steckte dem unermüdlichen Pfleger einen Extraschein zu, als sie sich verabschiedeten. Er war wirklich ein guter Mann, und es war ganz bestimmt nicht seine Aufgabe, auch Doyle zu bekochen.
»Falls Sie sich über das Allgemeinwissen Ihres Vaters wundern, Sir«, sagte Ben mit einem breiten Grinsen. »Dieses Quiz wurde schon öfter ausgestrahlt, und Mr Doyle hat es heute mindestens zum dritten Mal gesehen.«
Leicht amüsiert stand Doyle in der offenen Haustür und verfolgte, wie Ben sich in seinen kleinen Wagen zwängte. Wie ein menschliches Taschenmesser, das sich von selbst zusammenklappte.
Sein Vater schlief fest, davon hatte er sich überzeugt, als Doyle vor die Haustür trat und tief durchatmete. Die Luft war überraschend kühl und erinnerte ihn daran, dass es bereits Mitte Oktober war. Tagsüber täuschten die wärmenden Strahlen der Sonne darüber hinweg. Vielleicht half ihm die frische Abendluft dabei, einen klaren Kopf zu bekommen. Er hatte sich zu einem kleinen Spaziergang entschlossen, um das späte Essen zu verdauen und um seine Gedanken zu ordnen, die immer wieder um einen Mann kreisten: Julian Prideaux.
Er ging nur ein kurzes Stück die schmale Straße entlang, dann duckte er sich und zwängte sich durch eine enge Lücke im Gebüsch. Hier war es so dunkel, dass er kaum den Boden erkennen konnte, und er ließ seine kleine LED-Leuchte, die er für den Spaziergang eingesteckt hatte, aufflammen. Der schmale Weg, nicht mehr als ein ausgetretener Pfad, den er jetzt deutlich unter seinen Füßen sah, führte ihn zum Wasser und zum Saints Harbour. Kurz dachte er an Sharon, mit der er hier einen wunderschönen Abend verbracht hatte. Aber was immer er sich damals erhofft hatte, es hatte sich sehr schnell als Trugschluss erwiesen.
Das Licht der Gestirne fiel aus dem fast wolkenlosen Himmel auf das Wasser der Bucht und ließ die vielen kleinen Fischerboote, denen die Saints Bay als ein natürlicher Hafen diente, als Schattenrisse erkennbar werden. Sie dümpelten im schwachen Wellengang gemütlich vor sich hin, und nur gelegentlich hörte Doyle ein Klatschen, wenn eine etwas stärkere Welle gegen die Bootskörper schwappte. Er schloss für einen Moment die Augen, hörte auf das leise Glucksen der Wellen und atmete tief ein und aus. Die Seeluft, die nach Salz und Tang schmeckte, tat ihm gut. Es war die Luft seiner Kindheit, seiner Heimat.
Oft war er als Junge hier unten gewesen, allein oder mit Freunden, die Fischerboote waren zu spanischen Schatzgaleonen oder mächtigen Linienschiffen aus der Zeit von Schießpulver und wehenden Segeln geworden, und er hatte auf den Namen Francis Drake oder Horatio Hornblower gehört. Viele, viele Bücher hatte er über die Helden der Seefahrt gelesen, aber nicht genug, und sein Vater hatte ihm abends, vor dem Schlafengehen, noch Geschichten aus jener Zeit erzählen müssen, als Guernsey ein Paradies für Schmuggler und Kaperfahrer gewesen war.
Ihm war, als trüge die sanfte Brise, die in die Bucht hereinwehte, ihm die Stimmen der Seefahrer zu, deren Erlebnisse seine Kindheit mit so vielen bunten Abenteuern bereichert hatten. Zu seiner Ernüchterung musste er feststellen, dass es die Stimmen eines jungen Liebespaars waren, das sich weiter unten zwischen den Felsen eine geschützte Stelle für einen romantischen Abend ausgesucht hatte. Er wollte die beiden nicht belauschen und wandte sich ab, um zu »Le Petit Château« zurückzukehren. Jetzt war er kein Seeheld mehr, sondern wieder Polizist. Mit einem Schlag standen ihm die verzweifelten Züge von Julian Prideaux wieder lebhaft vor Augen, und er glaubte, erneut das auf Französisch vorgetragene Gebet zu hören – das letzte Vaterunser.
Zweiter Tag Mittwoch, 15. Oktober
Kapitel 2
Der Oktober blieb golden, und es war wieder ein sommerlich warmer Tag. Die kaum hörbar vor sich hin summende Klimaanlage sorgte für eine angenehme Temperatur in Doyles Büro.Wenn er durch die Fenster auf das weitläufige Grün von Candie Gardens sah, durch das mehr und mehr Spaziergänger flanierten, bekam er Lust, augenblicklich das Polizeihauptquartier an der Hospital Lane zu verlassen und sich ihnen anzuschließen. Obwohl in der historischen Gartenanlage aus der Zeit Königin Viktorias bereits die Herbstblumen blühten, trugen die meisten Besucher leichte Sommerkleidung. Aber er hatte eine Menge Arbeit zu erledigen, zumeist Administratives.
Als er die Londoner Metropolitan Police verlassen hatte, hatte er gehofft, auch den größten Teil von dem Verwaltungskram hinter sich zu lassen. Leider hatte er sich getäuscht. Aus der guten alten Einheit, wie die Guernsey Police von ihren Angehörigen gern genannt wurde, war längst ein moderner Polizeiapparat geworden – mit dem entsprechenden Papierkrieg. Auch wenn der weitgehend in der papierlosen Computerwelt stattfand, machte ihn das nicht weniger aufwendig. Trotz aller Bemühungen kam Doyle heute kaum voran, es ging bei ihm zu wie im Taubenschlag.
Zuerst erschienen Detective Sergeant Calvin Baker und Detective Constable Jasmyn Allisette, um ihm in der Angelegenheit der Belle-Greve-Einbrüche zu berichten.
»Zweimal Einbrüche in Wohnungen, deren Besitzer abwesend waren«, sagte der gut genährte Baker. »Wir gehen davon aus, dass der Einbrecher die Häuser an der Belle Greve Bay entweder genau auskundschaftet oder dass er aus anderen Gründen gut informiert ist. Vielleicht arbeitet oder wohnt er dort oder beides.«
»Und er hat wirklich nur Geld mitgenommen und die entsprechende Summe in Spielgeld dagelassen, ganz so wie damals der sogenannte Monopoly-Dieb?«
»Ja, Sir.«
»Wie wollen Sie weiter vorgehen?«
Die sommersprossige Jasmyn Allisette trat einen halben Schritt vor.
»Als Calvin vorhin einen Schoko-Karamell-Riegel verspeist hat, ist ihm eine tolle Idee gekommen. Lassen Sie uns nur machen, Sir.«
»Dann verfolgen Sie zwei mal Sergeant Bakers tolle Idee.«
Mit einem leichten Nicken bekräftigte Doyle, dass die beiden entlassen waren. Nur mühsam konnte er ein Schmunzeln so lange unterdrücken, bis sie sein Büro verlassen hatten. Sergeant Baker hatte zwei Vorlieben: Schokoriegel und seine hübsche Kollegin. Die Schokoriegel verhalfen ihm oft zu tollen Ideen. Die heimliche Zuneigung zu Jasmyn Allisette allerdings würde wohl unerwidert bleiben. Wie Doyle von Pat erfahren hatte, war der rothaarige Constable in dieser Hinsicht nur dem eigenen Geschlecht zugetan. Baker schien das nicht zu wissen, oder er hatte beschlossen, es zu ignorieren.
Daran musste Doyle keine zwanzig Minuten später denken, als Mildred bei ihm erschien, ein hübsch mit violettem Samtpapier verpacktes und mit einer weißen Schleife verziertes kleines Etwas in der Hand. Eine besondere Praline aus dem großen Süßwarenladen am unteren Ende der High Street, wie sie ein Bote zweimal pro Woche für Jasmyn Allisette abgab. Es war inzwischen ein offenes Geheimnis, dass Baker dahintersteckte, offenbar der alten Weisheit folgend, wonach Liebe durch den Magen geht.
»Ist Constable Allisette schon weg?«, fragte Mildred.
»Vermutlich. Sergeant Baker hatte mal wieder eine seiner Ideen, den Monopoly-Dieb betreffend, und der wollten er und Allisette nachgehen. Essen Sie die Praline doch, Mildred. Ich fürchte, Constable Allisette bekommt allmählich einen Schokoladenschock.«
Mildred schüttelte ihren Kopf, auf dem die brünette Hochfrisur wie festzementiert thronte.
»Letzte Woche erst habe ich gesehen, wie sie eine von diesen Pralinen mit großem Genuss verspeist hat. Außerdem wäre das kaum im Sinne ihres anonymen Verehrers.«
»Anonym?«
»Ich gebe nichts auf wilde Gerüchte, Sir.« Sie hielt das kleine Präsent ein Stückchen höher. »Das hier werde ich auf Allisettes Schreibtisch deponieren.«
Mildred verließ sein Büro, aber Doyle hatte sich kaum wieder dem Memo über die Veränderungen in der Personalstruktur innerhalb der vergangenen zehn Jahre zugewandt, da trat nach einem knappen energischen Klopfen der Verfasser dieses Memos höchstselbst ein: Colin Chadwick.
»Guten Morgen, Cyrus«, sagte der Polizeichef, obwohl Doyle von allen anderen, die ihn beim Vornamen nannten, einfach nur mit Cy angesprochen wurde.
Doyle erwiderte den Gruß und erkannte an Chadwicks ernsten Zügen, dass der Chief Officer diesen Morgen für gar nicht so gut hielt.
Chadwick blieb vor Doyles Schreibtisch stehen und warf ein zusammengefaltetes Papierbündel auf die Tischplatte.
»Heute schon Zeitung gelesen?«
Doyle wies einladend auf einen der Besucherstühle.
»Nein, Colin, noch keine Zeit gehabt. Anscheinend sollte ich das schnellstens nachholen.«
Während Chadwick sich setzte, faltete Doyle die heutige Ausgabe des Guernsey Spectator auseinander und sah gleich, was den Unwillen seines Chefs erregt hatte. Auf der Titelseite prangte ein großes Farbfoto von Doyle und Pat. Vor ihnen kniete Julian Prideaux und sah Doyle mit einem flehenden Blick an. Daneben stand in fetten schwarzen Buchstaben die Schlagzeile DCI DOYLE UND DER CLAMEUR DE HARO– ÜBERRASCHENDE WENDE IM MORDFALL ANNE CORBIN. Der dazugehörige Artikel referierte die wichtigsten Fakten in dem Mordfall und das Ereignis von gestern Mittag. Offenbar hatte die Zeitung mit Mr Prideaux gesprochen. Er wurde mit der Bemerkung zitiert, er und seine Frau hielten ihren Sohn Cameron nach wie vor für unschuldig und hätten große Hoffnung, dass die Wiederaufnahme des Falles durch DCI Doyle zu Camerons baldiger Freilassung führen würde.
»Der Clameur de Haro!« Chadwick schüttelte energisch den Kopf. »Ein seltsamer Brauch. Ich musste mich erst mal erkundigen, was das überhaupt ist.«
»Hier auf den Kanalinseln lernt das jedes Schulkind, aber im Rest der Welt dürfte der Clameur weitgehend unbekannt sein.«
»Zu Recht!«, schnaubte der Chief. »Das Ganze ist ja geradezu lächerlich.«
»In früheren Zeiten war es für einen Mann, dem großes Unrecht angetan wurde, oft die letzte – und auch einzige – Möglichkeit, um zu seinem Recht zu kommen.«
»Sie sagen es, Cyrus, in früheren Zeiten. Ich habe mich informiert. Heutzutage findet dieser … dieser Brauch nur noch in Grundstücksangelegenheiten Anwendung und auch dann nur unter sehr engen Voraussetzungen. Sie sind also Mr Prideaux gegenüber zu nichts verpflichtet.«
»Rein rechtlich nicht.«
»Rein rechtlich? Worauf wollen Sie hinaus?«
Doyle hielt die Zeitung ein Stück hoch.
»Mit diesem Artikel hier weiß die ganze Insel Bescheid. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass genau das in Prideaux’ Absicht lag.«
»Und weiter?«
»Damit haben wir – oder ich, das bleibt sich wohl gleich – die moralische Verpflichtung, uns seines Ansinnens anzunehmen. Jeder echter Gurn wird das so empfinden.«
»Was für ein Ansinnen?«
»Den Mordfall Anne Corbin noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Genau darum geht es doch, oder?«
Chadwick stand sein Unwille deutlich ins Gesicht geschrieben, und die rötlichen Brauen, die zur Farbe seines Bürstenhaars passten, zuckten mehrmals.
»Dieser Fall ist bereits genau unter die Lupe genommen worden, Cyrus. Erst von DCI Mourant und seinem Team und dann vom Gericht. Von dem Gericht, das aufgrund der von Charlie Mourant vorgelegten Fakten Cameron Prideaux für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt hat.«
»Wie Sie gerade sagten, Colin, hat das Gericht sich auf die Ermittlungen meines Vorgängers gestützt. Falls diese Ermittlungen aber, sagen wir mal, etwas ungenau waren, weil Charlie es zu eilig hatte, den Täter zu finden, dann hätte das Gericht auf einer falschen Grundlage geurteilt. Und dann hat es vielleicht auch den Falschen ins Gefängnis geschickt.«
Der Chief starrte ihn jetzt nicht nur unwillig, sondern geradezu empört an.
»Das möchte ich aus Ihrem Mund nicht wieder hören, Cyrus, verstehen Sie? DCI Charlie Mourant konnte auf eine tadellose Laufbahn bei der Guernsey Police zurückblicken, und ich sehe keine Veranlassung, durch die Aufnahme neuer Ermittlungen sein Andenken zu beschmutzen oder gar das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Arbeit zu erschüttern. Um es ganz deutlich auszudrücken: Sie lassen Ihre Finger von dieser Sache. Der Mordfall Anne Corbin ist abgeschlossen!«
»Was ist, wenn die von Ihnen angesprochene Öffentlichkeit nachfragt, ob und wie wir auf den Clameur de Haro reagieren?«
»Mit der Öffentlichkeit meinen Sie vermutlich die Presse? Nun, Sie werden sich jeder öffentlichen Äußerung enthalten. Ich werde Superintendent Ogier bitten, eine Erklärung für die Medien abzugeben.«
»Mit welchem Inhalt?«
»Wir werden unser Verständnis für die verzweifelte Lage ausdrücken, in der sich Cameron Prideaux’ Eltern befinden. Gleichzeitig werden wir betonen, dass wir neue Ermittlungen in dem Fall nicht in Betracht ziehen, da wir keinen Grund haben, das Gerichtsurteil anzuzweifeln. Das ist alles.«
»Und ich …«
»Sie, Cyrus«, unterbrach ihn der Chief, während er sich erhob und auf den Computerbildschirm zeigte, »tun nichts anderes, als sich meinem Memo zu widmen. Bis morgen Mittag erwarte ich von Ihnen einen Zehn-Punkte-Plan mit den wichtigsten Schlussfolgerungen, die Sie aus der Personalentwicklung der vergangenen zehn Jahre ziehen. Da Sie erst seit zwei Monaten bei uns sind, wird Ihnen das bestimmt dabei helfen, sich mit der jüngeren Geschichte unserer Einheit vertraut zu machen.«
Calvin Baker fand eine Parklücke nahe der Bucht und zwängte den metallicsilbernen Škoda zwischen einen mit allem möglichen Schnickschnack ausgestatteten SUV und den Lieferwagen einer Wäscherei.
Als er seinen fülligen Leib nach draußen wuchtete, brummte er mit Blick auf den SUV: »Angesichts der engen Straßen auf Guernsey sollten Privatfahrzeuge ab einer gewissen Größe verboten werden.«
»Leute mit großem Vermögen fahren gern auch große Autos, und eine Steueroase wie Guernsey zieht nun mal Vermögende an«, sagte Jasmyn Allisette, die dem Zivilfahrzeug der Polizei viel flinker entstieg als ihr Kollege. Sie lächelte und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: »Die vermögen ihr Vermögen eben nicht anders zu zeigen.«
Baker lachte, strich sein von der Fahrt zerknittertes Jackett glatt und atmete die salzige Luft ein, die über der Belle Greve Bay lag. Es war Flut, das Wasser reichte bis an die Ufermauer, und etliche kleine Boote in den verschiedensten Farben schaukelten im Blau des Wassers. Bei Ebbe, wenn ein breiter Uferstreifen frei lag, war der Anblick der auf Land liegenden Boote eher ernüchternd, aber jetzt schien es ein ganz anderer Ort zu sein. Ein paar Möwen segelten über der Bucht und beschwerten sich kreischend darüber, dass das Ufer, auf dem sie sonst im Schlick nach Würmern, kleinen Krebsen oder verendeten Fischen suchten, mit Wasser bedeckt war. Gegenüber der Ufermauer auf der anderen Straßenseite reihte sich in einem sanft geschwungenen Bogen ein Haus an das andere. Die meisten Gebäude erinnerten an die Zeit Königin Viktorias, waren drei Stockwerke hoch und hatten einen weißen oder cremefarbenen Anstrich.
Ein wenig geduckt, als hielte es sich nicht für vollwertig, stand dazwischen ein nur zweistöckiges Haus im dunklen Grau des Guernseygranits. Über dem Eingang hing ein großes Schild, und Baker schirmte seine Augen zum Schutz gegen die Sonne mit der flachen Hand ab.
»Guernsey Games and Model Kits.« Er wandte sich zu Jasmyn um. »Da ist es, das graue Haus.«
»Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt«, sagte sie, während sich beide gleichzeitig in Bewegung setzten.
In dem Spielzeug- und Modellbaugeschäft war es erstaunlich düster. Zum einen verfügte es, ursprünglich ein reines Wohnhaus, über keine großen Schaufenster. Zum anderen standen die Regale mit Brettspielen, Zubehör und Regelwerken für Tabletop-Spiele, Pappschachteln mit Plastikmodellen in allen nur denkbaren Größen sowie Werkzeug und Farbtöpfe zum Zusammenbauen und Bemalen der Modelle so dicht beieinander, dass Baker unwillkürlich seinen Bauch einzog.
Jasmyn war das nicht entgangen, und sie sagte mit einem breiten Grinsen: »Greif jetzt bloß nicht zu einem der Schokoriegel, die deine Jackentaschen ausbeulen, Calvin, sonst kriegen wir dich nachher nicht mehr hier raus.«
»Sehr komisch, Constable. Aber das kenne ich schon aus der Schule. Wer den Bauch hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.«
Sie tippte kurz auf seinen Bauch, der sich aus dem offenen Jackett vorschob.
»Spiel jetzt nicht den Dünnhäutigen, das passt nicht zu dir.«
Eine Gestalt näherte sich aus den dämmerigen Tiefen des Ladens, ein kleiner, älterer Mann mit einem weißen Haarkranz und einer wuchtigen Hornbrille auf der spitzen Nase.
»Guten Morgen, die Herrschaften. Kann ich Ihnen weiterhelfen. Suchen Sie etwas für sich selbst oder für Ihre Kinder?« Er unterzog Jasmyn einer eingehenden Musterung. »Na, so alt können die Kleinen ja noch nicht sein. Da muss ich Sie wohl enttäuschen. Unser Angebot richtet sich leider nicht an die ganz Kleinen.«
Jetzt war es an Baker, breit zu grinsen, als er eine Hand auf Jasmyns Schulter legte.
»Sie ist nicht mehr so jung, wie sie aussieht.«
Jasmyn streifte ihn kurz mit einem tadelnden Blick, zog ihren Polizeiausweis hervor und hielt ihn dem Weißhaarigen vor die spitze Nase.
»Guernsey Police. Ich bin Constable Allisette, das ist Sergeant Baker. Und Sie sind?«
»Edmund Kellaway, mir gehört dieses Geschäft. Aber an Sie beide werde ich nichts verkaufen, nehme ich an.«
»So ist es.« Jasmyn steckte ihren Ausweis wieder ein. »Arbeitet für Sie ein Harrison Fournier?«
»Ja, Harry Fournier. Er ist hinten im Lager, die neuen Lieferungen einsortieren. Soll ich ihn rufen?«
»Vorerst nicht«, sagte Baker, zog ein Blatt Papier aus einer Innentasche seines Jacketts und faltete es auseinander. »Sind die Brettspiele, die Sie anbieten, offen oder eingeschweißt?«
Kellaway war sichtlich irritiert über die Frage.
»Eingeschweißt schon, aber in der Regel haben wir von jedem Spiel ein offenes Exemplar für unsere Kunden zum Anschauen und Testen.«
»Gut.« Baker blickte auf seine Liste. »Zeigen Sir mir dann bitte das Testexemplar von Monopoly.«
»Welche Ausgabe soll es denn sein? Das klassische Monopoly, die Zombieversion Monopoly The Walking Dead, Star Wars Monopoly, Disney Classic Monopoly oder die Disney Princess Edition, Monopoly The Mega Edition, die Endzeitvariante Fallout Monopoly, Pokemon Monopoly, Christmas Monopoly, Metallica Rock Band Monopoly, KISS Monopoly, Monopoly Game of Thrones oder vielleicht …«
»Halt, halt, halt!«, fuhr Baker dazwischen und suchte in seinen Taschen hastig nach einem Plastikbeutel, in dem verschiedene Spielgeldscheine steckten. Er zeigte auf einen blauen Schein mit der Zahl 10 in der Mitte. »Aus welcher Ausgabe ist der?«
»Vermutlich aus dem klassischen Monopoly, sagen Sie das doch gleich.«
»Wieso vermutlich?«
»Bei einigen Monopoly-Varianten verwendet der Hersteller die Geldscheine aus dem klassischen Spiel, bei anderen nicht.«
Jasmyn schüttelte leicht den Kopf.
»Das ist ja eine Wissenschaft für sich.«
»Das können Sie durchaus sagen. Deshalb bin ich ganz froh, dass Harry hier arbeitet. Er ist ein kluger Kopf.«
Baker raschelte mit dem Plastikbeutel.
»Mr Kellaway, könnten Sie bitte nachprüfen, ob aus einem Ihrer offenen Monopoly-Spiele fünfzehn dieser Scheine fehlen? Möglicherweise verteilt sich die Summe auch auf mehrere Spielversionen mit den gleichen Scheinen.«
»Das ist aber ein reichlich seltsames Ansinnen, Sergeant.«
»Sie würden mir und meiner Kollegin damit einen großen Gefallen tun.«
»Na, dann kommen Sie mal.«
Baker und Allisette folgten dem Ladeninhaber bis zu einem hohen, langen Regal, vor dem Kellaway stehenblieb.
»Das hier sind alle Monopoly-Spiele, die wir derzeit anbieten. Es sei denn, es haben sich noch ein paar Exemplare im Lager versteckt. Aber dazu sollten wir besser Harry fragen.«
»Den werden wir noch fragen, ganz bestimmt«, sagte Baker und wies auf das Regal. »Aber jetzt nehmen wir uns erst mal dieses Regal vor. Wenn Sie so freundlich wären, Sir?«
Kellaway ging zum Anfang des Regals, zog ein nicht verschweißtes Exemplar des klassischen Monopoly-Spiels heraus und ging damit zu einem kleinen Tisch mit zwei Hockern. Dort öffnete er den Karton, ohne sich hinzusetzen, nahm alle blauen Spielgeldscheine heraus und zählte sie zweimal.
»Hier fehlen tatsächlich welche, aber nur acht.«
»Sind Sie sich da sicher?«, fragte Jasmyn.
»Natürlich, ich habe sie ja gerade gezählt.«
»Sie haben im Kopf, wie viele es sein müssen?«
»Selbstverständlich. Ich übe meinen Beruf inzwischen seit mehr als dreißig Jahren aus.«
»Constable Allisette zweifelt nicht an Ihrer beruflichen Eignung, Sir«, versicherte Baker. »Aber Sie werden verstehen, dass wir uns sicher sein müssen. Könnten Sie jetzt die übrigen Monopoly-Versionen auf weitere fehlende Zehnerscheine prüfen?«
Kellaway folgte der Bitte und stellte schließlich fest, dass sieben weitere blaue Scheine in dem Ansichtsexemplar von Monopoly Token Madness fehlten.
»Sehr gut, damit hätten wir die fünfzehn blauen Zehner«, sagte Baker, erleichtert darüber, dass seine Vermutung sich als wahr zu erweisen schien. »Wir haben da noch einige weitere Scheine aus anderen Spielen. Würden Sie bitte auch nach denen sehen? Diese beiden Spiele sind übrigens beschlagnahmt.«
Der Ladeninhaber legte die hohe Stirn in Falten.
»Also, wenn die Polizei für einen Spieleabend …«
»Beschlagnahmt als Beweisstücke«, fiel ihm Baker ins Wort.
Kellaway brummte etwas Unverständliches, auf jeden Fall eine Missfallensäußerung, und suchte nach den anderen Spielen. Tatsächlich entdeckte der Ladeninhaber genau die Fehlmenge der jeweiligen Scheine, die auf Bakers Liste verzeichnet war.
Baker sah Jasmyn mit einem strahlenden Lächeln an.
»Bin ich genial, oder bin ich genial?«
»Du bist genial«, bestätigte sie und wandte sich an Kellaway. »Jetzt wäre es an der Zeit, ein Wörtchen mit Mr Fournier zu wechseln.«
»Gut, ich werde ihn holen.«
»Wir kommen besser mit«, entschied Baker.
Erneut runzelte Kellaway seine Stirn und stieß auch wieder jenes unverständliche Brummen aus, sagte sonst aber nichts weiter und setzte sich mit leicht schleppendem Schritt in Bewegung, gefolgt von Baker und Jasmyn. Am hinteren Ende des Raums, eingepfercht zwischen einem Regal mit Star-Wars-Figuren und einem voller kleiner Panzer und anderer Militärfahrzeuge, blieb der Alte stehen und öffnete unter lautem Quietschen eine Metalltür. Der Raum dahinter schien kein Tageslicht zu kennen und wurde nur durch einige Neonröhren erhellt, von denen eine ständig flackerte. Auch hier stand Regal an Regal, aber es war kein Mensch zu sehen.
»Harry, kommst du mal bitte her?«, rief Kellaway in den Lagerraum.
»Schon unterwegs«, antwortete eine raue Stimme, und ein mittelgroßer Mann um die vierzig mit dunklem Haar und Dreitagebart, bekleidet mit Jeans und einem blau-gelben Karohemd, erschien in dem Gang vor ihnen. Als sein Blick auf Kellaways Begleiter fiel, blieb er abrupt stehen. »Was gibt es denn, Boss?«