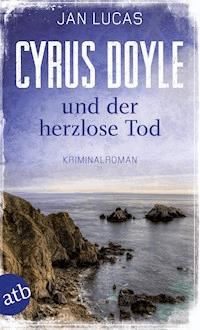8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cyrus Doyle ermittelt
- Sprache: Deutsch
Auf Guernsey findet ein internationales Victor-Hugo-Symposium statt, denn die Insel wurde während seines Exils zur Heimat für den Autor. Bei einer Filmvorstellung geschieht das Unfassbare: Als die Lichter angehen, ist ein Victor-Hugo-Double tot. Erschossen. Doch galt der Angriff wirklich ihm? Cyrus Doyle, der selbst im Publikum saß, und seine Kollegin Pat übernehmen die Ermittlungen. Eine Spur führt zu Pats gewalttätigem Exmann. Düstere Geheimnisse aus der Geschichte Guernseys treten ans Tageslicht. Als schließlich ein Victor-Hugo-Forscher spurlos verschwindet, beginnt für Cyrus Doyle ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Ein charismatischer Chief Inspector ermittelt vor atemberaubender Kulisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Jan Lucas
Jan Lucas ist das Pseudonym eines Autors zahlreicher erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Er lebt in Deutschland, hält sich aber immer wieder gern auf der Kanalinsel Guernsey auf.
Im Aufbau Taschenbuch sind von ihm bisher erschienen »Cyrus Dole und der herzlose Tod«, »Cyrus Doyle und das letzte Vaterunser« und »Cyrus Doyle und die Kunst des Todes«.
Mehr Informationen zum Autor unter www.facebook.com/Jan.Lucas.Autor
Informationen zum Buch
»Victor Hugo ermordet!«.
Auf Guernsey findet ein internationales Victor-Hugo-Symposium statt, denn die Insel wurde während seines Exils zur Heimat für den Autor. Bei einer Filmvorstellung geschieht das Unfassbare: Als die Lichter angehen, ist ein Victor-Hugo-Double tot. Erschossen. Doch galt der Angriff wirklich ihm? Cyrus Doyle, der selbst im Publikum saß, und seine Kollegin Pat übernehmen die Ermittlungen. Eine Spur führt zu Pats gewalttätigem Exmann. Düstere Geheimnisse aus der Geschichte Guernseys treten ans Tageslicht. Als schließlich ein Victor-Hugo-Forscher spurlos verschwindet, beginnt für Cyrus Doyle ein Wettlauf gegen die Zeit.
Ein charismatischer Chief Inspector ermittelt vor atemberaubender Kulisse.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jan Lucas
Cyrus Doyle und der dunkle Tod
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Jan Lucas
Informationen zum Buch
Newsletter
Guernsey
Erster Tag: Sonntag, 15. Mai
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zweiter Tag: Montag, 16. Mai
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Tag: Dienstag, 17. Mai
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Vierter Tag: Mittwoch, 18. Mai
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Drei Tage später: Samstag, 21. Mai
Epilog
Nachwort
Impressum
Für alle Guernseygirls –
mögen sie immer lächeln wie Pat
Wenn die Freiheit zurückkehrt, kehre ich auch zurück.
Victor Hugo über die Dauer seines Exils auf Guernsey
Guernsey
Erster Tag Sonntag, 15. Mai
Prolog
Um sie herum waren plötzlich Soldaten in französischen Uniformen – sie saßen in der Falle. Gilliatt reagierte schnell. In der einen Hand eine Pistole, griff er mit der anderen nach einem Stuhl und warf ihn nach dem schlichten Kerzenhalter unter der Decke des Wirtshauses. Treffer. Das Licht im Schankraum erlosch. Er packte die überraschte Drouchette und zog sie hastig mit sich, eine Treppe hinauf ins Obergeschoss. Die Tür zu einem Gastzimmer stand offen. Schnell hinein, und durch ein offenes Fenster sprangen sie ins Freie.
Die Morgendämmerung tauchte alles in ein diffuses Spiel aus schwachem Licht und noch nicht überwundener Dunkelheit. Das gab ihnen eine Chance, den Soldaten zu entkommen, die im Laufschritt aus dem Wirtshaus eilten und draußen noch Verstärkung erhielten. Sie hetzten durch den Wald in Richtung Strand, verfolgt von den Uniformierten.
Gilliatt schickte die protestierende Drouchette zum Boot, wehrte den vordersten Verfolger in einem kurzen Handgemenge ab, schnappte sich dessen Muskete und schoss. Der getroffene Soldat stürzte zu Boden. Zwei Feinde weniger. Gilliatt folgte Drouchette, die bereits ins Wasser gelaufen war, sich ihres Kleides entledigt hatte und zu dem kleinen Segelboot schwamm, das in Ufernähe auf sie wartete. Er streifte seine Jacke ab und entblößte seinen muskulösen, breitschultrigen Oberkörper. Dann stürzte auch er sich in die Fluten, und beide erreichten das Boot, auf dem der junge Willie auf sie wartete.
Die Sea Devil nahm Kurs aufs offene Meer. Heimwärts nach Guernsey – sie hatten es geschafft!
Gilliatt, dessen lockige Haarpracht durch das Wasser nicht im mindesten in Mitleidenschaft gezogen war, nahm Drouchette, deren ebenfalls lockiges und viel längeres Haar durch das Wasser auch nicht im mindesten in Mitleidenschaft gezogen war und die, wie durch Zauberei, wieder ihr Kleid trug, das noch dazu gänzlich trocken war, in seine Arme und küsste sie leidenschaftlich. Und auf der Leinwand stand in leuchtend roter Schrift: »The End – A Coronado Production«.
* * *
Während im Kino des Beau Sejour Leisure Centre langsam das Licht anging, brandete ein eher vorsichtiger Applaus auf. Die Filmfans unter den Zuschauern, wie Cyrus Doyle, die gewusst hatten, worauf sie sich einließen, bildeten nur einen Teil des Publikums. Kein Wunder, es war ja auch keine normale Kinovorstellung, sondern eine Sonderaufführung im Rahmen des Victor-Hugo-Kongresses. Das Hauteville House veranstaltete den Kongress unter dem Motto »150 Jahre Die Arbeiter des Meeres«. Vor genau hundertfünfzig Jahren, 1866, war Hugos Guernsey-Roman erstmals erschienen. Die heutige Matineevorstellung der Romanverfilmung Im Schatten des Korsen aus dem Jahr 1953 fiel aus dem Rahmen der wissenschaftlichen Vorträge und Diskussionen und war auch für die Allgemeinheit zugänglich. Doyle als großer Fan des klassischen Hollywoodkinos hatte sich das nicht entgehen lassen, und er hatte auch Pat mitgeschleppt.
Ungefähr die Hälfte der knapp hundert Zuschauer applaudierte – wohl überwiegend die Filmfans und nicht die Literaturwissenschaftler, die aus aller Herren Länder zu der Hugo-Tagung angereist waren. Letztere hatten eher zweifelnde Mienen aufgesetzt, und einige blickten mit ungläubigem Stirnrunzeln auf die jetzt weiße Leinwand, als wollten sie sich vergewissern, ob die neunzig Minuten in knalligem Technicolor vielleicht nur ein Spuk gewesen seien.
Doyle hingegen hatte sich prächtig amüsiert und grinste bei der Vorstellung, was hinter den Denkerstirnen der angesehenen Wissenschaftler jetzt vor sich gehen mochte, in sich hinein. Mit der Romanvorlage hatte der Streifen wirklich nicht besonders viel zu tun. Aus dem grimmigen, verschlossenen Helden Hugos war ein smarter Draufgänger in der Gestalt von Rock Hudson geworden, und aus dem scheuen jungen Mädchen eine durchtriebene Doppelagentin, gespielt von der rassigen und nicht mehr ganz jungen Yvonne de Carlo. Was alles nicht weiter schlimm war, fand Doyle, war doch von Hugos Handlung auch nichts übrig geblieben. War Hugos Roman eine Geschichte vom Kampf gegen die Naturgewalten, angesiedelt in den 1820er Jahren, so hatten die Filmemacher das Ganze ein Vierteljahrhundert vorverlegt, in die Zeit Napoleon Bonapartes, und in ein mit viel Hauen und Stechen garniertes Spionageabenteuer verwandelt. Sogar Napoleon selbst hatte einen Auftritt gehabt.
»Raoul Walsh wird beim Drehen seinen Spaß gehabt haben«, sagte Doyle in den Applaus hinein.
»Wie bitte?«, fragte Pat, die eher pflichtschuldig als begeistert in die Hände klatschte. Er hatte sie nicht lange zu bitten brauchen, ihn in die Vorstellung zu begleiten, aber jetzt fragte er sich, ob er ihr wirklich einen Gefallen damit getan hatte.
»Raoul Walsh, der Regisseur«, erklärte er. »Nicht gerade ein Vertreter der hohen Kunst, wie wir gerade gesehen haben, aber ein solider Handwerker und großer Routinier im Abenteuergenre. Einer seiner Lieblingssprüche beim Drehen war: ›Der Film wird gut, er erinnert mich an meinen letzten.‹«
Pat lachte, und sein Herz wurde bei diesem Anblick warm. Ihre Blicke trafen sich, und er hatte das Gefühl, sie könne in ihm lesen wie in einem offenen Buch.
Bevor die Situation peinlich werden konnte, trat ein breitschultriger Mann mit einer auffälligen Haarpracht, die ihm bis auf die Schultern reichte, vor Guernseys größte Kinoleinwand. Er hatte bereits vor der Filmvorführung ein paar einführende Worte gesprochen. Daher wusste Doyle, dass der Mittfünfziger mit der allmählich ergrauenden Löwenmähne Professor Simon Duvier war, einer der größten Victor-Hugo-Kenner und in seiner Rolle als Direktor von Hauteville House der Gastgeber des Kongresses.
Der Literaturwissenschaftler, der selbst aussah wie einem alten Abenteuerfilm entsprungen, blinzelte in das nach neunzig Minuten Kinodunkelheit blendende Licht und ließ seinen Blick über die Sitzreihen mit den rotbraunen Klappstühlen schweifen, offenbar nicht unzufrieden mit der gemischten Reaktion der Zuschauer auf das eben Gesehene. Er sprach in das Mikrofon, das eine junge Assistentin vor ihm aufbaute, wäre aber auch ohne technische Hilfe zurechtgekommen. Seine Stimme war tief und volltönend, was zusammen mit seinem Haar den Eindruck eines Löwen in Menschengestalt vervollständigte. Als seine Stimme durch den Kinosaal hallte, schwang in ihr ein nicht zu überhörender französischer Akzent mit.
»Das war ja ein Bombending«, sagte er mit einem dröhnenden Lachen, das auf einen Teil der bislang ernst dreinblickenden Kongressteilnehmer ansteckend wirkte. »Bis heute habe ich geglaubt, meinen Hugo in- und auswendig zu kennen. Aber diese Geschichte war mir neu. Ich möchte sagen, auch ein Victor Hugo hätte sie mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Aber hätte er sich darüber amüsiert oder geärgert? Um das herauszufinden, meine Damen und Herren, gibt es nur eine Möglichkeit: Fragen wir ihn selbst. Daher bitte ich jetzt niemand anderen auf die Bühne als den hochverehrten Monsieur Victor Hugo!«
Einige Besucher, darunter auch Doyle, begannen zögernd zu klatschen. Niemand schien zu wissen, was ihn erwartete. Im Programmzettel stand lediglich »Filmvorführung Im Schatten des Korsen von 1953, Regie: Raoul Walsh. Anschließend Filmeinordnung durch einen Überraschungsgast.« Vergebens hatte Doyle überlegt, wer dieser Überraschungsgast sein mochte. Ein höchst langlebiges Mitglied der Filmbesetzung oder des Drehstabs? Oder ein Filmhistoriker? Auf den Autor der Romanvorlage selbst war Doyle nicht gekommen. Wie auch, war Victor Hugo doch vor mehr als hundertdreißig Jahren gestorben.
Gebannt blickte er auf die Bühne, neugierig darauf, was Professor Duvier sich ausgedacht hatte. Die meisten anderen in dem großen Saal taten es ihm gleich, aber sie warteten vergebens auf den Überraschungsgast.
»Monsieur Hugo, wenn Sie bitte auf die Bühne kommen wollen!«
Duvier sprach jetzt in einem leicht drängenden Ton und richtete seinen auffordernden Blick auf die vorderste Sitzreihe im mittleren Block. Doyle, der mit Pat in der siebten Reihe desselben Blocks saß, reckte seinen Hals. An der rechten Seite des Mittelblocks, direkt am Gang, entdeckte er einen korpulenten Mann, den er vor Beginn der Vorstellung nicht bemerkt hatte. Der weißhaarige Kopf war nach vorn gesunken.
War der Mann, der sich als Hugo verkleidet hatte, während der Aufführung eingeschlafen? Selbst von seiner Position aus konnte Doyle erkennen, dass der Weißhaarige einen Gehrock nach der Mode des neunzehnten Jahrhunderts trug.
Der Professor gab der jungen Frau, die ihm das Mikrofon gebracht hatte, einen Wink, und sie eilte zu dem offenbar Schlafenden. Sie sagte etwas zu ihm, aber er rührte sich nicht. Sie berührte ihn an der Schulter, erst leicht, dann heftiger. Jetzt rutschte der Mann im Gehrock aus dem Klappsitz und fiel auf den Boden vor der ersten Sitzreihe, wo er reglos lieben blieb.
Leicht nach vorn gebeugt, sah die Frau auf ihn hinab. Sie wirkte erschrocken und öffnete ihre Lippen zu einem seltsamen Laut, irgendwo zwischen Aufstöhnen und ersticktem Schrei.
»Da stimmt was nicht«, sagte Doyle zu Pat. »Komm mit!«
Sie drängten sich auf den Gang zwischen dem mittleren und dem rechten Zuschauerblock und eilten die wenigen Stufen nach unten, wo Duviers Assistentin noch immer mit verzerrten Zügen auf den Mann am Boden starrte. Dessen weißes Haar war verrutscht, eine Perücke. Darunter war er fast kahl, und in seinem Hinterkopf klaffte ein kleines blutiges Loch.
Doyle und Pat hockten sich neben den Reglosen und wussten sofort, dass er nicht schlief. Das Geschoss, das durch den Hinterkopf in seinen Schädel eingedrungen war, hatte ganze Arbeit geleistet.
»Was ist mit ihm?«, fragte Professor Duvier, der zu ihnen geeilt war.
Doyle erhob sich wieder. »Er ist tot.«
»Tot? Ein Herzanfall?«
»Sehen Sie doch genau hin.« Doyles Stimme klang härter als beabsichtigt. »Wenn es ein Anfall ist, dann ein Anfall von Kopfschuss.«
Während Duvier fassungslos auf den Toten starrte, wandte sich Doyle an Pat.
»Verständige das Hauptquartier. Großes Besteck. Jeder, der erreichbar ist, kann seinen beschaulichen Sonntag vergessen. Hier gibt es eine Menge Verdächtige zu überprüfen.«
Kurz glitt sein Blick über die Sitzreihen, und er sah in viele fragende, verstörte Gesichter. War darunter eine Person, die sich nur verstellte?
Pat, die mit dem Hauptquartier gesprochen hatte, hielt ihm ihr Handy unter die Nase und sagte leise: »Für dich, Cy. Der Chief will wissen, was los ist.«
Er nahm das Handy und meldete sich knapp mit seinem Namen.
»Cyrus, was ist passiert?«, fragte Chief Officer Colin Chadwick ohne jeden Gruß. »Warum wollen Sie am heiligen Sonntag die ganze Einheit mobilisieren?«
»Ein unnatürlicher Todesfall, Colin. Victor Hugo ist ermordet worden.«
Kapitel 1
Eine Stunde später wimmelte es im Beau Sejour Leisure Centre von Polizisten, und es trafen laufend weitere Kollegen ein. Doyle tat es leid, dass er ihnen diesen traumhaft sonnigen Sonntag vermasselt hatte, aber an die hundert Zuschauer im Saal waren zu vernehmen. Hundert potentielle Zeugen – und potentielle Mörder.
Die Polizei hatte einige Räume in dem großen Sport-, Freizeit- und Erholungskomplex nördlich des Cambridge Parks mit Beschlag belegt, um die nach ihren Sitzplätzen in Gruppen Eingeteilten zu vernehmen. Eine langwierige Prozedur, über die weder die aus ihrer Freizeit und ihren Familien gerissenen Polizisten noch die Kinobesucher erbaut waren. Auch das Management von Beau Sejour hatte nur widerwillig zugestimmt, war heute doch ein besucherstarker Tag, an dem jede Einschränkung einen Einnahmeverlust bedeutete. Aber Doyle hatte keine andere Möglichkeit gesehen, die gewaltige Aufgabe logistisch zu bewältigen. Mit dem Argument, das Beau Sejour Centre sei eine staatliche Einrichtung und habe seine Ermittlungen, die dem öffentlichen Interesse dienten, nach besten Kräften zu unterstützen, hatte er sich schließlich durchgesetzt.
Alle Kinobesucher waren angewiesen worden, auf ihren ursprünglichen Plätzen zu warten, bis sie zur Vernehmung aufgerufen wurden. Der vernehmende Beamte trug dann den jeweiligen Namen in einen Sitzplan ein, um einen Überblick zu gewinnen, wer aus seiner Position was hätte sehen können. Das war Pflichtarbeit, aber Doyle gab sich keinen großen Hoffnungen hin, daraus wichtige Erkenntnisse gewinnen zu können. Pat und er selbst hatten nicht weit entfernt von dem Ermordeten gesessen und trotzdem nichts bemerkt.
Professor Duvier hatte ihnen verraten, dass das Mordopfer Terry Seabourne war, ein Laiendarsteller, der häufig bei Veranstaltungen als Victor-Hugo-Double gebucht worden war. Undeutlich erinnerte sich Doyle an einen Zeitungsbericht über die Eröffnung eines Restaurants oder eines Supermarkts vor ein paar Wochen, bei der ein Hugo-Double zum Einsatz gekommen war. Ein Foto hatte den Darsteller gezeigt, wie er mit großen Gesten eine Ansprache hielt. Er konnte beim besten Willen nicht sagen, ob das auch Terry Seabourne gewesen war, zumal der Ermordete, durch einen provisorischen Sichtschutz abgeschirmt, noch immer dort lag, wo er zu Boden gegangen war. Sein Gesicht war in dieser Haltung nicht gut zu erkennen. Sie warteten auf Dr. Helena Nowlan, um die Leichenschau vor Ort durchzuführen.
Nervös blickte Doyle auf das Ziffernblatt seiner Fliegeruhr. Die Chefärztin des Princess Elizabeth Hospital, gleichzeitig Guernseys Rechtsmedizinerin, ließ seit einer Stunde auf sich warten.
»Hast du heute noch etwas vor?«, fragte Pat, die seinen Blick auf die Uhr bemerkt hatte, mit einem leicht spöttischen Unterton.
Er lächelte wehmütig.
»Eigentlich wollte ich dich nach dieser Matineevorstellung zu einem ausgiebigen Lunch einladen, aber die Gelegenheit haben wir verpasst. Wahrscheinlich wird noch nicht einmal ein Dinner drin sein.«
»Ich verzeihe dir aufgrund der gegebenen Umstände und lasse mich gern ein andermal von dir zum Essen einladen.«
»Sehr nett von dir«, seufzte Doyle, war aber nur halb bei der Sache. »Eigentlich warte ich jetzt auf eine andere Dame.«
»So? Darf man erfahren, auf wen?«
Gerade als er antworten wollte, sah er oberhalb der Sitzreihen eine blonde Frau eintreten, deren schlanke Figur auch noch unter ihrem blauen Plastikoverall erkennbar war. Als sie die Plastikkapuze über ihr Haar zog, trafen sich ihre Blicke, und sie grüßte ihn mit einem knappen Nicken.
»Da kommt sie schon«, sagte Doyle zu Pat, die seinem Blick folgte.
Den Tatortkoffer in der Rechten, schritt Dr. Nowlan den Gang zwischen mittlerem und rechtem Sitzblock hinunter, von mehr als hundert Augenpaaren verfolgt.
»Ich glaube, ich habe an einem Leichenfundort noch nie vor so viel Publikum gearbeitet«, sagte sie nach der kurzen Begrüßung. »Oder ist das hier ein wissenschaftliches Seminar?«
»Etwas in der Art«, erwiderte Doyle. »Allerdings geht es den Leuten hier nicht um die Leichenschau, sondern um Victor Hugo.«
»Victor Hugo?« Die Augen hinter Nowlans viereckigen Brillengläsern verengten sich. »Ich habe gehört, er sei das Mordopfer. Wäre heute der erste April, hätte ich mich nicht auf den Weg hierher gemacht.«
»Haben wir Sie aus dem OP-Saal geholt, Doc?«, fragte Pat.
»Nein, von einem Segelboot. Deshalb hat es etwas länger gedauert.«
»Augen auf bei der Berufswahl. Sind Sie sauer wegen der sonntäglichen Störung?«
Dr. Nowlan wiegte den Kopf leicht hin und her.
»Mein Skipper ist wohl ärgerlicher als ich. In meinem Beruf sind solche Störungen fast schon normal, leider.« Sie blickte zu dem Toten. »Das mit Victor Hugo ist also kein schlechter Scherz?«
»Nicht so ganz«, antwortete Doyle und setzte sie mit wenigen Worten ins Bild.
»Na, dann wollen wir mal!«
Die Ärztin stellte ihren Koffer ab, setzte den weißen Mundschutz auf und ging neben der Leiche in die Hocke.
»Der Tod müsste vor einer bis zweieinhalb Stunden eingetreten sein«, sagte Doyle. »Der Film lief ungefähr neunzig Minuten.«
»Allerdings saß zu Beginn der Vorstellung jemand anderer auf dem Platz«, ergänzte Pat.
»Bist du sicher?«, fragte Doyle. »Ich kann beschwören, dass dort kein Mann im viktorianischen Outfit saß, als das Licht ausging. Aber an einen anderen, der dort gesessen hat, kann ich mich nicht erinnern.«
»Ich mich schon. Es war ein Mann, aber mehr kann ich nicht sagen. Ich habe ihn nur von hinten gesehen, als er schon auf dem Stuhl saß.«
»Was macht dich da so sicher?«
Sie erlaubte sich ein kurzes Lächeln. »Als Single achte ich nun mal auf die Männer in meiner Umgebung.«
»Danke für die Info«, sagte Doyle leise und fuhr lauter fort: »Und wann ist er aufgestanden?«
Pat hob die Schultern an und ließ sie wieder sinken.
»Frag mich was Leichteres, Cy. Ich war dann ganz und gar gebannt von Rock Hudson.«
»Spotte nur weiter!«
Doyle drohte ihr spielerisch mit dem erhobenen Zeigefinger, bevor er sich nach Professor Duvier umsah und ihn herbeiwinkte.
»Ich nehme an, den restlichen Ablauf des heutigen Kongresstages kann ich vergessen«, sagte Duvier.
Doyle nickte.
»In diesem Punkt kann ich Sie leider nicht enttäuschen, Professor. Wir tun, was wir können. Aber bei so vielen Leuten, die zu vernehmen sind, dauert es seine Zeit. Die Victor-Hugo-Tagung hat gestern begonnen, nicht wahr?«
»Das stimmt.«
»Wann endet sie?«
»Mittwoch. Am Vormittag halte ich meinen Abschlussvortrag, und am Abend findet das Abschlussdinner für all jene statt, die dann noch nicht abgereist sind.«
»Haben Sie Terry Seabourne für die Rolle als Victor Hugo engagiert?«
»Ja, er sollte ein paar launige Worte zu dem Film sagen, der mit seiner Romanvorlage nicht sehr viel zu tun hat. Aber auf einem Kongress zum Thema Die Arbeiter des Meeres durfte die Hollywoodversion nicht fehlen, dachte ich. Durch Hugos – oder Seabournes – ironische Worte wollte ich eine allzu heftige Kritik seitens der ernsthaften Hugo-Forscher abmildern. Schließlich sollte die heutige Matinee die Tagung ein wenig auflockern und den Gästen vor allem Spaß machen.« Duviers Blick wanderte zu dem Toten, der von Dr. Nowlan gewissenhaft untersucht wurde, und er seufzte schwer. »Das ist nun gründlich misslungen. Vielleicht war das Ganze doch keine so gute Idee.«
Pat fragte erstaunt: »Wieso sagen Sie das? Glauben Sie, einer Ihrer Tagungsteilnehmer war so erbost über den Auftritt des falschen Victor Hugo, dass er ihn lieber vorher erschossen hat?«
»Gott bewahre, natürlich nicht! Wobei ich nicht sagen will, dass Literaturwissenschaftler im Grunde ihres Herzens alles friedliche Menschen sind. Der – natürlich auf wissenschaftlicher Ebene – ausgetragene Streit in unserer Zunft nimmt zuweilen sehr heftige Formen an. Aber dass einer von uns eine tödliche Kugel als Argument ins Feld führt, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Mr Seabourne wohl noch am Leben wäre, hätte ich ihn nicht eingeladen.«
»Falls der Täter wirklich Mr Seabourne treffen wollte, hätte er auch an jedem anderen Ort und zu jeder anderen Zeit zuschlagen können«, sagte Pat.
Duviers Kopf fuhr zu ihr herum.
»Wieso falls? Sie glauben doch nicht, das war ein Unfall.«
»Wer weiß? Möglicherweise wollte der Mörder gar nicht Mr Seabourne umbringen, sondern den Mann, der vor ihm auf dem Platz saß.«
»Vor ihm? Ach, Sie meinen Professor Nehring. Den habe ich kurz nach Beginn des Films tatsächlich gebeten, sich einen anderen Platz zu suchen. Auf diesem Stuhl sollte Seabourne sitzen, damit er nach der Filmvorführung schnell auf die Bühne gelangte. Ich hielt es für effektvoller, wenn er aus der Mitte der Zuschauer kommt. Den Zettel mit der Aufschrift ›reserviert‹ hat Nehring ignoriert. Typisch für ihn.«
»Sie scheinen Ihren Kollegen nicht besonders zu schätzen«, stellte Doyle fest. »Nehring – was ist das für ein Name? Klingt nach einem Deutschen.«
»Das haben Sie richtig erkannt, Chief Inspector. Nehring ist tatsächlich Deutscher. Er kommt aus Hannover und lehrt dort am Institut für Literaturwissenschaft und Medienpädagogik.«
»Und Sie mögen ihn nicht?«, hakte Doyle nach.
»Sagen wir, wir haben oft sehr unterschiedliche Ansichten, was Hugos Werk betrifft. Er hat an meiner grundlegenden Arbeit über den Glöckner von Notre-Dame als Inselroman kein gutes Haar gelassen, und das mit oft fadenscheinigen Argumenten. Wie ich später erfahren habe, wollte er selbst etwas in dieser Richtung publizieren und war stocksauer, weil ich ihm zuvorgekommen war. Seitdem macht er meine Thesen madig, wo er nur kann. Manchmal könnte ich …«
»Ihn umbringen?«, ergänzte Pat, als Duvier abrupt verstummte.
»Nein, nein, das wollte ich nicht sagen.«
»Sondern?«
»Aus der Haut fahren. Manchmal könnte ich aus der Haut fahren, wenn ich einen seiner kruden Essays lese.«
Pats Augen waren auf den Professor fixiert, als wollten sie ihn festnageln.
»Wir haben es häufig mit Mördern zu tun, die einfach aus der Haut gefahren sind.«
Duviers kräftiger Körper straffte sich in einer Art Abwehrhaltung, und er wirkte verärgert.
»Sie wollen mich doch nicht ernsthaft beschuldigen, Terry Seabourne in der Annahme erschossen zu haben, er sei Nehring. Schließlich wusste ich doch, dass Seabourne seinen Platz eingenommen hatte.«
»Das scheint Sie vor dem Verdacht zu bewahren«, sagte Pat. »Trotzdem wüsste ich gern, wo Sie sich während der Vorführung aufgehalten haben.«
»Da ich den Film bereits kenne, habe ich mich die meiste Zeit über in einem Nebenraum mit dem Vortrag beschäftigt, den ich am Mittwoch auf dem Kongress halten will.«
»Kann das jemand bestätigen?«
»Jenny, meine Assistentin, hat hin und wieder reingeschaut. Sie hat mir auch Bescheid gegeben, als die Vorführung fast beendet war und ich auf die Bühne musste.«
»Die junge Frau, die dachte, Terry Seabourne wäre eingeschlafen?«, fragte Doyle.
»Ja, genau.«
»Dann waren Sie also die meiste Zeit während der Vorführung allein in dem Nebenraum«, nahm Pat den Faden wieder auf. Als Duvier nur stumm nickte, fuhr sie fort: »Das heißt, Sie haben kein Alibi.«
»Aber auch kein Motiv, wie ich Ihnen bereits sagte. Schließlich habe ich Terry Seabourne engagiert. Wenn ich nicht gewollt hätte, dass er seine Rede hält, hätte ich ihm das nur zu sagen brauchen.«
»Da haben Sie recht.« Ein flüchtiges Lächeln verlieh Pats Gesicht einen milderen Ausdruck. »Sie haben sich wacker geschlagen, Professor.«
»Heißt das, Sie verdächtigen mich nicht länger?«
»Wie Sie schon sagten, Ihnen fehlt jedes ersichtliche Motiv.«
»Sind wir fertig?«, fragte Duvier eher ungehalten als erleichtert. »Wie Sie sich vorstellen können, muss ich einiges umorganisieren. Die für den heutigen Nachmittag angesetzten Veranstaltungen an den drei folgenden Tagen unterzubringen, ist keine einfache Aufgabe.«
»Ich habe noch eine Frage«, meldete sich Doyle. »Zu welchem Thema halten Sie Mittwoch Ihren Vortrag?«
»Insel-Elemente bei Victor Hugo – ein Vergleich zwischen den Romanen Der Glöckner von Notre-Dame und Die Arbeiter des Meeres. Sie sind eingeladen, wenn es Sie interessiert.«
»Grundsätzlich ja«, sagte Doyle zu Duviers Überraschung. »Leider dürfte mir die Zeit fehlen. Eine Mordermittlung ist nicht weniger aufwendig als die Umstrukturierung eines literarischen Kongresses.«
»Ich muss mich wundern.«
»Worüber, Professor?«
»Die meisten Leute, die von Hugo keine Ahnung haben, fragen mich, warum ich den Glöckner von Notre-Dame als einen Inselroman bezeichne.«
»Glauben Sie, nur weil ich Polizist bin, habe ich keine Ahnung von Victor Hugo?«
Duvier musste lächeln.
»Jetzt haben Sie mich erwischt. So wie Sie und Ihre Kollegin mich voreilig als Verdächtigen eingestuft haben, habe ich Ihre Kenntnisse über Hugo unterschätzt. Touché.«
Als der Professor sich entfernte und zu seiner Assistentin ging, bemerkte Doyle Pats fragenden Blick.
»Ja?«
»Jetzt verrat mir schon, weshalb Der Glöckner von Notre-Dame ein Inselroman ist. Er spielt doch in Paris. Oder hast du eben geblufft?«
»Durch Paris fließt die Seine, und die umschließt die Île de la Cité, auf der wiederum die Kathedrale von Notre-Dame steht. Folglich spielt die Romanhandlung auf einer Insel.« Doyle grinste. »Vielleicht solltest du den Vortrag des Professors besuchen.«
»Schlaukopf!«
* * *
Professor Wolfgang Nehring war ein schlanker Mann in seinen Sechzigern, der mit seinem sonnengebräunten Teint und dem vollen dunklen, an den Schläfen bereits ergrauenden Haar zehn Jahre jünger wirkte. Die hervorspringende Nase gab dem Gesicht eine markante Note. Ein Professor, der wohl sehr beliebt gerade bei den weiblichen Studierenden war, schoss es Doyle durch den Kopf. Jenny Millard, Professor Duviers Assistentin, hatte ihn und Pat zu dem deutschen Literaturwissenschaftler geführt, der in der zweiten Reihe des Mittelblocks saß und sich mit einem anderen Mann unterhielt. Sie bedachte Nehring mit einem Blick, in dem eine gehörige Portion Wohlgefallen lag. Fast widerwillig entfernte sie sich, nachdem sie Doyle und Pat vorgestellt hatte.
»Ah, werde ich endlich zu meiner Vernehmung geholt?«, fragte Nehring in einem Englisch, in dem der deutsche Akzent nicht sehr stark, aber doch bemerkbar hervortrat.
»Die offizielle Vernehmung folgt noch«, sagte Doyle zu seiner Enttäuschung. »Wir haben aber vorab schon ein paar Fragen an Sie. Schließlich haben Sie bis zum Beginn der Filmvorführung auf dem Stuhl gesessen, auf dem dann der unglückliche Mr Seabourne Platz genommen hat.«
»Wer?«
»Der Hugo-Darsteller.«
»Ach, der Ermordete. Armer Mensch. Was kann so einer für Feinde haben?«
»Was können Sie für Feinde haben, Professor?«
»Ich, wieso?«
»Der Mord geschah in fast völliger Dunkelheit«, erläuterte Doyle. »Vielleicht hat der Mörder nicht bemerkt, dass Sie Ihren Platz Mr Seabourne überlassen hatten.«
Ein Schatten huschte über Nehrings Gesicht, war aber schnell wieder verschwunden.
»Wollen Sie mir Angst einjagen, Chief Inspector?«
»Ich muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Haben Sie Feinde, Professor?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Nein? Wie ich von Professor Duvier erfahren habe, stehen Sie beide sich nicht gerade freundschaftlich gegenüber.«
»Das ist noch milde ausgedrückt«, platzte es aus dem Mann heraus, mit dem sich Nehring eben unterhalten hatte. Er war nicht besonders groß, dafür umso mehr in die Breite gewachsen. Mit dem wildwuchernden Vollbart, der dieselbe rötliche Färbung aufwies wie sein lichtes Haar, war sein Alter schwer zu schätzen. Er sah zumindest älter aus als Nehring, und auch er sprach mit einem Akzent, einem sehr deutlichen, der den Schotten verriet. Als er Doyles fragenden Blick bemerkte, sagte er: »Angus Campbell von der University of Edinburgh.«
»Professor Angus Campbell, nehme ich an?«, vergewisserte sich Doyle.
Der Schotte lächelte verschmitzt und hatte damit etwas vom Weihnachtsmann an sich.
»Was soll’s, Titel sind in Wahrheit Schall und Rauch. Besser ein gutes Steak auf dem Teller als einen guten Titel auf der Visitenkarte, hm?«
»Vom Angus-Rind?«
Campbell brach in ein schallendes Lachen aus und klopfte Doyle kräftig auf die Schulter.
»Sehr gut, Chief Inspector. Aber wenn ein Detektiv schon Doyle heißt, muss er ja schlagfertig sein.«
»Sind wir mit den Namens-Bonmots jetzt durch?«, fragte ein leicht genervter Wolfgang Nehring und fixierte Doyle. »Ich dachte, Sie hätten ein paar Fragen an mich.«
»Ich hatte nach Ihren Feinden gefragt, Professor. Wie sieht es aus, würden Sie Simon Duvier als einen solchen bezeichnen?«
»Unsinn!«, sagte Nehring in seiner Muttersprache. »Wir vertreten auf unserem Fachgebiet oft gegensätzliche Meinungen, aber das macht uns nicht zu Feinden.«
»Das hat sich aber bei Ihrem Streit gestern nach der Eröffnungsveranstaltung ganz anders angehört«, kam es von Angus Campbell. »Sie beide haben sich gezankt wie die Kesselflicker.«
»So?«, fragte Doyle. »Um was ging es dabei?«
Nehring winkte ab.
»Ach, das Übliche. Ich habe zu erwähnen gewagt, dass ich einen ganzen langen Vortrag über Duviers Inselthema als Zeitverschwendung betrachte. Schließlich gibt es wichtigere Themen in Zusammenhang mit Hugos Guernsey-Roman. Dass der auf einer Insel spielt, steht ja wohl außer Frage.«
»Und da ist Duvier auf Sie losgegangen?«
»Das kann man so sagen.«
»Das muss man sogar so sagen«, mischte sich der Schotte ein. »Ich habe nur noch darauf gewartet, dass die Fäuste fliegen.«
Die Art, in der er das sagte, schien anzudeuten, dass er die Fäuste ganz gern hätte fliegen sehen.
Doyle lächelte.
»Ich hatte gedacht, Literaturwissenschaftler streiten allenfalls mit spitzer Feder.«
»Das ist der Nachteil von Kongressen«, sagte Nehring. »Da trifft man persönlich aufeinander, und manchmal schlagen dann die Emotionen hohe Wellen.«
Campbell nickte und kicherte in sich hinein.
Ein skurriler Streit unter Wissenschaftlern, der zu Handgreiflichkeiten führte? Fast hätte Doyle in das Kichern des Schotten eingestimmt. Aber als er an den Toten dachte, der nur ein paar Meter entfernt auf dem Boden lag, war jeder Anflug von Erheiterung verschwunden.
Er richtete seinen Blick auf Nehring.
»Sie haben also hier neben Professor Campbell gesessen, nachdem Sie Ihren ursprünglichen Platz für den Hugo-Darsteller geräumt hatten?«
»Ja, Chief Inspector.«
»Aber nicht die ganze Zeit über«, warf Campbell ein. »Der Film lief schon so ungefähr eine Stunde, da sind Sie für einige Minuten verschwunden, Herr Kollege.«
Nehring kratzte sich am Hinterkopf.
»Stimmt, das hatte ich jetzt in der ganzen Aufregung vergessen. In der Reihe hinter uns wurde laut getuschelt, weil den Leuten der Film wohl zu langweilig war. Ich habe mir einen anderen Platz in den oberen Reihen gesucht. Aber auch dort war es nicht gerade leise, obwohl ich einen abgelegenen Platz ausgewählt hatte. Da bin hierher zurückgekehrt.«
»Hat jemand Sie auf dem neuen Platz gesehen?«
»Ich glaube, nicht. Wie ich schon sagte, es war ein abgelegener Platz recht weit oben im Mittelblock.«
»Wie lange sind Sie dortgeblieben?«
»Keine fünf Minuten.«
Der Schotte schüttelte seinen rothaarigen Kopf.
»Es waren mindestens zehn Minuten, wenn nicht fünfzehn.«
Nehring setzte eine gleichgültige Miene auf.
»Wenn der Kollege das sagt, dann habe ich mich wohl getäuscht.«
* * *
Dr. Helena Nowlan sprach fast mechanisch, als sie, noch neben dem Toten stehend, ihren ersten Bericht ablieferte. Kein Zweifel, dachte Doyle, auch sie hätte den heutigen Tag lieber mit etwas anderem verbracht. So wie wohl all seine Kollegen vor Ort. Er dachte zurück an den letzten Mord, der sich an einem Sonntag auf Guernsey ereignet hatte. Drüben an der Westküste, in der Rocquaine Bay. Damals hatte es die lebenslustige Strandkünstlerin Lizzie Somers erwischt. Er schüttelte den Gedanken an den Fall Somers von sich ab und konzentrierte sich ganz auf die Worte der Ärztin.
»… ist der Todeszeitpunkt wahrscheinlich eine halbe Stunde vor dem Auffinden der Leiche anzusiedeln, plus minus zehn Minuten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war Seabourne augenblicklich tot. Sofortiger Stillstand von Atem und Kreislauf. Das Projektil scheint in die tiefen Hirnstrukturen eingedrungen zu sein. Genaueres weiß ich, nachdem ich den Schädel geröntgt habe.«
»Auf was für eine Waffe tippen Sie, Doc?«, fragte Pat.
»Das werden Sie sich selbst ausmalen können, Inspector. Da der Schädel des Toten zwar eine Eintrittswunde am Hinterkopf, aber keine Austrittswunde aufweist, können wir von einer kleinkalibrigen Waffe ausgehen.«
»Versehen mit einem Nachtzielgerät«, sagte Pat.
»Wieso?«
»Nach Ihrer Angabe über den Todeszeitpunkt wurde Seabourne während der Vorführung erschossen. Da war es hier im Saal ziemlich dunkel. Ich glaube nicht, dass der Täter direkt hinter Seabourne war. Dann müsste es selbst bei einer kleinkalibrigen Waffe eine Austrittswunde geben.« Sie wandte sich an Doyle. »Oder was sagst du, Cy?«
»Ich bin hundertprozentig deiner Meinung.«
»Aber? Du wirkst so nachdenklich.«
»Nichts aber. Ich habe nur gerade an Professor Nehring denken müssen. Der tödliche Schuss ist in dem Zeitraum abgegeben worden, als er nicht neben Professor Campbell saß.«
»Womit er kein Alibi hat.«
Doyle sah in Pats wunderschöne Augen.
»Schon wieder sind wir ganz einer Meinung.«
Kapitel 2
Die Untersuchungen im Beau Sejour Leisure Centre waren noch längst nicht abgeschlossen, als Doyle und Pat das Gebäude gegen halb drei am Nachmittag verließen. Die milde, ja warme Frühlingsluft machte Doyle erst richtig bewusst, was für einen schönen Sonntag er und seine Kollegen verpassten.
Pat streifte in einer eleganten Bewegung ihre leichte Jacke ab und hängte sie über ihre Schulter. Sie sah zum einladenden Grün des Cambridge Parks hinüber, an dem sich ein paar Spaziergänger erfreuten. Darin eingebettet war die Skateranlage. Etliche Kids mit Skateboards und Stunt Scootern schossen über die Betonpisten. »Mir fallen tausend Dinge ein, die ich jetzt lieber täte.«
»Mir auch. Zum Beispiel irgendwo im Grünen ein schönes Picknick abhalten.« Während Doyle das sagte, fuhr er sich unwillkürlich mit der Hand über den reichlich leeren Magen. »Wir sollten unterwegs zumindest eine Kleinigkeit essen.«
Sie steuerten den Parkplatz an, auf dem Doyles TVR Tamora ohne Verdeck in der Sonne stand. Pat blieb abrupt stehen und deutete nach rechts.
»Sieh mal, die beiden kennen wir doch.«
Im Schatten einiger Bäume standen Professor Nehring und Professor Campbell und unterhielten sich lebhaft miteinander. Offenbar waren beide vernommen und in Gnaden entlassen worden. In diesem Augenblick hielt ein Taxi auf die beiden zu und hupte mehrmals. Eine brünette Frau in einem auffälligen grünen Kostüm stieg aus, eilte in ihren zartrosa Pumps auf die beiden zu und fiel Nehring um den Hals. Es sah so aus, als hätte sie sich große Sorgen um ihn gemacht. Schließlich zog sie ihn mit sich in das Taxi, und Campbell winkte dem davonfahrenden Wagen nach.
»Jetzt bin ich ein wenig neugierig«, sagte Doyle und hielt, gefolgt von Pat, auf den Schotten zu. »Eine attraktive Begleiterin hat Ihr deutscher Kollege.«
»Das war Tessa, seine Frau«, sagte Campbell. »Sie hat ihn nach Guernsey begleitet, hatte aber keine Lust auf den Film und hat stattdessen einen Bummel am Hafen gemacht.«
»Die Dame scheint mir etwas jünger zu sein als ihr Mann.«
»Etwas? Zwanzig Jahre. Aber Nehring ist ja ein jugendlicher Typ, da fällt das nicht so auf. Er tut, wie ich ihn verstanden habe, einiges für seine Fitness.« In Campbells Augen blitzte es auf. »Muss er wohl auch, bei so einer Frau.«
* * *
Trotz des herrlichen Wetters saßen Doyle und Pat schweigend in dem offenen Roadster, als sie am Hafen entlang nach Norden fuhren. Die Menschen auf den Ausflugsbooten und Segelyachten, die Passanten mit einem Eis in der Hand oder einer Tüte Fish & Chips, sie alle schienen besser drauf zu sein als die beiden Polizisten in dem schnittigen kleinen Sportwagen. Es war nie eine heitere Aufgabe, einem Menschen die Nachricht vom plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen zu überbringen.
Schließlich brach Doyle das Schweigen: »Wer uns mit unseren ernsten Gesichtern sieht, hält uns bestimmt für ein heillos zerstrittenes Ehepaar.«
»Tut mir leid, dass sich das schöne Wetter nicht auf meine Stimmung auswirkt«, seufzte Pat. »Aber im Augenblick würde ich lieber mit Baker und Allisette tauschen und im Beau Sejour die Zeugen vernehmen. Vielleicht ist tatsächlich unser Mörder darunter.«
»Das glaube ich nicht. Ich an seiner Stelle hätte den Kinosaal direkt nach dem tödlichen Schuss verlassen. Immerhin haben wir keine Spur von der Tatwaffe gefunden.«
»Er könnte sie auch nur weggebracht haben und dann in den Kinosaal zurückgekehrt sein. Oder ein Komplize hat die Waffe für ihn verschwinden lassen.«
»Auch möglich«, gestand Doyle ein.
»Nehmen wir an, der Täter kommt tatsächlich aus den erlauchten Reihen der Kongressteilnehmer. Dann würde es doch auffallen, wenn er am Ende der Filmvorführung verschwunden gewesen wäre. Also müsste er jemand anderes sein. Oder es gibt tatsächlich einen Komplizen, der mit der Tatwaffe abgehauen ist.«
»Zum Beispiel eine Ehefrau, die angeblich einen Hafenbummel macht.«
Pat maß Doyle mit einem forschenden Seitenblick. »Du bist wohl scharf darauf, die attraktive Mrs Nehring in die Mangel zu nehmen?«
Jetzt grinste Doyle.
»Ein Polizist muss sich ohne Murren seiner Pflicht stellen.«
»Na klar. Aber glaubst du wirklich an diese Theorie? Diese Tessa ist nicht gerade unauffällig. Sie könnte leicht bemerkt worden sein, wenn sie heimlich im Beau Sejour war.«
»Vielleicht hat sie sich danach umgezogen.« Doyle rückte seine Sonnenbrille zurecht und überholte einen langsamen Mietwagen, in dem ein paar Touristen über die Hafenstraße schlichen. »Mir fehlt da eher das Motiv. Was sollte Nehring gegen Terry Seabourne gehabt haben?«
»Keine Ahnung«, sagte Pat und deutete nach vorn. »Wenn du da links abbiegst, könnten wir in Nelia’s Bakery eins der phantastischen Schinken-Käse-Croissants essen. Oder hältst du es für sehr verwerflich, unseren Besuch bei Seabournes Frau hinauszuzögern, nur um uns den Bauch vollzuschlagen?«
»Vielleicht ist es ein wenig pietätlos, aber es wäre nicht weniger pietätlos, Mrs Seabourne mit laut knurrenden Mägen gegenüberzutreten.«
Er fuhr nach links auf die Victoria Avenue und parkte den Tamora vor der Bäckerei, deren portugiesische Betreiberfamilie sich durch ihre stets frischen Backwaren einen guten Ruf auf Guernsey erworben hatte. Jeder von ihnen verdrückte eins der nicht nur phantastischen, sondern auch riesigen Schinken-Käse-Croissants und trank dazu einen Kaffee.
»Du siehst aber nicht richtig zufrieden aus«, stellte Pat fest, als Doyle seinen leeren Teller zur Seite schob.
»Je voller der Magen, desto schlechter das Gewissen.«
»Du hast ja recht.« Pat erhob sich. »Dann machen wir uns mal an die wohl unangenehmste Aufgabe dieses verkorksten Tages.«
* * *
St. Sampson badete, wie die gesamte Insel, im Sonnenschein. Dadurch wirkte Guernseys zweitgrößter Ort, der den alten Industriehafen beherbergte, trotz einer gewissen Rauheit durchaus anmutig. Heute, am Sonntag, lagen die Frachtschiffe ruhig im Hafenbecken, standen die Lagerhäuser und Silos verlassen in der Sonne, schienen sich die Lastkräne nur in den blauen Himmel zu recken, um die Möwen zu einer Ruhepause einzuladen. Ein wenig Betriebsamkeit herrschte lediglich bei den Motor- und Segelyachten in der Marina, zu der man den inneren Teil des Industriehafens vor einigen Jahren umgebaut hatte. Doyle verfolgte aus den Augenwinkeln, wie ein Segelboot hinaus aufs offene Meer glitt, bevor er den Tamora nach links lenkte und das idyllische Bild außer Sicht geriet. Der Gedanke, er und Pat könnten jetzt auf dem Boot sein und einfach den Tag genießen, lenkte ihn für wenige Sekunden von der unangenehmen Aufgabe ab, die ihnen bevorstand.
»Du lächelst so zufrieden, Cy«, bemerkte Pat neben ihm. »Woran denkst du?«
»Nanu, sonst liest du doch meine Gedanken.«
»Die Sonne macht mich faul und schläfrig. Aber du hast natürlich das Recht zu schweigen wie jeder Verdächtige.«
»Und wessen verdächtigst du mich?«
»Ich glaube, du denkst gerade an diese attraktive Brünette, die Frau von Professor Nehring.«
»Und wenn, wäre das schlimm?«
»Sagen wir, ich könnte es nachvollziehen.«
»Dann will ich dich erlösen. Die einzige Frau, an die ich eben dachte, verhört mich gerade.«
»Oh! Da sollte ich wohl nicht nach Einzelheiten fragen.«
»Es war alles jugendfrei. Ich dachte daran, wie schön es wäre, wenn wir beide jetzt, frei von allen Pflichten, eine Segeltour unternehmen könnten.«
»Cy, du bist und bleibst ein Romantiker.«
»Das ist für mich nichts Schlimmes«, sagte Doyle und steuerte den Roadster stadteinwärts über die Nocq Road, vorbei an Supermärkten, Geschäften und Wohnhäusern. »Für dich etwa?«
Sie setzte ein Pokerface auf.
»Private Fangfragen bitte erst nach Dienstschluss.«
»Da wirst du heute wohl lang warten müssen.«
Er bog nach rechts in die Lowlands Road ab, die ein ähnliches Bild bot wie die Nocq Road. Da die meisten Geschäfte heute am Sonntag geschlossen waren und sich kaum jemand auf der Straße aufhielt, wirkte St. Sampson fast wie ausgestorben. Wie aus einem dieser Science-Fiction-Filme, in der die Menschheit durch eine mysteriöse Katastrophe auf einen Schlag dahingerafft wird.
Der Nummer nach musste das Haus der Seabournes am Ende der Straße liegen. Doyle verlangsamte das ohnehin gelassene Tempo und hielt Ausschau. Pat entdeckte es zuerst. Es war das letzte Gebäude in einer kleinen Reihe von Einfamilienhäusern, und er fuhr den Wagen auf einen freien Platz neben der Hausreihe, auf dem bereits ein paar Fahrzeuge parkten.
Doyle drückte auf den Knopf einer schrillen Klingel. Er erschrak sich fast bei dem Geräusch. Nach zwanzig, dreißig Sekunden hörten sie eine Frauenstimme hinter der Tür.
»Ja?«
»Guernsey Police«, sagte Doyle in einem neutralen Tonfall, der nichts von dem Unheil verriet, das der zu überbringenden Botschaft innewohnte.
»Um was geht es?«
»Ich glaube, wir sollten drinnen darüber reden.«
Nach kurzem Zögern wurde die Haustür einen Spalt geöffnet, und das halbe Gesicht einer Frau erschien.
»Sie können sich doch ausweisen?«
Doyle hatte mit dieser Frage gerechnet und seinen Dienstausweis bereits in der Hand. Er hielt ihn vor das Auge der Frau, das er sehen konnte, und nannte dabei seinen Dienstrang und seinen Namen.
»In meiner Begleitung befindet sich Inspector Patricia Holburn.«
Die Frau öffnete die Tür und trat einen Schritt zurück. Sie war deutlich jünger, als Doyle erwartet hatte. Anfang bis Mitte vierzig, wogegen Seabourne sechzig oder älter gewesen sein musste. Ein ähnlicher Altersunterschied wie bei Professor Nehring und dessen Frau, ging es ihm durch den Kopf.
»Mrs Seabourne?«, fragte er vorsichtig, während er nähertrat.
»Ich bin Angela Seabourne, ja.«
»Die …« – fast hätte er Witwe gesagt – »Frau von Terry Seabourne?«
»Ja. Warum? Was ist los?«
Doyles Augen hatten sich schnell an das Halbdunkel des Hauseingangs gewöhnt, und er sah vor sich eine attraktive Frau, schlank und mittelgroß, die ihr rabenschwarzes Haar halblang trug. Auf der linken Seite war es so weit ins Gesicht gekämmt, dass ein Auge fast vollständig verdeckt war. Sie trug helle Jeans und eine leichte Sommerbluse.
Pat war hinter Doyle eingetreten und schloss die Haustür.
»Vielleicht sollten wir in ein Zimmer gehen, damit Sie sich hinsetzen können, Mrs Seabourne. Wir haben keine gute Nachricht für Sie.«
Was stark untertrieben war, dachte Doyle. Aber wie sonst sollte man sich herantasten an den bösen Satz »Ihr Mann ist tot«?
»Geht es um Terry?«, fragte Angela Seabourne, ohne sich von der Stelle zu bewegen. »Ist ihm etwas zugestoßen?«
»Ja, leider«, sagte Doyle zögernd. »Meine Kollegin hat recht, wir sollten uns besser setzen.«
Mrs Seabourne nickte leicht und wies auf eine Tür hinter ihr.
»Bitte, folgen Sie mir.«
Das Wohnzimmer war, im Vergleich zum Eingangsbereich, recht hell. Eine Wand war mit schwarzweißen und farbigen Fotos von Terry Seabourne geschmückt. Die Aufnahmen zeigten ihn in verschiedenen Rollen und Masken, darunter mehrmals als Victor Hugo. Doyle und Pat nahmen auf einer cremefarbenen Couch Platz, ihre Gastgeberin in einem gleichfarbigen Sessel ihnen gegenüber.
Sie beugte sich zu ihnen vor und fragte: »Was ist mit Terry? Ist er tot?«
Doyle bestätigte es.
»Ein Unfall? Oder war es sein Herz? Das machte ihm in letzter Zeit sehr zu schaffen.«
Angela Seabourne sprach ganz gefasst, als käme die Nachricht nicht gänzlich unerwartet. Entweder hatte sie ihre Gefühle gut unter Kontrolle, oder es gab da nicht viel, was zu kontrollieren war.
»Weder noch«, seufzte Doyle. »Wir ermitteln in einem unnatürlichen Todesfall.«
»In einem unnatürlichen Todesfall? Das sagen sie im Fernsehen immer, wenn jemand ermordet wurde.«
»Ja«, war alles, was Doyle darauf antwortete.
Er beobachtete Mrs Seabournes Gesicht. Überraschung zeichnete sich darauf ab, aber kein jäher Schmerz. Hatte sie sich so sehr unter Kontrolle? Oder war sie auch eine geübte Schauspielerin?
»Was ist passiert?«
Doyle schilderte es in knappen, sachlichen Worten. Dann stellte er ihr die Frage, die er stellen musste – die nach ihrem Alibi.
»Da muss ich Sie enttäuschen, Chief Inspector. Ich war den ganzen Tag über zu Hause, allein. Die Woche war sehr anstrengend, wissen Sie. Ich brauchte etwas Erholung.«
»Die Arbeit?«
»Ja. Ich bin Geschäftsführerin in einem Fachgeschäft für Angelbedarf, gleich um die Ecke.«
»Ist Angeln Ihre Leidenschaft?«
»Keine Spur. Früher war ich Schauspielerin, so habe ich auch Terry kennengelernt. Wir waren in derselben Theatertruppe. Eigentlich eine bessere Laienspielschar, aber damals hofften wir, unser Geld damit verdienen zu können. Als sich das als purer Wunschtraum herausstellte, habe ich die Notbremse gezogen und einen sogenannten ordentlichen Beruf ergriffen.«
»Und Ihr Mann?«
»Terry hielt nichts von geregelter Arbeit. Er hat weiterhin geschauspielert, und manchmal hat er auch eine Gage dafür erhalten.«
»Dann hat er nicht von Ihrem Geld gelebt?«
»Doch, eigentlich schon. Wenn er mal eine Gage erhielt, hat er die meistens im Pub gelassen.«
Dass die Ehe offenbar nicht die beste gewesen war, erklärte den halbwegs gelassenen Eindruck, den Angela Seabourne angesichts der Todesnachricht machte. Trauer konnte Doyle auf ihrem länglichen Gesicht nicht ausmachen. Sie wirkte auf ihn, als nähme sie das traurige Ende eines traurigen Zustands mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zur Kenntnis. Auf der anderen Seite zeigte sie keine Spur von Erleichterung oder gar Freude. Vorsicht, ermahnte er sich, die Frau hatte Erfahrung als Schauspielerin.
»Mrs Seabourne, hat Ihr Mann Sie geschlagen?«
Jetzt wirkte sie verwirrt.
»Wie … kommen Sie darauf, Mr Doyle?«
»Das geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf. Würden Sie so nett sein und das Haar vor Ihrem linken Auge zur Seite ziehen?«
»Ich weiß nicht, warum …«
»Bitte!«
Begleitet von einem leisen Seufzer, kam sie der Aufforderung nach und enthüllte ein stark geschwollenes Auge. Doyle empfand keine Freude darüber, mit seiner Vermutung richtig zu liegen. Er hatte nicht das geringste Verständnis für Männer, die ihre Frauen schlugen. In Pats Gesicht las er dieselbe Abscheu, die auch er empfand. Kein Wunder, in ihrer kurzen, lange zurückliegenden Ehe mit dem Bauunternehmer Randy Holburn hatte sich dieser als Trinker und brutaler Schläger entpuppt. Pat hatte Guernsey verlassen, weil nach damaliger Gesetzeslage die Abwesenheit eines Ehepartners von der Insel Voraussetzung für eine Scheidung gewesen war. In dieser Zeit hatte sie in Wales die Polizeiausbildung absolviert.
»Hat er zugeschlagen, wenn er betrunken war?«, fragte Doyle und bemühte sich um einen behutsamen Tonfall.
»Anfangs ja.« Angela Seabourne ließ die Haarsträhne wieder über ihr blaues Auge fallen. »Später hat er mich auch geschlagen, wenn er nüchtern war. Es war wohl der Frust darüber, dass ich viel mehr verdiente als er.«
Pat beugte sich zu ihr vor.
»Warum sind Sie bei ihm geblieben? Aus Liebe?«
»Liebe? Nein, die war schon lange gestorben. Eher aus Mitleid und aus Achtung vor dem, was Terry mir einmal bedeutet hat.« Nach einer kurzen Pause fuhr Mrs Seabourne fort: »Ich verstehe nicht, was das mit seinem Tod zu tun hat. Oder wollen Sie mir unterstellen, ich hätte ihn aus Hass oder Rache ermordet? Glauben Sie mir, wenn ich es nicht mehr ausgehalten hätte, hätte ich ihn schon längst verlassen.«
»Sie sind sehr leidensfähig«, stellte Pat fest.
»Haben Sie eine Idee, wer etwas gegen Ihren Mann hatte?«, fragte Doyle. »So sehr, dass ein Mord in Frage kommt?«
»Nein. Terry konnte unangenehm werden, wenn er getrunken hatte, keine Frage. Aber im Grunde war er harmlos.«
»Wie man’s nimmt«, sagte Pat leise und starrte dabei auf Angela Seabournes Gesicht.
Doyle erhob sich, bedankte sich bei der Witwe für ihre bereitwilligen Auskünfte und sagte ihr, dass man sie morgen noch einmal behelligen müsse, um den Ermordeten offiziell zu identifizieren und um ihre Aussage zu protokollieren.
Als sie wieder im Tamora saßen und Doyle den Wagen wendete, fragte Pat: »Was hältst du von Terry Seabournes Witwe?«
»Auf jeden Fall ist sie eine tapfere Frau. Sie hat in ihrer Ehe einiges aushalten müssen. Du weißt besser als ich, wovon ich spreche.«
»Tja, ich habe viel früher die Reißleine gezogen. Über Jahre hätte ich das mit Randy nicht ausgehalten.«
Doyle lenkte den Tamora zurück auf die Lowlands Road.
»Meinst du, Angela Seabournes Leidensfähigkeit war überstrapaziert, und sie hat deshalb heute die Reißleine gezogen?«
»Sie hat kein Alibi.« Pat dachte kurz nach. »Ansonsten hat sie sich in meinen Augen nicht verdächtig verhalten.«
»Schon richtig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass sie mit der Schauspielerei sehr vertraut ist.«