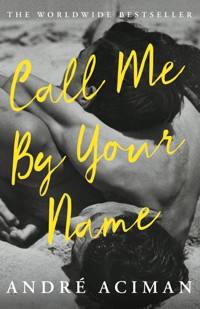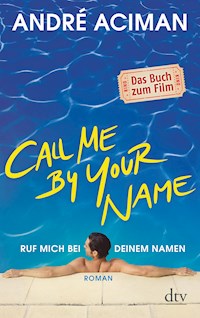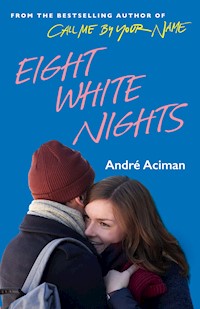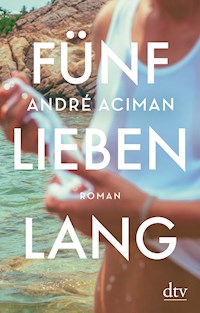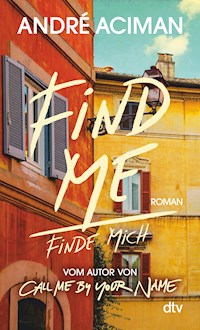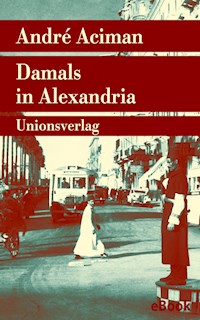
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine lebenslustige jüdische Großfamilie aus allen Ecken der Welt. In Alexandria kommen sie zusammen, zanken, necken, befehden und versöhnen sich in einem halben Dutzend Sprachen. Sie sind Bankiers, Kaufleute, Faulenzer und Träumer, die hier ihr Paradies gefunden haben. Die beiden Großväter trauen einander nicht über den Weg, die Großmütter unterhalten eine damenhafte Freundschaft, während der schwindelnde Großonkel philosophische Fragen zu stellen pflegt. Die Ankunft der aus Nazideutschland geflüchteten Tante lässt erste Wolken aufziehen, und bald lauscht alles auf das Vorrücken von Rommels Panzern. Doch die Lebensfreude lässt die Familie sich nicht nehmen. Sie lebt und liebt, bis sie vom Wind der politischen Ereignisse wieder zerstreut wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Eine lebenslustige jüdische Großfamilie aus allen Ecken der Welt. In Alexandria kommen sie zusammen, zanken, necken, befehden und versöhnen sich in einem halben Dutzend Sprachen. Die Ankunft der aus Nazideutschland geflüchteten Tante lässt erste Wolken aufziehen. Doch die Lebensfreude lässt die Familie sich nicht nehmen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
André Aciman (*1951 in Alexandria) ist Autor und Literaturwissenschaftler. Seine Familie ging 1965 nach Italien, er selbst schließlich nach New York. Er studierte in Harvard, lehrte in Princeton und an der University of New York. Sein Roman Call me by your Name wurde verfilmt. Er lebt in New York.
Zur Webseite von André Aciman.
Matthias Fienbork, geboren 1947, hat Musik und Islamwissenschaft studiert. Er übersetzte u. a. Bücher von Eric Ambler, W. Somerset Maugham, Michael Frayn, Amos Elon, Barack Obama und Tony Judt. Er lebt in Berlin.
Zur Webseite von Matthias Fienbork.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
André Aciman
Damals in Alexandria
Erinnerung an eine verschwundene Welt
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 im Carl Hanser Verlag, München/Wien.
Originaltitel: Out of Egypt
© by André Aciman, 1994
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Farrar, Straus und Giroux.
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlags, München.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: MARKA (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31073-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 30.10.2024, 12:25h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAMALS IN ALEXANDRIA
1 — Soldat, Kaufmann, Schwindler, Spion2 — Rue Memphis3 — Der hundertste Geburtstag4 — Taffi al-nur!5 — Die Lotosesser6 — Der letzte SederMehr über dieses Buch
Über André Aciman
Über Matthias Fienbork
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Religion
Zum Thema Geschichte
Zum Thema 2. Weltkrieg
Für Alexander, Michael und Philip,Henri und Regine, Alain und Caroleund für Piera
1
Soldat, Kaufmann, Schwindler, Spion
Also, sind wir, oder sind wir nicht, siamo o non siamo?«, prahlte mein Großonkel Vili, als wir beide uns an jenem sommerlichen Spätnachmittag im Garten seines ausgedehnten Besitzes in Surrey schließlich hinsetzten.
»Sieh nur«, er zeigte auf die weite grüne Fläche. »Ist das nicht prachtvoll?«, fragte er, als hätte er persönlich den Nachmittagsspaziergang auf dem englischen Land erfunden. »Kurz vor Sonnenuntergang und wenige Minuten nach dem Tee erfasst es mich immer: ein Gefühl der Erfüllung, von Seligkeit fast. Weißt du, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Nicht schlecht für einen Mann in den Neunzigern.« Ein arrogantes, selbstzufriedenes Strahlen lag auf seinem Gesicht.
Ich begann, von Alexandria zu sprechen, von vergangenen Zeiten und vergangenen Welten, vom Ende, als das Ende kam, von Monsieur Costa und Montefeltro und Aldo Kahn, von Lotte und Tante Flora und einem inzwischen so fernen Leben. Er fiel mir mit einer verächtlichen Handbewegung ins Wort, als wollte er einen üblen Geruch vertreiben. »Alles Unsinn. Ich lebe in der Gegenwart«, sagte er, beinahe verärgert über meine nostalgischen Erinnerungen. »Siamo o non siamo?«, fragte er, stand auf, um sich zu strecken, und zeigte mir dann die erste Eule des Abends.
Es war nie ganz klar, was man war oder nicht war, doch noch heute erinnert diese elliptische Redewendung alle Verwandten, selbst diejenigen, die kein Wort Italienisch mehr sprechen, an den großspurigen, tollkühnen, übertrieben selbstsicheren Soldaten, der im Ersten Weltkrieg aus einem italienischen Schützengraben gesprungen war und dann, versteckt hinter einem Baum, das Gewehr mit beiden Händen umklammernd, das ganze österreichisch-ungarische Reich umgemäht hätte, wären ihm die Patronen nicht ausgegangen. In dieser Redewendung drückte sich das aggressive Selbstbewusstsein eines Feldwebels aus, der Tag für Tag lauter Schwächlinge triezen muss. »Sind wir Manns genug oder nicht?«, schien er zu sagen. »Kommen wir voran oder nicht?«, »Taugen wir etwas oder nicht?« Es war seine Art, im Dunkeln zu pfeifen, Niederlagen mit einem Schulterzucken abzutun, sich wieder hochzurappeln und das Ganze als Sieg auszugeben. Und so mischte er sich in Schicksalsdinge ein, forderte stets mehr und gab alles als sein Verdienst aus, bis hin zum unvorhergesehenen Glanz seiner unseligsten Projekte. Überbeanspruchtes Glück verwechselte er mit Weitsicht, so wie er den gesunden Menschenverstand eines Gassenjungen fälschlicherweise für Mut hielt. Er besaß Mumm. Das wusste er, und damit brüstete er sich.
Unbeeindruckt von der schmachvollen Niederlage der Italiener in der Schlacht bei Caporetto im Jahre 1917, dachte Onkel Vili zeitlebens voller Stolz an seinen Dienst in der italienischen Armee, und auch damit brüstete er sich, in dem lebhaften florentinischen Tonfall, den er an den Schulen italienischer Jesuiten in Konstantinopel aufgeschnappt hatte. Wie die meisten jungen Juden, die gegen Ende des letzten Jahrhunderts in der Türkei geboren wurden, verachtete Vili alles, was mit osmanischer Kultur zu tun hatte; er dürstete nach dem Westen und wurde schließlich »Italiener«, wie es die meisten Juden in der Türkei machten: indem er behauptete, aus Livorno zu stammen, wo sich im sechzehnten Jahrhundert aus Spanien vertriebene Juden niedergelassen hatten. Passenderweise wurde in Livorno ein entfernter italienischer Verwandter ausgegraben, der den spanischen Namen Par-do-Roques trug – Vili war selbst ein halber Pardo-Roques –, woraufhin sämtliche noch existierenden »Vettern« in der Türkei sofort Italiener wurden. Natürlich waren sie allesamt glühende Nationalisten und Monarchisten.
Einen alexandrinischen Griechen, der erklärt hatte, die italienische Armee sei nie tapfer gewesen und alle italienischen Medaillen und Dekorationen änderten nichts daran, dass Vili noch immer ein türkischer Halunke sei, und ein jüdischer obendrein, forderte er sofort zum Duell. Onkel Vili war nicht deswegen entrüstet, weil jemand sein Jüdischsein angegriffen hatte – er selbst hätte das als Erster getan –, sondern weil er nicht gern daran erinnert werden wollte, auf welch obskuren Wegen viele Juden Italiener geworden waren. Die Waffen, die ihre Sekundanten ausgesucht hatten, waren so veraltet, dass keiner der beiden Duellanten damit umzugehen wusste. Niemand wurde verletzt, man entschuldigte sich, einer von ihnen kicherte sogar, und um den Geist der versöhnlichen Stimmung zu pflegen, schlug Vili vor, ein ruhiges Restaurant am Meer aufzusuchen, wo beide an diesem klaren alexandrinischen Junitag so herzhaft zu Mittag aßen wie seit Jahren nicht mehr. Als es Zeit wurde, die Rechnung zu begleichen, bestanden beide darauf zu zahlen, jeder beschwor seine Ehre und das Vergnügen, das ihm die Einladung bereitet hatte, und das Hin und Her wäre ewig so weitergegangen, hätte Onkel Vili nicht – wie ein Zauberer, der, wenn alles andere nicht wirkt, schließlich Magie einsetzen muss – seine elegante kleine Redewendung hervorgeholt, die in diesem Fall besagte: »Also, bin ich ein Ehrenmann oder nicht?« Der Grieche, als der noblere von beiden, gab nach.
Onkel Vili verstand es, den vagen, aber unverkennbaren Eindruck hervorzurufen, dass er aus gutem Hause kam, aus einer Familie, die so alt und vornehm war, dass man über derart unwichtigen Dingen wie Geburtsort, Nationalität oder Religion stand. Und mit dem Eindruck guter Herkunft verband sich zugleich der Eindruck von Reichtum – freilich immer mit der nebulösen Andeutung, dass dieser Reichtum dummerweise anderswo fest angelegt war, in Grund und Boden beispielsweise, ausländischem Boden, wovon niemand in der Familie besonders viel besaß, außer in Form von Blumentopferde. Doch das machte ihn kreditwürdig. Und darauf kam es für ihn an, denn er und die anderen männlichen Familienmitglieder verstanden es, mit nichts anderem Geld zu verdienen, zu borgen, zu verlieren und in Besitz einzuheiraten, als mit Kreditwürdigkeit.
Vornehmheit war für Vili so etwas wie eine zweite Natur, nicht weil er sie wirklich besaß oder gut imitierte oder sie mit der selbstverständlichen Lässigkeit verarmter Aristokraten an den Tag legte. Er war einfach überzeugt, dass er als jemand Besseres zur Welt gekommen war. Er hatte das imponierende Auftreten der Reichen, jenes distanzierte Lächeln, das in der Gesellschaft von Gleichen sofort herzlich wird. Er war aristokratisch in puncto Sparsamkeit, Politik und ausschweifendem Lebenswandel – schlechte Haltung störte ihn mehr als schlechter Geschmack, schlechter Geschmack mehr als Brutalität und schlechte Tischsitten mehr als schlechte Essgewohnheiten. Besonders verabscheute er die »Atavismen«, durch die Juden sich verrieten, zumal dann, wenn sie sich als Gojim gaben. Er verhöhnte alle angeheirateten Familienmitglieder und Bekannten, die typisch jüdisch aussahen, nicht, weil er selbst nicht auch so aussah oder weil er Juden hasste, sondern weil er wusste, wie sehr sie von anderen gehasst wurden. Es liegt an Juden wie ihnen, dass Juden wie wir gehasst werden. Als Vili einmal von einem frommen Juden, der auf seine jüdische Herkunft stolz war, zurechtgewiesen wurde, kullerte ihm seine Antwort von der Zunge wie ein Kirschkern, den er seit vierzig Jahren im Mund hin und her geschoben hatte: »Stolz worauf? Sind wir letzten Endes nicht allesamt Händler?«
Und auf den Handel verstand er sich am besten. Sogar den Faschismus verschacherte er, erst an die Briten in Ägypten und später, in italienischem Auftrag, in Europa. Er war dem Duce ebenso treu ergeben wie dem Papst. Seine alljährlichen Grußadressen an die Hitlerjugend fanden großen Beifall und führten notorisch zu Familienzwist. »Mischt euch nicht ein, ich weiß, was ich tue«, pflegte er zu sagen. Jahre später, als die Engländer drohten, alle erwachsenen Italiener in Alexandria zu internieren, stöberte Onkel Vili plötzlich in seinen Schränken und begann, alte Bescheinigungen vom Rabbinat in Konstantinopel zu verhökern, um seine Freunde vom britischen Konsulat darauf hinzuweisen, dass er als italienischer Jude kaum eine Gefahr für britische Interessen sein könne. Ob sie wollten, dass er für sie gegen die Italiener spioniere? Etwas Besseres hätten sich die Engländer nicht wünschen können.
Er zeigte so glänzende Leistungen, dass er nach dem Krieg mit einem Anwesen in Surrey belohnt wurde, wo er für den Rest seiner Tage unter dem angenommenen Namen Dr. H. M. Spingarn in hochherrschaftlicher Armut lebte. Herbert Michael Spingarn war ein Engländer, den Vili als Kind in Konstantinopel kennengelernt und der zwei lebenslange Leidenschaften in ihm geweckt hatte: das levantinische Bedürfnis, allem Britischen nachzueifern, und die osmanische Verachtung für alles Britische. Onkel Vili, der seinen eindeutig jüdischen Namen gegen einen angelsächsischen eingetauscht hatte, konnte sein Erschrecken nicht ganz verbergen, als ich ihm erklärte, dass dieser Spingarn ebenfalls Jude gewesen sei. »Ja, ich erinnere mich an etwas in der Art«, sagte er unbestimmt. »Wir sind eben überall, nicht wahr? Kratz nur an der Oberfläche, und schon ist jeder ein Jude«, spottete der über achtzigjährige turkoitalienisch-anglophil-aristokratisiert-faschistische Jude, der seine Karriere in Wien und Berlin mit dem Vertrieb von türkischen Fezen begonnen hatte und es als alleiniger Auktionator von König Faruks Besitz beenden sollte. »Der ägyptische Sotheby, aber dennoch ein Händler«, fügte er hinzu und lehnte sich in seinem Sessel zurück, während wir eine Vogelschar beobachteten, die sich auf dem trüben, stehenden Wasser eines früher vermutlich wunderschönen Teichs niederließ. »Trotzdem, ein großartiges Volk, diese Juden«, sagte er in gebrochenem Englisch, und seinem herablassenden, so absichtlich banalen und bewusst albernen Tonfall war zu entnehmen, dass er in Bezug auf seine Religionsgenossen immer das Gegenteil von dem meinte, was er sagte. Die bewundernswerten, aber »niederträchtigen« Juden pflegte er erst zu loben, dann zu verunglimpfen, um schließlich wieder umzuschwenken. »Immerhin – Einstein, Schnabel, Freud, Disraeli«, erklärte er mit glänzenden Augen und kaum unterdrücktem Schmunzeln, »waren sie, oder waren sie nicht?«
Onkel Vili hatte Ägypten, wohin die Familie im Jahre 1905 von Konstantinopel aus gezogen war, als Kadett in spe verlassen, mit Feuer im Leib und Quecksilber in den Augen. Er hatte in Deutschland studiert, in der preußischen Armee gedient, nach dem Kriegseintritt der Italiener im Jahre 1915 die Seiten gewechselt und nach Caporetto den Rest des Krieges als Dolmetscher auf Zypern eine ruhige Kugel geschoben. Vier Jahre nach seiner Demobilisierung war er nach Ägypten zurückgekehrt, ein eleganter Dandy von Ende zwanzig, dessen unverschämt gutes Aussehen manche zweifelhaften Geschäfte und gnadenlosen Attacken im Kampf der Geschlechter verriet. Seine Schwestern hielten ihn für ausgesprochen maskulin, waren beeindruckt von seinen Eroberungen, vom verwegenen Sitz seines Filzhutes, dem ungeduldigen »Los, los!« in seiner Stimme und der gönnerhaften, forschen Art, wie er einem die Flasche Champagner wegnahm, die man gerade öffnen wollte, und »Lass mich mal« sagte – nie herrisch, aber doch klar genug andeutend, dass da noch mehr, sehr viel mehr war. Er hatte in allen möglichen Schlachten gekämpft, auf allen Seiten, mit allen Waffen. Er war ein ausgezeichneter Schütze, ein hervorragender Athlet, ein cleverer Geschäftsmann, ein unverbesserlicher Casanova – und, jawohl, ausgesprochen maskulin.
»Sind wir, oder sind wir nicht?«, pflegte er nach einer Eroberung zu prahlen oder nach einem unerwarteten Börsengewinn oder wenn er sich plötzlich von einer schweren Malariaattacke erholt hatte oder wenn er eine kluge Frau durchschaute oder einen Rüpel niederschlug oder wenn er der Welt einfach zeigen wollte, dass man ihn nicht so leicht hinters Licht führen konnte. Es bedeutete: Habe ich es ihnen gezeigt oder nicht? Er benutzte diesen Spruch nach dem Abschluss einer schwierigen Transaktion: Habe ich ihnen nicht gesagt, sie würden noch betteln, um meinen Preis zahlen zu dürfen? Oder wenn er einen Erpresser ins Gefängnis gebracht hatte: Habe ich ihn nicht davor gewarnt, mich für dumm zu verkaufen? Oder wenn seine geliebte Schwester, Tante Marta, hysterisch weinend zu ihm gelaufen kam, nachdem sie wieder einmal von einem Verlobten sitzen gelassen worden war, wobei sein Ausspruch in diesem Fall bedeutete: Jeder Mann, der dieser Bezeichnung würdig ist, hätte das kommen sehen! Habe ich dich nicht gewarnt? Und dann, um sie daran zu erinnern, dass sie aus härterem Holz als Tränen geschnitzt war, zog er sie auf seinen Schoß und hielt ihre Hände, schaukelte sie sanft und versicherte ihr, dass sie schneller, als sie ahne, über ihren Schmerz hinwegkommen werde, denn so sei das nun mal bei Liebeskummer, und überhaupt, sei sie, oder sei sie nicht?
Später schenkte er ihr Rosen und besänftigte sie für ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht. Doch nicht immer ließ sie sich umstimmen, und manchmal hörte er sie, nachdem er sie gerade erst losgelassen hatte und in sein Arbeitszimmer gegangen war, am anderen Ende der Wohnung hysterisch schreien. »Aber wer wird mich heiraten, wer denn?«, fragte sie mit tränenerstickter Stimme ihre Schwestern und schnäuzte sich mit dem erstbesten Stück Stoff, das ihr unter die Finger kam, die Nase.
»Wer wird mich in meinem Alter denn noch heiraten, sagt mir, wer?«, rief sie und lief kreischend in sein Arbeitszimmer zurück.
»Es wird sich schon jemand finden, denk an meine Worte!«, sagte er.
»Niemals«, antwortete sie. »Verstehst du nicht, warum? Siehst du nicht, dass ich hässlich bin? Sogar ich weiß das.«
»Hässlich bist du nicht.«
»Sag die Wahrheit: hässlich!«
»Du bist vielleicht nicht die Schönste – «
»Niemand wird sich jemals auf der Straße nach mir umdrehen.«
»Du solltest an ein Zuhause denken, Marta, nicht an die Straße.«
»Du verstehst mich einfach nicht.« Sie hob jetzt die Stimme. »Du drehst mir bloß die Worte im Mund herum und stellst mich als dumm hin!«
»Hör zu, wenn ich unbedingt sagen soll, dass du hässlich bist, also gut, du bist hässlich.«
»Niemand versteht mich, niemand.«
Und dann zog sie wieder davon wie ein leidendes Gespenst, das bei den Lebenden Trost sucht, von ihnen aber nur weggescheucht wird.
Tante Martas crises de mariage, wie sie genannt wurden, konnten stundenlang dauern. Anschließend wurde sie von so heftigen Kopfschmerzen geplagt, dass sie am frühen Nachmittag schlafen ging und ihr Gesicht erst am nächsten Morgen zu zeigen wagte, und selbst dann hatte sich der Sturm nicht immer gelegt, denn kaum war sie aufgestanden, bat sie jeden, der ihr über den Weg lief, ihr in die Augen zu schauen. »Sie sind geschwollen«, sagte sie, »nicht wahr? Sieh nur, schau sie dir an«, rief sie und riss die Augen auf. »Nein, sie sind ganz normal«, erwiderte dann irgendjemand. »Du lügst. Ich spüre ja, wie geschwollen sie sind. Jetzt wissen alle, dass ich seinetwegen geweint habe. Sie werden es ihm erzählen, ich weiß es. Ich fühle mich so gedemütigt, so schrecklich gedemütigt.« Ihre Stimme zitterte, bis sie in Schluchzen ausbrach und die Tränen wieder flossen.
Für den Rest des Tages schauten abwechselnd ihre Mutter, die drei Schwestern, fünf Brüder und Schwägerinnen und Schwager bei ihr herein und brachten ihr, die mit einer selbst hergestellten Kompresse im Dunkeln lag, eine Schale mit Eisstückchen für die Augen. »Ich leide. Wenn ihr nur wüsstet, wie ich leide«, stöhnte sie mit genau den Worten, die ich sie mehr als fünfzig Jahre später in einem Pariser Krankenhaus flüstern hörte, wo sie an Krebs starb. Onkel Vili, der mit seinen anderen Geschwistern draußen im Wohnzimmer saß, konnte sich nicht länger beherrschen: »Jetzt reichts! Wir alle wissen, was Marta wirklich braucht.« »Sei nicht vulgär«, rief seine Schwester Clara kichernd, die an ihrer Staffelei stand und die soundsovielte Fassung von Tolstois grauenerregenden Zügen malte. »Na bitte«, gab Onkel Vili zurück. »Vielleicht gefällt dir die Wahrheit nicht, aber alle sind meiner Meinung«, erklärte er, zunehmend gereizt. »So alt ist sie schon, und das arme Mädchen weiß noch immer nicht, wo bei einem Mann vorne und hinten ist.« Sein älterer Bruder Isaac prustete los. »Könnt ihr sie euch wirklich mit jemandem vorstellen?« »Es reicht«, fuhr ihre Mutter dazwischen, eine Matriarchin, die auf die siebzig zuging. »Wir müssen einen guten jüdischen Ehemann für sie finden. Reich oder arm, ganz egal.« »Aber wer, wer, wer, sagt mir, wer?«, rief Tante Marta, die unterwegs zum Badezimmer die letzten Worte mitbekommen hatte. »Es ist aussichtslos. Aussichtslos. Warum musste ich nach Ägypten kommen, warum?«, sagte sie, an ihre ältere Schwester Esther gewandt. »Es ist heiß und schwül. Ständig schwitze ich, und die Männer sind so furchtbar.«
Onkel Vili erhob sich, legte die Hand um ihre Hüfte und sagte: »Beruhige dich, Marta, mach dir keine Sorgen. Wir werden jemanden für dich finden. Ich versprechs dir. Lass mich nur machen.«
»Aber das sagst du immer, und nie meinst du es ehrlich. Und außerdem, wen kennen wir hier denn?«
Das war Vilis sehnlichst erwartetes Stichwort. Und er zeigte sich der Lage gewachsen und reagierte mit der einstudierten Nonchalance eines Mannes, der genau die Worte sagt, die er immer schon sagen wollte. In diesem Fall bedeuteten sie: Kann denn irgendjemand wirklich bezweifeln, dass wir gute Beziehungen haben?
Das war eine versteckte Anspielung auf Onkel Isaac, der sich während seines Studiums an der Universität Turin mit einem Kommilitonen namens Fuad angefreundet hatte, dem späteren König von Ägypten. Beide sprachen Türkisch, Italienisch, Deutsch, etwas Albanisch und hatten sich eine an Obszönitäten und Doppeldeutigkeiten reiche Pidginsprache ausgedacht, die sie Türkitalbanisch nannten und bis ins hohe Alter hinein sprachen. Und eben weil Onkel Isaac seine ganzen Hoffnungen in diese unvergängliche Freundschaft gesetzt hatte, überredete er schließlich seine Eltern und Geschwister in Konstantinopel, alles zu verkaufen und nach Alexandria zu ziehen.
Onkel Vili brüstete sich gern damit, dass der König seinem Bruder »gehörte« – und damit indirekt auch ihm. »Er hat den König in der Tasche«, sagte er und zeigte auf seine eigene Brusttasche, in der immer ein silbernes Zigarettenetui mit dem Siegel des König steckte. Am Ende war es der König, der Isaac mit demjenigen Mann bekannt machte, der im Leben seiner Schwester eine so bedeutende Rolle spielen sollte.
Tante Marta, zu jener Zeit knapp vierzig, wurde schließlich die Ehefrau dieses Mannes, eines reichen schwäbischen Juden, der in der Familie nur »der Schwab« hieß – sein richtiger Name war Aldo Kohn – und der nicht viel mehr tat, als tagsüber Golf und nachts Bridge zu spielen und dazwischen türkische Zigaretten zu rauchen, auf die in feinen Goldbuchstaben sein Name und das Familienwappen geprägt waren. Er war ein dicklicher Mann mit einer kleinen Glatze, und obwohl Marta ihn zehn Jahre zuvor schon einmal abgelehnt hatte, war er fest entschlossen, erneut um sie anzuhalten, und zwar ohne eine Mitgift zu fordern, was allen sehr zupasskam. Bei einem Familientreffen wurden die beiden eine Weile miteinander allein gelassen, und ehe Marta begriff, was der Schwab tat, gar Zeit hatte, sich umzudrehen und sich ihm zu entwinden, hatte er sie beim Handgelenk gepackt und ihr ein kostbares Armband umgelegt, auf das sein Juwelier M’appari eingraviert hatte, nach der berühmten Arie aus Flotows Martha. In ihrer großen Verwirrung merkte Tante Marta überhaupt nicht, dass sie in Tränen ausgebrochen war, was den armen Schwab derart rührte, dass auch er zu weinen begann und schluchzend »Sag nicht Nein, sag nicht Nein!« flehte. Die entsprechenden Arrangements wurden getroffen, und bald bemerkte jeder ein ungewöhnlich heiteres und ruhiges Leuchten auf Tante Martas rosigem Gesicht. »Bei dem Tempo wird sie ihn noch umbringen«, spotteten ihre Brüder.
Der Schwab war ein sehr eleganter, aber ruhiger Mann, der alte Sprachen studiert hatte und dessen schüchterne Art ihn zum Gespött des ganzen Hauses machte. Er schien verwöhnt und dumm, einfältig und wohl auch andersherum zu sein. Die Brüder behielten ihn im Auge. Doch der Schwab war kein Narr. Obwohl er noch nie in seinem Leben gearbeitet hatte, stellte sich bald heraus, dass er binnen zwei Jahren das Familienvermögen mit Zuckergeschäften verdreifacht hatte. Als Onkel Vili merkte, dass sein Schwager, dieser unfähige, wehleidige Klops, ein »Spieler« war, stellte er sofort eine Liste von risikolosen Unternehmen für ihn zusammen. Der Schwab, der seine finanziellen Kunststückchen mehr dem Glück als den eigenen Fähigkeiten zuschrieb, zögerte jedoch, in Wertpapiere zu investieren, weil er vom Markt nichts verstand. Das Einzige, wovon er etwas verstand, war Zucker, und vielleicht Pferde. »Verstehen?«, entgegnete Onkel Vili. »Warum solltest du den Markt verstehen? Das erledige ich für dich.« Denn schließlich waren sie jetzt miteinander verwandt oder nicht?
Wochenlang ertrug der Schwab die Aufforderungen seines Schwagers, bis er eines Tages explodierte. Und zwar stilvoll: Er griff zu Vilis kleiner Lieblingsformulierung, wirbelte sie eine Weile vor sich her wie einen Kreisel, um Vili zu demonstrieren, dass auch er, der Schwab, dem Rest der Welt als Aldo Kohn bekannt, genauer gesagt, als Kohn Pascha – sich nicht übers Ohr hauen ließ. Onkel Vili war völlig verdattert. Er war vom Misstrauen seines Schwagers nicht nur »schmerzlich berührt«, wie er sich ausdrückte, sondern fand es auch außerordentlich misslich, mit seiner eigenen Waffe geschlagen worden zu sein. Das war vulgär, unsportlich. Es war ein weiteres Beispiel für aschkenasische Falschheit. Onkel Vili sprach nur noch selten mit ihm.
Eine Ausnahme gab es im Jahre 1930, als sich zeigte, dass die Familie um die Goldenen Zwanziger betrogen worden war. In dieser Zeit machte Onkel Vili den Vorschlag, zu emigrieren. Amerika? Schon zu viele Juden. England? Zu steif. Australien? Zu unterentwickelt. Kanada? Zu kalt. Südafrika? Zu weit weg. Schließlich befand man, dass Japan ideale Aussichten bot für Männer, deren Glücksanspruch in ihrer erhabenen tausendjährigen Rolle als Hausierer und Meisterscharlatane gründete.
Die Japaner hatten drei Vorteile: Sie arbeiteten hart, sie waren lernbegierig und konkurrenzwillig, und wahrscheinlich hatten sie noch nie einen Juden gesehen. Die Brüder wählten eine Stadt, von der sie zwar noch nie gehört hatten, deren Name aber entfernt und beruhigend italienisch klang: Nagasaki. »Werdet ihr auch Kinderspielzeug und Spiegel verkaufen?«, fragte der Schwab. »Nein. Autos. Luxuslimousinen.« »Was für Autos?«, fragte er. »Isotta-Fraschini.« »Habt ihr Erfahrungen als Autoverkäufer?« Es machte ihm Spaß, die Brüder zu ärgern, wann immer er konnte. »Nein. Autos nicht. Aber alles andere. Bettvorleger. Wertpapiere. Antiquitäten. Gold. Ganz zu schweigen von Hoffnung für Investoren, Sand für die Araber. Ganz egal. Und außerdem, wo ist der Unterschied?«, rief Vili aufgebracht. »Teppiche, Autos, Gold, Silber, Schwestern, es ist alles das Gleiche. Ich kann alles verkaufen«, prahlte er.
Die Isotta-Fraschini-Affäre begann damit, dass die ganze Familie eiligst in den Vertrieb dieser Automobile für den Nahen Osten und Japan investierte. Ein Japanischlehrer wurde engagiert, und Montag- und Donnerstagnachmittag saßen die fünf Brüder – von Nessim, dem Ältesten, der über fünfzig und von dem Unternehmen nicht restlos überzeugt war, bis hin zu Vili, zwanzig Jahre jünger und dämonischer Verfechter des Plans – im Esszimmer und füllten die Schreibhefte mit den, wie es schien, liederlichsten Tintenklecksen. »Die armen Jungen«, flüsterte Tante Marta ihrer Schwester Esther zu, wenn sie in den dunklen, holzgetäfelten Raum spähte, wo während des Unterrichts Tee serviert wurde. »Nicht einmal Arabisch haben sie gelernt, und jetzt diese verflixten Klänge.« Jedermann war zutiefst entsetzt. »Roher Fisch und jeden Tag Reis! Tod durch Verstopfung, das werden sie davon haben. Was müssen wir denn noch alles ertragen?«, war Tante Claras einziger Kommentar. Sie werde keine Zeit mehr für die Malerei haben, wurde ihr bedeutet. Sie werde im Familienunternehmen mithelfen müssen. »Außerdem hast du immer nur Tolstoiporträts gemalt. Es wird Zeit, dass sich das ändert«, meinte Onkel Isaac.
Ihre Mutter machte sich ebenfalls Sorgen. »Wir bauen auf schlechtem Boden. So war es, und so wird es immer bleiben. Gott steh uns bei.«
Aus Bosheit hatte niemand den Schwab gefragt, ob er auch nur einen Pfennig in das Unternehmen stecken würde. Zur Strafe würde er mit ansehen müssen, wie der Clan ungeheuer reich würde, und schließlich ein für alle Mal erkennen, wer war und wer nicht war.
Zwei Jahre später wurde er jedoch von seiner Frau gebeten, etwas zu den unmittelbaren Firmenkosten beizusteuern. Der Schwab, der, außer beim Glücksspiel, nicht gern in riskante Projekte investierte, erklärte sich bereit zu helfen, indem er eines dieser teuren Automobile zum Vorzugspreis erwarb. Bald stellte sich heraus, dass die neu gegründete Isotta-Fraschini-Asien-Afrika-Compagnie, abgesehen von den fünf Autos, die jeder der fünf Brüder bekommen hatte, nur zwei Wagen verkauft hatte. Drei Jahre später, nachdem die Firma bankrottgegangen war und die Vorführwagen wieder nach Italien zurücktransportiert worden waren, fuhren nur zwei Personen in Ägypten einen Isotta-Fraschini: der Schwab und König Fuad.
Das Isotta-Fraschini-Debakel warf die Familie um zehn Jahre zurück. Doch man wahrte den Schein. Weiterhin ging man sonntags im königlichen Park spazieren oder ließ sich in Limousinen zum exklusiven Sporting Klub chauffieren, auch wenn man völlig bankrott war. Zu eitel, um die Niederlage einzugestehen, und zu klug, um die Gläubiger anzulocken, wandte man sich nunmehr an vertrauenswürdige Freunde und Verwandte. Albert, der zweite Schwager, einst ein wohlhabender Zigarettenfabrikant, der seinen ganzen Besitz in der Türkei aufgegeben hatte und nach Ägypten gezogen war, wurde gebeten, etwas zu den Familienfinanzen beizutragen. Er tat das nur widerstrebend und nach furchtbaren Auseinandersetzungen mit Esther, seiner Frau, die, genau wie ihre Schwester Marta, nie daran zweifelte, dass Blutsbande stärker waren als eheliche Treueschwüre.
Albert hatte guten Grund, ihnen weder zu trauen noch zu helfen. Es waren die Zusicherungen des Clans gewesen, die ihn 1932 veranlasst hatten, seine Zigarettenfabrik in der Türkei zu verkaufen und mit seiner Familie nach Ägypten zu ziehen, wo er hoffte, in die Firma seiner Schwäger investieren und seinem achtzehnjährigen Sohn Henri die Schrecknisse des türkischen Kasernenlebens ersparen zu können. Sobald er in Alexandria eingetroffen war, erklärte ihm der Clan in aller Deutlichkeit, dass man ihn nicht an der Isotta-Fraschini-Sache beteiligen wolle. Geknickt und völlig ratlos, was er in Alexandria sonst tun könne, nahm der ehemalige Tabakfabrikant seine ganzen Ersparnisse, die er aus der Türkei geschmuggelt hatte, und kaufte an der zehn Kilometer langen Küstenstraße, die bei den Alexandrinern die Corniche heißt, einen kleinen Billardsalon mit Namen La Petite Corniche.
Er hat ihnen diese Gemeinheit nie verziehen. »Komm, wir werden dir helfen«, erinnerte er seine Frau, die wiederholten Appelle ihrer Brüder nachäffend. »Wir geben dir dies, wir geben dir das. Nichts! Meine Vorfahren waren so bedeutend, dass sie von Generationen von Sultanen ermordet wurden – und jetzt Billard!«, murmelte er, wenn er morgens draußen vor der Küchentür stand und auf die Käse- und Spinattaschen wartete, die seine Frau in aller Frühe backte. Sie verkauften sich gut und waren sehr begehrt bei den Billardspielern, die zu ihrem Glas Anis gern eine Kleinigkeit aßen.
Obschon Alberts finanzielle Lage sich drastisch verschlechtert hatte, wurde noch immer von ihm erwartet, dass er der Familie seiner Frau half. Und so pflegte Vilis Chauffeur, durchaus in der Annahme, dass er Geld eintrieb, das seinem Chef gehörte, vor der Petite Corniche anzuhalten, hineinzugehen, ein Bündel Geldscheine in Empfang zu nehmen und Albert daran zu »erinnern«, dass er in ein paar Wochen wieder aufkreuzen werde.
Nach ungefähr dem fünften Darlehen ging der ärmliche Besitzer des Billardsalons mit einem Queue nach draußen und zertrümmerte eine Autoscheibe, wobei er seinem Schwager, der lauernd auf dem Rücksitz saß, während sein Chauffeur Aufträge erledigte, mitteilte, da er so gute Beziehungen zum Königshaus habe, sollte er einmal Seine Majestät um eine »kleine Spende« anpumpen – Vilis Euphemismus für dringend benötigte Darlehen.
Esther erschrak, als sie von dem Krach zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder erfuhr. »So etwas hat er noch nie getan«, erklärte sie Vili, »er ist gar nicht aggressiv.«
»Er ist ein Türke durch und durch.«
»Und was bist du, bitte, ein Italiener vielleicht?«
»Italiener oder nicht, ich schlage doch keine Autoscheiben ein!«
»Ich werde mit ihm reden«, sagte sie.
»Nein, ich möchte ihn nie mehr sehen. Er ist ein furchtbar undankbarer Mensch. Wenn er nicht dein Mann wäre, Esther, wenn er nicht dein Mann wäre …«, hob Vili an.
»Wenn er nicht mein Mann wäre, hätte er dir nicht einen einzigen roten Heller geliehen. Und wenn du nicht mein Bruder wärst, säßen wir jetzt nicht in diesem Schlamassel.«
Vili hieß eigentlich Aaron. Als er 1922, vier Jahre nach Unterzeichnung des Waffenstillstands, nach Alexandria zurückkehrte, musste er versuchen, den Zeitverlust aufzuholen. Mithilfe seiner vier Brüder wurde er in einer Woche Reisexperte, dann Zuckerrohrprüfer. Innerhalb von drei Monaten lernte er, wie man jede nur denkbare Krankheit bekämpfte, von der die Baumwolle, Ägyptens Hauptexportprodukt, befallen werden konnte. Ein halbes Jahr später hatte er nicht nur sämtliche Winkel Ägyptens bereist, sondern auch jeden Magnaten aufgesucht, dessen Haus eine junge jüdische Ehefrau zu versprechen schien. Eine solche heiratete er knapp ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Europa.
Nunmehr ein angesehener Bürger, wandte er sich wieder dem zu, wonach ihm vor allem der Sinn stand: verheirateten Frauen. Einige seiner Mätressen sollen, als er ihnen den Laufpass gab, so verzweifelt gewesen sein, dass sie bei seiner Frau klingelten und sie anflehten, sich für sie einzusetzen, was die arme Tante Lola, deren Herz das größte Organ ihres Körpers war, bisweilen auch tat.
Sieben Jahre nach dem Krieg tauchte vor der Haustür eine Frau namens Lotte mit dem Foto eines Mannes auf, der ihr, wie sie erklärte, in Berlin die Ehe versprochen habe. Nachdem die Identität des Mannes schließlich zweifelsfrei geklärt war und die Frau ihr Taschentuch weggesteckt hatte, wurde sie gebeten, zum Mittagessen zu bleiben, zu dem sich die ganze Familie gegen ein Uhr einfinden würde. Vili kam ganz zuletzt, doch kaum hatte er die Diele betreten, erkannte sie bereits seine Schritte, stand auf, stellte ihr Sherryglas ab und eilte, laut »Willy! Willy!« rufend, aus dem Zimmer.
Niemand hatte auch nur die leiseste Ahnung, warum diese Verrückte ihrem Aaron diesen merkwürdigen Namen gab, doch während des Essens, nachdem sich alle wieder einigermaßen beruhigt hatten, erklärte sie, dass er 1914 in seiner neuen preußischen Uniform so sehr wie Kaiser Wilhelm ausgesehen habe, dass sie nicht anders gekonnt habe, als ihm den Spitznamen Willy zu geben. Seine Frau fand »Willy« so treffend, so kraftvoll und dabei so kurz, dass auch sie dazu überging, ihn »Vili« zu rufen, erst vorwurfsvoll, dann neckend und schließlich aus Gewohnheit, bis die ganze Familie, inklusive seiner Mutter, Vili zu ihm sagte, und irgendwann erhielt er schließlich seine griechisch-jüdisch-spanische Form: Vilico.
»Vilico, Verräter«, sagte seine Mutter später.
Er protestierte: »Damals war ich wirklich in sie verliebt. Und außerdem war das, lange bevor ich Lola kennenlernte.«
»Ich spreche nicht von Frauen. Du bist und bleibst ein Judas.«
Niemand brachte es übers Herz, die wiedererstandene Lotte nach Belgien zurückzuschicken. Also wurde sie Onkel Nessims Sekretärin, arbeitete zeitweilig als Modell in Tante Claras Zeichenklasse, dann als Verkäuferin für Onkel Cosimo und wurde schließlich an Onkel Isaac abgegeben, der sie am Ende heiratete. Auf dem Gruppenbild, das 1926 bei ihrer Hochzeit in der geräumigen Wohnung der Matriarchin in Grand Sporting mit Blick über das sonnige Mittelmeer aufgenommen wurde, steht Tante Lotte neben Onkel Isaac auf der Veranda, die rechte Hand auf Onkel Vilis rechter Schulter. Sind wir, blinzelt Onkel Vili, oder sind wir nicht Männer, die teilen, Männer, die die höchsten Opfer verlangen, Männer, die von Frauen angebetet werden.
Auf dem Foto ist Isaac schon ein hagerer Fünfzigjähriger, der sich bemüht, eine kahle Stelle zu verstecken, und Nessim, damals kurz vor dem Ruhestand, sieht älter aus als seine Mutter, deren aufgesetzte Fröhlichkeit am Hochzeitstag ihres Sohnes ihre Sorgen nicht verbergen kann.
»Er ist ein Prinz und sie eine Bäuerin«, sagte sie. »Schaut nur, wie sie geht. In ihren Schritten klingt noch immer das Klappern der batavischen Holzschuhe.«
»Und auf seinem Kopf sieht man noch immer die Spuren eines unsichtbaren Käppchens. Sie sind also quitt. Lasst sie in Ruhe«, schimpfte ihre Tochter Esther. »Sein Leben lang hat er Geliebte gehabt und nie eine Ehefrau. Es wird langsam Zeit, dass er heiratet.«
»Ja, aber keine Christin.«
»Christlich, jüdisch, Belgien, Ägypten, das sind moderne Zeiten«, sagte Vili, »wir leben im zwanzigsten Jahrhundert.«
Doch seine Mutter war nicht überzeugt. Und auf dem Foto zeigt sie den misstrauischen Blick einer Hekuba, die Helena im Schoß der Familie willkommen heißt.
Im Hintergrund, verstohlen aus hohen Verandafenstern hervorspähend, sind die Gesichter dreier Ägypter zu erkennen. Zeinab, das Dienstmädchen, nicht älter als zwanzig, aber schon seit zehn Jahren in der Familie, lächelt schelmisch. Ahmed, der Koch, der aus Khartum kommt, versucht schamhaft, den Blick vom Fotografen zu wenden, indem er die rechte Hand vors Gesicht hält. Seine jüngere Schwester Latifa, mit ihren zehn Jahren noch ein richtiges Kind, starrt mit dunklen, spitzbübischen Augen in die Kamera.
Während sich die Familie von dem Isotta-Fraschini-Debakel erholte, verfolgte Onkel Vili schon eifrig eine ganz andere Karriere, die eines Faschisten. Er war ein so glühender Anhänger des Duce geworden, dass er verlangte, jeder in der Familie solle ein schwarzes Hemd tragen und, gemäß den faschistischen Gesundheitsidealen, täglich Sport treiben. Als aufmerksamer Beobachter des Wandels der italienischen Sprache, der von den Faschisten verfügt wurde, bemühte er sich, übernommene Anglizismen aus seiner Redeweise, seinem Geschmack und seiner Kleidung zu tilgen; als Italien den Äthiopien-Feldzug begann, forderte er die Familie auf, allen Goldschmuck dem italienischen Staat zu schenken und auf diese Weise Mussolinis imperialen Traum finanzieren zu helfen.
Die Ironie bei Onkel Vilis patriotischem Gehabe war, dass er, als er den Faschisten ewige Treue schwor, bereits britischer Geheimagent geworden war. Sein Engagement als Spion verhalf ihm zu der einzigen Karriere, für die er wirklich von Kindesbeinen an geeignet war. Es trug auch dazu bei, dass die anderen Familienangehörigen in Ägypten blieben, zumal sie jetzt in die Angelegenheiten nicht nur eines Reichs, sondern zweier Imperien verstrickt waren.
Vilis Eintritt in den Geheimdienst Seiner Majestät im Jahre 1936 fiel mit einem weiteren für die Familie glücklichen Umstand zusammen: der innigen Freundschaft zwischen seinem Bruder Isaac und dem neuen König Faruk, dem Sohn Fuads. Es ist nicht klar, wie Isaac seine Ernennung zum Direktor im Finanzministerium erhielt, doch schon bald nach seiner Hochzeit saß er auf einmal in den Aufsichtsräten der wichtigsten ägyptischen Aktiengesellschaften. Durch »Fraternismus«, der Brüdern gibt, was Nepotismus Vettern und Enkeln gibt, erledigte sich das Übrige, sodass meine anderen Onkel – Nessim, Cosimo und Lorenzo – allesamt lukrative Stellen in mehreren ägyptischen Bankhäusern erhielten. Vilis Auktionsgeschäft gedieh, die mütterliche Wohnung mit dem atemberaubenden Meeresblick wurde, was dringend nötig war, renoviert, dem Schwaben und Marta wurde Arnaut geboren, und Vili versöhnte sich schließlich mit seinem Schwager Albert.
Onkel Vili versuchte zunächst, den Charakter seiner neuen Berufstätigkeit zu verheimlichen. Nur Tante Lola und Onkel Albert wussten Bescheid. Aber der Versuchung, derartige Geheimnisse weiterzuerzählen, konnte er einfach nicht widerstehen, zumal sie überall Neid und Bewunderung hervorriefen. Fast fühlte er sich wieder als Soldat. Er trug immer eine Pistole, und bevor er sich zu den anderen an den Mittagstisch setzte, lockerte er das Halfter. »Was ist er eigentlich«, fragte der Schwab, »ein Gangster?« »Psst«, machte Tante Marta, »das darf niemand wissen.« »Aber es ist so offensichtlich, dass er ein Lockvogel sein muss. Die Engländer können unmöglich so dumm sein.«
Nun werden Kriege nicht deswegen gewonnen, weil die eine Seite findiger, sondern weil die andere eine Spur unfähiger ist. Die Italiener ahnten nicht, dass Vili sich auf die Seite der Engländer geschlagen hatte, und ließen ihn weiterhin in Ägypten und anderswo für sich arbeiten. Er war sehr oft auf Reisen, entweder bei der italienischen Armee in Äthiopien oder in Italien oder als Mitglied diverser italienischer Delegationen in Deutschland. Um sich für die Italiener noch unentbehrlicher zu machen, tat er sich als Experte für Transportfragen und Fachmann für Treibstoffversorgung von Wüstenkonvois hervor. Wie und wo er sich auch nur eine flüchtige Kenntnis dieser Materie verschaffte, ist rätselhaft, aber die Italiener brauchten jeden, den sie bekommen konnten. Sie nutzten Vilis florierendes Auktionshaus als Tarnung für seine häufigen Reisen zwischen Rom und Alexandria. Um nicht das Misstrauen der Engländer zu erregen, begann er auf Anraten der Italiener mit dem Import von Antiquitäten. Auf diese Weise konnte er in Italien mithilfe der Faschisten echte Raritäten zu einem Bruchteil ihres Wertes erwerben und sie an ägyptische Paschas für ein Vermögen weiterverkaufen.
Er wurde sehr reich. Im Laufe der Zeit wuchsen ihm nicht nur die vielen Privilegien eines englischen Gentleman-Spions zu, sein Doppelleben erlaubte es ihm auch, all die aufwendigen Rituale zu praktizieren – vom Frühstück bis zum Schlummertrunk –, um die er die Engländer insgeheim immer beneidet hatte. Zugleich wurde sein bedingungsloser italienischer Patriotismus befriedigt, wenn die faschistische Hymne erklang oder als die Italiener, nicht ohne deutsche Hilfe, schließlich einen Sieg über die Griechen errangen. »Wir haben Griechenland erobert«, rief er eines Tages, den Telefonhörer in der Hand, mit durchaus türkischer Schadenfreude, »endlich sind wir in Athen« – worauf alle Leute im Haus ganz außer sich vor Freude gerieten, was wiederum die ägyptischen Diener und Hausmädchen elektrisierte, die bei dem geringsten Anlass zum Feiern in trillerndes Geheul ausbrachen, bis irgendjemand mit einer sorgenvollen Bemerkung über das Schicksal der griechischen Juden die festliche Stimmung unweigerlich dämpfte.
Vilis Stimme hatte vor Erregung gezittert, genau wie an jenem Tag, als italienische Froschmänner sich in den Hafen von Alexandria stahlen und erheblichen Schaden an zwei britischen Schlachtschiffen anrichteten. Vili hatte sich für die kühnen Taucher begeistert, war aber völlig deprimiert, als er daran erinnert wurde, dass er ihre Aktion verurteilen musste. »Die gute alte Zeit ist vorbei«, sagte er dann, und damit meinte er die Zeit, als man immer wusste, wer man war und auf wessen Seite man stand.
Dann geschah etwas. Nicht einmal er konnte es ganz verstehen. »Die Dinge stehen nicht zum Besten«, sagte Vili. Auf Nachfragen meinte er nur: »Die Dinge.« Enerviert von seinen Antworten, versuchte seine Schwester Esther, es auf die sanfte Art aus ihm herauszubekommen: »Heißt das, du willst es nicht sagen oder du weißt es nicht?« »Doch, ich weiß es.« »Dann sag es uns.« »Es hat mit Deutschland zu tun.« »Das ahnten wir schon. Was ist mit Deutschland?« »Sie schnüffeln zu sehr in Libyen herum. Es bedeutet einfach nichts Gutes.«
Ein paar Monate später traf aus Marseille meine Großtante Elsa mit ihrem deutschen Mann ein. »Sehr schlimm. Furchtbar«, sagte sie. Man hatte ihr kein Ausreisevisum geben wollen. Isaac, der schon einmal seine Beziehungen zu französischen Diplomaten eingesetzt hatte, um französischer Staatsbürger zu werden, hatte sich abermals einschalten müssen, um seiner Schwester eine ungehinderte Ausreise zu ermöglichen. Im Hinblick auf ihren komplizierten Status – Italienerin, in Frankreich lebend, mit einem deutschen Juden verheiratet – waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich; Isaac verschaffte ihr und ihrem Mann Diplomatenpässe, die das Siegel des Königs von Ägypten trugen. Tante Elsa jammerte, sie habe ihr Geschäft mit religiösen Souvenirs in Lourdes verloren und zwei Jahre in großer Armut zubringen müssen. »Da habe ich gelernt, geizig zu sein«, erklärte sie, als ob ihre angeborene Knickerigkeit dadurch in einem sympathischeren Licht erschiene.
Kaum einen Monat später betrat Flora, die fünfundzwanzigjährige Halbschwester des Schwaben, den Salon des Hauses. Marta erkannte sofort die Schrift an der Wand. »Wenn alle aschkenasischen Juden aus Deutschland jetzt zu uns kommen, dann wird das für uns das Ende sein. In der Stadt wird es von Schneidern und Maklern wimmeln, und es wird mehr Zahnärzte geben, als wir brauchen können.«
»Wir konnten nichts verkaufen«, sagte Flora. »Sie haben uns alles genommen. Wir hatten nur das dabei, was wir tragen konnten.« Tante Flora war allein mit ihrer Mutter gekommen, Frau Kohn, einer kränkelnden älteren Frau mit weißer, rosa schimmernder Haut und klaren blauen Augen, die schlecht Französisch sprach und deren Gesichtsausdruck immer etwas Flehendes, Schreckhaftes hatte. »Sie haben sie vor zwei Monaten auf der Straße zusammengeschlagen«, erklärte ihre Tochter. »Dann wurde sie von einem Kaufmann beleidigt. Jetzt geht sie nicht mehr aus sich heraus.«
In jenem Frühsommer hielten sich mehrere Wochen lang Gerüchte in der Stadt von einem bevorstehenden, möglicherweise entscheidenden Schlag gegen das Afrikakorps. Rommels Truppen hatten eine Stellung nach der anderen erobert und waren entlang der libyschen Küste vorgestoßen. »Es wird eine furchtbare Schlacht geben. Dann werden die Deutschen einmarschieren.« Die Engländer, sagte Vili, seien völlig demoralisiert, zumal nach Tobruk. Überall herrsche Panik. Der kleine Küstenort Mersa Matruh unweit der libyschen Grenze sei in deutsche Hände gefallen. »Ihr Hass auf uns Juden ist noch größer als ihre Verachtung für die Araber«, sagte Tante Marta, als wäre das völlig unbegreiflich. Onkel Isaac, der viel über deutschen Antisemitismus gehört hatte, entwarf ein schreckliches Bild aus Gerüchten und schlimmen Erinnerungen an das Armenier-Massaker von 1895, dessen Zeuge er gewesen war. »Erst stellen sie fest, wer Jude ist, dann kommen sie nachts mit Lastwagen und schaffen alle jüdischen Männer in abgelegene Fabriken, sodass Frauen und Kinder verhungern müssen.«
»Du machst den anderen nur Angst, also hör sofort damit auf«, sagte Esther, die, wie andere Angehörige ihrer Familie auch, in der Türkei mindestens zwei Massaker an Armeniern erlebt hatte.
»Ja, aber die Armenier haben viel zu lange für die Engländer spioniert«, wandte Vili ein, der in diesem Fall mit den Türken sympathisierte, obwohl er im Ersten Weltkrieg aufseiten der Engländer und Italiener gegen sie gekämpft hatte, während sein Schwager Albert, der mit den Türken gegen die Engländer gekämpft hatte, die Massaker als barbarisch verurteilte. »Die Türken mussten dem einfach ein Ende bereiten, und zwar auf die einzige Weise, die sie kannten: mit Blut und noch mehr Blut. Aber was haben die Juden den Deutschen getan?«, fragte Onkel Nessim. »So wie einige Juden sich aufführen«, rief Tante Clara dazwischen, »würde ich sie aus dieser Welt in die nächste befördern. Es liegt an Juden wie ihnen, dass Juden wie wir gehasst werden«, sagte sie und schielte dabei zu ihrem Bruder Vili, den sie gerade mit einem seiner Lieblingssprüche zitiert hatte. »Du glaubst also wirklich, dass sie uns fortschaffen werden«, warf Marta mit zittriger Stimme ein. »Bitte, fang jetzt nicht an zu heulen! Wir sind mitten im Krieg«, rief Esther ungehalten. »Genau deswegen weine ich ja, weil wir mitten im Krieg sind«, sagte Tante Marta, »verstehst du nicht?« »Nein, das verstehe ich nicht. Wenn sie uns abholen, dann holen sie uns ab, und das ist das Ende …«
Wochen vor der ersten Schlacht von El Alamein entsann sich meine Urgroßmutter wieder eines alten Hausmittels. Sie lud alle Familienangehörigen in ihre große Wohnung ein, solange es die Situation erfordere. Niemand lehnte ab, und alle kamen, zu zweit und zu viert, wie weiland Noahs Tiere, einige aus Kairo und Port Said, andere sogar aus Khartum, wo sie sicherer gewesen wären als in Alexandria. Auf dem Fußboden wurden Matratzen ausgelegt, der Esszimmertisch wurde ausgezogen, und zwei weitere Köche wurden eingestellt, von denen der eine Tauben und Hühner züchtete für den Fall, dass es zu einer Versorgungskrise kommen sollte. Im Schutze der Dunkelheit wurden ein Schaf und zwei Mutterschafe heimlich ins Haus gebracht und auf der Terrasse neben dem behelfsmäßigen Hühnerstall angebunden.
Vormittags gingen alle aus dem Haus, um sich ihren Geschäften zu widmen. Zum Mittagessen kehrte jeder zurück, und während der langen Sommernachmittage saßen die Männer um den Esstisch und sprachen über ihre schlimmsten Befürchtungen, während die Kinder schliefen und die Frauen in den anderen Zimmern nähten oder stopften. Benötigt wurde vor allem warme Kleidung; die Winter in Deutschland seien sehr streng, sagten sie. In einer Ecke neben der Wohnungstür standen, ordentlich aufgestapelt, mehrere kleine Koffer, von denen einige aus der Jugendzeit ihrer Besitzer stammten, die sie in der Türkei oder an ausländischen Schulen verbracht hatten. Inzwischen fleckig und ramponiert, mit vergilbten Aufklebern von europäischen Grandhotels versehen, warteten sie in der Diele stumm auf den Tag, da die Nazis in Alexandria einmarschieren und alle männlichen Juden über achtzehn abführen würden, wobei jeder nur einen kleinen Koffer mit dem Allernötigsten dabeihaben dürfte.
Nachmittags ging der eine oder andere wieder aus dem Haus, und die Frauen schauten vielleicht im Sporting Klub vorbei, doch zur Teezeit waren die meisten wieder daheim. Abends gab es gewöhnlich einen leichten Imbiss, bestehend aus Brot, Konfitüre, Obst, Käse, Schokolade und selbst gemachtem Joghurt – Ausdruck von Tante Elsas sparsamer Haushaltsführung, Onkel Vilis spartanischen Ernährungsregeln und der einfachen Herkunft meiner Urgroßmutter. Nach dem Essen wurde Kaffee serviert, und man versammelte sich im Wohnzimmer, um Radio zu hören, sei es BBC, sei es ein italienischer Sender – die Nachrichten waren immer verwirrend.
»Ich weiß nur, dass die Deutschen Suez brauchen. Deshalb müssen sie angreifen«, behauptete Vili.
»Ja, aber können wir sie aufhalten?«
»Nur kurzfristig. Langfristig, wer weiß? General Montgomery mag ein Genie sein, aber Rommel ist Rommel«, erklärte Onkel Vili.
»Was sollen wir nur tun?«, fragte Tante Marta, wie immer am Rand eines hysterischen Anfalls.
»Tun? Wir können nichts tun.«
»Was soll das heißen, wir können nichts tun? Wir könnten fliehen.«
»Und wohin?«, fragte Esther ärgerlich.
»Fliehen. Ich weiß nicht. Fliehen!«
»Aber wohin?« Ihre Schwester ließ nicht locker. »Nach Griechenland? Griechenland haben sie schon erobert. In die Türkei? Von dort kommen wir gerade. Nach Italien? Dort würden sie uns ins Gefängnis stecken. Nach Libyen? Dort sind die Deutschen schon. Begreifst du nicht, dass alles aus ist, sobald sie Suez erobern?«
»Was meinst du damit, alles aus? Du glaubst also, dass sie siegen?«
»Ach, ich weiß es nicht«, stöhnte Vili.
»Na los, sag schon. Sie werden siegen und uns dann alle abtransportieren.«
Vili antwortete nicht.
»Und wie wärs mit Madagaskar?«, meinte Tante Marta. »Madagaskar! Bitte, Marta, tu mir den Gefallen!«, warf Onkel Isaac ein.
»Oder Südafrika. Oder Indien. Was ist falsch daran, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Vielleicht verlieren sie ja.«
Es entstand eine kleine Pause.
»Sie werden nicht verlieren«, sagte Tante Flora schließlich.
»Wo du ein so fixes Mundwerk hast, Flora, warum bist du nicht schon längst fort?«, fragte Marta, fast schäumend vor Verachtung. »Warum bist du noch hier?«
»Du vergisst, dass ich schon einmal geflohen bin.«
Tante Flora zog gedankenverloren an ihrer Zigarette, blies dann nach einer Weile mit träumerischer, wehmütiger Miene den Rauch aus und beugte sich von ihrer Sofaecke zum Teetisch, um ihre Zigarette auszudrücken. Alle hatten sich ihr zugewandt, fragten sich, warum sie ständig Schwarz trug, wo doch Grün am besten zu ihren Augen passte. »Ich weiß nicht«, sagte sie und starrte weiter auf ihre Finger, die noch immer die langsamen Bewegungen machten, obwohl die Zigarette längst ausgedrückt war. »Ich weiß es nicht«, sagte sie zögernd. »Ich kann nirgendwohin. Ich bin es müde, wegzulaufen, und vor allen Dingen, darüber nachzudenken, wohin ich laufen soll. Die Welt ist nicht groß genug. Und es ist auch zu spät dafür. Tut mir leid«, sagte sie, an ihren Bruder gewandt. »Ich will nirgends mehr hin. Ich will nicht einmal mehr verreisen.« Schweigen legte sich über das Zimmer. »Die Wahrheit ist, wenn ich überzeugt wäre, dass wir eine Chance hätten, würde ich mich in der Wüste verstecken. Aber ich glaube nicht daran.«
»So jung und schon so pessimistisch«, rief Vili daraufhin, mit dem gönnerhaften Schmunzeln eines Mannes, der alles über ängstliche Frauen weiß und auch, wie man sie beruhigt. »Es steht nicht geschrieben, dass die Deutschen siegen müssen, weißt du. Möglicherweise verlieren sie. Ihre Treibstoffvorräte sind knapp, und sie haben sich übernommen. Sollen sie Ägypten angreifen, sollen sie so tief nach Ägypten einfallen, wie sie wollen. Am Ende siegt immer der Sand, vergiss das nicht« – ein Plädoyer für die Strategie des Abwartens, mit der Hannibals Gegner, Quintus Fabius Maximus, als Cunctator in die Geschichte eingegangen ist.
»›Am Ende siegt immer der Sand.‹ Ich bitte dich, Vili«, spottete Tante Flora und trat auf den Balkon hinaus, wo sie sich eine neue Zigarette anzündete. »Was meint er bloß?«, sagte sie laut zu Esthers Sohn, der ebenfalls rauchend auf dem Balkon stand.
»Der Sand siegt immer«, wiederholte Vili nachdrücklich, als hätte man ihn schon beim ersten Mal verstehen müssen. »Ihre Invasionspläne mögen perfekt sein, aber wir sind besser bewaffnet, besser ausgerüstet, und wir haben mehr Soldaten. Ihr werdet sehen, welchen Schaden ein paar Monate Wüstensand unter Rommels Panzern anrichten können. Also, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Wir werden einen Weg finden. Wir sind mit schlimmeren Feinden fertiggeworden, wir werden auch diesen überstehen.«
»Schön formuliert«, erwiderte Esther, die trotz ihres grimmigen Realismus positiv dachte und einfach nicht glauben mochte, dass die Katastrophe unmittelbar bevorstand. »Ich wusste, dir würde am Ende etwas einfallen«, sagte sie und warf ihrem schweigsamen Mann jenen verächtlichen, skeptischen Blick zu, mit dem alle angeheirateten Ehegatten in dieser Familie bedacht wurden.
»Solange wir Mut haben und zusammenhalten und nicht in Panik geraten und nicht leeren Gerüchten glauben, die zwischen dieser Näherin und jener Friseuse ausgetauscht werden, Schwestern«, rief Vili, »werden wir auch das überstehen.« Er trug diesen Appell in der einzigen ihm bekannten Ausdrucksweise vor: durch Anleihen bei Churchill und Mussolini.
»Mit anderen Worten, wir warten«, folgerte Marta.
»Wir warten.«
Und da lag es schon in der Luft, im Verborgenen wartend, wie ein Pianist, der sich vor einem lange erwarteten Konzert die Finger massiert, oder wie ein Schauspieler, der sich kurz räuspert, bevor er auf die Bühne tritt. Es ging einher mit dem zuversichtlichen Glanz in seinen Augen, dem gestreckten Rücken und dem vertrauten Beben in der Stimme, die jetzt ihre passende Tonlage erreichte: »Wir haben andere Dinge überstanden, wir werden auch dies überstehen. Schließlich sind wir fünftausend Jahre alte Juden – sind wir, oder sind wir nicht?«
Die Stimmung im Raum hob sich, und Vili, der durchaus etwas Demagogisches an sich hatte, bat Flora, ein Stück von Goldberg zu spielen oder auch von Brandenburg, er wisse nicht mehr, von wem.
»Du meinst Bach«, sagte Flora und ging zum Klavier.
»Bach, Offenbach, c’est tout la même chose, alles dasselbe. Todos lechli, alles Aschkenasim«, brummte er. Nur Esther hörte ihn. Sie drehte sich sofort um und versuchte, ihn mit strenger Miene zum Schweigen zu bringen. »Sie versteht es!« Doch Vili war ungerührt. »Es gibt nur eines, was sie versteht, und alle Männer hier im Raum wissen, was das ist.«
Die Halbschwester des Schwaben hörte diese Worte nicht. Sie nahm ihren Ring ab, legte ihn neben die Tasten und begann, etwas von Schubert zu spielen. Jeder war hocherfreut.
Sie spielte bis in die Nacht hinein, bis alle, einer nach dem anderen, ins Bett gegangen waren, jede Nacht spielte sie, leise, ohne von den Männern Notiz zu nehmen, die es müde wurden, auf sie zu warten, und über Esthers Sohn und seinen albernen wertherschen Weltschmerz spotteten. Und dann waren er und Flora eines Nachts allein im Salon, und sie hatte aufgehört zu spielen, und er versuchte, das herzlose Gerede von Liebe in Zeiten des Krieges wegzuküssen. In ihrem Zimmer, das eigentlich dem Dienstmädchen Latifa gehörte, nahm Flora ihre Ringe und Ohrringe wieder ab, stellte ihr Cognacglas auf das wacklige Nachttischchen und sagte: »Jetzt kannst du mich küssen.« Aber sie küsste ihn zuerst. »Es bedeutet nichts«, fügte sie hinzu, während sie zur Seite sah, die Petroleumlampe anzündete und den Docht so weit hinunterdrehte, dass er schwächer glühte als ihre Zigarette. »Solange wir uns klar darüber sind, dass es nichts bedeutet«, sagte sie, und sie schien es fast zu genießen, andere auf brutale Weise mit ihrer Verzweiflung anzustecken.
Dann kam die wunderbare Nachricht. Die Achte Armee der Briten hatte Rommels Vormarsch in El Alamein aufhalten können und im Herbst 1942 schließlich zum entscheidenden Schlag gegen das Afrikakorps ausgeholt. Zwölf Tage dauerte die Schlacht. Nachts stand die ganze Familie stundenlang auf dem Balkon, wie in Erwartung eines festlichen Feuerwerks, angestrengt in westlicher Richtung über die verdunkelte Stadt schauend, um etwas von der historischen Schlacht zu sehen, die ihrer aller Schicksal bestimmen würde. Man rauchte, man plauderte untereinander oder mit den Nachbarn, die ebenfalls dicht gedrängt auf ihren Balkonen standen, man winkte einander zu, Hoffnung und Resignation andeutend, während aus leeren Zimmern ein unaufhörliches Krächzen von Kurzwellensendern kam, die über die jüngsten Entwicklungen in Nordafrika berichteten. Ein ferner Lichtschein lag daumenbreit über dem westlichen Horizont, schwankend im Dunkel, plötzlich aufstrahlend wie der Scheinwerfer eines Autos, das einem hinter einer Bergkuppe entgegenkommt, dann wieder verblassend, ein fahler Mond in dunstiger Nacht. Nur ein weit entferntes, dumpfes Dröhnen war zu hören, wie das Surren von Ventilatoren an einem ruhigen Sommerabend oder das Summen des großen Kühlschranks in der Speisekammer. Die Leute gingen schlafen, während in der Ferne der Schlachtenlärm rumorte.
»Siehst du? Deine Angst, dass sie dich abholen, alles umsonst. Hab ich es dir nicht gesagt?«, sagte Vili zu seiner Schwester Marta, als klar wurde, dass die Engländer einen entscheidenden Sieg errungen hatten.
Alle schickten sich an, Urgroßmutters Wohnung wieder zu verlassen. Doch die Vorbereitungen kamen nur langsam, unsicher, ja zögernd voran, nicht nur, weil sich alle an das Flüchtlingsleben gewöhnt hatten und auf das Gemeinschaftsgefühl nicht verzichten wollten, sondern auch deswegen, weil niemand mit der Erklärung, jede Gefahr sei nun gebannt, das Schicksal herausfordern wollte. »Wozu die Eile?«, sagte meine Urgroßmutter. »Es sind noch viele Tauben und Hühner übrig. Außerdem, bei den Deutschen weiß man nie. In ein paar Wochen können sie wieder zurück sein.« Doch das Packen ging weiter.
Zum Abschied beschloss meine Urgroßmutter, ihren Söhnen und Töchtern jeweils ein mit goldenen Lilien versehenes Kristallglas zu schenken, das in der türkischen Glasfabrik des Urgroßvaters hergestellt worden war.
»Es ist das letzte Mal, dass so viele Menschen in dieser Wohnung sind«, erklärte die alte Dame.
»Wie die Dinge augenblicklich stehen, wäre ich mir nicht so sicher«, sagte Esther.
Esther hatte recht. Noch dreimal suchte man Unterschlupf in der Wohnung der alten Matriarchin: 1956 während des Suezkriegs, dann ein Jahrzehnt später und vorher schon, im Jahre 1948, nachdem Vili von zionistischen Agenten aufgespürt und übel zusammengeschlagen worden war, weil er für die Engländer spioniert hatte. Sie drohten, mit den anderen männlichen Familienmitgliedern ähnlich zu verfahren. Zwei Monate später bekam Vili Wind, dass sie wieder hinter ihm her waren und ihn diesmal umbringen würden. Er verbarg sich im Haus seiner Mutter. Eines Tages nahm er sein Glückspendel und legte seine Zyankalikapsel, die er seit den Tagen von El Alamein besaß, auf den Tisch. Das Pendel sagte Nein.
Vili verschwand erst nach Italien, dann nach England, wo er einen anderen Namen annahm, zum Christentum übertrat und alle vorangegangenen Staatsangehörigkeiten aufgab. Schon vier Jahre später tauchte er wieder in Ägypten auf, zum spektakulärsten Geschäft in seiner Karriere als Spion, Soldat und Schwindler: zur Versteigerung des Eigentums des abgesetzten Königs.
»Das war das Ende vom Ende«, erklärte er viele Jahre später in seinem Garten in Surrey. »Das Ende eines Zeitalters, das Ende einer Welt. Danach brach alles auseinander.«
Inzwischen war er Mitte achtzig, er liebte Pferde, Süßigkeiten und schmutzige Witze, und mit der Faust seines steif gewordenen Unterarms illustrierte er die saftigen Geschichten, die er in der gewohnten Manier erzählte: mit obszönen Gesten und übertriebener Mimik. Mit seiner alten Tweedhose, den Clarks, dem Halstuch und der fleckigen Kaschmirweste verkörperte er genau die Rolle, die er zeit seines Lebens geprobt hatte: die des viktorianischen Gentlemans, dem es völlig gleichgültig ist, was Rangniedere von ihm oder seinem Äußeren halten. Seine aristokratische Erscheinung wirkte besonders überzeugend, weil man bei seinem Anblick sofort Armut vermutete.
Er hatte mir seinen Obstgarten gezeigt, in dem nie etwas Vernünftiges wuchs, den großen Teich, der dringender Pflege bedurfte (»Wen interessiert das schon?«), den Stall mit mehr Pferden, als Platz vorhanden war, und dahinter den Wald, in den sich niemand hineinwagte – eine Art verwilderte Jane-Austen-Welt. »Ich weiß nicht«, sagte er, als ich ihn fragte, was hinter seinem Wald lag. »Ein Nachbar vermutlich. Aber diese englischen Lords, wer kennt sie schon?«
Das stimmte nicht. Er kannte sie sehr gut. In Wahrheit kannte er jeden. Auf dem Postamt, in der Bank, in einem der Pubs, wo er mich zu einem Bier einlud, kannte jeder Dr. Spingarn. »Well, hello« und »Cheerio« gingen ihm so leicht über die Lippen, als hätte er von Geburt an Englisch gesprochen. Er wusste alles über Fußball. Als eines Morgens, wir waren auf dem Weg in die Stadt, ein Mini-Morris neben uns hielt, begriff ich, wie tief er mit seiner neuen Heimat verwurzelt war. Es war Lady Soundso, die nach London unterwegs war und wissen wollte, ob er irgendetwas benötigte. »Kein Problem«, sagte sie, als er schließlich einwilligte, sich von ihr eine Kiste französischen Wein mitbringen zu lassen. »Sans façons«, fügte sie hinzu, erfreut darüber, mit ihrem Französisch angeben zu können, und versprach, dass Arthur, ihr Mann, den Wein noch am selben Abend höchstpersönlich vorbeibringen werde. »Entendu«, rief sie, während sie schon das Fenster hochkurbelte und dann auf der stillen Landstraße weiterfuhr in Richtung Autobahn.
»Sie ist trocken wie ein Dörrpflaume. Wie alle Engländerinnen.«
»Ich fand sie aber sehr nett«, sagte ich und erinnerte ihn daran, dass die Dame zuerst bei ihm zu Hause vorbeigeschaut hatte und dann, als sie hörte, dass er sich auf einem Spaziergang befinde, losgefahren war, um nach ihm zu suchen. »Sehr nett, sehr nett«, wiederholte er, »alle sind sehr nett hier. Du verstehst überhaupt nichts.«
In der Stadt winkte Vili dem Antiquitätenhändler zu und beschloss, ihm einen Besuch abzustatten.
»Guten Tag, Dr. Spingarn«, sagte der Händler.
»Gott zum Gruß«, erwiderte Vili und stellte mich vor. »Haben Sie mein türkisches Kaffeekännchen inzwischen gefunden?«
»Noch immer auf der Suche, noch immer auf der Suche«, trällerte der Händler, während er eine alte Uhr abstaubte.
»Neun Jahre sind es jetzt«, kicherte Vili. »Ich werde wohl tot sein, bevor Sie es gefunden haben.«
»Keine Sorge, Dr. Spingarn. Sie werden uns alle noch überleben.«
»Sie sind langsamer als Araber und doppelt so dumm. Wie haben sie es nur geschafft, ein Kolonialreich zu errichten?«, sagte er, sobald wir den Laden verlassen hatten.