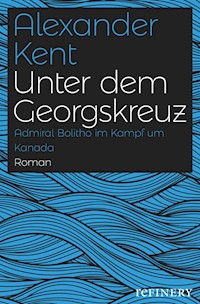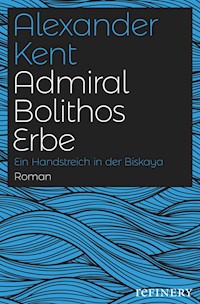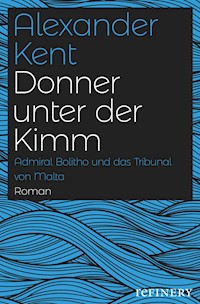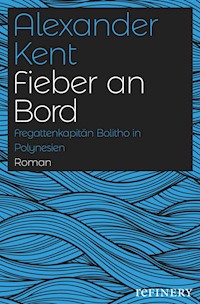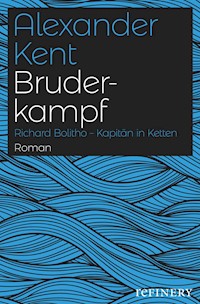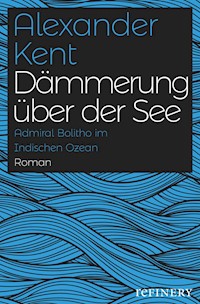
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Man schreibt das Jahr 1809, und der Krieg gegen Napoleon befindet sich auf dem Höhepunkt. Admiral Bolitho erhält den Befehl, mit der kampfstarken Fregatte Valkyrie und einem Geschwader aus kleineren Schiffen in den Indischen Ozean auszulaufen, um die britischen Goldtransporte aus Indien vor Angriffen zu schützen. Doch bereits im Südatlantik kommt es zu einem schicksalsträchtigen Seegefecht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Dämmerung über der See
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester. Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
Man schreibt das Jahr 1809, und der Krieg gegen Napoleon befindet sich auf dem Höhepunkt. Admiral Bolitho erhält den Befehl, mit der kampfstarken Fregatte Valkyrie und einem Geschwader aus kleineren Schiffen in den Indischen Ozean auszulaufen, um die britischen Goldtransporte aus Indien vor Angriffen zu schützen. Doch bereits im Südatlantik kommt es zu einem schicksalsträchtigen Seegefecht …
Alexander Kent
Dämmerung über der See
Admiral Richard Bolitho im Indischen Ozean
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinSeptember 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010© der deutschen Ausgabe: Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin, 1994 Erschienen bei William Heinemann 1993 © Highseas Authors Ltd., 1993Titel der englischen Originalausgabe: The Darkening SeaCovergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-104-1
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Landfall
II Ein sehr ehrenwerter Mann
III Nächtliche Stimmen
IV Strategie
V Keine Geheimnisse
VI Die Valkyrie
VII Konfrontationen
VIII Freunde und Feinde
IX Intrigen
X Gekreuzte Klingen
XI Das Entermesser
XII Vertrauen
XIII Es hätten auch wir sein können …
XIV Catherine
XV Nur ein Gefühl
XVI Kapitäne
XVII Noch ist nicht alles verloren
XVIII Der gefährlichste Franzose
Epilog
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
I Landfall
Widmung
Für Mike und Bee Hartree, in Liebe
Motto
The lights begin to twinkle from the rocks:The long day wanes: the slow moon climbs: the deep Moans round with many voices. Come, my friends,Tis not too late to seek a newer world.Push off, and sitting well in order smiteThe sounding furrows; for my purpose holdsTo sail beyond the sunset, and the bathsOf all the western stars, until I die.
Tennyson, Ulysses
I Landfall
Der gewundene Pfad, der sich um die weite Bucht von Falmouth zog, war gerade breit genug, um Pferd und Reiter Platz zu bieten. Er war kaum ungefährlicher als der Fußpfad, der sich irgendwo weiter unten befand. Für einen Fremden oder einen Furchtsamen würden beide gleich gefährlich sein.
An diesem Morgen schien die Küste verwaist, die Geräusche beschränkten sich auf das Kreischen der Seevögel, das gelegentliche lebhafte Trillern eines Rotkehlchens und den wiederholten Ruf eines Kuckucks, der nicht näher zu kommen schien. An einigen Stellen war die Steilküste abgebrochen. Dort verlief der Weg so nahe am Rand, daß man von unten das Brechen der See an den zerklüfteten Felsen hören konnte.
Feuchte Kälte hing in der Luft, obwohl es Ende Juni war und der Horizont sich in wenigen Stunden scharf und klar abzeichnen und die See wie Millionen Spiegel glitzern würde. Pferd und Reiter nahmen langsam eine niedrige Bodenwelle und blieben bewegungslos stehen; an diesem verhexten Küstenstreifen wirkten sie wie eine Erscheinung, die jederzeit plötzlich wieder verschwinden konnte.
Lady Catherine Somervell versuchte sich zu entspannen, während sie in den treibenden Dunst zurückblickte. Man mußte sie in dem großen grauen Haus unten in Pendennis Castle für verrückt halten, so wie der Pferdejunge, der seine Laterne hochgerissen hatte, als sie ihn aus dem Schlaf holte. Er hatte gemurmelt, daß er den Stallmeister oder den Kutscher rufen würde, aber das hatte sie abgelehnt. Während er Tamara sattelte, die kräftige Stute, von Richard Bolitho für sie ausgesucht, hatte sie immer noch diese drängende Unruhe gespürt, die ihr keinen Frieden ließ.
Sie hatte sich in dem großen Raum, ihrem gemeinsamen Zimmer, eilig angekleidet. Ihr langes dunkles Haar war nur nachlässig über den Ohren zusammengesteckt. Sie trug ihren dicken Reitrock und einen von Richards alten Marinemänteln, die sie oft während ihrer Spaziergänge auf den Klippen benutzte.
Während sich Tamara vorsichtig ihren Weg suchte, merkte sie, wie der Ginster und die Büsche an ihrem Rock zerrten, und schmeckte dabei die See auf den Lippen. Die See, der Feind, wie es Bolitho einmal in einem der seltenen privaten Momente ausgedrückt hatte; seine Stimme war bitter gewesen.
Sie klopfte auf den Hals des Pferdes, um sich selber Mut zu machen. Ein schnelles Postschiff hatte die Neuigkeiten aus der Karibik nach Falmouth gebracht. Die englische Flotte und eine beachtliche Landstreitmacht aus Soldaten und Marineinfanterie hatten Martinique angegriffen, den wichtigsten französischen Stützpunkt für Marineoperationen dort. Die Franzosen hatten sich ergeben, ihre Aktivitäten in der Karibik und auf dem Festland waren zum Erliegen gekommen.
Catherine hatte die Gesichter der Leute auf dem Platz beobachtet, als der Dragoneroffizier die Nachricht verlesen hatte. Den meisten von ihnen dürfte die Bedeutung Martiniques, das seit Jahren ein Dorn im Fleische der Briten war, nicht bewußt gewesen sein. Viele dürften nicht einmal gewußt haben, wo es lag. Es herrschte wenig Begeisterung, und es gab auch keine Hochrufe, denn man schrieb das Jahr 1809. Vier Jahre waren vergangen, seit Nelson, der Liebling der Nation, seinen Tod gefunden hatte. Die Schlacht bei Trafalgar war vielen als die entscheidende Wende in diesem endlosen Krieg erschienen.
Mit dem Postschiff war auch ein Brief von Richard gekommen. Er war in großer Eile geschrieben worden und enthielt keine Einzelheiten. Der Kampf war vorüber, und er verließ sein Flaggschiff, den Vierundneunziger Black Prince, um gemäß Befehl sofort nach England zurückzukehren. Es erschien ihr sogar noch jetzt unglaublich. Er war nur wenig länger als neun Monate fort gewesen. Sie hatte sich selber auf eine viel längere Zeitspanne vorbereitet – zwei Jahre oder sogar drei. Sie hatte nur für seine Briefe gelebt und stand ansonsten Bryan Ferguson, Bolithos einarmigem Verwalter, helfend zur Seite. Da jeder junge Mann in die Flotte gepreßt wurde, der nicht das Glück hatte, schützende Gönner zu haben, war es schwierig geworden, die Landwirtschaft und das Anwesen in Schuß zu halten. Es gab ein paar verkrüppelte Männer, die früher unter Bolitho gedient hatten, Männer, um die er sich jetzt kümmerte, so wie er es früher auch auf See versucht hatte. Viele Gutsbesitzer würden sie an den »Strand« geworfen haben, wie Richard es ausdrückte. Sie hätten dann bei denen betteln müssen, für deren Schutz sie gekämpft hatten.
Aber alles, was jetzt zählte, war, daß er nach Hause kam. Zuerst nach Falmouth. Sie zitterte, als ob es Winter wäre. Alles andere konnte warten, bis er hier war, in ihren Armen.
Unzählige Male hatte sie seinen kurzen Brief gelesen. Dabei hatte sie versucht herauszufinden, warum man von ihm verlangte, daß er sein Kommando einem anderen Admiral übergab. Auch Valentine Keen war abgelöst worden und stand wahrscheinlich zur Beförderung an. Sie dachte an Keens junge Frau und fühlte einen Anflug von Neid, denn Zenoria war schwanger und mußte bald niederkommen, vielleicht war das Kind schon geboren. Keens wohlmeinende Familie hatte Zenoria in einem ihrer schönen Häuser in Hampshire untergebracht. Sie war das einzige Mädchen gewesen, mit dem es Catherine leichtgefallen war, zu sprechen. Liebe, Leiden, Tapferkeit – sie hatten beide diese Gefühle in der Vergangenheit bis zur Neige ausgekostet.
Nachdem sie Richards Briefe bekommen hatte, war ein unerwarteter Besucher aufgekreuzt. Stephen Jenour, sein ehemaliger Flaggleutnant, war frischgebackener Kommandant auf der schmucken Brigg Orcadia. Er kam sie besuchen, während sein Schiff auf der Reede von Carrick Ausrüstung übernahm. Es war ein verwandelter Jenour, was nicht nur auf die Strapazen in dem offenen Boot nach dem Schiffbruch der Golden Plover zurückzuführen war. Sein eigenes Kommando, das er auf Bolithos Drängen hin nach seiner Rückkehr nach England auf ihrer eroberten französischen Prise bekommen hatte, trennte ihn von seinem Vorgesetzten, den er mehr respektiert, ja sogar geliebt hatte, als jeden anderen, dem er während seines kurzen Lebens begegnet war.
Sie hatten sich unterhalten, bis die Schatten schwarz im Raume lagen und die Kerzen blakten. Er hatte ihr in seinen eigenen Worten von der Schlacht berichtet, so wie es Bolitho gewünscht hatte. Aber als er sprach, hörte sie immer nur Richard und die Männer, die gekämpft und gestorben waren, die Hurrarufe und das Stöhnen, Sieg und Verzweiflung.
Was würde Richard auf seiner Heimreise denken? Von den wenigen Glücklichen, die ihm nahestanden, seiner Bruderschaft? Jetzt, nach Jenours Ausscheiden, waren es noch weniger.
Nach einem Schenkeldruck ihrer Herrin setzte sich Tamara wieder in Bewegung. Ihre Ohren spielten in Richtung See, wo die Wogen unablässig gegen die Felsen brandeten. Sie hatten auflaufendes Wasser. Catherine lächelte. Sicher hatte sie Richard und seinen Freunden zu lange zugehört, ebenso den Fischern, die ihren Fang nach Flushing oder direkt nach Falmouth brachten.
Die See war immer da – und wartete.
Angestrengt blickte sie hinaus, aber der Dunst war noch zu dicht und das Licht noch zu schwach, als daß man das Kap hätte sehen können.
Sie dachte über ihren Ritt nach. Das Landleben begann sich zu regen. Die Luft roch nach frischgebackenem Brot, nach den Fingerhüten und den wilden Heckenrosen. Sie hatte nur wenige Menschen gesehen, aber ihre Gegenwart gefühlt. Diesem Menschenschlag hier entging wenig. Die Familien kannten die Bolithos seit Generationen, ebenso die Männer, die Jahr für Jahr fortgegangen waren, um in vergessenen Scharmützeln oder großen Seeschlachten zu sterben. So wie die Porträts an den Wänden des alten Hauses, die auf sie herabblickten, wenn sie alleine nach oben ins Schlafzimmer ging. Noch immer schienen sie sie abschätzend zu mustern.
Zumindest würde Richard die Tage auf See mit seinem geliebten Neffen Adam teilen können. Er hatte seinen Brief damit beendet, daß er als Passagier auf Adams Schiff mitsegeln würde. Sie erlaubte sich, nochmals an Zenoria zu denken und dann an Zenoria und Adam.
War es pure Einbildung oder dieser warnende Instinkt, der sich bei ihr aus den Erfahrungen ihrer jungen Jahre entwickelt hatte? Sie riß das Pferd herum, ihre Hand packte die leichte Reiterpistole, die sie immer mit sich führte. Sie hatte die Männer weder gesehen noch gehört. Erleichterung durchflutete sie, als sie das schwache Glitzern der Uniformknöpfe erkannte. Es waren Männer der Küstenwache.
Einer rief aus: »Oh, Lady Somervell! Sie haben uns aber auf Trab gehalten! Toby hier dachte, daß ein paar Ehrenmänner Konterbande vom Strand heraufschaffen!«
Catherine versuchte zu lächeln. »Es tut mir leid, Tom, ich hätte es besser wissen müssen.«
Das Licht wurde stärker, so als ob es ihre Hoffnungen zerstören und ihre Dummheit bloßlegen wollte.
Tom von der Küstenwache betrachtete sie nachdenklich. Sie war die Frau des Admirals, über die man sich in London das Maul zerriß, schenkte man den Gerüchten Glauben. Aber sie hatte ihn mit seinem Namen angeredet. Als ob er von Bedeutung wäre.
Vorsichtig erkundigte er sich: »Darf ich fragen, M’lady, was Sie zu dieser Stunde hier oben wollen? Es könnte nicht ungefährlich sein.«
Sie sah ihn direkt an. Später mußte er sich oft an diesen Augenblick erinnern, ihre schönen dunklen Augen, die hohen Wangenknochen, die Überzeugung in ihrer Stimme, als sie sagte: »Sir Richard kommt nach Hause. Mit der Anemone.«
»Das weiß ich, M’lady. Die Marine hat uns entsprechend benachrichtigt.«
»Heute«, fuhr sie fort, »heute morgen.« Ihre Augen schienen feucht zu werden, und sie wandte sich ab.
Tom erwiderte freundlich: »Das kann niemand sagen, M’lady. Wind, Wetter, Strömungen …«
Er brach ab, als sie aus dem Sattel rutschte und ihre schmutzigen Stiefel auf den Pfad knallten. »Was ist los?«
Sie starrte auf die Bucht hinaus, wo der Dunst aufzureißen begann, das Licht sich über das Vorland wie flüssiges Glas ergoß.
»Haben Sie ein Fernglas, bitte?« Ihre Stimme war nicht ohne Schärfe.
Die beiden Männer stiegen ab, und Tom zog sein Fernglas aus dem langen Lederfutteral hinter dem Sattel.
Catherine beachtete sie nicht mehr. »Steh still, Tamara!« Sie legte das lange Teleskop auf den Sattel, der noch warm von ihrem Körper war. Möwen kreisten um ein kleines Boot weit draußen in Richtung des Kaps. Die Sicht war viel besser als vorher, die ersten Sonnenstrahlen fielen rötlich auf die Wasseroberfläche.
Toms Kamerad hatte auch sein Teleskop ausgezogen und meinte nach ein paar Minuten: »Da is’ ’nen Schiff da draußen, Tom, so wahr wie der liebe Gott selber! Verzeihung, M’lady!«
Sie hatte ihn nicht gehört. Sie studierte die Segel, die schmutzig und starr wirkten wie Muscheln, darunter den dunklen schlanken Rumpf.
»Was ist es für ein Schiff, Toby? Kannst du das Rigg ausmachen?«
Der Mann klang verblüfft. »Ohne Zweifel ‘ne Fregatte. Davon hab’ ich jede Menge im Laufe der Jahre die Reede von Carrick anlaufen oder von ihr absegeln sehen!«
»Aber das kann doch jede beliebige Fregatte sein. Reite zum Hafen hinunter und versuche mehr in Erfahrung zu bringen.«
Beide drehten sich um, als sie leise feststellte: »Er ist es.«
Sie hatte das Fernglas zur vollen Länge ausgezogen. Sie wartete, bis das Pferd stillstand, damit sie genau sehen konnte. Schließlich meinte sie: »Ich kann die Galionsfigur im Sonnenlicht ausmachen.« Mit Augen, die plötzlich blind waren, reichte sie das Fernglas zurück.
»Anemone …« Sie sah es vor ihrem inneren Auge, so wie sie es eben in Realität gesehen hatte, bevor das Schiff in den Schatten zurückgewendet hatte: das vollbrüstige Mädchen mit der erhobenen Trompete. Die goldene Farbe hell glänzend im reflektierenden Licht. Sie wiederholte es wie für sich selbst: »Anemone … Tochter des Windes.«
Sie legte ihr Gesicht an das Pferd. »Gott sei Dank, du bist zu mir zurückgekommen.«
Vizeadmiral Sir Richard Bolitho erwachte aus unruhigem Schlaf und starrte in die Dunkelheit der kleinen Schlafkammer. Sein Hirn nahm sofort die Geräusche und Bewegungen um ihn herum wahr. Sein seemännischer Instinkt sagte ihm, daß auch über der See noch Dunkelheit herrschte. Er lauschte auf das dumpfe Rütteln der Pinne auf dem Ruderschaft, wenn das Ruder den Kräften der See und dem Druck des Windes in den Segeln Widerstand leistete. Er hörte das Rauschen des Wassers am Rumpf, als sich die Fregatte Anemone auf dem neuen Bug auf die See legte. Ihre Bewegungen hatten sich verändert. Die langen, weit ausschwingenden Stöße des westlichen Ozeans unter abwechselnd prallem Sonnenschein und peitschenden Regenböen waren vorbei. Jetzt war der Seegang kurz und steil, durch den sich das Schiff näher an das Land heranarbeitete. Drei Wochen seit der Karibik. Adam hatte seine Anemone angetrieben wie ein Vollblut, das sie ja auch war.
Bolitho kletterte aus der pendelnden Koje und stützte sich mit einer Hand an einem Deckenbalken ab, bis er sich an die heftigen Bewegungen gewöhnt hatte. Eine Fregatte: Mehr konnte sich ein Mann nicht wünschen. Er erinnerte sich an die, die er in seiner Jugend kommandiert hatte, damals war er noch jünger als Adam gewesen. Er konnte sich noch genau an die verschiedenen Schiffe erinnern, nur die Gesichter der Männer erschienen ihm undeutlich – waren fast verschwunden.
Er spürte, daß sein Herz heftiger klopfte, wenn er an das sich nähernde Land dachte. Nach den einsamen Meilen auf dem Ozean waren sie jetzt fast zu Hause. Heute würden sie vor Falmouth ankern. Adam würde Frischwasser übernehmen und dann sofort nach Portsmouth versegeln. Von dort würde er über den neuen Telegrafen, der den Haupthafen mit der Admiralität in London verband, einen knappen Bericht über ihre Ankunft durchgeben.
In der gestrigen Abenddämmerung hatten sie kurz Kap Lizzard gesichtet, bevor es wieder im Dunst versank. Bolitho erinnerte sich daran, wie er es zusammen mit Allday bei einer anderen Gelegenheit in Sicht bekommen hatte. Auch damals war es das erste Feuer gewesen, und er hatte ihren Namen geflüstert, weil er sich nach ihr sehnte – so wie jetzt wieder.
Für die Nacht war Old Partridge, Anemones Segelmeister, auf den anderen Bug gegangen, so daß sie in der Dunkelheit mit gerefften Marssegeln hoch am Wind einen sicheren Abstand von der gefürchteten Doppelklaue halten konnten.
Bolitho wußte, daß er nicht länger schlafen konnte, und spielte mit dem Gedanken, an Deck zu gehen, aber er wußte auch, daß seine Anwesenheit die Wache ablenken konnte. Es war den Männern schwer genug gefallen, sich daran zu gewöhnen, einen Vizeadmiral in ihrer Mitte zu wissen und dazu noch einen so berühmten. Er grinste grimmig. Jedenfalls einen berüchtigten.
Er hatte beobachtet, wie die zusammengepferchte Besatzung der Fregatte von etwa zweihundertzwanzig Offizieren, Seeleuten und Marineinfanteristen miteinander gearbeitet hatte, um den Starkwinden und kreischenden Stürmen zu trotzen. Sie waren eine erfahrene Mannschaft geworden. Adam konnte stolz darauf sein, was er und seine jungen Offiziere unter Mitwirkung einiger alter Deckoffiziere, wie etwa Old Partridge, erreicht hatten. Adam würde der Ankunft in Portsmouth mit gemischten Gefühlen entgegensehen, denn dort würden höchstwahrscheinlich einige seiner besten Männer auf Schiffe versetzt werden, die unterbemannt waren. Wie der arme Jenour, dachte Bolitho. Er wollte zwar Karriere in der Marine machen, aber andererseits seinen Admiral aus Loyalität und Freundschaft nicht verlassen. Dies mußte aber sein, wollte er das Kommando auf der französischen Prise übernehmen, um den gefangenen feindlichen Admiral zu überführen. Er dachte auch an den Abschied, als er die Black Prince zum letzten Mal verließ. An Julyan, den Segelmeister, der Bolithos Hut getragen hatte, um den Feind abzulenken, als sie hinter Kopenhagen mit dem französischen Flaggschiff ins Gefecht kamen. Und an Old Fitzjames, den Stückmeister, der einen Zweiunddreißigpfünder so leicht richten und abfeuern konnte wie ein königlicher Seesoldat seine Muskete, und an Boucher, den Major der Marineinfanteristen, und die vielen anderen, die nie wieder etwas sehen würden. Männer, die gefallen waren, oft unter schrecklichen Umständen, nicht für König und Vaterland, wie es die Gazette behaupten würde, sondern füreinander. Für ihr Schiff.
Der Kiel stieß in eine hohe Welle, und Bolitho öffnete die Lamellentür zur Heckkabine der Anemone. Sie war sehr viel geräumiger als auf den alten Fregatten, sinnierte er, anders als auf der Phalarope, der ersten Fregatte, die er kommandiert hatte. Aber sogar hier in der privaten Domäne des Kapitäns waren Kanonen hinter den abgedichteten Geschützpforten sicher gelascht. Die Möbel, kleine Erinnerungen an ein zivilisiertes Leben, konnten alle in die Unterräume gestaut, Schotten und Türen niedergelegt werden, um das Schiff vom Bug bis zum Heck durchgängig zu machen. An beiden Seiten dräuten dann die Achtzehnpfünder, es war dann nur noch eine Kriegsmaschine.
Er mußte plötzlich an Keen denken. Vielleicht war die Trennung von ihm am schmerzlichsten gewesen. Auf Keen wartete die wohlverdiente Beförderung zum Kommodore oder gar zum Konteradmiral. Es würde für ihn eine ebenso große Veränderung der Lebensumstände bedeuten wie ehemals für Bolitho.
Eines Abends hatte er mit Adam beim Dinner gesessen, das Schiff stürmte blind in eine Regenbö, die Wanten und Fallen jaulten wie ein verrücktes Orchester, als er beiläufig Keens Beförderung erwähnte und die Veränderungen, die sie für Zenoria bedeuten würde. Catherine hatte ihm von der bevorstehenden Niederkunft geschrieben, und er vermutete, daß sie Zenoria gerne bei sich in Falmouth gehabt hätte. Was würde aus dem Kind werden? Eine Marinekarriere wie sein Vater? Keens Vorbild und Erfolg als Kapitän und Führungspersönlichkeit würde jedem Jungen einen guten Einstieg garantieren.
Oder würde es die Jurisprudenz werden oder vielleicht die City? Keens Familie war weitaus vermögender, als bei den Bewohnern der Fähnrichsmesse eines überfüllten Linienschiffs sonst üblich.
Adam hatte sich nicht gleich dazu geäußert. Er hatte auf das Klatschen der nackten Füße auf dem Oberdeck gelauscht, auf die barschen Kommandos, als das Ruder wieder übergelegt wurde.
»Auch wenn ich wieder von vorne anfangen könnte, Onkel, so könnte ich mir keinen besseren Lehrmeister denken.«
Er hatte gezögert. Für einen winzigen Augenblick war er wieder der dünne, halbverhungerte Fähnrich, der den ganzen Weg von Penzance gelaufen war, um seinen unbekannten Onkel zu suchen. Bolithos Name war auf einen Zettel hingekritzelt. »Auch keinen besseren Freund …«
Bolitho hatte abwiegeln wollen, aber er erkannte, daß es für den jugendlichen Kapitän, der ihm am Tisch gegenüber saß, eine äußerst wichtige Sache war. Es war eine sehr persönliche Angelegenheit, vergleichbar jenem anderen Geheimnis, das Bolitho nur selten aus seinen Gedanken verdrängen konnte. Sie hatten schon viel geteilt, aber die Zeit, auch das zu teilen, war noch nicht gekommen.
Dann hatte Adam leise festgestellt: »Kapitän Keen ist ein sehr glücklicher Mann.«
Adam hatte darauf bestanden, daß sein Gast die Schlafkabine bezog, während er die Heckkabine nehmen würde. Das veranlaßte Bolitho, sich einen anderen Vorfall der Überfahrt, die im großen und ganzen ereignislos verlaufen war, ins Gedächtnis zu rufen. Am Tag, nachdem die Mannschaft auch das leichte Segeltuch für den Endspurt in den Kanal gesetzt hatte, fand er Adam in der Heckkabine mit einem leeren Glas in der Hand vor.
Bolitho hatte seine Verzweiflung erkannt, den Widerwillen, den er offensichtlich für sich empfand. »Was bedrückt dich, Adam? Sag mir, was es ist – ich werde alles tun, was ich kann.«
Adam hatte ihn angeblickt und erwidert: »Ich habe heute Geburtstag, Onkel.« Er hatte in einem so ruhigen, gleichmäßigen Tonfall gesprochen, daß nur Bolitho erkannte, daß er mehr als dieses eine Glas getrunken hatte. Das war etwas, wofür Adam jeden seiner Offiziere bestraft hätte. Er liebte dieses Schiff, das Kommando, das er immer angestrebt hatte.
»Ich weiß«, hatte Bolitho erwidert und sich gesetzt. Dabei hatte er gefürchtet, daß der Anblick der goldenen Vizeadmiralsepauletten eine Kluft zwischen ihnen öffnen könnte.
»Ich bin jetzt neunundzwanzig Jahre alt.« Adam hatte sich in der Kabine umgeschaut, seine Augen blickten plötzlich sehnsüchtig.
»Außer der Anemone habe ich nichts.« Er fuhr herum, als sein Steward eintrat. »Was zum Teufel wollen Sie, Mann?«
Auch das sah ihm nicht ähnlich und hatte ihm geholfen, sich wieder zu fangen.
»Es tut mir leid. Das war unverzeihlich, da Sie mir meine Unhöflichkeit nicht Vorhalten können.« Der Diener zog sich verletzt und verstört zurück.
Dann war eine weitere Unterbrechung gefolgt, als der Zweite Leutnant eingetreten war und seinen Kommandanten darüber informiert hatte, daß es Zeit war, beide Wachen an Deck zu rufen und zu wenden.
Adam antwortete mit derselben Förmlichkeit: »Ich werde umgehend an Deck kommen, Mr. Martin.« Nachdem die Tür wieder geschlossen war, hatte er nach seinem Hut gegriffen, hatte dann gezögert und hinzugefügt: »An meinem letzten Geburtstag wurde ich von einer Dame geküßt.«
Bolitho hatte gefragt: »Kenne ich sie?«
Aber Adam hatte bereits dem Trillern der Pfeifen gelauscht und den stampfenden Füßen an Deck. »Ich glaube nicht, Onkel. Ich glaube, daß niemand sie kennt.« Dann war er gegangen.
Bolitho faßte einen Entschluß. Einen dicken Mantel verschmähend, suchte er sich seinen Weg auf das Quarterdeck.
Die Gerüche, das Knarren der Spieren und Planken, das Knacken in den vielen Meilen stehenden und laufenden Gutes, das unter Last stand, ließ ihn sich wieder jung fühlen. Er vermeinte, die Antwort des Admirals auf seine Bitte um ein Schiff zu hören, gleich was für ein Schiff, als der Krieg mit dem revolutionären Frankreich ausgebrochen war.
Noch immer vom Fieber geschwächt, das ihn in der Südsee niedergeworfen hatte, und jetzt, da jeder Offizier nach einem Einsatz oder einem eigenen Kommando schrie, hatte er fast gebettelt.
Ich bin ein Kommandant für eine Fregatte.
Der Admiral hatte kühl geantwortet: »Sie waren Kommandant einer Fregatte, Bolitho.« Das hatte ihn lange, lange Zeit gekränkt.
Er lächelte, die Anspannung fiel von ihm ab. Anstelle der Fregatte hatten sie ihm die Hyperion gegeben. Die alte Hyperion, über die noch immer Garn gesponnen und in den Kneipen, oder wo immer Seeleute zusammenhockten, gesungen wurde.
Er hörte Stimmen und vermeinte Kaffee zu riechen. Das würde sein maulwurfsähnlicher Steward Ozzard sein, obwohl es schwer war, die Gedanken des Mannes zu lesen. War er froh, nach Hause zu kommen? Machte er sich überhaupt Gedanken darüber?
Er trat auf die nassen Planken und warf einen Blick auf die dunklen Figuren um ihn herum. Der Fähnrich der Wache flüsterte bereits dem Segelmeister ins Ohr, daß ihr illustrer Passagier an Deck war.
Adam stand mit Peter Sargeant zusammen, seinem Ersten Leutnant. Sargeant war wahrscheinlich schon für eine Beförderung zum Kommandanten vorgemerkt, vermutete Bolitho. Adam würde ihn vermissen, sollte dies der Fall sein.
Ozzard tauchte aus der Dunkelheit mit seinem Kaffeepott auf und reichte ihm eine dampfende Mugg. »Frisch gebrüht, Sir Richard, aber er ist fast alle.«
Adam kam auf seine Seite hinüber, sein dunkles Haar flatterte in der feuchten Brise.
»Kap Rosemullion liegt an Backbord, Sir Richard.« Die Förmlichkeit wurde von ihnen beiden bemerkt. »Mr. Partridge hat mir versichert, daß wir gegen vier Glasen auf der Vormittagswache vor Pendennis Point stehen.«
Bolitho nickte und nippte an seinem heißen Kaffee. Er erinnerte sich an den Laden, zu dem ihn Catherine in der Londoner St. James’s Street geführt hatte. Sie hatte ausgezeichneten Kaffee, gute Weine, verschiedene Käsesorten und andere kleine Spezialitäten eingekauft, an die er nie und nimmer auch nur einen Gedanken verschwendet hätte. Er beobachtete, wie das Sonnenlicht über der felsigen Küste zu den sanft geschwungenen grünen Hügeln dahinter durchbrach. Zu Hause.
»Das war eine schnelle Reise, Kapitän. Schade, daß Sie keine Zeit haben, mit zum Haus zu kommen.«
Adam blickte ihn nicht an. »Ich weiß das Angebot zu schätzen, Sir.«
Der Erste Offizier berührte seinen Hut. »Ich werde unser Unterscheidungssignal setzen lassen, sobald wir nahe genug heran sind, Sir.« Er sprach mit seinem Kommandanten, aber Bolitho wußte, daß er gemeint war.
Ruhig sagte er: »Ich denke, daß sie es schon weiß, Mr. Sargeant.«
Er sah Alldays massige Gestalt an einer der Laufbrücken. Als ob er seinen Blick körperlich wahrnahm, drehte sich der große Bootssteurer um und blickte zu ihm hoch, auf seinem gebräunten Gesicht erschien ein breites Grinsen.
Wir sind da, alter Freund. Wie die vielen Male zuvor. Immer noch zusammen.
»Klar zur Wende! An die Brassen! Aufentern! Klar zum Setzen der Bramsegel!«
Bolitho stand an der Reling. Die Anemone würde ein perfektes Bild abgeben, wenn sie Kurs änderte.
Für einen perfekten Landfall.
Kapitän Adam Bolitho stand an der Luvseite des Achterdecks. Er hatte die Arme vor der Brust gekreuzt und war zufrieden, daß er die restliche Ansteuerung seinem Ersten überlassen konnte. Er sah zu den hingeduckten Wällen und dem Turm von Pendennis Castle hinüber, die sehr langsam durch das schwarze Verhau des geteerten Gutes wanderten, so als ob sie in einem Netz gefangen wären.
Von der alten Befestigung würden viele Ferngläser auf sie gerichtet sein. Die Burg bewachte zusammen mit dem Fort und den Batterien auf der gegenüberliegenden Landspitze die Hafeneinfahrt schon seit Jahrhunderten. Hinter Pendennis, versteckt in den grünen Hügeln, lag das alte graue Bolitho-Haus mit all den Erinnerungen an seine Söhne, die diesen Hafen verlassen hatten, um nicht zurückzukehren.
Er versuchte, nicht an die Nacht zu denken, als Zenoria ihn beim Brandy gefunden hatte, in seinen Augen brannten Tränen, denn er hatte die Nachricht bekommen, daß sein Onkel mit dem Transporter Golden Plover vermißt wurde. War das erst vor einem Jahr gewesen?
Bolitho hatte ihm erzählt, daß Zenoria schwanger war. Er hatte Angst, sich vorzustellen, daß es sein Kind sein könnte. Nur Catherine war der Wahrheit sehr nahe gekommen, und Bolithos Besorgnis um Adam hatte ihn fast dazu gebracht, ihm zu offenbaren, was er getan hatte. Aber er hatte die Konsequenzen gefürchtet, einmal für sich, doch am meisten für seinen Onkel.
Er sah Alldays massige Gestalt an einer der Backbordkanonen. Er schien in Gedanken verloren, vielleicht dachte er über die Frau nach, die er vor dem Ausplündern und noch Schlimmerem gerettet hatte. Ihr gehörte jetzt eine kleine Kneipe in Fallowfield. Heimkehr des Seemanns.
Old Partridges Stimme unterbrach seine Gedanken.
»Einen Strich abfallen!«
»Nord-zu-Ost, Sir! Kurs liegt an!«
Das Land veränderte sich wieder, als die Fregatte ihren langen Klüverbaum auf die Einfahrt und die Reede von Carrick richtete.
Die Mannschaft war dem schönen Schiff würdig. Es hatte viel Geduld und ein paar Knuffe gekostet, aber Adam war stolz auf sie. Das Blut erstarrte noch immer in seinen Adern, wenn er daran dachte, wie die Anemone von einem Schiff mit französischen Soldaten in den Feuerbereich einer mit glühenden Kugeln schießenden Strandbatterie gelockt worden war. Das war knapp gewesen. Er blickte das saubere Hauptdeck entlang, auf dem die Männer nun an den Brassen und Fallen auf den Aufschießer zum Ankerplatz warteten. Die glühenden Kugeln hätten seine geliebte Anemone in eine Feuersäule verwandeln können; die von der Sonne getrockneten Segel, das geteerte Tauwerk, die Vorräte an Pulver wären in Minutenschnelle hochgegangen. Sein Kiefer spannte sich, als er daran dachte, wie sie herumgegangen waren, um aus dem Schußbereich zu gelangen, nicht ohne vorher eine verheerende Breitseite in den Köder zu jagen, der jenem das Ende bescherte, das für sein Schiff bestimmt gewesen war.
Er erinnerte sich auch daran, daß Kapitän Valentine Keen beinahe mit ihm nach Hause geschickt worden wäre, aber im letzten Augenblick war er mit einer größeren Fregatte gesegelt, die den gefangenen französischen Admiral Baratte begleitete. Auch das war knapp gewesen. Bolitho hatte niemals seine wahren Gefühle über Herrick offenbart, den Mann, der ihm in dem Gefecht nicht zur Seite stand, in dem er so dringend Hilfe gegen die Übermacht benötigt hätte.
Adam packte die Reling des Achterdecks, bis seine Knöchel schmerzten. Möge er verdammt sein! Herricks Verrat mußte Bolitho so tief verletzt haben, daß er nicht darüber sprechen konnte.
Nach allem, was er für Herrick getan hatte – so wie für mich.
Seine Gedanken kehrten zögernd zu Zenoria zurück. Haßte sie ihn für das, was geschehen war?
Würde Keen jemals die Wahrheit erfahren?
Es wäre für ihn eine süße Rache, sollte ich die Marine verlassen müssen, so wie damals mein Vater, und sei es nur, um die zu schützen, die ich liebe.
Der Erste Leutnant murmelte: »Der Admiral kommt an Deck, Sir.«
»Danke, Mr. Sargeant.« Er würde ihn abgeben müssen, sobald sie Portsmouth erreichten, einige andere wertvolle Männer ebenfalls. Er sah, daß der Leutnant ihn beobachtete, und fügte ruhig hinzu: »Ich habe Sie in den vergangenen Monaten hart rangenommen, Peter.« Er legte ihm seine Hand auf den Arm, wie es Bolitho getan hätte. »Das Leben eines Kommandanten besteht nicht nur aus Zuckerschlecken, wie Sie eines Tages selber entdecken werden!«
Sie wandten sich um und hoben grüßend die Hände an die Hüte, als Bolitho ins Sonnenlicht trat. Er trug seine beste Ausgehuniform mit den glitzernden Silbersternen auf den Epauletten. Er war wieder der Vizeadmiral, der Held der Massen und wohl auch der Marine, bejubelt und anerkannt. Nicht der Mann in Hemdsärmeln oder einem schäbigen alten Mantel. Das hier war der Held, der jüngste Vizeadmiral in der Rangliste der Navy. Beneidet von einigen, gehaßt von anderen, Gesprächsstoff und bevorzugtes Klatschobjekt in Kaffeehäusern und auf jedem schicken Empfang in London. Der Mann, der für die Frau, die er liebte, alles riskiert hatte: Ruf und Sicherheit. Doch Adam war noch nicht soweit, um das zu erkennen.
Bolitho trug seinen Zweispitz unter dem Arm, wie um sich die letzten Fesseln der Autorität fernzuhalten. Sein Haar wurde vom Wind zerzaust. Es war immer noch so dunkel wie Adams, außer einer rebellischen, fast weißen Locke über dem rechten Auge, wo ein Entermesser beinahe seinem Leben ein Ende gesetzt hätte.
Leutnant Sargeant beobachtete sie nebeneinander. Seine anfängliche Nervosität bei der Aussicht, einen so berühmten und in der Marine allgemein bewunderten Mann an Bord zu haben, der die Enge eines Schiffes der 5. Klasse mit ihnen teilte, war bald verschwunden. Admiral und Kapitän hätten Brüder sein können, so stark war die Familienähnlichkeit. Sargeant hatte darüber viele Bemerkungen gehört. Die Enge ihrer Beziehung hatten ihn und den Rest der Offiziersmesse erleichtert. Bolitho war auf dem Schiff herumgegangen, »hatte sich seinen Weg erfühlt«, wie es sein untersetzter Bootssteurer ausgedrückt hatte, doch hatte sich niemals eingemischt. Sargeant war sich Bolithos Ruf als eines der besten Fregattenkommandanten der Marine wohl bewußt und vermutete, daß er Adams Freude über die Anemone auf seine Weise teilte.
Adam flüsterte leise: »Ich werde dich vermissen, Onkel.« Seine Stimme ging fast unter im Quietschen der Blöcke und dem Trampeln der Männer, die zum Kranbalken nach vorne eilten, um einen der größten Anker fallen zu lassen. Er versuchte, diesen Augenblick festzuhalten, ihn mit niemandem zu teilen.
»Ich wünschte, du könntest zum Haus kommen, Adam.« Er studierte Adams Profil, dessen Augen zuerst nach oben, dann zum Rudergänger wanderten. Vom Masttopp wehte Anemones Wimpel steif wie eine Lanze, als das Ruder reagierte.
Adam lächelte, was ihn wieder wie einen kleinen Jungen erscheinen ließ. »Ich kann nicht. Wir müssen Frischwasser übernehmen und dann in aller Eile absegeln. Bitte, übermittele Lady Catherine meine besten Wünsche.« Er zögerte. »Und auch allen anderen, die sich an mich erinnern.«
Bolitho sah zur Seite und bemerkte Allday, der ihn beobachtete, den Kopf fragend zur Seite geneigt wie ein struppiger Hund.
Er sagte: »Ich werde die Gig nehmen, Allday. Ich schicke sie dann für dich und Yovell zurück, sowie für alles Gepäck, das wir vergessen haben sollten.«
Allday, der es verabscheute, von seiner Seite weichen zu müssen, zwinkerte nicht einmal. Er verstand, Bolitho wollte allein sein beim Wiedersehen.
»Klar zum Aufschießer, Sir!«
Die großen Untersegel waren bereits aufgegeit, unter gerefften Marssegeln drehte Anemone in die auffrischende Brise hinein. Das war das Wetter, das sie schon immer geliebt hatte.
»Laß fallen Anker!«
Hoch aufspritzendes Wasser flog über das Vorschiff, als der Anker zum ersten Mal fiel seit der Sonne und den Stränden der Karibik. Männer, entwöhnt von ihren Lieben, ihren Häusern und ihren Kindern, die sie kaum kannten, starrten zu den grünen Hängen Cornwalls hinüber, die mit hellen Schafen bedeckt waren. Nur wenige würden an Land gehen dürfen, nicht einmal in Portsmouth. Schon jetzt hatten sich die scharlachrot berockten Seesoldaten auf den Laufbrücken und am Bug postiert, um auf jeden zu schießen, der versuchen sollte, an Land zu schwimmen.
Später überlegte Bolitho, daß es wie ein kurzer Traum gewesen war. Er hatte das Zwitschern einer Bootsmannspfeife gehört, als die Gig ausgeschwungen und längsseits weggefiert wurde, die Ruderer sahen schmuck aus in ihren karierten Hemden und geteerten Hüten. Adam hatte seine Lektion gut gelernt.
Ein Kriegsschiff wurde als erstes nach seinen Booten und deren Besatzungen beurteilt.
»Ehrenwache antreten!«
Die Royal Marines stellten sich in Reih und Glied an der Relingspforte auf. Ein Sergeant hatte den Platz des Offiziers eingenommen, der seinen Wunden erlegen war und jetzt viele Faden tief auf der anderen Seite des Ozeans lag.
Bootsmannsmaaten befeuchteten ihre Pfeifen mit den Lippen. Ihre Augen wanderten gelegentlich zu dem Mann hinüber, der im Begriff war, sie zu verlassen. Er hatte auf den Hundewachen nicht nur mit ihnen gesprochen, sondern auch zugehört, so als ob er wirkliches Interesse an ihnen hätte, an den einfachen Männern, die ihm bis in die Hölle der feuerspeienden Kanonenmäuler folgen mußten, wenn es befohlen wurde. Einige waren über diese Erfahrung verwundert gewesen. Sie hatten erwartet, mit einer unnahbaren Legende konfrontiert zu werden, stattdessen hatten sie ein menschliches Wesen vorgefunden.
Bolitho wandte sich ihnen zu und hob seinen Hut. Allday sah den plötzlichen Schmerz, als ein scharfer Sonnenstrahl durch die Wanten und sauber aufgetuchten Segel auf sein verletztes Auge traf.
Das war immer ein schlimmer Moment, und Allday mußte sich zurückhalten, um nicht vorzuspringen und Bolitho über die Seite zu helfen, wo die Gig in ihren Leinen längsseits schaukelte. Ein Fähnrich stand im Heck und erwartete den Passagier.
Bolitho nickte allen zu, dann drehte er sein Gesicht weg. »Ich wünsche Ihnen alles Glück. Ich bin stolz darauf, bei Ihnen an Bord gewesen zu sein.«
Vage Eindrücke folgten, die Wolke von Pfeifenton über den Bajonetten, als die Ehrenformation die Musketen präsentierte, das durchdringende Zwitschern der Pfeifen, die Erleichterung auf Alldays Gesicht, als er sicher in der Gig saß. Er sah Adam an der Reling, seine Hand halb zum Gruß erhoben, während sich hinter ihm die Leutnants und Deckoffiziere drängten. Ein Kriegsschiff, gleich ob auf See oder im Hafen, hatte niemals Ruhe, denn schon stießen Boote vom Kai des Hafens ab, um Verbindung aufzunehmen. Falls es der Kommandant erlaubte, würden sie alle möglichen Geschäfte anbieten, vom Tabak- und Obstverkauf bis hin zur Vermittlung der Dienste einheimischer Damen an Bord.
»Ruder an überall!« quiekte die Stimme des Fähnrichs. Bolitho überschattete die Augen, um die Menschen auf der nächstgelegenen Pier auszumachen. Schwach hörte er zwischen dem Gekreisch der Möwen, die über ein paar einlaufenden Fischkuttern kreisten, die Kirchenuhr die halbe Stunde schlagen. Old Partridge hatte mit ihrer Ankunftszeit recht gehabt. Wie er vorhergesagt hatte, mußte Anemone genau bei vier Glasen geankert haben.
Am Kopf der steinernen Treppe erwarteten ihn Uniformen, ein alter Mann mit einem Holzbein grinste, als wäre Bolitho sein eigener Sohn.
Bolitho begrüßte ihn: »Guten Morgen, Ned.« Es war ein alter Bootsmannsmaat, der früher unter ihm gedient hatte. Auf welchem Schiff? Vor wie vielen Jahren?
Der Mann rief hinter ihm her: »Habt ihr den Franzmännern den Hintern versohlt, Sir?«
Aber Bolitho war weitergeeilt. Er hatte sie in einer engen Gasse gesehen, die auf einen wenig genutzten Weg zum Haus führte. Sie beobachtete ihn. Sie stand ganz ruhig da, mit einer Hand tätschelte sie den Hals des Pferdes, ihre Augen ließen sein Gesicht nicht los.
Er hatte gewußt, daß sie hier sein würde, um die erste, die einzige zu sein, die ihn begrüßte.
Er war zu Hause.
Bolitho hatte den Arm um Catherines Schulter gelegt, mit der Hand berührte er ihre Haut. Die hohen Glastüren der Bibliothek standen weit offen, die Luft war schwer vom Duft der Rosen. Sie betrachtete sein Profil; die weiße Locke stach von der sonnenverbrannten Haut ab. Sie hatte sie als vornehm bezeichnet, obwohl sie wußte, daß er das haßte. Er schien es als einen Trick zu sehen, um ihn an den Altersunterschied zwischen ihnen zu erinnern.
Ruhig sagte sie: »Ich habe immer Rosen geliebt. Als du mich mitgenommen hast, um mir den Garten deiner Schwester zu zeigen, wußte ich, daß wir mehr davon pflanzen sollten.«
Er streichelte ihre Schulter. Er konnte es kaum glauben, daß er hier war, daß er erst vor einer Stunde an Land gekommen war. All die Wochen und Monate davor hatte er sich an ihre gemeinsame Zeit erinnert, an ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen vor und nach dem Verlust der Golden Plover, als er selbst daran gezweifelt hatte, ob sie die Qualen und Leiden in dem offenen Boot überleben würden, mit all den Haien in ihrer Nähe.
Ein kleines Hausmädchen huschte mit Bettwäsche vorbei, erstaunt blickte sie Bolitho an.
»Oh, willkommen zu Hause, Sir Richard! Es ist wirklich eine Freude, Sie zu sehen!«
Er lächelte. »Ich freue mich, hier zu sein, Mädchen.« Er sah, daß die Dienerin einen schnellen Blick auf Catherine warf, die noch immer den alten Mantel trug. Der Reitrock war mit Schmutzspuren übersät und auf dem Höhenweg eingestaubt.
Ruhig erkundigte er sich: »Haben sie dich gut behandelt, Kate?«
»Sie waren mehr als nur nett. Bryan Ferguson hat mir Kraft gegeben.«
»Als du den Kaffee geordert hast, erzählte er mir, wie du ihn im Gutsbüro unterstützt hast.« Er drückte sie. »Ich bin so stolz auf dich.«
Sie blickte über den ausgedehnten Garten bis an die niedrige Mauer, hinter der die See aussah wie Wasser in einem Stausee.
»Die Briefe, die auf dich gewartet haben …« Sie blickte ihn an, ihre Augen wirkten plötzlich besorgt. »Richard, werden wir Zeit füreinander haben?«
Er beruhigte sie: »Bevor Adam nicht seine Meldung über den Telegrafen von Portsmouth abgeschickt hat, werden sie nicht einmal wissen, daß ich hier bin. Außerdem ist mir nichts bezüglich meiner Abberufung mitgeteilt worden, da wird sich auch nichts tun, bevor ich die Admiralität aufsuche.«
Er musterte ihr Gesicht und versuchte, die Angst zu zerstreuen, daß sie wie beim letzten Mal bald wieder getrennt würden. »Eines ist sicher: Lord Godschale hat die Admiralität verlassen. Zweifellos werden wir dafür bald die Gründe erfahren!«
Sie schien zufrieden zu sein. Untergehakt gingen sie hinaus in den Garten. Es war sehr heiß, und der Wind schien zu einer sanften Brise abgeflaut. Er fragte sich, ob Adam es schaffen würde, sich aus dem Hafen hinauszuschleichen.
Er erkundigte sich: »Was gibt es Neues von Miles Vincent? Du hast mir geschrieben, nachdem er entdeckt hatte, was geschehen war. Der Admiral beabsichtigte, eine Nachricht an den Kommandanten der Ipswich zu schicken, um den Irrtum aufzuklären …«
Sie blickte ihn überrascht an, als Bolitho knurrte: »In genau den Dienst gepreßt zu werden, den er mit seiner Unbarmherzigkeit und Arroganz so ausgequetscht hat, könnte ihm gut tun! Dieser miese kleine Tyrann verdient eine Lektion. Wenn er anstelle der Fähnrichsmesse die Justiz des Zwischendecks kennenlernt, könnte ihm das vielleicht nützlich sein, obwohl ich es bezweifle.«
Sie blieb stehen, um ihre Augen abzuschirmen. »Es tut mir leid, daß dich Adam nicht hierher begleiten konnte.«
Ihre Stimmung schlug um, sie drehte sich in seinen Armen und lächelte ihn strahlend an.
»Aber ich lüge! Ich möchte dich mit niemandem teilen. Oh, mein Liebster … du bist gekommen, als ich wußte, daß du kommen würdest, und du siehst so gut aus.«
Schweigend gingen sie weiter, schließlich fragte sie leise: »Wie geht es deinem Auge?«
Er versuchte, das Thema herunterzuspielen. »Keine Veränderung, Kate. Irgendwie erinnert es mich immer an alles, was wir durchgestanden haben, … daß wir soviel mehr Glück hatten als die tapferen Männer, die nie mehr eine Frau umarmen oder den Geruch der Hügel Cornwalls im Morgengrauen genießen werden.«
»Ich höre Menschen im Hof, Richard.« Ihre Besorgnis legte sich, als sie Alldays tiefes Lachen erkannte.
Bolitho lächelte. »Meine Eiche. Er ist mit Yovell zurückgeblieben, um das Anlanden einiger Gepäckstücke und des herrlichen Weinkühlers zu überwachen, den du mir geschenkt hast. Ich werde ihn nicht verlieren wie den anderen.« Er sprach ruhig, aber sein Blick verlor sich in der Ferne.
»Es war ein harter Kampf, Kate. Wir haben an jenem Tag viele gute Männer verloren.« Wieder das müde Achselzucken. »Ich fürchte, daß ohne Kapitän Rathcullens Initiative die Sache für uns sehr schlecht ausgegangen wäre.«
Sie nickte und erinnerte sich an die Anspannung auf dem Gesicht des jungen Stephen Jenour, als er sie auf Bitten Richards besucht hatte.
»Und Thomas Herrick hat dich wieder im Stich gelassen, trotz der offensichtlichen Gefahr und eurer früheren engen Freundschaft …«
Er starrte auf die See und fühlte, daß sein Auge etwas schmerzte. »Ja. Aber wir haben gewonnen, und jetzt sagt man, hätten wir nicht gesiegt, hätten unsere Hauptstreitkräfte vor Martinique zurückgezogen werden müssen.«
»Es ist dein Verdienst, Richard! Du darfst nie vergessen, was du für deine Marine, dein Vaterland geleistet hast.«
Er beugte seinen Kopf herunter und küßte zärtlich ihren Nacken. »Meine Tigerin!«
»Da kannst du sicher sein!«
Fergusons Frau Grace, die Haushälterin, kam auf sie zu und blieb strahlend mit einem Kaffeetablett vor ihnen stehen. »Ich vermutete, daß Sie ihn gerne hier draußen trinken würden, M’lady.«
»Ja, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Das Haus scheint heute besonders geschäftig zu sein.«
Plötzlich griff sie nach seiner Hand. »Hier sind zu viele Leute, Richard. Sie wollen dich sehen, dich etwas fragen, dir alles Gute wünschen. Es ist schwer, alleine zu sein, sogar in unserem eigenen Haus.« Dann blickte sie ihn an, eine Ader pulsierte heftig an ihrem Hals. »Ich habe mich so nach dir gesehnt, und ich begehre dich.« Sie schüttelte den Kopf, und ein paar ihrer lose aufgesteckten Locken fielen in ihr Gesicht. »Ist das etwa unschicklich?«
Er packte fest ihre Hand. »Es gibt da einen Schlupfwinkel.«
Sie blickte ihm in die Augen.
»Unseren besonderen Platz?« Sie studierte sein Gesicht, bis ihr Atem wieder ruhiger ging. »Jetzt?«
Ferguson fand seine Frau neben dem Steintisch im Garten. Sie blickte auf den Kaffee, der nicht angerührt war.
Er meinte: »Ich habe Pferde gehört …« Er sah ihren Gesichtsausdruck und setzte sich an den Tisch. »Es wäre schade, ihn wegzuschütten.« Er umschlang mit einem Arm die Hüfte seiner Frau und drückte sie. Es war schwer, sie sich als das dünne, kränkliche Mädchen vorzustellen, das sie gewesen war, als Bolithos Preßpatrouille ihn und Allday mit ein paar anderen eingesackt hatte.
»Sie müssen wieder zueinanderfinden.« Sie strich sich über das Haar, und ihre Gedanken gingen zurück.
Sogar unten in der Stadt dachte man inzwischen anders über Ihre Ladyschaft. Früher war sie die Hure gewesen, für die Sir Richard Bolitho seine Frau aufgegeben hatte, die mit ihrer Schönheit und ihrem stolzen Hochmut jedem Mann den Kopf verdrehte. Einige würden sie nie mögen und sie ablehnen, aber die Bewunderung über das, was sie auf der unglücklichen Golden Plover getan und erduldet hatte, das Elend, der Kampf ums Überleben mit den anderen in dem offenen Boot, hatte fast alles verändert.
Es wurde gesagt, daß sie einen der Meuterer mit einem ihrer spanischen Kämme niedergestochen hatte, nachdem Bolithos Plan, das Schiff zurückzuerobern, fehlgeschlagen war.
Einige der Frauen hatten versucht sich vorzustellen, wie es sein mußte, auf einem kleinen Boot mit den Guten und den Bösen, den Verzweifelten und den Lüstlingen zusammengepfercht zu sein, wenn doch alles verloren schien. Die Männer sahen ihr nach und stellten sich vor, mit der Frau des Vizeadmirals allein zu sein.
Grace Ferguson schreckte aus ihren Gedanken auf: »Heute abend gibt es Lamm, Bryan.« Sie war wieder im Dienst. »Und diesen französischen Wein, den sie beide anscheinend mögen.«
Amüsiert blickte er sie an. »Man nennt ihn Champagner, meine Liebe.«
Sie wollte sich schon eilig auf den Weg machen, um mit den Vorbereitungen zu beginnen, als sie innehielt und ihn umarmte.
»Ich werde dir etwas verraten: Trotz all’ der Teufel, die uns plagen, können sie nicht glücklicher sein als wir!«
Ferguson starrte ihr hinterher. Sogar nach so langer Zeit konnte sie ihn noch überraschen.
II Ein sehr ehrenwerter Mann
Bryan Ferguson brachte seine kleine Kutsche zum Stehen und betrachtete seinen Freund, der die Gasse zum Gasthof hinunterblickte. »The Stag’s Head« war schön gelegen in dem kleinen Weiler Fallowfield am Helford River. Es war schon fast dunkel, aber an diesem milden Juniabend konnte er ein Stück des Flusses durch die Reihe hoher Bäume schimmern sehen. Die Luft war erfüllt vom Abendgesang der Vögel und dem Summen der Insekten.
John Allday trug sein bestes blaues Jackett mit den besonderen Goldknöpfen, die ihm Bolitho gegeben hatte. Sie zeigten alle das Wappen der Bolithos. Allday war über diese Geste fast vor Stolz geplatzt: einer der Familie, so wie er sich selber oft beschrieben hatte.
Ferguson bemerkte die Unsicherheit seines Freundes, eine Nervosität, die er bei Allday vor dem ersten Besuch des »Hirschen« niemals festgestellt hatte. Doch Allday hatte der Frau, der das Wirtshaus jetzt gehörte, das Leben gerettet: Unis Polin, die hübsche Witwe eines Steuermannsmaaten der alten Hyperion. Sie war von zwei Straßenräubern überfallen worden, als sie ihre paar Habseligkeiten in diesen Flecken bringen wollte.
Ferguson ging vieles durch den Kopf. Mit dem vom Wind und Wetter gegerbten Gesicht, dem feinen blauen Jackett und den Nanking-Breeches würden die meisten Leute Allday geradezu für das Musterexemplar eines Jan Maaten halten. Für einen jener Seeleute, die das sichere Schutzschild gegen die Franzosen und die anderen Feinde bildeten, die sich erdreisteten, der Marine Seiner Britannischen Majestät die Stirn zu bieten. Er hatte fast alles gesehen und erlebt. Ein paar Auserwählte kannten ihn nicht nur als den Bootssteuerer von Vizeadmiral Sir Richard Bolitho, sondern auch als dessen besten Freund. Für einige war es kaum denkbar, sich den einen ohne den anderen vorzustellen.
Aber an diesem Abend fiel es Ferguson schwer, in ihm den sonst so selbstbewußten Mann wiederzuerkennen. Er spekulierte: »Na, rutscht dir das Herz in die Hose, John?«
Allday leckte sich die Lippen. »Nur dir und sonst keinem gestehe ich, daß mir die Segel backstehen. Ich habe mir diesen Augenblick vorgestellt – und sie natürlich auch oft genug. Als die Anemone beim Wenden unter Rosemullion ihren Kupferboden zeigte, war mein Kopf so voller froher Gedanken, daß ich kaum geradeaus sehen konnte. Aber jetzt …«
»Hast du Angst, daß du einen Narren aus dir machst?«
»Etwas in dieser Art. Tom Ozzard fürchtet das auch.«
Ferguson schüttelte den Kopf. »Ach der! Was versteht der schon von Frauen?«
Allday blickte ihn an. »Darüber bin ich mir auch nicht so sicher.«
Ferguson legte seine Hand auf Alldays Arm. Er fühlte sich an wie ein Stück Holz.
»Sie ist eine gute Frau. Genau das, was du brauchst, wenn du seßhaft werden willst. Dieser verdammte Krieg kann nicht mehr lange dauern.«
»Was ist mit Sir Richard?«
Ferguson blickte auf den dunklen Fluß. Also das war es. Er hatte es fast vermutet. Der alte Wachhund machte sich Sorgen um seinen Herren. So war es immer.
Allday deutete sein Schweigen als Zweifel. »Ich werde ihn nicht im Stich lassen, und du weißt das!«
Ferguson schüttelte die Zügel sehr behutsam, und das Pony lief den Hang hinunter. »Du hast erst gestern Anker geworfen, seitdem läufst du herum wie ein Bär mit Kopfschmerzen. Du kannst an nichts anderes mehr denken.« Er grinste. »Also los und bring’s hinter dich.«
Es war die Nacht der Sonnenwende, einem heidnischen Fest, dem man christliche Traditionen aufgepfropft hatte. Die Alten konnten sich noch daran erinnern, wie das Fest früher nach Sonnenuntergang begann und mit einer Kette von Freudenfeuern quer durch das Land seinen Höhepunkt fand. Die Feuer wurden mit wilden Blumen und Kräutern gesegnet. Wenn alles hell loderte, pflegten oft junge Paare durch die Flammen zu springen, um sich Glück zu sichern. Der Segen wurde im alten Dialekt Cornwalls gesprochen. Während der Zeremonie wurde reichlich gegessen und getrunken. Einige Nörgler waren allerdings der Meinung, daß bei alldem eher der alte Hexenkult als die Religion im Vordergrund stand.
Aber diesen Abend war alles ruhig, obwohl sie ein Feuer hinter dem Weiler gesehen hatten, wo ein Bauer oder Gutsherr mit seinen Leuten feiern mochte. Die Kette der Freudenfeuer war verlöscht, nachdem man dem König von Frankreich den Kopf abgehackt hatte und sich der Terror im Land ausbreitete wie ein Steppenbrand. Sollte jemand so unvorsichtig sein, den alten Brauch wieder aufleben zu lassen, würde jeder Bewohner sowie die örtliche Miliz von den Trommeln zu den Waffen gerufen werden, denn so eine Kette von Feuern bedeutete Invasion!
Ferguson spielte mit den Zügeln. Sie waren fast am Ziel. Er mußte etwas herausfinden. Er hatte alles über Alldays alte Brustwunde gehört, die ihn plötzlich wie eine feindliche Kugel niedergestreckt hatte, als er die Frau vor den beiden Straßenräubern gerettet hatte. Solange seine Wunde nicht aufbrach, konnte Allday die Klinge mit jedem kreuzen, konnte er kämpfen wie ein Löwe. Aber es war ein langer Weg vom Gasthaus bis zum Haus der Bolithos in Falmouth. Ein dunkler Weg: Dort konnte alles passieren.
Er fragte geradeheraus: »Falls sie dich freundlich aufnimmt, John … was ich meine, ist …«
Überraschenderweise grinste Allday. »Ich bleibe nicht über Nacht, falls du das denken solltest. Das würde ihrem Ruf hier in der Gegend schaden. Schließlich ist sie hier immer noch fast eine Ausländerin.«
Ferguson rief erleichtert aus: »Aus Devon, meinst du wohl!« Er blickte ihn ernst an, als sie in den Hof einrollten. »Ich muß noch weiter und den alten Maurer Josiah besuchen. Er wurde vor ein paar Tagen auf unserem Land verletzt. Ihre Ladyschaft hat mich gebeten, ihm etwas zu bringen, was ihm die trüben Stunden verkürzt.«
Allday kicherte. »Rum, nicht wahr?« Er wurde wieder ernst. »Bei Gott, du hättest Lady Catherine sehen sollen, als wir in dem verdammten Langboot hockten, Bryan.« Er schüttelte seinen struppigen Kopf. »Ich bezweifele, daß wir mit dem Leben davongekommen wären, wenn sie nicht gewesen wäre.«
Die kleine Kutsche wiegte sich in den Federn, als Allday ausstieg. »Ich sehe dich dann, wenn du dich auf den Rückweg machst.« Er starrte noch immer die Kneipentür an, als Ferguson die Kutsche schon wieder auf die Straße dirigierte.
Allday packte die schwere eiserne Türklinke, als ob er dabei wäre, eine wilde Bestie freizulassen, und stieß dann die Tür auf.
Sein erster Eindruck war, daß sich seit seinem letzten Besuch einiges verändert hatte. Die Hand der Hausfrau, vielleicht?
Ein alter Bauer saß mit seinem Bierkrug neben dem leeren Kamin. Seine Pfeife schien schon lange ausgegangen zu sein. Ein Hütehund lag neben dem Stuhl des Mannes und bewegte nur die Augen, als Allday die Tür hinter sich schloß. Zwei gutgekleidete Händler sahen beim Anblick der blauen Jacke mit den goldenen Knöpfen erschrocken auf, wahrscheinlich vermuteten sie, daß er Teil einer Preßpatrouille war, die in letzter Minute noch ein paar Rekruten suchte. Es war heutzutage nicht ungewöhnlich, daß unbescholtene Kaufleute von Preßkommandos auf deren nicht enden wollender Jagd nach Kanonenfutter für die unersättliche Flotte eingesackt wurden. Allday hatte sogar von einem jungen Bräutigam gehört, der beim Verlassen der Kirche aus den Armen seiner Braut gerissen wurde. Ferguson hatte recht: Die meisten Einheimischen mußten irgendwo die Sonnenwende feiern. Diese Männer waren offensichtlich auf dem Weg zum Viehmarkt in Falmouth und wollten hier übernachten.
Alles schien zu seinen Gunsten zu laufen: Der Geruch von Blumen auf einem Tisch, gute Käsesorten und die geräumigen Bierkrüge auf den Regalen vervollständigten ein Bild, das jeder Brite vor Augen hatte, wenn er in der Ferne darbte. So wie die Männer der Blockadegeschwader oder die auf den schnellen Fregatten wie der Anemone, die für Monate, ja vielleicht für Jahre, keinen Fuß an Land setzen konnten.
»Was kann ich für Sie tun?«
Allday fuhr herum und sah einen großen Mann mit gleichmütigen Augen in einer grünen Schürze, der hinter den Bierfässern stand und ihn beobachtete. Ohne Zweifel hielt auch er ihn für ein Mitglied der verhaßten Preßkommandos. Sie waren in den Gasthäusern kaum willkommen, denn dort, wo sie regelmäßig erschienen, würde die Kundschaft bald ausbleiben. Der Mann wirkte irgendwie bekannt, aber alles, was Allday fühlte, war Enttäuschung, ein Gefühl des Verlustes. Er war ein Dummkopf gewesen. Er hätte es wissen müssen. Vielleicht hatte selbst der verschlossene Ozzard versucht, ihm diesen Schmerz zu ersparen.
»Wir haben gutes Ale aus Truro. Ich habe es selbst besorgt.« Der Mann kreuzte die Arme, und Allday sah die leuchtende Tätowierung: gekreuzte Flaggen und die Nummer »31stes«. Der Schmerz fraß sich tiefer. Noch nicht mal ein Seemann!
Fast zu sich selbst sagte er: »Das Einunddreißigste Infanterieregiment, die alten Huntingdonshires.«
Der Mann starrte ihn an. »Komisch, daß Sie das wissen.«
Er kam um die Fässer herum, Allday hörte das Poltern eines Holzbeins.
Der Mann packte fest Alldays Hand, sein Gesicht hatte sich völlig verändert.
»Ich bin ein Narr – ich hätte Sie gleich erkennen müssen! Sie sind John Allday, der meine Schwester vor diesen Bluthunden gerettet hat.«
Allday studierte ihn. Schwester. Natürlich, er hätte es sehen müssen. Sie hatten dieselben Augen.
Der Mann fuhr fort: »Ich heiße auch John. Früher war ich Schlachter bei den 31ern, bis ich das hier verloren habe.« Er klopfte auf das Holzbein.
Allday sah, wie die Erinnerungen über sein Gesicht zogen. Wie bei Bryan Ferguson und den anderen armen Hunden, die er in allen Häfen gesehen hatte. Und dann waren da noch die anderen, die, in ihren Hängematten eingenäht, wie Abfall über die Kante gegangen waren.
»Hier nebenan gibt es noch ein kleines Wohnhaus, also hat sie mir geschrieben und mich gefragt …« Er drehte sich um und meinte ruhig: »Und hier ist sie, Gott segne sie!«
»Willkommen, John Allday.« Sie sah sehr proper und adrett in ihrem neuen Kleid aus, das Haar sorgfältig über den Ohren hochfrisiert.
Er sagte ungeschickt: »Du siehst bildschön aus … äh, Unis.«
Sie sah ihn immer noch an. »Ich habe mich für dich so herausgeputzt, als ich hörte, daß Sir Richard zurückgekommen ist. Ich hätte nie wieder ein Wort mit dir gesprochen, falls …«
Dann rannte sie zu ihm hinüber und drückte ihn, bis er keine Luft mehr bekam, und das, obwohl sie ihm kaum bis zur Schulter reichte. Hinter ihr konnte er das kleine Wohnzimmer und das Modell der alten Hyperion sehen, das er ihr geschenkt hatte.
Zwei weitere Reisende traten ein. Sie nahm Alldays Arm und führte ihn in das Wohnzimmer. Ihr Bruder, der andere John, grinste und schloß die Tür hinter ihnen.
Sie schubste ihn fast in einen Sessel. »Ich will alles von dir hören, alles, was du erlebt hast. Ich habe guten Tabak für deine Pfeife – einer der Zollbeamten hat ihn mir gebracht. Ich konnte mich bremsen und habe nicht nachgefragt, wo er ihn herhatte.« Sie kniete sich hin und blickte ihn forschend an. »Ich habe mir so viele Sorgen um dich gemacht. Mit jedem Postschiff geht der Krieg hier an Land. Ich habe für dich gebetet …«
Er war berührt, als er ihre Tränen sah, die auf ihre Brust tropften.
»Als ich in die Schenke kam, dachte ich schon, daß du des Wartens müde geworden wärst.«
Sie schniefte und trocknete ihre Tränen mit einem Taschentuch. »Und ich wollte so gut für dich aussehen!« Sie lächelte. »Du dachtest, mein Bruder wäre mehr als das, nicht wahr?«
Dann fuhr sie in festem ruhigem Ton fort: »Ich habe Johns Seemannsberuf nie in Frage gestellt, und das werde ich auch bei dir nicht machen. Verspreche mir nur, daß du zu mir zurückkommst und zu keiner anderen.«
Sie rannte schnell fort, bevor Allday antworten konnte, dann kam sie mit einer Deckelkanne Rum zurück, die sie Allday in die Hand drückte. Ihre Hände lagen wie kleine Pfoten auf den seinen.
»Bleib nur ruhig sitzen und genieße deine Pfeife.« Sie trat einen Schritt zurück und stemmte die Hände in die Hüften. »Ich werde dir etwas zu essen machen, das kannst du sicher nach der Zeit auf dem Kriegsschiff vertragen!« Sie war erregt wie ein junges Mädchen.
Allday wartete, bis sie vor einem Geschirrschrank stand. »Mr. Ferguson wird mich später abholen.«
Sie wandte sich um, und er sah an ihrem Gesicht, daß sie verstanden hatte. »Du bist ein ehrenwerter Mann, John Allday.« Sie verschwand in der Küche, um das Essen zu bereiten, und über die Schulter rief sie zurück: »Aber du hättest bleiben können. Ich möchte, daß du das weißt.«
Es war eine pechrabenschwarze Nacht, nur der silberne Mond stand am Himmel, als Ferguson mit dem Pony und der Kutsche in den Hof einfuhr. Er wartete, bis Alldays massige Gestalt aus dem Dunkel auftauchte und die Kutsche sich in ihren Federn überlegte.
Allday blickte zur Kneipe zurück, wo nur in einem Fenster Licht brannte.
»Ich hätte dich auf einen Drink eingeladen, Bryan. Aber damit warten wir besser, bis wir zu Hause sind.«
Sie ratterten schweigend den Weg entlang, das Pony warf den Kopf, wenn ein Fuchs kurz durch das Licht der Laternen schnürte. Die Freudenfeuer waren alle verlöscht. Morgen früh, wenn die Dämmerung die Männer zurück auf die Felder und in die Melkställe rief, würde es jede Menge Kopfschmerzen geben.
Schließlich konnte er es nicht länger aushalten.
»Wie war es, John? Daß sie dich mit Essen und Trinken vollgestopft hat, kann ich deinem Atem entnehmen!«
»Wir haben uns unterhalten.« Er dachte an ihre Hände, die auf den seinen lagen, die Art, wie sie ihn angeschaut hatte, wie ihre Augen geleuchtet hatten, wenn sie sprach. »Die Zeit verging rasch. Kam mir vor wie eine Hundewache.«
Er mußte auch an die Verlockung denken, die in ihrer Stimme gelegen hatte, als sie über die Schulter gemeint hatte: »Du hättest bleiben können, ich möchte, daß du das weißt.«