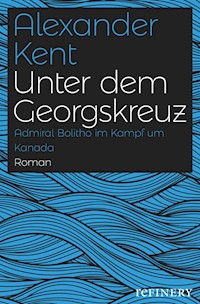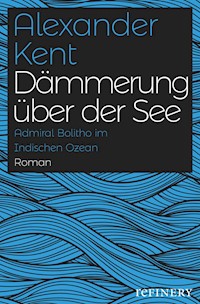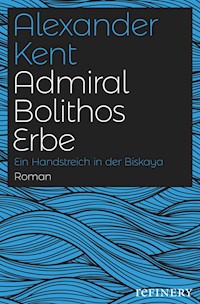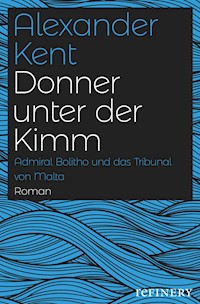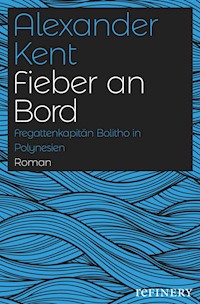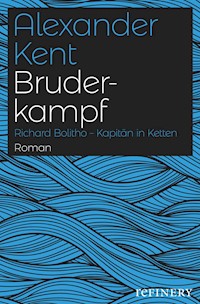6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Februar 1806: Vizeadmiral Richard Bolitho hat für die britische Krone das Kap der Guten Hoffnung von den Holländern zurückerobert. Allerdings ist in London kaum jemand gewillt, dieser Leistung die gebührende Anerkennung zu zollen, da er auf Grund des Skandals um seine Affäre mit Lady Somervell gesellschaftlich geächtet ist. Von daher wird Bolitho schleunigst nach Dänemark beordert, wo die zweite Schlacht um Kopenhagen bevorsteht. Und bei so einem blutigen Gefecht kann schließlich so manches passieren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Ähnliche
Mauern aus Holz, Männer aus Eisen
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester. Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
Februar 1806: Vizeadmiral Richard Bolitho hat für die britische Krone das Kap der Guten Hoffnung von den Holländern zurückerobert. Allerdings ist in London kaum jemand gewillt, dieser Leistung die gebührende Anerkennung zu zollen, da er auf Grund des Skandals um seine Affäre mit Lady Somervell gesellschaftlich geächtet ist. Von daher wird Bolitho schleunigst nach Dänemark beordert, wo die zweite Schlacht um Kopenhagen bevorsteht. Und bei so einem blutigen Gefecht kann schließlich so manches passieren …
Alexander Kent
Mauern aus Holz, Männer aus Eisen
Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung
Roman
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinSeptember 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1991 © der englischen Originalausgabe: Highseas Authors Ltd., 1990 Titel der Originalausgabe: The Only Victor (William Heinemann Ltd.; London 1990)Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-119-5
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Die Pflicht ruft
II Erinnerung an Nelson
III Wer ist die
Albacora?
IV Wer suchet, der findet
V Wofür sie sterben müssen
VI Die Tapferen und die anderen
VII Noch eine Überlebenschance
VIII Im Mondlicht
IX Ein schöner Sommer
X Im Zentrum der Macht
XI Ein neuer Auftrag
XII Sturmwarnung
XIII In auswegloser Lage
XIV Ehrenhändel
XV Ein letzter Dienst
XVI Das Nordseegeschwader
XVII »Aber er hat ihre Herzen«
XVIII Feuer und Nebel
XIX Die wahre Flagge
Epilog
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
I Die Pflicht ruft
Widmung
Maurice und Geraldine Fitzgerald in Liebe und Dankbarkeit gewidmet
Motto
»Wir wenigen, wir wenigen Beglückten,ein Kreis verschwor’ner Brüder;denn ihn, der heut’ sein Blut mit mir vergießt,ihn nenn’ ich Bruder.«
Heinrich V
I Die Pflicht ruft
Kapitän Daniel Poland, Kommandant Seiner Britannischen Majestät Fregatte Truculent, streckte die Arme und unterdrückte ein Gähnen, während sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Als er die Reling des Achterdecks umklammerte und die schemenhaften Figuren ringsum Identität und Rang annahmen, fühlte er Stolz auf sein Kommando. Er hatte diese Männer zu einer Besatzung geformt, die seine Wünsche und Befehle befolgte, ohne sich noch viel verbessern zu müssen. Vor zwei Jahren hatte er das Kommando übernommen, aber seinen vollen Kapitänsrang würde er erst in sechs Monaten erhalten. Erst dann würde seine Laufbahn sicher sein vor Rückschlägen. Mißgunst, ein unseliger Fehler oder ein Mißverständnis – alles konnte ihn wieder nach unten oder ganz aus dem Dienst in der Kriegsmarine befördern. Aber wenn er erst einmal Vollkapitän war, mit den beiden Epauletten auf den Schultern, konnte ihn nur noch wenig aus der Bahn werfen. Er lächelte kurz. Nur der Tod oder eine schreckliche Verwundung würden das schaffen, denn das Eisen des Feindes nahm keine Rücksicht auf die Hoffnung und den Ehrgeiz seiner Opfer.
Poland trat an den kleinen Tisch am Niedergang und hob die geteerte Segeltuchhaube, um im Licht einer abgeblendeten Lampe das Logbuch zu prüfen. Niemand auf dem Achterdeck sprach oder störte ihn; jedermann wußte, daß er da war, und kannte nach zwei Jahren seine Gewohnheiten.
Während er die sauber geschriebenen Kommentare seiner Wachoffiziere las, spürte er, wie sich das Schiff unter ihm hob und senkte; Schaum peitschte wie Hagel über das Deck. Wieder fühlte er Stolz, mahnte sich aber zur Vorsicht. Wer sich auf andere verließ, konnte schnell Mißtrauen ernten, und Mißtrauen bei Vorgesetzten gefährdete Beförderungen. Trotzdem – wenn der Wind durchstand, würden sie die afrikanische Küste, das Kap der Guten Hoffnung, beim ersten Tageslicht sichten.
Seit neunzehn Tagen unterwegs. Das war wahrscheinlich die schnellste Überfahrt, die je ein britisches Kriegsschiff von Portsmouth gemacht hatte. Poland dachte zurück an England, das sie in einem Regenschauer achteraus hatten versinken sehen, als die Truculent sich in den offenen Kanal schob: kalt, naß, Lebensmittelmangel und Preßkommandos.
Sein Blick blieb am Datum hängen: 1. Februar 1806. Das war vielleicht die Erklärung. Die Nachricht vom Sieg bei Kap Trafalgar war vor weniger als vier Monaten ins Land geplatzt. Seither sah es so aus, als habe Nelsons Tod die Menschen betäubt. Sogar auf seinem eigenen Schiff hatte es Poland gespürt: Der Kampfgeist seiner Offiziere und Mannschaftsgrade schien stumpfer geworden zu sein. Dabei war die Truculent zur Zeit der großen Schlacht nicht einmal im selben Ozean gewesen, und seines Wissens nach hatte keiner seiner Leute je den kleinen Admiral gesehen. Dieser Umstand ärgerte ihn, und er verfluchte sein Schicksal, das sein Schiff so weit weg geführt hatte von einem Kampf, in dem er Ruhm und Lohn hätte ernten können. Typisch für Poland war, daß er dabei den furchtbaren Zoll an Toten und Verwundeten nicht bedachte, den die denkwürdigen Tage von Trafalgar gefordert hatten.
Er schaute nach oben in den hellen Umriß des vollstehenden Kreuzmarssegels. Dahinter gab es nur Dunkelheit. Das Schiff hatte seine schwere Leinwand gegen die Leichtwettersegel der Passatzone ausgewechselt und würde sehr gut aussehen, wenn das Tageslicht kam. Er erinnerte sich an ihre schnelle Fahrt nach Süden: die Berge Marokkos häsig blau in der Ferne, dann weiter südöstlich über den Äquator. Ein einziger Stopp nur bei St. Helena, diesem winzigen Fleck auf der Karte.
Kein Wunder, daß junge Offiziere darum beteten, ein Kommando über eine Fregatte zu erhalten. Auf ihr war man sein eigener Herr, hing nicht an den Schürzenzipfeln der Flotte und war ziemlich sicher vor den Eingriffen der Admiralität.
Er wußte, daß ein Kommandant bei seinen Leuten gleich nach Gott kam. Meistens schien er auch wirklich allmächtig, denn er konnte jeden an Bord strafen oder belohnen – ohne selbst mit Strafe rechnen zu müssen. Poland hielt sich für einen gerechten und fairen Kommandanten, aber er wußte, daß man ihn eher fürchtete als verehrte. Jeden Tag hatte er dafür gesorgt, daß es seinen Männern nicht an Arbeit mangelte. Der Vizeadmiral würde nichts an seinem Schiff auszusetzen haben, weder an seinem Aussehen noch an der Besatzung.
Sein Blick fiel auf das Skylight der Kajüte, es leuchtete jetzt hell aus der Dunkelheit. Auf dieser Reise durfte es keine Fehler geben, nicht mit einem so bedeutenden Passagier dort unten in den Räumen des Kommandanten.
Es wurde Zeit. Poland stellte einen Fuß auf die Lafette eines gesicherten Neunpfunders, und der Zweite Offizier erschien wie herbeigezaubert.
»Mr. Munro, Sie können die Achterdeckswache in fünfzehn Minuten antreten lassen, wenn wir über Stag gehen.«
Der Leutnant berührte im Dunkeln seinen Hut. »Aye, aye, Sir.« Er sprach so leise, als ob auch er an den Passagier dachte und an den Lärm der Soldatenstiefel auf dem Deck über dessen Schlafraum.
Poland mahnte unwirsch: »Und keine Schlamperei!«
Munro sah, wie der Master, der schon an seinem Platz neben dem großen Doppelrad stand, die Schultern krümmte. Er ahnte wahrscheinlich, daß der Kommandant ihn verantwortlich machen würde, wenn der Horizont bei Tagesanbruch so leer wie zuvor blieb.
Eine stämmige Gestalt schlurfte an Deck nach Lee, und Poland hörte, wie Waschwasser über Bord geschüttet wurde. Das war der Bootsführer ihres Passagiers, ein kräftiger, vierschrötiger Mann namens John Allday. Einer, der vor niemandem Respekt hatte, außer vor seinem Vizeadmiral. Wieder empfand Poland Zorn – oder Neid. Er dachte an seinen eigenen Bootsführer, der zwar so geschickt und verläßlich war, wie man es sich nur wünschen konnte, ein Mann, der sich von den Bootsgasten nichts vormachen ließ. Aber er war ihm kein so guter Freund, wie es Allday für den Admiral zu sein schien. Naja, ein Bootsführer war eben nur ein gemeiner Seemann.
Scharf rief er: »Der Admiral ist wach und wird bald erscheinen. Purren Sie die Achterdeckswache heraus – und dann alle Mann an die Brassen!«
Williams, seiner Erster Offizier, kletterte den Niedergang hoch und versuchte, gleichzeitig den Mantel zuzuknöpfen und den Hut auszurichten, als er den Kommandanten bereits an Deck sah. »Einen guten Morgen, Sir!«
»Das will ich auch hoffen«, antwortete Poland kühl.
Die Leutnants sahen sich an und grinsten hinter seinem Rücken. Poland war Realist im Umgang mit der Besatzung, besaß aber kaum Humor. Seine Richtlinien fand er gleicherweise in der Bibel wie in den Kriegsartikeln.
Die Pfeifen schrillten zwischen den Decks, und die Wache kam über die feuchtglänzenden Planken getrabt. Jeder eilte auf seine Manöverstation, wo die Unteroffiziere mit ihren Listen standen und die Bootsmannsgehilfen darauf warteten, Schlafmützen mit Tampen oder Rohrstock anzutreiben. Sie alle wußten, wer der berühmte Passagier war, der die meiste Zeit achtern in Polands Kajüte geblieben war.
»Da geht sie auf, Leute!«
»Notieren Sie den Mann zur Bestrafung«, bellte Poland. Aber er sah doch hin und bemerkte das erste zarte Glühen der Morgensonne, das die Flaggleinen und den Wimpel im Masttopp berührte, dann nach unten floß und die Wanten lachsrosa einfärbte. Bald würde das Licht über die Kimm fluten, sich ausbreiten und den ganzen Ozean beleben. Aber Poland war das gleichgültig. Zeit, Entfernung, geloggte Geschwindigkeit – nur sie bestimmten seinen Alltag.
Allday lehnte sich gegen die feuchten Finknetze. Sie würden vollgestopft mit Hängematten sein, wenn das Schiff erst auf dem neuen Kurs lag. Land voraus? Wahrscheinlich. Doch Allday spürte Kapitän Polands Unrast, so wie er sich auch seiner eigenen Ängste bewußt war. Gewöhnlich war er froh, ja sogar erleichtert, das Land verlassen und wieder an Bord eines Schiffes gehen zu können. Aber diesmal war es nicht so gewesen.
Allday hatte gehört, wie man an Bord über den Mann sprach, dem er diente und den er liebte wie sonst niemanden. Nein, die Truculent war nicht ihr Schiff. Er betastete diesen Gedanken im Geist wie eine frische Narbe. Die Truculent war nicht zu vergleichen mit der alten Hyperion.
Es war am 15. Oktober geschehen, vor weniger als vier Monaten. In seinem Herzen spürte er immer noch das Krachen jener fürchterlichen Breitseiten, die Schreie, den Wahnsinn und dann … Der alte Schmerz zuckte durch seine Brust, und er griff nach ihm mit der Faust, schluckte Luft und wartete darauf, daß er aufhörte. Das war in einem anderen Ozean, einer anderen Schlacht gewesen, aber eine brennende Erinnerung an ihr gemeinsames Schicksal. Allday ahnte, was Poland hinter seiner regungslosen Miene dachte. Männer wie er konnten Richard Bolitho nie verstehen. Sie wollten es auch gar nicht.
Allday rieb sich die Brust und grinste. Ja, sie beide hatten viel gesehen und viel zusammen erlebt, Vizeadmiral Sir Richard Bolitho und er. Das Schicksal hatte sie zusammengespleißt. Allday wischte sich Gischtflocken aus dem Gesicht und schüttelte den langen geteerten Zopf über seinem Kragen. Die meisten Leute glaubten wahrscheinlich, daß es Bolitho an nichts mangelte. Seine letzten Ruhmestaten wurden in den Häfen und Kneipen Englands besungen, und Charles Dibdin oder einer seiner Freunde hatte sogar eine Ballade darüber komponiert: »Wie die Hyperion uns den Weg freischoß…« Das waren die Worte eines sterbenden Matrosen gewesen, dessen Hand Bolitho an jenem schrecklichen Tag bis zuletzt gehalten hatte, obwohl er gleichzeitig an hundert anderen Stellen benötigt wurde.
Nur die, die an seinen Gefechten teilgenommen hatten, wußten, wie Bolitho wirklich war. Sie kannten die Kraft und die Hingabe des Mannes mit den goldenen Schulterstücken, der seine Leute auch dann noch begeistern konnte, wenn sie halb wahnsinnig waren oder taub vom höllischen Lärm der Schlacht. Der sie Mut fassen ließ, selbst im Angesicht des sicheren Todes. Trotzdem blieb Bolitho ein Außenseiter, über den die Londoner Gesellschaft die Nase rümpfte und in den Kaffeehäusern Gerüchte verbreitete. Allday richtete sich seufzend auf. Der Schmerz kam nicht wieder. Die Schwätzer wären alle überrascht gewesen, wenn sie gewußt hätten, wie wenig Bolitho sich darum scherte.
Er hörte Polands kurzes Kommando: »Einen guten Mann nach oben, wenn ich bitten darf!«
Allday fühlte fast Mitleid mit dem Ersten, als der antwortete: »Bereits geschehen, Sir. Ich habe einen Gehilfen des Masters in den Fockmast geschickt, als die Wache an Deck kam.«
Beim Weggehen funkelte Poland den müßigen Bootssteurer des Admirals an. »Nur die Achterdeckswache und meine Offiziere dürfen hier …« Aber er verschluckte den Rest und trat zum Kompaß.
Allday stapfte den Niedergang hinunter und tauchte wieder in die Gerüche und Geräusche des Schiffes ein: Teer, Farbe, Tauwerk und Salz. Er hörte gebellte Kommandos, das Quietschen von Spieren und Blöcken, das Stampfen Dutzender nackter Füße, als die Männer ihre Kraft gegen den Druck von Wasser und Wind warfen und das Schiff über Stag ging, auf den neuen Kurs.
An der Tür zur Achterkajüte stand der Posten der Seesoldaten steif unter einer wild tanzenden Lampe. In seinem roten Rock kippte er fast um, als das Ruder hart übergelegt wurde. Allday nickte ihm zu und stieß die Lamellentür auf. Er mißbrauchte seine Vorrechte selten, aber es machte ihn stolz, hier nach eigenem Willen kommen und gehen zu können. Wieder etwas, das Kapitän Poland ärgerte, dachte er und kicherte. Fast stieß er mit Ozzard zusammen, Bolithos schmächtigem Steward, der sich mit ein paar Hemden zum Waschen davondrückte, grau und unauffällig wie ein Maulwurf.
»Wie geht’s ihm?«
Ozzard sah sich um. Hinter den Schlafstellen und Polands Schwingkoje lag die Kajüte fast noch im Dunkeln – bis auf eine einsame Laterne. Er murmelte: »Hat sich nicht bewegt.« Dann war er verschwunden: verläßlich, verschwiegen und immer da, wenn er gebraucht wurde. Ozzard brütete wohl immer noch über seinem Verhalten an jenem Tag im Oktober, als die alte Hyperion zwar den Kampf gewonnen, aber danach untergegangen war. Nur Allday wußte, daß Ozzard vorgehabt hatte, mit ihr zu sterben, mit all den Toten und Verwundeten. Der Grund dafür war sein Geheimnis. Ob Bolitho ihn ahnte?
Dann sah er Bolithos bleiche Gestalt vor den breiten Heck- fenstern. Er saß auf der Bank, ein Knie angezogen, und sein Hemd leuchtete weiß vor dem bewegten Wasser draußen.
Allday sagte unsicher: »Ich hole noch eine Laterne, Sir Richard.«
Bolitho wandte den Kopf, aber seine grauen Augen blieben im Schatten. »Es wird bald hell genug sein, mein Freund.« Unwillkürlich berührte er sein linkes Augenlid. »Wir werden heute wohl Land sichten.«
So ruhig gesagt, dachte Allday, und doch mußten ihm Kopf und Herz von Erinnerungen überquellen, von guten und bösen. Aber seine Stimme verriet nichts davon, auch nichts von der Sehschwäche seines linken Auges.
»Wenn nicht, wird Käpt’n Poland gottslästerlich fluchen, darauf wette ich«, sagte Allday.
Bolitho lächelte und wandte sich wieder der See zu, die ums Ruder kochte, als würde gleich ein großer Fisch das Wasser durchstoßen, um nach der Fregatte zu schnappen. Er liebte die Morgendämmerung auf See. Auf so vielen und so unterschiedlichen Gewässern hatte er sie erlebt, von den stillen blauen Tiefen der großen Südsee bis zu den wütenden grauen Wüsten des Atlantiks. Jedes Meer hatte sich ihm so unverwechselbar eingeprägt wie die Schiffe und die Männer, die sich mit ihm gemessen hatten.
Er hatte gehofft, daß der neue Tag ihm Befreiung bringen würde von seinen bohrenden Gedanken. Ein gutes, sauberes Hemd, eine gründliche Rasur von Allday – danach fühlte er sich meist wohler. Aber diesmal nicht.
Wieder hörte er die Pfeifen schrillen und konnte sich leicht die systematische Hektik an Deck vorstellen, als die Segel getrimmt und Brassen und Fallen dichtgeholt wurden. Insgeheim würde er wohl immer der Fregattenkapitän bleiben, der er einst gewesen war, als Allday an Bord kam, geschnappt von einem Preßkommando. Seit damals hatten sie viele tausend Meilen gesegelt und zu viele Männer verloren: Gesichter, so schnell weggewischt wie Kreidestriche von einer Tafel.
Bolitho sah das erste Licht auf den Wellenkämmen; zu beiden Seiten des Ruders teilte sich golden der Schaum, als die Morgensonne über die Kimm zu steigen begann. Da stand er auf und stützte sich aufs Fenstersüll, um der See ins Gesicht zu blicken.
Er erinnerte sich, als sei es gestern gewesen, an den Admiral, der ihm den verhaßten Befehl gegeben hatte. Vergeblich hatte er protestiert, es war das einzige Kommando, das ihm die Admiralität nach seinem schrecklichen Fieber zugebilligt hatte.
»Schließlich waren Sie doch einmal Fregattenkapitän, Bolitho …« Ja, aber vor zwölf Jahren – oder noch länger! Am Ende hatte man ihm die alte Hyperion geben müssen und das wohl auch nur wegen der blutigen Revolution in Frankreich und wegen des Krieges, der ihr folgte und bis zu diesem Tag tobte.
Die Hyperion wurde das wichtigste Schiff seines Lebens. Viele hatten an seiner Urteilsfähigkeit gezweifelt, als er sich den alten Vierundsiebziger als Flaggschiff erbat. Aber sie schien die richtige Wahl zu sein, die einzige. Und nun war sie im letzten Oktober gesunken, nachdem sie im Mittelmeer Bolithos Geschwader gegen eine viel stärkere Streitmacht spanischer Schiffe angeführt hatte, die sein alter Feind, Admiral Don Alberto Casares, kommandierte. Es war ein verzweifeltes Gefecht gewesen, und von den ersten Breitseiten an war der Ausgang völlig ungewiß. Obwohl es unmöglich schien, hatten sie die Spanier schließlich doch geschlagen und sogar einige Prisen mit nach Gibraltar gebracht.
Aber die alte Hyperion hatte dabei ihr Letztes gegeben. Mit ihren dreiunddreißig Jahren leistete sie schließlich keinen Widerstand mehr, als die große spanische SanMateo mit ihren neunzig Kanonen eine letzte Breitseite auf sie abfeuerte. Doch trotz allem, was Bolitho in seinem Leben auf See erlebt und erlitten hatte, konnte er sich nur schwer damit abfinden, daß es die alte Hyperion nicht mehr gab.
Daheim in England sagten sie, wenn er das spanische Geschwader Casares’ nicht im Gefecht aufgehalten und besiegt hätte, wäre es rechtzeitig zur Vereinigten Flotte vor Trafalgar gestoßen, und dann hätte selbst der tapfere Nelson dort kaum siegen können. Bolitho wußte nicht, wie er darauf reagieren sollte. Wollte man ihm damit schmeicheln – oder Nelsons Ruhm schmälern? Jedenfalls war ihm übel geworden, als dieselben Leute, die Nelson einst gehaßt und verachtet hatten – auch wegen seiner Affäre mit Emma Hamilton ihn jetzt aufs höchste lobten und seinen Tod beklagten.
Wie so viele, war auch Bolitho dem kleinen Admiral nie begegnet, der seine Seeleute begeistert hatte, trotz des zermürbenden Blockadedienstes oder bei blutigen Gefechten Schiff gegen Schiff. Nelson hatte seine Männer wirklich gekannt und ihnen die Autorität gegeben, die sie verstanden und brauchten.
Bolitho merkte, daß Allday leise die Kajüte verließ, und machte sich wieder Vorwürfe, daß er ihn mitgenommen hatte zu diesem Einsatz. Doch Allday, standfest wie eine englische Eiche, wollte es nicht anders. Bolitho hätte ihn nur verletzt und beleidigt, wenn er ihn als Halbinvaliden in Falmouth zurückgelassen hätte.
Er berührte sein linkes Lid und seufzte. Würde ihn das verletzte Auge im hellen afrikanischen Sonnenlicht quälen? Nur zu gut konnte er sich an den Augenblick im Gefecht erinnern, als er in die Sonne geschaut und sein Blick sich verschattet hatte, als krieche Seenebel übers Deck. Und an den triumphierenden Atemzug des Spaniers, der mit seinem Säbel einen Ausfall machte. Jenour, dem Flaggleutnant, war der Degen aus der Hand geschlagen worden, als er versuchte, Bolitho zu verteidigen. Aber Allday war dagewesen und hatte das Schlimmste verhindert. Der Säbel des Spaniers war über das blutige Deck geschlittert, sein abgetrennter Arm mit ihm. Ein zweiter Hieb brachte ihm das Ende, als Alldays Rache für eine Wunde, die ihn seither fast ständig schmerzte und behinderte.
Konnte er Allday nach all dem daheim zurücklassen, und sei es aus Fürsorglichkeit? Bolitho wußte, daß nur der Tod sie einst trennen würde.
Er stieß sich vom Fenster ab und nahm den Fächer aus seiner Seekiste zur Hand. Catherines Fächer. Sie hatte dafür gesorgt, daß er ihn mitnahm, als er in Spithead an Bord der Truculent ging. Was tat sie wohl gerade, gut sechstausend Meilen achteraus? In Cornwall mußte es jetzt kalt und trüb sein. Die Bauernkaten duckten sich um das große graue Haus der Bolithos unterhalb von Pendennis Castle. Wind vom Kanal würde die wenigen Bäume am Hang schütteln, die Bolithos Vater einst »meine zerlumpten Krieger« genannt hatte. Die Bauern konnten jetzt ihre Steinwälle und Scheunen reparieren, die Fischer von Falmouth ihre Boote ausbessern, dankbar für den Schutzbrief, der sie vor den verhaßten Preßkommandos rettete.
Das alte graue Haus war Catherines einzige Zuflucht vor dem Hohn und Tratsch der Gesellschaft. Ferguson, der einarmige Steward, der einst wie Allday in die Marine gepreßt worden war, kümmerte sich aufopfernd um sie. Aber im ganzen Westen des Landes würde man ebenso wie in London über sie lästern und tratschen: Bolithos Geliebte. Die Frau eines Viscount, die zu ihrem Mann gehörte und nicht wie eine Matrosenhure leben sollte. Das waren Catherines eigene Worte.
Nur einmal hatte sie sich Bitterkeit und Zorn anmerken lassen: als er nach London gerufen wurde zum Empfang seiner Befehle. Da hatte sie ihn quer durch den ganzen Raum empört angesehen und gefragt: »Begreifst du nicht, was sie uns antun, Richard?« Die Wut hatte ihr dabei eine ganz neue Schönheit verliehen. Ihr langes dunkles Haar breitete sich aufgelöst über ihren hellen Morgenmantel, ihre Augen blitzten zornig. »In ein paar Tagen ist doch Lord Nelsons Beisetzung!« Sie entwand sich ihm, als er versuchte, sie zu beruhigen. »Hör mir lieber zu, Richard. Uns bleiben weniger als zwei Wochen zusammen, und davon bist du die meiste Zeit unterwegs. Verdammt noch mal, du hast dein altes Schiff verloren und alles für dein Land geopfert. Jetzt haben sie Angst, daß du an Nelsons Beisetzung nicht teilnehmen willst ohne mich, während sie doch nur Belinda akzeptieren würden. Deshalb befehlen sie dich nach London.«
Dann war sie weinend zusammengebrochen und hatte sich von ihm trösten lassen, hatte sich an ihn geschmiegt wie damals, als sie in Falmouth ihren ersten gemeinsamen Sonnenaufgang erlebt hatten.
Bolitho hatte ihre Schulter gestreichelt und gesagt: »Ich erlaube niemandem, dich zu beleidigen.«
Hatte sie ihm überhaupt zugehört? Nein, sie dachte nur an seine Behinderung. »Der Chirurg, der mit dir segelte – Sir Piers Blachford -, der müßte dir doch helfen können.« Sie hatte sein Gesicht zu sich herabgezogen und seine Augen mit besorgter Zärtlichkeit geküßt. »Mein Liebster, du mußt dich vorsehen!«
Jetzt war sie in Falmouth, und trotz allem Schutz und aller Verehrung blieb sie dort weiterhin eine Fremde.
Sie hatte ihn an jenem kalten, windigen Vormittag zu seiner Abreise nach Portsmouth begleitet. Zusammen warteten sie am alten Kai, wohl wissend, daß mit diesen abgetretenen Stufen auch Nelson zum letzten Mal englischen Boden unter den Füßen gehabt hatte. Hinter ihnen stand die Kutsche mit dem Wappen der Bolithos, so schlammbespritzt, als wolle sie von den Stunden zeugen, die sie beide unerkannt darin verbracht hatten.
Nicht immer ganz unerkannt. Auf dem Weg durch Guildford hatten ein paar Bummelanten auf der Straße hurra gerufen und: »Gott segne dich, Dick! Und scheiß auf die Arschlöcher in London. ‘Tschuldigung, Madam!«
Als die Barkasse sich mit kräftigem Riemenschlag der Treppe näherte, hatte sie die Arme um seinen Hals gelegt, das Gesicht naß von Regen und Tränen: »Ich liebe dich, mein Alles.« Sie hatte ihn lange geküßt und sich erst von ihm gelöst, als die Barkasse geräuschvoll festmachte. Erst dann hatte sie sich abgewandt, aber noch einmal innegehalten, um zu sagen: »Erinnere Allday daran, daß er gut auf dich aufpassen soll.«
Die restlichen Umstände hatte er vergessen, als ob plötzlich Dunkelheit über ihn hereingebrochen sei.
Kapitän Poland klopfte hart an die Tür und trat in die Kajüte, den Dreispitz unter den Arm geklemmt. Bolitho sah seine Blicke durch den halbdunklen Raum huschen, als erwarte er, seine Kajüte völlig verändert zu finden.
Bolitho setzte sich wieder auf die Fensterbank. Truculent war ein gutes Schiff, er fühlte sich wohl darauf. Darüber fiel ihm sein Neffe Adam ein, und er fragte sich, ob er schon die größte aller Chancen erhalten hatte: das Kommando über eine neue Fregatte. Wahrscheinlich war er schon mit ihr auf See wie die Truculent. Adam würde es bestimmt schaffen.
»Neuigkeiten, Kapitän?« fragte er.
Poland sah ihm ins Gesicht. »Wir haben Land in Sicht, Sir Richard. Der Master, Mr. Hull, hält es für einen perfekten Landfall.«
Immer diese Vorsicht. Bolitho war sie schon einige Male aufgefallen, auch als er Poland eingeladen hatte, mit ihm zu Abend zu speisen. »Und was halten Sie selbst davon, Kapitän?«
Poland schluckte trocken. »Er hat wohl recht, Sir Richard.« Zögernd fügte er hinzu: »Der Wind hat nachgelassen. Wir werden den ganzen Tag brauchen, um die Küste zu erreichen. Selbst den Tafelberg sieht man erst vom Masttopp aus.«
Bolitho griff nach seinem Mantel, ließ ihn aber dann doch liegen. »Ich komme gleich nach oben. Sie haben eine ungewöhnlich schnelle Reise gemacht, Kapitän. Das werde ich in meinem Bericht erwähnen.«
Zu jeder anderen Zeit hätte es ihn amüsiert, den schnellen Wechsel des Ausdrucks in Polands sonnengerötetem Gesicht zu beobachten. Einerseits freute er sich, denn das schriftliche Lob eines Vizeadmirals konnte vielleicht für eine noch schnellere Beförderung des Kommandanten sorgen. Andererseits konnte es aber so interpretiert werden, daß Poland die zweifelhafte Gönnerschaft eines Mannes genoß, der über Autorität spottete, der seine Frau wegen einer anderen verlassen und seine Ehre in den Wind geworfen hatte.
Aber jetzt war jetzt, und Bolitho sagte scharf: »Also los!«
Auf dem Achterdeck sah Bolitho seinen Flaggleutnant Jenour bei den Schiffsoffizieren stehen und freute sich wieder, wie vorteilhaft sich der Mann verändert hatte: ein eifriger, liebenswürdiger Junge und der erste in seiner Familie, der zur Royal Navy gegangen war. Bolitho hatte anfangs daran gezweifelt, daß er die Herausforderungen bestehen würde, die sie erwarteten. Auch hatte er gehört, daß einige der erfahrenen Salzbuckel an Bord darüber Wetten abschlossen, wie lange Jenour überleben würde. Aber er hatte überlebt – und wie! Er war aus den Gefechten als Mann, als Veteran hervorgegangen.
Es war Jenours schöner Degen gewesen, ein Geschenk seines Vaters, der ihm entrissen worden war, als er Bolitho zu Hilfe eilte. Jenour hatte aus dieser Erfahrung ebenso gelernt wie aus vielen anderen. Seit jenem letzten Gefecht trug der junge Mann seinen Degen stets an eine Sorgleine geknüpft, die mit einem dekorativen Knoten geschmückt war und die Waffe im Kampf fest mit seinem Handgelenk verband. Es war auffallend, mit welchem Respekt die Offiziere der Truculent Jenour behandelten, obwohl die meisten von ihnen älter waren als er und einen höheren Rang hatten. Die Fregatte mit ihren sechsunddreißig Kanonen war zwar ständig im Dienst gewesen, auf Patrouillen und als Begleitschiff, doch noch kein Mitglied der Offiziersmesse hatte – wie Jenour – bisher an einem größeren Seegefecht teilgenommen.
Bolitho nickte den Offizieren zu und schritt übers Seitendeck nach vorn, das wie sein Gegenüber das Achterdeck mit dem Vordeck verband. Unter ihm in der Kuhl wurde die Hauptbatterie bereits vom Stückmeister und einem seiner Gehilfen inspiziert. Poland war wirklich gründlich, dachte Bolitho. Er stand jetzt an der Reling und beobachtete die halbnackten Seeleute, die ihre Hängematten sauber in die Finknetze stauten. Einige der Männer waren schon braun, andere rot verbrannt von zuviel Sonne.
Diese Sonne erhob sich nun aus der See und übergoß die niedrigen Wellen wie mit geschmolzenem Kupfer. Schon dampfte Truculent in der Morgenkühle. Sie würde wie ein Geisterschiff aussehen, bis die Hitze Rumpf und Segel ganz getrocknet hatte.
Bolitho bedauerte die Wachoffiziere in ihren Hüten und schweren Mänteln. Poland wollte damit offensichtlich Autorität demonstrieren, wie ungemütlich sie sich auch fühlten. Was sie wohl von seiner lässigen Kleidung hielten? Für Pomp und Etikette blieb immer noch Zeit, wenn sie auf die Flotte trafen, die angeblich hier vor der afrikanischen Küste operierte. Unterwegs waren sie sich vorgekommen wie das einzige Schiff auf dem Ozean.
Gedankenversunken begann er langsam hin und her zu gehen. Männer, die mit nimmer endenden Wartungsarbeiten beschäftigt waren, mit Spleißen, dem Ersatz von Tauwerk, mit Malen und Schrubben, sahen hoch, wenn sein Schatten an ihnen vorbeiglitt. Aber jeder schaute schnell weg, wenn ihre Blicke sich zufällig trafen.
Mr. Hull, der schweigsame Master der Fregatte, überwachte drei Midshipmen, die abwechselnd in einer Karte arbeiteten. Neben ihm versuchte der Zweite, zur Zeit Wachoffizier, nicht zu gähnen – das wäre riskant gewesen bei einem Kommandanten mit so unberechenbarem Temperament. Aus der Kombüse roch es nach Frühstück, doch bis zum Wachwechsel würde es noch lange dauern.
Hull fragte leise: »Was denkt er jetzt wohl, Mr. Munro?« Er deutete kurz auf die hohe Gestalt im weißen Hemd, in deren dunklem Haar, im Nacken zusammengebunden, die Brise spielte, während er ohne Hast hin und her wanderte.
Munro antwortete leise: »Ich weiß nicht, Mr. Hull. Aber wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was man so hört, hat er genug zum Nachdenken.«
Wie die anderen hatte auch Munro wenig vom Vizeadmiral gesehen, außer bei einem gemeinsamen Essen, zu dem er und der Kommandant die Offiziere und Unteroffiziere eingeladen hatten, um ihnen den Zweck der Reise zu erläutern.
Zwei starke Verbände waren mit Infanterie und Seesoldaten zum Kap beordert worden. Ihr einziges Ziel: zu landen, Kapstadt zu belagern und es den Holländern wieder abzunehmen, Napoleons unfreiwilligen Alliierten. Dann, und nur dann, würden Englands Schiffahrtswege ums Kap wieder sicher sein vor französischen Kaperern. In Kapstadt gab es auch eine Werft, die nach der Wiedereroberung verbessert und vergrößert werden sollte, damit englische Schiffe sich nie wieder notdürftig selbst versorgen oder wertvolle Monate vergeuden mußten auf der Suche nach passenden Stützpunkten.
Polands Stimme schnitt durch Munros Gedanken wie ein Messer: »Mr. Munro! Achten Sie gefälligst auf die Faulpelze, die angeblich am zweiten Kutter arbeiten. Sie starren zum Horizont, statt zu arbeiten. Aber vielleicht liegt es daran, daß auch der Wachhabende in den Tag träumt, wie?«
Mr. Hull grinste mitleidlos. »Der hat seine Augen wirklich überall.« Er wandte sich an die Seekadetten, um von Munros Verlegenheit abzulenken. »Und was treiben Sie da, meine Herren? Guter Gott, so werden aus Ihnen niemals Leutnants, aus keinem von Ihnen.«
Bolitho hörte das alles, war aber in Gedanken woanders. Er dachte an Catherines verzweifelten Zorn. Wieviel von dem, was sie sagte, traf zu? Er wußte, daß er sich im Lauf der Jahre Feinde gemacht hatte. Viele hatten versucht, ihm zu schaden, auch wegen seines toten Bruders Hugh, der während der Amerikanischen Revolution die Fronten gewechselt hatte. Später hatten sie das gleiche mit seinem Neffen Adam versucht. O ja, er hatte echte Feinde, nicht nur eingebildete.
Brauchte man ihn wirklich so schnell am Kap der Guten Hoffnung? Oder stimmte es, daß Nelsons Sieg über die Vereinigte Flotte die englische Strategie völlig umgestoßen hatte? Frankreich und Spanien hatten zwar viele Schiffe verloren, sie waren gesunken oder als Prise genommen worden. Aber auch Englands Flotte war nach Trafalgar schwer angeschlagen, und die wichtigen Blockadegeschwader vor Frankreichs Häfen hatten die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Napoleon würde jetzt neue Schiffe brauchen und sie in Toulon bauen lassen oder an der französischen Kanalküste, moderne Schiffe, von denen Nelson in seinen Wortgefechten mit der Admiralität so oft gesprochen hatte. Doch bis dahin würde sich Napoleon woanders nach Hilfe umschauen – vielleicht bei seinem alten Aliierten Amerika?
Bolitho zupfte Kühlung suchend an seinem Hemd, einem aus der eleganten Kollektion, die Catherine ihm in London gekauft hatte, während er bei den Lords der Admiralität vorsprach. Er hatte die Hauptstadt immer gehaßt, ihre verlogene Gesellschaft, ihre privilegierten Bürger, die den Krieg nur wegen seiner Unbequemlichkeit verfluchten, ohne an die vielen Männer zu denken, die draußen ihr Leben hingaben, um die Freiheit aller zu schützen. Bürger wie … Doch er verdrängte Belinda aus seinen Gedanken und tastete nach dem silbernen Medaillon, das Catherine ihm gegeben hatte: klein, aber mit ihrem perfekten Miniaturporträt im Inneren. Es zeigte ihre dunklen Augen, ihren unverhüllten Hals, wie er ihn kannte und liebte. Auf der Rückseite enthielt es eine gepreßte Haarlocke von ihr. Er konnte nur raten, wie lange sie dieses Medaillon schon besessen hatte. Sicherlich war es kein Geschenk ihres ersten Mannes, dieses Glücksritters, der bei einer Rauferei in Spanien ums Leben gekommen war. Vielleicht aber stammte es von ihrem zweiten Mann, Luis Parejas. Er war gefallen, als er Bolitho half, ein erobertes Handelsschiff gegen Berberpiraten zu verteidigen. Luis war doppelt so alt gewesen wie Catherine, aber auf seine Weise hatte er sie geliebt. Die Miniatur besaß die Finesse, die er als spanischer Kaufmann geschätzt hätte.
Damals war Catherine in Bolithos Leben getreten – und nach einer kurzen, heftigen Affäre wieder daraus verschwunden. Das war ein Mißverständnis gewesen, der fehlgeschlagene Versuch, ihrer beider Ruf zu schützen. Bolitho hatte sich oft verflucht, daß er ihre Trennung zugelassen hatte.
Erst vor zwei Jahren, als die Hyperion Antigua anlief, hatten sie einander wiedergefunden. Bolitho führte eine Ehe mit Belinda, die erkaltet war. Catherine war zum dritten Mal verheiratet – mit Viscount Somervell, einem bösartigen, dekadenten Mann. Er hatte versucht, sie physisch zu vernichten, und hatte sie ins Schuldgefängnis werfen lassen, als er von ihrer neu entflammten Leidenschaft erfuhr. Bolitho hatte sie daraus gerettet. Er hörte ihre Stimme so klar, als stünde sie neben ihm auf dem schnell trocknenden Deck: »Trag dies immer bei dir, Liebster. Ich werde es dir erst wieder abnehmen, wenn du neben mir liegst.« Er fühlte die Gravur auf der Rückseite des Medaillons, die sie in London hatte anbringen lassen: Möge das Glück dich immer leiten. Möge die Liebe dich immer schützen.
Bolitho trat an die Finknetze und beschattete seine Augen, um ein paar Möwen zu beobachten. Dann wandte er den Kopf und hielt den Atem an. Die Sonne war zwar stark, blendete aber noch nicht genug, um … Er zögerte, starrte zur glitzernden Kimm. Nichts geschah. Kein Nebel stieg auf wie ein böser Geist und trübte sein linkes Auge. Er atmete auf.
Allday bemerkte Bolithos Reaktion und freute sich. Das Gesicht des Vizeadmirals hatte ausgesehen wie das eines Mannes auf dem Schafott, der im letzten Augenblick begnadigt worden war.
»An Deck!« Alle Gesichter wandten sich nach oben. »Segel an Steuerbord achteraus!«
Scharf befahl Poland: »Mr. Williams, entern Sie auf und nehmen Sie ein Fernglas mit nach oben!«
Der Erste nahm dem Midshipman der Wache das Teleskop ab und kletterte in den Wanten des Großmasts zum Krähennest hinauf. Truculents Leinwand blähte sich kaum, doch die Bramsegel des fremden Schiffes schienen sich ihnen auf konvergierendem Kurs mit großer Schnelligkeit zu nähern. Bolitho hatte das oft beobachtet: Im selben Seegebiet hing das eine Schiff in der Flaute fest, während das andere mit vollen Segeln dahinstürmte.
Poland sah Bolitho ausdruckslos an, aber seine Hände öffneten und schlossen sich an seiner Seite und verrieten seine Erregung. »Soll ich klar zum Gefecht machen, Sir Richard?«
Bolitho hob das Teleskop. Eine ungewöhnliche Peilung. Wahrscheinlich gehörte der Ankömmling nicht zum örtlichen Geschwader. »Wir lassen uns noch Zeit, Kapitän Poland. Zweifellos können Sie die Kanonen in weniger als zehn Minuten ausrennen lassen, wenn es sein muß.«
Poland errötete. »Ich – also, Sir Richard …« Er nickte energisch. »In weniger, ganz bestimmt.«
Bolitho richtete das Glas sorgsam aus, konnte aber nur die Mastspitzen des Ankömmlings erkennen. Er sah die Peilung auswandern, weil der andere Kurs änderte, als wolle er sich auf die Tuculent stürzen.
Leutnant Williams rief aus dem Krähennest: »Fregatte, Sir!«
Bolitho sah winzige Farbflecken über dem fremden Schiff aufsteigen, als dort ein Flaggensignal gehißt wurde. Williams rief die Kennziffern nach unten. Poland konnte sich nur mit Mühe davon zurückhalten, dem Midshipman das Signalbuch aus den Händen zu reißen.
Der Junge stotterte: »Es ist die Zest, Sir. Vierundvierzig Kanonen. Unter Kapitän Varian.«
Poland murmelte: »Oh, ich weiß, wer er ist. Antwortet mit unserer Kennung – schnell!«
Bolitho senkte das Glas und beobachtete die beiden Gesichter. Das des Midshipman war verwirrt, fast verängstigt. Noch vor wenigen Minuten hatte er den ersten Hügel des ersehnten Landes gesehen, das sich aus dem Seedunst hob, und im nächsten Augenblick war das alles unwichtig geworden, und die Aussicht auf einen unerwarteten Feind, vielleicht sogar auf den Tod, lag vor ihm. Das andere Gesicht war das Polands. Wer Varian auch sein mochte, er war bestimmt nicht sein Freund und ohne Zweifel ranghöher, da er ein Vierundvierzig-Kanonen-Schiff befehligte.
Leutnant Munro hockte in den Wanten, die Beine um die Webleinen gehakt, achtete nicht auf den Teer, der seine weiße Kniehose befleckte, und hatte sogar seinen Frühstückshunger vergessen. »Signal, Sir: Kommandant wird an Bord gebeten«, meldete er.
Bolitho sah die plötzliche Niedergeschlagenheit in Polands Gesicht. Nach dieser bemerkenswert schnellen Reise von England, ohne Verlust oder Verletzung eines einzigen Mannes an Bord, wirkte diese Arroganz auf ihn wie ein Schlag ins Gesicht.
»Mr. Jenour zu mir, bitte.« Bolitho sah den Flaggleutnant ahnungsvoll lächeln. »Ich nehme an, Sie haben meine Flagge in Verwahrung?«
Diesmal konnte Jenour das Grinsen nicht zurückhalten. »Aye, aye, Sir!« Er rannte fast vom Achterdeck.
Bolitho sah, wie die große Segelpyramide der anderen Fregatte sich über dem funkelnden Wasser hob und senkte. Was er vorhatte, war vielleicht kindisch – aber Poland hatte es verdient.
»Kapitän Poland, um der guten Ordnung willen: Ihr Schiff steht nicht nur unter Ihrem Kommando.« Er sah, wie auf Polands angespanntem Gesicht die Niedergeschlagenheit dem Begreifen wich. »Signalisieren Sie bitte an Zest, und machen Sie es Kapitän Varian unmißverständlich klar: ›Sie haben den Vortritt‹.«
Poland blickte hoch, als Bolithos Admiralsflagge im Fockmasttopp auswehte. Dann gestikulierte er ungeduldig zu den Signalgasten hinüber, die fieberhaft ihre bunten Signalflaggen ordneten.
Jenour trat zu Munro, als der wieder an Deck sprang. »Sie wollten doch wissen, wie der wahre Bolitho aussieht«, sagte er. »Zum Beispiel duldet er nicht, daß man seinen Männern mit Mißachtung begegnet.« Nicht einmal einem Streber wie Poland, hätte er fast hinzugefügt.
Bolitho sah die Teleskope auf der anderen Fregatte das Sonnenlicht reflektieren. Zests Kommandant konnte nichts von Bolithos Auftrag wissen, niemand konnte das. Er biß die Zähne zusammen. Aber nun waren sie alle gewarnt.
II Erinnerung an Nelson
»Bitte, glauben Sie mir, Sir Richard, eine Respektlosigkeit war nicht beabsichtigt …«
Bolitho stand am großen Kajütfenster und hörte das Schlagen der Blöcke und das Plätschern der Wellen. Die Truculent lag beigedreht. Ihre Unterredung mußte kurz sein, denn der Wind würde bald wieder auffrischen, wie der Master vorhergesagt hatte. Die andere Fregatte sah er nicht, sie lag wohl in Lee.
Er setzte sich auf die Bank unter dem Fenster und deutete auf einen Stuhl. »Eine Tasse Kaffee, Kapitän Varian?« Er hörte Ozzards leise Schritte, der mit der Kanne herbeikam. So hatte Bolitho Zeit, seinen Gast genauer zu betrachten.
Kapitän Varian war das genaue Gegenteil von Poland: sehr groß, breitschultrig und selbstsicher. Wie sich Landratten wahrscheinlich Fregattenkapitäne vorstellten.
»Ich brannte eben auf Neuigkeiten, Sir Richard«, fuhr Varian fort. »Da sah ich dieses Schiff und …« Er hob seine großen Hände und versuchte, entwaffnend zu lächeln.
Bolitho musterte ihn unbewegt. »Daß ein Kommandant der Kanalflotte kaum Zeit zum Übersetzen haben dürfte, ist Ihnen nicht eingefallen? Sie hätten doch leicht auf Rufweite herankommen können.«
Ozzard goß Kaffee ein und starrte an dem Besucher vorbei.
»Ich hab’ eben nicht nachgedacht«, nickte Varian. »Aber daß gerade Sie hier sind, Sir Richard, der doch sicher woanders dringend gebraucht wird …« Das Lächeln blieb, der Blick wurde hart.
Das ist kein Mann, mit dem man sich streitet, jedenfalls nicht als Untergebener, dachte Bolitho. »Sie werden sofort auf Ihr Schiff zurückkehren, Kapitän«, sagte er. »Aber vorher bitte ich um Ihre Beurteilung der Lage.« Er trank einen Schluck heißen Kaffee. Was ist bloß los mit mir? dachte er. Warum bin ich so kurz angebunden? Als junger Kommandant hätte er doch genauso gehandelt. Tausend Meilen von zu Hause monatelang warten und dann ein befreundetes Schiff treffen … »Ich habe neue Befehle auch für Sie«, schloß er.
Varian sah ihn aufmerksam an. »Sie wissen, Sir Richard, der größte Teil von Heer und Marine für die Rückeroberung von Kapstadt ist bereits hier. Das Geschwader ankert nordwestlich von hier vor der Saldanhabucht. Sir David Baird befehligt die Truppen, Commodore Popham die Transporter und Begleitschiffe. Wie ich hörte, soll die Landung bald beginnen.« Er verstummte unter Bolithos festem Blick.
»Sie gehören zur Einsatzreserve.« Bei dieser Feststellung zuckte Varian mit den Schultern und schob seine Tasse auf dem Tisch hin und her.
»Jawohl, Sir Richard. Ich erwarte aber noch einige Schiffe.« Als Bolitho schwieg, fuhr er fort: »Wir beobachteten das Kap und sahen Ihre Segel. Da nahm ich an, Sie seien vom Kurs abgekommen.«
»Warum hat Ihr Vorgesetzter, Commodore Warren, Sie dazu abgestellt? Zest ist doch seine wichtigste Fregatte, deren Hilfe er jederzeit brauchen kann.« Bolitho erinnerte sich an Commodore Warren wie an ein verblaßtes Bild. Er hatte mit ihm vor Toulon zu tun gehabt. Damals wollten französische Königstreue den Hafen der Revolutionsarmee wieder abnehmen, und Bolitho war zum ersten Mal Kommandant der Hyperion gewesen. Seither hatte er Warren nicht mehr getroffen, hatte nur gehört, daß er in der Karibik Dienst tat.
»Dem Commodore geht es nicht gut, Sir Richard«, antwortete Varian. »Er hätte meines Erachtens kein Kommando mehr, wenn …«
»Sie haben also als dienstältester Kapitän die gesamte Verantwortung für die Begleitschiffe übernommen?«
»Ich habe einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben, Sir Richard.«
»Den werde ich lesen, sobald ich Zeit dazu habe.« Bolitho hob die Hand. »Ich will, daß wir Kapstadt früher angreifen. Die Zeit ist entscheidend. Darum sind wir so schnell gesegelt.« Das traf Varian. »Also werden unsere beiden Schiffe sofort zum Geschwader stoßen. Ich möchte Commodore Warren unverzüglich sprechen.«
Er stand auf und sah aus dem Heckfenster. Die Wellenkämme kräuselten sich im Wind wie weiße Spitzen. Das Schiff hob sich ungeduldig.
Varian versuchte Haltung zu bewahren. »Und wo bleiben die anderen uns versprochenen Schiffe, Sir Richard?«
»Es gibt keine anderen Schiffe und wird auch keine geben. Ich muß sogar einige der hiesigen Einheiten sofort nach England in Marsch setzen.«
»Ist etwas Schlimmes passiert, Sir Richard?«
»Im Oktober hat unsere Flotte unter Lord Nelson den Feind bei Trafalgar besiegt«, sagte Bolitho leise.
Varian schluckte trocken. »Das wußten wir nicht, Sir Richard.« Für einen Moment verlor er die Kontrolle. »Ein Sieg! Mein Gott, was für eine wunderbare Nachricht!«
Bolitho zuckte mit den Schultern. »Aber der tapfere Lord Nelson ist dabei gefallen. Der Sieg war also zu teuer erkauft.«
Es klopfte, Poland trat ein. Die Kapitäne musterten einander, nickten sich zu wie alte Freunde. Doch Bolitho spürte, daß sie Welten trennten.
»Der Wind frischt auf aus Nordwest, Sir Richard.« Poland sah Varian nicht wieder an. »Und Zests Beiboot hängt immer noch an den Großrüsten in Luv.«
»Bis demnächst, Kapitän Varian.« Bolitho streckte die Hand aus und ergänzte etwas freundlicher: »Wir blockieren noch immer alle feindlichen Häfen, Sir. Das ist lebenswichtig für unser Land und muß auch so bleiben. Aber trotz des ermutigenden Siegs von Trafalgar ist unsere Flotte geschwächt.«
Die Tür fiel hinter den beiden Kapitänen zu, und Bolitho hörte das Schrillen der Pfeifen, als Varian von Bord ging.
Unruhig lief Bolitho in seiner Kajüte auf und ab und erinnerte sich an seine letzte Besprechung in der Admiralität in London. Admiral Sir Owen Godschale hatte ihm erläutert, warum Eile geboten war. Zwar war die vereinigte französischspanische Flotte geschlagen, aber der Krieg noch lange nicht gewonnen. Es gab Berichte, wonach mindestens drei kleine französische Geschwader die Blockade durchbrochen hatten und in den Weiten des Atlantiks verschwunden waren. War es Napoleons neue Strategie, abgelegene Häfen und einsame Inseln zu überfallen, Versorgungsschiffe aufzubringen und Handelswege zu bedrohen? Gab es keine Ruhe für die Engländer, während die Franzosen ihre neue Flotte aufbauten?
Godschales verächtliche Einschätzung der französischen Kriegsmarine ärgerte Bolitho. Ein Geschwader, das aus Brest ausgebrochen war, hatte der erfahrene alte Vizeadmiral Leis- segues geführt, und sein Flaggschiff, die Imperial, hatte 120 Kanonen. Das war also gewiß keine Lappalie, wie Sir Owen meinte.
Die Franzosen hatten sicher Kapstadt im Auge, und was sie mit einer Eroberung der Stadt erreichen würden, konnte man sich leicht vorstellen. Dann konnten sie wie mit einer Axt Englands Handelswege nach Indien und Ostasien kappen.
Bolitho erinnerte sich, wie kühl Godschale zu ihm gewesen war. Der Admiral war zur selben Zeit wie er in die Marine eingetreten, sie waren also dem Dienstalter nach gleich. Aber vielleicht wollte Godschale wie so viele andere, möglicherweise sogar auf Betreiben Belindas, Catherine und ihn trennen. Oder liebte der Admiral seine neue Macht so sehr, wie er Skandale haßte? Es hieß, Godschale strebe einen Sitz im Oberhaus an.
Catherines Worte klangen ihm wieder im Ohr: »Begreifst du nicht, was sie uns antun?«
Vielleicht war dieser Auftrag nur ein Anfang. Jeder in London wußte, wie Bolitho eine Aufgabe anging: furchtlos, ohne Zögern und ohne Rücksicht auf das, was zu Hause geschah. Wollte man ihm eine Falle stellen?
Er trat vor den alten Familiendegen an der Wand. Er sah schäbig aus, verglichen mit der prunkvollen Präsentierwaffe darunter. Aber so viele Bolithos vor ihm hatten die alte Waffe geführt und waren manchmal sogar mit ihr gefallen. Keiner seiner Vorfahren hatte sie kampflos gestreckt. Das machte Bolitho zuversichtlich, und er lächelte grimmig, als Allday eintrat.
»Jetzt ist die Nachricht über Lord Nelsons Tod im Geschwader rum, Sir. Das wird manchem den Mut nehmen.« Er deutete auf das afrikanische Festland. »Dafür zu kämpfen lohnt sich nicht, werden sie sagen. Ja, wenn man zwischen den Franzosen und England stünde …«
»Mit solch knorrigen alten Eichen wie dir werden sie schon wieder Mut fassen«, antwortete Bolitho.
»Außerdem wette ich, daß sich zwei gewisse Kapitäne bald in den Haaren liegen«, grinste Allday.
Bolitho musterte ihn forschend. »Verdammt noch mal, was weißt du noch, du alter Fuchs?«
»Nicht viel im Augenblick, Sir Richard. Nur daß unser Kapitän Poland früher mal Erster Offizier bei diesem anderen Kapitän war.«
Bolitho schüttelte den Kopf. Nur mit Allday konnte er freimütig über alles reden. Die anderen erwarteten von ihm nur Führung und sonst nichts.
Allday nahm den Degen von der Wand und wickelte ihn in ein Tuch. »Ich sag’ ja immer, Sir Richard, achtern finden Sie zwar die meiste Ehre, aber vorn die besseren Männer. Und dabei bleibt’s.«
Als Allday gegangen war, setzte sich Bolitho und öffnete sein Tagebuch. Darin lag der Brief an Catherine, den er begonnen hatte, als England in Dunst und Regen achteraus verschwunden war – zu Beginn der langen Reise. Ob sie diesen Brief je lesen würde, konnte er erst wissen, wenn sie wieder in seinen Armen lag. Er beugte sich vor und berührte das Medaillon unter seinem frischen Hemd.
Wieder ein Morgen, liebste Kate, und ich sehne mich so nach dir … Er schrieb noch immer, als das Schiff über Stag ging und der Ausguck im Masttopp das versammelte Geschwader meldete.
Mittags ging er an Deck und spürte die Sonne wie Feuer im Gesicht. Seine Schuhe blieben am aufgeweichten Teer kleben, der aus den Ritzen der Planken quoll. In seinem Teleskop sah er braunrote und rosa Berge unter dem harten, glitzernden Licht liegen. Die Sonne gleißte wie poliertes Silber und sog alle Farbe aus dem Himmel. Er bewegte das Glas, fing den Schwell darin ein, der das Schiff anhob und an beiden Seiten vorbeirauschte. Das also war der Tafelberg: ein dunkler Klotz in geheimnisvollem Dunst, dräuend wie ein riesiger Altarstein.
Zu seinen Füßen ankerten die Schiffe. Er musterte eins nach dem anderen. Der ältere Vierundsechziger Themis war Commodore Warrens Flaggschiff. Warren war krank. Aber wie schwer? Er hatte Varian nicht weiter ausgefragt, wollte nicht Untergebenen gegenüber unsicher erscheinen, die ihm bald rückhaltlos vertrauen mußten.
Eine zweite Fregatte, einige Schoner und zwei Versorger bildeten den Rest, der Kern der Flotte lag weiter im Nordwesten sicher vor Anker, weit genug von Land entfernt. Hier gab es nur eine kleine flache Bank, auf der man ankern konnte. Hinter der Hundert-Faden-Linie fiel der Grund steil ab in schwarze Tiefen.
Licht spiegelte sich drüben in Teleskoplinsen, und Bolitho wußte, daß man die Truculent überrascht beobachtete, ihr langsames Näherkommen unter der Admiralsflagge im Vortopp. Kapitän Poland trat neben ihn.
»Rechnen Sie mit einem langen Feldzug, Sir Richard?« fragte er. Sein Ton war überaus höflich. Sicher wollte er gern wissen, was Bolitho und Varian in der Kajüte besprochen hatten.
Bolitho ließ das Teleskop sinken und sah Poland an. »Ich hatte gelegentlich mit dem Heer zu tun, Kapitän. Die mögen Feldzüge, ich nicht. Eine Seeschlacht ist schnell vorbei, man siegt oder streicht die Flagge. Langwierige Nachschubprobleme und endlose Märsche sind nichts für mich.«
Poland gestattete sich ein seltenes Lächeln. »Für mich auch nicht, Sir Richard.«
Bolitho sah sich nach Jenour um. »Lassen Sie Wasserleichter längsseits kommen, sobald wir ankern, Kapitän. Und loben Sie Ihre Mannschaft mal, das wird allen gut tun. Es war eine sehr schnelle Reise.«
Als die Achterdeckswache den großen Besanbaum schiftete, stach das Sonnenlicht wie mit blitzenden Lanzen nach ihnen. Bolitho biß die Zähne zusammen. Aber sie hatten sich alle geirrt, sein Auge war in Ordnung. Er konnte die anderen Schiffe trotz des Hitzeflimmerns klar und deutlich erkennen.
Jenour beobachtete ihn und nickte Allday zu, der mit dem polierten Degen nach achtern kam. Es gab also doch noch Hoffnung.
Die beiden Fregatten drehten in den Wind und ankerten erheblich früher als selbst der grimmige Mr. Hull vorhergesagt hatte. Signale wurden ausgetauscht, Boote zu Wasser gelassen, Sonnensegel aufgeriggt. Bolitho beobachtete das alles vom Achterdeck aus, während er noch einmal über seinen Auftrag nachdachte.
Der Landeplatz im Nordwesten war für den ersten Angriff gut gewählt, es gab keinen besseren. Bolitho studierte die Karte mit größter Sorgfalt. Die Saldanhabucht war flach und geschützt genug, um dort Truppen und Marineinfanterie anlanden zu können. Die Schiffe würden ihnen zunächst Feuerschutz geben. Doch im Binnenland begannen dann die wirklichen Probleme, denn die Bucht lag einhundert Meilen von Kapstadt entfernt. Die englische Infanterie, wochenlang auf engstem Raum an Bord zusammengepfercht, war noch nicht fit für lange Fußmärsche und ständige Scharmützel. Die Holländer, diese hervorragenden Soldaten, würden sich nicht alle paar Meilen mit ihnen schlagen, sondern Vorräte und Wasserstellen unbrauchbar machen und den erschöpften Truppen erst vor Kapstadt entschlossen entgegentreten. Widerstand bei der bevorstehenden Landung schien also wenig wahrscheinlich.
Bolitho verspürte seine alte Ungeduld. Es würde einen langen und teuren Feldzug geben, der um die Nachschublinien geführt wurde von Truppen, die bisher nur den Garnisonsdienst in Westindien kennengelernt hatten – auf den Inseln des Todes, wie die Infanterie sie nannte. Dort starben mehr Männer an Fieber als im Feuer des Feindes.