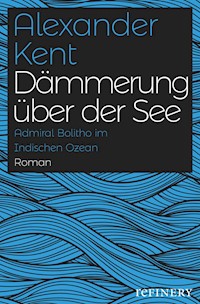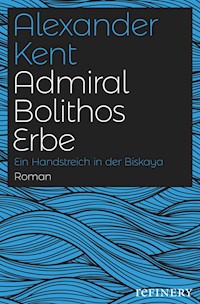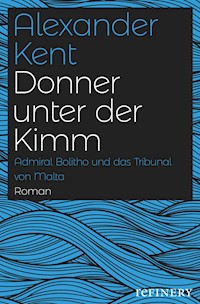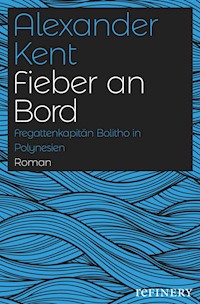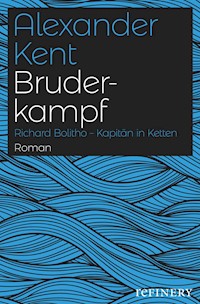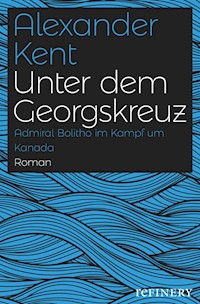
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
1813: Kaum aus Übersee zurückgekehrt, wird Sir Richard Boltiho von der britischen Admiralität erneut in die Pflicht genommen. Napoleon, der Verbündete der Amerikaner, beginnt sich an allen Fronten zurückzuziehen, und die Yankees drängen auf eine schnelle Entscheidung. Mit seinen Getreuen führt Sir Richard auf der Indomitable das Geschwader an, das den Feind vor Kanadas Küste vernichtend schlagen soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Ähnliche
Unter dem Georgskreuz
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester. Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1813: Kaum aus Übersee zurückgekehrt, wird Sir Richard Boltiho von der britischen Admiralität erneut in die Pflicht genommen. Napoleon, der Verbündete der Amerikaner, beginnt sich an allen Fronten zurückzuziehen, und die Yankees drängen auf eine schnelle Entscheidung. Mit seinen Getreuen führt Sir Richard auf der Indomitable das Geschwader an, das den Feind vor Kanadas Küste vernichtend schlagen soll.
Alexander Kent
Unter dem Georgskreuz
Admiral Bolitho im Kampf um Kanada
Roman
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlagder Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinOktober 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© der deutschen Übersetzung: Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1998© 1996 by Bolitho Maritime ProductionsTitel der englischen Originalausgabe: Cross of St. GeorgeCovergestaltung: © Sabine Wimmer, BerlinE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-96048-123-2
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Der Ehrensäbel
II Um der Liebe willen
III Aufbruch am Morgen
IV Kapitäne
V Ein Gesicht in der Menge
VI Böses Blut
VII Der älteste Trick
VIII Ein zu großer Verlust
IX Ein Flaggkapitän
X Zeit und Entfernung
XI Eine Warnung
XII Ehrenkodex
XIII Damit sie es nie vergessen
XIV Urteil
XV Kein Kriegsgeschrei
XVI Die Lee-Küste
XVII Der größte Lohn
Epilog
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
I Der Ehrensäbel
Widmung
Für meine Kimin Liebe und Dankbarkeitfür dein Kanada,das du mit mir teiltest.
Motto
Wo immer Holz schwimmen kann,werde ich ganz sicher diese englische Flagge finden.
Napoleon Bonaparte
I Der Ehrensäbel
Die Königliche Werft in Portsmouth, gewöhnlich ein lauter und geschäftiger Ort, lag still wie ein Grab. Zwei Tage lang hatte es ununterbrochen geschneit, und die Häuser, Werkstätten, Holzstapel und Vorräte für die Schiffe, die typisch waren für jede Werft, hatten sich in bedeutungslose Schemen verwandelt. Und es schneite immer noch weiter. Die weiße Decke hatte selbst die vertrauten Gerüche überlagert: Die unverkennbare Mischung aus Farbe und Teer, Hanf und frischem Sägemehl roch anders als sonst. Sie schien so fremd wie die Geräusche. Gedämpft durch den vielen Schnee waren sogar der Schuß der Kanone, mit dem die Verhandlung des Kriegsgerichts eröffnet wurde, und sein Echo fast unbemerkt verhallt.
Residenz und Kontore des Admirals schienen heute noch mehr von den anderen Gebäuden isoliert als sonst. Von einem der hohen Fenster, von dem man immer ein nahes Dock überblickte, konnte man jetzt nicht einmal das Wasser des Hafens entdecken.
Kapitän Adam Bolitho wischte über das feuchte Fensterglas und starrte nach unten auf den einsamen Posten, einen Seesoldaten in scharlachroter Uniformjacke. Es war früher Nachmittag, doch schon dämmrig wie bei Sonnenuntergang. Im Fenster betrachtete Bolitho sein Spiegelbild und das flackernde Holzfeuer im Kamin an der anderen Seite des Raums. Dort saß auf der Kante eines Stuhls sein Begleiter, ein nervöser, junger Leutnant, und rieb seine Hände vor den Flammen. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Bolitho Mitleid mit ihm gehabt. Es war keine leichte oder gar erstrebenswerte Pflicht, als Begleiter zu agieren. Seine Lippen wurden schmal. Begleiter?
Eskorte war richtiger. Eskorte für jemanden, der vor einem Kriegsgericht erscheinen mußte. Dabei hatte ihm jedermann versichert, daß das Urteil ohne jeden Zweifel zu seinen Gunsten ausfallen würde.
Das Gericht war an diesem Morgen in der großen Halle zusammengetreten, die sich an das Haus des Admirals anschloß. Sie diente häufiger als Ort für Empfänge denn als Gerichtssaal, in dem über das Schicksal eines Mannes, ja sogar über sein Leben entschieden wurde. Man sah immer noch einige unpassende Spuren des großen Weihnachtsballs, der kürzlich hier veranstaltet worden war.
Adam starrte auf den Schnee. Gerade hatte ein neues Jahr begonnen: Man schrieb den 3. Januar 1813. Nach allem, was er durchgemacht hatte, hätte er nach diesem Neuanfang greifen müssen wie ein Ertrinkender nach der Rettungsleine. Aber das tat er nicht, konnte es nicht. Alles, was ihm lieb und teuer war, lag hinter ihm – nur zerbrochene Erinnerungen blieben ihm.
Er spürte, daß der Leutnant sich auf seinem Stuhl regte, und bemerkte Bewegung auch draußen. Das Gericht trat wieder zusammen. Nach einer sicher verdammt guten Mahlzeit, dachte er. Das Essen war offenbar ein Grund, die Verhandlung hier zu führen, statt die Herren der Unbill einer Passage im offenen Boot zum Flaggschiff auszusetzen, das irgendwo im Schneetreiben in Spithead ankerte.
Er berührte die Seite, wo der eiserne Splitter ihn getroffen und zu Boden gerissen hatte. Er glaubte damals, sterben zu müssen. Manchmal hatte er sich das sogar gewünscht. Wochen und Monate waren inzwischen vergangen. Und immer noch fiel es ihm schwer zu begreifen, daß er vor weniger als sieben Monaten verwundet worden war. Und daß damals seine geliebte Anemone sich dem Feind ergeben hatte – ohnmächtig gegen die geballte Feuerkraft der U.S.S. Unity. Selbst heute noch war seine Erinnerung daran verschwommen. Der rasende Schmerz der Wunde, der gebrochene Stolz, der nicht akzeptieren wollte, daß er Kriegsgefangener war. Ohne Schiff, ohne Hoffnung, jemand, den man schnell vergessen würde.
Jetzt spürte er kaum noch Schmerzen. Selbst einer der Chirurgen der Königlichen Flotte hatte das Können des französischen Wundarztes der Unity gelobt, ebenso die anderen Ärzte, die während seiner Gefangenschaft alles Menschenmögliche für ihn getan hatten.
Er war geflohen. Männer, die er kaum gekannt hatte, hatten alles für ihn aufs Spiel gesetzt, um ihn zurück in die Freiheit zu bringen. Einige waren dafür sogar gestorben. Und dann gab es noch andere, denen er auch niemals zurückgeben könnte, was sie für ihn getan hatten.
Mit einem Räuspern sagte der Leutnant: »Ich glaube, sie sind zurück, Sir!«
Adam nickte. Der Mann schien Furcht zu haben. Vor mir? Vielleicht wollte er nur Abstand halten, falls man mich verurteilte?
Seine Fregatte, die Anemone, hatte sich mit einem weit überlegenen Gegner eingelassen, der nicht nur mehr Kanonen, sondern auch eine größere Mannschaft besaß. Viele Männer der Anemone waren als Prisenkommandos von Bord geschickt worden. Nicht aus Überheblichkeit oder verstiegenem Stolz hatte er gehandelt. Es ging darum, einen Konvoi von drei schwer beladenen Frachtschiffen, die er zu den Bermudas begleiten sollte, zu retten. Anemones Angriff hatte dem Konvoi Gelegenheit zur Flucht gegeben – Sicherheit im nahenden Dunkel. Er erinnerte sich an den beeindruckenden Kommandanten der Unity, Nathan Beer, der ihn in seine eigene Kajüte hatte bringen lassen und der ihn besucht hatte, während der Chirurg ihn behandelte. Selbst durch die Schleier von Schmerz und Bewußtlosigkeit hatte er den großen Amerikaner neben sich gespürt. Beer hatte mit ihm wie ein Vater mit seinem Sohn gesprochen, von Kapitän zu Kapitän, nicht als Gegner.
Und nun war Beer tot. Adams Onkel, Sir Richard Bolitho, war auf die Amerikaner gestoßen und hatte sie in einen kurzen, blutigen Kampf verwickelt. Am Ende hatte Bolitho dem sterbenden Gegner beistehen müssen. Bolitho meinte, ihr Aufeinandertreffen sei eine Fügung des Schicksals gewesen. Keinen von beiden hatte die Auseinandersetzung oder ihre Härte überrascht.
Adam hatte wieder eine Fregatte erhalten, die Zest. Ihr Kommandant war im Kampf mit einem unbekannten Schiff gefallen. Er war der einzige Tote, so wie Adam der einzige Überlebende der Anemone war, einen zwölfjährigen Schiffsjungen ausgenommen. Alle anderen waren gefallen, ertrunken oder gefangengenommen worden.
Die einzige mündliche Zeugenaussage heute morgen war von ihm gekommen. Es gab nur noch eine einzige andere Informationsquelle. Nachdem die Unity erobert und nach Halifax gebracht worden war, hatte man das Logbuch gefunden, das Beer noch während des Angriffs der Anemone geführt hatte. Im Gerichtssaal herrschte Stille wie draußen im fallenden Schnee, als der älteste Gerichtsdiener Beers Aufzeichnungen laut vorlas. Sie betrafen den heftigen Angriff der Fregatte ebenso wie die Explosion an Bord der Anemone, die aller Hoffnung, sie als Prise zu nehmen, ein Ende gesetzt hatte. Beer hatte auch notiert, daß er wegen der eigenen erlittenen Schäden am Schiff die Verfolgung des Konvois abbrechen mußte. Am Ende des Berichts hatte er geschrieben: Wie der Vater, so der Sohn!
Ein paar Blicke wurden unter den Offizieren des Gerichts gewechselt, mehr nicht. Die meisten ahnten nicht, was Beer damit gemeint hatte. Andere wollten sich zu keinerlei Bemerkung hinreißen lassen, die das Urteil vorwegnehmen könnte.
Adam schien es, als habe er in der Stille des Raums die Stimme des großen Amerikaners gehört, so als stünde Beer selber dort, um Zeugnis abzulegen von dem Mut und der Ehre seines Gegners.
Bis auf Beers Logbuch gab es in der Tat wenig als Beweis dessen, was tatsächlich geschehen war. Und wenn ich immer noch Gefangener wäre? Wer würde mir helfen? Man würde sich an mich nur noch als an den Kapitän erinnern, der vor dem Feinde seine Fahne strich. Ob nun verwundet oder nicht, die Kriegsartikel ließen kaum Spielraum für Milde zu. Du bist so lange schuldig, bis zweifelsfrei das Gegenteil bewiesen ist.
Er preßte hinter dem Rücken die Finger zusammen, damit der Schmerz ihm half, Haltung zu bewahren. Ich habe die Fahne nicht gestrichen. Damals nicht, noch zu irgendeiner anderen Zeit.
Er hatte in Erfahrung gebracht, daß zwei Kommandanten, die da vor ihm zu Gericht saßen, einst auch vor einem Kriegsgericht angeklagt worden waren. Vielleicht erinnerten sie sich, zogen Vergleiche. Dachten vielleicht daran, was geschehen wäre, wenn die Spitze des Säbels auf sie gezeigt hätte …
Er trat vom Fenster zurück und stellte sich vor einen großen Spiegel. Wahrscheinlich prüften hier alle Offiziere den Sitz ihrer Uniform, um sicherzugehen, daß sie die Billigung des Admirals fand. Er starrte unbewegt auf sein Spiegelbild, drängte die Erinnerung zurück. Doch sie war immer da, unauslöschbar und beständig. Er sah seine glänzenden goldenen Schulterstücke. Kapitän mit vollem Rang. Wie stolz sein Onkel gewesen war. Wie alles andere, war auch seine Uniform neu. Alle seine sonstigen Besitztümer lagen in seiner Seekiste auf dem Grund des Meeres. Selbst der Säbel auf dem Tisch des Gerichts war nur geliehen. Er dachte an die wunderschöne Klinge zurück, die die Kaufmannschaft der Stadt London ihm verehrt hatte. Ihr gehörten die drei Schiffe, die er gerettet hatte. Die Ehrengabe war das Zeichen ihrer Dankbarkeit. Er schaute zur Seite, weg von seinem Spiegelbild, mit Ärger im Blick. Die Kaufleute konnten sich solche Dankbarkeit leisten. Zu viele von denen, die damals für sie gekämpft hatten, würden davon nie erfahren.
Leise antwortete er dem Leutnant: »Ihre Aufgabe ist bald beendet. Ich war kein guter Gesellschafter, fürchte ich.«
Der Leutnant schluckte schwer. »Ich bin stolz darauf, bei Ihnen gewesen zu sein, Sir. Mein Vater diente unter Ihrem Onkel, Sir Richard Bolitho. Weil er mir so viel berichtet hatte, bin ich in die Königliche Marine eingetreten.«
Trotz der Spannung dieses unwirklichen Augenblicks war Adam seltsam bewegt.
»Vergessen Sie das nie. Liebe, Loyalität – so etwas hat viele Namen. Es wird Sie immer halten.« Er zögerte. »Es muß Sie halten!«
Sie schauten sich beide um, als die Tür vorsichtig geöffnet wurde und der Hauptmann, der die Seesoldaten kommandierte, hereinblickte.
Er sagte nur: »Man erwartet Sie, Kapitän Bolitho!« Es schien, als wolle er noch etwas hinzufügen, vielleicht etwas Mutmachendes, Hoffnunggebendes. Aber der Augenblick verstrich. Er knallte zackig die Hacken zusammen und marschierte in den Korridor zurück. Der Leutnant starrte hinter ihm her, als ob er versuchte, sich diesen Augenblick genau einzuprägen, um vielleicht seinem Vater davon zu berichten.
Adam lächelte fast. Er hatte vergessen, ihn nach seinem Namen zu fragen.
Der große Raum war bis auf den letzten Platz besetzt.
Was wollten die wohl alle hier, und wer waren sie? Aber dann erinnerte er sich: Eine öffentliche Hinrichtung zog immer große Mengen Gaffer an.
Adam war sich der Entfernung sehr bewußt. Hinter ihm klickten die Schritte des Hauptmanns der Seesoldaten. Einmal rutschte er. Es lagen immer noch Reste von Puderkalk auf dem Boden als Erinnerung an den Weihnachtsball.
Als er an der letzten Reihe sitzender Zuschauer vorbeikam, um vor den Offizieren des Gerichts seinen Platz einzunehmen, sah er auf dem Tisch den geborgten Säbel. Der Griff zeigte auf ihn. Er war schockiert – nicht etwa, weil er wußte, daß das Urteil gerecht war, sondern weil er nichts fühlte. Absolut gar nichts. So als sei er, wie all die anderen, nur Zuschauer.
Der Vorsitzende, ein Konteradmiral, sah ihn ernst an.
»Kapitän Bolitho, der Spruch dieses Gerichts lautet: Sie sind in allen Ehren freigesprochen!« Er lächelte kurz. »Bitte, nehmen Sie Platz!«
Adam schüttelte den Kopf. »Nein, Sir. Ich stehe lieber.«
»Nun denn.« Der Admiral öffnete seine Papiere. »Dieses Gericht ist überzeugt, daß Kapitän Adam Bolitho nicht nur seine Pflicht nach bester Tradition der Königlichen Marine erfüllt hat, sondern sich in Erfüllung dieser Pflicht auch unendlichen Ruhm erworben hat, weil er sich hartnäckig gegen einen weit überlegenen Gegner verteidigte. Als er sein Schiff zwischen den Gegner und die Handelsschiffe, die er zu beschützen hatte, manövrierte, bewies er sowohl Mut als auch ungewöhnliche Initiative.« Er hob seine Augenbrauen. »Ohne diese Charaktereigenschaften hätten Sie höchstwahrscheinlich keinen Erfolg gehabt, vor allem angesichts der Tatsache, daß Sie von einer Kriegserklärung nichts wußten. Andernfalls …« Das Wort blieb in der Luft hängen. Er brauchte nicht weiter zu erklären, wie dann der Spruch des Kriegsgerichts gelautet hätte.
Alle Offiziere des Gerichts erhoben sich. Einige lächelten breit, offensichtlich sehr erleichtert, daß das alles nun vorbei war.
»Nehmen Sie Ihren Säbel wieder an sich, Kapitän Bolitho«, sagte der Admiral und reichte ihm den Säbel. »Ich hatte angenommen, Sie würden den Ehrensäbel tragen, von dem ich hörte – oder?«
Adam ließ den geborgten Säbel in die Scheide gleiten. Geh am besten. Red nicht. Aber er sah den Admiral und die acht Kapitäne des Gerichts an und sagte: »George Starr war mein Bootsführer, Sir. Mit eigenen Händen hat er die Ladung gezündet, die das schnelle Ende meines Schiffes bedeutete. Ohne ihn würde die Anemone heute unter der Flagge der Vereinigten Staaten kämpfen.«
Der Admiral nickte, sein Lächeln verblaßte. »Ich weiß das. Das habe ich schon in Ihrem Bericht gelesen.«
»Er war ein aufrechter und ehrlicher Mann, der mir und seinem Land gut gedient hat.« Ihm fiel plötzlich die Stille auf, in der nur das Knarren von Stühlen zu hören war. Die hinten Sitzenden lehnten sich vor, um die leise, unbewegte Stimme zu hören. »Aber dann hängte man ihn seiner Treue wegen wie einen gemeinen Dieb!«
Er starrte in die Gesichter auf der anderen Seite des Tisches, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Seine Haltung täuschte jeden. Er wußte, er würde zusammenbrechen, wenn er jetzt fortfuhr. »Ich habe den Ehrensäbel einem Sammler verkauft, der solche Dinge schätzt.« Hinter ihm hörte er überraschte Stimmen. »Was das Geld angeht, das habe ich George Starrs Witwe gegeben. Es ist sicher alles, was sie je empfangen wird, denke ich.«
Er verbeugte sich steif, drehte sich um und ging durch die Stuhlreihen mit der Hand an der Seite, als würde er den alten Schmerz gleich wieder fühlen. Er achtete nicht auf die Gesichter, die Mitgefühl, Verständnis, ja sogar Scham zeigten. Er sah nur auf die Tür, die ein Seesoldat mit weißen Handschuhen bereits für ihn öffnete. Seine eigenen Seesoldaten und Seeleute waren an jenem Tag gefallen, und kein Ehrensäbel konnte sie je wieder zum Leben erwecken.
Im Vorraum warteten schon ein paar Leute. Hinter ihnen sah er es schneien. Alles so sauber nach dem Vorgefallenen.
Ein Mann in Zivil trat vor und streckte ihm die Hand entgegen. Irgendwie schien Adam sein Gesicht vertraut, doch er wußte, er war ihm noch nie vorher begegnet.
Der Mann zögerte. »Entschuldigen Sie, Kapitän Bolitho! Ich sollte Sie nicht länger aufhalten nach all dem, was Sie eben durchgemacht haben.« Er suchte mit dem Blick nach einer Frau, die weiter hinten saß und sie genau beobachtete: »Meine Frau, Sir!«
Adam wollte am liebsten gehen. Bald würden ihn alle umringen, ihm gratulieren, ihn für seine Tat loben. Hätte die Säbelspitze auf ihn gedeutet, hätten sie ihn mit demselben Interesse beobachtet. Doch irgend etwas hielt ihn zurück, als habe jemand laut gesprochen.
»Was kann ich für Sie tun, Sir?«
Der Mann war sicher weit über sechzig Jahre alt. Als er sprach, spürte man seine Haltung und seinen Stolz. »Ich heiße Hudson, Charles Hudson, verstehen Sie …« Er schwieg sofort, als Adam ihn fassungslos anstarrte.
»Richard Hudson war mein Erster Offizier auf der Anemone«, sagte er. Er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Hudson hatte die Flaggleine mit seinem Entermesser gekappt, als Adam verwundet auf dem Deck lag und sich nicht bewegen konnte. Wieder schien ihm, als sei er nur Zuschauer, als höre er andere sprechen. Ich habe Ihnen befohlen, mit dem Schiff zu kämpfen!
Jeder Atemzug wühlte in seiner Wunde wie glühendes Eisen. Während Anemone unter ihnen starb, als der Feind längsseits ging. Und dann Hudsons letzte Worte, ehe Adam in das Boot hinabgehievt wurde. Wenn wir uns je Wiedersehen …
Adam erinnerte sich genau an seine Antwort. Ich werde Sie töten, verdammt noch mal. Und Gott ist mein Zeuge.
»Wir haben nur einen einzigen Brief von ihm bekommen.« Wieder blickte Hudson zu seiner Frau hinüber, die ihm zunickte, als wolle sie ihm helfen. Sie sah zerbrechlich aus und unwohl. Die Reise hierher hatte sie Kraft und Überwindung gekostet.
»Wie geht es ihm?« fragte er.
Charles Hudson schien nicht zuzuhören. »Mein Bruder war Vizeadmiral. Er machte seinen Einfluß geltend, damit Richard auf Ihr Schiff kommandiert wurde. Er sprach immer sehr warm von Ihnen, wenn er an uns schrieb … war stolz, unter Ihnen zu dienen. Als ich von dem Kriegsgericht hörte – so wagen sie es ja wohl zu nennen –, mußten wir natürlich kommen. Wir wollten Sie sehen und Ihnen für alles danken, was Sie für Richard getan haben. Er war unser einziger Sohn.«
Adam riß sich zusammen. »Was ist passiert?«
»Er schrieb in seinem Brief, er wolle Sie finden, um etwas … um etwas klarzustellen.« Er ließ seinen Kopf hängen. »Man schoß auf ihn, als er zu fliehen versuchte, und tötete ihn.«
Adam fühlte den Raum schwanken wie das Deck eines Schiffes. Die vergangenen Monate, der Schmerz, die Verzweiflung, die Wut auf das Geschehene: Immer nur hatte er an sich selbst gedacht.
»Ich werde das meinem Onkel berichten, wenn ich ihn treffe. Ihr Sohn kannte ihn«, sagte er. Dann ergriff er den Arm des Mannes und geleitete ihn zu seiner Frau. »Richard hatte mir nichts zu erklären. Jetzt, da er seinen Frieden hat, wird er das wissen.«
Hudsons Mutter erhob sich, hielt ihm ihre Hand entgegen. Adam beugte sich vor und küßte ihre Wange. Sie fühlte sich wie Eis an.
»Danke.« Er sah sie beide an. »Ihr Verlust ist auch meiner.«
Er blickte sich um, als hinter ihm ein Leutnant leise hüstelte und murmelte: »Der Hafenadmiral möchte Sie gerne sprechen, Sir!«
»Hat das nicht Zeit?«
Der Leutnant fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Man sagte mir, es sei wichtig, Sir. Wichtig für Sie!«
Adam drehte sich um, um sich zu verabschieden. Aber beide waren schon gegangen, so leise und unauffällig, wie sie gewartet hatten.
Er fuhr sich über die Wange. Ihre Tränen oder seine?
Dann folgte er dem Leutnant durch all die Menschen hindurch, die ihm zulächelten oder ihn beim Vorbeigehen am Arm berührten. Er nahm keinen wahr.
Er hörte nichts als seine eigene Wut. Ich habe Ihnen befohlen, mit dem Schiff zu kämpfen. Das war ein Satz, den er nie wieder vergessen würde.
Lady Catherine Somervell trat leise ans Fenster und sah zurück auf das Bett. Sie lauschte seinem Atem. Stille. Er schlief jetzt nach all der Ruhelosigkeit, die er vor ihr zu verbergen gesucht hatte.
Ihr fiel auf, daß die Nacht sehr ruhig war und jetzt erst der Mond durchkam. Sie griff nach einem schweren Seidenschal, hielt aber inne, als Richard sich auf dem Bett bewegte.
Sie sah die gezackten Wolken langsamer ziehen. Mondlicht fiel auf die Straße, die von den Schauern der Nacht immer noch regennaß glänzte. Jenseits der Straße, die die Häuserreihe von der Themse trennte, konnte sie das strömende Wasser des Flusses gerade eben erkennen. Es sah im Mondlicht aus wie schwarzes Glas. Auch der Fluß schien voller Stille, doch so war London: In wenigen Stunden würden auf dieser Straße Händler zum Markt eilen und Leute ihre Verkaufsstände errichten – Regen hin, Regen her.
Sie spürte die Kühle trotz des warmen Schals und fragte sich, was der Tag wohl bringen würde.
Vor gut einem Monat erst war Richard Bolitho nach Hause zurückgekehrt. Die Batterien von St. Mawes hatten Falmouths berühmtesten Sohn mit Salut begrüßt. Ein Admiral Englands, ein Held, der alle begeisterte, die seiner Flügge folgten.
Doch diesmal fand er keine Ruhe. Sein Neffe war vor ein Kriegsgericht gestellt worden, unmittelbare Folge der Tatsache, daß er die Anemone an den Gegner verloren hatte. Richard hatte sie beruhigt. Das Urteil würde Adam freisprechen. Doch sie kannte ihn gut genug. Seine Sorgen und seine Zweifel konnte er vor ihr nicht verbergen. Weil er in der Admiralität zu tun hatte, konnte er nicht nach Portsmouth reisen, wo die Verhandlung stattfand. Sie wußte auch, worauf Adam bestanden hatte: dem Gericht allein gegenüberzutreten, ohne jede Hilfe. Adam wußte genau, wie sehr Bolitho Vetternwirtschaft haßte und Manipulationen, Einflüsse von außen. Sie lächelte traurig. Sie waren sich so ähnlich, fast wie Brüder.
Vizeadmiral Graham Bethune hatte Richard versichert, ihn sofort zu informieren, sobald er etwas hören würde. Der schnelle Telegraph zwischen Portsmouth und London würde eine Nachricht in weniger als einer halben Stunde in die Admiralität befördern. Das Gericht war gestern morgen zusammengetreten, doch noch immer gab es keine Nachricht, nur Schweigen.
In Falmouth hätte sie ihn ablenken können, hätte ihn mit den Angelegenheiten seines Besitzes beschäftigt, die sie sich während seiner langen Abwesenheit auf See ganz zu eigen gemacht hatte. Aber man brauchte ihn in London. Der Krieg mit den Vereinigten Staaten, der im letzten Jahr ausgebrochen war, schien an einem Wendepunkt angekommen. Bolitho war in die Admiralität beordert worden, um Zweifel zu vertreiben oder Zuversicht zu verbreiten. Sie fühlte wieder Bitterkeit. Gab es außer ihm niemanden, den man schicken konnte? Ihr Mann hatte genug geleistet und oft genug dafür bezahlt.
Ihr war klar: Sie würden sich wieder trennen müssen. Wenn sie wenigstens nach Cornwall zurückkehren könnten … Bei den heutigen Straßenverhältnissen würde das fast eine Woche dauern. Sie dachte an ihr Zimmer in dem grauen Gutshaus unterhalb von Pendennis Castle, an die Fenster zur See hinaus. Die Ausritte und die Spaziergänge, die ihnen so viel Freude machten. Sie zitterte wieder, aber nicht vor Kälte. Welche Geister würden auf sie warten, wenn sie wieder den Weg entlanggingen, von dem aus sich eine verzweifelte Zenoria in den Tod gestürzt hatte?
So viele Erinnerungen! Die andere Seite der Medaille zeigte Neid und Gerede, ja sogar Haß, der sich auf mancherlei Weise enthüllte, Skandale, die sie beide erlebt und überlebt hatten. Sie schaute auf sein dunkles Haar auf dem Kissen. Kein Wunder, daß dich alle verehren, mein liebster Mann.
Sie hörte Eisenräder rollen, erste Lebenszeichen auf der Straße. Da fuhr jemand ganz bestimmt, um Fisch vom Markt zu holen. Fisch gab es immer pünktlich, im Frieden genauso wie im Krieg.
Er hatte ihr Leben verändert wie sie seins. Ein Leben, das weit über die Forderungen von Pflicht und Gefahren hinausging, etwas, das nur sie beide teilten, das Leute veranlaßte, sich umzudrehen und sie beide anzustarren. So viele ungestellte Fragen, etwas das andere nie verstehen würden.
Sie berührte ihn. Wird er mich immer noch schön finden, wenn er von neuem Kampf aus fernen Ländern zurückkehrt? Ich würde für ihn sterben.
Sie griff nach den Vorhängen, um sie zu schließen, und stand dann still, als halte sie jemand fest. Sie schüttelte den Kopf, ärgerlich über sich selber. Es war nichts. Sie wischte mit dem Schal über die Fensterbank und starrte nach unten auf die Straße, den Walk, wie sie hier hieß. Mondlicht fiel auf schwarze, blattlose Baumskelette. Dann hörte sie es: Räder ratterten über Kopfsteine, die Hufe eines Pferdes klapperten. Es bewegte sich langsam, als schien es sich seines Weges nicht sicher. Ein höherer Offizier kehrte gerade zu seinem Quartier in der Kaserne zurück, nach einer Nacht am Kartentisch oder – viel wahrscheinlicher – in den Armen seiner Geliebten.
Sie sah genauer hin. Schließlich rollte ein kleines Gefährt durch einen Streifen Mondlicht. In seinem kalten Glanz sah sogar das Pferd silbrig aus. Zwei Kutschlampen brannten wie helle, kleine Augen auf der Suche nach dem Weg.
Sie seufzte. Da hatte sicher jemand zuviel getrunken. Der Kutscher würde ihm für diese Heimfahrt viel Geld abnehmen. Doch das Wägelchen drehte auf der Straße und kam genau auf ihr Haus zu.
Sie starrte nach unten, konnte kaum atmen. Die Kutschentür öffnete sich, ein weißes Hosenbein erschien und blieb unschlüssig auf dem Tritt stehen. Der Kutscher gestikulierte mit seiner Peitsche wie in einer Pantomime. Dann stieg der Gast aus der Kutsche auf das Pflaster. Die Goldknöpfe seiner Jacke glänzten wie Silbermünzen.
Plötzlich stand Richard neben ihr, legte den Arm um ihre Hüfte, und sie war sich nicht sicher, ob sie ihn gerufen hatte.
Auch er sah auf die Straße. Der Marineoffizier musterte das Haus, während die Kutsche wartete.
»Von der Admiralität?« Sie wandte sich ihm zu.
»Nicht zu dieser Stunde, Kate.« Er schien eine Entscheidung zu treffen. »Ich gehe nach unten. Es wird ein Irrtum sein.«
Catherine sah wieder auf die Straße, doch die Gestalt vor der Kutsche war verschwunden. Das Knallen der vorderen Haustür zerriß die Nacht wie ein Pistolenschuß. Ihr war das egal. Sie mußte bei ihm sein, gerade jetzt.
Sie wartete oben auf der Treppe. Die Kälte kroch ihre Beine empor, als Bolitho die Tür öffnete, die vertraute Uniform und das Gesicht erkannte.
»Catherine«, rief er, »es ist George Avery!«
Jetzt war auch die Haushälterin da, murmelte vor sich hin und holte neue Kerzen. Ganz offensichtlich mißbilligte sie solch nächtliche Besuche.
»Bringen Sie irgend etwas Warmes, Mrs. Tate«, sagte Catherine, »und auch etwas Cognac.«
George Avery, Bolithos Flaggleutnant, setzte sich, als ob er sich erst sammeln müßte. Dann sagte er: »In Ehren freigesprochen, Sir Richard!« Da entdeckte er Catherine und erhob sich. »Mylady!«
Sie kam nach unten und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Berichten Sie. Ich kann das alles noch gar nicht glauben.«
Avery sah auf seine schmutzigen Stiefel. »Ich war dabei, Sir Richard. Ich hielt es nur für richtig. Ich weiß, was es heißt, vor einem Kriegsgericht zu stehen – vor der Möglichkeit, in Ungnade zu fallen oder das eigene Ende zu erfahren.« Er wiederholte sich. »Ich hielt es nur für richtig. An der Südküste liegt sehr viel Schnee. Die Telegraphentürme waren vom einen zum anderen nicht mehr zu erkennen. Es hätte noch einen ganzen Tag dauern können, bis Sie die Nachricht bekommen hätten.«
»Aber Sie sind gekommen?« Catherine sah, wie Bolitho nach seinem Arm griff.
Überraschenderweise grinste Avery. »Die längste Strecke bin ich geritten. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich die Pferde gewechselt habe. Schließlich hab ich mich dem Kerl da draußen überlassen, weil ich sonst Ihr Haus sicher nicht gefunden hätte.« Er griff nach dem Glas Cognac. Seine Hand zitterte unkontrolliert. »Das kostet mich wahrscheinlich einen Jahressold. Und ich fürchte, die nächsten vier Wochen werde ich nicht bequem sitzen können.«
Bolitho trat ans Fenster. In Ehren freigesprochen. So gehörte sich das. Aber die Dinge liefen nicht immer so, wie es sich gehörte.
Avery leerte das Glas und hatte nichts dagegen, als Catherine es wieder füllte. »Ein paar Kutschen und Wägelchen habe ich von der Straße getrieben.« Er bemerkte Bolithos Gesichtsausdruck und fügte sanfter hinzu: »Ich war nicht im Gerichtssaal, Sir Richard, aber er wußte, daß ich da war. Ihr Neffe ging dann zum Hafenadmiral. Es hieß, er habe einen ausgedehnten Urlaub bewilligt bekommen. Das ist alles, was ich an Information habe.«
Bolitho sah Catherine an und lächelte. »Siebzig Meilen auf dunklen, gefährlichen Straßen. Wer würde das sonst noch tun?«
Sie nahm Avery das Glas aus der gefühllosen Hand, als er gegen das Kissen gesunken und eingeschlafen war.
Leise antwortete sie: »Deine Männer, Richard … Hast du jetzt Ruhe?«
Als sie wieder im Schlafzimmer standen, konnten sie den Fluß sehr deutlich erkennen und auch Menschen, die schon unten auf der Straße liefen. Es war unwahrscheinlich, daß jemand die plötzliche Ankunft der Kutsche oder den großen Marineoffizier bemerkt hatte, der an die Tür klopfte. Und wenn, würden sie nichts damit anfangen können. Hier in Chelsea kümmerte man sich vor allem um seine eigenen Angelegenheiten und sonst um wenig mehr.
Zusammen sahen sie zum Himmel auf. Bald würde es Tag sein, wieder ein grauer Januarmorgen. Doch dieser Tag wäre ganz anders.
Sie hielt seinen Arm an ihrer Hüfte fest und sagte: »Vielleicht ist dein nächster Besuch in der Admiralität für eine Weile dein letzter!«
Er spürte ihr Haar an seinem Gesicht, ihre Wärme. Sie gehörten einander.
»Und dann, Kate?«
»Bring mich nach Hause, Richard, egal wie lang die Reise dauert.«
Er führte sie zum Bett zurück, und sie lachte, als sie draußen die ersten Hunde bellen hörte.
»Dann kannst du mich lieben. Bei uns zu Hause.«
Vizeadmiral Graham Bethune stand schon, als Bolitho in sein großes Zimmer in der Admiralität begleitet wurde. Sein Lächeln war warm und ehrlich.
»Wir sind heute beide früh auf den Beinen, Sir Richard!« Sein Gesicht wurde eine Spur ernster. »Doch leider habe ich noch keine Nachricht über Ihren Neffen, Kapitän Bolitho. Zwar haben die Telegraphen viele unschätzbare Vorteile, aber gegen unser englisches Wetter kommen sie meistens nicht an.«
Bolitho nahm Platz, nachdem ein Diener ihm Hut und Mantel abgenommen hatte. Er war nur ein paar Schritte von der Kutsche in die Admiralität gegangen, doch der Mantel war schwer vor Nässe.
Er lächelte. »Adam ist in Ehren freigesprochen worden.« Es bereitete ihm Vergnügen, Bethunes Überraschung zu sehen.
Seit Bolithos Ankunft in London hatten sie sich einige Male getroffen, doch er war immer noch überrascht, daß Bethunes neues wichtiges Amt ihn so gar nicht verändert hatte. Äußerlich war er natürlich sehr gereift seit seinen Tagen als Midshipman auf Bolithos erstem eigenen Schiff, der kleinen Kriegsslup Sparrow. Der rundgesichtige Junge war verschwunden – ebenso wie seine dunklen Sommersprossen. Er hatte sich in einen scharfsichtigen, verläßlichen Flaggoffizier verwandelt, nach dem sich viele Frauen bei Hofe umdrehten und auch bei vielen anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die er pflichtgemäß zu besuchen hatte. Bolitho erinnerte sich an Catherines anfängliche Ablehnung, als er berichtete, Bethune sei nicht nur jünger, sondern habe auch einen niedrigeren Rang. Sie war nicht die einzige, die über Entscheidungen der Admiralität verblüfft war.
Er sagte: »Mein Flaggleutnant Avery ritt von Portsmouth her die ganze Nacht, um mir die Nachricht zu bringen.«
Bethune nickte, war mit seinen Gedanken aber schon ganz woanders. »George Avery, o ja. Sir Paul Sillitoes Neffe.« Wieder dieses jungenhafte Lächeln. »Tut mir leid, Baron Sillitoe of Chiswick heißt er ja jetzt. Aber schön, das zu hören. Es war sicher schlimm für Ihren Neffen, Schiff und Freiheit gleichzeitig auf einen Schlag zu verlieren. Und dennoch haben Sie ihn zum Kommandanten der Zest gemacht beim letzten Treffen mit den Schiffen von Commodore Beer! Erstaunlich.« Er ging zu einem Tisch hinüber. »Ich habe meinen eigenen Bericht eingereicht, das war ja wohl klar. Auf Kriegsgerichte kann man sich kaum verlassen, wie wir ja selber immer wieder erfahren haben.«
Bolitho entspannte sich etwas. Also hatte Bethune Zeit gefunden, Adams wegen zur Feder zu greifen. Er konnte sich nicht vorstellen, daß einer seiner Vorgänger, Godschale oder vor allem Hamett-Parker, für ihn auch nur einen Finger krumm gemacht hätte.
Bethune sah auf die Schmuckuhr neben dem Gemälde, das eine kämpfende Fregatte zeigte. Bolitho wußte, daß es Bethunes eigenes Kommando darstellte. Er hatte gegen zwei große spanische Fregatten gekämpft, hatte – geradezu unwahrscheinlich – eine auf Grund laufen lassen und die andere erobert. Das war ein guter Anfang, der seiner Karriere gewiß nicht geschadet hatte.
»Wir nehmen gleich eine Erfrischung.« Er hüstelte. »Lord Sillitoe kommt heute, und ich hoffe, wir erfahren etwas mehr von den Ansichten des Prinzregenten über den amerikanischen Konflikt.« Er zögerte, als sei er sich einen Augenblick lang nicht ganz sicher. »Eines ist so gut wie beschlossen. Man erwartet, daß Sie dorthin zurückkehren. Wie lange ist es her? Doch erst knapp vier Monate, daß Sie Beers Schiffe angegriffen und besiegt haben! Aber Ihre Meinung und Ihre Erfahrung sind unschätzbar. Ich weiß, es ist zuviel verlangt von Ihnen.«
Bolitho merkte, daß er sein rechtes Auge berührte. Vielleicht war das auch Bethune aufgefallen, oder aber die Nachricht über seine Verletzung und daß sie niemals ausheilen würde, hatte endlich auch dieses berühmte Haus erreicht.
Er antwortete: »Ich hatte es erwartet.«
Bethune sah ihn nachdenklich an. »Ich hatte das große Vergnügen, Lady Catherine Somervell zu treffen, Sir Richard. Ich weiß, was die Trennung für Sie bedeutet.«
»Ich weiß, daß Sie sie trafen«, antwortete Bolitho. »Sie erzählte es mir. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse, und es wird nie welche geben.« Catherine hatte Bethunes Frau auf einem Empfang in Sillitoes Residenz am Fluß getroffen. Über sie hatte sie nicht gesprochen, aber sie würde es tun, wenn der Augenblick kam. Hatte Bethune einen Blick für Damen? Hatte er vielleicht sogar eine Geliebte?
Bolitho sagte: »Sie und ich sind Freunde, das stimmt doch?«
Bethune nickte, obwohl er das Gemeinte nicht einordnen konnte. »Ein kleines Wort für so viel Bedeutung!«
»Stimmt.« Er lächelte. »Nennen Sie mich Richard. Ich glaube, daß unser Rang und die Vergangenheit uns nicht im Wege stehen sollten.«
Bethune trat an seinen Stuhl, und sie schüttelten sich die Hand. »Was für ein Tag! Viel besser als ich gehofft hatte.« Er grinste und sah dabei sehr jung aus. »Richard.« Wieder sah er zur Uhr. »Ich würde mit Ihnen noch gern etwas besprechen, ehe Lord Sillitoe eintrifft.« Er sah ihn einige Augenblicke an. »Sie werden es bald erfahren. Konteradmiral Valentine Keen wird ein neues Kommando übernehmen. Seine Basis ist Halifax in Neuschottland.«
»Ich habe so etwas schon gehört.« So schließt sich der Kreis, dachte er. Halifax – dort hatte er nach dem Befehl, nach London zurückzukehren, sein Flaggschiff, die Indomitable, zurückgelassen. War das wirklich erst vor so kurzer Zeit geschehen? Bei ihr lagen die beiden mächtigen Prisen, Beers U.S.S. Unity und die Baltimore. Gemeinsam hatten sie soviel Feuerkraft wie ein Linienschiff. Der Zufall hatte sie zu ihrem letzten Treffen zusammengeführt. Verbissenheit und ein verdammter Siegeswille hatten das Ende entschieden. Nach all den Jahren auf See gab es immer noch Bilder, die klar und deutlich in seiner Erinnerung waren.
Alldays Schmerz, als er einsam zwischen den keuchenden Überlebenden seinen toten Sohn an die Reling getragen hatte, um ihn der See zu übergeben. Und der sterbende Beer, ihr beachtlicher Gegner, der Bolithos Hand hielt. Beiden war klar, daß dieses Treffen und sein Ausgang unvermeidlich gewesen waren. Beer mit der amerikanischen Flagge bedeckt. Bolitho hatte der Witwe den Säbel nach Newburyport schicken lassen. Den Hafen kannte jedes Kriegsschiff und jeder Kaperer. Dort hatte einst sein eigener Bruder Hugh Zuflucht gefunden, vielleicht sogar Frieden.
Bethune sagte: »Konteradmiral Keen wird seine Flagge auf der Fregatte Valkyrie setzen. Ihr Kommandant, Peter Dawes, der Ihr zweiter Mann war, wird befördert und wartet schon auf ein neues Kommando.« Er machte eine diskrete Pause. »Sein Vater, der Admiral, meint, daß der Zeitpunkt richtig sei.«
Keen kehrte also in den Krieg zurück – immer noch in Trauer um Zenoria. Das also brauchte er, oder glaubte es zu brauchen. Bolitho kannte selbst den Tatendrang, während er trauerte – bis er Catherine wiedergetroffen hatte.
»Also ein neuer Flaggoffizier?« Als er die Frage stellte, kannte er schon die Antwort. »Adam?«
Bethune antwortete nicht direkt. »Sie haben ihm die Zest aus Not gegeben.«
»Er war der beste Kommandant einer Fregatte, den ich hatte.«
Bethune fuhr fort: »Als die Zest in Portsmouth einlief, mußte sie dringend gründlich ausgebessert werden. Mehr als vier Jahre im Einsatz, zwei Kapitäne, drei mit Ihrem Neffen, einige Seegefechte – das hat ihr schwere und dauernde Schäden zugefügt. Ohne eine richtige Ausbesserungswerft … der letzte Kampf mit der Unity gab den Ausschlag. Der Hafenadmiral erhielt den Befehl, all das Ihrem Neffen zu erläutern – nachdem der Spruch des Kriegsgerichts gefällt war. Es wird Monate dauern, bis die Zest wieder einsatzbereit ist. Und selbst dann …«
Nachdem der Spruch des Kriegsgerichts gefällt war. Bolitho fragte sich, ob Bethune wirklich wußte, was er da sagte. Hätte die Säbelspitze auf Adam gezeigt, hätte er von Glück reden können, in der Königlichen Marine zu bleiben, selbst mit einem Schiff, das so müde und schwach geworden war wie die Zest.
Bethune ahnte das zumindest. »Der Krieg könnte dann längst zu Ende sein. Und Ihren Neffen würde man, wie so viele andere auch, von der einzigen Aufgabe abhalten, die er liebt.« Er rollte eine Karte auf.
»Konteradmiral Keen und Kapitän Bolitho sind immer gut miteinander ausgekommen – unter Ihrem Kommando und auch anderswo. Es scheint mir eine befriedigende Lösung zu sein.«
Bolitho versuchte, Adams Gesicht zu verdrängen, das er an jenem Tag auf der Indomitable gesehen hatte, als er ihm Zenorias Tod mitteilen mußte. Sein Herz schien in Stücke zu brechen. Wie konnte Adam das neue Kommando annehmen? In dem Bewußtsein, jeden Tag auf den Menschen zu treffen und seine Befehle auszuführen, der Zenorias Mann gewesen war. Das Mädchen mit den Mondscheinaugen! Sie hatte Keen aus Dankbarkeit geheiratet. Adam hatte sie geliebt, liebte sie immer noch. Aber vielleicht war Adam für den Ausweg, den Keen ihm bot, dankbar? Ein Schiff auf See, keine Hulk im Hafen mit wenig Männern und all den Widrigkeiten einer Werft. Wie würde das gehen? Wie würde es ausgehen?
Er liebte Adam wie einen Sohn, hatte ihn seit jenem Tag geliebt, als der Junge den langen Weg von Penzance nach Falmouth gekommen war, um sich ihm nach dem Tod seiner Mutter vorzustellen. Adam hatte ihm seine Liebe zu Zenoria eingestanden, weil er meinte, Bolitho müsse es wissen. Catherine hatte sie schon längst in Adams Gesicht entdeckt und zwar an dem Tag, als Zenoria Keen in ihrer Heimatkirche in Zennor heiratete.
Wahnsinn, daran zu denken. Keen übernahm sein erstes wirklich verantwortliches Kommando als Flaggoffizier. Daran durfte nichts aus der Vergangenheit rütteln.
Er fragte: »Glauben Sie wirklich, daß der Krieg bald vorbei ist?«
Bethune war nicht überrascht über diese Wendung in ihrem Gespräch. »Napoleons Armeen ziehen sich an allen Fronten zurück. Das wissen die Amerikaner. Ohne ein alliiertes Frankreich werden sie ihre letzte Chance verspielen, ganz Nordamerika zu beherrschen. Wir werden immer mehr Schiffe freisetzen können, die ihren Geleitzügen auflauern und große Truppenbewegungen über See verhindern. Im September letzten Jahres haben Sie bewiesen, falls es denn überhaupt eines Beweises bedurft hätte, daß geschickt eingesetzte mächtige Fregatten nützlicher sind als sechzig Linienschiffe.« Er lächelte. »Ich erinnere mich noch an die Gesichter da drüben in dem Saal, als Sie Ihren Lordschaften sagten, daß der Kampf in Kiellinie vorbei wäre. Das hielten einige für Gotteslästerung. Unglücklicherweise gibt es aber noch viele, die Sie davon erst überzeugen müssen.«
Bolitho sah ihn wieder zur Uhr blicken. Sillitoe hatte sich verspätet. Er wußte genau, welchen Einfluß er hatte, lebte damit und wußte auch, daß Menschen ihn fürchteten. Bolitho hegte den Verdacht, daß Sillitoe daran sogar seine Freude hatte.
»All diese Jahre, Richard, bedeuten für manche ein ganzes Leben«, bemerkte Bethune. »Zwanzig Jahre fast ununterbrochen Krieg mit Frankreich. Und davor haben wir auf der Sparrow auch schon gegen Frankreich gekämpft. Während der amerikanischen Rebellion.«
»Wir waren damals sehr jung, Graham. Aber ich kann schon verstehen, daß der Mann auf der Straße nicht mehr an unseren Sieg glaubt, auch wenn er jetzt greifbar nahe ist.«
»Aber Sie haben nie daran gezweifelt?«
Bolitho hörte Stimmen auf dem Flur. »Ich habe nie daran gezweifelt, daß wir gewinnen würden, letzten Endes jedenfalls. Aber siegen? Ein Sieg ist etwas ganz anderes.«
Ein Diener öffnete die vornehmen Doppeltüren, und Sillitoe trat ein.
Catherine hatte ihm das Porträt von Sillitoes Vater beschrieben, das sie beim Empfang in seinem Haus gesehen hatte. Valentine Keen hatte sie damals begleitet. Als Sillitoe jetzt in schiefergrauem feinen Tuch und glänzenden weißen Kniestrümpfen vor ihnen stand, verglich Bolitho die Gesichter, als habe er das Porträt selber gesehen. Sillitoes Vater war Sklavenhändler gewesen, »ein Kapitän, der mit schwarzem Elfenbein handelte«, wie der Sohn meinte. Baron Sillitoe of Chiswick hatte es weit gebracht, denn als man den König für geisteskrank erklärt hatte, war Sillitoes Stellung als persönlicher Berater des Prinzregenten so mächtig geworden, daß es kaum etwas in der nationalen Politik gab, das er nicht beeinflussen oder gar lenken konnte.
Er verbeugte sich knapp. »Sie sehen sehr gut und sehr erholt aus, Sir Richard. Ich bin froh über die Entlastung Ihres Neffen!«
Offenbar verbreiteten sich solche Nachrichten unter Sillitoes Spionen schneller als auf den Fluren der Admiralität.
Sillitoe lächelte. Seine tiefliegenden Augen verbargen wie immer seine wahren Gedanken.
»Er ist ein zu guter Kapitän, als daß man auf ihn verzichten könnte. Ich bin sicher, er wird Konteradmiral Keens Bitte annehmen. Ich denke, er sollte es. Ich glaube, er will es.«
Bethune klingelte nach einem Dienen »Bitte, bringen Sie uns etwas zur Erfrischung, Tolan.« Das gab ihm Zeit, sich von dem Schock zu erholen, daß Sillitoe schneller informiert war als er selber.
Sillitoe wandte sich Bolitho zu.
»Und wie geht es Lady Catherine? Gut, wie ich annehme. Sicher freut sie sich, wieder in London zu sein.«
Es machte wenig Sinn, ihm zu erklären, wie sehr sich Catherine nach Falmouth und dem ruhigen Leben dort zurücksehnte. Doch man war sich dieses Mannes nicht sicher. Er, der scheinbar alles wußte, hatte das vielleicht auch schon erfahren.
»Sie ist glücklich, Mylord.« Er dachte zurück an die frühe Morgenstunde, in der Avery angekommen war. Glücklich? Ja, doch gleichzeitig verbarg sie, wenn auch nicht immer erfolgreich, ihre tiefe Furcht vor der unvermeidlichen Trennung. In der Zeit vor Catherine war das Leben einfacher gewesen. Er hatte immer akzeptiert, daß seine Pflichten dort lagen, wohin seine Befehle ihn führten. So mußte es wohl auch in Zukunft sein. Doch seine Liebe würde er dort lassen, wo Catherine war.
Sillitoe lehnte sich über die Karte. »Kritische Zeiten, meine Herren. Sie werden nach Halifax zurückkehren müssen, Sir Richard – als einziger kennen Sie alle Stücke des Puzzles. Der Prinzregent war überaus beeindruckt von Ihrem Bericht und den Schiffen, die Sie verlangen.« Er lächelte trocken. »Selbst die Kosten schreckten ihn nicht ab. Jedenfalls nicht mehr als einen Augenblick lang.«
Bethune sagte: »Der Erste Lord ist einverstanden, daß die Befehle in dieser Woche ausgestellt werden.« Er sah Bolitho verständnisvoll an. »Dann kann Konteradmiral Keen mit der ersten Fregatte ankerauf gehen, unabhängig davon, wen er sich als Flaggkapitän aussucht.«
Sillitoe trat an ein Fenster. »Halifax. Ein trostloser Ort zu dieser Jahreszeit, hörte ich. Wir können dann dafür sorgen, daß Sie ihm folgen, Sir Richard. « Er drehte sich nicht um. »Ende nächsten Monats – würde Ihnen das passen?«
Bolitho wußte, daß Sillitoe keine unnötigen Bemerkungen machte. Dachte er endlich auch einmal an Catherine und wie sie die Dinge aufnehmen würde? Grausam, nicht gerecht, zuviel verlangt – er hörte fast ihre Worte. Trennung und Einsamkeit. Weniger als zwei Monate, denn man mußte die unbequeme Reise nach Cornwall abziehen. Sie durften keine Minute verlieren, keine Minute ihrer Zweisamkeit.
Er antwortete: »Sie werden mich bereit finden, Mylord.«
Sillitoe nahm dem Diener ein Glas ab. »Gut.« Seine tiefliegenden Augen verrieten nichts. »Ausgezeichnet.« Damit meinte er sicher nicht den Wein. »Mein Wohl auf Sir Richard! Auf Sie und den Kreis verschworener Brüder.« Auch davon hatte er also gehört.
Bolitho nahm das weitere kaum noch zur Kenntnis. Im Geiste sah er nur sie, ihren herausfordernden Blick, der doch so schützte.
Verlaß mich nicht.
II Um der Liebe willen
Bryan Ferguson, der einarmige Verwalter der Besitzungen Bolithos, öffnete den Tabaktopf und hielt inne, bevor er seine Pfeife füllte. Er hatte einst geglaubt, daß er niemals mehr selbständig die leichtesten Aufgaben würde lösen können: wie etwas zuzuknöpfen, sich zu rasieren, eine Mahlzeit einzunehmen, ganz zu schweigen vom Stopfen einer Pfeife.
Immer wenn er in Ruhe darüber nachdachte, wußte er, daß er zufrieden, ja dankbar war – trotz seiner Behinderung. Er war Sir Richard Bolithos Gutsverwalter und besaß ein eigenes Haus in der Nähe der Ställe. Ein kleiner Raum an der Rückseite war sein Kontor. Dort hatte er um diese Jahreszeit wenig zu tun. Der Regen hatte aufgehört und der Schnee, von dem einer der Postleute berichtet hatte, hatte sie verschont.
Er sah sich in der Küche um. Sie war das Herz der Welt, die er mit seiner Frau Grace teilte. Grace war Haushälterin bei den Bolithos. Überall sah man, wie tüchtig sie war. Marmeladen in Töpfen, sorgfältig beschriftet und mit Wachs versiegelt, getrocknete Früchte, und am anderen Ende der Küche hingen geräucherte Schinken. Ihr Geruch ließ ihm immer das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch besser nicht! Seine Gedanken wurden von diesen einfachen Freuden auf etwas anderes gelenkt. Er machte sich Sorgen um seinen ältesten und besten Freund John Allday.
Er sah nach dem kleinen Krug Rum, der vor ihm auf dem blankgescheuerten Tisch stand – unberührt.
Er sagte: »Los, John, trink endlich deinen Schluck. So was braucht man doch an einem kalten Januarmorgen!«
Doch Allday blieb am Fenster stehen. Seine unruhigen Gedanken lasteten auf seinen breiten Schultern wie ein Joch.
Endlich sagte er: »Ich hätte mit ihm nach London gehen sollen. Ich gehör dahin, klar?«
Das also war es. »Um Gottes willen, John. Du bist noch nicht mal eine Hundewache lang zu Hause gewesen und murrst schon rum, daß du Sir Richard nicht nach London begleitet hast. Du hast Unis, ein Baby und die gemütlichste kleine Kneipe auf dieser Seite vom Helford. Du solltest dich wirklich darüber freuen.«
Allday drehte sich zu ihm um. »Weiß ich doch, Bryan. Natürlich weiß ich das.«
Ferguson stopfte den Tabak fest. Er machte sich echte Sorgen. Diesmal war es noch schlimmer mit Allday als beim letzten Mal. Er sah zu seinem Freund hinüber, bemerkte wieder die tiefen Linien an seinen Mundwinkeln – Zeichen bleibender Schmerzen in seiner Brust, nachdem ein spanischer Säbel ihn niedergemacht hatte. Das dichte, feste Haar war schon grau durchsprenkelt. Doch sein Blick war klar wie immer.
Ferguson wartete, daß er sich setzte und seine großen Hände um diesen besonderen Steinkrug legte, den sie hier für ihn bereithielten. Wer Allday nicht kannte, mußte ihn für grob und ungeschickt halten. Doch Ferguson hatte ihn mit rasiermesserscharfen Klingen und Beiteln ein paar der feinsten Schiffsmodelle basteln sehen, die ihm je vor Augen gekommen waren. Dieselben großen Hände hatten sein Töchterchen Kate mit der Behutsamkeit einer Amme gehalten.
»Was meinst du, wann sind sie wieder da, Bryan?« wollte Allday wissen.
Ferguson gab ihm den brennenden Span und sah, wie er ihn an seine lange Tonpfeife hielt. Der Rauch zog in Richtung Kamin, vor dem eine schlafende Katze lag.
»Einer der Leute von Roxby war kürzlich hier und sagte, die Straßen sehen jetzt besser aus als letzte Woche. Immer noch schlimm für einen Vierspänner, von der Postkutsche ganz zu schweigen.« Doch das führte zu nichts. Also sagte er: »Ich denke immer mal wieder daran, John. Im April sind es einunddreißig Jahre her seit der Schlacht bei den Saintes. Das glaubt man kaum, oder?«
Allday hob seine Schultern. »Es überrascht mich, daß du überhaupt noch daran denkst.«
Ferguson sah auf seinen leeren Ärmel. »Das kann ich so leicht nicht vergessen.«
Allday legte ihm über den Tisch hinweg die Hand auf den Arm. »Tut mir leid, Bryan. Das wollte ich nicht.«
Ferguson lächelte, und Allday schlürfte einen Mundvoll Rum. »Das heißt, daß ich in diesem Jahr dreiundfünfzig werde.« Er merkte sofort, wie Allday sich bei den Worten gar nicht wohl fühlte. »Nun ja, ich hab ein Stück Papier, um es zu beweisen.« Dann fragte er leise: »Wie alt bist dann du? Gleich alt, meine ich, oder?« Er wußte, daß Allday älter war. Er war bereits zur See gefahren, als eine Preßgang in Pendower Beach sie beide mitgenommen hatte.
Allday sah ihn mißmutig an. »Ja, ja, ungefähr so.« Er starrte ins Feuer und schien noch bedrückter. »Ich bin sein Bootsführer. Ich muß einfach bei ihm sein.«
Ferguson nahm den Steinkrug und füllte ihn wieder mit Rum. »Ich weiß das, John. Und jeder andere auch.« Er dachte plötzlich an sein enges Kontor, das er vor einer Stunde verlassen hatte, als Allday mit einem kleinen Botenwägelchen unerwartet erschienen war. Trotz der muffigen Hauptbücher und der Feuchtigkeit des Winters schien es ihm, als sei sie kurz vor ihm eingetreten. Lady Catherine Somervell war das letzte Mal vor Weihnachten, bevor sie mit dem Admiral nach London aufgebrochen war, in seinem Kontor gewesen. Und doch war ihr Duft immer noch zu spüren, ein Duft nach Jasmin. Das alte Haus hatte viele Bolithos kommen und gehen sehen in all den Jahren. Und früher oder später kam der eine oder andere nicht mehr zurück. Das Haus nahm das alles an. Es wartete mit seinen dunklen Porträts der Bolithos. Wartete … Doch wenn Lady Catherine weg war, war alles anders – ein verlassenes Haus.
»Lady Catherine wahrscheinlich mehr als jeder andere!« antwortete er.
Etwas in seiner Stimme ließ Allday sich umdrehen.
»Du also auch, Bryan?«
»So eine Frau habe ich noch nie gesehen!« sagte Ferguson. »Ich war bei ihr, als wir die tote Frau fanden.« Er starrte auf seine Pfeife. »Sie war ganz und gar zerschmettert, aber Mylady hielt sie wie ein Kind. Ich werd das nie vergessen … Ich weiß, du hast Angst davor, daß du zu alt wirst, John, für die Härten eines Seemannslebens mit all seinen Kämpfen. Ich nehme an, Sir Richard fürchtet das auch. Aber warum sag ich dir das? Du kennst ihn besser als jeder andere, Mann!«
Zum ersten Mal lächelte Allday jetzt. »War ich froh, daß Kapitän Adam vor dem Kriegsgericht keine Probleme hatte. Da hat Sir Richard wenigstens eine Sache weniger in seinem Kopf.«
Ferguson räusperte Zustimmung und rauchte. Ein Zollkutter war in Falmouth eingelaufen und hatte die Neuigkeit und andere Nachrichten gebracht.
Ganz direkt fragte Allday: »Du wußtest von der Sache zwischen ihm und diesem Mädchen Zenoria?«
»Ich hab’s geraten. Es bleibt unter uns. Selbst Grace ahnt nichts davon.«
Allday blies den Span aus. Grace war Bryan eine wunderbare Ehefrau. Sie hatte ihn gerettet, als er damals ohne Arm nach Hause zurückgekehrt war. Aber sie hatte Freude am Tratschen. Gut, daß Bryan sie richtig zu nehmen wußte.
Er sagte: »Ich liebe meine Unis mehr, als ich sagen kann. Aber ich würde Sir Richard nicht verlassen. Vor allem jetzt nicht, wo es fast vorbei ist.«
Die Tür ging auf, und Grace Ferguson trat in die Küche. »Ihr seid wie zwei alte Weiber, wirklich. Was macht meine Suppe?« Doch sie sah sie dabei freundlich an. »Ich habe mich gerade um die Feuer gekümmert. Das neue Mädchen Mary ist ja ganz willig, aber sie hat ein Gedächtnis wie ein Sieb.«
»Feuer?« fragte Ferguson überrascht. »Bist du nicht ein bißchen voreilig?« Doch seine Gedanken schweiften ab, hingen Alldays letzten Worten nach. Ich würde Sir Richard nicht verlassen, jetzt, da es fast vorbei ist. Er versuchte sie wegzuwischen, aber das gelang ihm nicht; Was hatte er damit gemeint? Sollte der Krieg endlich enden, damit Männer die Bilanz ziehen konnten? Oder hatte er Angst um Sir Richard? Das wäre nichts Neues. Ferguson hatte mal gehört, wie Bolitho sie beide mit Herr und Hund verglich. Jeder fürchtete, den anderen allein zu lassen.
Grace schaute ihn fragend an: »Ist irgendwas nicht in Ordnung, mein Lieber?«
Er schüttelte den Kopf: »Nichts!«
Allday bedachte beide mit einem Blick. Obwohl er sie lange allein lassen mußte, wenn er auf See war, hatte er keine besseren Freunde.
Er sagte: »Bryan meint, ich werde alt und werde zerfallen wie eine verrottete Hulk.«
Sie legte eine Hand auf sein kräftiges Handgelenk. »Das ist ja wohl blanker Unsinn, du mit deiner wunderbaren Frau und dem wonnigen Baby. Du und alt!« Doch das Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Sie kannte beide gut genug und ahnte, was vorgefallen war.
Wieder ging die Tür auf, und diesmal trat der Kutscher Matthew ein. Genau wie Allday hatte er dagegen protestiert, daß er in Falmouth bleiben und Bolitho und Catherine einer gemeinen Postkutsche anvertrauen mußte.
Ferguson war froh über die Unterbrechung: »Was liegt an, Matthew?«
Matthew grinste.
»Ich habe gerade das Posthorn gehört. Es klang wie beim letzten Mal, als er nach Hause kam.«
Sofort gab ihm Ferguson den Auftrag: »Fahr zum Platz nach Falmouth und hol sie dort ab.« Doch Matthew war längst verschwunden. Er wußte von der Ankunft als erster so wie er auch die Salutschüsse der Batterie von St. Mawes richtig gedeutet hatte, als Bolitho vor gut einem Monat nach Falmouth zurückgekehrt war.
Er hielt inne und küßte seine Frau auf die Wange.
»Wozu denn das?«
Ferguson sah zu Allday rüber. Sie kamen nach Hause zurück. Er lächelte. »Weil du die Feuer schon angezündet hast.« Und dann konnte er’s doch nicht sein lassen. »Und für vieles andere auch, Grace.« Er griff nach seinem Mantel. »Du bleibst doch zum Essen, John?«
Aber Allday machte sich zum Aufbruch bereit. »Die wollen nicht von einer Menge begrüßt werden, wenn sie ankommen.« Doch er wurde sofort ernst. »Aber wenn er mich braucht, bin ich sofort da. Das ist alles, und mehr ist nicht nötig.«
Die Tür fiel hinter ihm zu. Die beiden sahen sich an.
»Er nimmt sich das sehr zu Herzen«, sagte sie.
Ferguson dachte an den Duft von Jasmin. »Genau wie sie!«
Die glänzende Kutsche mit dem Wappen der Bolithos auf der Tür entfernte sich klappernd über den Hof. Funken sprühten von den Reifen auf das Pflaster. Matthew hatte sich schon tagelang auf dieses Ereignis vorbereitet und war mit den Pferden in dem Augenblick zur Stelle, als die Postkutsche von Truro ziemlich sicher vor dem King’s Head in Falmouth hielt. Ferguson blieb noch mal an der Tür stehen. »Hol den Wein, den sie immer so gern trinken, Grace!«
Sie sah ihm nach und erinnerte sich wie gestern daran, als ihn die Preßgang geschnappt und auf ein Schiff des Königs geschleppt hatte. Bolithos Schiff. Und sie erinnerte sich, wie er als Invalide zurückgekehrt war. Sie hatte es nie mit Worten gesagt: Den Mann liebe ich.
Sie lächelte: »Champagner. Ich weiß nicht, was sie daran finden!«
Jetzt, da alles bald vorbei ist. Er hätte ihr sagen können, was Allday gemeint hatte. Doch sie war verschwunden, und er war ganz froh, daß es nun wie ein Geheimnis zwischen ihm und Allday blieb.
Er trat nach draußen in die feuchte, kalte Luft und konnte die See riechen. Heimkehr. Plötzlich war es wichtig, daß darum kein Aufheben gemacht wurde: Allday hatte das schon richtig begriffen, obwohl er natürlich vor Neugier fast platzte, was wohl als nächstes anlag. Es war, als hätten sie Falmouth nur für einen einzigen Tag verlassen.
Er sah zum letzten Stall hinüber. Dort hob die große Stute Tamara immer wieder ihren Kopf und ließ ihn fallen. Im schummrigen Licht erkannte er deutlich den hellen Fleck auf ihrer Stirn.
Es gab keinen Zweifel mehr. Ferguson ging hinüber und streichelte das Maul des Tieres.
»Sie ist wieder da. Und bestimmt nicht zu früh!«
Eine halbe Stunde später ratterte die Kutsche in die Auffahrt. Der Held und seine Dame, die dem Land einige Skandale geliefert hatten und sich weder um das Übliche noch um Überempfindlichkeiten kümmerten, waren nach Hause zurückgekehrt.
Leutnant George Avery musterte sich kritisch im Spiegel des Schneiders. London kannte er kaum, frühere Besuche hatten ihn fast immer nur mit irgendeinem Auftrag in die Admiralität geführt. Der Schneiderladen lag in der Jermyn Street, zwischen gut besuchten Geschäften und eleganten Häusern. Der Lärm von Pferden und Kutschen kam von draußen herein.
Er war viele Meilen zu Fuß gegangen. Das machte ihm Freude nach der Enge auf dem Achterdeck eines Kriegsschiffs. Er lächelte sein Spiegelbild an; er war richtig müde nach dem ungewohnten Wandern.
Es war schon seltsam und neu für ihn, Geld zu haben und es ausgeben zu können. Es war das Prisengeld, das er vor mehr als zehn Jahren erhalten hatte. Er war damals Erster Offizier des Schoners Jolie gewesen, selber eine französische Prise. Er hatte daran gar nicht mehr gedacht. Das schien angesichts des späteren Mißgeschicks unbedeutend. Er war verwundet worden, als eine französische Korvette die Jolie aufbrachte, und kam als Kriegsgefangener nach Frankreich. Während des kurzen Friedens von Amiens war er ausgetauscht und nach seiner Rückkehr sofort vor ein Kriegsgericht gestellt worden.
Er hatte einen schweren Tadel erhalten wegen des Verlustes seines Schiffes, obwohl er so schwer verwundet worden war. daß er andere nicht daran hindern konnte, die Flagge zu streichen. Als Beobachter der Verhandlung Adam Bolithos hatte er jeden Augenblick seiner eigenen Schande wieder neu durchlebt.
Er dachte an das Haus in Chelsea, in dem er noch wohnte. Ob wohl Bolitho und Catherine bereits in Cornwall waren? Er hatte immer noch Schwierigkeiten, sich damit anzufreunden, ja gar zu genießen, daß er ihr Haus in London nach eigenem Belieben nutzen konnte. Doch auch er würde bald nach Falmouth reisen müssen, um dabei zu sein, wenn Sir Richard seine endgültigen Befehle erhielt. Seine kleine Mannschafl – so nannte er sie – Für Avery war das gefährlich nahe an einer Familie.
Der Schneider Arthur Crowe sah zu ihm hoch. »Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Sir? Die anderen Kleider werde ich Ihnen schicken, sobald sie fertig sind.« Höflich, fast unterwürfig. Ganz anders als bei ihrem ersten Treffen … Crowe hatte damals fast ein paar kritische Sätze über Averys Uniform fallen lassen, die Joshua Miller in Falmouth geschneidert hatte. Wieder so ein armer Hund, mit fünfunddreißig zu alt für seinen Rang; irgendwas hängt über ihm. Wird Leutnant bleiben, bis er entlassen wird oder der Tod die Sache entscheidet. Avery hatte die stumme Kritik verdorren lassen, indem er wie nebenbei Bolithos Namen erwähnt hatte und die Tatsache, daß die Millers schon seit Generationen die Uniformen der Bolithos schneiderten.
Er nickte. »Sehr zufrieden.« Sein Blick blieb auf der glänzenden Epaulette auf seiner rechten Schulter hängen. Daran mußte er sich erst gewöhnen. Ein einzelnes Schulterstück auf der rechten Schulter hatte bisher den Rang eines Kapitäns signalisiert, eines Kapitäns, der noch keinen vollen Rang hatte, aber immerhin schon Kapitän war. Ihre Lordschaften hatten das offensichtlich auf Drängen des Prinzregenten geändert. Die einzelne Epaulette gehörte jetzt zum Leutnant – jedenfalls solange, bis wieder etwas Neumodisches eingeführt wurde.
Der Raum wurde dunkler. Sicher zogen Wolken auf. Doch es war eine Kutsche, die auf der Straße genau vor dem Fenster hielt. Ein sehr elegantes Fahrzeug, tiefes Blau, irgendein Wappen an der Seite. Auch der Schneider hatte die Kutsche bemerkt. Er eilte zur Tür, öffnete sie und ließ bitterkalte Luft herein.
Seltsam, dachte Avery, in keinem einzigen Laden sah man Knappheit. Es schien, als fehle nichts, so als fände der Krieg gegen Frankreich oder Amerika auf einem anderen Stern statt.
Eine Frau stieg aus der Kutsche. Sie trug einen schweren, hochtaillierten Mantel fast in der Farbe der Kutsche. Der Rand einer Haube verdeckte ihr Gesicht, als sie nach unten auf das Straßenpflaster blickte.
Arthur Crowe verbeugte sich steif. Sein Maßband hing um seinen Hals wie eine Amtskette.
»Was für eine Freude, Sie an diesem frischen Morgen wieder begrüßen zu dürfen, Mylady.«
Avery lächelte in sich hinein. Crowe kam es offensichtlich darauf an, die zu kennen, die wichtig waren. Und die anderen zu übersehen.