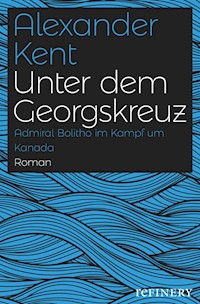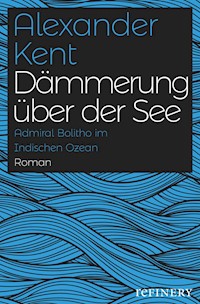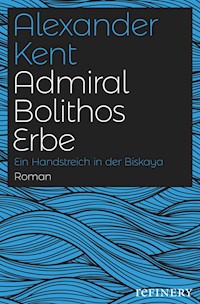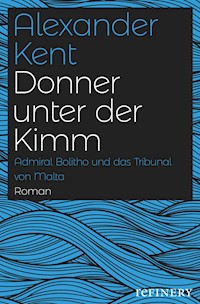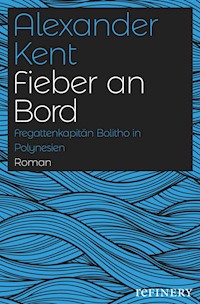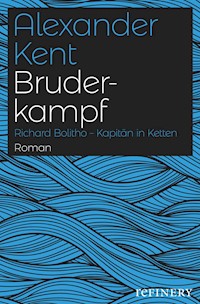6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Es sind Sir Richard und seine Getreuen, die 1811 auf der Indomitable in den Gewässern von Halifax bis zu den Inseln unter dem Winde die reichbeladenen britischen Schiffe zu bewachen haben. Man fürchtet den Krieg der Vereinigten Staaten gegen Großbritannien. Sollte die Diplomatie versagen und die Auseinandersetzung auf See unvermeidlich werden, dann müssten sie kämpfen bis zum letzten Atemzug - dem Vaterland zuliebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Ähnliche
Dem Vaterland zuliebe
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester. Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
Es sind Sir Richard und seine Getreuen, die 1811 auf der Indomitable in den Gewässern von Halifax bis zu den Inseln unter dem Winde die reichbeladenen britischen Schiffe zu bewachen haben. Man fürchtet den Krieg der Vereinigten Staaten gegen Großbritannien. Sollte die Diplomatie versagen und die Auseinandersetzung auf See unvermeidlich werden, dann müssten sie kämpfen bis zum letzten Atemzug - dem Vaterland zuliebe.
Alexander Kent
Dem Vaterland zuliebe
Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas
Roman
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinSeptember 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004© Bolitho Maritime Productions Ltd., 1995Titel der englischen Originalausgabe: For My Country’s Freedom (William Heinemann, London)Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-108-9
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erster Teil: 1811
I Bedauern
II Mehr als Treue
III Der Ozean ist immer da
IV Auftrag des Königs
V Die Indomitable
VI Das St. Georgs-Kreuz
VII Unruhige See
VIII Träume
IX Das Zeichen Satans
Zweiter Teil: 1812
X Täuschung
XI Wie der Vater, so der Sohn
XII Zeuge
XIII Einsamkeit
XIV Bewährungsprobe
XV Streich um Streich
XVI Eines Schiffes Stärke
XVII Und wofür?
XVIII Epilog
Anhang
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Erster Teil: 1811
I Bedauern
Lady Catherine Somervell zügelte die große Stute und tätschelte den Hals des Tieres.
»Nicht mehr lange, Tamara, wir sind bald zu Hause.«
Dann saß sie kerzengerade und unbewegt im Sattel und sah mit dunklen Augen auf die See. Schon kurz vor der Mittagsstunde dieses ersten Märztages 1811 hing ein ungewohnter Dunst über dem Pfad, den sie eingeschlagen hatte, um John Allday und seine ihm frisch angetraute Unis zu besuchen. Noch immer wunderte sie sich, daß die Admiralität in London sie alle so lange unbehelligt gelassen hatte. Zwei und einen halben Monat – das war die längste Zeit, die sie und Richard jemals gemeinsam auf seinem Besitz in Cornwall verbracht hatten.
Sie schob die pelzgefütterte Kapuze vom Kopf. Die feuchte Luft ließ ihr Gesicht noch frischer aussehen. Sie schaute nach Süden. Rosemullion Head, ganze drei Meilen entfernt an der Mündung des Helford River, war von Dunst eingehüllt. Sie befand sich auf dem oberen Küstenpfad. Den unteren hatte die See in den Januarstürmen unterspült und ins Meer brechen lassen.
Jetzt meldete sich der Frühling. Die ersten waghalsig fliegenden Bachstelzen ließen sich bereits an den Ufern des Helford River sehen. Dohlen hockten wie Klosterbrüder in Reihen auf den Steinwällen. Die windzerzausten Bäume auf den nahen Hügeln trugen zwar noch keine Blätter, dafür glänzten ihre geneigten Äste aber nach einem kürzlichen Regenschauer. Vereinzelt sah man schon – wie winzige gelbe Pinselspuren im Graugrün der Wiesen – frühe Narzissen. Sie zitterten in der salzigen Luft, die vom Kanal und vom nahen Atlantik herüberwehte.
Catherine trieb die Stute wieder an. In ihren Gedanken hing sie den letzten Wochen nach, in denen sie ganz ungestört ihre Freiheit genießen konnten. Nach der ersten Umarmung nach Bolithos Rückkehr aus Mauritius, wo er Barattes Kaperer zur Aufgabe gezwungen hatte, hatte sie gefürchtet, er würde – wie sonst – bald wieder Unruhe zeigen, weil er von seinen Schiffen und den Männern getrennt war. Vielleicht fürchtete er insgeheim, daß die Marine, der er so viel gegeben und geopfert hatte, ihn aus dem Blick verlor.
Aber ihr Wiedersehen hatte ihre Liebe neu entflammt, sie stärker als früher lodern lassen – wenn das überhaupt möglich war. Sie machten trotz des unangenehmen Wetters lange Ausritte und Spaziergänge und besuchten Familien auf dem Gut. Wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, nahmen sie auch an festlichen Abenden auf dem großartigen Landsitz von Richards Schwager Lewis Roxby teil, den man spöttelnd den König von Cornwall nannte. Diese Feiern fanden statt, weil Roxby unerwartet geadelt worden war. Catherine mußte lächeln. Jetzt würde ihn nichts mehr aufhalten können …
Sie beobachtete Richard sehr genau. Die Tage flossen ohne besondere Ereignisse dahin. Früher war er schon bald wieder unruhig geworden, doch diesmal nicht. Sie spürte ihre Leidenschaft und die sanfte Glut der Liebe, die sie verband. Nichts war ihr an ihrem Mann mehr fremd.
In der Londoner Welt hatte sich viel verändert. Sir Paul Sillitoes Prophezeiung hatte sich vor genau einem Monat erfüllt. König Georg III. war für geisteskrank erklärt und aller Macht enthoben worden. Den Prinzen von Wales hatte man zum Prinzregenten ausgerufen. Bis zu seiner Krönung würde er das bleiben. Einige Nachbarn meinten gnadenlos, Lewis Roxby sei nur aufgrund des Einflusses des Prinzregenten geadelt worden. Dabei war ihm der Adelstitel wegen seiner patriotischen Verdienste verliehen worden. Als eine französische Invasion drohte, hatte er als Vertreter der Regierung eine örtliche Miliz gegründet. Andere meinten, der Prinzregent, der gleichzeitig auch Herzog von Cornwall war, könne einflußreiche Verbündete überall gut gebrauchen.
Wieder blickte sie auf die See. Sie sah in ihr nicht länger die gefürchtete Rivalin. Auf Catherines Schulter waren immer noch die Narben des Sonnenbrands zu erkennen, Erinnerungen an die Tage im offenen Boot vor dem Hundert-Meilen-Riff nach dem Verlust der Golden Plover. War das erst zwei Jahre her? Sie hatte mit den anderen Überlebenden gelitten. Aber Richard und sie waren zusammengewesen und hatten das Furchtbare, das sie bis an die Schwelle des Todes gebracht hatte, gemeinsam erlebt.
Hinter den blassen Wolken war keine Sonne zu erkennen, nur die See glitzerte etwas. Die ewige Dünung schien wie von einer gigantischen Laterne beleuchtet.
Sie hatte Richard im Hause am Schreibtisch zurückgelassen. Er mußte einige Briefe beenden, die mit der Nachmittagspost vom Marktplatz in Falmouth abgehen sollten. Einer war an die Admiralität adressiert. Zwischen ihnen beiden gab es jetzt keine Geheimnisse mehr. Sie hatte ihm sogar ihren Besuch in Whitechapel geschildert und von Sillitoes Hilfsbereitschaft berichtet.
Bolitho hatte darauf nur leise gesagt: »Und ich glaubte immer, dem Mann könne man nicht trauen.«
Sie hatte Richard im Bett in die Arme geschlossen und geflüstert: »Er half mir, als niemand anderer da war. Aber ein Kaninchen darf niemals dem Fuchs den Rücken zukehren.«
Zum Brief an die Admiralität hatte er nur bemerkt: »Irgend jemand muß wohl meinen Bericht über die Gefechte bei Mauritius gelesen haben. Darin habe ich mehr Fregatten gefordert. Aber ich kann immer noch nicht glauben, daß durch die staubigen Korridore der Admiralität ein neuer Wind weht.«
An einem dieser Tage stand er mit ihr auf dem Kap unterhalb von Pendennis Castle. Seine Augen hatten die gleiche Farbe wie die grauen Wolken, die in endloser Folge am Himmel vorbeizogen.
Sie hatte gefragt: »Würdest du jemals einen Posten in der Admiralität annehmen?«
Er hatte sich zu ihr umgedreht und entschlossen und überzeugend geantwortet: »Wenn ich der See den Rücken kehre, werde ich auch der Navy den Rücken kehren, Kate, endgültig.« Er lachte auf seine jungenhafte Art. Und die Falten in seinem Gesicht verschwanden. »Mich würden sie übrigens niemals darum bitten!«
Und sie selber hatte darauf nur geantwortet: »Sicher meinetwegen, oder wegen unseres Verhältnisses – das ist der wahre Grund!«
»Vielleicht. Aber das ist keine Strafe, Kate, sondern eine Belohnung!«
Sie mußte jetzt auch an den jungen Adam Bolitho denken. Seine Fregatte Anemone lag nach der langen Reise von Mauritius über das Kap der Guten Hoffnung und Gibraltar in Plymouth in der Werft. Sie war im letzten Gefecht mit Barattes Kaperern so durchlöchert worden, daß ihre Pumpen auf der langen Heimreise keine Stunde aussetzen konnten.
Heute wollte Adam nach Falmouth kommen. Sie hörte vom Turm der Kirche König Charles der Märtyrer die Uhr schlagen. In dieser Kirche waren seit Jahrhunderten alle Bolithos getauft worden, hatten dort geheiratet und in ihrem Schatten die letzte Ruhestätte gefunden. Es war gut, wenn Richard Zeit für ein Gespräch mit seinem Neffen fand. Sie bezweifelte allerdings, daß er mit Adam über Valentine Keens Frau sprechen würde. Es war unklug, offen darüber zu sprechen.
Sie dachte an Allday, den sie in der kleinen Gaststätte Old Hyperion in Fallowfield besucht hatte. Ein Maler aus der Gegend hatte das Gasthausschild gemalt – und zwar bis auf die letzte Geschützpforte exakt, wie Allday nach seiner Trauung eine Woche vor Weihnachten stolz versicherte. Unis, seine strahlende Frau, kannte die Hyperion auch, denn ihr erster Mann war auf ihr gefallen. Sie hatte Kate anvertraut, daß John Allday insgeheim fürchtete, Sir Richard könne ihn an Land zurücklassen, wenn er sein nächstes Kommando antrat.
Sie sprach mit großer Liebe von diesem großen, schlottrigen Seemann, ohne Furcht, daß die Navy sich zwischen sie drängen könnte. Und sie war stolz auf die starken Bande, die den Vizeadmiral und seinen Bootssteuerer zusammenhielten.
Catherine hatte geantwortet: »Ich weiß. Ich muß es genauso aushalten wie Sie. Unseretwegen sind die Männer da draußen – ständig gefährdet durch die See und Kugeln. Nur unseretwegen.« Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie Unis überzeugt hatte.
Sie lächelte und schmeckte beim Reiten Salz auf den Lippen. Ob ich das selber glaube?
Die Stute wurde schneller, als sie auf die neue Straße kamen, die Lewis Roxby von französischen Kriegsgefangenen hatte bauen lassen. Catherine vermutete, daß die Gefangenen auch sein Haus und den Garten so makellos gepflegt hielten. Bolithos eigener Besitz wurde wie die meisten Güter der Umgebung von Männern versorgt, die die Marine, der sie treu gedient hatten, als Krüppel an Land geworfen hatte. Ohne offiziellen Schutzbrief war jeder junge Mann ständig in Gefahr, von den ewig gierigen Preßkommandos eingefangen zu werden. Doch in dunklen Nächten half auch solch ein Schutzbrief nichts, wenn draußen ein Kriegsschiff ankerte und ihr Kommandant die an Bord Gebrachten nicht sonderlich genau prüfte.
Sie sah das Dach des alten grauen Hauses in der letzten Senke des Hügels. Ob Adam Neuigkeiten mitgebracht hatte? Auch ihm würde sicher auffallen, wie erholt sein Onkel aussah. Viel Bewegung, gutes Essen, Ruhe … Sie lächelte. Und viel Liebe, die ihnen immer wieder den Atem raubte.
Sie fragte sich oft, ob Adam wohl aussah wie sein Vater? Von Hugh gab es nirgendwo im Haus ein Porträt. Sie nahm an, daß Bolithos Vater das verhindert hatte, nachdem sein Sohn Schande über sich und die Familie gebracht hatte. Schande nicht wegen seiner Spielleidenschaft. Seine Schulden hatten den Familienbesitz gefährdet, bis Richard als erfolgreicher Kommandant von Fregatten genügend Prisengelder erhielt, um sie zu begleichen. Hugh hatte wegen seiner Spielleidenschaft sogar einen Offizierskameraden getötet.
Beides hätte der Vater dem Sohn wahrscheinlich verziehen. Aber die Britische Marine zu verlassen und auf amerikanischer Seite für die Unabhängigkeit der Kolonien zu kämpfen – das konnte man nicht verzeihen. Sie dachte jetzt an die Porträts ernst dreinschauender Männer an den Wänden und auf der Empore. Deren Blicke schienen sie zu verfolgen und abzuschätzen, wann immer sie nach oben ging. Die Männer waren doch sicher nicht alle Heilige gewesen?
Ein Stallbursche nahm den Zügel, und Catherine sagte: »Reib sie gut trocken!« Sie sah ein Pferd, das eifrig in der Krippe im Stall kaute. Es trug immer noch eine blaugoldene Satteldecke. Adam war also schon hier.
Als sie die große zweiflüglige Tür öffnete, erblickte sie die beiden Männer vor dem großen Kamin. Man konnte sie für Brüder halten. Dasselbe schwarze Haar und die selben Gesichtszüge wie auf den Porträts, die sie so intensiv studiert hatte, als dieses Haus ihr Heim wurde. Sie blickte kurz auf den Tisch. Dort lag ein Leinenumschlag mit dem angedeuteten Anker der Admiralität. Irgendwie hatte sie eine Nachricht erwartet. Dennoch traf sie sie wie ein Schock.
Sie lächelte und breitete ihre Arme aus, als Adam sie begrüßte. Richard hatte bestimmt ihren Blick bemerkt und ihr plötzliches Erschrecken.
Dort auf dem Tisch lag der wahre Feind.
Leutnant George Avery stand am Fenster seines Zimmers und beobachtete das Gewimmel von Leuten mit ihren Karren unten auf der Straße. In Dorchester war Markttag. Bauern waren von den Höfen und aus den Dörfern gekommen, um zu kaufen und zu verkaufen. Man stritt über Preise. Die Gasthäuser waren jetzt sicher schon sehr voll.
Er trat vor einen einfachen Spiegel und musterte sich, so wie er einen angehenden Midshipman prüfen würde.
Noch immer war er über seine Entscheidung verblüfft. Er hatte Sir Richard Bolithos Einladung angenommen, weiter sein Flaggoffizier zu bleiben. Dabei hatte er sich oft genug geschworen, daß er jedes auch noch so kleine Kommando übernehmen würde, wenn er dazu die Chance bekäme. Für seinen Rang war er schon ziemlich alt, bereits jenseits der dreißig. Kritisch musterte er die gutsitzende Uniform. Das Stück Goldlitze auf seiner linken Schulter zeigte an, daß er Sir Richard Bolithos Adjutant war.
Avery würde nie den Tag vergessen, als er den berühmten Admiral zum ersten Mal in seinem Haus in Falmouth getroffen hatte. Er hatte nicht geglaubt, daß Bolitho ihn akzeptieren würde, auch wenn er Sir Paul Sillitoes Neffe war. Er kannte seinen Onkel kaum und konnte sich nicht vorstellen, warum er ein Wort für ihn einlegen sollte.
Noch immer bekam er Alpträume, wenn er an das Ereignis zurückdachte, das ihn fast das Leben gekostet hätte. Er war zweiter Mann an Bord des kleinen Schoners Jolie, einer ehemaligen französischen Prise. Die Jagd auf feindliche Blockadebrecher hatte er erregend gefunden. Doch sein jugendlicher Kommandant, ebenfalls Leutnant, war sich seiner Sache zu sicher geworden und war zu viele Risiken eingegangen. Er konnte immer noch hören, wie er bei jenem ersten Treffen Bolitho Bericht erstattet hatte: Ich hielt ihn für einen Teufelskerl, Sir Richard. Sie waren von einer französischen Korvette überrascht worden, die plötzlich hinter einem Kap erschienen war und sie unter Feuer nahm, bevor sie fliehen konnten. Die erste Breitseite hatte den jungen Kommandanten zerrissen, und wenige Augenblicke später lag auch Avery schwer verwundet an Deck. Hilflos hatte er zusehen müssen, wie seine Männer die Flagge strichen. Die erdrückende Wucht des plötzlichen Angriffs hatte sie allen Kampfesmut verlieren lassen.
Als Kriegsgefangener hatte Avery Verzweiflung und Schmerz unter den Händen französischer Wundärzte kennengelernt. Das lag nicht an mangelnder Fürsorge oder Gleichgültigkeit. Ihr Mangel an Verbandsmaterial war die Folge der englischen Blockade, eine wahre Ironie des Schicksals.
Der kurze Frieden von Amiens hatte zur frühen Entlassung Averys geführt – im Austausch mit einem französischen Gefangenen. Der Frieden hatte den Streitenden nur Gelegenheit gegeben, ihre Wunden zu lecken und Schiffe und Verteidigungsanlagen zu reparieren. Bei seiner Rückkehr nach England hatte ihm niemand gratuliert oder ihn gar für seine frühere Tapferkeit ausgezeichnet. Statt dessen wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Zwar war er freigesprochen worden, die Anklage wegen Feigheit vor dem Feind und Gefährdung des Schiffes wurde fallengelassen. Aber weil die kleine Jolie ihre Flagge zu schnell vor dem Feind gestrichen hatte, war er, ohne Rücksicht auf seine Verwundung, gezeichnet und würde den Rest seines Marinelebens Leutnant bleiben.
Dann, vor etwa achtzehn Monaten, hatte Bolitho ihn zu seinem Flaggoffizier gemacht. Ihm öffnete sich damit wieder eine Tür. Für Avery begann ein neues Leben, das er mit einem Helden Englands teilte. Bolithos Taten und sein Mut lebten in den Herzen der ganzen Nation.
Er lächelte sich im Spiegel an und fand, daß er wieder jünger aussah. Einen Augenblick lang verschwanden sein üblicher bedrückter Ausdruck und die scharfen Falten um den Mund. Doch die grauen Strähnen in seinem Hunkelbraunen Haar und die steife Schulter, Folge der erwundung und der schlechten ärztlichen Versorgung, aften sein Lächeln Lügen.
Er hörte jemanden an der Haustür und sah sich um: kahles, einfaches Zimmer ohne Stil. Es glich darin dem Haus, dem Pastorenhaus, in dem sein Vater ihn erzogen hatte – konsequent, aber gütig. Averys Schwester lebte nach dem Tode ihres Vaters jetzt hier als Ehefrau eines Pfarrers. Den Vater hatte auf der Straße ein durchgehendes Pferd getötet.
Er hängte seinen Degen ein und griff nach dem Hut. Die Goldlitze glänzte noch immer so hell wie vor achtzehn Monaten, als er in Falmouth Joshua Miller, den Schneider, aufgesucht hatte. Schon zwei Generationen lang hatten die Millers den Bolithos Uniformen geschneidert, doch niemand wußte mehr genau, wie alles begonnen hatte. Bolitho hatte ihn nach seiner Ernennung zum Flaggoffizier ausgestattet – aus Großzügigkeit. Sie war eines der Merkmale des Mannes, den er so gut kannte und doch immer noch nicht ganz verstand: Sein Charisma, dessen sich der Vizeadmiral offensichtlich selbst nicht bewußt war, ebenso wie der Beschützerinstinkt, den er bei jenen, die ihm besonders nahestanden, auslöste. Er nannte sie seine kleine Mannschaft, den schlottrigen Bootssteuerer Allday, den rundschultrigen Sekretär Yovell aus Devon und seinen Diener Ozzard, einen Mann ohne Vergangenheit.
Er legte für seine Schwester Geld auf den Tisch. Ihr geiziger Ehemann gab ihr sicherlich viel zuwenig. Aver hatte ihn sehr früh am Morgen das Haus verlassen hören, entweder um jemandem zu helfen oder um einem Gesetzesbrecher aus der Gegend ein Gebet vorzusprechen, ehe der am Galgen sein Leben aushauchte. Er lächelte. Wenn sein Schwager wirklich ein Mann Gottes war, sollte der Herr auch besser für die kleine Mannschaft um den Pfarrer herum sorgen.
Die Tür öffnete sich, und seine Schwester stand im Gang und sah ihn an, als bedauere sie seinen Aufbruch. Sie hatte dasselbe dunkle Haar wie Avery. Und ihre Augen glänzten katzengleich wie die ihres Bruders. Doch damit endete die Ähnlichkeit. Er mochte noch immer nicht glauben, daß sie erst sechsundzwanzig Jahre alt war, denn ihr Körper war von vielen Geburten erschöpft. Sie zog vier Kinder groß, zwei hatte sie während der Schwangerschaft verloren. Noch schwerer war es, sie sich als junges Mädchen vorzustellen. Wie schön sie damals gewesen war!
»Der Fuhrmann ist hier«, sagte sie. »Er wird deine Seekiste zur Kutsche ins King’s Arms bringen, George.« Sie starrte ihn an, als er sie an sich zog und umarmte. »Ich weiß, daß du abreisen mußt, George, aber es war so schön, dich hier zu haben. Mit dir zu reden und überhaupt …« Wenn sie bedrückt war wie jetzt, klang ihr Dorsetdialekt sehr durch.
Unten schrien zwei Kinder, aber sie schien sie nicht zu hören. Plötzlich sagte sie: »Ich wünschte, ich hätte Lady Catherine gesehen, wie du!«
Avery drückte sie enger an sich. Sie hatte sich oft bei ihm nach Catherine erkundigt, was sie tat, wie sie mit ihm sprach, wie sie sich kleidete. Er strich über das verblichene Kleid, das seine Schwester während der ganzen Zeit seines Besuchs getragen hatte.
Er hatte Catherine auch einmal erwähnt, als Ethels Mann im Zimmer war. Erregt hatte der ihn angefahren: »Ein gottloses Weib. Ich will in meinem Haus ihren Namen nie wieder hören!«
Avery hatte blitzschnell geantwortet: »Ich dachte, dies sei das Haus eines vergebenden Gottes, Sir!«
Seitdem hatten sie kein Wort mehr gewechselt. Darum hatte der Pfarrer das Haus wohl so früh verlassen, um eine Umarmung mit verlogenen brüderlichen Abschiedswünschen zu vermeiden.
Plötzlich wollte Avery das alles hinter sich lassen. »Ich werde den Fuhrmann vorausschicken und komme zu Fuß nach.« Noch vor kurzem hätte er alles getan, um nicht durch die Straßen gehen zu müssen. Obwohl die Stadt im Binnenland lag, sah man hier doch genügend Marineoffiziere. Dorchester lag nahe genug an der Weymouth Bay, an Portland und Lyme – war also bei Marineoffizieren, die sich ein Haus kaufen wollten, sehr beliebt. Als er seine Verwundung ausheilte und das Kriegsgerichtsverfahren erwartete, hatte er genügend Marineoffiziere gesehen, die ihm auf die andere Straßenseite hinüber ausgewichen waren.
Jetzt, da er zu Bolitho gehörte, sah alles anders aus. Doch meine Gefühle denen gegenüber werden sich nie ändern.
Er umarmte sie noch einmal und spürte ihren müden Körper an seinem. Was war aus dem jungen Mädchen geworden!
»Ich werde dir Geld schicken, Ethel.« Er sah sie nicken. Vor Tränen konnte sie nicht sprechen. »Der Krieg ist bald vorbei. Dann werde ich wieder an Land sein.«
Er dachte daran, wie ruhig Bolitho mit der Situation fertig wurde, was Allday ihm über das verletzte Auge anvertraut hatte. In besserer Gesellschaft könnte ich nie sein.
Dann ging er die wohlbekannten Stufen hinunter, nacktes Holz, um ja nichts zu verschwenden – wie der Pfarrer gemeint hatte. Doch Avery war aufgefallen, daß der Mann sich einen guten Vorrat Wein im Keller hielt, verborgen hinter dem Zimmer, in dem sein Vater ihn einst erzogen hatte. Zu jeder anderen Gelegenheit hätte er bei diesem Gedanken gelächelt. Yovell hatte ihn in der kleinen Mannschaft sofort willkommen geheißen, weil er Latein sprechen und schreiben konnte. Seltsam, daß diese Fähigkeit, wenn auch indirekt, das Leben von Konteradmiral Herrick, Bolithos Freund, gerettet hatte.
Er sagte: »Die Straßen sind jetzt sicher in besserem Zustand. Übermorgen werde ich in Falmouth sein.«
Sie sah zu ihm auf, und er meinte, das junge Mädchen von einst sehe ihn wie durch eine Maske an.
»Ich bin so stolz auf dich, George!« Sie wischte sich mit der Schürze über das Gesicht. »Du weiß nicht, wie sehr!«
Draußen auf der Straße nahm der Fuhrmann sein Geld in Empfang und tippte, Ethel grüßend, mit dem Finger an den Hut. Sie küßten sich. Auf der Straße wurde Avery erschreckend klar, daß sie ihn wie eine Frau geküßt hatte, die über ihr vertanes Leben nachdachte.
An der Straßenecke entdeckte er vor dem Gasthof die Kutsche mit den Insignien der Royal Mail. Die Deichseln waren noch unbespannt, doch schon zurrten Bedienstete auf dem Dach Gepäckstücke fest.
Er drehte sich um und sah die Straße entlang zurück, in der er groß geworden war. Doch seine Schwester war verschwunden.
Zwei Midshipmen, offenbar dienstlich unterwegs, gingen grüßend an ihm vorbei. Avery bemerkte sie nicht einmal.
Und dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Hieb. Er würde seine Schwester nie wiedersehen.
John Allday machte beim Stopfen seiner langen Pfeife eine Pause und ging, ohne den Tabak anzuzünden, zur Tür seines Gasthauses.
Lange betrachtete er das brandneue Wirtshausschild, das da oben im Wind schwankte. Obwohl er von hier aus den Kanal nicht sah, konnte er ihn sich ohne Mühe vorstellen. Der Wind hatte seit dem Morgen etwas rückgedreht, und draußen lief jetzt das Wasser ab. Auch Falmouth sah er in Gedanken ganz deutlich vor sich. Schiffe holten die Anker dicht und warteten, ankerauf zu gehen, um Tide und Wind zu nutzen. Es waren vor allem Kriegsschiffe, doch dort lagen auch die berühmten Paketschiffe von Falmouth, ebenso wie Fischerboote und Hummerfänger. Er würde sich an solche Bilder gewöhnen. Gewöhnen müssen, sagte er sich. Er hörte den dünnen Glockenschlag der winzigen Gemeindekirche. Seine Augen wurden feucht. In ihr hatten Unis und er vor gut zwei Monaten geheiratet. Solche Wärme, solch unerwartete Liebe hatte er nie gekannt. Er hatte immer ein Auge für schmucke Frauen, für flotte Boote gehabt, wie er gelegentlich zugab. Aber Unis hatte sie alle übertroffen.
Bald würden jetzt auch die Männer von den Feldern heimkehren. Es wurde noch immer zu früh dunkel, um lange draußen zu bleiben.
Er hörte Unis’ Bruder, der auch John hieß, Krüge bereitstellen und Bänke schieben. Dumpf klang sein Holzbein auf dem Fußboden und verriet jedem, wohin er sich bewegte. Ein guter Mann, ehemaliger Soldat des 31. Regiments zu Fuß, des Regiments Huntingdonshire. John wohnte jetzt nebenan und würde von seinem Haus aus Unis helfen, sobald er wieder auf See war.
Lady Catherine war den langen Weg nach Fallowfield geritten und hatte versucht, ihn zu beruhigen. Aber einer der Kutscher war hier auf ein Bier und ein paar Pasteten eingekehrt und hatte ihm vom Brief der Admiralität an Sir Richard Bolitho berichtet. Und seither hatte er an nichts anderes mehr denken können.
Er hörte, wie Unis leichtfüßig durch die andere Tür trat, sah sich um, sah sie lachen, einen Korb frisch gelegter Eier am Arm.
»Machst du dir immer noch Sorgen, Lieber?«
Allday trat wieder ins Gastzimmer und versuchte, seine trüben Gedanken mit einem Lachen zu verscheuchen.
»Für mich ist doch das alles ganz neu, verstehst du?«
Sie sah sich im Gastzimmer um. Die kleinen Fässer mit je viereinhalb Gallonen Bier ruhten auf ihren Ständern. Auf den Tischen saubere Tücher. Es roch nach frischem Brot. All das würde jeden hart arbeitenden Knecht auf dem Weg nach Hause zur Einkehr bewegen. Ein Ort zum Wohlfühlen. Sie war zufrieden mit sich.
»Für mich ist das auch neu, jetzt wo mein Mann hier bei mir ist.« Sie lächelte sanft. »Mach dir keine Sorgen. Du besitzt mein Herz. Doch mir wird’s schwerfallen, wenn du gehst. Und du wirst ganz sicher wieder weggehen. Ich bin hier gut aufgehoben. Versprich mir nur, daß du wiederkommst.« Sie drehte sich zur Küche um, damit er die Tränen in ihren Augen nicht sehen konnte. »Ich bring dir einen Schluck zu trinken, John!«
Ihr Bruder richtete sich auf. Er hatte gerade neues Holz in den Kamin gelegt. Jetzt sah er Allday ernst an.
»Also bald, nicht wahr?«
Allday nickte. »Er wird erst einmal nach London aufbrechen. Ich sollte ihn begleiten.«
»Diesmal nicht, John. Du hast doch jetzt Unis. Ich hatte Glück. Ich hab ein Bein für König und Vaterland verloren. Glück – na ja, damals dachte ich anders darüber. Einer Kanone ist so was egal. Also mach das Beste aus dem, was du hast.«
Allday nahm seine Pfeife wieder auf und lächelte seiner Frau entgegen, die ihm einen Krug Rum brachte.
»Du weißt wirklich, was ein Mann braucht«, sagte er.
Sie hob scherzend den Finger. »Du bist ein schlimmer Kerl, John Allday!« kicherte sie.
In der anderen Ecke des Raums machte ihr Bruder es sich bequem. Allday war zufrieden. Doch ob der ihn wirklich verstand? Schließlich war er ja nur Soldat gewesen, wie sollte er da einen Seemann verstehen?
Lady Catherine blieb oben an der Treppe stehen, und zog ihren Morgenmantel enger um sich. Nach der Wärme des großen Himmelbetts und des Kaminfeuers im Schlafzimmer spürte sie jetzt die Kälte an ihren Füßen.
Früher als sonst war sie zu Bett gegangen, damit Richard sich allein und ungestört mit seinem Neffen unterhalten konnte. Später waren sie zusammen die Treppe hinaufgestiegen. Ihr schien, als sei Adam beim Betreten seines Schlafzimmers unsicher gestolpert.
Während des Abendessens schien er verspannt und in sich gekehrt. Sie hatten über seine Heimreise gesprochen und sich über Anemone unterhalten, die im Dock lag. Kupferbeschläge mußten ersetzt werden, die das Geschützfeuer von Barrattes Kaperern durchlöchert hatte. Adam hatte von seinem Teller aufgeblickt, und ein paar Augenblick lang hatte sie in seinem vertrauten Mienenspiel den Stolz auf seine Anemone wiederentdeckt.
»Sie hat wirklich viel einstecken müssen, aber bei Gott, unter dem Kupfer ist ihr Rumpf kerngesund.«
Er erwähnte, daß auch die Brigg Larne in Plymouth ankerte. Sie hatte Depeschen vom Kap gebracht und mußte in Plymouth bleiben zum Überholen von Rigg und Rahen. Das überraschte niemand, denn die Larne war ohne Pause vier Jahre im Dienst auf See gewesen – in brütender Hitze ebenso wie in kreischenden Stürmen.
Sie beobachtete Richard, und plötzlich wurde ihr klar, daß sie so etwas erwartet hatte. Irgendwie schien es kein Zufall, daß ausgerechnet jetzt James Tyacke nach England zurückgekehrt war – der tapfere, stolze Mann, den die arabischen Sklavenhändler als Teufel mit dem halben Gesicht fürchteten. Ganz sicher würde er Plymouth hassen. Überall in diesem geschäftigen Hafen würden ihn gnadenlose und entsetzte Blicke verfolgen, sobald er seine schrecklichen Narben sehen ließ.
Adam bestätigte, daß Tyacke seinen ersten Offizier mit den Depeschen nach London geschickt hatte. Dabei war es üblich, daß ein Kapitän höchst persönlich der Admiralität seine Aufwartung machte.
Catherine sah eine flackernde Kerze auf einem Tisch, dort, wo die Treppe ins Halbdunkel führte. Als sie die beiden nach oben kommen hörte, war sie wohl wieder eingeschlafen. Als sie im Bett nach ihrem Mann tastete, faßte sie ins Leere.
Sie zitterte, als fühle sie sich beobachtet. Sie sah zum nächsten Bild. Es zeigte Konteradmiral Denziel Bolitho, der Richard mehr ähnelte als jeder andere. Er war sein Großvater und hatte dieselben Augen, das gleiche rabenschwarze Haar. Denziel war außerdem ein weiterer Bolitho, der es bis zum Flaggoffizier gebracht hatte. Richard hatte sie jetzt alle überflügelt. Er war – nach Nelsons Tod – der jüngste Vizeadmiral auf der Liste der Marine. Sie zitterte wieder, aber nicht wegen der kalten Nachtluft. Richard hatte ihr gesagt, er würde ihretwegen all das aufgeben.
Richard hatte oft von seinem Großvater berichtet, doch dabei zugegeben, daß er sich nicht recht an ihn erinnern könne. Er bezog seine Erinnerungen aus Berichten seines Vaters, Kapitän James, und natürlich aus dem Porträt selber. Das Bild zeigte Denziel, der vor Quebec neben Wolfe kämpfte. Im Hintergrund stieg Schlachtenrauch empor. Der Porträtmaler hatte den Mann hinter der Uniform gut getroffen. Augen und Mund schienen zu lächeln. Hatte auch er eine Geliebte gehabt wie sein Enkel?
Jetzt, als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte Catherine ein Glimmen im Kamin ausmachen und entdeckte dann auch Bolitho. Er saß auf dem Teppich, stützte sich mit einem Arm auf einen Stuhl, den Stuhl, in dem sein Vater zu sitzen pflegte, wenn er ihm etwas vorlas. Es sah aus, als wage er nicht, nach draußen zu blicken, um nicht an die nahe See erinnert zu werden. Sie wartete, wartete auf den nächsten Bolitho. Ein Brandyglas stand neben dem Kamin, fing die verlöschende Glut wie ein Vergrößerungsglas ein.
Bolitho öffnete die Augen und sah sie an. Er wollte sich erheben, doch sie schlüpfte neben ihn und stocherte in der Glut, bis wieder kräftige Flammen loderten.
Bolitho zog seinen Mantel aus und warf ihn ihr über die Schultern. »Entschuldige, Kate, ich bin eingeschlafen. Ich ahnte ja nicht …«
Sie legte ihm zwei Finger auf die Lippen. »Das macht doch nichts. Ich bin froh, daß ich wach wurde.«
Sie sah sein scharfes Profil vor dem Fenster und konnte seine Gedanken lesen. Sie hatten schon so oft hier gesessen, in Gespräche vertieft, sich gegenseitig zuhörend! Er verlor niemals die Geduld, auch nicht, als sie mit ihm den Kauf der Kohlenbrigg Maria José besprach. Jeder andere Mann, jeder Seemann hätte den Kauf für Unsinn gehalten. Bolitho hatte nur geantwortet: »Warten wir ab, bis die Saison beginnt. Es ist ein gewagtes Unternehmen, aber selbst wenn es schiefgeht, gewinnt unser Schiff an Wert.« Er sprach immer von uns. Selbst wenn sie getrennt waren, blieben sie so immer zusammen.
Plötzlich sagte er: »Adam hat mir alles erzählt!«
Sie wartete, fühlte seinen Schmerz, doch sie schwieg.
Bolitho fuhr fort: »Das zerreißt ihn innerlich, auch weil er ahnt, was er mir damit antut.«
»Ist es so schlimm?«
Er legte seinen Arm fester um ihre Schultern. »Wie kann ich ihn zurechtweisen? Ich habe dich einem anderen Mann weggenommen wie einst auch Cheney.« Er sah sie an, war überrascht, diesen Namen wieder aus dem eigenen Mund zu hören. »Er wollte uns sofort verlassen. Aber in seinem Zustand hätte er sich auf den verdammten Landstraßen umgebracht.«
»Ich kam freiwillig zu dir. Ich habe dich damals geliebt, ich liebe dich jetzt. Wenn ich etwas bereue, dann die Jahre, in denen ich dich noch nicht kannte.«
Er blickte in die Flammen. »Das geschah alles erst, als die Golden Plover vermißt gemeldet war. Zenoria war hier und wachte wie du mitten in der Nacht auf. Adam verhielt sich wie ein Junge, weinte herzzerreißend, weil er glaubte, du und ich wären ertrunken. Auch Val schien tot zu sein.« Er schüttelte den Kopf. »Das verdammte Schiff steht für eine ganze Menge Schlimmes.«
»Aber wir waren zusammen, Liebster!«
»Ich weiß, daran denke ich ja auch gern und oft.«
Sie fragte: »Hat er dir alles erzählt?«
Bolitho nickte zögernd. »Sie mochten sich, liebten sich vielleicht sogar. Als dann bekannt wurde, daß die Larne uns gefunden und wir alle am Leben waren, war schon alles geschehen. Ich weiß nicht, was Zenoria denkt – sie hat einen guten Ehemann und jetzt ein Kind. Es mußte einfach so kommen, es war weder Verrücktheit noch Betrug.« Er schaute ihr ins Gesicht, streichelte sanft ihr Haar. »Aber Adam liebt sie immer noch. Er muß dieses Geheimnis bewahren – und sie ebenfalls.«
»Ich bin so froh, daß er es dir berichtet hat. Du bedeutest ihm so viel, mehr als alle anderen Menschen.«
»Da gibt es einen Brief!«
Sie spürte Spannung, als er fortfuhr. »Aus Verzweiflung schrieb er ihr – irgendwann im letzten Jahr. Das wird die Probe sein. Wir müssen abwarten und hoffen.«
Catherine hob das Glas. Sie sah, wie er ihr beim Trinken des Cognacs zuschaute. »Was hast du aus London Neues erfahren, Richard?«
Er schien erleichtert, als sie das Thema wechselte. »Ihre Lordschaften sind offenbar davon angetan und bedenken meine Vorschläge.«
Sie nahm einen zweiten kleinen Schluck und fühlte den Cognac auf ihren Lippen brennen. Das war sicher noch nicht alles.
»Sir James Hamett-Parker gibt es nicht mehr, oder?«
Er nickte. »Er ist spurlos verschwunden. Seinen Platz hat ein anderer eingenommen, Admiral Sir Graham Bethune. Ein guter Mann.«
Sie sah ihn an. »Du hast oft gesagt, die Navy ist wie eine große Familie. Aber den Namen hast du noch nie erwähnt!«
»Ich kenne ihn seit langem, aber ich habe ihn aus den Augen verloren. Er ist viel jünger als Hamett-Parker, und das kann uns allen nur nützen!«
»Jünger als du?« fragte sie.
»Er war erst Midshipman, als ich mein erstes Kommando auf der Sparrow antrat, ja, so war es.« Er schien über ihre Frage nachzudenken. »Ja, er ist jünger. Etwa vier Jahre, nehme ich an.« Er sah sie unbewegt an. Bei hellerem Licht, dachte sie, würde er aussehen wie Adam, wenn er stolz und überheblich von seiner Anemone sprach. »Ich war erst 22 Jahre alt, als ich das Kommando antrat. Das war damals auch in Antigua.«
»Es scheint mir irgendwie nicht richtig, daß er dir jetzt Befehle geben kann.«
Er lächelte. »Mein Tiger wieder mal! Die Navy hat ihre eigenen Gesetze. Glück, Schicksal, Beziehungen – das alles spielt bei Beförderungen auch eine Rolle, nicht nur das Können. Vergiß nicht, daß Nelson vor Trafalgar zehn Jahre jünger als Collingwood war – und sie trotzdem gute Freunde blieben.«
Er nahm ihre Hände, und sie standen auf.
»Ins Bett oder mein Mädchen wird mich morgen früh beschimpfen!»
Sie sah auf den dicken Teppich vor dem Kamin. Hier mußte es geschehen sein. Sie konnte sich Adams Gefühle leicht vorstellen, als er diesen Raum wieder betrat.
Leise antwortete sie: »Nicht dein Mädchen, Richard, Liebling. Eine Frau, eine Frau mit all ihren Leidenschaften. Und mit all ihrem Haß, wenn es sein muß.«
Arm in Arm gingen sie zur Treppe. Die einsame Kerze war erloschen, und der grauäugige Konteradmiral war in der Dunkelheit unsichtbar.
Sie hielten inne und lauschten den nächtlichen Geräuschen des großen Hauses, leisem Knarren, Lebenszeichen.
»Sie wollen mir ein neues Kommando geben, ein neues Flaggschiff. Wir beide werden uns in London wiedersehen. Doch zuerst muß ich nach Plymouth fahren.«
Sie sah ihn an, wieder überrascht von seiner Fähigkeit, an so viele Dinge gleichzeitig zu denken.
»Ich möchte dich mit all dem nicht behelligen, Kate, oder gar irgend jemand anders hineinziehen.«
»Du wirst doch James Tyacke treffen?«
»Ja. Aber dich verlassen? Jetzt zählt jede Stunde doppelt.«
Sie erinnerte sich an Tyacke, als stünde er im gleichen Zimmer. Er wäre ein gutaussehender Mann ohne die schreckliche Verletzung. Als ob eine Bestie ihm das halbe Gesicht weggerissen hatte. Sie erinnerte sich, wie die Larne sich ihnen damals näherte, nachdem sie soviel Leiden und Tod gesehen hatten. Und sie dachte auch an das gelbe Kleid, das Tyacke ihr angeboten hatte, um sie vor weiterem Sonnenbrand zu schützen. Er hielt es in seiner Seekiste gestaut als Geschenk für das Mädchen, das ihn nach seiner Verwundung zurückgewiesen hatte. Tyacke verdiente gewiß eine bessere Frau als jene.
»Ich möchte, daß er mein Flaggkapitän wird«, sagte Bolitho nur.
»Das wird er niemals annehmen. Und ich weiß auch nicht, ob er es sollte«, antwortete sie.
Bolitho führte sie zu den letzten Stufen. »Das ist das Grausame, Kate. Ich brauche ihn, ohne ihn bin ich verloren.«
Später, als sie in dem großen Himmelbett lagen, dachte sie an seine Worte zurück.
Und an das, was er nicht gesagt hatte. An sein beeinträchtigtes Sehvermögen. Was sollte geschehen, wenn auch das andere Auge verletzt würde? Er brauchte einen Kapitän, auf den er sich ganz und gar verlassen konnte. Kein Wunder also, daß Richard Tyacke allein sprechen wollte. Tyacke durfte keinen Augenblick annehmen, Bolitho nutze Catherines Gegenwart, um ihn zu überreden, die Beförderung anzunehmen und all das, was mit ihr verbunden war. Und auch das, was sie von ihm forderte.
Sie preßte sich gegen Richard und murmelte: »Ich werde auf dich warten, Liebster, was immer du tust!«
Gleich darauf hörte sie einen Hahn krähen und wußte, daß sie nicht träumte.
II Mehr als Treue
Die kleine unauffällige Kutsche hielt nur kurz am Werfttor. An ihren Fenstern und Türen klebte der Schmutz der zerfurchten Straßen. Die Insassen zeigten ihre Papiere. Als die Räder über das Kopfsteinpflaster ratterten, starrte der junge Leutnant der Seesoldaten ihnen immer noch mit offenem Mund nach. Jedenfalls nahm Bolitho das an.
Er versuchte, seinem Flaggleutnant zuzulächeln, doch das geschah eher halbherzig. Zwar war er nicht offiziell nach Plymouth gekommen, doch sein Aufenthalt hier würde nicht lange verborgen bleiben. Der Seesoldat eilte sicher schon zum Hafenadmiral. Sir Richard ist hier, Sir!
Bolitho hielt sich am Haltegurt fest und sah nach draußen auf die geschäftige Werft, ignorierte Averys neugierige Blicke. Von allen britischen Häfen war Plymouth ihm am vertrautesten. Hier hatte er sich von Catherine getrennt, als es nach Mauritius ging. Avery hatte ihn auf diesem ersten gemeinsamen Kommando begleitet. Der hatte sich sehr bedeckt gehalten, versuchte sich neu zu orientieren nach allem, was ihm im Zusammenhang mit der Kriegsgerichtsverhandlung geschehen war. Fast schien er seinem eigenen Urteil nicht mehr zu glauben. Wie hatte er sich doch verändert! Vielleicht hatten sie beide sich verändert.
»Wir gehen den restlichen Weg zu Fuß!«
Avery klopfte an die Kutschendecke, worauf die Pferde scharf gezügelt wurden und der Wagen hielt.
Bolitho trat nach draußen und spürte den scharfen Wind im Gesicht. Die sanft geschwungenen Hügel hinter dem Tamar zeigten schon kräftiges Grün. Der Tamar – nur ein Fluß. Und doch trennte er ihn von seiner Heimat Cornwall. Das Wasser war dunkel und modrig, kein Wunder nach den ausgedehnten Regenfällen.
»Da drüben liegt sie!« Er fragte sich, ob Avery sein langes Schweigen während der ungemütlichen langen Reise aufgefallen war. Möglicherweise war er auch mißgestimmt. Denn jetzt, da er als sein Adjutant zurückgekehrt war, hatte er wahrscheinlich alle Chancen einer Beförderung oder eines eigenen Kommandos verspielt.
Bolitho sah ihn an, sah das starke, intelligente Profil und sagte: »Ich bin wirklich ein schlechter Reisegefährte. Aber hier hat für mich so viel begonnen und geendet!«
Avery nickte. Auch er dachte zurück. Er hatte bei seinem letzten Besuch beobachtet, wie Bolitho sich vor dem Golden Lion von der schönen Catherine verabschiedete. Er erinnerte sich an seine Gefühle, als am Fockmasttopp Bolithos Flagge auswehte. Ihm erschien es wie eine Wiedergeburt. Die Marine hatte ihn wieder aufgenommen, nachdem sie ihn bisher zurückzuweisen schien.
Bolitho schritt jetzt in gleichem Tempo neben ihm her. Ihre langen Bootsmäntel verbargen Uniform und Rang vor den forschenden Blicken der vielen, die an Bord der zahlreichen Schiffe Reparaturen ausführten.
Avery erinnerte sich sehr genau, als sie einmal in derselben Werft an einem anderen Dock gehalten hatten. Bolitho hatte ihm von seiner alten Hyperion berichtet, die mit ihren 74 Kanonen hier gelegen hatte – praktisch ein Wrack nach dem Kampf, der wohl der schwerste ihres ganzen Seelebens gewesen war. Doch die Hyperion lebte weiter, war zur Legende geworden. In Liedern, die in allen Kneipen gesungen wurden, erinnerte man sich an sie. Es waren Lieder über ihr letztes Gefecht, als sie mit Bolithos wehender Flagge gesunken war. Vielleicht wehte die Flagge in den Tiefen der See immer noch über den Männern, die dort, wo sie gefallen waren, als Schatten weiterlebten. Ganz lebendig waren Schiff und Mannschaft in Bolithos Erinnerungen und in der von John Allday. Sie waren dabeigewesen. Und sie würden das nie vergessen.
Bolitho hielt an und sah sich die Brigg Larne mit ihren 14 Kanonen genauer an. Wie klein sie schien, viel zu klein für die großen Meere. Doch als Tyacke gegen alle Vernunft und Erfahrung auf der Suche nach dem Boot der Golden Plover bestanden hatte, da war die Larne wie ein Gigant aus der Gischt aufgetaucht.
Bolitho sah jetzt auch den Posten der Seesoldaten auf dem Steg. Er hatte dafür zu sorgen, daß niemand desertierte, daß selbst Männer, die Monate oder gar Jahre lang nicht zu Hause gewesen waren, das Schiff nicht verließen. So etwas beleidigte einen Kommandanten James Tyacke, der niemals ein »desertiert« neben den Namen eines Mannes auf der Besatzungliste hatte schreiben müssen.
Bolitho sagte: »Sie wissen, was Sie zu tun haben!« Er sprach schärfer als beabsichtigt, aber das fiel Avery kaum auf.
Avery fühlte in der Tasche die Befehle, die Bolitho seinem Sekretär Yovell diktiert hatte. Auch sie erschienen wie ein Geheimnis, so als sei Bolitho sich noch immer nicht über seine Absichten im klaren. Vielleicht war er wirklich unsicher.
Avery sah ihn an. Unsicher? Nein, nach all dem, was hinter ihm lag, ganz bestimmt nicht.
»Sorgen Sie bitte dafür, daß wir morgen sehr früh aufbrechen können. Wir werden hier übernachten«, sagte Bolitho.
»Im Golden Lion, Sir Richard?«
Bolitho musterte ihn mit grauen Augen, Augen in der Farbe des Plymouth Sound, und er fürchtete, ihm zu nahe getreten zu sein.
»Ich dachte nur …«
Überraschenderweise lächelte Bolitho und griff nach seinem Arm unter dem regennassen Mantel.
»Ich weiß. Ich bin heute nicht ganz bei der Sache.« Er sah zur Stadt hinüber. »Ich denke, wir suchen diesmal ein anderes Gasthaus.«
Plötzlich mußte er an Catherine denken. Wie sie sich umarmt hatten, ehe er nach Plymouth aufgebrochen war. Sie war jetzt unterwegs nach London zu ihrem Haus in Chelsea. Sie hatte ihr London mit ihm geteilt. Und solche Erinnerungen waren das einzige, was ihnen blieb, wenn er wieder auf See ging.
Er hatte sich selten so gefühlt wie heute. Jeder Tag erschien ihm wie eine helle Morgendämmerung, und obwohl sie wußten, daß sie sich wieder trennen mußten, fiel es ihm schwer, sich das vorzustellen.
Er sah jetzt Avery zur wartenden Kutsche zurückgehen. Seine schiefe Schulter, die Art, wie er sich mit der Verletzung hielt, bewegte ihn tief. Was sind das für Männer, Kate? Ganz England sollte solche stolzen Söhne sehen. Und über der frischen Brise, die an den Fallen und am halbfertigen Rigg rüttelte, hörte er in der Erinnerung ihre Stimme: Verlaß mich nicht.
Rufe waren zu hören, und nervös beobachtete ihn der Posten. Ein kräftiger Kerl in Leutnantsuniform ohne Hut erschien an Deck, schob Seeleute und Werftarbeiter einfach zur Seite und brüllte: »Antreten zur Begrüßung, ihr verdammten Kerle. Warum hat mir das keiner gesagt?«
Bolitho machte den ersten Schritt auf die Gangway und hob den Hut Richtung kleines Achterdeck.
»Es ist schön, Sie wiederzusehen, Mister Ozanne! Und gut bei Stimme sind Sie auch noch!« Dann warf er eine Falte seines Mantels über seine Schulter, und eine Epaulette mit zwei glänzenden silbernen Sternen wurde sichtbar.
Die Werftarbeiter staunten mit offenem Mund. Einige Seeleute jubelten. Es schien, als träfen sich alte Freunde.
Ozanne stammte von den Kanalinseln, kam aus der Handelsschiffahrt. Er war ein hervorragender Offizier, trotz seines bäuerlichen Auftretens. Doch er war nicht nur zu alt für seinen Rang, nein, er war auch noch fünf Jahre älter als sein Kommandant.
Bolitho schüttelte ihm die Hand. »Wie gefiel Ihnen London?«
Ozanne strahlte, doch sein Blick blieb betrübt. »Fast vergessen, Sir Richard! Kapitän Adam war hier. Die Anemone liegt da drüben.« Dann dachte er noch einmal über die Frage nach. »London gefiel mir nicht sehr. Aber die waren ganz froh, daß ich die Depeschen brachte.« Er schüttelte seinen gewaltigen Kopf. »Rennen die immer wie aufgescheuchte Hühner durch die Admiralität, Sir Richard?«
Bolitho lächelte. Die Familie. »Das ist da wohl so gang und gäbe, höre ich.« Dann wurde er ernst. »Ist der Kommandant an Bord?«
»Ich werde ihn rufen …«
»Nicht nötig, Mr. Ozanne. Ich kenne mich hier aus.« Bolitho ahnte, daß James Tyacke wußte, daß er an Bord gekommen war. Er musterte den schlanken Schiffskörper und die schwarzen Kanonenrohre. Über die gelbbraunen Lafetten war Leinwand gezurrt, als sollten sie vor den unwürdigen Reparaturarbeiten geschützt werden. Larne, James Tyackes Schiff. Unter meinem Kommando. Er stieg den Niedergang hinunter, und zog, auf dem Weg zur Heckkajüte, den Kopf vor den niedrigen Decksbalken ein.
Es roch hier wie immer, auch die Werft konnte den Geruch des Schiffs nicht überlagern. Farbe, Teer, Hanf und stickige Nässe. Und doch war sie keine so strapazierte Brigg wie jede andere. Tyacke hatte sie zu einem Schiff gemacht, auf das er stolz sein konnte. Der Teufel mit dem halben Gesicht.
Würde er jetzt wieder ganz von vorn anfangen? Konnte man ihn überhaupt darum bitten?
Tyacke stand vor den hellen schrägen Heckfenstern. Er stand mit gebeugten Schultern zwischen den niedrigen Balken der kleinen Kajüte, die die ganze Breite des Hecks ausfüllte. Sein Gesicht lag im Schatten.
»Willkommen an Bord, Sir!« sagte er. Er griff nach seiner Uniformjacke mit der einzelnen Epaulette auf der linken Schulter.
Aber Bolitho unterbrach ihn. »Ich komme ohne Einladung.« Er ließ seinen Bootsmantel einfach fallen und hängte die schwere Jacke seiner Ausgehuniform über einen Stuhl. »Lassen Sie uns bitte mal von Mann zu Mann reden!«
Tyacke öffnete einen Schrank, nahm eine Flasche und zwei Gläser heraus.
»Stammt von einem Schmuggler, Sir. Scheint ganz gut zu sein!«
Als er sich umdrehte, fiel das vom Wasser reflektierte Licht auf seine linke Gesichtshälfte. Sie war ausgeprägt wie die von Avery, mit tiefen Krähenfüßen um die Augen, Spuren all der Jahre auf so vielen Ozeanen.
Die andere Seite des Gesichts war so verbrannt, daß sie kaum noch menschlich aussah. Nur das Auge war unverletzt, strahlte blau wie die Augen von Herrick. Selbst sein widerspenstiges Haar war nicht davongekommen. Früher war es schwarz wie Bolithos gewesen, doch jetzt zeigten sich schon graue Strähnen. Über den Brandnarben war sein Haar nun schlohweiß, genau wie Bolithos verhaßte Locke, die seine Stirnnarbe bedeckte.
Passiert war das auf der Majestic während der Schlacht von Abukir, wie man sie jetzt nannte. Tyacke kommandierte das unterste Kanonendeck. Um ihn herum explodierte plötzlich die brennende Hölle. Er hatte nie herausgefunden, was die Explosion verursacht hatte, denn die Mannschaften waren sofort tot gewesen. Auch Westcott, Kommandant der Majestic, war an diesem schrecklichen Tag gefallen.
Der Cognac war stark und feurig. Sie stießen mit den Gläsern an, und Tyacke sagte: »Ein Gegner, der den Kampf aufnimmt, und genügend Raum auf See, Sir, mehr verlange ich nicht!«
Es war schon seltsam, den altvertrauten Trinkspruch hier in der Werft zu hören. Man hörte, nur ein paar Zoll höher, Arbeiter über das Achterdeck schlurfen. Viele Längen Tau wurden über das Deck gezogen, um dann zu den Riggern in Masten und Rahen gehievt zu werden.
Tyacke sah ihn ruhig an. Dann fragte er entschlossen: »Sie werden mir mein Schiff abnehmen, Sir, nicht wahr?« Die Frage schien körperlichen Mut zu verlangen.
Es hörte sich leicht an – und brach doch sein Herz. Er drehte jetzt sein Gesicht in den spärlichen Schatten, als wolle er unbedingt das Licht, das durch das Skylight fiel, vermeiden. So viel war auf diesem Schiff geschehen. So viele Entscheidungen, für manchen vielleicht sogar zu viele. Sie hatten oft mutterseelenallein gegen die gewaltige See angekämpft. Aber dieser Mann hatte nie aufgegeben.
Bolitho sagte: »Ich habe erfahren, daß die Larne auf ihr Kommando vor Afrika zurückkehren wird, um dort wieder Sklavenschiffe aufzubringen – bald wieder. Ich habe auch erfahren, daß niemand aus Ihrer Mannschaft auf ein anderes Schiff versetzt wird. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das schriftlich vom Hafenadmiral geben.«
Tyacke starrte auf seine große Seekiste. »Das würde ich gern schriftlich haben, Sir. Ich habe noch nie einem Hafenadmiral getraut.« Er blickte hoch, schien einen Augenblick verwirrt. »Das ist dumm ausgedrückt, Sir, tut mir leid.«
»Ich war auch einmal Kommandant einer Fregatte.« Seltsam, daß der Satz selbst nach den vielen Jahren noch schmerzte. Auch einmal Kommandant einer Fregatte. »Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie man mir ständig gute Leute wegnahm und sie durch Galgenvögel ersetzte.«
Tyacke füllte Cognac nach und wartete.
»Ich habe kein Recht, Sie zu fragen, aber …«, begann Bolitho. Er unterbrach sich, weil etwas Schweres oben an Deck umgestürzt war. Er hörte Ozanne sofort laut fluchen und danach lachen. An Bord eines königlichen Schiffs wurde selten gelacht. Wie kann ich ihn bloß fragen?
Tyacke war vor dem Fenster nur als Silhouette erkennbar.
»Natürlich haben Sie das, Sir.« Er lehnte sich so weit vor, daß sein Gesicht im Sonnenlicht lag. »Der Dienstrang spielt doch dabei keine Rolle.«
»Nein, in der Tat nicht«, antwortete Bolitho. »Wir haben zuviel zusammen erlebt. Und seit Sie uns damals auf dem Meer vor Afrika gefunden haben, stehe ich tief in Ihrer Schuld.«
Er hörte sich leise sagen. »Ich möchte, daß Sie eine Beförderung annehmen …« Er zögerte. »Werden Sie mein Flaggkapitän. Ich will keinen anderen haben.« Sag ihm, wie du ihn brauchst. Die Worte schienen in der Luft zu hängen. »Ich kam nur, um Sie darum zu bitten.«
Tyacke starrte ihn an. »Es gibt keinen, unter dem ich lieber dienen würde, Sir. Aber …« Er schien seinen Kopf zu schütteln. »Ja, so ist es wirklich, Sir. Ohne Ihr Vertrauen in mich wäre ich längst in Selbstmitleid verfallen. Aber ohne die Freiheit dieses Schiffes, ohne die Larne … Sie verlangen zuviel von mir, Sir.«
Bolitho griff nach seiner Jacke. Avery würde oben auf ihn warten. Wenn er sich einmischte, würde er ihn nur verletzen.
Er erhob sich und streckte seine Hand aus. »Ich werde zum Hafenadmiral fahren.« Er sah ihm gerade in die Augen und wußte, er würde diesen Augenblick nie vergessen. »Sie sind mein Freund und der von Lady Catherine Somervell – und dabei wird es immer bleiben. Ich werde darum bitten, daß Ihre Mannschaft Wache um Wache an Land gehen kann.«
Er fühlte die Härte des Handschlags, hörte die Bewegung in Tyackes Worten. Und dann war der Augenblick vorbei.
Leutnant George Avery kletterte aus der Kutsche. Er fühlte feinen Regen an den Laternen vorbei in sein Gesicht wehen.
»Warte hier, es dauert nur einen Augenblick. Dann kannst du uns zum Boar’s Head fahren.«
Es hatte alles länger gedauert als erwartet, oder war es nur früher dunkel geworden als sonst? Er zog den Hut tiefer in die Stirn und stellte den Kragen seines Bootsmantels hoch. Er spürte Leere im Magen und erinnerte sich, außer ein paar hastigen Bissen in einem Gasthof am Weg, den ganzen Tag noch nichts gegessen zu haben.
Auf dem Wasser des Hamoaze hinter den Docks flackerten bereits Ankerlichter wie Glühwürmchen. Dunkle Schatten von kleinen Booten, Offiziere kamen und verließen die Schiffe, Wachboote wurden rundum gerudert – das war das nie ruhende Leben in einem Kriegshafen.
Hier an der Mauer brannten Lampen vor Gangways und Relingspforten. Wer Hafengelände nicht gewöhnt war oder zuviel getrunken hatte, der konnte sonst leicht über einen Festmacherring stolpern oder über Material, das Werftarbeiter hatten liegenlassen. Ein Sturz ins Wasser wäre die Folge.
Er sah die nackten Masten der Brigg. In der auflaufenden Flut schienen sie höher als sonst. Männer an der Relingspforte: Er erkannte an den weißen Aufschlägen den Mantel eines Leutnants. Wahrscheinlich war die Seesoldatenwache angetreten, um den Vizeadmiral zu verabschieden.
Er fragte sich, was wohl an Bord besprochen worden war. Vielleicht war es nur um alte Zeiten gegangen. Armer Allday. Der war sicher außer sich über diese Reise, bei der er nicht seinen gewohnten Platz einnahm.
Avery erkannte in dem kräftigen Offizier Paul Ozanne, Larnes Ersten Offizier.
»Ich wurde aufgehalten, Mister Ozanne. Ich hoffe, Sir Richard ist nicht zu ungehalten!«
Ozanne nahm seinen Arm und führte ihn nach achtern. Er blickte durch das Skylight nach unten in die Kajüte. In der Dunkelheit brannte eine einsame Kerze.
»Sir Richard ist längst von Bord!« sagte er geradeheraus. »Wir sollen Ihnen ausrichten, er erwartet Sie im Haus des Hafenadmirals.«
Avery richtete sich auf. Irgend etwas war schiefgelaufen. Und zwar sehr schief. Sonst wäre …
»Was ist passiert?« Ozanne müßte es wissen. Besser als jeder andere verstand er seinen Kommandanten, der auch noch sein Freund war.
»Er ist allein da unten und trinkt. Und zwar schlimmer denn je. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das macht mich sehr unruhig.«
Avery erinnerte sich an Bolithos Gesichtsausdruck, als er an Bord geklettert war. Ängstlich, fast mutlos – ganz anders, als er ihn von zu Hause in Falmouth oder von See her kannte.
»Soll ich mal mit ihm reden?« Er erwartete eigentlich ein entschiedenes Nein.
Doch statt dessen sagte Ozanne nur rauh: »Das wäre gut. Aber passen Sie auf sich auf. Es könnte Ihnen kräftig entgegenwehen.«
Avery nickte. Er hatte verstanden. Allday hatte diesen Ausdruck schon einmal warnend gebraucht.
Unter Deck war es so dunkel, daß er fast gestürzt wäre. Die Larne war eng und klein im Vergleich zu einer Fregatte, und ganz besonders im Vergleich zur alten Campus, auf der er gedient hatte, als Sillitoe ihm die Möglichkeit einer Beförderung zum Flaggleutnant mitgeteilt hatte.
»Wer ist da draußen? Beweg dich nur her, wenn es sein muß!«
»Avery, Sir, Flaggleutnant«, rief er laut. Dann sah er die flackernde Kerze und Tyackes entstelltes Gesicht. Er drehte sich weg, als Tyacke nach der Flasche griff.
»Er hat Sie geschickt, nicht wahr?«
Er klang verärgert, ja sogar gefährlich. Ruhig antwortete Avery: »Ich nahm an, Sir Richard sei immer noch an Bord, Sir!«
»Sie sehen ja, daß er’s nicht mehr ist. Also hauen Sie bloß ab.« Dann änderte sich seine Stimme plötzlich. »Es ist ja nicht Ihr Fehler. Es ist der Fehler von keinem. Es ist der verdammte Krieg, der uns das antut.« Er sprach eigentlich nur zu sich selbst, öffnete die Flasche wieder und ließ etwas in ein zweites Glas gurgeln. Es ging etwas daneben, doch er achtete nicht darauf. Avery roch, was es war, und dachte an seinen leeren Magen.
»Tut mir leid. Das hier ist nur Genever. Den Cognac habe ich schon erledigt.« Er machte eine vage Bewegung. »Verholen Sie da irgendwohin. Ich kann Sie von hier nicht klar erkennen.«
Avery zog den Kopf ein, um nicht an die Balken zu stoßen. Der arme Hund. Er will nicht, daß ich die andere Seite seines Gesichts sehe.