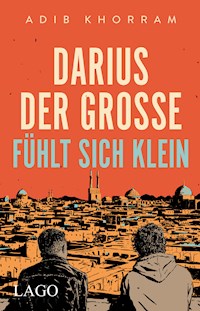
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lago
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Darius weiß mehr über die Gepflogenheiten von Hobbits als über persische Traditionen. Doch sein erster Besuch im Iran wird sein Leben verändern. Der depressive Teenager ist sich sicher, dass er dort genauso wenig dazugehören wird wie in den USA. Doch dann trifft er den Nachbarsjungen Sohrab. Von nun an verbringen sie die Tage gemeinsam, essen Faloodeh oder reden stundenlang an ihrem Rückzugsort über den Dächern von Yazd. Gemeinsam mit Sohrab lernt Darius nicht nur die persische Kultur besser kennen, sondern vor allem sich selbst. Dieses Buch ist für jeden, der sich manchmal verloren fühlt – denn man kann sich wiederfinden. Ab 14 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ADIB KHORRAM
DARIUS DER GROßEFÜHLT SICH KLEIN
ADIB KHORRAM
DARIUS DER GROßEFÜHLT SICH KLEIN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2020
© 2020 by LAGO, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 bei Dial Books, einem Imprint von Penguin Young Readers Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel Darius the Great Is Not Okay. © 2018 by Adib Khorram. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Julia Mielewski
Redaktion: Matthias Teiting
Umschlaggestaltung: Manuela Amode, dem Original nachempfunden
Umschlagabbildung: Adams Carvalho
Satz: Eka Rost, Digital Design
Druck: Livonia Print, Riga
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95761-196-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-272-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-273-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Familie. Dafür, dass der Wasserkessel nie stillsteht.
INHALT
DIE EHRWÜRDIGSTE UND ENTSETZLICHSTE ALLER KATASTROPHEN
TRUCKER-HODEN
DER BEMERKENSWERTE PICARD-HALBMOND
MOBY DER WAL
SLINGSHOT-MANÖVER
EINE PLÖTZLICHE OXIDATIONS- ODER ZERFALLSREAKTION
MATERIE-ANTIMATERIE-REAKTION
OLYMPUS MONS
TEMPORALE VERSCHIEBUNG
DA SIND VIER LICHTER
DER TANZENDE VENTILATOR
DIE GESCHICHTE DER IRANISCH-AMERIKANISCHEN BEZIEHUNGEN
EIN HOLODECK-BLICK
FUSSBALL/ SOCCER
DER TURBAN DES AJATOLLAH
STANDARD-ELTERNMANÖVER ALPHA
DIE DESSERT-HAUPTSTADT DER ANTIKEN WELT
DIE SÜNDEN DES VATERS
DIE KOLINAHR-DISZIPLIN
BETTE DAVIS EYES
PERSISCH LEGER
MEINE COUSINE, DER RINGGEIST
HAUPTREIHE
DER BORG UNTER DEN KRÄUTERN
DAS KHAKI-KÖNIGREICH
EIN TAKTISCHER RÜCKZUG
DIE TÜRME DES SCHWEIGENS
DIE ALTE ENTERPRISE
VATERPROBLEME
MACHEN SIE ES SO!
TSCHELO KABAB
DER VIRGO-SUPERHAUFEN
DAS ZEITALTER DER BAHRAMIS
MAGNETISCHE EINDÄMMUNG
DIE EIGENTLICHE BESTIMMUNG
DURCH EIN WURMLOCH
DIE SCHICKSALSKLÜFTE
DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN
DARIUS DER GROSSE
NACHWORT
WEBSEITEN:
DANKSAGUNG
DIE EHRWÜRDIGSTE UND ENTSETZLICHSTE ALLER KATASTROPHEN
Wasserdampf rülpste und zischte. Schweiß tröpfelte mir den Nacken hinunter.
Smaug der Schreckliche war wütend auf mich.
»Was bedeutet das, ›Filterfehler‹?«, fragte ich.
»Hier.« Herr Apatan ruckelte an dem Ende des Schlauchs, das in Smaugs schimmerndem chromschwarzem Rücken verschwand. Das blinkende rote Fehlerlicht erlosch. »Besser?«
»Ich glaube schon.«
Smaug gurgelte glücklich vor sich hin und begann wieder zu kochen.
»Gut. Hast du einen der Knöpfe gedrückt?«
»Nein«, sagte ich. »Nur, um die Temperatur zu überprüfen.«
»Du musst die Temperatur nicht überprüfen, Darius. Sie bleibt immer auf hundert Grad.«
»Okay.«
Es war völlig sinnlos, mit Charles Apatan, dem Geschäftsführer des Tea Haven im Fairview Court Einkaufszentrum, zu diskutieren. Wie viele Artikel ich ihm auch ausdruckte und mitbrachte – er weigerte sich, etwas am Bildschirm zu lesen –, Herr Apatan blieb überzeugt davon, dass jeder Tee mit kochendem Wasser aufgegossen werden musste, egal ob es sich dabei um einen robusten Yunnan oder einen weniger widerstandsfähigen Gyokuro handelte.
Nicht, dass der Tea Haven jemals derart besondere Teesorten führen würde. Alles, was wir verkauften, war mit Antioxidationsmitteln angereichert oder mit Auszügen aus Superfruits versehen oder zur Unterstützung von Schönheit und Gesundheit künstlich entwickelt worden.
Smaug, der Unbezähmbar Pedantische, war unser Wasserkocher. Ich hatte ihn in meiner ersten Arbeitswoche auf diesen Namen getauft, nachdem ich mich dreimal in einer einzigen Schicht verbrüht hatte, aber bisher verwendete im Tea Haven niemand außer mir diesen Namen.
Herr Apatan reichte mir eine leere Pumpthermoskanne. »Wir brauchen mehr Blueberry-Açai-Bliss.«
Ich schaufelte Tee aus der hellorangenen Dose in den Filterkorb, gab zwei Löffel Kandiszucker obendrauf und klemmte ihn unter dem Zapfhahn ein. Smaug, der Unangreifbar unter Druck Stehende, spuckte seinen dampfenden Inhalt in die Thermoskanne. Ich zuckte zurück, als das kochende Wasser auf meine Hände spritzte.
Smaug, die Ehrwürdigste und Entsetzlichste aller Katastrophen, hatte wieder einmal triumphiert.
Die Volksgruppe der Perser ist genetisch dazu veranlagt, Tee zu mögen. Und obwohl ich nur zur Hälfte Perser war, hatte ich die volle Ladung Tee-Liebe von der Gensequenz meiner Mom abbekommen.
»Weißt du, wie Perser Tee zubereiten?«, pflegte sie zu fragen.
»Wie?«, gab ich zurück.
»We put hell in it and we damn it«, sagte sie, und ich lachte, weil es lustig war, dass meine Mom, die nie farbenfrohe Metaphern benutzte, so tat, als würde sie fluchen.
Hel bedeutet »Kardamom« auf Farsi, was persischen Tee so köstlich macht, und dam bedeutet »ziehen lassen«.
Als ich Herr Apatan den Witz erklärte, fand er ihn absolut nicht komisch.
»Du kannst nicht einfach unsere Kunden beschimpfen, Darius«, sagte er.
»Das hatte ich auch nicht vor. Das war Farsi. Ein Witz.«
»Das kannst du nicht machen.«
Ich kannte niemanden, der alles so wörtlich nahm wie Charles Apatan.
Nachdem ich unsere strategisch platzierten Probier-Thermoskannen mit frischem Tee aufgefüllt hatte, stellte ich an jeder Station neue Plastikbecher bereit.
Ich lehnte Plastikbecher kategorisch ab. Alles schmeckt ekelhaft aus Plastik, einfach nur chemisch und fad.
Wirklich äußerst widerwärtig.
Nicht, dass das im Tea Haven irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Der Zuckergehalt in unseren Probier-Tees war so hoch, dass sogar der Geschmack der Plastikbecher überdeckt wurde. Vielleicht sogar hoch genug, um das Material der Becher aufzulösen, wenn man genug Zeit vergehen ließ.
Der Tea Haven im Fairview Court Einkaufszentrum war kein schlechter Arbeitsplatz. Kein wirklich schlechter. Gegenüber meinem letzten Job – ich war dafür da, das Schild mit dem Tagesmenü einer Pizzakette hin und her zu drehen – war es sogar eine erhebliche Verbesserung. Außerdem machte er sich gut auf meinem Lebenslauf. Nach meinem Schulabschluss würde ich nun vielleicht in einem Teefachgeschäft arbeiten können, statt in einem Laden, in dem der aktuellste Superfood-Extrakt zu allen jämmerlichen Teepartikeln hinzugefügt wurde, die der Großhändler zum höchsten Rabatt auftreiben konnte.
Mein Traumjob war Rose City Teas, dieser Laden im Nordwestteil der Stadt, der nur kleine Mengen von handverlesenen Teesorten führte. Bei Rose City Teas gab es keine künstlichen Aromastoffe. Aber man musste achtzehn Jahre alt sein, um dort arbeiten zu dürfen.
Als ich gerade die Becher in den federgespannten Spender stopfte, erschallte Trent Bolgers Hyänenlache durch die offene Ladentür.
Ich war völlig exponiert. Die gesamte Vorderseite des Tea Haven bestand aus riesigen Fenstern, die zwar getönt waren, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, aber dennoch einen umfassenden, verlockenden Blick auf die Waren (und Mitarbeiter) boten.
Ich wünschte mir im Stillen, dass die Sonne von den Fenstern reflektieren, Trent blenden und mich vor dem sicherlich unangenehmen Zusammentreffen schützen würde. Oder dass Trent einfach weiterlaufen und mich in meiner Arbeitsuniform mit dem schwarzen Hemd und der hellblauen Schürze nicht erkennen würde.
Es funktionierte nicht. Trent Bolger kam um die Ecke und hatte mich sofort in der Sensorenanalyse.
Er hielt sich am Türrahmen fest und schwang sich in den Laden, gefolgt von einem seiner Seelenlosen Lakaien der Orthodoxie, Chip Cusumano.
»Hey! D-Arsch-ius!«
Trent Bolger nannte mich nie Darius. Nicht, wenn ihm ein beleidigender Spitzname einfiel, den er stattdessen verwenden konnte.
Mom sagte immer, dass sie mich nach Darius dem Großen benannt hatte, und ich denke, bei einer solchen historischen Persönlichkeit als Namenspaten ist die Enttäuschung gewissermaßen vorprogrammiert. Ich war vieles – D-a-Loch, D-anal, D-Arsch-ius –, aber ich war sicher nicht »groß«.
Wenn überhaupt, war ich eine große Zielscheibe für Trent Bolger und seine Seelenlosen Lakaien der Orthodoxie. Wenn dein Name mit D beginnt, finden sich die sexuellen Anspielungen quasi von allein.
Wenigstens war Trents Verhalten vorhersehbar.
Wenn man es genau nahm, war das, was Trent Bolger machte, eigentlich kein Mobbing. Die Chapel Hill Highschool – in der Trent, Chip und ich in die zehnte Klasse gingen – hatte nämlich eine Null-Toleranz-Grenze gegenüber Mobbing.
Außerdem gab es eine Null-Toleranz-Grenze gegenüber Prügeleien, Plagiaten, Drogen und Alkohol.
Und da jeder an der Chapel Hill Highschool Trents Verhalten tolerierte, bedeutete das wohl, dass er niemanden mobbte.
Oder etwa nicht?
Trent und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten. Damals waren wir Freunde, so wie im Kindergarten nun mal alle befreundet sind, bevor sich die sozialpolitischen Allianzen zementieren und man, sobald man in der dritten Klasse ist, beim Daumendrücken-Spiel von seinen Klassenkameraden völlig ignoriert wird und sich fragt, ob man unsichtbar geworden ist.
Trent Bolger war nur ein Level-zwei-Sportler (höchstens Level drei). Er spielte irgendetwas mit -back im Junioren-Footballteam der Chapel Hill Highschool (Go Chargers). Sonderlich gut aussehend war er auch nicht. Trent war fast einen Kopf kleiner als ich, hatte kurz geschorenes, schwarzes Haar, eine quadratische schwarze Brille und eine stark nach oben gebogene Nasenspitze.
Trent Bolger hatte die größten Nasenlöcher, die ich je gesehen hatte.
Trotz alldem war Trent unverhältnismäßig beliebt in der zehnten Klasse der Chapel Hill Highschool.
Chip Cusumano war größer, cooler und sah besser aus. Sein Haar war lang, am Oberkopf voluminös und an den Seiten ausrasiert. Er hatte eine elegante gebogene Nase, wie man das von Statuen und Gemälden kennt, und seine Nasenlöcher waren genau richtig groß.
Außerdem war er netter als Trent (immerhin zu den meisten anderen, wenn auch nicht zu mir), was natürlich dazu führte, dass er deutlich weniger beliebt war.
Zudem war sein richtiger Name Cyprian, was noch etwas ungewöhnlicher war als Darius.
Trent Bolger hatte denselben Nachnamen wie Fredegar »Fatty« Bolger, ein Hobbit aus Der Herr der Ringe. Der Hobbit, der zu Hause im Auenland bleibt, während Frodo und seine Leute zu ihrem Abenteuer aufbrechen.
Fatty Bolger ist so ziemlich der langweiligste Hobbit, den es gibt.
Ich nannte Trent niemals in seiner Anwesenheit »Fatty«.
Es war ein Level-fünf-Desaster.
Ich hatte mir große Mühe gegeben, dass niemand an der Chapel Hill Highschool erfuhr, wo ich arbeitete, vor allem, damit es nicht bis zu Trent und seinen Seelenlosen Lakaien der Orthodoxie durchdrang.
Chip Cusumano nickte mir vom Eingang aus zu und betrachtete dann unsere farbenfrohen Teetassen mit integriertem Sieb. Trent kam direkt auf die Teestation zu, an der ich stand. Er trug graue Sportshorts und seinen Pullover des Chapel-Hill-Highschool-Wrestlingteams.
Trent und Chip betrieben im Winter beide Wrestling. Trent war im Juniorenteam, während Chip es als Einziger aus der zehnten Klasse auf die Mannschaftsliste geschafft hatte.
Chip hatte ebenfalls seinen Team-Pullover an, trug dazu aber seine üblichen schwarzen Jogginghosen, die seitlich gestreift waren und an den Knöcheln enger wurden. Außer im Sportunterricht hatte ich Chip noch nie in Sportshorts gesehen, und ich nahm an, dass er dafür denselben Grund hatte, aus dem ich sie vermied.
Das war auch schon das Einzige, was wir gemeinsam hatten.
Trent Bolger stand grinsend vor mir. Er wusste, dass ich ihm auf der Arbeit ausgeliefert war.
»Willkommen bei Tea Haven«, sagte ich, was die vorgeschriebene Begrüßung unseres Unternehmens war. »Würden Sie gern einen unserer ausgezeichneten Tees probieren?«
Genau genommen hätte ich mich auch noch zu einem Lächeln zwingen sollen, aber ich konnte keine Wunder vollbringen.
»Verkauft ihr hier auch Teebeutel?«
Am anderen Ende des Ladens schmunzelte Chip und schüttelte den Kopf.
»Äh.«
Ich wusste, was Trent vorhatte. Wir waren hier nicht in der Chapel Hill Highschool, und beim Tea Haven im Fairview Court Einkaufszentrum gab es keine Null-Toleranz-Grenze für Mobbing.
»Nein. Wir verkaufen nur Maschensiebe und biologisch abbaubare Beutel.«
»Das ist schade. Ich wette, du magst Teebeutel sehr.« Trents Grinsen zog sich über die eine Hälfte seines Gesichts. Er lächelte immer nur mit einer Gesichtshälfte. »Du scheinst mir genau der Typ zu sein, der zwei Teebeutel richtig genießen würde.«
»Ähm.«
»Du wirst sicher oft geteebeutelt, hab ich recht?«
»Ich versuche zu arbeiten, Trent«, sagte ich. Und weil ich das ungute Gefühl hatte, dass Herr Apatan irgendwo in der Nähe war und meine Kundenfreundlichkeit genau überwachte, räusperte ich mich und fragte: »Würden Sie gern unsere Orange-Blossom-Awesome-Kräuter-Mischung probieren?«
Ich weigerte mich, das Wort »Tee« zu benutzen, da nicht einmal echte Teeblätter enthalten waren.
»Wie schmeckt das?«
Ich nahm einen Probierbecher vom Stapel, füllte ihn mit einem Pumpstoß Orange Blossom Awesome und reichte ihn Trent, indem ich meine flache Handinnenseite wie eine Art Untertasse darunter hielt.
Er leerte den Becher in einem Zug. »Igitt, das schmeckt nach Orangensaft und Hodensäcken.«
Chip Cusumano lachte in eine leere Teedose hinein, die er gerade begutachtete. Es war eine unserer neuen Dosen mit Frühlingsmuster, mit Kirschblüten darauf.
»Hast du ihn richtig aufgebrüht, Darius?«, fragte Herr Apatan hinter mir.
Herr Apatan war sogar noch kleiner als Fatty Bolger, aber irgendwie schaffte er es, mehr Platz einzunehmen, als er zwischen uns trat, um selbst einen Probierbecher zu füllen.
Fatty zwinkerte mir zu. »Wir sehen uns, D-Beutel.«
D-Beutel.
Mein neuester zweideutiger Spitzname.
Es war nur eine Frage der Zeit gewesen.
Trent nickte Chip zu, der grinste und mir unschuldig zuwinkte, als wäre er nicht gerade an meiner Demütigung beteiligt gewesen. Sie rempelten einander lachend aus der Tür.
»Vielen Dank für Ihren Besuch bei Tea Haven«, sagte ich. »Beehren Sie uns bald wieder.«
Die vom Unternehmen vorgeschriebene Verabschiedung.
»Hat er dich gerade Teebeutel genannt?«, fragte Herr Apatan.
»Nein.«
»Hast du ihm von unseren Siebkörben erzählt?«
Ich nickte.
»Hmm.« Er schlürfte seinen Probiertee. »Also, der ist genau richtig. Gut gemacht, Darius.«
»Danke.«
Ich hatte nichts getan, was ein Lob verdient hätte. Jeder konnte Orange Blossom Awesome zubereiten.
Das war der Sinn und Zweck vom Tea Haven.
»War das ein Schulfreund von dir?«
Offensichtlich waren Charles Apatan die Zwischentöne meiner Interaktion mit Fatty Bolger, dem langweiligsten Hobbit der Welt, entgangen.
»Lass ihn das nächste Mal Blueberry Bliss probieren.«
»Okay.«
TRUCKER-HODEN
Die Fahrradständer des Fairview Court Einkaufszentrums lagen am hinteren Ende des Gebäudes, direkt neben einem dieser Klamottenläden, die von Seelenlosen Lakaien der Orthodoxie wie Fatty Bolger und Chip Cusumano frequentiert wurden. Einer dieser Läden, in denen sie Bilder von oberkörperfreien Typen mit Waschbrettbäuchen aushängten.
Fünf verschiedene penetrante Parfümnoten wehten mir in die Nasennebenhöhlen und begannen, dort Krieg zu führen, als ich an dem Laden vorbeiging. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, aber die Quecksilberlampen waren schon entflammt, als ich den Parkplatz erreichte. Die Luft war trocken und fast geruchlos nach all den Wochen, in denen es nicht geregnet hatte.
Seit ich im Tea Haven im Fairview Court Einkaufszentrum arbeitete, fuhr ich von der Chapel Hill Highschool aus mit dem Fahrrad dorthin. Es war einfacher, als bei meinen Eltern mitzufahren.
Aber als ich zu den Fahrradständern kam, war mein Rad nicht mehr da.
Bei eingehenderer Betrachtung stimmte das so nicht ganz – nur ein Teil meines Rades war weg. Der Rahmen war noch da, aber die Räder fehlten. Das Fahrrad war gegen den Pfosten gesackt und wurde nur noch notdürftig von meinem Schloss festgehalten.
Der Sattel fehlte ebenfalls, und wer auch immer ihn mitgenommen hatte, hatte an seiner Stelle einen blauen Knubbel hinterlassen.
Nun, es war kein blauer Knubbel. Es war ein Paar blaue Gummihoden.
Ich hatte noch nie zuvor blaue Gummihoden gesehen, aber ich wusste sofort, woher sie kamen.
Wie ich schon erwähnte, gab es im Fairview Court Einkaufszentrum keine Null-Toleranz-Grenze für Mobbing. Es gab eine in Bezug auf Diebstahl, aber das beinhaltete wohl keine Fahrradsättel.
Mein Rucksack hing schwer an meinen Schultern.
Ich musste meinen Dad anrufen.
»Darius? Ist alles okay?«
Das fragte Dad immer. Kein ›Hallo Darius‹, sondern: ›Ist alles okay?‹
»Hey. Kannst du mich von der Arbeit abholen?«
»Ist was passiert?«
Es war demütigend, meinem Vater von den blauen Gummihoden erzählen zu müssen, besonders, weil ich wusste, dass er lachen würde.
»Wirklich? Du meinst Trucker-Hoden?«
»Was sind Trucker-Hoden?«
»Die Leute stecken sie auf die Anhängerkupplung von ihren LKWs, und dann sieht es so aus, als hätte das Fahrzeug Hoden.«
Es kribbelte in meinem Nacken.
Mein Vater und ich hatten während dieses Telefonats das Wort Hoden öfter benutzt, als es in meinen Augen gesund war für jede Vater-Sohn-Beziehung.
»Alles klar, ich bin gleich da. Hast du die Goldfische besorgt?«
»Ähm.«
Dad gab ein Level-fünf-Seufzen der Enttäuschung von sich.
Meine Ohren brannten. »Ich hole sie jetzt gleich.«
»Hallo, Sohn.«
Dad stieg aus dem Auto und half mir, mein radloses, sattelloses Fahrrad in den Kofferraum seines Audis zu laden.
Stephen Kellner liebte seinen Audi.
»Hi, Dad.«
»Was ist mit den Trucker-Hoden passiert?«
»Ich habe sie weggeworfen.«
Ich brauchte kein Andenken an dieses Ereignis.
Dad drückte auf den Knopf, um den Kofferraum zu schließen, und setzte sich wieder ins Auto. Ich warf meinen Rucksack auf den Rücksitz und ließ mich in den Beifahrersitz fallen. Die Goldfische hingen in ihrem Plastikgefängnis zwischen meinen Beinen.
»Ich hätte dir fast nicht geglaubt.«
»Ich weiß.«
Er hatte dreißig Minuten gebraucht, um mich abzuholen.
Wir wohnten nur zehn Autominuten entfernt.
»Das mit deinem Rad tut mir leid. Weiß der Sicherheitsdienst, wer es war?«
Ich schnallte mich an. »Nein. Aber ich bin sicher, dass es Trent Bolger war.«
Dad legte den Gang ein und fuhr vom Parkplatz herunter.
Stephen Kellner fuhr gern viel zu schnell, weil sein Audi einiges an Pferdestärken besaß und ihm damit diese Dinge möglich waren: beschleunigen, bis er Fluchtgeschwindigkeit erreicht hatte, kräftig auf die Bremse treten, wenn es sein musste (zum Beispiel, um zu verhindern, dass er ein Kleinkind mit seinem nigelnagelneuen Stofftier im Arm überfuhr), und dann wieder beschleunigen.
Zum Glück hatte der Audi allerlei Warnlichter und Sensoren, damit Roter Alarm ausgelöst werden konnte, wenn eine Kollision bevorstand.
Dad hielt seine Augen auf die Straße gerichtet. »Wie kommst du darauf, dass es Trent war?«
Ich war mir nicht sicher, ob ich meinem Vater die ganze demütigende Geschichte erzählen wollte.
»Darius?«
Stephen Kellner ließ sich nicht so leicht abspeisen.
Ich erzählte ihm von Trent und Chip, aber nur in den gröbsten Zügen. Ich vermied es, Trents Teebeutel-Anspielungen zu erwähnen.
Ich wollte nie wieder mit Stephen Kellner über Hoden sprechen.
»Das ist alles?« Dad schüttelte den Kopf. »Wie kannst du dann wissen, dass die beiden es waren?«
Ich wusste es, weil ich es eben wusste, aber das hatte Stephen Kellner, den Advocatus Diaboli, noch nie interessiert.
»Ist egal, Dad.«
»Weißt du, wenn du mal für dich selbst einstehen würdest, würden sie dich in Ruhe lassen.«
Ich saugte an den Schnüren meines Kapuzenpullovers.
Stephen Kellner verstand überhaupt nichts von den sozialpolitischen Dynamiken an der Chapel Hill Highschool.
Als wir auf die Autobahn abbogen, sagte er: »Du brauchst mal wieder einen neuen Haarschnitt.«
Ich kratzte mich am Hinterkopf. »Sind gar nicht so lang.« Mein Haar berührte noch nicht mal meine Schultern, obwohl das zum Teil daran lag, dass es sich an den Enden lockte.
Das machte jedoch keinen Unterschied. Stephen Kellner hatte sehr kurzes, sehr glattes, sehr blondes Haar, und er hatte auch sehr blaue Augen.
Mein Vater war so ziemlich der Inbegriff des Übermenschen.
Ich hatte nichts von dem guten Aussehen meines Dads geerbt.
Okay, die Leute sagen, ich hätte seine »markante Kieferpartie«, was auch immer das bedeuten sollte. Hauptsächlich sah ich aber aus wie Mom, mit schwarzen, leicht lockigen Haaren und braunen Augen.
Standardpersisch.
Einige Leute sagen, Dad hätte arisches Aussehen, was ihm immer sehr unangenehm war. Ursprünglich hatte arisch einmal nobel bedeutet – es ist ein altes Sanskritwort, und Mom sagt, dass »Iran« sich davon ableitet –, aber heute bedeutet es etwas anders.
Manchmal dachte ich darüber nach, dass ich halb arisch und halb arisch war, aber ich glaube, das war mir auch irgendwie unangenehm.
Manchmal dachte ich darüber nach, wie seltsam es war, dass ein Wort seine Bedeutung so drastisch verändern konnte.
Manchmal dachte ich darüber nach, dass ich mich absolut nicht wie Stephen Kellners Sohn fühlte.
DER BEMERKENSWERTE PICARD-HALBMOND
Was auch immer langweilige Hobbits wie Fatty Bolger vielleicht dachten: Ich ging nicht nach Hause und aß Falafel zum Abendessen.
Zunächst einmal sind Falafel kein typisch persisches Gericht. Ihre mysteriöse Herkunft verliert sich irgendwann in einem früheren Zeitalter dieser Welt. Aber ob sie aus Ägypten oder Israel oder von ganz woanders herstammten, eines ist sicher: Falafel sind nicht persisch.
Außerdem mochte ich Falafel nicht, weil ich Bohnen kategorisch ablehnte. Außer Jelly Beans.
Ich zog mich um und setzte mich zu meiner Familie an den Esstisch. Mom hatte Spaghetti mit Fleischsauce gemacht – das womöglich unpersischste Essen aller Zeiten, auch wenn sie ein wenig Kurkuma an die Sauce gab, was dem Öl darin einen leicht orangenen Schimmer verlieh.
Mom kochte nur am Wochenende persisches Essen, weil so ziemlich jedes persische Menü eine komplizierte Angelegenheit ist, bei der mehrere Stunden Schmorzeit involviert sind, und sie hatte keine Zeit, sich einem Schmorgericht zu widmen, wenn sie gerade mit einem Level-sechs-Programmierungs-Not-fall zu tun hatte.
Mom arbeitete als UX-Designerin für eine Firma in Downtown Portland, was unglaublich cool klang. Auch wenn ich nicht wirklich verstand, was genau es eigentlich war, das Mom machte.
Dad war Partner in einem Architekturbüro, das vor allem Museen und Konzerthallen und andere »Herzstücke des urbanen Lebens« entwarf.
An den meisten Abenden aßen wir an einem runden Tisch mit Marmorplatte in einer Ecke der Küche zu Abend, alle vier in einem kleinen Kreis angeordnet: Mom gegenüber von Dad, ich gegenüber meiner kleinen Schwester Laleh, die in die zweite Klasse ging.
Während ich Spaghetti um meine Gabel wickelte, setzte Laleh zu einer detaillierten Beschreibung ihres Tages an, was einen kompletten Bericht von dem Spiel Daumendrücken beinhaltete, das sie nach dem Mittagessen gespielt hatten, und Laleh war dabei dreimal ausgewählt worden.
Sie war erst in der zweiten Klasse, hatte einen noch persischeren Namen als ich und war dennoch sehr viel beliebter als ich.
Ich begriff es einfach nicht.
»Park hat nie erraten, dass ich seinen Daumen runtergedrückt habe«, sagte Laleh. »Er rät nie richtig.«
»Das liegt vielleicht an deinem guten Pokerface«, sagte ich.
»Vielleicht.«
Ich liebte meine kleine Schwester. Wirklich.
Es war unmöglich, das nicht zu tun.
Das gehörte jedoch nicht zu den Dingen, die ich jemals jemandem sagen konnte. Zumindest nicht laut. Ich meine, es wird nicht erwartet, dass Jungen ihre kleinen Schwestern lieben. Wir können auf sie aufpassen. Wir können die Dates einschüchtern, die sie nach Hause bringen, auch wenn ich in Lalehs Fall hoffte, dass das noch ein paar Jahre dauern würde. Aber wir können nicht sagen, dass wir sie lieben. Wir können nicht zugeben, dass wir Teepartys zusammen geben oder gemeinsam mit ihren Puppen spielen, weil das unmännlich ist.
Aber ich spielte mit Laleh und ihren Puppen. Und ich gab Teepartys mit ihr (bei denen ich darauf bestand, dass wir echten Tee und keinen imaginären Tee servierten und ganz gewiss nichts vom Tea Haven). Und ich schämte mich nicht dafür.
Ich sagte es nur niemandem.
Das ist doch normal.
Stimmt’s?
Schließlich verlor Lalehs Geschichte an Fahrt, und sie begann, sich löffelweise Spaghetti in den Mund zu schaufeln. Meine Schwester schnitt sich Spaghetti immer klein, statt sie aufzuwickeln, was in meinen Augen den Sinn und Zweck von Spaghetti verfehlte.
Ich nutzte die Gesprächspause, um über den Tisch nach mehr Pasta zu greifen, aber Dad drückte mir die Salatschüssel in die Hand.
Man konnte mit Stephen Kellner nicht über diätische Fehltritte diskutieren.
»Danke«, murmelte ich.
Salat war Spaghetti auf jede erdenkliche Weise unterlegen.
Nach dem Abendessen machte Dad den Abwasch und ich trocknete das Geschirr ab, während ich darauf wartete, dass mein Wasserkocher achtzig Grad erreichte, damit ich meinen Genmaicha aufgießen konnte.
Genmaicha ist ein japanischer grüner Tee, in dem gerösteter Reis enthalten ist. Manchmal platzt der geröstete Reis wie Popcorn auf und hinterlässt fluffige kleine Wolken im Tee. Er hat eine grüne Note und schmeckt nussig und köstlich, ein wenig wie Pistazien. Er hat auch dieselbe grüngelbe Farbe wie Pistazien.
Niemand anders in meiner Familie trank Genmaicha. Niemand trank jemals irgendetwas anderes als persischen Tee. Mom und Dad rochen und nippten manchmal daran, wenn ich eine Tasse von irgendetwas gemacht hatte und sie bat zu kosten, aber das war es auch schon.
Meine Eltern wussten nicht, dass Genmaicha gerösteten Reis enthielt, vor allem, weil ich nicht wollte, dass Mom es wusste. Perser empfinden sehr leidenschaftlich, wenn es um die richtigen Einsatzbereiche von Reis geht. Kein Echter Perser würde seinen Reis jemals aufplatzen lassen.
Als wir mit dem Geschirr fertig waren, ließen Dad und ich uns zu unserer abendlichen Tradition nieder. Wir sanken Schulter an Schulter in die hellbraune Wildledercouch – es war die einzige Zeit, zu der wir so saßen –, und Dad wählte unsere nächste Folge von Star Trek: The Next Generation aus.
Jeden Abend schauten Dad und ich uns genau eine Folge Star Trek an. Wir sahen sie in der Reihenfolge der Ausstrahlung an, beginnend bei Star Trek: The Original Series, wobei die Dinge nach der fünften Staffel von The Next Generation ein wenig kompliziert wurden, da die sechste Staffel sich mit Deep Space Nine überschnitt.
Ich hatte schon lange alle Folgen jeder Staffel gesehen, sogar die Zeichentrickserie. Wahrscheinlich sogar mehr als einmal, aber ich schaute schon Star Trek mit Dad, seitdem ich klein war, und meine Erinnerung war ein wenig unscharf. Es war aber auch egal, was genau ich wie oft gesehen hatte.
Eine Folge pro Abend, an jedem Abend.
Das war unser Ding.
Es fühlte sich gut an, eine gemeinsame Sache mit Dad zu haben, bei der ich ihn einmal siebenundvierzig Minuten nur für mich hatte, und er so tun konnte, als würde er meine Gesellschaft für die Dauer einer Folge genießen.
Heute Abend sahen wir »Der Gott der Mintakaner«, eine Folge aus der dritten Staffel, in der Captain Picard von einer Prä-Warpkultur als eine Gottheit namens Der Picard verehrt wird.
Ich konnte ihren Impuls verstehen.
Ohne Zweifel war Captain Picard der beste Captain aus Star Trek. Er war klug, er liebte Tee, »Earl Grey, heiß«, und er hatte die beste Stimme überhaupt: dunkel, klangvoll und britisch.
Meine eigene Stimme war viel zu piepsig, um jemals Captain eines Raumschiffes zu werden.
Und nicht nur das – er hatte eine Glatze und schaffte es trotzdem, selbstsicher zu sein. Was gut war, weil ich Bilder von den Männern auf der Seite der Familie meiner Mom gesehen hatte, und sie alle teilten den bemerkenswerten Picard-Halbmond.
Ich kam in vielen Bereichen nicht nach Stephen Kellner, dem teutonischen Übermenschen, aber ich hoffte, dass ich so wie er volles Haar behalten würde, auch wenn meines schwarz und lockig war. Und nach Übermenschen-Standards scheinbar einen Haarschnitt benötigte.
Manchmal dachte ich darüber nach, mir die Seiten ausrasieren oder mein Haar lang wachsen zu lassen und einen Man Bun zu tragen.
Das hätte Stephen Kellner in den Wahnsinn getrieben.
Captain Picard lieferte seinen ersten Monolog der Folge ab, als plötzlich der tutende Signalton von Moms Computer durch das Haus schallte. Sie bekam einen Videoanruf. Dad pausierte die Folge und warf einen Blick in Richtung Treppe.
»Oh, oh«, sagte er. »Wir werden gerufen.« Dad lächelte mich an, und ich lächelte zurück. Dad und ich lächelten einander nie an – nicht wirklich –, aber wir waren noch in unserem magischen Siebenundvierzig-Minuten-Zeitfenster, in dem die normalen Regeln nicht galten.
Vorsichtshalber drehte Dad die Lautstärke des Fernsehers auf. Natürlich begann Mom Sekunden später, auf Farsi auf ihren Computer einzuschreien.
»Jamshid!«, rief Mom. Ich konnte sie selbst über die anschwellende Musik kurz vor der Pause hören.
Aus irgendeinem Grund schien Mom sichergehen zu wollen, dass der Klang ihrer Stimme bis in die niedrige Erdumlaufbahn zu hören war, wenn sie über den Computer telefonierte.
»Chetori toh?«, brüllte sie. Das ist Farsi für »Wie geht es dir«, aber nur, wenn man die Person, mit der man spricht, gut kennt oder älter ist als sie. Auf Farsi gibt es verschiedene Arten mit Leuten zu sprechen, abhängig vom Formalitätsgrad einer Situation und von der Beziehung, die man zu der Person hat, die man anspricht.
Die Sache mit Farsi ist, dass es eine äußerst besondere Sprache ist: besonders speziell, besonders poetisch, besonders kontextspezifisch.
Nehmen wir zum Beispiel den ältesten Bruder meiner Mutter, Jamshid.
Dâyi ist das Wort für Onkel. Aber nicht für irgendeinen, sondern für einen spezifischen Onkel: den Bruder deiner Mutter. Und es ist nicht nur das Wort für Onkel – es bezeichnet auch noch die Beziehung zwischen dir und deinem Onkel. Also konnte ich Dâyi Jamshid meinen Dâyi nennen, und er konnte mich auch so nennen, als Kosename.
Meine Farsi-Kenntnisse bestanden aus vier Hauptsäulen: (1) Familienverhältnisse; (2) Wörter für Speisen, weil Mom immer die Originalnamen der persischen Speisen benutzte, die sie kochte; (3) Tee-Wörter, weil, nun ja, ich nun mal ich bin und (4) höfliche Phrasen, die man in Fremdsprachenklassen in der Mittelstufe lernt, obwohl in keiner Mittelstufe in Portland jemals Farsi als Wahlmöglichkeit angeboten wurde.
Die Wahrheit war, dass mein Farsi unterirdisch war. Ich habe es nie wirklich gelernt, als ich aufwuchs.
»Ich hatte nicht gedacht, dass du es jemals verwenden würdest«, sagte Mom zu mir, als ich sie nach dem Grund fragte, was wenig Sinn ergab, weil Mom hier in den Staaten persische Freunde hatte, außerdem gab es noch ihre ganze Familie im Iran.
Anders als ich sprach Laleh ziemlich fließend Farsi. Als sie ein Kleinkind war, redete Mom Farsi mit ihr und wies alle ihre Freunde an, dasselbe zu tun. Laleh wuchs mit einem guten Gehör für die Sprache auf – für die uvularen Frikative und die alveolaren Triller, die ich nie richtig hinbekam.
Auch ich hatte versucht, mit Laleh Farsi zu sprechen, als sie klein war. Aber ich hatte nie ganz den Dreh rausbekommen, und Moms Freunde korrigierten mich ständig, weshalb ich nach einer Weile irgendwie aufgab. Ab diesem Punkt sprachen Dad und ich nur noch Englisch mit Laleh.
Es kam mir immer so vor, als wenn Farsi dieses besondere Ding zwischen Mom und Laleh war, so wie Star Trek für Dad und mich.
Dadurch tappten wir beide völlig im Dunkeln, wenn wir uns mit Freunden von Mom trafen. Es waren die einzigen Momente, in denen Dad und ich im selben Team waren: Wenn wir mit Farsi-Sprechenden festsaßen und nur einander zur Gesellschaft hatten. Und sogar dann standen wir am Ende noch mit einem unangenehmen Level-sieben-Schweigen herum.
Stephen Kellner und ich waren Experten für Hochgradig Unangenehmes Schweigen.
Laleh warf sich auf der anderen Seite von Dad auf die Couch und zog ihre Füße unter sich, wobei sie das Gravitationsfeld auf der Couch durcheinanderbrachte und Dad sich weg von mir und ihr entgegen lehnte. Dad drückte auf Pause. Laleh sah sich nie Star Trek mit uns an. Das war Dads und mein Ding.
»Was gibt’s, Laleh?«, fragte Dad.
»Mom redet mit Dâyi Jamshid«, sagte sie. »Er ist gerade bei Mamu und Babu im Haus.«
Mamu und Babu waren Moms Eltern. Ihre richtigen Namen waren Fariba und Ardeshir, aber wir nannten sie immer Mamu und Babu.
Mamu und Babu bedeutet Mutter und Vater in Dari, dem Dialekt, den meine Großeltern sprachen, da sie als Zoroastrier in Yazd aufgewachsen waren.
»Stephen! Laleh! Darius!«, hörten wir Moms Stimme aus dem Obergeschoss.
»Kommt Hallo sagen!«
Laleh sprang von der Couch und rannte wieder nach oben.
Ich sah Dad an, der mit den Schultern zuckte, und wir folgten meiner Schwester nach oben ins Büro.
MOBY DER WAL
Meine Großmutter prangte auf dem Bildschirm, mit winzigem Kopf und riesigem Oberkörper.
Ich kannte meine Großeltern bislang nur aus der Perspektive mit gutem Naseneinblick.
Sie sprach in Schnellfeuer-Farsi mit Laleh, und ich nahm an, dass es um die Schule ging, weil Laleh vom Farsi ins Englische sprang, um Wörter wie Cafeteria und Daumendrücken zu benutzen.
Mamus Bild bewegte sich und erstarrte abwechselnd, und gelegentlich verwandelte es sich in klobige Blöcke, wenn die Bandbreite schwankte.
Es war wie eine verstümmelte Übertragung von einem Raumschiff in Not.
»Maman«, sagte Mom, »Darius und Stephen wollen Hallo sagen.«
Maman ist ein weiteres Wort auf Farsi, das sowohl eine Person als auch eine Beziehung bezeichnet – in diesem Fall Mutter. Aber es konnte auch Großmutter bedeuten, auch wenn das eigentlich Maman-Bozorg hieß.
Ich war ziemlich sicher, dass maman aus dem Französischen kam, aber Mom hat das weder bestätigt noch dementiert.
Dad und ich knieten auf dem Boden, um unsere Gesichter auch noch in das Kamerabild zu quetschen, während Laleh auf Moms Schoß auf dem Bürodrehstuhl saß.
»Eh! Hallo Maman! Hallo Stephen! Wie geht es euch?«
»Hallo Mamu«, sagte Dad.
»Hallo«, sagte ich.
»Ich vermisse dich, Maman. Wie läuft es in der Schule? Wie ist es auf der Arbeit?«
»Ähm.« Ich wusste nie, was ich mit Mamu reden sollte, obwohl ich mich freute, sie zu sehen.
Es fühlte sich an, als hätte ich diesen Brunnen in mir, aber jedes Mal, wenn ich Mamu sah, verstopfte er. Ich wusste nicht, wie ich meine Gefühle herauslassen sollte.
»In der Schule ist es okay. In der Arbeit läuft es gut. Ähm.«
»Wie geht es Babu?«, fragte Dad.
»Ach, weißt du, er ist okay«, antwortete Mamu. Sie warf Mom einen Blick zu und sagte: »Jamshid hat ihn heute zum Arzt gebracht.«
Noch während sie es sagte, erschien mein Onkel Jamshid über ihrer Schulter. Sein haarloser Kopf sah noch winziger aus. »Eh! Hallo Dariush! Hallo Laleh! Chetori toh?«
»Khubam, merci«, sagte Laleh, und bevor ich mich versah, setzte sie zur dritten Wiedergabe ihres aktuellsten Daumendrücken-Spiels an.
Dad lächelte und winkte und stand auf. Meine Knie taten langsam weh, also tat ich dasselbe und bewegte mich in Richtung Tür.
Mom nickte zu Lalehs Erzählung und lachte an all den richtigen Stellen, während ich Dad zurück nach unten ins Wohnzimmer folgte.
Es war nicht so, dass ich nicht mit Mamu sprechen wollte.
Ich wollte immer mit ihr sprechen.
Aber es war schwierig. Es fühlte sich nicht so an, als wäre sie nur eine halbe Welt entfernt, sondern als wäre es ein halbes Universum – als würde sie aus einer alternativen Realität bei mir auftauchen.
Es war, als wenn Laleh zu dieser Realität gehörte, und ich nur ein Gast wäre.
Ich nehme an, auch Dad war nur zu Gast.
Zumindest das hatten wir gemeinsam.
Dad und ich blieben bis zum Ende des Abspanns sitzen – auch das war Teil unserer Tradition –, und dann ging Dad nach oben, um nach Mom zu sehen.
Laleh war in den letzten Minuten der Sendung wieder zurück nach unten gewandert, aber sie stand beim Haft Sin und schaute den Goldfischen zu, die in ihrem Glas schwammen.
Dad bringt uns jedes Jahr am 1. März dazu, unseren Beistelltisch in einen Haft Sin zu verwandeln. Und jedes Jahr sagt Mom ihm, dass es zu früh dafür ist. Und jedes Jahr sagt Dad, dass er uns in Stimmung für Nouruz bringen will, obwohl Nouruz – das persische Neujahr – erst am Frühlingsanfang stattfindet.
Auf den meisten Haft Sins stehen Essig und Sumak und Sprösslinge und Äpfel und Pudding und getrocknete Oliven und Knoblauch – alles Dinge, die in Farsi mit dem S-Laut beginnen. Einige Leute fügen noch andere Dinge, die nicht mit s beginnen, hinzu: Symbole der Erneuerung und des Wohlstands wie Spiegel und Schüsseln voll mit Münzen. Und einige Familien – so wie wir – haben auch Goldfische. Mom sagte immer, der Brauch habe etwas mit dem Sternzeichen Fische zu tun, aber irgendwann gab sie zu, dass die Goldfische niemals Teil des Ganzen wären, wenn Laleh sich nicht so gern um sie kümmern würde.
Manchmal dachte ich, dass Dad Nouruz noch lieber mochte als wir anderen zusammen.
Vielleicht fühlte er sich dadurch immerhin ein bisschen persisch.
Vielleicht war das so.
Also war unser Haft Sin überfrachtet mit allem, was die Tradition erlaubte, und außerdem stand ein gerahmtes Foto von Dad in einer Ecke. Laleh bestand darauf, dass wir es dazustellten, weil Stephen auch mit s begann.
Der Logik meiner Schwester konnte man kaum widersprechen.
»Darius?«
»Ja?«
»Der eine Goldfisch hat nur ein Auge!«
Ich kniete mich neben Laleh, während sie auf den besagten Fisch deutete.
»Guck!«
Es stimmte. Der größte Fisch, ein Gigant in der Größe von Lalehs Hand, hatte nur ein rechtes Auge. Die linke Seite seines Kopfs – Gesichts – (haben Fische Gesichter?) bestand aus glatten, lückenlosen orangefarbenen Schuppen.
»Du hast recht«, sagte ich. »Das war mir gar nicht aufgefallen.«
»Ich werde ihn Ahab nennen.«
Seitdem Laleh dafür verantwortlich war, die Fische zu füttern, hatte sie sich auch der ernsten Aufgabe angenommen, ihnen Namen zu geben.
»Kapitän Ahab hatte nur ein Bein, nicht ein Auge«, bemerkte ich. »Aber es ist ein guter literarischer Bezug.«
Laleh sah zu mir hoch, ihre Augen groß und rund. Ich war etwas neidisch auf Lalehs Augen. Sie waren riesig und blau, genau wie Dads. Alle sagten immer, wie schön Lalehs Augen waren.
Niemand sagte mir jemals, dass ich schöne braune Augen hätte, außer Mom, was nicht zählte, weil (a) ich sie von ihr geerbt hatte und (b) sie meine Mom war, also musste sie solche Sachen sagen. Genau wie sie behaupten musste, dass ich gut aussah, auch wenn das überhaupt nicht stimmte.
»Machst du dich über mich lustig?«
»Nein«, sagte ich. »Wirklich nicht. Ahab ist ein guter Name. Und ich bin stolz auf dich, dass du ihn kennst. Er stammt aus einem sehr berühmten Buch.«
»Moby der Wal!«
»Richtig.«
Ich konnte mich nicht überwinden, Moby-Dick vor meiner kleinen Schwester zu sagen.
»Was ist mit den anderen?«
»Das da ist Simon.« Sie zeigte auf den kleinsten Fisch. »Und das ist Garfunkel. Und das ist Bob.«
Ich fragte mich, wie Laleh so sicher sein konnte, dass die Fische männlich waren.
Ich fragte mich, wie die Leute männliche von weiblichen Fischen unterschieden.
Ich beschloss, dass ich es nicht wissen wollte.
»Das sind alles gute Namen. Ich mag sie.« Ich lehnte mich herunter, um Laleh einen Kuss auf den Kopf zu geben. Sie wand sich, versuchte aber nicht wirklich zu entkommen. Genau wie ich so tun musste, als ob ich es nicht mochte, Teepartys mit meiner kleinen Schwester zu geben, musste Laleh so tun, als ob sie die Küsse von ihrem großen Bruder nicht mochte. Aber sie war noch nicht so gut darin, sich zu verstellen.
Ich brachte meine leere Genmaicha-Tasse in die Küche und wusch und trocknete sie mit der Hand ab. Dann füllte ich ein Glas mit Wasser aus dem Kühlschrank und ging zu dem Schrank, in dem wir die Medizin für uns alle aufbewahrten. Ich sah die orangefarbenen Pillendosen durch, bis ich meine gefunden hatte.
»Würdest du mir meine auch geben?«, fragte Dad von der Tür aus.
»Klar.«
Dad trat in die Küche und schob die Tür zu. Es war eine schwere Holztür auf einer Schiene, auf der man sie in die Wand direkt hinter dem Ofen schieben konnte. Ich kannte niemand sonst, der so eine Tür hatte.
Als ich klein war und Dad mich gerade mit Star Trek bekannt gemacht hatte, nannte ich sie gern die Turbolift-Tür. Ich spielte ständig mit ihr, und Dad machte mit, indem er Decknummern rief, auf die uns der Computer bringen sollte, als wären wir wirklich an Bord der Enterprise.
Dann schob ich sie beim Schließen aus Versehen ziemlich heftig auf meine Finger und weinte zehn Minuten vor Schmerz und Schreck darüber, dass die Tür mich verraten hatte.
Ich hatte eine sehr genaue Erinnerung daran, wie Dad mich anschrie, dass ich aufhören sollte zu weinen, damit er meine Hand untersuchen konnte, und wie ich sie ihm nicht zeigen wollte, weil ich Angst hatte, dass er den Schmerz noch schlimmer machen würde.
Danach spielten Dad und ich nicht mehr mit der Tür.
Ich zog Dads Pillendose aus dem Schrank und stellte sie auf die Küchentheke, ließ den Deckel von meiner eigenen aufspringen und schüttelte meine Pillen heraus.
Dad und ich nahmen Medikamente gegen Depressionen.
Abgesehen von Star Trek – und dass wir nicht Farsi sprachen – waren Depressionen so ziemlich das Einzige, was wir gemeinsam hatten. Wir nahmen unterschiedliche Medikamente, gingen aber zum selben Arzt, was ich ein bisschen komisch fand. Ich glaube, ich war etwas paranoid, dass Dr. Howell mit meinem Dad über mich sprechen würde, auch wenn ich wusste, dass er das nicht durfte. Und Dr. Howell war immer ehrlich zu mir, also versuchte ich, mir weniger Sorgen zu machen.
Ich nahm meine Pillen und leerte das ganze Wasserglas. Dad stand neben mir und sah zu, als wäre er besorgt, dass ich ersticken könnte. Er hatten diesen Gesichtsausdruck, denselben enttäuschten Blick wie in dem Moment, als ich ihm erzählt hatte, dass Fatty Bolger meinen Fahrradsattel durch blaue Trucker-Hoden ersetzt hatte.
Er schämte sich für mich.
Er schämte sich für uns.
Übermenschen sollten nicht auf Medikamente angewiesen sein.
Dad schluckte seine Pillen ohne Wasser; sein hervorspringender teutonischer Adamsapfel hüpfte dabei hoch und runter. Dann drehte er sich zu mir um und fragte: »Also, du hast mitbekommen, dass Babu heute beim Arzt war?«
Er sah nach unten. Eine Unangenehme Stille des Levels drei begann, sich um uns zu bilden wie interstellarer Wasserstoff, der durch Gravitation zu einem Nebel zusammengezogen wurde.
»Ja, ähm.« Ich schluckte. »Wegen seines Tumors?«
Es fühlte sich immer noch seltsam an, dieses Wort auszusprechen.
Tumor.
Babu hatte einen Gehirntumor.
Dad warf einen Blick auf die Turbolift-Tür, die noch geschlossen war, und sah dann wieder mich an. »Seine letzten Testergebnisse sahen nicht gut aus.«
»Oh.« Ich hatte Babu bisher nie persönlich getroffen, nur über den Computerbildschirm. Allerdings sprach er nie wirklich mit mir. Sein Englisch war gut genug, und die wenigen Worte, die ich ihm entlocken konnte, zeigten zwar seinen Akzent, aber auch seine Sprachgewandtheit.
Er hatte mir einfach nicht viel zu sagen.
Ich nehme an, ich hatte ihm auch nicht viel zu sagen.
»Es wird ihm nicht wieder besser gehen, Darius. Es tut mir leid.«
Ich drehte mein Glas zwischen meinen Händen.
Mir tat es auch leid. Aber nicht so sehr, wie es mir hätte leid tun sollen. Und ich fühlte mich irgendwie schrecklich deswegen.
Es war einfach so: Die Existenz meines Großvaters in meinem Leben war bis zu diesem Punkt nur photonischer Art gewesen. Ich wusste nicht, wie ich traurig darüber hätte sein können, dass er starb.
Wie ich schon erwähnte, war der Brunnen in mir blockiert.
»Was passiert jetzt?«
»Deine Mom und ich haben das besprochen«, sagte Dad. »Wir reisen in den Iran.«
SLINGSHOT-MANÖVER
Es war nicht so, als hätten wir alles stehen und liegen lassen und gleich am nächsten Tag aufbrechen können.
Mom und Dad hatten gewusst, dass so etwas passieren konnte. Aber wir mussten trotzdem noch die Flugtickets und Visa und alles organisieren.
Daher vergingen einige Wochen, bevor ich mich mittags an den Tisch setzte und verkündete: »Wir fahren morgen.«
Ich führte sofort das Ausweichmanöver Beta aus und duckte mich zur linken Seite. Meine Tischgenossin Javaneh Esfahani neigte dazu, Dr Pepper aus der Nase zu schnauben, wenn ich sie am Mittagstisch überraschte.
Javaneh nieste zweimal – sie nieste immer zweimal, nachdem sie Dr Pepper aus der Nase geschnaubt hatte – und wischte ihr Gesicht mit einem der braunen Cafeteria-Papiertüchern ab. Sie schob eine Locke zurück unter ihr Kopftuch, die sich während ihres gewaltigen Nasennebenhöhlen-Ausbruchs gelöst hatte.
Javaneh trug immer ihr Kopftuch in der Schule, was ich sehr mutig fand. Die sozialpolitische Landschaft an der Chapel Hill Highschool war schon tückisch genug, ohne dass man den Leuten einen Grund gab, einen zu schikanieren.
Javaneh Esfahani war eine Löwin.
Sie blinzelte mich an. »Morgen? Das ging schnell. Meinst du das ernst?«
»Ja. Wir haben unsere Visa und alles.«
»Wow.«
Ich wischte die kohlensäurehaltige Explosion vom Tisch, während Javaneh ihr Dr Pepper mit einem Strohhalm trank.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














