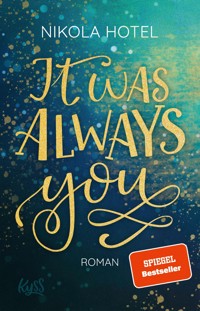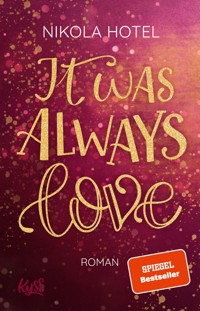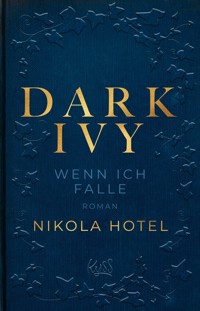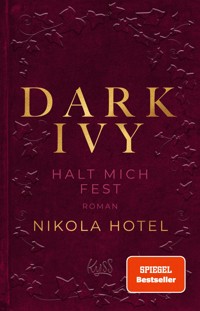
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dark-Academia-Duett
- Sprache: Deutsch
Das herzzerreißende Finale des Dark-Academia-Duetts. Bist du bereit? Nachdem ein tragischer Unfall die Woodford Academy erschüttert hat, versucht Eden, wieder zurück zur Normalität zu finden. Doch für sie ist nichts mehr normal – ebenso wenig wie für William. Er ringt mit den Entscheidungen, die er an jenem Abend getroffen hat, und gerät in eine Abwärtsspirale aus Reue und Schuld. Eden versucht verzweifelt, ihm zu helfen. Manchmal wirkt es, als wäre sie sein einziger Halt, an anderen Tagen kann er kaum ihren Anblick ertragen. Sie sehnt sich so sehr nach ihm. Aber wie kann man weiterleben – weiterlieben –, wenn man in Schuldgefühlen ertrinkt? Aufwühlend und zutiefst bewegend – die Fortsetzung des Spiegel-Bestsellers «Dark Ivy - Wenn ich falle». Mit Blackout Poetry im Innenteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Nikola Hotel
Dark Ivy – Halt mich fest
Roman
Über dieses Buch
Was kannst du ertragen, wenn du mich liebst?
Nachdem ein tragischer Unfall die Woodford Academy erschüttert hat, versucht Eden, wieder zurück zur Normalität zu finden. Doch für sie ist nichts mehr normal – ebenso wenig wie für William. Er ringt mit den Entscheidungen, die er an jenem Abend getroffen hat, und gerät in eine Abwärtsspirale aus Reue und Schuld. Eden versucht verzweifelt, ihm zu helfen. Manchmal wirkt es, als wäre sie sein einziger Halt, an anderen Tagen kann er kaum ihren Anblick ertragen. Sie sehnt sich so sehr nach ihm. Aber wie kann man weiterleben – weiterlieben –, wenn man in Schuldgefühlen ertrinkt?
Aufwühlend und zutiefst bewegend – das Finale des Dark-Academia-Duetts.
Mit Blackout Poetry im Innenteil.
Vita
Nikola Hotel hat eine große Schwäche für dunkle Charaktere und unterdrückte Gefühle, daher hängt ihr Herz vor allem am New-Adult-Genre. Und das merkt man ihren ebenso gefühlvollen wie mitreißenden Liebesgeschichten an. Seit 2020 gelang jedem ihrer Bücher unmittelbar nach Erscheinen der Einstieg auf die Spiegel-Bestsellerliste. Zudem sind alle ihre Romane besonders ausgestattet, seien es Handletterings in «It was always you» und «It was always love», ein Daumenkino und Origami-Faltanleitungen in «Ever» und «Blue» oder die Blackout Poetry in «Dark Ivy». Nikola lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Bonn und gewährt auf Instagram allerlei Einblicke in ihren Schreiballtag. Mehr Informationen sind auf ihrer Homepage zu finden: www.nikolahotel.de
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Illustrationen © 2024 by Nikola Hotel und Shutterstuck
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01303-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/darkivy2 eine Content-Note.
Für Anne
pothogonia
n. the torturous feeling of being caught between desire and pain because you love too much and are unable to give up on the person you’ve lost.
From Greek póthos (desire, longing) and agonía (struggles of emotions, pain, suffering)
– Notizbuch von Eden Collins
Playlist
Achilles Come Down – Gang of Youths
Falling Down – Lil Peep, XXXTENTACION
Goliath – Woodkid
Greek God – Conan Gray
After Dark – Mr.Kitty
Unfair – The Neighbourhood
Succession (Main Title Theme) – Nicholas Britell
Love and War – Fleurie
Asleep – The Smiths
Briony – Dario Marianelli, Jean-Yves Thibaudet
Adagio in C Minor – Nicholas Britell
Everybody’s Watching Me (Uh Oh) – The Neighbourhood
Runaway – AURORA
Everything Matters – AURORA, Pomme
A Little Death – The Neighbourhood
Softcore – The Neighbourhood
Watch Me Bleed – Tears For Fears
In This Shirt – The Irrepressibles
Please, Please, Please Let Me Get What I Want – The Dream Academy
Dark Ivy – Robert Gromotka, Meike-Lu Schneider
1. Kapitel
William
Auf dem Foto leuchten Kerzen zwischen den Felsen.
Wer auch immer sie dahin gestellt hat, kann Devin nicht gut gekannt haben. Er fände es ziemlich armselig, dass nicht mal ein paar Teddybären danebenliegen oder angemalte Herzen aus Ton. «Wer hat dir das geschickt?» Ich strecke die Hand zwischen den Sitzen hindurch, um unserem Chauffeur Wesley das Handy mit dem Foto zurückzugeben, und er klemmt es in die Halterung am Armaturenbrett.
Es ist arschkalt. Viel zu kalt für Ende November. Mit den kurz geschorenen Haaren sieht Wesley sonst immer aus wie eine Bürste, aber heute hat sogar er sich eine Wollmütze in die Stirn gezogen. Er schnalzt als Antwort nur mit der Zunge.
«Verstehe. Also sind die Fotos irgendwo im Netz aufgetaucht.» Es ist keine Frage.
«Ich wollte dich darauf vorbereiten. Dein Vater meinte, dass die Presseanfragen nicht weniger geworden sind, und wegen der Sache mit deinem Großvater damals besteht ein enormes Interesse an Devins …», er zögert, «na ja, an seinem Unfall.»
Diese Pause ist ein Faustschlag in den Magen. Danke dafür.
Das bedeutet also noch mehr neugierige Blicke als sonst schon. Noch mehr Leute, die heimlich Fotos machen oder ihre Handycam mitlaufen lassen, wenn ich auch nur an ihnen vorbeigehe. Nicht wegen Devin, was ich vielleicht noch nachvollziehen könnte, sondern weil der Enkel von William Grantham senior in einen Todesfall verwickelt ist.
Fluch des Geldes. Bester Freund des Millionenerbes William Grantham III. ertrinkt am Campus der Woodford Academy.
«Ich weiß die Warnung zu schätzen.» Mit zusammengepressten Lippen wische ich meine Hände an der Hose ab und merke dabei erst, wie verschwitzt sie sind.
«Wir sind in spätestens sechzig Minuten da», erklärt Wesley, als er losfährt.
Mit anderen Worten: In sechzig Minuten beginnt meine persönliche Hölle. Durch das dunkle Glas meiner Sonnenbrille starre ich nach vorn auf die Windschutzscheibe, ohne wirklich etwas zu sehen. Jede Meile, die wir uns dem Hafen nähern, sorgt dafür, dass der Druck in meinem Brustkorb steigt und ich an der Wirkung meiner Tabletten zweifle.
Ich zucke zusammen, als Wesleys Stimme irgendwann das Schweigen durchbricht. «Du stehst das durch, oder?» Wesley verstellt den Rückspiegel, sodass er mich besser sehen kann. Seine Hand zittert, als er wieder das Lenkrad packt. Mir wäre es lieber, ich hätte das nicht registriert. Das Zittern. Wie angespannt er ist. Die Sorge in seiner Stimme.
An der ich die Schuld trage.
Mea culpa.
«Kannst du bitte einfach sagen, dass du klarkommst, William?» Jetzt wirft er einen kurzen Blick über seine rechte Schulter nach hinten. Ein Blick, der mehr ist als der eines Angestellten. Wesley gehört fast zur Familie; er fährt diesen Wagen seit über zehn Jahren. Er hat mich damit zur Schule gebracht, zu Kindergeburtstagen, und später zu Dates oder zu Flughäfen.
Und jetzt bringt er mich damit zurück zur Woodford Academy.
Mühsam durchforste ich mein Gehirn nach einer geistreichen Antwort. Das Einzige, was mir einfällt, ist eine lateinische Phrase. «Calamitas virtutis occasio est», zitiere ich schleppend und ziehe gequält einen Mundwinkel nach oben, weil meine Zunge so schwer ist wie ein Sack Zement. Was an den Tabletten liegen muss. Wenn ich mich nicht zusammenreiße, wird es Wesley auffallen.
«Komm mir jetzt nicht mit so einem Cäsar-Mist. Ich meine es ernst.»
Vermutlich tut es ihm gut, mich anzublaffen. Wenn es ihm hilft, gerne. Wes hat allen Grund, mir nicht mehr zu vertrauen. Das letzte Mal, als er mich zur Fähre gebracht hat, saß Devin noch neben mir. Wesley hatte kein gutes Gefühl dabei, dass wir mit den Booten rüberrudern wollten, und ich habe es ignoriert. Jetzt bezahle ich dafür. Nein, Devin hat dafür bezahlt.
«Unglück ist eine Gelegenheit, seine Stärke zu zeigen.» Ich lehne mich zurück. «Das ist von Seneca. Aus seinem Buch über die Vorsehung. Buch eins, Kapitel vier.» Was geraten ist. Aber wer will mir das nachweisen?
Wesley formt im Rückspiegel mit seinem Mund das Wort Klugscheißer. Dann gibt er einen Laut von sich, der sowohl ein Schnauben als auch ein Auflachen sein könnte. «Das beantwortet meine Frage nicht.»
«Sind doch nur zwei Tage bis zum Wochenende. Ich komm schon klar.» Meine erste Lüge heute. Aber er gibt sich damit zufrieden, auch wenn er trotzdem skeptisch aussieht. In den nächsten Minuten fragt er mich nach meinen Kursen aus, wie ich den Stoff der letzten Wochen nachholen will und ob ich genug Klamotten eingepackt habe oder er mir Sachen nachbringen soll.
Unsere Art zu kommunizieren ist absurd, aber über Belanglosigkeiten zu reden, hält mich über Wasser. Ich kann Wesley über die Anzahl meiner Boxershorts Auskunft geben, welche Bücher ich eingepackt habe und wie die Farbe heißt, mit der meine kleine Schwester Katie heute Morgen die Fingernägel meiner linken Hand lackiert hat, aber nicht darüber, wie ich es aushalten soll, wenn ich mit der Fähre übersetze.
Wenn ich das Wohnheim betrete.
Wenn ich an Devins altem Zimmer vorbeilaufe.
Wenn ich sie sehe.
Augenblicklich ist die Enge wieder da. Der unerträgliche Druck hinter meinen Rippen, der es mir schwer macht, normal Luft zu holen. Als wäre meine Seele aus Blei.
Da sind noch sechzehn Tabletten in meiner Manteltasche, und es sollte mir Sorge bereiten, dass mich das erleichtert. Ich hole die Packung heraus. Vierzehn. Entweder, ich habe mich verzählt, oder ich habe gestern doch mehr geschluckt, als ich in Erinnerung habe. Was nicht weiter verwunderlich wäre, weil ich mich an kaum etwas erinnern kann, das in den letzten vier Wochen passiert ist. Mit Ausnahme der Highlights, die sind noch sehr präsent.
Die «Highlights» der vergangenen Wochen waren unsere Besuche bei den Emersons. Devins Familie, die völlig unter Schock stand. Kendra, die bis zur Erschöpfung geweint hat. Die vielen Fragen, die sie mir gestellt haben und die ich immer und immer wieder beantwortet habe, obwohl ich gar keine Antworten hatte. Die Diskussionen unserer Eltern, ob sie einer Autopsie zustimmen sollen oder nicht. Das Gefühl, dass ich in diesem Moment gerne mit Devin getauscht hätte, um das nicht miterleben zu müssen. Und schließlich der Moment, als die Leiche freigegeben wurde. Der Gottesdienst in der Old North Church. Der Sarg, der mit so vielen Blumen geschmückt war, dass Devin es garantiert zum Kotzen gefunden hätte. Genau wie diese Kerzen an der Uferböschung von Ivy Island.
Ich hatte genug «Highlights». Und bei dem Gedanken an die Trauerfeier für die Studenten, die gleich in der Dwight Church stattfinden soll, wird mir schlecht. Ich will da nicht hin, aber ich habe es Kendra versprochen. Vor allem will ich da nicht nüchtern hin. Es ist gerade einmal vier Stunden her, dass ich die letzte Xanax geschluckt habe, doch die Wirkung lässt bereits nach. Ohne groß zu überlegen, drücke ich eine Tablette aus dem Blister.
Ich solle sie auf keinen Fall länger als zwei Wochen einnehmen, hat Doc Reisman gesagt, aber Doc Reisman hat auch nicht zugesehen, wie sein bester Freund im Nordatlantik ertrinkt.
Ich schlucke die Pille mit Sodawasser aus der Minibar runter und hole meinen alten Walkman aus der Manteltasche. Auf die Kassette habe ich For when I wanna feel nothing geschrieben. Ich setze die Kopfhörer auf. Achilles Come Down gepaart mit einem Milligramm eines Benzodiazepins wird dafür sorgen, dass sich dieses Angstgefühl in mir auflöst. Dass ich gar nichts spüre.
Der Song läuft sieben Minuten. Ich muss ihn immer viermal hören, bis die Wirkung eintritt, und das wird knapp mit der restlichen Fahrtzeit hinhauen. Nach dem ersten Mal spule ich die Kassette zurück und starte von Neuem. Zweimal. Aber das Band dreht dabei schon langsamer, und die Musik fängt an zu leiern. Scheiße. Ich habe keine Ersatzbatterien hier in der Limousine. Nervös schalte ich die Wiedergabe ab. Ich stehe das durch. Ich muss.
Wesley sucht im Rückspiegel meinen Blick, und ich schiebe die Kopfhörer in meinen Nacken. «Wenn die Fähre nach Plan fährt, musst du keine fünf Minuten warten», teilt er mir mit.
«Perfekt.» Wenn die Fähre vor vier Wochen nach Plan gefahren wäre, wäre Devin jetzt nicht tot. Wenn wir nicht selbst gerudert und dieses unnötige und irrsinnige Wettrennen daraus gemacht hätten, wäre Devin nicht tot. Wenn ich bei ihm im Boot gewesen und auf ihn aufgepasst hätte, wäre Devin nicht tot. Wenn ich auch nur einen Moment mein Gehirn benutzt hätte, wäre Devin nicht tot. Wenn ich Eden nicht …
Bevor sich die Gedankenspirale tiefer in meinen Kopf bohren kann, fängt die Tablette an zu wirken.
2. Kapitel
William
Mein Kopf wird in Watte gedrückt. Auf einmal ist alles easy. Meine Sorgen lösen sich auf. Mein Körper wird schwer und träge, aber ich kann wieder Luft holen, als hätte jemand den unsichtbaren Gurt um meinen Brustkorb durchschnitten. Gott, was für eine Erleichterung!
Ich werde die Trauerfeier in der Dwight Church hinter mich bringen und danach wahrscheinlich zwölf Stunden schlafen, so wie letzte Nacht. Ich muss an nichts mehr denken. Alles ist egal. Der perfekte Zustand.
Meinen Kopf lasse ich nach hinten fallen, die Arme reglos neben mir auf den Ledersitzen, als würden sie gar nicht zu mir gehören. Ich versuche, meine Herzschläge zu zählen, die bis in meinen Hals pochen, komme aber schon bei sieben oder acht durcheinander und lasse es sein. Weil es sogar egal ist, ob ich bis zehn zählen kann. Heiser lache ich auf.
Okay, klingt nicht gesund.
Wesley räuspert sich, und seine Brauen ragen im Rückspiegel wie Dreiecke in die Höhe. «Am liebsten würde ich dich eigenhändig ins Wohnheim bringen.»
«Sie lassen dich nicht mal auf die Fähre. Sicherheitsbesch-schtimmungen.» Beim letzten Wort lalle ich fast. Gott, ich muss mich zusammenreißen.
Mit einem Kopfschütteln lenkt Wesley den Wagen in ein scharfes U und hält direkt vor dem Anleger. Und er hatte recht, die Fähre ist bereits da und eine Handvoll Leute gehen gerade aufs Schiff. Wesley kramt im Handschuhfach. Mir bleiben nur ein paar Sekunden, in denen ich unbeobachtet bin, und obwohl ich gefühlt eine halbe Ewigkeit brauche, um die Minibar zu öffnen und eine der halb vollen Whiskeyflaschen zu greifen, schaffe ich es, sie unbemerkt in meine Manteltasche gleiten zu lassen. Für den Notfall. Dann rutsche ich zur Tür und steige aus.
Der Novembertag ist genau das, was zu meiner Stimmung passt. Eiskalter Nieselregen und alles in monochromem Graublau, das in der einsetzenden Dämmerung immer dunkler wird. Ich klopfe meine Tasche ab. Die Schlüsselkarte fürs Wohnheim, die ich vorzeigen muss, um auf die Fähre zu kommen, ist da.
«Das hat mir deine Mutter für dich mitgegeben. Ich sollte damit warten, bis wir hier sind.» Wesley drückt mir eine kleine Papiertüte in die Hand, die ich reflexartig ergreife und die so leicht ist, dass kaum was drin sein kann. Sofort rennt er zum Kofferraum, um den großen Weekender mit meinen Klamotten zu holen. Mit zwei Fingern öffne ich die Tüte.
Eine Handyschachtel.
Was zum …?!
Meine Mutter hat mir ein verdammtes iPhone gekauft. Sie weiß genau, dass ich das nicht will, aber seit Monaten versucht sie, mich zu überreden. Ich verstehe ihre Gründe, aber sie hat keine Ahnung, wie hart es vor zwei Jahren war, davon loszukommen. Meine Bildschirmzeit im Internat lag bei neun Stunden Tagesdurchschnitt, und ich habe ernsthaft einem Mädchen, das ich mochte, die Abkürzung «ily» per Snapchat geschickt. Langsam, aber sicher wäre ich verblödet. Jetzt benutze ich einen Laptop zum Arbeiten, meinen Walkman zum Musikhören, und mein Notizbuch. Alles andere brauche ich nicht. Nicht mehr.
Das Smartphone werfe ich zusammen mit der Tüte auf den Rücksitz und danach die Autotür zu.
Natürlich hat unser Chauffeur es gesehen. Er hat wieder die Brauen angehoben, als er zu mir kommt. «Vielleicht wärst du irgendwann froh, es zu haben. Du könntest im Notfall zu Hause anrufen. Oder einfach zum Spaß mal Clash of Clans spielen oder so was.»
Für Notfälle habe ich die Flasche aus der Minibar, und Spaß … Ich mache nichts mehr zum Spaß. «Wir haben im Wohnheim ein zuverlässig funktionierendes Flurtelefon», kläre ich ihn auf.
«Das ist nicht dasselbe.»
«Ich weiß.» Ich nehme ihm die Tasche ab. «Du kannst meiner Mutter mitteilen, dass du es versucht hast, ich aber renitent gewesen bin.» Der Satz kommt vollkommen flüssig aus mir raus, und ich bin sicher, dass Wesley nicht auffällt, dass er in Wirklichkeit einen Zombie vor sich stehen hat, der um jedes Wort ringt.
«Renitent.» Er schüttelt schnaubend den Kopf. «Pass auf dich auf, Will.»
Mein Körper ist so schlaff, dass ich kaum reagiere, als er mich kurz in eine väterliche Umarmung zieht.
«Und grüß Eden von mir.»
Scheiße.
«Mach ich.» Die zweite Lüge an diesem Tag. Meine Stimme klingt dabei wie ein Reibeisen. Es reicht, dass Wes einmal ihren Namen erwähnt, um das Trommeln in meiner Brust wieder in die Höhe zu treiben. Was passiert dann erst, wenn ich ihr gleich begegne? Ich packe das nicht. Ich pack das einfach nicht. Irgendwie schaffe ich es dennoch durch die Sicherheitskontrolle und auf die Fähre, ohne dass mir die Beine wegknicken. Es ist windig, und als wir losfahren, fallen eisige Regentropfen auf meine Sonnenbrille, die ich nur trage, damit man das Feuermal über meinem linken Auge nicht sofort sieht. Als ich sicher sein kann, dass mich niemand beobachtet, stelle ich den Kragen meines Mantels gegen die Kälte auf und schraube die halb volle Flasche des zehn Jahre alten schottischen Single Malt auf.
Keine Ahnung, wie ich wieder von der Fähre runtergekommen bin und den Weg über den Campus zurückgelegt habe, aber ich kann meine Füße sehen, die automatisch einen Schritt vor den anderen setzen, was bedeutet, dass ich noch funktioniere. Mir ist schwindelig, und irgendwo muss ich meine Tasche losgeworden sein. Mit beiden Händen reibe ich mir übers Gesicht, aber davon bekomme ich auch keinen klaren Kopf, der ist immer noch voller Watte. Von der Kälte spüre ich nichts mehr. Ich werfe einen Blick auf die Uhr an meinem Handgelenk. Grandpas Uhr. War ich bereits im Wohnheim? Ich denke schon. Dabei kann ich kaum denken. Ich versuche mich zu erinnern, wohin ich wollte, aber mein Geist stochert im Nebel.
Die Kirche. Ich muss in die Dwight Church, weil um sechs Uhr die Gedenkfeier für Devin losgeht. Zum Glück fällt mir das wieder ein.
Es ist inzwischen stockdunkel. Als ich durch den Park laufe, ziehe ich aus meiner Manteltasche die leere Whiskeyflasche und werfe sie in den Mülleimer unter einer Laterne. Kann sein, dass ich gerade eine weitere Tablette damit runtergespült habe. Das Zählen habe ich aufgegeben. Als ich die Kirche erreiche und ins Innere trete, ist Gemurmel zu hören, und es riecht nach Kerzen und muffigen Gebetsbüchern. Ich fasse mir ans Revers und kontrolliere, dass ich unter dem Mantel ein angemessenes Sakko trage. Obwohl das Devin so was von scheißegal wäre.
Das Kerzenlicht flackert im Windzug, und ich kneife die Augen zusammen. Meine Sonnenbrille ist weg. Mit den Fingern fahre ich mir durchs Haar und lasse ein paar Strähnen über meine linke Gesichtshälfte fallen, weil … ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich bin mir sicher, es gibt einen Grund.
Flüchtig hebe ich die Hand, als mich jemand mit einem Nicken begrüßt. Die Blicke, die mir folgen, spüre ich zwar, aber sie sind mir gleichgültig. Alles ist mir gleichgültig. Klassische Musik dringt aus unsichtbaren Lautsprechern. Eine Nocturne von Chopin, die ich als Vierzehnjähriger endlos auf dem Klavier geübt habe.
Devins Schwester Kendra ist unschwer an dem schwarzen Band zu erkennen, das ihre Locken zurückhält. Sie sitzt in der ersten Bankreihe.
Sie weiß es immer noch nicht.
Dass ich sie belogen habe, was Devins Unfall angeht. Zumindest zu einem Teil. Ich habe eine Scheißangst vor ihrer Reaktion, deshalb habe ich nichts gesagt. Und selbst ohne diese Schuldgefühle wäre es verdammt schwer, den Weg bis zu ihr zurückzulegen.
Ich laufe stockend durch die Sitzreihen und stütze mich an jeder einzelnen Bank ab. Auf halber Strecke fällt mir das gerahmte Bild mit der Trauerschleife neben dem Altar auf. Devin sieht darauf so sauber und brav aus wie ein Pfadfinder. Keine Ahnung, wann das aufgenommen wurde. Er würde sich totlachen, wenn er es sehen könnte. Aber er hätte auch definitiv einen anderen DJ bestellt.
Meine Beine sind so schwer, ich könnte im Gehen einschlafen. Oder mich einfach hier in eine Bank legen.
«Hey, Grantham. Alles okay mit dir?»
Ich überlege, wann und wo ich Garrett das letzte Mal gesehen habe, und weil ich eine ehrliche Antwort auf diese Frage nicht über die Lippen bringe, nicke ich nur.
«Du siehst verdammt fertig aus», teilt er mir mit.
«Erz…zähl mir was Neues», nuschle ich. Dumpf blicke ich von ihm zu der Person, die neben ihm auftaucht, und mein Kopf prallt gegen eine Nebelwand.
Als mein Blick sich endlich scharf stellt, registriere ich unter der Winterjacke vor mir ein schwarzes Kleid. Meine Augen wandern nach oben. Kinnlanges braunes Haar, graubraune tiefgründige Augen. Und Lippen, von denen ich wünschte, ich würde nicht wissen, wie sie sich anfühlen. Die weichsten Lippen der ganzen verfickten Welt.
Für eine Sekunde schwappt Wärme durch meinen Brustkorb, dann ist sie verschwunden, Xanax sei Dank.
«Eden», sage ich mit einer Stimme, die abgestumpft und gleichgültig klingt, weil alles in mir betäubt ist. Ich spüre nichts. Dann registriere ich, wie Eden mich ansieht. So verletzlich. Wahrscheinlich bin ich daran schuld, dass sie so aussieht, aber die Erinnerung an unsere letzte Begegnung nimmt keine klaren Konturen an. Da blitzt etwas auf. Schuld. Selbsthass. Reue. Verflucht viel Reue. Nichts davon ergibt Sinn.
«Will, können wir …» Sie spricht nicht weiter, aber sie hält mich am Arm fest.
Was? Ich schlucke hart. Reden? Sterben? Uns nebeneinander auf die Bank setzen und gegenseitig trösten? Bitter lache ich auf. Aber unter Edens warmer Hand trommelt mein Herz, was mich überrascht, weil es bedeutet, dass mein Herz absurderweise in meinem Unterarm sitzen muss. Und dass es doch nicht völlig betäubt ist. Aber vor allem bedeutet es, dass ein paar Milligramm Benzodiazepine nicht ausreichen, um meine Gefühle abzutöten.
Und dann wird mir bewusst, dass wir nicht mehr zusammen sind, dass ich sie verlassen habe und dass sie denken muss, ich würde sie hassen. Dabei hasse ich mich selbst, weil es mir gut geht und Devin tot ist. Weil ich einfach alles habe und mein bester Freund nicht mal mehr sein Leben. Nichts davon will ich fühlen. Ich schlucke und schmecke den Alkohol auf meiner Zunge. Ruckartig ziehe ich meinen Arm weg.
«Nein, können wir nicht.»
Ich glaube, ich muss kotzen.
3. Kapitel
Eden
Jeden Tag habe ich mir vorgestellt, wie es sein wird, William wiederzusehen. Ich habe damit gerechnet, dass es schlimm wird, dass er mich hasst und es mir das Herz bricht, dieses Gefühl in seinen Augen zu sehen. Aber ich habe nicht gedacht, dass er so kalt und gleichgültig sein würde, was fast noch schlimmer ist. Meine Brust zieht sich zusammen, und mein Herzschlag rast dagegen an.
Waldosia. So nennt sich der Zustand, wenn man in jeder Menschenmenge an jedem Ort Ausschau nach einer bestimmten Person hält, obwohl die gar nicht dorthin gehört. Und in der einen Woche, die ich zu Hause bei meinem Dad war, um den Schock von Devins Tod irgendwie zu überleben, habe ich jede Minute, jede Sekunde überall nur nach William gesucht. Mein Gehirn hat jeden Stein nach ihm umgedreht. Dad und ich waren bei Target einkaufen, und ich habe gedacht, ich würde William vor einem der Regale sehen. Als Dad mich an Larks Todestag gezwungen hat, zur Ablenkung mit ihm zu einem Footballspiel zu gehen, war ich für einen Sekundenbruchteil absolut sicher, einer der Männer in der Reihe vor uns wäre Will. An der Tankstelle, als unerwartet ein Reisebus neben uns gehalten hat, haben meine Augen das Wageninnere nach ihm abgesucht, und dann hätte ich beinahe einem Typen beim Einsteigen auf die Schulter geklopft, weil ich mir so sicher war, dass er es sein muss. Bei jeder Gelegenheit habe ich vergeblich gehofft, dass er plötzlich auftaucht. Und jetzt steht er vor mir und sieht einfach durch mich hindurch.
Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Es ist Gleichgültigkeit.
Ich beiße mir auf die Lippe, weil mir auffällt, wie anziehend William in diesem schwarzen Anzug auf mich wirkt, und das, obwohl er gerade so abweisend ist. Es geht ihm nicht gut, er weicht meinem Blick aus, und es ist offensichtlich, dass er leidet. Ich versuche, nur daran zu denken und nicht verletzt zu sein, weil er mich zurückweist. Aber das schaffe ich einfach nicht.
Für ihn ist das Gespräch mit mir beendet. Als er sich wegdreht, rieche ich Alkohol in seinem Atem, und offenbar bin ich nicht die Einzige.
«Der hat doch gesoffen», zischt Garrett mir zu. Er ist mehr als einen Kopf größer als ich, und die dunklen Locken lassen ihn wirken wie einen überdimensionierten Pudelwelpen.
Ich sage nichts. Weil … ich könnte es verstehen. Wenn überhaupt einer das versteht. Vor einem Jahr habe ich meinen besten Freund verloren. Dass William nun dasselbe durchmachen muss, ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
«Findest du das etwa okay? Er kommt stockbesoffen zu Devins Trauerfeier. Wenn sie ihn erwischen, kann er seine Tasche packen.»
«Nicht so laut, Garrett.» Ich senke meine Stimme. «Ich glaube nicht, dass er so betrunken ist.» Wir können nicht wissen, wie viel William getrunken hat. Vielleicht ist er auch krank. Mein Blick folgt ihm. Gott, nein, Garrett hat recht. Wills Gang sieht nicht danach aus, als könne er sich noch lange auf den Beinen halten.
Doch mir liegt nun selbst ein Vorwurf auf der Zunge. Hast du mal gefragt, wie es ihm geht? Warum hast du nicht mal nach ihm gesehen? Aber die Frage kann ich mir selbst beantworten: weil William das nicht zugelassen hätte. Garrett hat ihn wahrscheinlich auch gerade das erste Mal seit diesem verhängnisvollen Abend wiedergesehen. Der Abend, der alles verändert hat.
«Meinst du, das macht noch einen Unterschied, ob mich jemand hört?» Mit einem Nicken deutet er zu Wills Rücken, der durch die Reihen weiter nach vorne wankt. «Als ob den anderen das nicht auffallen würde.»
Schnell sehe ich mich in der fast vollen Kirche um. Präsidentin Amory hat ihren Platz noch nicht eingenommen, es liegt ein Zettel mit ihrem Namen auf einem der Stühle am Altar, aber Professor Cushing stand eben in der Nähe von Kendras Philosophieprofessor in einer der kleinen Nischen und hat beaufsichtigt, dass die Studenten sich angemessen und ruhig in den Bänken verteilen. Ms. Colegrove entdecke ich nirgends, aber sie wird sicher auch noch auftauchen, und wenn unsere TA William in diesem Zustand sieht, ist ihr sofort alles klar. Sie wird ihn melden müssen. Meine Hand, mit der ich William gerade noch berührt habe, schließt sich zur Faust. Ihm wird nichts passieren, rede ich mir ein. Er ist ein Grantham, und sein Grandpa hat Millionen in dieses College investiert. Trotzdem wird mir eiskalt bei der Vorstellung, dass sein Zustand einem der Dozenten auffallen könnte.
William stolpert, und ich zucke zusammen. Die anderen müssen doch mitkriegen, dass er sich kaum aufrecht halten kann. «Wir können ihn nicht allein lassen, Garrett. Wir müssen ihn hier rausschaffen.»
«Klar, aber wie soll ich das bitte anstellen? Ihn tragen?»
«Bring ihn einfach so schnell wie möglich hier raus. Ich …» Kanndas nicht. Er wird mich wieder abweisen. Er wird mich selbst im betrunkenen Zustand von sich stoßen, oder nicht? Das halte ich nicht aus.
«Okay, aber wäre das nicht eher deine … Ich meine, willst du nicht …?» Garrett unterbricht sich selbst. «Ach Fuck.» Mit einem Fluch dreht er sich auf dem Absatz um und läuft ihm hinterher. So schnell, dass es schon fast als Sprint durchgeht. Erleichtert sehe ich, dass er William abfangen kann, bevor der am Altar ankommt, und ihn ins Seitenschiff der Kirche zieht. Gerade noch rechtzeitig, denn Präsidentin Amory geht in diesem Moment im Schlepptau des Geistlichen nach vorne.
Trotz der dicken Jacke, die ich über das schwarze Kleid gezogen habe, fange ich an zu zittern. Schnell rutsche ich auf den erstbesten freien Platz in der Bank neben mir und versuche mich zu sammeln. Ganz automatisch fasse ich mir an die Stirn, wo die Platzwunde inzwischen verheilt ist und langsam zu einer dünnen Narbe verblasst. Es pocht wie ein Phantomschmerz. Die Stelle, an der das Ruder mich erwischt hat, bevor ich ins Wasser gefallen bin. Die Stelle, die mich jede Sekunde daran erinnert, dass Devin ertrunken ist.
Meinetwegen.
«Hey Eden.»
Ich reiße die Hand runter und rücke zur Seite, als Sheela und Morris sich neben mich auf die Bank quetschen. Gott sei Dank jemand, den ich kenne.
Sheela deutet auf die Narbe an meiner Stirn. «Ist gut verheilt. Du hast echt Glück gehabt, oder?»
«Ja.» Dasselbe hat Ms. Colegrove auch zu mir gesagt. Du hast solches Glück gehabt, nur mit einer Platzwunde davonzukommen. Es fühlt sich aber nicht nach Glück an. Sondern nach einer Tragödie.
Weder William noch Garrett kann ich von hier aus noch sehen. Er sollte bei Kendra sein. Das sollten wir beide. Aber Kendra sitzt ganz vorne neben Sun-young. Sie hat sich nicht einmal umgedreht. In meiner Tasche habe ich eine Packung Pop Rocks für sie. Wahrscheinlich ist das die bescheuertste Idee, die je ein Mensch gehabt hat, aber ich habe ihr Pop Rocks mit Erdbeergeschmack gekauft, weil sie Brausepulver liebt und ich gehofft habe, dass … na ja … ich habe unglaubliche Angst, mit ihr zu reden, und gehofft, dass sie vielleicht lächeln würde. Jetzt, wo ich hier sitze, wird mir klar, wie unglaublich blöd das ist.
«Ich habe dich seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Wohnst du gar nicht mehr im Wohnheim?» Sheela ist zwei Semester über mir, wohnt aber auch im North Park House. Seit der Strandparty ist sie mit Morris zusammen. Wir sind uns vor dem Unfall ab und zu auf dem Flur begegnet, mehr hatten wir bisher aber nicht miteinander zu tun.
«Doch, ich … war nur viel auf meinem Zimmer», antworte ich ausweichend. Ich habe mich verkrochen.
Nur eine Woche war ich zu Hause, länger habe ich es nicht ausgehalten. Eine Woche, in der ich versucht habe, zu begreifen, was passiert ist. Ich begreife es bis heute nicht. Ich liebe meinen Dad, aber ich konnte es ihm nicht antun, meine ganze Verzweiflung bei ihm abzuladen. Nicht nach dem, was er wegen Lark mit mir durchgemacht hat. Deshalb habe ich versucht, tapfer zu sein, auch wenn es mich innerlich zerrissen hat. Ich habe gequält gelächelt, anstatt zu heulen, und wenn ich unbeobachtet war, mein Gesicht verzweifelt in ein Kissen gedrückt.
Weil William und Kendra nach drei Wochen immer noch nicht zurück ins College gekommen waren und ich nicht wusste, was ich tun sollte, habe ich vor ein paar Tagen Williams Mom angerufen. Was keine gute Idee war. Sie konnte kaum sprechen, und wir haben beide am Telefon nur geweint. Von ihr habe ich erfahren, dass die Beerdigung bereits stattgefunden hat. Devins Vater wollte nicht, dass jemand von uns aus dem College dabei ist. Nur die engsten Familienmitglieder. Diese Trauerfeier für die Studenten in der Dwight Church auf dem Campus hatte man eh schon organisiert. Damit wir alle uns verabschieden können.
Mein Magen zieht sich zu einem Knoten zusammen, weil ich dieses Wort so sehr hasse.
Verabschieden.
Ich habe mich von meinem besten Freund Lark verabschiedet. Niemals hätte ich gedacht, dass mir das hier in Woodford wieder passiert. Das hätte mein Neuanfang sein sollen. Stattdessen habe ich William und Kendra mit in den Abgrund gezogen. Bei dem Gedanken kralle ich mich an der Holzbank fest.
«Garrett hat mir erzählt, dass du bewusstlos warst.»
Ich drehe den Kopf, und im ersten Moment ist mir nicht klar, wovon Sheela spricht.
«Bei dem Unfall.» Sie lächelt schief. «Du hast was abbekommen, oder? Du hättest auch … Also, wenn es stimmt, was die Leute so erzählen, dann könnte es jetzt auch deine Trauerfeier sein. Was für ein Horror.»
Ich bin zu geschockt, um etwas darauf zu erwidern.
Sheela verzieht zerknirscht das Gesicht. «Sorry. Das war nicht so unsensibel gemeint, wie es klang.»
«Schon okay.» Ist es nicht. Aber sie meint es bestimmt nicht so. Und ich muss es aushalten. Die Trauerfeier kann nicht unendlich lang dauern, und ich bin es Devin schuldig. Ich werde es aushalten, flüstere ich mir selbst ein.
Morris beugt sich vor. «Kannst du dich eigentlich daran erinnern, wie es passiert ist?»
Ich zögere und schüttele schließlich den Kopf. «Nicht wirklich», antworte ich ausweichend. Meine Stirn juckt, aber diesmal fasse ich die Stelle nicht an. Das Schlimme ist, ich erinnere mich an alles. Ich will nur nicht darüber reden. Es reicht mir, von allen beobachtet zu werden und das Getuschel zu hören.
Angeblich hat sie sich mit Devin gestritten, bevor es passiert ist.
Da sollen Drogen im Spiel gewesen sein.
Eden war auf der Highschool im Ruderteam. Ich wette, sie hat die anderen dazu überredet.
Wie dumm kann man eigentlich sein, in so ein Boot zu steigen, wenn man nicht richtig schwimmen kann?
Es war der Schlag gegen meinen Kopf. Das Ruder hat mich erwischt, als Devin es rumgerissen hat. Nur deshalb bin ich untergegangen. Nur deshalb hat William mich aus dem Wasser gezogen. Nur deshalb konnte er seinem Freund nicht helfen. Seitdem frage ich mich, ob William es bereut. Dass er mich gerettet hat anstatt Devin. Ob er die gleichen Albträume hat wie ich und darin immer wieder ins schwarze Wasser taucht? Ob er immer wieder versucht, Devin zu finden, und dann seinen leblosen Körper vor sich sieht mit den nassen roten Haaren, die in dem blassen Gesicht kleben?
Nun taste ich doch wieder über die Stelle an meiner Stirn. Manchmal bilde ich mir ein, dass ich das Blut noch spüren kann. Wie hart und rissig es sich angefühlt hat, als es geronnen ist. Im Krankenhaus vor dem halb blinden Spiegel im Badezimmer habe ich minutenlang gebraucht, um es mir von der Haut zu kratzen. Wenn ich nur alles andere auch so von mir hätte abkratzen können. Die Trauer, die Angst. Die Schuldgefühle.
Ich schlucke und versuche, die Erinnerungen zu verdrängen, was aber nicht funktioniert, weil die Bilder in Full HD durch meinen Kopf jagen. Ich bin den Abend so oft durchgegangen, dass ich jede Sekunde wieder und wieder durchlebt habe. Und jedes Mal frage ich mich, an welchem Punkt die Sache so schiefgelaufen ist. Wieso ist Devin so plötzlich aus dem Boot gefallen? Ja, wir haben uns gestritten. Er war total aufgekratzt und dann auf einmal völlig abwesend. Genauso seltsam wie an dem Abend, als wir nach dem Küchenbrand zusammensaßen und er ewig nicht reagiert hat, nachdem ich ihn angesprochen hatte. Oder im Cabot-Theater, als er in dem einen Moment noch auf dem Tisch getanzt hat und im nächsten einfach so runtergekippt ist. Es würde nichts daran ändern, dass Devin tot ist, aber es quält mich, nicht zu wissen, was mit ihm los war. Ob er vielleicht doch Drogen genommen hat. Vielleicht hätte ich etwas tun können. Vielleicht …
Dieses verdammte vielleicht!
«Aber du hast mit Devin geredet. Auf dem Boot.» Morris hakt weiter nach, und ich verstehe nicht, warum er es nicht wenigstens auf Devins Trauerfeier auf sich beruhen lassen kann. «Hat er irgendwas gesagt?»
«Was? Nein. Ich …» Was will er denn von mir hören? Worüber wir uns unterhalten haben? Devins letzte Worte?
«Devin ist obduziert worden, oder? Erfahren wir eigentlich irgendwann, was dabei rausgekommen ist?»
Mir dreht sich der Magen um. Morris’ Tonfall ist so locker, als würden wir uns darüber unterhalten, wann die neue Staffel Wednesday auf Netflix erscheint.
Sheela gibt ihrem Freund einen Stoß. «Was ist denn mit dir los?», zischt sie. «Das geht ja wohl nur seine Familie was an.»
«Sorry.» Er sieht betroffen aus, verschränkt aber die Arme vor der Brust. «Trotzdem … Wir sind immerhin Freunde von ihm. Ich würde einfach gerne wissen, woran er wirklich gestorben ist.»
Und ob wirklich Drogen im Spiel waren, füge ich in Gedanken hinzu.
«Er ist ertrunken, was gibt es da denn noch mehr zu wissen?»
Die beiden diskutieren im Flüsterton weiter, und ich will mich auflösen. Ich will nicht an diesen Gesprächen und schon gar nicht an dieser Trauerfeier teilnehmen, aber es ist ein Unterschied, ob man etwas tun will oder tun sollte. Ich bin es Devin schuldig. Also konzentriere ich mich einfach darauf, weiter zu atmen.
Sheela stößt mich mit dem Knie an und beugt sich zu mir rüber. «Wie geht es denn Kendra?», fragt sie.
«Ich weiß es nicht. Wir … Ich habe sie heute noch nicht gesehen», antworte ich ausweichend. Ich habe sie seit vier Wochen nicht gesehen, und seit drei Wochen trage ich die Pop Rocks in meiner Jackentasche.
Mit dem Handy meines Dads habe ich ihr mehrmals geschrieben, weil mein eigenes kaputt ist und sie auf meine Anrufe nicht reagiert hat.
Arthur Collins: Hier ist Eden. Es tut mir so unendlich leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie geht es dir? Ich wäre so gerne bei dir. Können wir reden?
Arthur Collins: Ich kann Tag und Nacht an nichts anderes denken. Es gibt nichts, was ich tun kann, um es rückgängig zu machen. Ich wünschte, wir wären nie in das Boot gestiegen. Vielleicht bin ich der letzte Mensch auf Erden, mit dem du darüber reden willst. Aber wenn ich etwas für dich tun kann, sag es mir bitte. Du kannst mich jederzeit anrufen.
Eden
Arthur Collins: Ich will nur, dass du weißt, dass ich an dich denke. Immer. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich wünschte, es würde nicht so unfassbar wehtun.
Arthur Collins: Heute hat mein Dad Blaubeer-Pancakes gebacken, und ich musste daran denken, wie Devin sich über meine Torte lustig gemacht hat. Er fehlt mir. Du fehlst mir. Wenn du telefonieren möchtest …
Arthur Collins: Ich mache mir solche Sorgen. Können wir bitte reden? Es tut mir so leid, Kendra. Bitte hass mich nicht.
Eden
Kendra: Ich hasse dich nicht, aber ich habe grad echt keine Kraft zu reden, Eden.
Das war die einzige Nachricht, die ich von Kendra bekommen habe, und danach habe ich das Handy meinem Dad zurückgegeben.
Sicher, dass du es nicht behalten willst, Sweetheart? Vielleicht meldet sie sich noch mal.
Ich war mir absolut nicht sicher. Aber ich wollte Dad nicht auch noch sein Mobiltelefon wegnehmen. Die Fahrten nach Woodford und zurück, der unbezahlte Urlaub, den Dad in dieser Woche gemacht hat … Das alles war teuer genug. Ich brauche unbedingt einen Nebenjob, dann kann ich mir selbst ein neues Telefon besorgen. Die Gärtnerei hier auf der Insel sucht gerade eine Aushilfe, und morgen während einer Freistunde habe ich dort ein Vorstellungsgespräch. Dabei ist es völlig bizarr, sich Gedanken um so etwas wie einen Studentenjob zu machen, wenn Devin tot ist. Als würde das Leben weitergehen. Nur wie soll es weitergehen, wenn Devin nicht mehr da ist, Kendra nicht mit mir redet und William es nicht mal ertragen kann, mich auch nur anzusehen?
Das Getuschel wird leiser, die Musik wird so weit gedämpft, bis sie nur noch ein sanftes Hintergrundrauschen ist. Ich denke, Präsidentin Amory wird gleich ein paar Sätze sagen. Hoffentlich passt Garrett auf William auf. Ich werfe einen vorsichtigen Blick über meine Schulter und ignoriere die Leute, die mich beobachten, weil ich diejenige bin, die dabei war. Diejenige, die im Wasser war, als Devin ertrunken ist. Devin würde jetzt wahrscheinlich einen Witz reißen und etwas sagen wie «das Mädchen, das überlebt hat». Ich kralle mich noch stärker an der Bank fest. Nur niemanden direkt ansehen. Keinen Blickkontakt herstellen.
Die meisten haben ihre Plätze eingenommen.
Reihen aus schwarzen Mänteln.
Als wir zum Beginn des Semesters von Präsidentin Amory begrüßt wurden, waren es erwartungsvolle Gesichter. Jetzt sind es fassungslose, betroffene.
Devin hätte im März seinen neunzehnten Geburtstag gefeiert. Jetzt ist er tot.
Gerade hinsetzen. Schultern zurück. Nicht weinen. Nicht schuldbewusst aussehen. Nicht zeigen, dass man dagegen ankämpft, sich unendlich schuldig zu fühlen. Weil … ich bin schuldig. Nicht nur auf eine Art.
Ich schlucke, und es schmeckt salzig.
Als mein Blick vorne die Reihe durchgeht, dreht Kendra sich um. Ihre dichten schwarzen Wimpern, ihr ganzes Gesicht ist tränennass, aber sie bemerkt mich nicht. Es tut weh, sie so zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir alle nie wieder glücklich sein werden. Ich weiß, dass das nicht realistisch ist, irgendwann werden wir darüber hinwegkommen, auch wenn wir alle Devin für immer vermissen. Aber jetzt, in diesem Augenblick, ist die Trauer endlos.
Die Musik verklingt ganz, Präsidentin Amory geht endlich zum Mikrofon. Im selben Moment hallt in die Stille hinein ein lautes Husten durch das Seitenschiff. Ich zucke zusammen und hebe den Kopf. Quietschen. Ruckartiges Schaben über den Steinboden.
Dann höre ich Würgegeräusche.
Oh mein Gott.
William ist noch in der Kirche.
«Ach du Scheiße, wer ist das denn?», raunt Morris neben mir, und auch in den Reihen vor uns drehen die Leute den Kopf.
Eine Tür donnert gegen die Wand, als jemand nach draußen stürzt.
Abrupt springe ich auf. Unter einer geflüsterten Entschuldigung schiebe ich mich an Sheela und Morris vorbei zum Mittelgang. Mein Magen verkrampft sich vor Angst, als ich mich zwinge, ruhig und gelassen zum Ausgang zu gehen. Sie dürfen William auf keinen Fall in diesem Zustand sehen.
Ich habe Glück, dass mich niemand beachtet, weil alle zum Seitenschiff starren und dann Präsidentin Amory die Anwesenden zur Ordnung ruft. Trotzdem fühlt sich der Weg durch die Kirche an, als würde ich über glühende Kohlen laufen. Schnell ziehe ich die schwere Eichentür auf. Ich warte nicht darauf, dass sie ins Schloss fällt. Sobald mich die Kälte von draußen trifft, fange ich an zu rennen.
4. Kapitel
Eden
Ich laufe über den Kiesweg um das Gebäude herum. Die grauen Steinmauern der Dwight Church werden von Strahlern angeleuchtet, aber der Park liegt größtenteils im Dunklen. Seit wann schalten sie über Nacht die Hälfte der Parkbeleuchtung aus?
«Will?», flüstere ich. «Garrett?»
Keine Antwort.
Verdammt! Laut zu rufen kann ich nicht riskieren. Hinter der Kirche ist aber niemand. Ich schlage den Weg ein, der zum Wohnheim führt, in der Hoffnung, dass die beiden dorthin unterwegs sind, bleibe dann aber stehen, weil meine Schritte im Kies so laut sind, und horche für einen Moment in die Dunkelheit.
Ein leises «Fuck» erklingt. Garrett. Erleichtert renne ich in Richtung seiner Stimme weiter. Weg von der Kirche und tiefer in den Park hinein, schlittere über altes Laub, als ich den Kiesweg verlasse und auf das feuchte Gras trete.
Etliche Meter vom Weg entfernt leuchtet ein Handylicht auf. In seinem Schein sehe ich Williams Silhouette, die sich über einen Strauch beugt. Mit einer Hand an einer Eiche abgestützt kotzt er ins Gebüsch, während Garrett daneben aufstöhnt. Und dann zusammenzuckt, als ich ihn am Arm berühre.
«Scheiße, Eden, hast du mich erschreckt!»
«Ich habe gehofft, ihr wärt schon im Wohnheim.» Mein Puls rast, meine Knie zittern. Gott sei Dank hat William sich nicht mitten in der Kirche übergeben.
«Wären wir auch, wenn Grantham sich nicht gesträubt hätte wie ein verdammter Esel.» Mit dem Handy leuchtet er an sich selbst runter über seine schwarze Stoffhose bis zu seinen Schuhen. «Wenn meine Klamotten was abgekriegt haben, bringe ich dich um», schnauzt er William an.
Wenn wir nicht sofort hier verschwinden, wird Amory das für ihn übernehmen.
«Bezahle ich dir», stößt William, immer noch würgend, hervor. «Deine verdammten Klamotten.»
Es geht hier gerade nicht um Geld, und wäre William nüchtern, wüsste er das auch. Ich kann mir Garretts genervtes Gesicht gut vorstellen, aber das Licht reicht nicht aus, um es zu erkennen.
Ich habe keinen Schimmer, wie ich William beistehen soll. Er will mich nicht sehen, nicht mit mir reden, und schon gar nicht will er sich von mir helfen lassen. Was soll ich machen, wenn er mich wieder von sich stößt? Als erneut eine Welle der Übelkeit durch seinen Köper geht, halte ich wenigstens seinen Mantel zur Seite, damit der nicht noch mehr abbekommt.
Es tut mir weh, zu sehen, wie er sich zusammenkrümmt und sich mit dem Kopf gegen den Baum lehnt. Es tut mir weh, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als sich zu betrinken. Es tut mir weh, dass ich daran schuld bin. Und in Momenten wie jetzt, wenn diese Gedanken besonders quälend sind, wünschte ich mir, er hätte mich niemals aus dem Wasser gezogen. Sie wären damit fertiggeworden, so viel leichter fertiggeworden, wenn ich es gewesen wäre. Sie alle.
Langsam und mit einem Stöhnen kommt William wieder hoch und wischt sich mit dem Ärmel über den Mund. Garrett strahlt ihn mit seinem Smartphone an, deshalb fällt mir auf, dass Williams Augen tränen und seine Haut beängstigend blass aussieht.
«Geht es dir besser?» Ich will nicht, dass es mitleidig klingt, aber der Blick, den William mir zuwirft, sagt mir, dass es nicht nur mitleidig, sondern auch noch verletzend bei ihm ankam.
«V-viel besser.» Sein Auflachen ist bitter. Mit den Fingern kämmt er sich das wirre blonde Haar zurück, stößt sich vom Baum ab und schwankt gegen mich.
Damit habe ich nicht gerechnet. Durch das Gewicht seines Körpers taumle ich zurück und spüre einen Schmerz am Bein, als mir die Sträucher die Strumpfhose aufreißen. Ich beiße die Zähne zusammen und raune Garrett zu, dass er ihn festhalten soll.
William wehrt sich nicht, aber als wir losgehen, schlägt er die falsche Richtung ein. «Ich muss … wieder rein.»
Das kann er nicht ernst meinen. «Du kannst auf keinen Fall zurück. Du gehörst ins Bett.»
«Mir geht’s bestens.»
Ich glaube ihm, dass er das wirklich denkt. Aber auch wenn er mich dafür hassen wird, ich werde nicht zulassen, dass er betrunken Devins Trauerfeier sprengt und vom College fliegt. Spätestens morgen früh würde er das bereuen. Und ich, dass ich ihn nicht daran gehindert habe. Wir alle bereuen schon jetzt so vieles.
Denkst du, Devin würde wollen, dass du deine Zukunft einfach so wegwirfst? Ich presse die Lippen zusammen, weil ich das nicht laut sagen kann. «Wie viel hast du getrunken?» Nicht dass die Antwort auf diese Frage irgendeine Rolle spielt.
«Nicht genug.» Seine Stimme ist immer schon rau gewesen, aber die Kälte darin verursacht mir eine Gänsehaut.
«Will, ich …»
Er hebt abwehrend die Hand, weil er wieder von einem Würgen erfasst wird und sich vornüberbeugt, was mich sofort zum Verstummen bringt.
Garrett seufzt, und ich werfe ihm einen hilflosen Blick zu. Nachdem die erneute Welle der Übelkeit verebbt ist, richtet William sich schwer atmend auf. «In Ordnung, ihr habt mich überredet.»
«Kannst du laufen?», frage ich ihn erleichtert.
Er sieht an mir vorbei. «Ich denke schon.»
Garrett packt ihn unter der rechten Schulter, versucht aber gleichzeitig so viel Abstand zu halten, dass er nicht mit Williams Mantel in Berührung kommt. «Wenn du noch mal reihern musst, sag es vorher, okay? Ich habe keinen Bock darauf, von dir angekotzt zu werden.»
William hustet, und Garrett gibt sofort einen angewiderten Laut von sich. «Mach keinen Scheiß, Alter!»
Ich dirigiere die beiden zurück auf den Weg und bete, dass uns keiner der Dozenten begegnet. Wenn wir Glück haben, sind die meisten in der Kirche oder haben die Insel für die Nacht verlassen, auch wenn die letzte Fähre erst nach der Trauerfeier geht.
Von der Kirche bis zum North Park House sind es vielleicht vierhundert Meter, aber sie kommen mir vor wie die Strecke von hier bis nach Boston, weil William sich zwischen unseren Armen hängen lässt wie ein nasser Sack. Er lässt zu, dass ich ihn festhalte, aber es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, denn würde ich loslassen, könnte Garrett allein ihn nicht halten.
Im Kopf gehe ich durch, was ich gleich im Wohnheim erledigen muss: aus der Küche eine Schüssel holen. William eine Kopfschmerztablette einflößen, damit er den Tag morgen überlebt. Ihn nicht allein lassen, falls es ihm schlechter geht und wir einen Arzt rufen müssen. Was wahrscheinlich am schwierigsten wird, weil ich die Letzte bin, die er bei sich haben will.
Als wir es bis zum Wohnheim geschafft haben, stützt William sich auf Garrett, während ich die Tür mit meiner Schlüsselkarte entriegle. Ich wünschte, es gäbe einen Aufzug, dann müssten wir uns jetzt nicht auch noch die Stufen nach oben quälen. So brauchen wir eine Ewigkeit, bis wir im dritten Stock ankommen, und jedes Mal, wenn William wankt, habe ich Angst, er stürzt die Treppe runter. Als das Flurlicht auf Williams Gesicht fällt, sehe ich, dass er von der Anstrengung völlig verschwitzt ist.
«Okay, Grantham, hast du deine Zimmerkarte in der Tasche?»
Als William nicht reagiert, tätschelt Garrett ihm unsanft mit der flachen Hand die Wange.
«Garrett, hör auf. Du siehst doch, dass er völlig fertig ist.»
«Ja und? Willst du, dass er uns hier auf dem Flur einpennt?»
«Nein. Trotzdem musst du nicht grob werden.»
William stößt ein heiseres Lachen aus, als wäre es in dieser Situation besonders absurd, dass wir uns seinetwegen auch noch streiten.
«Die beschissene Schlüsselkarte, Mann!»
«M-mantel», keucht William und lässt seinen Hinterkopf gegen die Zimmertür sinken. «Glaube ich.» Er schließt die Augen und atmet mit offenem Mund, während Garrett ihn abstützt, damit er nicht einfach zur Seite wegkippt. «Erinnere mich daran …», fängt William an und schluckt, führt den Satz aber nicht zu Ende.
Ich schiebe eine Hand in seine linke Manteltasche, aber da ist nur sein Walkman drin. Wo ist seine verfluchte Zimmerkarte? «Woran soll ich dich erinnern?»
Er überlegt, öffnet die Augen aber nicht. «Dass ich Garrett verabscheue.»
«Beruht auf Gegenseitigkeit», knurrt Garrett, aber er wirkt trotzdem besorgt.
Ich schlage Williams Mantel auf und kontrolliere die Innentasche. Auch hier Fehlanzeige. Mit der flachen Hand fahre ich über seine Hosentasche. Er duldet zwar, dass ich ihn absuche, aber er macht keinerlei Anstalten, mir zu helfen. Und ich finde die Karte einfach nicht.
«Ich kann ihn nicht mehr lange halten. Dann schaffen wir ihn eben in den Aufenthaltsraum.» Mit dem Kinn nickt Garrett zum Ende des Flurs. «Ein Sofa wird ja wohl reichen.»
«Keine gute Idee. Dann stolpert noch jemand aus Versehen über ihn. Sollte jemand einen Kontrollgang machen …»
«Glaubst du, dass einer der Profs heute Nacht durch das Wohnheim läuft, oder was?» Garrett schüttelt genervt den Kopf. «Und selbst wenn. Selber schuld. Er hätte sich ja nicht so die Kante geben müssen.»
«Bringen wir ihn in mein Zimmer.» Auch wenn mir klar ist, dass er das kaum wollen wird, kann ich William nicht einfach sich selbst überlassen.
William sackt in die Knie, noch bevor wir eine endgültige Entscheidung getroffen haben, und Garrett stemmt ihn mit ganzem Körpereinsatz wieder hoch.
«V-v-vergisses», nuschelt er.
«Zu mir kommst du garantiert nicht», schnauzt Garrett ihn an. «Entweder Edens Zimmer oder wir parken dich in der Dusche, da kannst du auch am wenigsten anrichten. Du entscheidest.» Doch er wartet Williams Reaktion nicht ab, er zerrt ihn einfach mit sich.
Als ich sicher bin, dass Garrett das alleine hinbekommt, laufe ich voraus, um die Tür aufzuschließen und die Decke von meinem Bett zu ziehen. William streift sich umständlich den Mantel ab. Er schwankt dabei so sehr, dass ich Angst habe, er stürzt und verletzt sich gleich noch. Ich helfe ihm, das schwarze Sakko über die Schultern nach unten zu ziehen, dann sackt er auf dem Bett zusammen.
«Wenn was ist, wisst ihr ja, wo ich wohne», meint Garrett. «Süße Träume, Grantham.»
William zieht die Beine an und kneift die Augen gegen das Licht zusammen. «Verschwinde, Endicott.»
Garrett schnaubt abfällig, dann nimmt er mich beiseite. «Ist es okay, wenn ich dich mit ihm allein lasse?» Unschlüssig schaut er von William zu mir. «Ich meine, wirst du mit ihm fertig?»
Ich nicke langsam. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich heute noch mal bewegt. Und ich werde Sun-young fragen, ob ich bei ihr schlafen kann. Danke, Garrett.»
Garrett öffnet den Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn dann aber wieder und verabschiedet sich, bevor er aus dem Zimmer verschwindet. Ich schalte die große Deckenlampe aus, damit William nicht länger geblendet wird, und knipse stattdessen meine Schreibtischlampe an, sodass er sich orientieren kann, sollte er später in der Nacht irgendwann wach werden.
Erst jetzt komme ich dazu, meine Winterjacke auszuziehen. Ich hänge sie über Williams Sakko auf den Schreibtischstuhl, dann besorge ich aus der Küche eine Wasserflasche und eine Plastikschüssel.
«Will?» Unschlüssig bleibe ich vor dem Bett stehen und stupse ihn schließlich vorsichtig an der Schulter an. Erst beim zweiten Mal gibt er mit einem Stöhnen zu verstehen, dass er noch wach ist. «Wenn dir wieder schlecht wird – ich habe eine Schüssel neben das Bett gestellt. Auf den Boden. Du musst nur die Hand ausstrecken, okay?»
Ich glaube nicht, dass etwas von dem, was ich sage, wirklich zu ihm durchdringt. «William Grantham», flüstere ich. «Das ist wichtig. Hast du mich verstanden? Kotz mir bitte nicht ins Bett.»
Nur … in Wirklichkeit ist es komplett unwichtig, oder? Bei all dem, was passiert ist, kommt es mir geradezu bescheuert vor, mir Sorgen um so was zu machen wie schmutzige Bettwäsche.
William öffnet den Mund, seufzt leise. «Schüssel. Neben dem Bett. Verstanden.» Eine Hand presst er an seine Schläfe, wahrscheinlich fängt es jetzt schon an, dahinter zu hämmern. Ich sollte ihn sich selbst überlassen, aber …
«Willst du noch was trinken? Soll ich dir eine Aspirin in Wasser auflösen?» Mit der rechten Hand fasse ich an seine Stirn – sie ist schweißnass. Er schüttelt den Kopf – was nein bedeuten kann, aber genauso gut kann es sein, dass er mich abschütteln will. Also ziehe ich betreten die Hand zurück.
«Kein Wasser», murmelt er.
Nein, kein Wasser. Für einen winzigen Moment habe ich es fast vergessen. Als wäre das hier eine normale Nach-Party-Situation, in der man sich um den anderen kümmert. Aber das hier ist nicht normal. Das hier ist eine «Die-Trauer-ist-so-schlimm-ich-halt-es-nicht-mehr-aus»-Situation, und die Erinnerung presst mein Herz zu einem Klumpen zusammen. Mit einem Schlag ist alles wieder da. Unsere letzte Begegnung. Der Moment, als wir beide durchnässt an der Uferböschung gestanden haben und Will mich von sich gestoßen hat.
Fass mich nicht an. Nie wieder.
Nie wieder.
5. Kapitel
Eden
Als ich vom Bett zurückweiche, rollt William sich wie ein Embryo zusammen. Für ein paar Sekunden lausche ich auf seinen Atem. Dann fällt mir ein, dass es höllisch unbequem ist, mit Lederschuhen zu schlafen. Er reagiert nicht, als ich ihn frage, ob er sie nicht lieber ausziehen will. Er reagiert auch nicht, als ich schließlich einfach die Schnürsenkel aufziehe und sie ihm umständlich von den Füßen zerre und unter mein Bett schiebe. Ich breite die Decke über ihm aus.
«Danke», nuschelt er.
Okay, er hat es doch gemerkt. Ob er denkt, dass es Garrett war, weil er nicht mitgekriegt hat, dass der längst gegangen ist. Oder ist es nur seine typische Höflichkeit. Ich wünschte, es würde etwas bedeuten, dass er hier ist, aber das wäre er nicht, wenn er eine andere Wahl hätte.
Ich sollte zur Trauerfeier zurück, aber ich komme auf keinen Fall unbemerkt in die Kirche. Jeder würde es mitkriegen, und das würde nur Fragen aufwerfen. Sun-young anrufen, um zu fragen, ob ich in ihr Zimmer kann, ist zwecklos, solange sie noch in der Kirche ist. Und ich will William ohnehin nicht allein lassen, bevor ich nicht sicher bin, dass er den Abend einigermaßen unbeschadet übersteht. Nur dass Williams Mantel müffelt, und den kann ich so nicht über Nacht in meinem Zimmer lassen.
Ich hebe ihn auf und hole die wenigen Sachen aus den Taschen raus, damit sie bei der Reinigungsprozedur nichts abbekommen. Nicht genau hinsehen. Es geht mich nichts an, was William in seinen Taschen hat, deshalb lasse ich die Sachen schnell auf meinen Tisch fallen. Trotzdem registriert mein Gehirn jedes einzelne Teil: Williams Walkman, einen zusammengeknüllten Zettel, der um einen Medikamentenblister gewickelt ist, den verbeulten Deckel einer Whiskeyflasche, ein dünnes Taschenbuch mit einem fremdsprachigen Titel, von dem ich vermute, dass es deutsch ist. Williams blaues Notizbuch mit seinem eingeprägten Namen und Stiftschlaufe. Ich will nicht darüber nachdenken, aber vor ein paar Wochen haben wir uns darin noch gegenseitig Nachrichten geschrieben. Als Devin noch nicht tot war und ich dachte, hier in Woodford würde ich wieder so was wie ein normales Leben haben. Ich würde alles dafür geben, Williams Nachrichten noch einmal zu lesen, aber sein Notizbuch ist für mich jetzt tabu.
Ich glaube, William ist weggenickt. Als ich mich vorsichtig über ihn beuge, geht sein Atem ruhig und sein Arm ruht schlaff auf dem Kopfkissen. Wahrscheinlich kann ich es riskieren, ihn kurz sich selbst zu überlassen. Mit einem letzten Blick auf die dunkelblonden Haarsträhnen, die sich auf meinem Kopfkissen ausbreiten, husche ich mit dem Mantel aus dem Zimmer.
Das Wohnheim ist wie ausgestorben. Wahrscheinlich sind noch alle in der Dwight Church, denn ich laufe über den Flur, ohne jemandem zu begegnen. Im Badezimmer halte ich den Saum von Williams Mantel direkt unter den Wasserhahn und reibe die Flecken mit meinem Shampoo ein. Ob ich es damit besser mache? Ich weiß es nicht. Vielleicht ruiniere ich seinen Mantel auch vollends. Ist bestimmt Kaschmir und superempfindlich. Ich hoffe einfach mal, dass das Teil es überlebt, von mir gewaschen und ausgewrungen zu werden, und wuchte den schweren Mantel zum Trocknen über eine der Duschkabinen.
Das Brennen an meiner Wade erinnert mich daran, dass ich mir die Strumpfhose am Gebüsch zerrissen habe, und ich schlüpfe aus den zu engen Ballerinas, die ich mir von Sun-young ausgeliehen habe. Im Gegensatz zu ihr sehe ich in den schwarzen Klamotten aus, als würde ich zum Cast einer Gothic-Serie gehören. Vorsichtig rolle ich die Strumpfhose nach unten, um die kleine Schürfwunde zu begutachten. Im Licht der Badezimmerlampe sieht es nicht weiter schlimm aus. Es ist nur unangenehm, wenn man es anfasst, also fasse ich es einfach nicht an.
Die kaputte Strumpfhose stopfe ich in den Müll und tapse mit den Schuhen in der Hand zurück in mein Zimmer.
Die Tür öffnet sich mit einem leisen Klick. Erst denke ich, William hat sich keinen Millimeter bewegt, aber dann fällt mir auf, dass die Decke halb auf den Boden hängt und er die Beine ausgestreckt hat. Die Schüssel ist unberührt. Aber als ich das Shampoo zurück an seinen Platz räumen will, stelle ich fest, dass das kleine Waschbecken in meinem Zimmer quasi explodiert ist. William hat alles zerwühlt. Die Zahnpasta liegt geöffnet und halb zerdrückt im Waschbecken, meine Zahnbürste ebenso. Der Becher ist noch halb voll und das Handtuch hängt nass über dem Rand. Na ja, immerhin hat er es allein zurück ins Bett geschafft.
Möglichst leise räume ich die Sachen weg und ziehe aus dem Kleiderschrank eine weite Jogginghose und ein Shirt heraus, damit ich endlich aus dem Kleid schlüpfen kann. William liegt mit dem Gesicht zur Wand, aber es wäre ohnehin egal, er hat mich mehr als einmal nackt gesehen. Schnell schlüpfe ich in die frischen Sachen.
Mit dicken Wollsocken an den Füßen setze ich mich auf meinen Schreibtischstuhl und ziehe die Beine an. Es ist erst halb sieben. Noch mehr als genug Zeit, Sun-young vom Flur aus anzurufen. Oder die wenigen Meter zu ihrem Zimmer zu laufen, wenn die Trauerfeier vorbei und sie wieder zurück ist. Wieder einmal wird mir bewusst, wie aufgeschmissen ich ohne Handy bin. Normalerweise würde Dad sich heute melden und fragen, wie die Gedenkveranstaltung war, aber es ist ihm peinlich, hier im Flur anzurufen, als wäre er ein Helikoptervater. Dabei ist er alles andere als das. Ich vermisse mein Handy. Ich vermisse es, die alten Nachrichten zu lesen oder mir meine Fotos anzusehen.
Vor ein paar Wochen, noch vor Devins Unfall, habe ich William mein kaputtes Smartphone gegeben, und er wollte es reparieren lassen. Vermutlich hat er nicht mehr daran gedacht, und ich kann ihn auch unmöglich danach fragen. Keine Ahnung, wie Will es aushält, ohne Handy zu leben. Ich hatte alle Nachrichten und Fotos von meinem besten Freund Lark darauf, Will hat von Devin nicht einmal mehr das. Ob er Fotos von ihm in der kleinen Schachtel auf seinem Schreibtisch hat? Kann er sie sich überhaupt ansehen?
Ich blicke zum Bett. William gibt bis auf ein leises Atemgeräusch keinen Laut von sich, und trotzdem lässt sich seine Anwesenheit unmöglich ignorieren. Der Waschmittelgeruch, der seinem Hemd anhaftet, der Alkohol. Das halb verdunstete Gefühl der Vertrautheit. Wie lange dauert es, bis sich der ganze Alkohol in seinem Blut abgebaut hat? Sechs Stunden? Noch länger? Hängt davon ab, wie viel er getrunken hat.
Nicht genug.
Nicht genug, um die Trauerfeier zu ertragen?
Nicht genug, um mich zu ertragen?
Wieso tut das so weh? Ich sollte aufhören, so viel in seine Worte hineinzuinterpretieren. Er ist betrunken. Mit einem Seufzen schiebe ich den Bücherstapel und die losen Zettel auf meinem Schreibtisch bis zur Kante, um Platz zu haben. Der Liebesroman mit dem blauen Leineneinband, in den wir beide Blackout Poetrys gemalt haben, liegt ganz oben auf dem Stapel. Nach kurzem Zögern nehme ich ihn in die Hand und schlage die Seiten auf. Auf der Fahrt zu meinem Dad habe ich versucht, Williams Gesicht auf eine der Seiten zu zeichnen. Sechs Wörter habe ich mit einem schwarzen Kuli umkreist und freigelassen, der Rest ist kaum noch zu lesen.
you
you
you