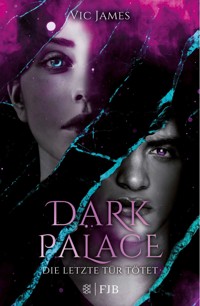14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Palace
- Sprache: Deutsch
Die Wattpad-Sensation jetzt als Buch! Zehn Jahre Sklavenarbeit für alle. Fast alle. In England muss jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, zehn Jahre lang als Sklave arbeiten. Lukes Familie will diese Sklavenjahre gemeinsam durchstehen, im Dienst der mächtigen Herrscherfamilie Jardine. Doch nun rast Lukes Herz vor Angst, als er plötzlich von den anderen getrennt und in die laute und schmutzige Fabrikstadt Millmoor gebracht wird. Die Arbeit dort ist besonders hart. Seine Schwestern sind mit den Eltern am prunkvollen Hofe der Jardines den rücksichtslosen Machtspielen und eiskalten Intrigen der Elite ausgesetzt. Vor allem der junge Adlige Silyen verfolgt mit seinen ungeheuerlichen magischen Fähigkeiten eigene Ziele. Und Lukes Schwester Abi verliert ihr Herz an den Falschen. Also das verstand man unter ›Geschick‹, dachte Luke, als er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ein so unerträglicher Schmerz, dass man sich wünschte, man wäre tot. Wie sollte man dagegen ankämpfen? Wie konnte man Menschen besiegen, die dazu fähig waren? Nicht Menschen – Monster. Es spielte keine Rolle, dass es nur wenige von ihnen gab: Diese Wenigen genügten völlig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vic James
Dark Palace
Zehn Jahre musst du opfern
Über dieses Buch
Die Wattpad-Sensation jetzt als Buch!
Zehn Jahre Sklavenarbeit für alle. Fast alle.
In England muss jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, zehn Jahre lang als Sklave arbeiten. Lukes Familie wollte diese zehn Jahre gemeinsam durchstehen, doch nun rast Lukes Herz vor Angst, als er von ihnen getrennt und in die laute und schmutzige Fabrikstadt Millmoor gebracht wird. Die Arbeit dort ist hart und riskant, und er schuftet bis zur Erschöpfung.
Lukes Schwester Abi befindet sich derweil mit dem Rest der Familie am prunkvollen Hofe der magischen Elite. Dort sind sie rücksichtslosen Machtspielen und eiskalten Intrigen ausgesetzt. Denn der junge Adlige Silyen verfolgt mit seinen ungeheuerlichen Fähigkeiten niemals andere Interessen, als seine eigenen. Und Abi verliert ihr Herz an den Falschen.
Also das verstand man unter ›Geschick‹, dachte Luke, als er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ein so unerträglicher Schmerz, dass man sich wünschte, man wäre tot.
Wie sollte man dagegen ankämpfen? Wie konnte man Menschen besiegen, die dazu fähig waren? Nicht Menschen – Monster. Es spielte keine Rolle, dass es nur wenige von ihnen gab: Diese Wenigen genügten völlig.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Vic James hat ihr Debut zunächst auf Wattpad veröffentlicht, wo eine große Community begeistert die Entstehung des Romans verfolgte. 2015 wurde die erste Fassung von „Dark Gifts“ dann bei den “Watty Awards” mit dem ‘Talk of the Town’-Award ausgezeichnet. Sie hat Geschichte und Englisch am Merton College in Oxford studiert, wo Tolkien einst Professor war. Später zog sie nach Rom, um in den geheimen Archiven des Vatikans für ihre Promotion zu forschen und arbeitete außerdem als TV-Produzentin. Inzwischen konzentriert sie sich ganz auf das Schreiben und lebt in London, Notting Hill.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Gilded Cage« bei Pan Macmillan, London
© 2015 by Vic James Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.marie-grasshoff.de
Coverabbildung: © shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490249-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog Leah
1 Luke
2 Silyen
3 Abi
4 Luke
5 Bouda
6 Luke
7 Abi
8 Luke
9 Abi
10 Euterpe
11 Gavar
12 Luke
13 Bouda
14 Luke
15 Abi
16 Luke
17 Luke
18 Abi
19 Gavar
20 Luke
21 Abi
22 Luke
Epilog Abi
Danksagung
Für Mum
Danke für alles, vor allem für die Bibliotheksbücher
PrologLeah
Zuerst hörte sie das Motorrad, dann das galoppierende Pferd – zwei weit entfernte Geräusche in der Dunkelheit, die schnell näher kamen, während sie hastig weiterlief.
Abgesehen vom Knirschen ihrer Schuhe auf dem Untergrund, verursachte Leah nicht den geringsten Laut, und das Gleiche galt für das Kind, das sie fest an sich drückte. Doch ihre Verfolger brauchten sie nicht zu hören, um sie zu finden. Die Grenzmauer von Kyneston war der einzige Ort, zu dem sie fliehen konnte. Und wenn sie die Mauer endlich erreicht hatte, bildete das Kind in ihren Armen – ihre Tochter Libby – die einzige Hoffnung auf eine Flucht.
Der Mond kam nur gelegentlich hinter den hohen, jagenden Wolken hervor, aber der schwache Schimmer der Mauer strahlte ihr beständig vom Horizont entgegen. Der Anblick erinnerte sie an einen Lichtstreifen, der aus einem hellerleuchteten Flur unter der Schlafzimmertür hindurchfiel und albtraumgeplagten Kindern Trost spendete.
Hatte sich ihr Leben auf Kyneston genau dazu entwickelt: zu einem Albtraum? Einst hatte es scheinbar all ihre Träume erfüllt.
Das Röhren des Motorrads kam nun näher, während das Donnern der Hufe dahinter zurückblieb. Bei ihren Verfolgern konnte es sich nur um Gavar und Jenner handeln. Beide befanden sich weit links von ihr, steuerten aber in einer schnurgeraden Linie auf sie zu. Allerdings erreichte Leah deutlich vor ihnen die Mauer.
Erleichtert ließ sie sich einen Moment dagegensinken. Während sie keuchend Luft holte, ruhte ihre Hand auf dem uralten Mauerwerk. Die Steine fühlten sich unter ihren Fingern kühl an. Sie waren feucht und mit Moos bedeckt – ein starker Kontrast zum Eindruck von Wärme, den das unnatürlich leuchtende Mauerwerk erzeugte. Aber so äußerte sich nun mal die Macht des Geschicks. Weder dieser Ort noch die Menschen, die hier lebten, hatten irgendetwas Natürliches an sich.
Höchste Zeit zu verschwinden.
»Bitte, mein Schatz. Bitte«, flüsterte Leah, zog eine Ecke der selbstgestrickten Decke weg und drückte einen Kuss auf Libbys seidiges Köpfchen.
Die Kleine quengelte, als Leah ihren Arm sanft unter der Decke hervorholte und ihre kleine Hand nahm. Leahs Brust hob und senkte sich gleichermaßen vor Anstrengung und Angst, während sie sich gegen die Wand lehnte und die Handfläche ihrer Tochter dagegendrückte.
An den Stellen, wo die winzigen Finger das verwitterte Mauerwerk berührten, leuchteten die Steine stärker auf. Unter Leahs wachsamen Augen breitete sich das Leuchten aus und strömte durch den Mörtel zwischen den Steinen. Zunächst war der Schein nur schwach, wenn auch deutlich sichtbar. Aber dann sprang das Licht ruckartig höher und kletterte in Richtung Mauerkrone, immer kräftiger, intensiver, stärker. Und es bildete eine Kontur: eine gerade, senkrechte Linie und dann einen Bogen. Das Tor.
Aus der Dunkelheit drang ein mechanisches Fauchen zu ihr. Der Motor des Motorrads wurde abgewürgt. Und erstarb.
Dann durchbrach ein anderes, näheres Geräusch die Nacht: ein lässiges Klatschen. Leah zuckte zurück, als hätte sie tatsächlich einen Schlag ins Gesicht bekommen.
Jemand wartete dort in der Dunkelheit. Und als die hochgewachsene, schlanke Gestalt ins Licht trat, sah sie, dass er es war. Natürlich. Silyen. Der jüngste der drei Jardine-Brüder, aber nicht der unbedeutendste. Er führte alle durch das Tor nach Kyneston – all jene, die hier ihre Pflichtzeit abdienten. Und es war sein Geschick, das sie auf dem Familienanwesen festhielt. Wie hatte sie sich nur einbilden können, dass er ihr die Flucht erlauben würde?
Der langsame Applaus brach ab. Eine seiner schmalen Hände mit den abgekauten Fingernägeln deutete auf das Gitterwerk der Torwölbung.
»Nur zu«, sagte Silyen in einem Ton, als würde er Mutter und Kind zum Tee hereinbitten. »Ich werde dich nicht aufhalten. Mich interessiert die Vorstellung, endlich herauszufinden, wozu die kleine Libby fähig ist. Du weißt ja, dass ich meine eigenen … Theorien habe.«
Leahs Herz raste. Silyen war der letzte der Brüder, dem sie vertraute. Der allerletzte. Trotzdem musste sie die angebotene Gelegenheit nutzen, selbst wenn es sich dabei nur um das Spiel einer Katze handelte, die kurz die Tatze vom Rücken der gefangenen Maus nahm.
Sie musterte sein Gesicht, als könnten der Mondschein und das Geschick-Licht seine wahren Absichten offenbaren. Und als Silyen ihr vermutlich zum allerersten Mal direkt in die Augen sah, glaubte Leah darin etwas zu erkennen. Neugier? Er wollte sehen, ob Libby das Tor öffnen konnte. Falls ihr das gelang, würde er sie beide vielleicht durchlassen. Nur um des Vergnügens willen, bei Libbys Demonstration ihrer Kräfte dabei zu sein – und vielleicht um seinen ältesten Bruder zu ärgern.
»Danke«, sagte sie, kaum lauter als im Flüsterton. »Sapere aude?«
»›Wage, weise zu sein.‹ In der Tat. Wenn du es wagst, werde ich weiser sein.«
Silyen lächelte. Leah wusste jedoch nur zu gut, dass es sich dabei nicht um Mitleid oder Freundlichkeit handelte.
Sie trat einen Schritt vor und drückte Libbys Hand auf das schwach umrissene Tor, das unter den klebrigen Fingern der Kleinen sofort hell aufstrahlte. Wie geschmolzenes Metall in einer Gussform breitete sich das Licht aus: ein kunstvolles Gitterwerk, mit Blättern und phantastisch anmutenden Vögeln, gekrönt von den verschlungenen Buchstaben »P« und »J«. Das Tor sah exakt so aus wie an jenem Tag vor vier Jahren, als Leah in Kyneston eingetroffen war und es sich geöffnet hatte, um sie hereinzulassen. Und zweifellos genauso wie an jenem Tag vor etlichen Jahrhunderten, als es erschaffen wurde.
Doch jetzt blieb das Tor verschlossen. Verzweifelt packte Leah eine der schmiedeeisernen Ranken und zog mit aller Kraft daran. Libby brach nun in lautes Heulen aus. Aber der Lärm spielte jetzt keine Rolle mehr, dachte Leah mit dumpfer Hoffnungslosigkeit. Sie würden das Kyneston-Anwesen an diesem Abend nicht mehr verlassen.
»Na, das ist ja interessant«, murmelte Silyen. »Deine Tochter – das heißt, die Tochter meines Bruders – hat zwar das Blut in ihren Adern, um das Tor zum Leben zu erwecken, aber sie besitzt nicht das Geschick, es zu öffnen. Es sei denn, sie will dir damit zu verstehen geben, dass sie ihre Familie nicht verlassen möchte.«
»Du bist nicht Libbys Familie«, fauchte Leah, wütend vor schierer Angst, und drückte ihr Kind noch fester an sich. Ihre Finger schmerzten vom Kampf mit dem unnachgiebigen Metalltor. »Weder du noch Gavar, noch sonst irgendjemand von eu…«
Ein Schuss ertönte, und Leah schrie laut auf und stürzte zu Boden. Ein heißer Schmerz jagte durch ihren Körper, so schnell und grell, wie das Licht das Tor erhellt hatte.
Gavar schlenderte in aller Ruhe herbei und schaute auf sie herab. Tränen quollen ihr aus den Augen. Einst hatte sie diesen Mann geliebt: Kynestons Erben, Libbys Vater. Er hielt die Waffe noch immer in der Hand.
»Ich habe dich gewarnt«, sagte Gavar Jardine. »Niemand nimmt mir etwas weg, das mir gehört.«
Leah sah ihn nicht an. Stattdessen drehte sie den Kopf, drückte die Wange gegen den kalten Boden und heftete ihren Blick auf das kleine Bündel in der Decke, das nur wenige Schritte entfernt lag. Libby schrie jetzt vor Schmerz und Empörung. Leah sehnte sich danach, ihre Tochter zu berühren und zu besänftigen, aber aus irgendeinem Grund hatte ihr Arm nicht länger die Kraft, selbst diese kurze Entfernung zu überbrücken.
In der Nähe klapperten Hufe und hielten abrupt inne. Ein Pferd wieherte, und zwei Stiefelabsätze trafen auf dem Boden auf. Und hier kam er auch schon, Jenner, der mittlere der Brüder. Der Einzige, der gelegentlich gute Absichten hatte, aber nicht in der Lage war, sie umzusetzen.
»Was tust du da, Gavar?«, rief er. »Sie ist doch kein Tier, das du einfach abknallen kannst. Ist sie verletzt?«
Wie als Antwort auf seine Frage stieß Leah in diesem Moment einen schrillen Schrei aus, der in einem atemlosen Röcheln erstarb. Jenner hastete zu ihr, kniete sich neben sie, und Leah spürte, wie er ihr die Tränen aus den Augen wischte. Seine Finger fuhren sanft über ihr Gesicht.
»Es tut mir leid«, beteuerte er. »So leid.«
In der Dunkelheit, die sich um sie herum ausbreitete und die auch das Leuchten des Tores nicht vertreiben konnte, sah sie, wie Gavar seine Waffe in den Mantel steckte, bevor er sich bückte und ihre gemeinsame Tochter aufhob.
Silyen setzte sich in Richtung des Herrensitzes in Bewegung. Als er Gavar passierte, drehte dieser ihm den Rücken zu und beugte sich beschützend über Libby. Leah konnte nur hoffen, dass er als Vater gütiger sein würde, als er es als Liebhaber gewesen war.
»Silyen!«, hörte Leah Jenners Stimme. Aber er klang weit entfernt, als stünde er beim Haupthaus und würde über den See hinwegrufen. Dabei konnte sie noch immer seine Hand an ihrer Wange fühlen. »Silyen, warte! Kannst du denn nichts tun?«
»Du weißt doch, wie das Ganze funktioniert«, kam seine Antwort, so schwach, dass Leah sich fragte, ob sie sich das vielleicht nur eingebildet hatte. »Niemand kann die Toten wiedererwecken. Nicht einmal ich.«
»Sie ist nicht …«
Aber dann schien Jenner zu verstummen. Und Gavar musste es gelungen sein, Libby zu beruhigen. Und das Tor schien zu verblassen, und sein Geschick-Licht erlosch, denn plötzlich wurde es um sie herum still und dunkel.
1Luke
Es war ein ungewöhnlich heißes Juniwochenende, und Schweißperlen bildeten sich an Luke Hadleys Rückgrat, während er bäuchlings auf einer Decke im Vorgarten lag. Blind starrte er auf die ausgebreiteten Lehrbücher vor ihm. Das Kreischen lenkte enorm ab und dauerte nun schon eine ganze Weile an.
Wenn Abigail hier gelegen und zu lernen versucht hätte, wäre es Daisy und ihren Freundinnen niemals gestattet worden, so einen Krach zu veranstalten. Aber unerklärlicherweise schien Mum sich für Daisys Geburtstag, der zur Party des Jahrhunderts mutiert war, förmlich zu überschlagen. Lukes kleine Schwester und ihre Freundinnen rasten laut quietschend hinter dem Haus hin und her, während irgendeine drittklassige, unerträglich schlechte Boyband durch das geöffnete Wohnzimmerfenster plärrte.
Luke stopfte die Ohrhörer tiefer in die Gehörgänge – so tief wie es gerade noch ging, ohne dabei das Trommelfell zu zerreißen – und drehte die Lautstärke seiner eigenen Musik auf. Aber es nutzte nichts. Der eingängige Rhythmus von »Happy Panda« erhielt Unterstützung durch die sich überschlagenden Stimmen zehnjähriger Mädchen, die die chinesische Sprache massakrierten. Luke stöhnte und ließ das Gesicht auf die aufgeschlagenen Bücher im Gras vor sich sinken. Er wusste, wem er die Schuld geben würde, wenn er in Geschichte und Bürgerrecht durchfiel.
Neben ihm saß Abi, die ihre Abschlussprüfung schon lange hinter sich hatte und gebannt in einem ihrer Lieblingskitschromane las. Luke warf einen Seitenblick auf den Umschlag und zuckte beim Titel gequält zusammen: Die Sklavin ihres Herrn und Meisters. Seine große Schwester hatte das Buch fast zu Ende gelesen und schon das nächste pastellfarbene Gräuel bereitgelegt. Die Versuchung des jungen Erben. Luke war es völlig schleierhaft, wie jemand so Schlaues wie Abigail solch einen Mist lesen konnte.
Aber zumindest war sie dadurch abgelenkt. Untypischerweise hatte Abi nicht ein einziges Mal genörgelt und ihn zum Lernen aufgefordert, obwohl die Ergebnisse dieser Prüfung die wichtigsten in seiner schulischen Laufbahn waren, zumindest bis zum Ende seiner Schulzeit in zwei Jahren. Erneut wandte er sich den Prüfungsfragen aus den vorherigen Jahrgängen zu. Aber die Worte verschwammen vor seinen Augen.
Beschreibe den Aufstand der Ebenbürtigen im Jahr 1642 und erkläre, wie es dadurch zum Sklavenzeit-Vertrag kam. Analysiere die Rollen der folgenden Personen: (a) Charles I, der Letzte König; (b) Lycus Parva, der Königsmörder; (c) Cadmus Parva-Jardine, der Herzens-Reine.
Luke stöhnte genervt und rollte sich auf den Rücken. Diese blöden Namen der Ebenbürtigen schienen nur dafür gemacht, Verwirrung zu stiften. Und wen interessierte es schon, warum die Sklavenzeit eingeführt worden war, vor Hunderten von Jahren? Im Grunde zählte doch nur eines: die Tatsache, dass sie noch immer Gültigkeit besaß. Es musste noch immer jeder Bürger Großbritanniens ein ganzes Jahrzehnt seines Lebens opfern. Abgesehen von den Ebenbürtigen – den Aristokraten mit ihrem besonderen Geschick. Diese Jahre verbrachte man dann innerhalb einer der üblen Sklavenstädte, die auf jede der britischen Großstädte einen düsteren Schatten warfen, ohne Bezahlung und ohne Ruhepause.
Plötzlich bemerkte Luke aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Er setzte sich auf in der Hoffnung auf etwas Ablenkung. Ein Fremder war die Auffahrt hinaufgekommen und warf einen neugierigen Blick durch die Scheiben von Dads Wagen. Was an sich nichts Ungewöhnliches war. Luke sprang auf und ging zu dem Mann.
»Tolles Auto, oder?«, wandte er sich an den Fremden. »Das ist ein Austin-Healey, über fünfzig Jahre alt. Mein Dad hat ihn restauriert. Er ist Automechaniker. Aber ich habe ihm geholfen. Wir haben mehr als ein Jahr dafür gebraucht. Wahrscheinlich könnte ich die meisten Reparaturen jetzt selbst durchführen – mein Dad hat mir so vieles gezeigt und beigebracht.«
»Tatsächlich? Na ja, dann wirst du es vermutlich bedauern, den Wagen gehen zu sehen.«
»Gehen zu sehen?« Luke war verdutzt. »Der Wagen geht nirgendwohin.«
»Ach? Aber das hier ist doch die Adresse in der Anzeige.«
»Kann ich Ihnen helfen?« Abi war neben Lukes Schulter aufgetaucht. Sie versetzte ihm einen sanften Stoß. »Kümmer dich um deine Schulbücher, Bruderherz. Ich mach das schon.«
Luke wollte gerade antworten, dass sie sich die Mühe sparen könnte, weil dieser Mann sich in der Adresse geirrt hätte, als eine Horde kleiner Mädchen um das Haus bog und auf sie zugaloppierte.
»Daisy!«, rief Abi tadelnd. »Du weißt, dass ihr nicht hier vorne spielen dürft. Ich will nicht, dass irgendeine von euch auf die Straße läuft und überfahren wird.«
Daisy trottete zu ihnen. Sie trug einen großen, orangefarbenen Sticker mit einer glitzernden »10« darauf und eine Brustschärpe mit der Aufschrift »Birthday Girl«.
»Also ehrlich.« Daisy verschränkte die Arme. »Das war doch nur für eine Minute, Abi.«
Der Mann, der wegen des Wagens gekommen war, musterte Daisy jetzt eindringlich. War der Typ etwa irgend so ein Perverser?
»›Birthday Girl‹?«, las er die Worte auf Daisys Schärpe. »Du bist heute zehn geworden? Verstehe …«
Einen kurzen Moment verzog er das Gesicht zu einer seltsamen Miene, aber Luke konnte den Ausdruck nicht deuten. Dann betrachtete der Mann die drei Geschwister, die vor ihm standen. Sein Blick war zwar nicht bedrohlich, hatte aber etwas an sich, das Luke veranlasste, beschützend einen Arm um seine kleine Schwester zu legen und sie näher an sich zu ziehen.
»Wisst ihr was … ich werde euren Dad ein anderes Mal anrufen«, verkündete der Mann. »Genieß deine Party, junges Fräulein. Amüsiere dich, solange du es noch kannst.«
Er nickte Daisy zu, machte auf dem Absatz kehrt und schlenderte die Auffahrt hinunter.
»Total schräg«, sagte Daisy gedehnt. Dann stieß sie ein Kriegsgeheul aus und führte ihre Freundinnen in einer hüpfenden, jubelnden Polonaise wieder auf die Rückseite des Hauses.
Total schräg traf es genau, dachte Luke. Und eigentlich galt das für den gesamten Tag, der sich irgendwie nicht richtig anfühlte.
Aber erst am Abend, als er hellwach in seinem Bett lag und grübelte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Der Verkauf des Wagens. Das Tamtam um Daisys Geburtstag. Der verdächtige Mangel an nörgelnden Aufforderungen, endlich für seine Klausuren zu lernen.
Als er gedämpfte Stimmen aus dem Erdgeschoss hörte und die Treppe hinunterstiefelte, fand er seine Eltern und Abi am Küchentisch vor, auf dem ein Haufen Papiere und Dokumente lagen. Und in diesem Moment wusste er, dass er recht hatte.
»Wann hattet ihr vor, es Daisy und mir zu sagen?«, fragte er von der Küchentür aus und verspürte eine Art grimmiger Genugtuung, als er ihre verwirrten Mienen sah. »Wenigstens habt ihr dem armen Mädchen noch erlaubt, die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auszupusten, bevor ihr mit eurem großen Geheimnis herausrückt. ›Herzlichen Glückwunsch, Schätzchen. Mummy und Daddy haben eine Überraschung für dich: Sie werden dich während der nächsten zehn Jahre allein zurücklassen, um ihre Sklavenzeit abzudienen.‹«
Seine Eltern und Abi starrten ihn stumm an. Dad griff nach Mums Hand, die auf dem Tisch ruhte. Elterliche Solidarität – das war nie ein gutes Zeichen.
»Also wie lautet euer Plan? Dass Abi sich um Daisy und mich kümmert? Und wie soll sie das machen, sobald sie ihr Medizinstudium aufgenommen hat?«
»Setz dich, Luke.«
Dad wirkte normalerweise eher gelassen, doch jetzt klang seine Stimme ungewöhnlich ernst. Das ließ bei Luke die erste Alarmglocke schrillen.
Und als er dann die Küche betrat, sah er, wie Abi die Unterlagen hastig zu einem Stapel zusammenschob. Zu einem verdächtig hohen Stapel. Das oberste Blatt trug Daisys Geburtsdatum.
Jetzt klickte es in Lukes Gehirn, und die Erkenntnis bohrte sich wie ein Messer tief in seine grauen Zellen.
»Es geht nicht nur um euch beide, stimmt’s?«, krächzte er. »Es betrifft uns alle. Jetzt, da Daisy zehn geworden ist, ist die Sache legal. Ihr nehmt uns mit. Wir alle werden unsere Sklavenzeit abdienen.«
Er konnte den letzten Satz kaum glauben. Der Gedanke schnürte ihm die Kehle zu.
Innerhalb eines Sekundenbruchteils hatte sich die Sklavenzeit von einer öden Klausurfrage in das nächste Jahrzehnt seines Lebens verwandelt. Fortgerissen von allen und allem, das er kannte. In Manchesters dreckige, unerbittliche Sklavenstadt verschleppt. Millmoor.
»Ihr kennt ja die Redensart.« Luke war sich nicht sicher, ob er seinen Eltern Vorwürfe machte oder sie anflehte. »›Wer seine Sklavenzeit zu alt antritt, wird nicht durchkommen. Wer seine Sklavenzeit zu jung antritt, wird nicht darüber hinwegkommen.‹ Welchen Teil davon habt ihr nicht verstanden? Niemand absolviert seine Zeit in meinem Alter – von Daisys Alter ganz zu schweigen.«
»Deine Mutter und ich haben uns diese Entscheidung nicht leichtgemacht«, erwiderte Dad mit ruhiger Stimme.
»Wir wollen nur das Beste für euch, für euch alle«, sagte Mum. »Und wir sind davon überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung ist. Du bist noch zu jung, um das jetzt zu verstehen, aber das Leben ist für diejenigen, die ihre Sklavenzeit hinter sich haben, viel leichter. Es bietet euch Möglichkeiten – bessere Möglichkeiten, als dein Vater und ich je gehabt haben.«
Luke wusste, was sie meinte. Man war erst dann ein vollwertiger Bürger mit allen Rechten und Pflichten, wenn man seine Sklavenzeit abgedient hatte, denn nur solche Bürger konnten bestimmte Posten innehaben, ein eigenes Haus besitzen oder ins Ausland reisen. Aber Jobs und Häuser lagen für Luke in unvorstellbar weiter Ferne, und zehn Jahre Knechtschaft im Tausch für ein paar Wochen Urlaub in einem fremden Land erschienen ihm nicht wie ein erstrebenswerter Deal.
Die betont vernünftige Haltung seiner Eltern empfand er als brutalen Verrat. Hier ging es nicht um etwas, das seine Eltern einfach so bestimmen konnten, wie beispielsweise neue Vorhänge fürs Wohnzimmer. Hier ging es um sein Leben. Über das sie eine gravierende Entscheidung getroffen hatten, ohne ihn auch nur zu fragen.
Wohingegen sie allem Anschein nach Abi zu Rate gezogen hatten.
»Weil sie achtzehn ist«, erklärte Dad, als er Lukes Blick folgte. »Abigail ist volljährig und kann selbst bestimmen, was sie möchte. Und natürlich sind deine Mum und ich hocherfreut, dass sie beschlossen hat, mit uns zu kommen. Genau genommen hat sie sogar noch sehr viel mehr getan.«
Dad legte einen Arm um Abis Schultern und drückte sie stolz an sich. Was hatte Supergirl denn jetzt schon wieder vollbracht?
»Ist das dein Ernst?«, wandte Luke sich an seine Schwester. »Du hast Angebote von drei verschiedenen Unis für ein Medizinstudium und lässt sie alle sausen, um die nächsten zehn Jahre in Millmoors ›Bank of China‹-Callcenter alle fünf Minuten nin hao zu sagen? Vielleicht stecken sie dich aber auch in die Textilfabrik. Oder in eines der Schlachthäuser.«
»Komm wieder runter, Bruderherz«, erwiderte Abi. »Ich habe meine Uniangebote aufgeschoben. Außerdem geh ich nicht nach Millmoor. Keiner von uns geht dahin. Und jetzt tu, was Dad gesagt hat: Setz dich, und dann werde ich alles erklären.«
Noch immer wütend – aber gleichzeitig auch brennend daran interessiert, zu erfahren, wie man Millmoor entkommen konnte – folgte Luke ihrer Aufforderung. Und dann hörte er mit einer Mischung aus Bewunderung und Entsetzen zu, während Abi ihm erzählte, was sie getan hatte.
Das Ganze war krank. Und furchterregend.
Aber es handelte sich noch immer um Sklavenzeit, und da Luke noch nicht volljährig war, blieb ihm keine Wahl, so oder so. Seine Eltern konnten ihn mitnehmen, wohin sie auch wollten.
Aber wenigstens brachten sie ihn nicht in dieses Rattenloch namens Millmoor.
Am nächsten Morgen weihten Mum und Dad Daisy ein – die die Neuigkeit mit einem Gleichmut hinnahm, der Luke beschämte. Zum ersten Mal erlaubte er sich den Gedanken, dass der Plan seiner Eltern vielleicht doch nicht so verkehrt war und dass sie alle die Sklavenzeit relativ glimpflich überstehen könnten, gemeinsam als Familie.
Wenige Tage später, als Luke das Ganze etwas verdaut hatte, erzählte er seinem besten Freund Simon davon. Simon stieß einen leisen Pfiff aus, als er die große Neuigkeit erfuhr.
»Innerhalb des Arbeitszuteilungsamtes gibt es eine Abteilung namens Landgutdienstleistungen, wo die Ebenbürtigen sich ihre Haussklaven besorgen«, erklärte Luke. »Abi hat dort für uns alle einen Antrag eingereicht. Wir werden in den Süden geschickt, nach Kyneston.«
»Selbst ich hab schon mal von Kyneston gehört.« Simon starrte ihn ungläubig an. »Das ist die Familie Jardine. Ganz hohe Tiere. Lord Jardine ist der unheimliche Kerl, der während unserer Kindheit Kanzler war. Und wofür zum Teufel brauchen sie dich?«
»Keine Ahnung«, räumte Luke ein.
Die Unterlagen sahen für Mum, Dad und Abi klar umrissene Rollen vor: als Krankenschwester für das Landgut, als Kynestons Kraftfahrzeugmechaniker und irgendein Posten als Sekretärin. Aber weder für Daisy noch für ihn fanden sich genauere Angaben – vermutlich, weil sie noch minderjährig waren, hatte Abi erklärt. Vermutlich würden sie keine feste Stelle bekommen, sondern einfach nur irgendwelche Aufgaben erledigen, die man ihnen täglich neu zuteilte.
Luke hatte sich ausgemalt, was damit gemeint sein konnte. Vielleicht die vergoldeten Toiletten des Herrenhauses putzen? Oder die Ebenbürtigen bei den Mahlzeiten bedienen und mit zurückgeschleimten Haaren und weißen Handschuhen Erbsen aus einer silbernen Schüssel vorlegen? Nichts davon erschien ihm wirklich verlockend.
»Und Daisy …«, fuhr Simon jetzt fort. »Welche Verwendung haben die Jardines für so ein kleines Kind? Und wozu brauchen sie überhaupt eine Krankenschwester? Ich dachte immer, die Ebenbürtigen würden ihr Geschick nutzen, um sich selbst zu heilen.«
Luke hatte so etwas Ähnliches angenommen. Aber Abi – allzeit bereit, irgendwelche Zweifel aus dem Weg zu räumen – hatte darauf hingewiesen, dass niemand genau wisse, wozu die Ebenbürtigen ihr Geschick nutzten. Was es umso aufregender machte, die Sklavenzeit auf einem ihrer Herrensitze zu absolvieren, fand sie. Und Daisy hatte dazu derart heftig genickt, dass es an ein Wunder grenzte, dass ihr Kopf nicht abgefallen war. Nicht mal die Ebenbürtigen würden das wieder beheben können, überlegte Luke.
Der Sommer verging quälend langsam. Eines Morgens Mitte Juli stapfte Luke die Treppe hinunter, wo er einen Makler vorfand, der gerade potentielle Nachmieter im Haus herumführte. Und kurz darauf füllte sich der Flur zunehmend mit Umzugskisten, in die ihre persönlichen Sachen während ihrer Sklavenzeit eingelagert werden sollten.
Anfang August traf Luke sich mit ein paar Freunden aus der Fußballmannschaft seiner Schule und teilte ihnen die unfrohe Botschaft mit. Ihre Reaktionen bestanden aus Schock, Mitleid und dem Vorschlag, zu einem Abschiedsumtrunk in einen Pub zu gehen, dessen Wirt dafür bekannt war, dass er das Alter seiner jugendlichen Gäste schlecht einschätzen konnte. Aber letztendlich hatten sie nur eine Weile im Park Fußball gespielt.
Und sie hatten keine Pläne für ein weiteres Treffen vereinbart.
Zwölf Tage vor dem Umzug kehrte der Mann zurück, der sich an Daisys Geburtstag nach dem Wagen erkundigt hatte. Luke sah zu, wie sein Vater die Autoschlüssel überreichte, und musste sich abwenden. Er würde nicht in Tränen ausbrechen, schon gar nicht wegen eines Autos.
Aber er wusste, dass er weniger um den Wagen trauerte als vielmehr um das, was er repräsentierte. Bye-bye Fahrstunden im Herbst. Adieu Unabhängigkeit. Macht’s gut, beste Jahre meines Lebens.
Abi versuchte ihn aufzuheitern, aber wenige Tage später musste er sie trösten. Er sah ihre Silhouette, als sie mit gesenktem Kopf und bebenden Schultern in der Küchentür stand. Sie hielt einen aufgerissenen Briefumschlag in der Hand. Ihre Schulabschlussergebnisse. Die hatte er völlig vergessen.
Anfangs dachte er, Abi hätte nicht den erhofften Notendurchschnitt erreicht. Doch als er sie in den Arm nahm, zeigte sie ihm das Zeugnis. Perfekte Noten, die ihr den Zugang zu jeder gewünschten Universität gewährten. In diesem Moment wurde Luke klar, wie viel seine große Schwester aufgab, um sie zu begleiten.
Zwei Tage vor dem Abreisetag stand das ganze Haus Freunden und Verwandten offen, um sich in Ruhe zu verabschieden, und am Abend veranstalteten seine Eltern eine lustlose Party. Luke verbrachte den Tag vor seiner Spielekonsole – dort, wohin sie bald fahren würden, gab es keine Videogames. (Wie amüsierten sich eigentlich die Sklaven auf Kyneston? Mit Scharaden, um ein Klavier versammelt? Aber vielleicht hatten sie auch überhaupt keine Freizeit. Möglicherweise arbeiteten alle bis zum Umfallen, schliefen erschöpft ein und standen am nächsten Morgen wieder auf, um das Ganze von vorn zu beginnen. Jeden Tag, ein ganzes Jahrzehnt lang.)
Und dann brach der »große Tag« an, natürlich mit heiterem, sonnigem Wetter.
Luke saß auf der Gartenmauer und beobachtete seine Familie, die irgendwelche letzten Handgriffe erledigte. Mum hatte den Kühlschrank geleert und die Lebensmittel zu den Nachbarn gebracht. Dad war ein paar Straßen weiter bei einem Freund, um die restlichen Habseligkeiten abzuliefern, die dieser zu den anderen Kisten der Familie ins Mietlager bringen würde.
Die Mädchen lagen auf der Wiese, wo Daisy ihre Schwester mit Fragen löcherte und die Antworten auswendig lernte.
»Lord Whittam Jardine, Lady Thalia, Master Gavar und Jenner«, wiederholte Daisy. »Aber an den letzten Namen kann ich mich nicht erinnern. Der ist einfach zu blöd.«
»Du hast fast alles richtig aufgesagt«, erwiderte Abi lächelnd. »Der letzte Name ist Silyen – Sill-jen. Er ist der jüngste der Brüder, altersmäßig etwa zwischen Luke und mir. Die Familie Jardine hat keine Kinder in deinem Alter. Der Name wird Jar-dien ausgesprochen und Kye-neston wie ›Ei‹. Ganz bestimmt legen sie da unten im Süden keinen Wert auf unseren nordenglischen Akzent.«
Daisy verdrehte die Augen und ließ sich wieder ins Gras sinken. Abi streckte die langen Beine aus und schob den Saum ihres T-Shirts unter ihren BH, um sich zu sonnen. Luke hoffte inständig, dass sie das auf Kyneston nicht machen würde.
»Mir wird deine umwerfende Schwester fehlen«, raunte Simon Luke ins Ohr, worauf dieser erschrocken zusammenzuckte. Luke wandte sich seinem Freund zu, der angetrabt war, um sich zu verabschieden. »Sorg dafür, dass eure Lords und Herren nicht auf dumme Ideen kommen, was ihnen angeblich alles zusteht.«
»Ich weiß nicht recht«, murmelte Luke. »Du hast ja gesehen, welche Bücher sie liest. Vermutlich sind die Lords diejenigen, die Schutz brauchen.«
Simon lachte. Sie tauschten ein paar linkische Schulterklopfer, aber Luke blieb auf der Mauer hocken, während Simon vor ihm auf dem Gehweg stand.
»Ich hab gehört, die Mädchen der Ebenbürtigen sind total scharf«, sagte er schließlich und stieß Luke mit dem Ellbogen an.
»Und das hast du aus zuverlässiger Quelle, oder wie?«
»Na ja, wenigstens bekommst du überhaupt ein paar Mädchen zu sehen. Mein Onkel Jim hat erzählt, dass sämtliche Fabriken und Werkstätten in Millmoor nach Geschlechtern getrennt sind. Das heißt, die einzigen weiblichen Wesen, mit denen man Kontakt hat, sind die Mitglieder der eigenen Familie. Ist ein ziemliches Drecksloch, dieser Ort.«
Angewidert spuckte Simon auf den Boden. »Jimmy ist vor ein paar Wochen entlassen worden. Wir haben noch niemandem davon erzählt, weil er kaum das Haus verlässt und keine Besucher will. Mein Onkel ist ein gebrochener Mann. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte einen Unfall und jetzt ist sein Arm …«
Simon knickte einen Arm und ließ sein Handgelenk herabbaumeln. Der Anblick war absurd, aber Luke war nicht nach Lachen zumute.
»Jimmy wurde von einem Gabelstapler oder so was erwischt. Aber er hat nicht viel darüber erzählt. Überhaupt redet er kaum noch irgendetwas. Er ist der kleine Bruder meines Dads, aber er sieht zehn Jahre älter aus. Nee, nee, ich mach einen weiten Bogen um Millmoor, jedenfalls solange ich kann. Aber du wirst auf diesem Anwesen vermutlich eine ruhige Kugel schieben.«
Simon hob den Kopf und blickte über die Straße. Schaute in jede Richtung, nur nicht in Lukes.
Luke erkannte, dass sein bester Freund nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Sie hatten fast zwölf Jahre gemeinsam verbracht, mit Fußballtraining, Streichespielen, Hausaufgabenabschreiben. Seit ihrer ersten Woche in der Grundschule. Und all das endete nun hier und jetzt.
»Glaub bloß nicht, dass die Ebenbürtigen so sind wie wir«, setzte Simon zu einem letzten Gesprächsversuch an. »Das sind sie nämlich nicht. Im Gegenteil: Die sind Freaks. Ich erinnere mich noch gut an unseren Schulausflug zu ihrem Parlamentsgebäude, diesem Haus des Lichts. Der Reiseleiter hat die ganze Zeit geschwafelt, was für ein architektonisches Meisterwerk das Gebäude sei, nur mit Hilfe von Geschick errichtet. Aber mir hat das Ding einen Schauer über den Rücken gejagt. Erinnerst du dich noch an diese Fenster? Keine Ahnung, was da drin vor sich ging, aber für mich sah das ›Innere‹ nach nichts aus, was ich je gesehen hatte. Also pass besser gut auf dich auf. Und auf deine Schwester.«
Simon zwinkerte halbherzig in Abis Richtung, worauf Luke innerlich zusammenzuckte. Sein Freund war eine echt peinliche Nummer.
Luke würde ihn ein ganzes Jahrzehnt nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Und Abi würde Simons Anzüglichkeiten bestimmt nie wieder hören, denn wenn Luke und seine Familie in zehn Jahren nach Manchester zurückkehrten, war Simon vermutlich längst verheiratet und hatte Kinder. Er würde dann einen Job haben. Neue Freunde. Er würde sein eigenes Leben führen. Alle Bestandteile von Lukes heutigem Universum würden dann verschwunden sein oder zehn Jahre weiter, während Luke auf der Stelle getreten hatte.
Die Ungerechtigkeit der ganzen Situation machte ihn plötzlich furchtbar wütend, und er schlug so fest mit der Hand auf die Mauerkrone, dass er sich die Haut aufschürfte. Als er vor Schmerz winselte, blickte Simon ihn endlich an, und Luke erkannte Mitleid in seinen Augen.
»Okay, ich bin dann mal weg«, sagte Simon. »Ich wünsch dir schnelle zehn Jahre.«
Luke sah ihm nach, bis er um die Ecke bog und außer Sicht war – der letzte Teil seines alten Lebens.
Dann gesellte er sich zu seinen Schwestern – schließlich gab es nichts mehr, was er sonst noch hätte tun können – und streckte sich neben ihnen im Gras aus. Daisy rückte näher und lümmelte halb auf ihm; ihr Kopf lag schwer auf seinem Brustkorb, während er ein- und ausatmete. Luke schloss die Augen und lauschte auf den lauten Fernseher im gegenüberliegenden Nachbarhaus, auf das Dröhnen des Verkehrs auf der Hauptstraße, auf den Gesang der Vögel, auf Mums Stimme, die Dad mitteilte, dass sie nicht sicher sei, ob sie genügend Sandwiches für die fünfstündige Fahrt nach Kyneston eingepackt hatte.
Irgendetwas krabbelte aus dem Gras und kroch über Lukes Hals, bis er es wegwischte. Er fragte sich, ob er die nächsten zehn Jahre nicht einfach verschlafen konnte, wie jemand in einem Märchen, um dann nach dem Aufwachen festzustellen, dass seine Sklavenzeit überstanden und ein für alle Mal erledigt war.
Plötzlich nahm Dads Stimme einen übereifrigen Tonfall an, und Mum rief: »Kinder, hoch mit euch. Es wird Zeit.«
Natürlich hatten die Jardines keinen Rolls-Royce mit Chauffeur geschickt. Lediglich eine alte, schlichte, silbergraue Limousine. Dad zeigte der Fahrerin, auf deren Pullover die gestickten Initialen des Arbeitszuteilungsamtes prangten, die Unterlagen der Familie.
»Fünf Personen?«, fragte die Frau und musterte die Dokumente stirnrunzelnd. »Ich habe hier nur vier Namen.«
Mum trat vor und präsentierte ihre zuversichtlichste Miene.
»Nun ja, unsere Jüngste, Daisy, war noch nicht ganz zehn Jahre alt, als wir die Anträge ausgefüllt haben. Aber inzwischen ist sie zehn, was wahrscheinlich der Grund …«
»Daisy? Doch, sie steht auf der Liste.« Die Frau las die Namen auf dem obersten Blatt ihres Klemmbretts vor: »HADLEY, Steven, Jacqueline, Abigail und Daisy. Abholadresse: 28 Hawthornden Road in Manchester, 11.00 Uhr vormittags. Zieladresse: Kyneston-Anwesen in Hampshire«.
»Was?«
Mum riss der Frau das Klemmbrett aus der Hand, und Abi beugte sich über ihre Schulter, um ebenfalls einen Blick darauf zu werfen.
Angst und aberwitzige Hoffnung krallten ihre Finger in Lukes Eingeweide und zerrten in entgegengesetzte Richtungen. Jemand hatte bei den Anträgen Mist gebaut. Er bekam eine Gnadenfrist. Und vielleicht brauchte er seine Sklavenzeit ja überhaupt nicht zu absolvieren.
Im nächsten Moment bog ein weiteres Fahrzeug in die Straße ein – ein wuchtiger, schwarzer Minivan mit einem Emblem auf der Motorhaube. Sie alle kannten dieses Symbol und die Worte, die in geschwungener Schrift darunterstanden: »Labore et honore.« Das Motto der Sklavenstadt Millmoor.
»Ah, da kommt mein Kollege«, sagte die Frau, offenkundig erleichtert. »Ich bin mir sicher, er wird die Angelegenheit gleich aufklären können.«
»Sieh mal«, zischte Abi und zeigte auf irgendetwas in den Papieren.
Der Minivan hielt vor dem Haus, und ein untersetzter Mann mit fast glattrasiertem Schädel stieg aus. Statt der Dienstkleidung des Arbeitszuteilungsamtes trug er dunkle Kleidung, die eher an eine Polizeiuniform erinnerte. Ein Schlagstock hing an seinem Mehrzweckgürtel und baumelte gegen seinen Oberschenkel, als er die Auffahrt hinaufkam.
»Luke Hadley?«, fragte er und blieb vor Luke stehen. »Schätze, das bist du, Junge. Schnapp deine Sachen, wir müssen noch vier weitere abholen.«
»Was hat das zu bedeuten?«, wandte Abi sich an die Frau vom Arbeitszuteilungsamt und hielt ihr das Klemmbrett unter die Nase.
Mehrere Blätter waren nach hinten geklappt, und auf dem Foto, das jetzt zu sehen war, erkannte Luke sein eigenes Gesicht. Ein dicker, roter Strich zog sich über das gesamte Blatt; darüber hatte jemand zwei Wörter gestempelt.
»Was das zu bedeuten hat?« Die Frau lachte nervös. »Nun ja, ›Überschüssig: Neuzuweisung‹ erklärt sich doch wohl selbst, oder? Das Kyneston-Anwesen war außerstande, eine sinnvolle Aufgabe für deinen Bruder zu finden. Also wurde seine Akte für eine Neuzuweisung an uns zurückgeschickt. Und für eine unverheiratete männliche Person ohne Ausbildung bleibt wirklich nur eine Option übrig.«
Die Angst hatte das Tauziehen gewonnen und zog jetzt Lukes Eingeweide Meter für Meter auseinander, mit freundlicher Unterstützung von nacktem Entsetzen. Er wurde in Kyneston nicht gebraucht. Man würde ihn nach Millmoor bringen.
»Nein«, stieß er hervor und wich zurück. »Nein, das muss ein Irrtum sein. Wir sind eine Familie.«
Dad stellte sich beschützend vor ihn.
»Mein Sohn wird mit uns kommen.«
»In den Unterlagen steht aber etwas anderes«, wandte die Frau ein.
»Wir pfeifen auf Ihre Unterlagen«, fauchte Mum.
Und dann geschah alles erschreckend schnell. Als der uniformierte Kerl aus Millmoor um Dad herumgriff, um Lukes Arm zu packen, holte Dad aus. Seine Faust traf den Mann derart fest am Kinn, dass dieser fluchend rückwärtstaumelte und nach seinem Gürtel tastete.
Sie alle sahen, wie der Schlagstock herabfuhr, und Daisy schrie auf. Der Gummiknüppel traf Dad seitlich am Kopf, worauf er ächzend auf die Knie sank. Blut sickerte aus seiner Schläfe und färbte den Bereich seiner Haare, der allmählich ergraute, dunkelrot. Mum keuchte auf, kniete sich neben ihn und untersuchte seine Wunde.
»Sie Tier!«, brüllte sie. »Stumpfe Gewalteinwirkung kann zum Tode führen, wenn das Gehirn anschwillt.«
Daisy brach in Tränen aus. Luke schlang die Arme um sie, drückte ihr Gesicht an seine Hüfte und hielt sie fest.
»Ich werde Sie anzeigen«, fauchte Abi und zeigte drohend mit dem Finger auf den Millmoor-Mann. Sie spähte auf den Namenszug auf seiner Uniform. »Für wen halten Sie sich, Mr Kessler? Sie können nicht einfach irgendwelche Leute angreifen.«
»Wie recht Sie haben, junges Fräulein.« Kessler verzog die Lippen zu einem breiten, hässlichen Grinsen. »Aber ich fürchte, dass ihr vor genau sieben Minuten …« – er warf einen demonstrativen Blick auf seine Uhr und drehte das Handgelenk, damit alle das Zifferblatt sehen konnten, das 11.07 Uhr anzeigte – »… alle eure Sklavenzeit angetreten habt. Damit seid ihr jetzt in rechtlicher Hinsicht Nicht-Personen. Leibeigene des Staates.« Er schaute Daisy an und fügte hinzu: »Um das für die Kleine hier verständlich zu machen: Das bedeutet, dass ihr nicht länger ›Bürger‹ seid und keine Rechte mehr habt. Keinerlei.«
Abi schnappte nach Luft, und Mum stöhnte leise und schlug sich die Hand vor den Mund.
»Ja, genau«, fuhr der Mann mit einem schmallippigen Lächeln fort, »die Leute vergessen das gern, wenn sie irgendwelche Vereinbarungen treffen. Vor allem dann, wenn sie sich für was Besseres halten – zu gut, um die Sklavenzeit zusammen mit uns anderen abzudienen. Ihr habt jetzt also die Wahl.«
Seine Hand fuhr zu seinem Gürtel und löste dort ein Gerät aus einer Halterung. Es erinnerte an eine Kinderzeichnung einer Pistole: wuchtig und bedrohlich.
»Das Ding hier hat 50000 Volt und kann jeden Einzelnen von euch im Nu außer Gefecht setzen. Dann verfrachten wir euch in die Wagen, zusammen mit euren Sachen. Ihr vier dort drüben rein und du …« – er zeigte auf Luke und anschließend auf den Minivan – »hier rein. Oder ihr könnt jetzt alle freiwillig in das richtige Fahrzeug einsteigen. So einfach ist das.«
Gegen so was konnte man doch Beschwerde einlegen, oder?
Abi hatte sie alle für Kyneston angemeldet. Sie war bestimmt in der Lage, ihn aus Millmoor rauszuholen. Natürlich schaffte sie das. Sie würde das Arbeitszuteilungsamt allein schon durch die Menge an Beschwerdeschreiben und Anträgen kleinkriegen.
Luke konnte nicht zulassen, dass noch mehr seiner Familienmitglieder verletzt wurden.
Er gab Daisy frei und versetzte ihr einen sanften Schubs.
»Luke, nein!«, schrie seine kleine Schwester und versuchte, sich noch fester an ihn zu klammern.
»Hör zu, Daisy«, setzte Luke an, kniete sich vor sie und wischte ihr die Tränen von der Wange. »Wir machen das jetzt folgendermaßen: Ich fahre nach Millmoor. Und du fährst nach Kyneston, wo du so super-sensationell sein wirst, dass die Jardines ihren Privatjet schicken werden, um mich zu holen. Du musst ihnen nur erzählen, dass du einen Bruder hast, der noch sensationeller ist, aber irgendwie aus Versehen nicht mitkonnte. Verstanden?«
Daisy wirkte zu geschockt, um irgendetwas zu sagen, aber sie nickte.
»Mum, Dad, macht euch keine Sorgen.« Dad brachte einen erstickten Laut hervor, und Mum brach in lautes Schluchzen aus, als er sie beide umarmte. »Es ist nur für kurze Zeit.«
Er konnte diese Scharade nicht viel länger aufrechterhalten. Wenn er nicht schnell in diesen Bus stieg, würde er zusammenbrechen. Innerlich fühlte er sich völlig leer, nur eine bittere, schwarze Angst wirbelte wie dreckiger Unrat in seinem Magen herum.
»Wir werden uns schon bald wiedersehen«, sagte er mit einer Zuversicht, die er nicht empfand.
Dann nahm er seine Reisetasche und drehte sich zum Minibus um.
»Was bist du doch für ein kleiner Held«, höhnte Kessler und riss die Seitentür des Wagens auf. »Mir kommen gleich die Tränen. Steig ein, Hadley E-1031, damit wir endlich loskönnen.«
Der Schlagstock traf Luke hart zwischen den Schulterblättern, und er stürzte vorwärts. Er besaß noch die Geistesgegenwart, die Füße anzuziehen, bevor Kessler die Tür zuknallte. Dann wurde er gegen die Beine der Sitzbank geworfen, als der Wagen davonraste.
Während Luke mit dem Gesicht auf dem schmutzigen Fahrzeugboden lag, halb gegen die stinkenden Stiefel eines Fremden gepresst, konnte er sich nichts vorstellen, was noch schlimmer war als das gerade Erlebte.
Aber Millmoor sollte ihn eines Besseren belehren.
2Silyen
Das Licht der frühen Septembersonne strömte durch das Erkerfenster des kleinen Salons von Kyneston, legte sich wie ein dickes goldenes Tuch über den Frühstückstisch und verwandelte das Silbergeschirr vor Silyen Jardine in ein schimmerndes Sternbild. Die Obstschale in der Tischmitte, eine strahlende Sonne, war bis zum Rand mit Birnen gefüllt, die frisch aus Tante Euterpes Garten kamen. Silyen zog die Schale zu sich heran und wählte ein grünes Exemplar mit rotgelben Flecken.
Dann nahm er ein scharfes Messer mit Elfenbeingriff und schnitt die reife Birne an. Fasziniert beobachtete er, wie der Saft auf den Teller tropfte, und wischte sich schließlich die Finger ab.
Noch bevor er zu seiner Kaffeetasse griff, näherte sich der Sklave, der einen Schritt hinter ihm stand, von links und goss einen dampfenden schwarzen Strom aus einer glänzenden Kaffeekanne in Silyens Tasse. Gavar, sein ältester Bruder, hatte einst einem Haussklaven ein Veilchen verpasst, weil er ihm angebrannten Toast serviert hatte, aber beim »jungen Herrn« gab sich die Haussklavenschaft immer alle Mühe, ihn so gut und schnell wie möglich zu bedienen. Silyen fand diese Tatsache sehr erfreulich. Und der Umstand, dass Gavar sich darüber maßlos ärgerte, war eine schöne Dreingabe.
Aber wie üblich befanden sich Silyen und seine Mutter, Lady Thalia, zu dieser frühen Morgenstunde allein im Frühstücksraum. Lediglich umgeben von einem halben Dutzend Sklaven, die geschäftig mit warmen Frühstücksspeisen hantierten. Gedankenverloren beobachtete Silyen die Haussklaven. Was für ein nerviges Hin und Her, noch dazu vollkommen unnötig.
Und an diesem Tag würde Mama den Haussklaven noch weitere Personen hinzufügen.
»Eine ganze Familie?«, fragte er, weil er spürte, dass seine Mutter einen Kommentar von ihm erwartete. »Wirklich?«
Das Personal fiel in Jenners Aufgabenbereich. Seine Mutter vertrat die Ansicht, dass es wichtig sei, seinem mittleren Bruder das Gefühl zu vermitteln, dass auch er innerhalb der Familie nützlich und von Wert war. Allerdings hatte Silyen den Verdacht, dass Jenner nur allzu gut wusste, was seine Familie tatsächlich von ihm hielt. Um es nicht zu merken, hätte er dumm sein müssen und nicht nur geschicklos.
Auf der gegenüberliegenden Tischseite knabberte Mama an einer Brioche, während sie ein paar Papiere mit dem Briefkopf des Arbeitszuteilungsamtes durchblätterte.
»Die Frau ist der Grund, wieso uns das Amt ihre Unterlagen zugeschickt hat. Als Krankenschwester mit großer Erfahrung auf dem Gebiet der Langzeitpflege wird sie sich um deine Tante kümmern. Der Mann versteht etwas von Kraftfahrzeugen und restauriert Oldtimer, weshalb er einige von den Autowracks reparieren kann, die dein Vater und Gavar ja unbedingt sammeln müssen. Außerdem haben die beiden ihre Sklavenzeit gerade erst angetreten und kommen nicht aus einer der Sklavenstädte, was bedeutet, dass sie …« – seine Mutter hielt einen Moment inne, als suchte sie nach der richtigen Formulierung – »… dass sie noch keine falschen Vorstellungen entwickelt haben.«
»Mit anderen Worten: Sie haben noch nicht gelernt, uns zu hassen.« Silyen warf Lady Thalia einen Blick aus seinen dunklen Augen zu, die so dunkel waren wie die seiner Mutter. Dann schob er eine dunkle Locke beiseite – ein weiteres, charakteristisches Erbe der Parvas, seiner Vorfahren mütterlicherseits. »Du hast von einer ganzen Familie gesprochen. Also was ist mit den Kindern?«
Lady Thalia machte eine abschätzige Handbewegung, worauf eines der Dienstmädchen einen Schritt vortrat, um ihre Anweisungen entgegenzunehmen. Doch dann wurde ihr bewusst, dass sie sich geirrt hatte, und sie zog sich wieder zurück. Ein ermüdender Unterwürfigkeitstanz, den die Sklaven, die die Familie Jardines bedienten, täglich viele Male aufführten.
»Nun ja, da wäre zunächst ein intelligentes Mädchen, das vor kurzem achtzehn geworden ist. Jenner hat um eine zusätzliche Bürohilfe gebeten, deshalb werde ich sie ihm zuteilen.«
»Achtzehn? Wirst du ihnen erzählen, was mit dem letzten Mädchen passiert ist, die mit achtzehn nach Kyneston gekommen war, um ihre Sklavenzeit abzudienen?«
Das makellose Make-up seiner Mutter kaschierte jede aufsteigende Röte, aber Silyen sah, wie die Dokumente in ihrer Hand zitterten.
»Du solltest so etwas nicht sagen. Beim Gedanken an das arme Mädchen könnte ich sofort in Tränen ausbrechen. Welch ein schrecklicher Unfall – und wie grausam, dass ausgerechnet dein Bruder sie erschossen hat. Er leidet noch immer darunter. Ich glaube, er hat sie sehr geliebt, auch wenn es sich um eine törichte Vernarrtheit gehandelt hat. Das arme kleine Ding, das jetzt ohne Mutter oder Familie dasteht.«
Silyens Lippen zuckten. Ein Glück, dass Gavar nicht da war und sich diese Verleugnung seines Kindes anhören musste. Widerstrebend hatten seine Eltern gestattet, dass die Kleine den Nachnamen Jardine tragen durfte – schließlich ließ sich an ihrer Herkunft nicht rütteln. Ihre Fülle kupferroter Haare zeugten von ihrer eindeutigen Verwandtschaft mit Gavar und seinem Vater, Whittam. Aber darüber hinaus hatte man dem Kind keine weiteren Privilegien zuteilwerden lassen.
»Ich habe mir gedacht, dass diese netten Leute sich um das arme Kind kümmern können«, fuhr seine Mutter vor.
Normalerweise interessierte Silyen sich sehr für das uneheliche Kind seines ältesten Bruders. Obwohl Sklavenmischlinge in den bedeutenden Familien des Landes keine Seltenheit waren, wurden sie gewöhnlich zusammen mit der schuldigen Mutter verstoßen. Glücklicherweise hatte Leahs Tod der kleinen Libby ein solches Schicksal erspart, was Silyen die Möglichkeit verschaffte, sie genau im Auge behalten zu können.
Da das Kind nicht zwei Ebenbürtige als Eltern besaß, hätte sie nach den Regeln der Vererbungslehre eigentlich geschicklos sein müssen. Aber man konnte nie wissen. Die Ereignisse am Tor, damals in der Nacht von Leahs Fluchtversuch, übten noch immer eine starke Faszination auf Silyen aus. Und auch davor hatten sich schon merkwürdige Dinge auf Kyneston ereignet – wie etwa Jenners Mangel an Geschick, trotz des tadellosen Stammbaums seiner Eltern.
Aber die Vereinbarungen für Libbys Betreuung interessierten Silyen eher weniger. Im Moment beschäftigten ihn ganz andere Dinge.
Schon bald würde der Kanzler auf Kyneston eintreffen: Winterbourne Zelston persönlich. Sein Besuch galt Mamas Schwester, mit der er früher verlobt gewesen war. Vermutlich waren sie noch immer verlobt, da Zelston seine Jugendliebe noch immer zu sehr liebte und viel zu viele Schuldgefühle hatte, um die Verbindung aufzulösen. Aber Tante Euterpe war nicht in der Verfassung, den Weg zum Altar anzutreten. Genau genommen war sie während der vergangenen fünfundzwanzig Jahre nicht in der Verfassung gewesen, irgendetwas anderes zu tun, als zu atmen und zu schlafen.
Doch Silyen hatte zu diesem Thema ein paar interessante Neuigkeiten. Für Zelston würde dieser Besuch unvergesslich werden.
Silyen brannte vor Ungeduld: Sein Bein zuckte unter dem Tisch, und er drückte eine Hand auf sein Knie, um es zu beruhigen. An Tagen wie diesen konnte er regelrecht spüren, wie sein Geschick in seinen Adern pulsierte, auf der Suche nach einem Ventil. Das Kanalisieren des Geschicks ließ sich mit dem Spielen einer Geige vergleichen, mit jenem Moment, in dem sich die Vibrationen der Saiten als Musik äußerten: exquisite, unwiderstehliche Musik. Er sehnte sich danach, diese Fähigkeit endlich einzusetzen.
Ihm war schleierhaft, wie seine Familie scheinbar unberührt von diesem ständigen Drang durchs Leben gehen konnte. Und er verstand überhaupt nicht, wie Jenner, ohne jedes Geschick, sein Leben überhaupt ertragen konnte.
»Diese Leute sehen ehrlich und zuverlässig aus«, sagte seine Mutter jetzt und tupfte sich ein paar Krümel vom Mund, ohne dabei ihren Lippenstift zu verwischen. »Sie kommen gegen vier Uhr hier an, was bedeutet, dass du dann gebraucht wirst. Jenner wird sich um ihre Unterbringung kümmern. Hier, wirf mal einen Blick darauf.«
Sie schob ihm ein Foto über die polierte Nussbaumfläche des Frühstücktischs zu. Die Aufnahme zeigte fünf Personen an einem windgepeitschten, englischen Strand. Ein Mann mittleren Alters mit Stirnglatze und einem stolzen Lächeln hatte den Arm um eine adrette Frau in einem sportlichen Top gelegt. Vor ihnen stand ein kleines Mädchen mit Sommersprossen, das eine Grimasse zog. Zwei ältere Geschwister rahmten das Trio: ein großgewachsenes Mädchen mit langen rotblonden, zu einem Zopf geflochtenen Haaren, das sich nicht entscheiden konnte, ob es lächeln sollte oder nicht, und ein blonder Junge, der verlegen grinste.
Das ältere Mädchen sah nicht nach Gavars Typ aus, was eine Erleichterung war. Aber der Junge verdiente einen zweiten Blick. Er schien in Silyens Alter zu sein, was interessante Möglichkeiten versprach.
»Wie alt ist der Sohn?«
»Fast siebzehn, denke ich. Aber er kommt nicht mit. Es wollte mir partout keine sinnvolle Tätigkeit für ihn einfallen. Und Jungen in diesem Alter können ja so schwierig und störend sein. Du natürlich nicht, mein Lieber. Du nicht.«
Lady Thalia hob ihre winzige Teetasse, ein Salut an ihren Lieblingssohn – auch wenn es eigentlich keine große Konkurrenz gab. Silyen schenkte ihr ein gleichmütiges Lächeln. Allerdings war es ziemlich frustrierend, dass der Junge nicht hierherkam. Aber vielleicht würde sich eine seiner Schwestern als ebenso nützlich erweisen.
»Ich wüsste nicht, welche sinnvolle Aufgabe die jüngste Schwester hier übernehmen könnte.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber Jenner hat darauf bestanden. Er wollte die ganze Familie hierherholen, weil er meinte, wir könnten die Kinder doch nicht von ihren Eltern trennen. Deshalb bin ich ihm auf halbem Weg entgegengekommen und habe ihm zugesichert, das kleine Mädchen dürfe die Eltern begleiten, aber der Junge nicht. Damit war Jenner zwar immer noch nicht zufrieden, aber er weiß, dass ich das letzte Wort habe. Ich mache mir Sorgen, dass er sich aufgrund seiner Art zu sehr mit dieser Sorte von Leuten identifiziert. Eine Eigenschaft, die dein Vater und ich keineswegs zu fördern wünschen.«
Jenners bedauerlicher Mangel an Geschick und seine unangemessene Sympathie für die Gewöhnlichen waren ein weiteres, vieldiskutiertes Gesprächsthema innerhalb der Familie, weshalb Silyen seine Aufmerksamkeit wieder auf die Birne auf seinem Teller richtete. Er hatte sie fast vollständig seziert, als die Türglocke draußen ertönte, begleitet von einem schrecklichen, erstickten Jaulen.
Großtante Hypatia musste ihr Haustier mitgebracht haben. Während Silyen auf das Geräusch lauschte, verwandelte sich das Jaulen in ein leises Winseln. Eines nicht allzu fernen Tages würde er diesem Tier den Gnadenschuss geben – obwohl es möglicherweise amüsanter wäre, es freizulassen.
»Das sind bestimmt der Kanzler und deine Großtante«, sagte Lady Thalia und überprüfte rasch ihr Erscheinungsbild in der glänzenden Oberfläche eines silbernen Sahnekännchens, bevor sie sich erhob. »Dein Vater hat sie herbestellt, um mit ihr über Gavars Hochzeit zu reden. Als sie erfuhr, dass Winterbourne ebenfalls hierherkommen würde, hat sie sich einfach in seine Staatskarosse eingeladen. Nur Hypatia schafft es, den mächtigsten Mann des Landes dazu zu bewegen, ihr eine Mitfahrgelegenheit anzubieten.«
Die Besucher warteten in der Eingangshalle, direkt hinter Kynestons kunstvoll geschnitzter Eichentür. Kanzler Winterbourne Zelston machte eine stattliche Figur, während Großtante Hypatia sich in einen prächtigen Mantel aus Fuchspelzen gehüllt hatte – allesamt von Tieren, die sie persönlich erlegt hatte. Zwischen ihnen kauerte eine dritte Gestalt, hager und mit zitternden Flanken. Das Wesen kratzte sich gelegentlich, als hätte es Flöhe, aber vermutlich juckten eher die Geschwüre auf seinen hervortretenden Rippen. Seine ungeschnittenen Nägel wölbten sich unter den Gliedmaßen und schabten über die glatten Steinplatten.
»Lordkanzler«, sagte Lady Thalia und machte einen Knicks.
Als der Kanzler huldvoll nickte, fiel ein Sonnenstrahl durch die riesigen Fenster der Eingangshalle und beleuchtete die kostbaren Perlen in den ordentlichen Flechtreihen seiner dunklen Haare. Der Schmuck warf leuchtende Muster auf Kynestons Wände. Silyen hatte den Verdacht, dass der Mann die Kunst der Selbstinszenierung seit vielen Jahren kultivierte.
Zelston umklammerte Lady Thalias Hand; Platinringe glitzerten an seinen dunklen Fingern. Eine makellos gestärkte weiße Manschette schaute unter dem schweren schwarzen Stoff seines Mantels hervor. Sein Kleidungsstil deutete auf einen Mann mit unumstößlichen Wertvorstellungen hin. Aber seine Politik war weit weniger entschieden. Vater, der vorherige Amtsinhaber des Kanzlerpostens, schwang beim Abendessen gern lange Schmähreden über die Unzulänglichkeiten seines Nachfolgers.
»Es ist mir eine Ehre, wieder auf Kyneston zu Gast zu sein«, murmelte Zelston. »Ich bedaure es sehr, dass mich die Amtsgeschäfte so lange Zeit ferngehalten haben. Mir haben die Besuche gefehlt.«
»Und Sie haben meiner Schwester Euterpe gefehlt«, erwiderte Mama. »Dessen bin ich mir sicher, auch wenn wir das natürlich nie mit absoluter Gewissheit sagen können. Bitte gehen Sie doch gleich zu ihr.«
Der Kanzler verschwendete keine Zeit. Er wünschte Großtante Hypatia noch kurz einen »Guten Tag« und schritt dann auf den hinteren Bereich des Anwesens zu. Silyen drückte sich von der Wand ab, um ihm zu folgen, und trat sorgfältig über die zitternde Kreatur auf dem Boden. Seine Großtante begrüßte er auf die übliche Weise – mit anderen Worten: gar nicht.
Zelston brauchte keine Wegbeschreibung, während er durch die breiten, von Familienporträts gesäumten Gänge eilte. Er hatte Kyneston schon lange vor Silyens Geburt viele Male besucht.
Am Ende des Flurs befanden sich zwei Türen. Die linke stand offen und gab den Blick frei auf einen schlichten Raum mit einem Ebenholzklavier, einem Spinett und Regalen mit Notenbüchern. Silyens Musikzimmer, wo er sich jedoch nicht nur in der Kunst des Musizierens übte.
Diese Tür ignorierte Zelston natürlich. Stattdessen griff er nach dem vertrauten Griff der zweiten, geschlossenen Tür, hielt dann inne und drehte sich zu Silyen um. Vor dem Hintergrund seiner dunklen Haut wirkten seine Augen blutunterlaufen. Hatte er geweint, als er Silyens Brief gelesen hatte?
»Wenn du mich belogen hast«, setzte Zelston mit heiserer Stimme an, »werde ich dich vernichten.«
Silyen unterdrückte ein Grinsen. Das klang schon eher nach dem Kanzler.
Die Augen des Mannes streiften über sein Gesicht, auf der Suche nach … wonach? Angst? Empörung? Unaufrichtigkeit? Silyen schwieg und lud den Kanzler damit ein, ihn in Ruhe zu betrachten. Zelston knurrte und öffnete dann die Tür.
Im Verlauf von Silyens Leben hatte sich fast nichts in Tante Euterpes Zimmer verändert – einschließlich der Frau, der das Zimmer gehörte. Sie lag in dem breiten weißen Bett, die langen Haare sorgfältig auf den Kissen ausgebreitet. Ihre Augen waren geschlossen, und ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig.
Die Rautenfenster, die auf einen kleinen, ordentlich gestutzten Garten hinausgingen, standen einen Spalt offen. Spitzen hoher Stockmalven und wippender Schmucklilien streiften die Brüstung, und eine Glyzine hatte sich um die Fensterlaibung gewunden, als versuchte sie, das stattliche Anwesen niederzureißen. Dahinter lag der Obstgarten. Birnbäume wuchsen an Spalieren vor der Ziegelsteinmauer, ihre Äste sorgfältig gespreizt wie die Glieder einer Messerwerferassistentin.
Auf einem Nachttisch stand eine ganze Sammlung von Medikamentenfläschchen, flankiert von einem Wasserkrug und einer Porzellanschüssel. Daneben ragte ein einzelner Stuhl mit hoher Lehne auf. Zelston ließ sich schwer auf die Sitzfläche fallen, als wäre sein Körper eine schreckliche Last. Jemand hatte der Schlafenden, die mit einem Nachthemd bekleidet war, die Bettdecke bis zur Brust hinaufgezogen; ein Arm ruhte auf dem Seidengewebe. Silyen sah, wie der Kanzler die bleichen Finger zwischen seine Hände nahm und fester drückte, als jede Krankenschwester gestattet hätte.
»Dann haben Sie meinen Brief also erhalten«, wandte er sich an Zelstons gesenkten Kopf. »Sie wissen, was ich Ihnen anbieten kann. Und Sie kennen meinen Preis.«
»Dein Preis ist zu hoch«, entgegnete der Kanzler, ohne Tante Euterpes Hand freizugeben. »Wir haben hier nichts mehr zu besprechen.«
Die Vehemenz des Mannes verriet Silyen alles, was er wissen musste.
»Ach, ich bitte Sie«, erwiderte er milde und umrundete das Bett, bis er in Zelstons Blicklinie stand. »Wir wissen doch beide, dass es nichts gibt, was Sie nicht für sie tun würden.«
»Es würde mich meinen Posten kosten«, sagte der Kanzler und ließ sich herab, Silyen in die Augen zu schauen. »Hat dein Vater dich dazu angestachelt? Du weißt, dass er das Amt des Kanzlers kein zweites Mal bekleiden kann.«
Silyen zuckte die Achseln. »Was ist wohl die größere Tragödie: eine verlorene Karriere oder eine verlorene Liebe? Sie erscheinen mir wie ein Mann, der über solchen Dingen steht. Und ich bin mir sicher, dass meine Tante das Gleiche gedacht haben muss.«
Einen Moment herrschte Stille im Raum. Ein leises Brummen bildete das einzige Geräusch, gefolgt vom hörbaren Klatschen einer pollentrunkenen Biene, die gegen die Fensterscheibe flog.
»Seit fünfundzwanzig Jahren liegt sie so da«, sagte Zelston. »Seit dem Tag, an dem Orpen Mote bis auf die Grundmauern niederbrannte. Ich habe versucht, sie aus diesem Zustand zu holen; deine Mutter hat es versucht und sogar dein Vater. Die Geschicktesten unter uns haben es versucht und sind gescheitert. Und jetzt kommst du daher, ein siebzehnjähriger Junge, und willst mir erzählen, dass du es schaffen kannst. Warum sollte ich dir glauben?«
»Weil ich bei ihr war, an dem Ort, an dem sie sich befindet. Ich brauche sie lediglich zurückzuführen.«
»Und wo befindet sie sich?«
»Aber das wissen Sie doch.« Silyen lächelte. Er hatte das gleiche Lächeln wie seine Mutter – was angesichts der großen Familienähnlichkeit bedeutete, dass er auch das gleiche Lächeln wie Tante Euterpe hatte. Zelston musste den Anblick hassen. »Sie ist exakt dort, wo Sie sie zurückgelassen haben.«
Zelston sprang vom Stuhl auf, der daraufhin mit einem so lauten Knall umkippte, dass er Tote hätte wecken können – aber natürlich nicht die Frau im Bett. Der Kanzler packte Silyen an dem abgewetzten Revers seiner Reitjacke – eine unerwartete Reaktion. Silyen hörte, wie das Samtgewebe riss. Aber er brauchte ohnehin eine neue Jacke. Der Atem des Kanzlers schlug ihm heiß ins Gesicht.
»Du widerst mich an«, fauchte der Mann. »Der monströse Sohn eines monströsen Vaters.«
Zelston stieß Silyen gegen die Fensterlaibung, so dass dessen Kopf gegen die bleiverglaste Scheibe stieß. Ein paar Vögel flatterten aus den Bäumen auf.
»Ich bin der Einzige, der Ihnen Ihren Herzenswunsch erfüllen kann«, sagte Silyen und ärgerte sich darüber, wie dünn seine Stimme klang. Andererseits musste man damit rechnen, wenn einem die Hand eines Mannes die Luftröhre zudrückte. »Und ich verlange nicht viel als Gegenleistung.«
Der Kanzler machte ein angewidertes Geräusch und löste seinen Griff um Silyens Hals. Als Silyen seinen zerrissenen Kragen würdevoll glattzog, räusperte sich der ältere Mann.
»Das Privileg der Kanzlervorlage gestattet es mir, unserem Parlament jedes Jahr einen neuen Gesetzesentwurf vorzulegen, der während der drei Großdebatten besprochen wird. Und du verlangst, dass ich dieses Vorrecht in diesem Jahr missbrauche, indem ich die Abschaffung der Sklavenzeit vorschlage – das Fundament unserer Gesellschaftsordnung. Ich weiß, dass eine Handvoll unter uns Ebenbürtigen der Überzeugung ist, dass die Sklavenzeit irgendwie falsch sei und nicht einfach nur Teil der natürlichen Ordnung. Aber ich hätte nie gedacht, dass du zu ihnen zählen würdest.
Dir muss doch bewusst sein, dass ein solcher Vorschlag niemals umgesetzt und verabschiedet würde. Nicht einmal dein eigener Vater und dein Bruder würden dafür stimmen. Die beiden am allerwenigsten. Und ein solcher Vorschlag würde nicht nur mich ruinieren, er könnte unser gesamtes Land in den Ruin treiben. Wenn die Gewöhnlichen davon erfahren – wer weiß, was dann passiert? Das Ganze könnte Großbritanniens Landfrieden gefährden.
Ich bin bereit, dir alles in meiner Macht Stehende zu geben. Beispielsweise könnte ich einen der kinderlosen Ebenbürtigen dazu bewegen, dich als seinen Erben zu benennen. Und als Erbe eines Anwesens – und später als Lord – hättest du einen eigenen Sitz im Parlament und damit die Möglichkeit, eines Tages selbst Kanzler zu werden. Etwas, das du als dritter Sohn von Lord Jardine niemals erreichen wirst. Aber diese Abschaffung der Sklavenzeit ergibt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn.«