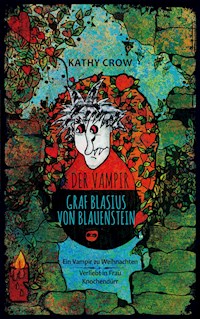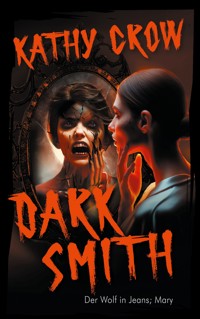
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1875. Und mein Name ist Dark Smith. Die finstere Nacht ist von vielen bösen Mächten, Dämonen und Mördern eine Verbündete. Hinter ihr fühlt sich das Böse sicher und zugleich unsichtbar. Seine Werkzeuge für den Tod seiner Opfer sucht sich jeder Mörder selbst aus, um dann damit qualvoll töten zu können, um ihre grausamen Gedanken zu befriedigen. Die schrecklichen Schreie ihrer Opfer klingen wie Musik in ihren Ohren, und regen ihre Fantasie nur noch mehr an. Sie genießen es regelrecht die aus Angst stark schwitzenden zitternden Körper zu sehen und das Gefühl der Macht zu haben. Sie weiden sich in einem Meer der Überlegenheit und der Erregung, wenn sie ihren Opfern beim Sterben zusehen können, und mit ansehen, wie den Sterbenden so langsam das Leben aus den Augen gesaugt wird, und ihre Seelen den leblosen Körper verlassen. Nachdem sie die Leichen nicht mehr gebrauchen können und ihr Hunger nach Mord und Tod gestillt ist, wird der gequälte Leichnam wie Müll an den unterschiedlichsten Stellen entsorgt oder regelrecht gefressen, sollte die Gier und das Verlangen nach Menschenfleisch vorhanden sein. Nicht immer ist das Böse von uns gleich zu erkennen, und wir sind oft ohne Angst und zu gutgläubig. Denken Sie daran, manchmal ist auch das Opfer der Täter grausamer Taten gewesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FÜR ALLE, DIE DIE WELT DER FABELWESEN UND DIE FANTASIE VON KATHY CROW LIEBEN UND KENNENLERNEN WOLLEN.
Thriller von Kathy Crow
INHALT
TEIL 1: DER WOLF IN JEANS
Dark Smith
Die seltsamen Gastgeber
Rätselhafte Gerüche
Der Wolf in Jeans
Die Erlösung
TEIL 2: MARY UND DIE FURIEN
Dark Smith
Der Brief
Liebe auf den ersten Blick
Mary und die Furien
John ist völlig verändert
Das erste Opfer
Rache ist Ratte
Inspektor Norman Brighton
Das Irrenhaus
Gedanken von Dark Smith
… und du bist weg
Gedanken von Dark Smith
Eine Trennung voller Liebe
Eine neue Liebe – mit Norman?
Aufbruch nach Glenfinnan
Die Rückkehr der Furien
Normans Geliebte
Tod für Normans Geliebte
Gedanken von Dark Smith
Lebendig gefressen
Acht auf einen Streich
Blutflecke, Gift und Tod
Überraschender Besuch einer Ratte
Die vergifteten und gequälten Geister
Giftiges Brot
Geschenkter Tod
Trauer, Tränen, Marys Freude
Die leichenwaschenden Weiber
Auch Bestatter können Furien sein
Ene, mene, meck, Verwalter und Vermieter weg
Das Ende der Geschichte
Dark Smiths’ letzte Worte
Über die Autorin
TEIL 1:
DER WOLF IN JEANS
Dark Smith
Wir schreiben das Jahr 1875. Ich bestreite meinen Lebensunterhalt, indem ich Zeitungsberichte, Geschichten oder Erzählungen für unterschiedliche Zeitungsverlage schreibe, und verdiene nicht schlecht dabei. Mir geht es recht gut, und ich fühle mich in meiner Wohnung, die mitten in einer kleinen Stadt irgendwo in England ist, deren Namen ich hier aus bestimmten Gründen nicht nennen möchte, ziemlich wohl. Und damit das auch so bleibt, denn die Mieten sind nicht gerade günstig, lasse ich mir viele Geschichten einfallen und schreibe all das auf, was meiner Fantasie entspringt, bis mir der Kopf raucht. Meine Leser fühlen sich von mir gut unterhalten, und ich genieße eine für mich angenehme Aufmerksamkeit und werde aus diesen Gründen auch hin und wieder bei der besseren Gesellschaft eingeladen.
Doch sind inzwischen nicht alle Geschichten, die ich schreibe, erfunden, denn mein Leben veränderte sich plötzlich vollkommen, und ich fing an, über Geschehnisse zu berichten, die sich wirklich ereignet hatten, mitten im Leben meiner Mitmenschen. Doch lest es selbst, ich konnte es auch nicht glauben, hätte ich es nicht am eigenen Leib oder von Betroffenen erfahren, die mich aufsuchten und darum baten, es zu veröffentlichen, damit die Menschheit davon in Kenntnis gesetzt ist, dass nicht nur Gutes unter uns ist, sondern auch schwarze Mächte ihr Unwesen treiben und das Böse auch ein Gesicht hat.
DIE SELTSAMEN GASTGEBER
Mein Name ist Dark Smith, ich bin 29 Jahre alt, habe kurzes dunkelbraunes Haar und bin Brillenträger. Normalerweise bin ich kein Freund von großen Unterhaltungen und behalte privat Erlebtes lieber für mich, doch was ich in der Weihnachtsnacht im Jahr 1875 bei meinen besten Freunden auf ihrem Landsitz am Rande des kleinen Dorfes Robin Hoods Bay erlebt habe, davon muss ich einfach berichten.
Wie jedes Jahr haben Matt und Jennifer Williams, die zu meinem engen Freundeskreis gehören, ihre Einladungen für die bevorstehende Weihnachtsfeier und den Jahreswechsel auf ihrem Landsitz, dessen genaue Adresse ich hier auch nicht nennen möchte, verschickt. So erreichte mich am 22. Dezember 1875 ein Brief, der mir von Mrs. Moore, meiner Hausdame, einer ziemlich neugierigen, aber äußerst liebenswerten Person, überreicht wurde.
Mrs. Moore ist eine herzensgute Frau und eine ausgezeichnete Köchin. Ich möchte mir nicht einmal im Traum vorstellen, sie nicht mehr bei mir zu haben. Erledigt sie doch mit größter Sorgfältigkeit meinen Haushalt und was sonst so alles anfällt. Die Gute kümmert sich um mich wie eine Mutter, die ich leider nie hatte. Zugegeben, ich genieße die Fürsorge von Mrs. Moore, denn ich bin in einem Waisenhaus groß geworden, in dem nicht gerade zimperlich mit mir umgegangen wurde.
Wie jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, schaute ich aus dem Fenster meiner Wohnung, die sich in der ersten Etage eines großen Wohnhauses befand und noch nicht mein Eigentum war. Ich hatte mir vorgenommen, das Haus irgendwann zu erwerben, um es mein Eigen nennen zu können. Aber dafür muss ich noch jede Menge schreiben.
Die unteren Räume bewohnt Mrs. Moore zusammen mit ihrer kleinen, lieben Familie, die aus einem netten, taubstummen Ehemann, der nur laute Geräusche von sich geben konnte, und einer fast schon erwachsenen Tochter, die sehr schön anzusehen war, bestand.
Grau und wolkenverhangen begann ein neuer Dezembertag, und es schien so, dass es jeden Moment zu schneien anfangen würde. Zusätzlich peitschte ein kalter Wind durch die noch menschenleeren engen Häusergassen. Dennoch hatte ich schon eine ganze Weile in meinem gut geheizten Arbeitszimmer bei Kerzenlicht an meinem Schreibtisch gesessen und versucht, mir eine neue Geschichte auszudenken, die ich für den Zeitungsverlag »London Time « schreiben sollte.
Wöchentlich wollte der Verlag von mir eine Kurzgeschichte, die die Bewohner in der kleinen Stadt über außergewöhnliche Neuigkeiten, die ich erfand, bei Laune halten sollte, damit sich die Zeitung gut verkaufte. Dies fiel mir heute Morgen sehr schwer, denn ich war äußerst unkonzentriert und müde. Ich brauchte jedoch das Geld, und so kam ich nicht drumherum, mir etwas Spannendes einfallen zu lassen, um die Leser zu begeistern. Schlaftrunken saß ich an meinem Schreibtisch und raufte mir mein noch völlig struppiges Haar. Die letzte Nacht war für mich ziemlich schnell zu Ende gegangen, weil sich Betrunkene laut singend unter meinem Schlafzimmerfenster aufgehalten und sich nicht davon abbringen lassen hatten, ihren grauenvollen Gesang woanders vorzutragen.
Als ich gerade vor Müdigkeit meine Augen nicht länger offen halten konnte und, mit der Hand am Kinn, einzuschlafen begann, klopfte es sacht an meiner Zimmertür, und Mrs. Moore betrat pünktlich wie immer um 7:30 Uhr, mit einem Tablett in ihrer Hand, auf dem eine Tasse mit dampfendem Kaffee stand, mit den Worten den Raum: »Mr. Smith, der ist gerade für Sie angekommen. Ich lege ihn auf den Tisch.«
Sie zog einen roten Briefumschlag aus ihrer Schürzentasche, legte ihn ab und schlenderte zur Tür hinaus. Mein trüber Blick richtete sich auf den roten Umschlag und ich rief meiner Haushälterin nach: »Danke, Mrs. Moore.« Ich begann mit einem müden Lächeln, den roten weihnachtlichen Briefumschlag, der stark nach Zimt roch, vor mich hin murmelnd zu lesen. Als ich sah, dass es sich um eine Einladung für das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel handelte, war ich sogleich hellwach und in voller Vorfreude, das Fest in gemütlicher Runde meiner Freunde Matt und Jennifer zu verbringen.
Ich lief ins Schlafzimmer, zog einen braunen Lederkoffer unter meinem Bett hervor und fing an, ihn mit meinen besten Kleidungsstücken zu packen. Zwischendurch lief ich zur Zimmertür, öffnete sie einen Spalt und rief fröhlich durchs Haus: »Mrs. Moore, bitte bestellen Sie mir für morgen früh eine Kutsche.« Die Gute erledigte sofort alles zu meiner Zufriedenheit. Dann verschlang ich unten in der Küche mein Frühstück, wobei mich Mr. Moore lächelnd beobachtete und mir sanft meine Hand tätschelte.
Später machte ich mich fröhlich gestimmt auf ins vorweihnachtliche bunte Geschäftstreiben, denn ich wollte nicht mit leeren Händen bei meinen Freunden unter dem Tannenbaum stehen. Auch für Mrs. Moore besorgte ich eine schöne Weihnachtsüberraschung. Es war der bunte Schal, den sie im Schaufenster von Mr. Midges Damenbekleidung gesehen hatte.
Nachdem ich von meinen Weihnachtseinkäufen zurück war, begab ich mich sofort in mein Arbeitszimmer und begann, die ersten Zeilen auf das raue Papier zu schreiben. Ich dachte mir, etwas über einen Weihnachtsgeist zu schreiben, der die Leser für eine Weile ihren Alltag vergessen lässt, hatte aber nach den ersten Zeilen keine Ideen mehr, legte meine Arbeit nieder und genoss stattdessen einen Gin, der sanft meine Kehle hinunterfloss. Gleich nach dem Abendbrot rauchte ich auf dem Balkon eine Zigarette, starrte in eine sternenklare Dezembernacht und auf den bevorstehenden Vollmond.
Ich legte mich früh schlafen, denn für mich sollte die Nacht noch weit vor dem Morgengrauen enden, denn ich hatte eine längere Reise in der Kutsche vor mir.
Nach dreistündigem Schlaf stand ich auf, war sehr vergnügt und immer noch voller Vorfreude. Als ich in die Küche kam, meinen Kaffee mit viel Milch schlürfte und als Frühstück nur ein hart gekochtes Ei zu mir nahm, überreichte ich meiner guten Mrs. Moore ihr Geschenk, das ich am Vorabend in einer Geschenkkiste verpackt hatte.
Für Mr. Moore und Clan hatte ich die besten Pralinen in der Stadt gekauft und sie in eine Geschenkkiste mit einem Weihnachtsgruß gelegt. Freudentränen rollten über Mrs. Moores rundliche apfelrote Wangen, und sie drückte mich fest an sich. Dann legte sie ebenfalls einen sehr langen, bunten, selbst gestrickten Wollschal um meinen Hals und wuschelte mir durch mein dichtes dunkelbraunes kurzes Haar mit den Worten: »Kommen Sie mir gesund wieder, und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen, Mr. Smith.«
Mit meinem riesigen Koffer, den ich mit beiden Händen trug, weil er doch ziemlich schwer war, begab ich mich zur Kutsche, die schon seit ein paar Minuten auf dem zugeschneiten Kopfsteinpflaster stand und nur darauf wartete, mich zum Landsitz der Williams zu kutschieren.
Als wir den Stadtrand erreicht hatten, wurde die Kutschfahrt durch das schlechte Wetter immer beschwerlicher. Nur mühselig bewegten sich die Räder mit lautem Knirschen durch den Schnee. Der Morgen brach an, und der Himmel war von dunklen Wolken verdeckt. Unsanft fuhren wir über vereiste Stellen, bis wir an einem etwas angenehmeren Waldweg anlangten, der nicht so dicht von Schnee bedeckt war. Eine unheimliche Stimmung von stürmischem Gesang des Windes begleitete mich und ließ meiner Fantasie freien Lauf.
Auf dem Weg zum Landsitz kam mir plötzlich alles so seltsam vor, es war so anders als die letzten Fahrten. Die Umgebung erschien mir unheimlich, und mich überkamen Ängste, von denen ich nicht gewusst hatte, dass es sie überhaupt gab. In meinen Gedanken beruhigte ich mich selbst und sagte zu mir: »Dark, du schaust jetzt nicht mehr aus dem Fenster, deine Fantasie geht sonst noch mit dir durch.« Mit diesen Gedanken lehnte ich mich in meinem Sitz zurück, schob meine Brille mit dem Zeigefinger auf die Nase und schloss meine müden Augen.
Nachdem ich in der Kutsche kräftig durchgeschüttelt worden war, kamen wir am frühen Abend am Haus der Williams’ an, wo ich von Matt und Jennifer bereits erwartet und aufs Herzlichste begrüßt wurde. Ein äußerst elegantes Haus, das diesmal von einer schwarzen Stimmung überdeckt war, was etwas sehr Gruseliges an sich hatte.
Laut kreischend, eng aneinander gekauert, saß eine Schar von Krähen in dem blattlosen Baum, der gleich neben dem prachtvollen Haus stand. Ihr Krächzen klangen wie Zurufe für mich, fast so, als wollten sie mir etwas Wichtiges sagen. Bei genauem Hinhören klang es sogar wie eine Warnung, die mich zur Umkehr aufforderte.
Matt und Jennifer lächelten mich verlegen an, doch kam es mir so aufgesetzt vor – vollkommen anders als sonst. Schnell galt meine Aufmerksamkeit dem betörenden Duft von Weihnachten. Aus allen Fensterritzen und der offen stehenden Eingangstür kamen himmlisch gut riechende Weihnachtsgerüche geschwebt. Ein Duft von frisch gebackenen Kuchen, Plätzchen und Weihnachtsbraten.
Als wir das Haus betraten und ich vom Personal freundlich begrüßt wurde, konnte ich in ihren Augen eine Angst lesen, die mit der Hoffnung verbunden war, dass ich sie wovon auch immer erlösen sollte. Doch mein Blick richtete sich auf den prachtvollen Weihnachtsbaum, der in der Empfangshalle stand, vom Personal geschmückt worden war und im vollen Lichterglanz erstrahlte.
Mit gestellter Fröhlichkeit lächelten sich alle verlegen an. »Dark, komm schnell ins Warme, du musst ja ganz durchgefroren sein«, sagte Jennifer zu mir und hielt sich an meinem Arm fest, während sie mit einem Spitzentaschentuch ihre rote Nase putzte und mich bis zu den Treppenstufen begleitete. Es kam mir vor, als würde sie sich an mir abstützen, denn es war nicht zu übersehen, wie dürr und blass sie geworden war, was großes Mitleid und gleichzeitige Nachdenklichkeit in mir auslöste. In ihrem fast weißen Gesicht konnte ich Kummer und Sorgen erkennen, die nichts Gutes bedeuteten.
Nachdem wir die Eingangshalle des riesigen Hauses betreten hatten, strahlte ich dennoch über das ganze Gesicht und vergaß für einen Moment alles um mich herum. Zu schön war der Anblick der geschmückten Tanne, die im Hintergrund von zarter Weihnachtsmusik untermalt wurde. Im ganzen Haus duftete es nach Weihnachtsbraten, und ich konnte das Abendessen kaum erwarten.
Mit warmem Kerzenlicht und Tannengrün war das Treppenhaus weihnachtlich geschmückt. Das Haus war, wie im Märchen, wunderschön anzusehen, und überall an den Wänden hing Tannengrün, das mit Zimtstangen, Nüssen und roten Äpfeln geschmückt war. Dieser Anblick ließ mich für einen Moment aufatmen, und die traurigen Gedanken verblassten für eine kurze Zeit.
RÄTSELHAFTE GERÜCHE
Nachdem ich von Henry, dem Butler, in die erste Etage auf mein Zimmer gebracht worden war, kramte ich aus dem Koffer meinen Waschbeutel heraus, lief ins Badezimmer und machte mich etwas frisch für das bevorstehende Abendessen. Doch ließ mich auch hier in meinem Zimmer etwas nicht zur Ruhe kommen.
Ich hatte einen strengen Geruch in der Nase, den ich nicht so schnell wieder loswerden sollte. Er war stark und streng und erinnerte mich an unseren längst verstorbenen Familienhund Jo, der sich gern im Regen draußen herumtrieb, sodass sein Fell stark gerochen hatte.
Naserümpfend und in frischer Kleidung, die ich mit jeder Menge Duftwasser besprenkelt hatte, machte ich mich gut gelaunt auf den Weg zum Speisesaal. Noch immer roch das Haus nach herrlichem Braten, und ich lief hastig die Treppenstufen hinunter. Im Speisesaal angekommen, saßen Matt und Jennifer an einem großen langen Tisch, auf dem Kerzenlicht im goldenen Glanz erstrahlte. Matt saß im Schatten der Dunkelheit.
Im Kamin knisterte und knackte ein Feuer, dessen Flammen bei näherem Betrachten wie Fabelwesen aus einem Märchen aussahen, die versuchten, mir eine schreckliche Geschichte zu erzählen. Der Fußboden war mit schwarz-weißen Karomusterfliesen ausgestattet, die auf Hochglanz poliert waren, sodass man sich darin spiegeln konnte.
Jennifer bat mich, am anderen Ende des Esstisches Platz zu nehmen; ich wunderte mich darüber, kam aber ihrem Wunsch nach, denn sie hatte bestimmt ihre Gründe dafür, dachte ich mir. Unsere Unterhaltung war laut, denn wir mussten uns die Worte zurufen, wobei Matt und Jennifer scheinbar nicht an großen Gesprächen interessiert waren. Auch wunderte ich mich, dass ich bisher der einzige Gast war.
Nachdem ich mir meinen Mund mit der Stoffserviette abgetupft und meine abendliche Zigarette angezündet hatte, pustete ich die ersten Rauchkringel stöhnend aus. »Sind denn Doktor Bird und die Sandersens, Jack, Jewel, und all die anderen Gäste, die jedes Jahr mit uns Weihnachten verbringen, noch nicht eingetroffen?«
Im selben Moment schaute ich auf die Standuhr, deren Zeiger sich langsam auf Mitternacht zubewegten, und der herannahende Vollmond strahlte durch das bunte Fensterglas. Matt wurde immer unruhiger . Er zappelte und rutschte auf seinem riesigen Stuhl hin und her, während er mit einer Hand seine Krawatte lockerte und um Luft rang.
Jennifer bat mich, auf mein Zimmer zu gehen und die Tür gut zu verschließen. Als ich sie nach dem Grund fragen wollte, schrie sie mich an und klang dabei, als ob sie weine. Pure Angst konnte ich ihrem Gesichtsausdruck entnehmen, und mit kreisrunden, weit aufgerissenen Augen bibberte ihr ganzer Körper. »Geh, geh endlich, und verlasse auf gar keinen Fall das Zimmer. Geh«, schrie sie, während sie Matt mit einem Taschentuch dicke Schweißperlen von der Stirn tupfte.
Ich verstand die Welt nicht mehr, tat aber das, worum sie mich gebeten hatte. Schnellen Schrittes begab ich mich auf mein Zimmer und verschloss die schwere Eichentür, die mit vielen Schlössern versehen war. Zum Schluss schob ich zwei Eichenbalken zum Schutz vor die Tür, bevor ich das Eisengitter von der Decke fest im Boden verankerte.
Ich sah mir die nun gut gesicherte Zimmertür genauer an, ich sagte zu mir selbst: »Hm, ja, das ist noch ziemlich neu, die Farbe ist sogar noch frisch.« Ich lief eilig rüber zum Bett und kroch unter die dicke Daunendecke, denn ich fror auf einmal sehr, das Feuer im Kamin war wie von Geisterhand plötzlich erloschen. Eine unheimliche Stille und eisige Kälte schlichen durch das Haus.
Als ich unter meiner Bettdecke lag und gerade in einen leichten Schlaf gefallen war, konnte ich aus der Ferne schreckliches Wolfsheulen hören. Vorsichtig schaute ich über den Rand meiner Bettdecke und sah, wie der Vollmond in seiner ganzen Pracht mit schwarzer Stimmung zu mir ins Zimmer hineinschien, als ich zeitgleich grausiges Knurren und schmatzende Geräusche, die nicht weit von meiner Zimmertür entfernt sein konnten, hörte. Ein strenger, starker Geruch, wie der von einem Wolf, drang unter dem Türspalt durch.
Dann hörte ich plötzlich etwas laut schnaufen – es schnüffelte eine riesige schwarze, feuchte Nase am Türspalt und nahm meinen Geruch auf. Immer heftiger und lauter wurde das brummige Knurren, und ich konnte regelrecht die Gier nach Menschenfleisch hören. Mit lauten, angsteinflößenden Geräuschen begann das mir unbekannte Wesen an der Tür zu kratzen. Es versuchte, sie mit seinem Körper zu durchbrechen.
Es musste ein gewaltig großes Tier mit riesigen Krallen sein, denn später sah ich, wie tief die Spuren ins Holz gekratzt waren. Aufgeregt schlug und stieß es immer und immer wieder mit seinem Körper vor die schwere Tür, wobei das Knurren und gierige Hecheln immer lauter und boshafter wurden. Auf einmal ertönte in der Ferne eine Art Sturmglocke, was das Wesen davonjagen ließ.
DER WOLF IN JEANS
Um ins Freie zu gelangen, sah ich von meinem Fenster aus, wie sich ein riesiger Wolf durch das bunte Fensterglas im Treppenhaus die Freiheit verschafft hatte, in voller Größe aufrecht stand und den Vollmond anheulte. Angstschweiß schoss aus meinen Poren, und ich sagte zu mir selbst: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu, hier sind schwarze Mächte am Werk.«
Im Mondlicht konnte ich die grausame Gestalt besser erkennen und sah in seinem weit aufgerissenen Maul lange, spitze Reißzähne, sein grauenhaftes Aussehen ließ meinen Atem stocken. In tiefschwarzer Nacht peitschte ein schrecklicher Wind durch das Land, und durch den starken Schneefall konnte man fast seine Hand vor Augen nicht mehr erkennen. Ich hörte jedoch, dass sich eine Kutsche dem Haus der Williams näherte. Durch lautes Zurufen, begleitet von Peitschenknallen, versuchte der Kutscher, mühselig durch das Unwetter zu fahren.
Der riesige Wolf nahm trotz des Schneegestöbers den Geruch der herannahenden Kutsche auf, auf die er sogleich mit gierigen Geräuschen und grauenvollem Knurren zum Angriff ansetzte. Ich dachte mir: »Das müssen die anderen Gäste sein, ich muss ihnen zu Hilfe eilen, sonst sind sie verloren.« Auch waren meine Gedanken bei Matt und Jennifer. Was, wenn die riesige Kreatur die beiden zu fassen bekäme? Ich wollte mir nicht einmal im Traum vorstellen, wie die Bestie die beiden grauenhaft zerfleischen würde. Ich dachte nur darüber nach, in welcher Gefahr meine Freunde sich in diesem Moment befanden.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und öffnete vorsichtig meine Zimmertür. Aus Angst, weiterzuatmen, hörte ich unbewusst damit auf. Nachdem sich der erste Schreck gelegt hatte, schaute ich mich auf dem langen Gang vorsichtig um. Eine unheimliche Atmosphäre tat sich vor meinen Augen auf. Eine eisige Kälte strömte durch das Haus, während ein Nebeldunst sich durch den Fußboden fraß und nach mir greifende Hände zum Vorschein brachte. An den Wänden konnte ich verzweifelte Seelen sehen, die mir mit ihrem grauenvollen Gesang fast den Verstand raubten.
Auf Zehenspitzen lief ich zur Treppe und hatte zu tun, dass mich die Hände der schwarzen Seelen nicht zu fassen bekamen. Ich hörte leises Weinen, von dem ich nicht wusste, woher es kam. Zuerst lief ich orientierungslos herum und versuchte, mich zu konzentrieren, und suchte mit meinem Blick nach der weinenden Person. Dann öffnete sich mit lautem Quietschen und Knarren hinter mir eine Tür, und eine liebliche Stimme rief mir leise zu: »Dark, oh bitte, Dark, du musst uns helfen.«
Als ich der Stimme folgte, kam ich gerade noch rechtzeitig, um die zusammenbrechende Jennifer aufzufangen. Leichenblass war sie, und ihrem Gesichtsausdruck konnte ich entnehmen, dass ihr und Matt etwas Grauenhaftes passiert sein musste. Ihre letzten Worte, bevor sie in Ohnmacht fiel, waren: »Nimm die Pistole mit den Silberkugeln aus meinem Nachttisch. Bitte, Dark, bitte, hilf uns.«
Vorsichtig nahm ich Jennifer auf meine Arme und trug sie in ihr Zimmer. Ich legte sie behutsam aufs Bett und nahm die Pistole mitsamt den selbst hergestellten Silberkugeln aus dem Nachttisch. Mit großer Angst im Nacken rannte ich in Windeseile in Richtung Eingangstür. Meine Gedanken waren nur noch bei Matt: Wo ist er nur, hat der Wolf ihn schon zerfleischt?
Dann aber wurden meine Gedanken unterbrochen. Ich hörte draußen an der Tür das verzweifelte Rufen mehrerer Personen: »Hilfe, Hilfe. Bitte öffnet uns die Tür. Hört uns denn niemand? Bitte, bitte, Hilfe!« Zeitgleich konnte ich in der Ferne das grauenvolle Heulen der herannahenden Bestie hören. Der Sturm wurde immer heftiger. »Mein Herr, ich helfe Ihnen. Bitte folgen Sie mir, ich weiß, wo wir uns alle in Sicherheit bringen können«, rief eine mir vertraute Stimme.
Der Butler Henry war inzwischen zur Tür geeilt und wollte sie öffnen. Mir schien es, als würde ihm das alles bekannt vorkommen. Die angsteinflößenden Hilferufe an der Eingangstür wurden immer lauter. Ich eilte Henry zu Hilfe, und wir versuchten gemeinsam, die Tür zu öffnen.
Mit großer Anstrengung schoben wir die schweren Riegel zur Seite, steckten den Schlüssel mit zitternden Händen ins Schloss und drehten ihn vorsichtig nach rechts. Es wollte einfach nicht gelingen, irgendetwas klemmte, der Schlüssel drohte, abzubrechen. Angstschweiß lief an unseren Gesichtern hinunter, und wir hatten nicht mehr viel Zeit, bis der Wolf die Menschen erreicht hätte.
Henry und ich schauten uns mit großer Verzweiflung an. Dann rief ich laut: »Noch einmal, Henry, kommen Sie, mein Freund, versuchen wir es noch einmal.« Die Zeit war knapp, der riesige Wolf näherte sich, mit Fleischresten des Kutschers im Maul, in Windeseile dem Haus und knurrte mit großer Gier und messerscharfen Zähnen. Nachdem Henry und ich es in letzter Sekunde geschafft hatten, die Tür zu öffnen, zogen wir drei Gäste, die mir nicht unbekannt waren, ins Haus, die vom Personal in warme Wolldecken gehüllt wurden. Mit suchendem Blick schaute ich mich nach Matt um, konnte ihn aber nicht ausfindig machen. Mein erster Gedanke war, dass er in Gefahr sein musste. Sicher hatte er den Gästen zu Hilfe eilen wollen und war noch da draußen mit dem Wolf.
Ich fror schrecklich, meine Hände schmerzten von der beißenden Kälte und ich hatte das Gefühl, meinen Körper nicht mehr zu spüren. Doch wir hatten keine Zeit. Als Henry und ich die Tür verschließen wollten, stieß von draußen etwas so heftig dagegen, dass wir zur Seite flogen. Mit bösem Knurren kam der Wolf ins Haus. Sein zotteliges grauschwarzes Fell war mit Schnee bedeckt, den er in der Eingangshalle abschüttelte.
Ich beobachtete, wie das Monster auf seinen mächtigen Pfoten sich langsam im Inneren des Hauses bewegte und schnüffelnd unsere Gerüche aufnahm. Es war unheimlich, wie ihm der Sabber aus dem Maul tropfte und das Blut seiner Opfer in seinem Fell klebte. Ich hatte einen Moment lang das Gefühl, seine Gedanken lesen zu können. Ich konnte in Gedanken sehen, wie er jeden einzelnen von uns aufspürte und auffraß. Dann aber blieb der Werwolf mit einem Mal stehen, es war so, als spürte er jemanden, den er kannte. Die Bestie änderte scheinbar ihren Plan, mit großer Vorsicht drehte sie sich in die andere Richtung und schlich auf ihren riesigen Pfoten zur Treppe, gleich neben den Weihnachtsbaum, wo sie aufrecht auf ihren Hinterbeinen in voller Größe stand und mit ihren leuchtend grünen Wolfsaugen eine Person fixierte, die oben am Treppenabsatz stand.
Erst konnte ich aus meinem Versteck heraus nur den Schatten der Person sehen, dann aber sah ich, dass es Jennifer war, die weinend dastand und den Wolf mit zarter Stimme aufforderte: »Bitte, so beruhige dich doch. Du darfst uns nichts tun, bitte.« Mit leisem Knurren nahm der Wolf den Geruch von Jennifer auf, blieb weiterhin aufrecht stehen und schaute fast schon liebevoll zu ihr hinauf. Sein Knurren hörte zeitgleich auf, und ich konnte mir in diesem Moment das Tier genauer anschauen. Ich erschrak, als ich sah, dass der aufrecht stehende Wolf in Jeanshose dastand. Der Anblick erschien mir äußerst ungewöhnlich – ein Wolf in Jeans?
DIE ERLÖSUNG
Auf leisen Pfoten schlich das grausam aussehende Tier um den Weihnachtsbaum in der Eingangshalle. Wieder erschrak ich und zuckte am ganzen Körper. Gerade als Henry und ich dabei waren, die Leute im Wandschrank unter der Treppe in Sicherheit zu bringen, konnte ich den Wolf einen kurzen Augenblick aus der Ferne beobachten. Ich sah, dass er beim Betrachten der Erscheinung von Jennifer Tränen vergoss und sie mit lieblichem Augenaufschlag einen Moment lang ansah. Zugleich war er wie von Sinnen mit bösem Blick und lautem Knurren zähnefletschend und mit großer Gier auf sie fixiert. Er ging zum Angriff über und bewegte sich schleichend auf die hagere Frau zu. Sabbernd und zähnefletschend leckte er sich seine Schnauze.
Ich musste sofort handeln, mein Puls raste und mir stockte der Atem. Ich nahm mit noch immer vor Kälte schmerzenden Händen die Pistole. Ich versuchte, die Kugel in den Lauf zu drücken, was mir einfach nicht gelingen wollte. Die Situation für Jennifer wurde immer bedrohlicher. Meine Angst um meine beste Freundin war berechtigt, ich wunderte mich über ihr unerklärliches Verhalten. Jennifer blieb völlig angstfrei oben am Treppenabsatz stehen. Warum lief sie nicht weg? Sie musste in eine Art Schock gefallen sein, anders konnte ich mir ihr Verhalten nicht erklären. Ich schrie, wie vom Wahnsinn gepackt, Jennifer immer wieder zu: »Lauf weg, Jennifer, lauf doch weg, bitte!« Doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Stocksteif, wie in Hypnose, blieb sie am Treppenabsatz stehen.
Henry eilte mir zu Hilfe, nahm meine Hände in seine, schaute mich an und sagte mit leiser, ganz ruhiger Stimme: »Ganz ruhig, Dark, ganz ruhig.« Ich sah in sein Gesicht und erkannte den Geist von Matt, der aus Henrys Körper drang und mit ruhigen Worten zu mir sprach. Dann ließ er meine gewärmten Hände los, und ich sah wieder in das Gesicht von Henry. Ich zitterte nicht mehr, und die Pistole lud sich fast von selbst. Mit ausgestrecktem Arm zielte ich auf den riesigen Wolf, der sich von Jennifer abgewandt hatte und plötzlich auf uns zugestürmt kam.
Ich zielte auf den herannahenden Wolf. Das mächtige Tier setzte zum Sprung an und wollte sich gerade auf mich stürzen. Doch in letzter Sekunde drückte ich den Abzug, die silberne Kugel schoss mit hoher Geschwindigkeit aus dem Lauf und traf den Wolf mitten ins Herz. Er gab einen schrecklichen Schmerzensschrei von sich. Die Silberkugel durchbohrte seinen Brustkorb, blieb mitten im Herzen stecken und stoppte das grauenvolle Tier. Der Wolf fiel mit einem lauten Krachen auf den Boden, nur einen Meter weit von mir entfernt, und blieb regungslos liegen.
Jennifer kam weinend die Treppe hinuntergerannt und stürzte sich auf die Bestie, die sich in einen Menschen zu verwandeln begann. Mit verweinten Augen schaute Jennifer mich an, während sie den Wolf, der jetzt kein Wolf mehr war, zärtlich übers Gesicht streichelte. Weinend und schluchzend sagte sie zu mir: »Danke, Dark, wir wussten, dass du uns helfen und uns von unserem Fluch befreien würdest.«
Ich sah Jennifer traurig an und dann auf den Boden. Vor uns lag nun ein Mensch, und ich schaute in das Gesicht meines Freundes Matt Williams. Ich konnte es kaum fassen und ging völlig erschöpft in die Knie – ich hatte meinen Freund Matt Williams erschossen, Tränen von Verzweiflung, Wut und Schmerz durchzogen meinen Körper. Jennifer tröstete mich, nahm mich in ihre Arme. Leise flüsterte sie mir ins Ohr: »Es ist gut so, Dark, es ist gut so. Wir danken dir.«
Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte und der erste Schreck überwunden war, erzählte Jennifer mir, dass Matt vor vielen Jahren auf einer Geschäftsreise in Ungarn mit einem bösen Zauber belegt worden war, weil er einem Vertrag nicht zugestimmt hatte. Ihm war der Vertragspartner nicht geheuer gewesen, weshalb Matt sich von ihm abgewendet hatte. Aus Rache hatte er Matt mit einem Fluch belegt: Auf Matts Heimreise wurde dessen Kutsche von einem Werwolf angegriffen, der alle Fahrgäste bis auf die Knochen zerfleischt und gefressen hatte. Matt kam mit einem Biss im Oberschenkel davon und konnte sich vor dem Werwolf in Sicherheit bringen. Er musste von nun an jedoch in jeder Vollmondnacht, nach einer zuvor schmerzhaften Verwandlung, als grausamer Werwolf sein Dasein fristen und das ungewollte Morden ertragen. Jennifer musste sich seither in jeder Vollmondnacht vor ihrem Mann in Sicherheit bringen.
Nachdem wir Matt noch in derselben Nacht beerdigt hatten, verbrachten wir das Weihnachtsfest in aller Stille zusammen. Am zweiten Weihnachtstag verließ ich das Haus der Williams. Jennifer hat das Haus verkauft, lebt heute in London und ist eine erfolgreiche Schriftstellerin.
Mein Name ist Dark Smith, und ich wünsche Ihnen eine besinnliche und vor allem eine werwolffreie Weihnachtszeit.
TEIL 2:
MARY UND DIE FURIEN
DARK SMITH
Mein Name ist Dark Smith, ich treffe mich hin und wieder mal mit einem guten Freund, um etwas Abstand von meinem Schreibtisch und Alltag zu bekommen, der nicht immer einfach ist. Ich schreibe für die unterschiedlichsten Zeitungsverlage und verdiene dabei nicht schlecht.
Es geht mir recht gut, und ich will mich nicht beschweren. Doch seit dem letzten Erlebnis bei meinen Freunden Matt und Jennifer, die mich wie jedes Jahr zu sich aufs Land eingeladen hatten, um das Weihnachtsfest zusammen zu feiern, hat sich sehr viel in meinem Leben verändert, und ich habe das Gefühl, dass sich seither alles Gruselige wie ein roter Faden durch meinen Alltag zieht. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Natürlich ist es für mich nicht schlecht und zahlt sich aus, denn ich fülle seither die Zeitungsseiten mit meinen seltsamen Berichten wie nie zuvor. Doch bin ich von dieser Zeit an von dunklen Mächten umgeben.
Ich höre Stimmen, bekomme Botschaften aus dem Jenseits und habe Visionen. Manchmal weiß ich schon im Voraus, was mit den Menschen in meiner Umgebung passiert, ohne dass ich es beeinflussen kann. Auch habe ich öfter mal Erscheinungen, die nicht von dieser Welt sein können, doch ich fühle mich gut beschützt und weiß, dass es Himmelskräfte gibt, die mir meinen Weg weisen. Viele Schutzengel begleiten mich täglich, und Götter, die mir zur Seite stehen, spüre ich von Tag zu Tag mit immer stärker werdender Präsenz um mich herum.
Mein Misstrauen Menschen gegenüber – ob ich sie kenne oder nicht –, ist mit der Zeit immer größer geworden. Und ich liebe es mittlerweile, allein zu sein und niemanden treffen zu müssen. Ich halte mich von den Menschen fern, und es stört mich nicht großartig, was da draußen passiert. Sollen sie alle nur tun und lassen, was sie für richtig halten, ich kann es sowieso nicht ändern.
Wenn ich meine Wohnung verlasse, dann nur, weil ich etwas zu erledigen habe. Hier und da mal ein kurzes Gespräch, dann ist es mir genug. Doch was mir vor ein paar Tagen von einer sehr geheimnisvollen Dame zugetragen wurde, kann ich nicht für mich behalten, und davon muss ich einfach berichten.
Am 9. Mai 1876 erreichte mich ein Brief, der mir von meiner Hausdame Mrs. Moore gebracht wurde. Wie jeden Morgen, pünktlich um 7:30 Uhr, klopfte es leise an meine Zimmertür, und sie brachte mir eine Tasse Kaffee. So war es auch an diesem Morgen, an dem alles ganz harmlos begonnen hatte.
DER BRIEF
»Mr. Smith, ich habe Post für Sie. Scheinbar etwas Dringendes, er duftet ziemlich stark nach Parfüm«, kicherte Mrs. Moore und legte den Brief auf meinen Schreibtisch gleich neben meinen Tabakbeutel und den riesigen Stapel mit noch jeder Menge ungeöffneter Post. »Danke, Mrs. Moore. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie diese unnötigen Kommentare für sich behalten könnten, meine Gute«, sagte ich mit einem bestimmenden Ton, ohne dass ich sie dabei anschaute. »Ist noch Kaffee da? Ich hätte gern eine Tasse, Mrs. Moore, mit viel Milch, wie immer«. Ich zeigte mit meinem Finger auf sie, die mit langsamen Schritten den Raum kopfschüttelnd und wortlos mit einem kleinen Lächeln verließ. Sie ist beleidigt, dachte ich mir, machte mir darüber aber keine großen Gedanken. Denn so war Mrs. Moore nun mal.
Nachdem ich einiges an Post abgearbeitet hatte, nahm ich als Letztes den Brief in die Hand, den meine Hausdame mir vor zwei Stunden gebracht hatte. Und wahrhaftig, der Umschlag roch ziemlich stark nach Parfüm. Vergebens suchte ich nach einem Absender. Ich schaute mir den Umschlag immer und immer wieder an, bevor ich ihn öffnete.
Schon den ersten Sätzen des Briefes konnte ich einen Hilferuf entnehmen und wusste nicht, ob ich mich darüber freuen oder ihn besser ungelesen wieder zur Seite legen sollte. Doch wie immer war meine Neugier größer: Ich musste unbedingt wissen, wer mir da schrieb und was der Inhalt dieses Briefes sein konnte.
Sehr geehrter Mr. Smith,
sicherlich wundern Sie sich, dass ich Sie auf diesem Wege kontaktiere. Aber ich benötige dringend Ihre Hilfe. Bitte kommen Sie am Samstagabend in die Diamond Street 3. Ich erwarte Sie gegen 20 Uhr. Klingeln Sie bei Mrs. Rowlands. Und, bitte, seien Sie pünktlich.
Es grüßt Sie
Mary Rowlands
Der Name der geheimnisvollen Dame war mir nicht bekannt, und ich machte mir keine weiteren Gedanken über die unbekannte Frau, denn ich bekam immer wieder mal Briefe von Damen aus gehobener Position, die meine Gesellschaft als angenehm empfanden.
Es war Samstag, eine äußerst arbeitsreiche Woche lag hinter mir, und ich hatte mir am Abend zuvor vorgenommen, richtig auszuschlafen. Nachdem ich den Tag im Schlafanzug verbracht hatte, machte ich mich am späten Nachmittag frisch, wechselte meine Garderobe und begab mich am frühen Samstagabend auf den Weg. Ich verließ recht gut gelaunt und ausgeschlafen meine Wohnung und fuhr mit einer Droschke in die Diamond Street 3. Es war keine lange Fahrt, als der Kutscher in eine sehr dunkle und menschenleere Sackgasse abbog, an deren Ende sich das Haus von Mary Rowlands befand, das eine alte, aber sehr anschauliche Villa war, doch bei genauerem Betrachten etwas sehr Unheimliches an sich hatte.
Der Nebel klebte am Glas des Laternenlichts und hing wie Watte in den blattlosen Bäumen, die am Straßenrand in einer Reihe wie Zinnsoldaten standen, und nahm dem Kutscher und mir die Sicht. Nachdem wir das Haus in der Dunkelheit erreicht hatten, zog ich mehrmals an der silberneren Glocke, die sich gleich neben der Eingangstür befand.
Das Hausmädchen, ein ziemlich junges Ding und noch sehr unerfahren im Umgang mit Gästen, öffnete mir verlegen die Tür mit einem lieblichen Lächeln und leisen Worten: »Guten Abend, Sie müssen Mr. Smith sein. Ach, bitte, kommen Sie doch herein, Sie werden schon von der Dame erwartet.« Ich konnte beobachten, wie sehr ihr Gesicht aus Scham errötete, denn in ihrem Alltag bei Mrs. Rowlands bekam sie nicht so viel mit von der Männerwelt da draußen.
Ich nahm meinen Hut ab und begab mich ins Haus. »Bitte, hier entlang, Mr. Smith«, bat sie mich mit einer Geste, ihr den langen Gang zu folgen. Sie brachte mich in das Zimmer, in dem Mrs. Rowlands mich erwartete.