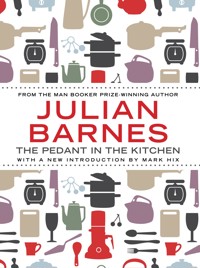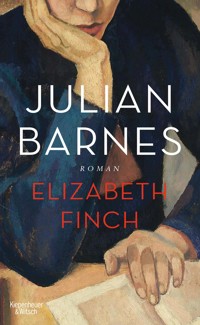19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das meine ich nicht. Ich meine, ich will nicht bloß eine Affäre mit dir haben. Affären – Affären sind – ich weiß auch nicht –, wie wenn man sich eine Ferienwohnung in Marbella zur Teilnutzung kauft oder so.« Oliver und Stuart sind Freunde seit Schultagen. Als Stuart Gillian kennenlernt, die Frau, die er heiraten will, ist er überglücklich. Alles klingt nach Happy End. Doch auch Oliver ist in Gillian verliebt, das merkt er am Tag nach der Hochzeit. Und er lässt nicht locker, sondern hofft, die Frau seines besten Freundes für sich zu gewinnen.Julian Barnes hat einen Roman geschrieben, in dem die Protagonisten einzeln zu Wort kommen und allzu menschliche Abgründe auf höchst amüsante Weise deutlich werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Julian Barnes
Darüber reden
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, geboren 1946, erhielt zahlreiche europäische und amerikanische Literaturpreise, zuletzt den Man Booker Prize. Er hat ein umfangreiches erzählerisches Werk vorgelegt, u.a. die Romane »Flauberts Papagei«, »Die Geschichte der Welt in 10 ½ Kapiteln«, »Arthur & George«. Sein Roman »Vom Ende einer Geschichte« verkaufte sich über 130000-mal.
Die Übersetzerin
Gertraude Krueger, 1949 geboren, lebt als Dozentin und freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E. L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der biedere Bankangestellte Stuart ist ein Langeweiler, wie er im Buche steht, dabei aber gutmütig und zuverlässig. Sein bester Freund schon seit Schultagen ist Oliver – ein Traumtänzer, der sich gerne über den biederen Stuart lustig macht. Doch dann bricht das Schicksal in Gestalt von Gillian über das ungleiche Freundespaar herein. Stuart findet in ihr die Frau des Lebens, und sie heiraten. Oliver ist erst Trauzeuge, dann spannt er sie aus, doch damit fangen die Verwicklungen erst an …
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1 Der, der oder die, die Pl.
2 Leih mir mal ’n Pfund
3 Ich war brillant in jenem Sommer
4 Jetzt
5 Hier fängt alles an
6 Beugt der Alzheimer’schen vor
7 Also, das war komisch
8 Okay, dann eben Boulogne
9 Ich liebe dich nicht
10 Ich kann das nicht so recht glauben
11 Liebe &c.
12 Erspar mir Val. Erspart euch Val.
13 Was ich denke
14 Jetzt ist da eine Zigarette im Aschenbecher
15 Aufräumungsarbeiten
16 De consolatione pecuniae
17 Sont fous, les Anglais
Für Pat
»Er lügt wie ein Augenzeuge.«
Russische Redensart
1 Der, der oder die, die Pl.
Stuart Mein Name ist Stuart, und ich weiß noch alles. Stuart ist mein Vorname. Mein vollständiger Name ist Stuart Hughes. Mein vollständiger Name: Mehr ist da nicht. Kein zweiter Vorname. Hughes war der Name meiner Eltern, die fünfundzwanzig Jahre lang verheiratet waren. Sie haben mich Stuart genannt. Zuerst hat mir der Name nicht sonderlich gefallen – in der Schule wurde ich Stutzi und Stutzer und dergleichen genannt –, aber ich hab mich dran gewöhnt. Ich habe mich damit abgefunden. Abfindungen gehören nun mal zu meinem Beruf.
Tut mir leid, im Witzemachen bin ich nicht besonders gut. Das hab ich schon öfter gehört. Jedenfalls, Stuart Hughes, ich glaube, das reicht für mich aus. Ich will gar nicht St. John St. John de Vere Knatschbull heißen. Meine Eltern hießen Hughes. Sie sind gestorben, und jetzt trage ich ihren Namen. Und wenn ich sterbe, heiße ich immer noch Stuart Hughes. Es gibt nicht allzu viele Gewissheiten auf unserer großen weiten Welt, aber das ist eine.
Verstehen Sie, was ich damit sagen will? ’tschuldigung, wie sollten Sie auch. Ich hab ja grade erst angefangen. Sie kennen mich fast gar nicht. Fangen wir noch mal an. Hallo, ich bin Stuart Hughes, freut mich, Sie kennenzulernen. Sollen wir uns die Hand geben? Gut, okay. Nein, was ich sagen will, ist: Es gibt sonst niemand hier, die ihren Namen nicht geändert haben. Das ist doch ein Ding. Es ist sogar schon etwas unheimlich.
Na, haben Sie gemerkt, dass ich niemand mit die Plural zusammen gebraucht habe? »Es gibt niemand, die ihren Namen nicht geändert haben.« Ich hab das mit Absicht gemacht, womöglich bloß, um Oliver zu ärgern. Wir hatten da diesen fürchterlichen Krach mit Oliver. Na, jedenfalls eine Auseinandersetzung. Oder zumindest eine Meinungsverschiedenheit. Er ist ein großer Pedant, unser Oliver. Er ist mein ältester Freund, daher darf ich ihn einen großen Pedanten nennen. Als Gill – das ist meine Frau, Gillian – ihn kennenlernte, hat sie kurz darauf zu mir gesagt: »Dein Freund redet ja wie ein Wörterbuch.«
Wir waren damals an einem Strand nördlich von Frinton, und als Oliver hörte, was Gill sagte, hat er wieder so eine Nummer abgezogen. Er sagt break dazu, wie im Jazz, aber solche Wörter liegen mir nicht. Ich kann nicht wiedergeben, wie er redet – da müssen Sie ihn schon selber mal hören –, aber er hebt einfach irgendwie ab. Damals auch. »Was für ein Wörterbuch bin ich denn? Hab ich ein Daumenregister? Bin ich zweisprachig?« Und so weiter. Das ging eine ganze Weile so, und schließlich fragte er, wer ihn wohl kaufen würde. »Wenn mich nun keiner haben will? Ich bleibe unbeachtet. Mein Kopfschnitt verstaubt. Oh, nein, ich werde verramscht, das seh ich schon, ich werde verramscht.« Und er fing an, auf den Sand zu schlagen und die Möwen anzuheulen – als wären wir in so einem Kleinen Fernsehspiel –, und ein älteres Ehepaar, das hinter einem Windschutz Radio hörte, sah ziemlich verschreckt drein. Gillian hat bloß gelacht.
Jedenfalls, Oliver ist ein Pedant. Ich weiß ja nicht, was Sie davon halten, wenn man niemand mit die Plural gebraucht. Womöglich nicht sehr viel, warum sollten Sie auch. Und ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, aber wir hatten da diese Auseinandersetzung. Oliver und Gillian und ich. Wir hatten jeder eine andere Meinung. Ich will mal versuchen, die gegensätzlichen Standpunkte darzulegen. Vielleicht mach ich ein Sitzungsprotokoll, wie in der Bank.
OLIVER sagte, dass Wörter wie jemand und jeder und niemand Pronomen im Singular seien und daher das Relativpronomen Singular nach sich zögen, nämlich der.
GILLIAN sagte, man könne nicht eine allgemeine Behauptung aufstellen und dann die Hälfte der Menschheit ausschließen, da dieser jemand sich in fünfzig Prozent aller Fälle als weiblich erweisen würde. Daher sollte man aus Gründen der Logik und der Fairness der oder die sagen.
OLIVER sagte, wir redeten über Grammatik und nicht über Sexualität und Herrschaft.
GILLIAN sagte, wie wir das wohl auseinanderhalten wollten, denn wo käme die Grammatik denn her, wenn nicht von Grammatikern, und fast alle Grammatiker – ja alle ohne Ausnahme, soweit sie wisse – seien Männer, was wir da denn erwarteten; aber vor allem vertrete sie den gesunden Menschenverstand.
OLIVER verdrehte die Augen, zündete sich eine Zigarette an und sagte, dass allein schon der Ausdruck gesunder Menschenverstand ein Widerspruch in sich sei, und wenn der Mensch – und an der Stelle tat er so, als sei ihm das äußerst peinlich, und verbesserte sich zu der-oder-die Mensch –, wenn der-oder-die Mensch sich in den vergangenen Jahrtausenden auf den gesunden Menschenverstand verlassen hätte, würden wir alle noch in Lehmhütten hausen und grauenvolle Nahrung zu uns nehmen und Del-Shannon-Platten hören.
STUART konnte dann eine Lösung anbieten. Da der entweder unzutreffend oder beleidigend oder womöglich gleich beides sei und der oder die diplomatisch, aber furchtbar umständlich, liege es auf der Hand, die Plural zu sagen. Stuart trug diesen Kompromissvorschlag voller Überzeugung vor und war über dessen Ablehnung seitens der übrigen stimmberechtigten Mitglieder verwundert.
OLIVER sagte, dass sich beispielsweise der Satz Da war jemand, die haben den Kopf zur Tür reingesteckt so anhöre, als wären da zwei Körper und ein Kopf, wie bei einem dieser grässlichen wissenschaftlichen Experimente in Russland. Er verwies auf die Monstrositätenkabinette, die es früher auf Jahrmärkten gab, wobei er Bärtige Damen, missgebildete Schafsföten und dergleichen Dinge mehr anführte, bis er vom Präsidium (= mir) zur Ordnung gerufen wurde.
GILLIAN sagte, ihrer Meinung nach sei die Plural genauso umständlich und genauso durchsichtig diplomatisch wie der oder die, aber warum sich die Versammelten denn überhaupt so anstellen würden, wo es darum ginge, einfach mal Stellung zu beziehen? Frauen seien jahrhundertelang angewiesen worden, männliche Pronomen zu gebrauchen, wenn sie von der gesamten Menschheit sprachen, warum sollte dies daher nicht, wenn auch mit Verspätung, ausgeglichen werden, selbst wenn manche (Männer) daran etwas zu knabbern hätten?
Stuart behauptete weiterhin, dass die Plural die beste Lösung sei, da sie den goldenen Mittelweg darstelle.
Die SITZUNG wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
Ich hab hinterher noch ziemlich lange über dieses Gespräch nachgedacht. Da waren wir nun, drei einigermaßen intelligente Leute, und diskutierten über die Vorzüge von der und der oder die und die Plural. Winzig kleine Wörter, und doch konnten wir uns nicht einigen. Dabei waren wir Freunde. Und doch konnten wir uns nicht einigen. Irgendwie hat mir das zu schaffen gemacht.
Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach ja, es gibt sonst niemand hier, die ihren Namen nicht geändert haben. Es stimmt, und das ist doch ein Ding, nicht? Gillian zum Beispiel, die hat ihren Namen geändert, als sie mich heiratete. Ihr Mädchenname war Wyatt, aber jetzt heißt sie Hughes. Ich will mir nicht schmeicheln, dass sie darauf brannte, meinen Namen anzunehmen. Ich glaube, es war eher so, dass sie Wyatt loswerden wollte. Weil, das war nämlich der Name ihres Vaters, und mit ihrem Vater hat sie sich nicht verstanden. Er hat ihre Mutter sitzen lassen, und die musste dann jahrelang mit dem Namen von einem Menschen rumlaufen, der sie verlassen hatte. Nicht sehr schön für Mrs Wyatt, oder Mme Wyatt, wie manche sie nennen, weil sie ursprünglich aus Frankreich kommt. Ich hatte den Verdacht, dass Gillian Wyatt loswerden wollte, um auf diese Weise mit ihrem Vater zu brechen (der im Übrigen noch nicht einmal zur Hochzeit kam) und ihrer Mami zu zeigen, was die schon vor Jahren hätte tun sollen. Nicht, dass Mme Wyatt den Wink verstanden hätte, falls es einer war.
Es war typisch Oliver, dass er sagte, nach der Hochzeit müsste sich Gillian eigentlich Mrs Gillian Wyatt-oder-Hughes nennen, das heißt, wenn sie logisch und grammatisch und gesunden-menschenverständlich und diplomatisch und umständlich sein wollte. So ist er nun mal, unser Oliver.
Oliver. Das war nicht sein Name, als ich ihn kennenlernte. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. In der Schule hieß er Nigel, manchmal auch »N. O.«, gelegentlich auch »Russ«, aber »Oliver« wurde Nigel Oliver Russell nie genannt. Ich glaube nicht einmal, dass wir wussten, wofür das O stand; vielleicht hat er da gelogen. Jedenfalls, die Sache ist die: Ich bin nicht auf die Uni gegangen, Nigel schon. Nigel rückte zu seinem ersten Semester ein, und als er wiederkam, war er Oliver. Oliver Russell. Das N hatte er fallen lassen, selbst bei dem Namen, der auf seinen Schecks gedruckt stand.
Sie sehen, ich weiß alles noch. Er ist zu seiner Bank gegangen und hat die Leute dazu gebracht, dass sie ihm neue Schecks drucken, und statt mit »N. O. Russell« hat er jetzt mit »Oliver Russell« unterschrieben. Ich hab gestaunt, dass die das durchgehen ließen. Ich hätte gedacht, er müsste seinen Namen durch notariell beglaubigte Willenserklärung oder so ändern. Ich hab ihn gefragt, wie er das gemacht hat, aber er wollte es mir nicht erzählen. Er hat nur gesagt: »Ich hab denen gedroht, ich würde mein Konto woanders überziehen.«
Ich bin nicht so clever wie Oliver. In der Schule bekam ich manchmal bessere Noten als er, aber das war dann, wenn er keine Lust hatte, sich anzustrengen. Ich war besser in Mathematik und Naturwissenschaften und in praktischen Dingen – ihm brauchte man im Metallwerkraum nur eine Drehbank zu zeigen, dann legte er schon einen Ohnmachtsanfall hin –, aber wenn er mich übertrumpfen wollte, dann tat er das auch. Na ja, nicht bloß mich, alle. Und er kannte sich aus. Als wir in der Cadet Force Soldaten spielen mussten, war Oliver immer als nicht marschfähig freigestellt. Er kann wirklich clever sein, wenn er will. Und er ist mein ältester Freund.
Er war Brautführer bei mir. Nicht im eigentlichen Sinn, weil es eine standesamtliche Trauung war, und da hat man keine Brautführer. Tatsächlich hatten wir darüber auch so einen albernen Streit. Wirklich albern; das erzähle ich Ihnen ein andermal.
Es war ein herrlicher Tag. Ein Tag, wie ihn alle zum Heiraten haben sollten. Ein sanfter Junimorgen mit blauem Himmel und einer lauen Brise. Wir waren zu sechst: ich, Gill, Oliver, Mme Wyatt, meine Schwester (verheiratet, getrennt, hat ihren Namen geändert – was hab ich gesagt?) und irgendeine ältliche Tante, die Mme Wyatt in letzter Minute ausgegraben hatte. Ich habe ihren Namen nicht verstanden, aber ich möchte wetten, es war nicht der ursprüngliche.
Der Standesbeamte war ein würdiger Mann, der sich mit dem korrekten Maß an Förmlichkeit benahm. Der Ring, den ich gekauft hatte, ruhte auf einem pflaumenfarbenen Kissen aus Samt und zwinkerte uns zu, bis es Zeit war, ihn Gill an den Finger zu stecken. Ich hab mein Gelübde ein bisschen zu laut gesagt, und es schien von den hellen Eichenpaneelen des Raumes widerzuhallen; Gill hat offenbar überkompensiert und so geflüstert, dass der Standesbeamte und ich es gerade eben hören konnten. Wir waren sehr glücklich. Die Zeugen haben im Personenstandsregister unterschrieben. Der Standesbeamte hat Gill ihren Trauschein gegeben und gesagt: »Das gehört Ihnen, Mrs Hughes, diesen jungen Mann hier geht das gar nichts an.« Draußen vor dem Rathaus war eine große Normaluhr, und darunter haben wir ein paar Fotos gemacht. Auf dem ersten Bild von dem Film stand 12.13, und da waren wir drei Minuten verheiratet. Auf dem letzten Bild von dem Film stand 12.18, und da waren wir acht Minuten verheiratet. Ein paar Bilder haben eine verrückte Perspektive, weil Oliver herumgeblödelt hat. Dann sind wir alle in ein Restaurant gegangen und haben gegrillten Lachs gegessen. Es gab Champagner. Dann noch mehr Champagner. Oliver hat eine Rede gehalten. Er sagte, er hätte auf eine Brautjungfer anstoßen wollen, aber nun sei keine da, also wäre er so frei und würde stattdessen auf Gill anstoßen. Alle haben gelacht und geklatscht, und dann hat Oliver einen ganzen Haufen langer Wörter gebraucht, und jedes Mal, wenn er eins gebraucht hat, haben wir alle gebrüllt. Wir waren in einer Art Hinterzimmer, und an einer Stelle haben wir bei einem ganz besonders langen Wort ganz besonders laut gebrüllt, und da hat ein Kellner hereingeschaut, ob wir irgendwas haben wollten, und ist dann wieder gegangen. Oliver brachte seine Rede zu Ende und setzte sich, und es wurde ihm auf die Schulter geklopft. Ich hab mich zu ihm umgedreht und gesagt: »Übrigens, da war gerade jemand, die den Kopf zur Tür reingesteckt haben.«
»Was wollten die denn?«
»Nein«, hab ich gesagt und wiederholt: »Da war gerade jemand, die den Kopf zur Tür reingesteckt haben.«
»Bist du betrunken?«, hat er gefragt.
Ich glaube, er hatte es wohl vergessen. Aber ich weiß es noch, sehen Sie. Ich weiß noch alles.
Gillian Schauen Sie, ich finde einfach, das geht im Grunde niemand etwas an. Wirklich nicht. Ich bin eine ganz gewöhnliche Privatperson. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Heutzutage findet man an allen Ecken und Enden Leute, die darauf bestehen, einem ihre Lebensgeschichte aufzudrängen. Sie brauchen nur eine Zeitung aufzuschlagen, da ruft es überall Hier Ist Mein Leben – Komm Herein. Sie brauchen nur den Fernseher anzustellen, und in jedem zweiten Sender redet jemand über seine oder ihre Scheidung, seine oder ihre uneheliche Geburt, seinen oder ihren Alkoholismus, Krebs, Konkurs, seine oder ihre Krankheit, Drogenabhängigkeit, Vergewaltigung, Amputation, Psychotherapie. Seine Vasektomie, ihre Mastektomie, seine oder ihre Appendektomie. Wozu machen die das alle? Seht mich an, hört mir zu. Warum können die nicht einfach ihre Sachen machen? Warum müssen sie über alles reden?
Bloß weil ich keinen Bekenntnisdrang habe, heißt das nicht, dass ich alles vergesse. Ich weiß noch, wie mein Trauring auf einem dicken burgunderroten Kissen lag, wie Oliver im Telefonbuch blätterte und Leute mit blödsinnigen Namen heraussuchte und wie mir zumute war. Aber das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Meine Erinnerungen sind meine Sache.
Oliver Hallöchen, ich bin Oliver, Oliver Russell. Zigarette? Nein, hab ich mir schon gedacht. Du hast doch nichts dagegen? Ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht gesund ist, deshalb mag ich es ja. Mein Gott, wir kennen uns noch kaum, und schon gebärdest du dich wie ein wild gewordener Körnerfresser. Was geht dich das überhaupt an? In fünfzig Jahren bin ich tot, und du bist ein munteres Echslein, das durch einen Strohhalm Joghurt schlürft, Moorwasser nippt und Gesundheitssandalen trägt. Also mir ist das so rum lieber.
Soll ich dir mal meine Theorie erzählen? Wir kriegen allesamt entweder Krebs oder was mit dem Herzen. Es gibt, im Wesentlichen, zwei Arten von Menschen, solche, die ihre Gefühle in sich hineinfressen, und solche, die alles rausschreien. Introvertierte und extrovertierte, wenn dir das lieber ist. Introvertierte neigen bekanntermaßen dazu, ihre Gefühle, ihre Wut und ihre Selbstverachtung zu internalisieren, und diese Internalisierung ruft, ebenso bekanntermaßen, Krebs hervor. Extrovertierte andererseits lassen alles fröhlich raushängen, wüten gegen die ganze Welt, übertragen ihre Selbstverachtung auf andere, und diese Überanstrengung führt, logischerweise, zu Herzanfällen. Entweder – oder. Nun bin ich zufälligerweise extrovertiert, wenn ich das also mit Rauchen kompensiere, bleibe ich so ein vollkommen ausgeglichener und gesunder Mensch. Das ist meine Theorie. Obendrein bin ich nikotinsüchtig, und das erleichtert das Rauchen.
Ich bin Oliver, und ich weiß noch alles, was wichtig ist. Das mit dem Gedächtnis ist doch so. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Leute über vierzig herumjaulen wie die Kettensägen, ihr Gedächtnis sei nicht mehr das, was es mal war, oder nicht so gut, wie sie es gern hätten. Offen gestanden überrascht mich das nicht: Guck dir doch bloß mal an, wie viel Mist sie da zu speichern belieben. Denk dir einen ungeheuren Schuttcontainer, vollgestopft mit Banalitäten: einzigartig uneinmalige Kindheitserinnerungen, fünf Billionen Sportergebnisse, Gesichter von Leuten, die sie nicht leiden können, Handlungsverläufe von rührseligen Fernsehserien, Tipps zur Entfernung von Rotweinflecken aus dem Teppich, der Name ihres Abgeordneten und so Zeug. Welch ungeheure Eitelkeit lässt sie zu dem Schluss kommen, das Gedächtnis wolle sich mit solcherlei Müll zustopfen lassen? Stell dir das Organ der Erinnerung vor wie den Mann an der Gepäckaufbewahrung eines brodelnden Kopfbahnhofs, der auf deinen kümmerlichen Krempel aufpasst, bis du den wieder mal brauchst. Nun überleg mal, worauf der da alles achtgeben soll. Und für so wenig Geld! Und für so wenig Dank! Kein Wunder, dass der Schalter die halbe Zeit nicht besetzt ist.
Ich mach das mit dem Gedächtnis so, dass ich es nur mit solchen Dingen betraue, um die es sich mit einem gewissen Stolz kümmern kann. Zum Beispiel merke ich mir nie Telefonnummern. Ich kann mir gerade eben meine eigene merken, aber mir kommen nicht gleich alle Ängste dieser Welt hoch, wenn ich mein Adressbüchlein zücken und darin Oliver Russell nachschauen muss. Manche Leute – verbissene parvenus im Königreich des Geistes – faseln was von Gedächtnistraining, auf dass es fit und agil werde wie ein Athlet. Na, was mit Athleten passiert, wissen wir ja alle. Diese widerlich wendigen Ruderer nibbeln doch allesamt ab, wenn sie gerade mal mittelalt sind, Fußballspieler kriegen die Knarzscharnier-Arthritis. Muskelrisse verhärten, Bandscheiben verschwinden und Wirbel verklumpen. Schau dir mal ein Sportveteranentreffen an, das sieht aus wie die Reklame für ein geriatrisches Pflegeheim. Hätten sie nur ihre Sehnen nicht so heftig strapaziert …
Daher bin ich ein überzeugter Gedächtnisverhätschler und stecke meinem nur die feineren Erfahrungshäppchen zu. Dieses Essen nach der Hochzeit, zum Beispiel. Wir haben einen durchaus spritzigen Nichtjahrgangs-Champagner getrunken, den Stuart ausgesucht hatte (Marke? was weiß ich? mis en bouteille par Les Vins de l’Oubli), und saumon sauvage grillé avec son coulis de tomates maison gegessen. Ich persönlich hätte das nicht gewählt, aber ich wurde ja auch nicht gefragt. Nein, es war vollkommen in Ordnung, nur eben ein wenig fantasielos … Mme Wyatt, bei der ich à côté war, schien es zu schmecken, oder zumindest schien sie den Lachs zu genießen. Doch in den durchscheinenden rosaroten Würfelchen, die den Fisch umgaben, stocherte sie ziemlich herum, dann wandte sie sich an mich und fragte:
»Was genau könnte das Ihrer Meinung nach sein?«
»Tomate«, konnte ich sie aufklären. »Gehäutet, entstrunkt, entkernt, gewürfelt.«
»Wie seltsam, Oliver, dass man genau das, was den Charakter einer Frucht ausmacht, entfernt, als sei es ein Geschwür.«
Findest du das nicht ziemlich prachtvoll? Ich nahm ihre Hand und küsste sie.
Andererseits könnte ich dir leider nicht sagen, ob Stuart zu der Zeremonie seinen mitteldunkelgrauen Anzug oder seinen dunkeldunkelgrauen Anzug anhatte.
Siehst du, was ich meine?
Ich weiß noch, wie der Himmel an dem Tag war: Wolkenwirbel wie marmoriertes Vorsatzpapier. Ein bisschen viel Wind, und jeder, der beim Standesamt zur Tür reinkommt, streicht sich erst mal die Haare glatt. Zehn Minuten Warten um einen niedrigen Couchtisch, auf dem drei Telefonbücher von London und drei Ausgaben des Branchenverzeichnisses liegen. Ollie will die Gesellschaft bei Laune halten, indem er einschlägige Fachleute wie Scheidungsanwälte und Gummiwarenlieferanten heraussucht. Doch springt der Funke des Frohsinns nicht über. Dann gingen wir hinein und standen diesem kleinen Standesbeamten gegenüber, der absolut salbaderisch und crépusculaire war. Eine Mehlbombe von Schuppen auf den Schultern. Die Schau ging einigermaßen normal über die Bühne. Der Ring glitzerte auf seiner schlehenfarbenen pouffe wie ein Intrauterinpessar. Stuart brüllte seinen Text, als hätte er sich vor dem Standgericht zu verantworten, und wenn er nicht mit absolut vollster Lautstärke artikulierte, würde ihm das ein paar Jahre Festungshaft zusätzlich eintragen. Die arme Gillie konnte ihre Responsorien nur mit Müh und Not intonieren. Sie hat wohl geweint, doch ich erachtete es für vulgär, genauer hinzugucken. Hinterher gingen wir nach draußen und machten Fotos. Stuart sah ganz besonders selbstgefällig aus, dachte ich. Er ist ja mein ältester Freund, und es war ja seine Hochzeit, aber vor lauter Selbstzufriedenheit sah er ganz mogadanal aus, daher eignete ich mir die Kamera an und tat kund, da müssten unbedingt noch ein paar künstlerisch wertvolle Aufnahmen in das Hochzeitsalbum. Ich stolzierte herum und lag auf dem Boden und drehte das Objektiv um 45 Grad und rückte ihnen porentief auf den Leib, aber in Wirklichkeit hatte ich nur eins im Sinn, nur ein Anliegen – eine gute Aufnahme von Stuarts Doppelkinn. Dabei ist er erst zweiunddreißig. Na ja, Doppelkinn ist vielleicht etwas unfair: Sagen wir einfach Schweinebacke. Doch ein Maestro an der Blende bringt sie zur Geltung, fett glänzend und sich blähend.
Stuart … Nein, Moment mal. Du hast schon mit ihm gesprochen, nicht wahr? Du hast mit Stuart gesprochen. Ich hab das leise Zögern durchaus bemerkt, als ich das Thema seines Doppelkinns angeschnitten habe. Es sei dir überhaupt nicht aufgefallen? Mag sein im Dunkeln und im Gegenlicht … Und womöglich hat er zur Kompensation den Unterkiefer vorgestreckt. Meiner Ansicht nach würde dieser Kehlsack lange nicht so sehr ins Auge springen, wenn Stuart längere Haare hätte, aber er lässt seinem borstigen Mäusepelz ja keinerlei Lebensraum. Und dann sein rundes Gesicht und die freundlichen kleinen Knopfaugen, die hinter dieser Brille hervorlugen, die ja nicht gerade der allerletzte Modeschrei ist. Ich meine, er sieht durchaus gutmütig aus, aber da müsste doch irgendwie noch dran gearbeitet werden, meinst du nicht?
Wie war das? Er hatte keine Brille auf? Natürlich hatte er eine Brille auf. Ich kannte ihn schon als Fünfkäsehoch und … na ja, vielleicht hat er sich insgeheim Kontaktlinsen zugelegt und hat sie bei dir ausprobiert. Na schön. Möglich wär’s. Möglich ist alles. Vielleicht versucht er’s jetzt mit einer dynamischeren Tour, damit er eine Idee mehr macho rüberkommt, als wir alle ihn kennen, wenn er in seinen ekligen kleinen Karnickelstall in der City geht und auf seinen neurotisch blinkenden kleinen Monitor glotzt und in sein schnurloses Telefon schnauzt, um noch eine tranche Bleioptionen oder sonst was zu ordern. Aber er hat für den Umsatz der Optiker besonders – derjenigen, die so richtig unmoderne Gestelle führen – gesorgt, seit wir zusammen zur Schule gegangen sind.
Was gibt es denn jetzt wieder zu grinsen? Wir sind zusammen zur Schule … Ah. Alles klar. Stuart hat rumgestänkert, weil ich meinen Namen geändert hab, nicht wahr? Er ist geradezu besessen von solchen Dingen, musst du wissen. Er hat diesen wahrhaft langweiligen Namen da – Stuart Hughes, sag mal selbst, damit kann man doch in der Heimtextilbranche wunderbar Karriere machen, keine Qualifikationen erforderlich außer dem perfekten Namen, Sir, und Sie sind ein gemachter Mann – und ist es ganz zufrieden, auf diesen Namen zu hören bis ans Ende seiner Tage. Oliver aber hieß früher mal Nigel. Mea culpa, mea maxima culpa. Beziehungsweise doch nicht. Beziehungsweise: Danke, Mami. Jedenfalls, man kann doch nicht ein ganzes Leben lang auf den Namen Nigel hören, oder? Man kann noch nicht einmal ein ganzes Buch lang auf den Namen Nigel hören. Manche Namen sind nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr angemessen. Nehmen wir mal an, du heißt Robin, also Rotkehlchen, zum Beispiel. Also, bis zum Alter von etwa neun Jahren ist das absolut in Ordnung, aber dann muss da doch bald mal was unternommen werden, nicht wahr? Änder den Namen durch notariell beglaubigte Willenserklärung zu Samson oder Goliath oder sonst was. Bei manchen appellations wiederum ist das Gegenteil der Fall. Bei Walter, beispielsweise. Man kann nicht Walter sein im Kinderwagen. Man kann nicht Walter sein, bevor man um die fünfundsiebzig ist, wenn du mich fragst. Wenn sie dich also Walter taufen wollen, sollten sie demnach möglichst noch ein paar andere Namen davorsetzen, einen für die Kinderwagenzeit und dann noch einen für den weiten Weg des Walterwerdens. Sie könnten dich also vielleicht Robin Bartholomew Walter nennen, zum Beispiel. Ganz schön bescheuert, meiner Meinung nach, doch dann und wann wird es da und dort wohl auch zur Freude gereichen.
Also hab ich Nigel gegen Oliver eingetauscht, was schon immer mein zweiter Name war. Nigel Oliver Russell – da, ich sprech das ohn’ Erröten aus. Ich bin als Erstsemester nach York an die Uni gegangen und hieß Nigel, und als Oliver kam ich zurück. Was ist daran so verwunderlich? Es ist nicht seltsamer, als wenn man zum Militär geht und beim ersten Heimaturlaub mit Schnurrbart wiederkommt. Ein bloßer Initiationsritus. Aber aus irgendeinem Grund kommt der gute alte Stuart da nicht drüber weg.
Gillian ist ein guter Name. Er passt zu ihr. Er wird sich halten.
Und Oliver passt zu mir, findest du nicht auch? Er harmoniert recht gut mit meinem dunklen, dunklen Haar und meinen küssenswerten Elfenbeinzähnen, meiner schlanken Taille, meinem Aplomb und meinem Leinenanzug mit dem unverwüstlichen Pinot-Noir-Fleck. Er passt dazu, dass ich mein Konto überziehe und mich im Prado auskenne wie in meiner Anzugtasche. Er passt dazu, dass manche Leute mir am liebsten den Kopf einschlagen würden. Wie dieser absolute Neandertaler von Bankzweigstellenleiter, den ich am Ende meines ersten Uni-Semesters aufsuchte. Einer von der Sorte, der eine Erektion kriegt, wenn er hört, dass der Discontsatz ein zehntel Prozent gestiegen ist. Jedenfalls, dieser Neandertaler, dieser … Walter holte mich in seine holzgetäfelte Wichsbude von Büro, klassifizierte mein Gesuch auf Änderung des Namens auf meinen Schecks von N. O. Russell zu Oliver Russell als nicht von zentraler Bedeutung für die Politik der Bank in den 80er-Jahren und gab mir zu bedenken, dass ich, sollten nicht bald Mittel eingehen, das schwarze Loch meines Überziehungskredits zu tarnen, überhaupt kein neues Scheckheft bekäme, und nennte ich mich Sankt Nikolaus. Woraufhin ich mich mit einer effektvollen Simulation von Speichelleckertum in meinem Sessel wand, dann minutenlang matadormäßig tänzelnd Unmengen guten alten Charmes vor ihm versprühte, und ehe du noch fundador sagen konntest, lag Walter auf den Knien und bettelte um den coup de grâce. Also gestattete ich ihm die Ehre, meine Namensänderung zu beglaubigen.
Anscheinend sind mir alle Freunde, die mich mal Nigel nannten, abhandengekommen. Außer Stuart, natürlich. Du solltest Stuart mal dazu bringen, dass er dir von unserer gemeinsamen Schulzeit erzählt. Ich hab meinem Gedächtnis doch nie den Tort angetan, es diesen ganzen Routinekram speichern zu lassen. Stuart hat manchmal, bloß um etwas zu sagen, angefangen »Adams, Aitken, Apted, Bell, Bellamy …« (die Namen denk ich mir jetzt aus, du verstehst schon).
»Was ist denn das?«, hab ich dann gesagt. »Dein neues Mantra?«
Dann hat er verdutzt dreingeblickt. Vielleicht hat er gedacht, ein Mantra wär eine Automarke. Der Oldsmobile Mantra. »Nein«, hat er geantwortet. »Weißt du nicht mehr? Das war die 5A. Der alte Handkanten-Vokins war unser Klassenlehrer.«
Aber ich weiß es nicht mehr. Ich will es nicht mehr wissen. Erinnern ist ein Willensakt, Vergessen auch. Ich glaube, ich habe den Großteil meiner ersten achtzehn Jahre hinreichend gelöscht, zu harmlosem Babybrei püriert. Was könnte schlimmer sein, als von diesem ganzen Krempel verfolgt zu werden? Das erste Fahrrad, die ersten Tränen, der alte Teddy mit dem abgekauten Ohr. Das ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, es ist auch eine praktische Frage. Wenn man seine Vergangenheit allzu gut in Erinnerung hat, fängt man an, sie für die Gegenwart verantwortlich zu machen. Seht doch, was sie mir angetan haben, deshalb bin ich jetzt so, es ist nicht meine Schuld. Erlaube mir, dass ich dich korrigiere: Wahrscheinlich ist es eben doch deine Schuld. Und verschone mich freundlicherweise mit den Einzelheiten.
Es heißt, je älter man wird, desto besser erinnert man sich an seine ersten Jahre. Eine der vielen Panzerfallen, die da vor uns liegen: die Rache der Senilität. Habe ich dir übrigens schon meine Theorie über das Leben präsentiert? Das Leben ist wie die Invasion von Russland. Ein Blitzstart, massierte Tschakos, tanzende Federbüsche wie in einem aufgeschreckten Hühnerstall; eine Periode des graziösen Vorrückens, in überschwänglichen Depeschen festgehalten, derweil der Feind zurückweicht; dann der Beginn eines langen, moralunterminierenden Marsches mit immer kleiner werdenden Rationen und ersten Schneeflocken, die dir ins Gesicht wehen. Der Feind setzt Moskau in Brand, und du weichst zurück vor General Januar, der von Eiszapfen starrt bis in die Fingerspitzen. Bitterer Rückzug. Kosaken setzen dir von allen Seiten zu. Schließlich fällst du im Kartätschenfeuer eines Kanonenbubis bei der Überquerung eines polnischen Flusses, der noch nicht mal beim General auf der Karte eingezeichnet ist.
Ich möchte niemals alt werden. Verschon mich damit. Steht das in deiner Macht? Nein, das steht leider auch nicht in deiner Macht. Dann rauch doch noch eine. Na los. Ach, schon gut, wie du willst. Jeder nach seinem Geschmack.
2 Leih mir mal ’n Pfund
Stuart Irgendwie ist es ja erstaunlich, dass es den Edwardian noch gibt, aber ich bin ganz froh darüber. Es ist auch erstaunlich, dass es die Schule noch gibt, aber als sie alle Gymnasien in diesem Land gekillt und Gesamtschulen und Mittelstufenzentren und Oberstufenzentren daraus gemacht haben und alle mit allen anderen zusammengesteckt wurden, da wussten sie irgendwie nicht, mit wem sie St. Edward’s zusammenstecken könnten, und haben uns gewissermaßen in Ruhe gelassen. Also hat die Schule weiterbestanden, und das Altherren-Blatt auch. In den ersten Jahren nach meinem Abgang von der Schule habe ich es nicht groß beachtet, aber jetzt, wo ich schon, na, fünfzehn Jahre oder so raus bin, stelle ich bei mir ein ziemliches Interesse daran fest, was da so passiert. Man sieht einen vertrauten Namen, und der löst alle möglichen Erinnerungen aus. Aus den verschiedensten Ecken der Welt melden sich Alte Herren und berichten, was sie so treiben. Großer Gott, denkt man dann, ich hätte nie gedacht, dass Bailey mal das ganze Südostasiengeschäft unter sich haben würde, sagt man sich. Ich weiß noch, wie er gefragt wurde, was das wichtigste Anbauprodukt von Thailand sei, und er antwortete Transistorradios.
Oliver sagt, er kann sich aus der Schule an nichts mehr erinnern. Er sagt – wie heißt sein Spruch noch mal? –, er sagt, in diesen speziellen Brunnen kann er einen Stein fallen lassen und hört es nie platschen. Er gähnt immer viel und sagt betont gelangweilt Wer?, wenn ich ihm Neuigkeiten aus dem Edwardian weitergebe, aber ich glaube, es interessiert ihn schon. Nicht, dass er je mit eigenen Erinnerungen kommt. Vielleicht tut er bei anderen so, als wäre er auf eine feinere Schule gegangen – Eton oder so. Das würde ich ihm durchaus zutrauen. Ich bin immer der Meinung gewesen, man ist, was man ist, und man sollte nicht vorgeben, wer anderer zu sein. Aber Oliver hat mich immer zurechtgewiesen und erklärt, man sei der, der man zu sein vorgibt.
Wir sind ziemlich verschieden, Oliver und ich, wie Ihnen wohl schon aufgefallen ist. Manchmal staunen die Leute, dass wir Freunde sind. Sie sagen es nicht direkt, aber ich kann es spüren. Sie denken, ich hätte Glück, dass ich einen Freund wie Oliver habe. Oliver macht Eindruck auf die Leute. Er kann gut reden, er ist in ferne Lande gereist, er spricht Fremdsprachen, er ist kunstbewandert – mehr als bewandert –, und er zieht Sachen an, die sich seinen Körperkonturen nicht anpassen und daher von kundigen Menschen für modern erklärt werden. Was bei mir alles nicht so ist. Ich kann nicht immer sehr gut sagen, was ich meine, das heißt, außer bei der Arbeit; ich bin in Europa gewesen und in den Staaten, aber nie in Ninive und im Fernen Ophir; ich hab – buchstäblich – nicht viel Zeit für die Künste, obwohl ich in keiner Weise was gegen sie habe, verstehen Sie (manchmal gibt es im Autoradio ein schönes Konzert; wie die meisten lese ich ein, zwei Bücher im Urlaub); und über meine Kleidung mache ich mir nicht groß Gedanken, Hauptsache, ich sehe gepflegt aus bei der Arbeit und habe es bequem, wenn ich nach Hause komme. Aber ich glaube, Oliver mag mich, weil ich so bin, wie ich bin. Und da hätte es ja nicht viel Sinn, wenn ich ihn plötzlich nachäffen wollte. Ach ja, es gibt noch einen Unterschied zwischen uns: Ich habe ein ordentliches Vermögen, und Oliver hat so gut wie gar nichts. Jedenfalls nichts, was Leute, die was von Geld verstehen, Geld nennen würden.
»Leih mir mal ’n Pfund.«
Das war das Erste, was er je zu mir gesagt hat. Wir saßen in der Klasse nebeneinander. Wir waren fünfzehn. Wir waren schon zwei Halbjahre in derselben Klasse gewesen, ohne richtig miteinander zu reden, weil wir unterschiedliche Freunde hatten und man in St. Edward’s sowieso nach den Prüfungsergebnissen vom Ende des letzten Halbjahres gesetzt wurde, von daher war es nicht wahrscheinlich, dass wir nahe beieinandersitzen würden. Aber ich muss im vorhergehenden Halbjahr gut abgeschnitten haben, oder vielleicht hatte er getrödelt, oder beides, denn da waren wir nun zusammen, und Nigel, wie er sich damals nannte, bat mich um ein Pfund.
»Wofür willst du das?«
»Was für eine kolossale Unverschämtheit. Wofür in aller Welt willst du das wissen?«
»Ein kluger Finanzmanager würde nie einen Kredit einräumen, ohne zunächst dessen Zweck in Erfahrung zu bringen«, erwiderte ich. Dies schien mir eine absolut vernünftige Feststellung zu sein, aber aus irgendeinem Grund brachte sie Nigel zum Lachen. Handkanten-Vokins schaute von seinem Pult auf – dies sollte eine persönliche Beschäftigungsstunde sein – und bedachte uns mit einem fragenden Blick. Mehr als fragend, genau genommen. Was Nigel nur noch mehr zum Lachen brachte, und es dauerte eine ganze Weile, bis er zu einer Erklärung ansetzen konnte.
»Entschuldigung, Sir«, sagte er endlich. »Es tut mir wirklich leid. Aber Victor Hugo kann bisweilen so furchtbar amüsant sein.« Dann fing er vor lauter Lachen zu brüllen an. Ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen.
Nach der Stunde erklärte er mir, er wolle sich ein wirklich gutes Hemd kaufen, das er irgendwo gesehen habe, und ich erkundigte mich nach dem Wiederverkaufswert des Artikels im Hinblick auf die Deckung meiner Außenstände im Falle der Zahlungsunfähigkeit, was ihn noch mehr amüsierte; und dann teilte ich ihm meine Bedingungen mit. Fünf Prozent einfache Zinsen pro Woche auf den Darlehensbetrag, rückzahlbar innerhalb von vier Wochen, andernfalls Erhöhung des Zinssatzes auf zehn Prozent wöchentlich. Er nannte mich einen Wucherer, womit ich dieses Wort zum ersten Male hörte, zahlte mir nach vier Wochen £ 1.20 zurück, protzte an den Wochenenden mit seinem neuen Hemd herum, und seither waren wir Freunde. Freunde: Wir hatten das einfach beschlossen, und damit basta. In dem Alter diskutiert man nicht, ob man Freundschaft schließen will oder nicht, man tut es einfach. Es ist ein irreversibler Prozess. Manche Leute wunderten sich, und ich weiß noch, dass wir das auch ein bisschen ausgespielt haben: Nigel gab vor, mich zu bevormunden, und ich gab vor, ich sei nicht clever genug, das zu merken; und er tat großspuriger, als er in Wirklichkeit war, und ich tat noch langweiliger; aber wir wussten, was wir taten, und wir waren Freunde.
Wir blieben Freunde, obwohl er auf die Uni ging und ich nicht, obwohl er fortging nach Ninive und ins Ferne Ophir und ich nicht, obwohl ich zur Bank ging und einen festen Arbeitsplatz hatte, während er von einem Aushilfsjob zum nächsten flatterte und schließlich in einer Seitenstraße der Edgware Road landete und Englisch als Fremdsprache unterrichtete. Das Ding nennt sich Shakespeare School of English und hat eine Union-Jack-Leuchtreklame außen dran, die ständig an- und ausgeht. Er sagt, er hätte den Job nur angenommen, weil ihn die Leuchtreklame immer fröhlich stimmt; aber Tatsache ist, dass er das Geld wirklich braucht.
Und dann kam Gillian, und wir waren zu dritt.
Gill und ich waren uns einig, dass wir niemandem erzählen würden, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben immer gesagt, ein gewisser Jenkins aus dem Büro hätte mich nach Feierabend in die Weinbar um die Ecke mitgenommen, und dort hätten wir eine alte Freundin von ihm getroffen, und Gillian, die das Mädchen flüchtig kannte, wäre mit ihr da gewesen, und wir hätten uns irgendwie sofort verstanden und uns wieder verabredet.
»Jenkins?«, sagte Oliver, als ich ihm diese Geschichte einigermaßen stockend erzählte, obwohl ich glaube, meine Nervosität kam daher, dass ich von Gillian sprach. »Ist das der aus der Arbitrage?« Oliver tut gern so, als verstünde er, was ich mache, und schmeißt ab und zu mal so ein Wort in die Diskussion, damit er sich kompetent anhört. Heutzutage ignoriere ich das meistens.
»Nein«, sagte ich. »Er war neu. Na ja, jetzt ist er alt. Er hat sich nicht lange gehalten. War dem Job nicht gewachsen.« Das stimmte. Ich hatte Jenkins ausgesucht, weil der unlängst gefeuert worden war und ihm wohl keiner über den Weg laufen würde.
»Na ja, wenigstens hat er dir eine tranche de bonheur zugeschustert, während er da war.«
»Eine Trongschdewas?«, fragte ich, den Dummen Stu spielend. Er lächelte sein Lächeln, den Kultivierten Ollie spielend.
Tatsache ist, es ist mir nie sehr leichtgefallen, Leute kennenzulernen. Manchen fällt das von Natur aus leicht, und anderen nicht. Ich stamme nicht aus so einer riesigen Familie, wo es haufenweise Cousins gibt und ständig alle möglichen Leute »reinschauen«. Bei unserer Familie hat die ganze Zeit, wo ich zu Hause wohnte, nie jemand »reingeschaut«. Meine Eltern sind gestorben, als ich zwanzig war, meine Schwester ist nach Lancashire gezogen und Krankenschwester geworden und hat geheiratet, und damit war die Familie weg.
Da war ich nun also, wohnte alleine in einer kleinen Wohnung in Stoke Newington, ging zur Arbeit, blieb manchmal bis spätabends, wurde einsam. Ich bin nicht das, was man einen geselligen Typ nennt. Wenn ich Leute kennenlerne, die ich mag, da sage ich nicht etwa mehr und zeige, dass ich sie mag, und stelle Fragen, sondern mache sozusagen die Schotten dicht, als könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass sie mich mögen, oder als wäre ich nicht interessant genug für sie. Und dann, was Wunder, finden sie mich auch nicht interessant genug für sie. Und wenn es dann das nächste Mal passiert, fällt mir das wieder ein, doch statt jetzt den Entschluss zu fassen, es besser zu machen, erstarre ich erst recht. Anscheinend hat die halbe Welt Selbstvertrauen und die andere halbe Welt nicht, und ich weiß nicht, wie man den Sprung von der einen Hälfte zur anderen schafft. Um Selbstvertrauen zu haben, muss man sich vorher schon etwas zutrauen; es ist ein Teufelskreis.
Die Anzeige war überschrieben JUNG UND ERFOLGREICH? 25–35? ZU VIEL ARBEIT, UND DIE GESELLIGKEIT BLEIBT AUF DER STRECKE? Ganz gut gemacht, diese Anzeige. Es hörte sich nicht an wie so ein Aufreißschuppen, wo sie dann alle zusammen Oben-ohne-Ferien machen; es erweckte auch nicht den Eindruck, als sei man selbst schuld an der fehlenden Geselligkeit. Es war einfach was, das auch den nettesten Leuten mal passiert, und das ging man vernünftigerweise so an, indem man £ 25 bezahlte und sich auf ein Glas Sherry in einem Londoner Hotel einfand mit dem indirekten Versprechen, nicht gedemütigt zu werden, wenn es nicht klappte.
Ich dachte, sie geben uns vielleicht Anstecker mit unserem Namen drauf, wie bei einer Konferenz; aber vermutlich haben sie gedacht, das sähe so aus, als wären wir nicht mal in der Lage, den eigenen Namen über die Lippen zu bringen. Da war so eine Art Gastgeber, der den Sherry ausschenkte und jeden Neuankömmling zu den einzelnen Gruppen führte; doch da wir ziemlich viele waren, konnte er sich nicht alle unsere Namen merken, sodass wir gezwungen waren, sie zu sagen. Oder vielleicht hat er sich manche Namen absichtlich nicht merken können.
Ich sprach gerade mit einem Mann, der stotterte und eine Ausbildung zum Immobilienmakler machte, als Gillian von dem Veranstalter angebracht wurde. Irgendwie gab mir die Tatsache, dass dieser Typ stotterte, mehr Selbstvertrauen. Es ist herzlos, so etwas zu sagen, aber es ist mir in der Vergangenheit oft genug selbst passiert: Man hört sich selbst ganz gewöhnliches Zeug daherreden, und plötzlich wird der Mensch neben einem geistreich. O ja, das ist mir oft genug so gegangen. Es ist so eine Art primitive Überlebensregel – such dir jemand, die noch schlechter dran sind als du, und neben denen blühst du auf.
Na ja, »aufblühen« ist vielleicht übertrieben, aber ich hab Gillian den einen oder anderen von Olivers Witzen erzählt, und wir haben über das mulmige Gefühl geredet, mit dem man in die Gruppe kommt, und dann stellte sich heraus, dass sie Halbfranzösin war, und dazu konnte ich etwas sagen, und der Immobilienmakler versuchte, Deutschland ins Spiel zu bringen, aber darauf ließen wir uns überhaupt nicht ein, und ehe ich noch wusste, wie mir geschah, hatte ich so halb den Rücken gedreht, um den anderen Typ auszuschließen, und sagte: »Hören Sie, ich weiß, Sie sind eigentlich gerade eben erst gekommen, aber würden Sie vielleicht einen Happen zu Abend essen wollen? Oder vielleicht ein andermal, wenn Sie schon was vorhaben?« Ich staunte über mich selbst, das kann ich Ihnen sagen.
»Meinen Sie, wir dürfen so früh schon gehen?«
»Warum denn nicht?«
»Sollten wir nicht erst einmal alle kennenlernen?«
»Das ist nicht obligatorisch.«
»Also gut.«
Sie lächelte mich an und blickte nach unten. Sie war schüchtern, und das gefiel mir. Wir gingen essen in einem italienischen Restaurant. Drei Wochen später kam Oliver von irgendeinem exotischen Aufenthalt zurück, und wir waren zu dritt. Den ganzen Sommer lang. Zu dritt. Es war wie in diesem französischen Film, wo sie alle zusammen Rad fahren.
Gillian Ich war nicht schüchtern. Ich war nervös, aber schüchtern war ich nicht. Das ist ein Unterschied. Der Schüchterne war Stuart. Das war von Anfang an sonnenklar. Wie er da mit seinem Sherryglas rumstand, etwas an den Schläfen schwitzend, offensichtlich nicht in seinem Element, und sich qualvoll Mühe gab, das zu überwinden. Allerdings fühlte sich da natürlich niemand in seinem oder ihrem Element. Damals dachte ich, das ist ein bisschen so wie ein Menschenmarkt, und darauf sind wir nicht trainiert, nicht in unserer Gesellschaft.
Stuart fing also damit an, dass er ein paar Witze erzählte, die ziemlich danebengingen, weil er so aufgeregt war, und ich glaube, die Witze haben sowieso nicht sehr viel getaugt. Dann kam die Rede auf Frankreich, und er redete irgendetwas Gewöhnliches daher, wie dass man es immer merkt, wenn man da ist, weil es so anders riecht, und dass man es selbst mit verbundenen Augen merken würde. Aber das Entscheidende war, dass er sich Mühe gab, mit sich selbst genau wie mit mir, und das ist doch rührend. Das ist wahrhaftig rührend.
Ich wüsste gern, was aus dem stotternden Mann geworden ist, der über Deutschland reden wollte. Ich hoffe, er hat jemand gefunden.
Ich wüsste gern, was aus Jenkins geworden ist.
Oliver Sag nichts. Lass mich raten. Lass mich auf telepathischem Wege die gutartige, zerknautschte und etwas steatopyge Gestalt meines Freundes Stu anvisieren. Steatopyg? Bedeutet, dass sein Hintern raussteht: ein derrière à la Hottentotte.
Jules et Jim? Stimmt’s? Ich glaube, ich weiß Bescheid. Er hat ihn einmal erwähnt, aber nur mir gegenüber, Gillian nie. Jules et Jim. Oskar Werner, der kleine, blonde und – darf man’s sagen – sehr wahrscheinlich steatopyge Part, Jeanne Moreau, und dann der große, dunkle, elegante Gutaussehende, der bestimmt küssenswerte Zähne hatte (wie hieß der noch gleich?). Tja, keine Probleme mit der Besetzung, das einzige Problem ist, die Handlung zusammenzukriegen. Sie fahren alle zusammen Rad und sausen über Brücken und blödeln rum, ja? Dacht ich’s doch. Aber wie dickerchentypisch von Stuart, sich ausgerechnet Jules et Jim – durchaus sympathisch, aber nicht gerade von zentraler Bedeutung für den Nachkriegsfilm – als kulturelle Analogie auszusuchen. Stuart, da sollte ich dich gleich vorwarnen, ist so ein Mensch, für den Mozarts KV 467 das Elvira-Madigan-Konzert ist. Bei klassischer Musik hat er es am liebsten, wenn er ein paar Streicher hört, die Vögel nachahmen, oder Uhren, oder eine kleine Tschuff-tschuff-Eisenbahn, die den Berg hochfährt. Ist das nicht goldig stillos?
Vielleicht hat er mal einen Kurs über den französischen Film mitgemacht, um zu lernen, wie man Mädchen aufgabelt. Das war nie sein forte, verstehst du. Ich bin ihm manchmal mit Verabredungen zu viert beigesprungen, aber die sind immer so ausgegangen, dass die beiden Mädchen sich um meine Wenigkeit kabbelten und Stuart irgendwo in der Ecke saß und schmollte und das ganze Charisma einer Napfschnecke an den Tag legte. Meine Güte, waren das funebre Angelegenheiten, und unser Stuart neigte leider dazu, hinterher die Schuld auf mich zu schieben.
»Du solltest mir mehr helfen«, beschwerte er sich einmal jämmerlich.
»Dir helfen? Dir helfen? Ich treibe die Mädchen auf, ich stelle sie dir vor, ich sorge dafür, dass der Abend einen parabolischen Aufschwung nimmt, und du sitzt nur da und starrst finster vor dich hin wie Hagen in der Götterdämmerung, falls du mir die kulturelle Anspielung verzeihst.«
»Manchmal meine ich, du lädst mich nur ein, damit ich die Rechnung zahlen kann.«
»Wenn ich mit den Börsenbullen das große Geld machen würde«, gab ich ihm zu bedenken, »und du wärst mein ältester Freund und arbeitslos und würdest zwei so Klassemädchen anschleppen, wäre es mir eine Ehre, die Rechnung zu zahlen.«
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich meine nur, du hättest ihnen nicht erzählen sollen, dass ich bei Frauen keinerlei Selbstvertrauen habe.«
»Ach, das wurmt dich also.« Jetzt fing ich an zu begreifen. »Der geniale Plan war, dass jeder sich auf seine Art wohlfühlt.«
»Ich glaube, du willst nicht, dass ich eine Freundin kriege«, schloss Stuart schmollend.
Ich war deshalb ziemlich überrascht, als er Gillian ausbaggerte. Wer hätte das gedacht? Damit nicht genug, wer hätte gedacht, dass er sie in einer Weinbar aufgelesen hat? Stell dir doch bitte mal die Szenerie vor: Gillian auf einem Barhocker mit einem bis zur Hüfte geschlitzten Satinrock, Stuart zupft nonchalant den schwellenden Krawattenknoten zurecht, während er auf seiner Computerarmbanduhr den aktuellen body-gebuildeten Gesundheitszustand des Yen ermittelt, ein Barmann, der ohne zu fragen weiß, dass Mr Hughes-Sir den fassgereiften 1918er Sercial in diesem besonderen Glas wünscht, das die Blume konzentriert, Stuart gleitet auf den nächsten Hocker und verströmt lässig den subtilen Moschus seiner Sexualität, Gillian bittet um Feuer, Stuart lässt das perlmutterne Dunhill aus der Tasche seines legeren Armani-Anzugs gleiten …
Ich bitte dich, ich meine, ich bitte dich. Bleiben wir doch ein bisschen bei der Realität. Ich hab mir den Bericht bis in alle raunenden und bebenden Einzelheiten angehört, und er war ehrlich gesagt nicht mehr und nicht weniger unerquicklich, als zu erwarten stand. Irgendein Schneckenhirn aus der Bank, der es in der Woche darauf fertigbrachte, sich feuern zu lassen (und man muss wirklich ein Schneckenhirn sein, um da entlassen zu werden), ging eines Abends mit Stu auf einen Feierabendschluck in die Squires Wine Bar. Ich hab mir den Namen von Stuart mehrfach wiederholen lassen: Squires Wine Bar.
»Soll das nun heißen«, begann ich das Kreuzverhör, »dass es sich hier um ein Etablissement handelt, dessen Eigner sich für einen Squire hält; oder vielmehr um eine Örtlichkeit, die Squires wie du und deinesgleichen aufsuchen, wenn sie zu zechen begehren?«
Darüber musste Stuart ein Weilchen nachdenken. »Ich kann dir nicht folgen.«
»Dann betrachte es mal so. Wo kommt das Apostroph hin?«
»Das Apostroph?«
»Heißt es e Apostroph s, oder s Apostroph? Das ist ein merklicher Unterschied.«
»Ich weiß es nicht. Ich glaub, da ist gar keins.«
»Es muss eins da sein, wenn auch nur unterschwellig.« Wir haben uns ein paar Sekunden lang angestarrt. Ich glaube, Stuart hat überhaupt nicht begriffen, was ich damit sagen wollte. Er hat geguckt, als meinte er, ich wollte seine Neuinszenierung von Paul et Virginie absichtlich sabotieren. »Entschuldigung. Bitte, fahr doch fort.«
Da waren sie also, Herr Schneckenkopf und Stu, ließen in Squire’s oder Squires’ Wine Bar, je nachdem, den großen Lord raushängen, und wer mag da hereinkömmen denn eine vieille flamme
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: