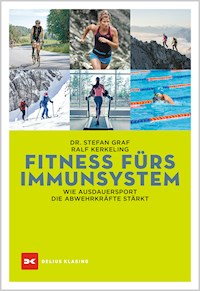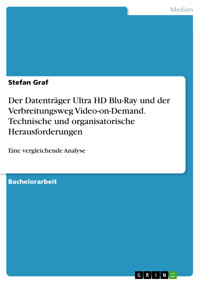14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ist die fest etablierte Evolutionstheorie Charles Darwins ein kapitaler Irrtum? Fußt sein Abstammungsmodell auf wissenschaftlich nicht mehr haltbaren Fehleinschätzungen? War Darwin selbst ein populistischer Blender, mit dem einzigen Ziel, den eigenen Wohlstand zu wahren? Diese Vorwürfe erheben Darwins Kritiker: Eine Unzahl von Zufällen im Zusammenspiel mit einem auf Mord- und Totschlag basierenden Überlebenskampf hätte doch niemals eine so stabile Koexistenz der heutigen Vielfalt an Lebensformen hervorbringen können, meinen sie. Zudem habe Darwins Lehre den Gräueltaten der Rassenhygiene der Nazis den Weg bereitet. Es gelte ein Darwin-Komplott zu sprengen - geschmiedet von Wissenschaftskapazitäten, die wider besseren Wissens an einem völlig überholten Modell festhalten. Stefan Graf geht den Einwänden dieser Antidarwinisten unvoreingenommen, spannend und humorvoll auf den Grund.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Stefan Graf
Darwin im Faktencheck
Stefan Graf
Darwin im Faktencheck
Moderne Evolutionskritik auf dem Prüfstand
Stefan GrafDarwin im FaktencheckModerne Evolutionskritik auf dem Prüfstand© Tectum Verlag Marburg, 2013(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3152-0 im Tectum Verlag erschienen.)eISBN 978-3-8288-5669-1Mobi ISBN 978-3-8288-5670-7
Umschlagabbildung: shutterstock.com, Marcio Jose Bastos SilvaUmschlaggestaltung: Jens Vogelsang | vogelsangdesign.deSatz und Layout: Ina Beneke | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
„Alles, was im Weltall existiert,ist die Frucht von Zufall und Notwendigkeit.“ (Demokrit)
„Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.“ (Leonardo da Vinci)
Darwins „Tochter“ ist zu beträchtlicher Größe herangewachsen.
Inhalt
Anmerkungen
Darwinist/Darwinismus
Vorwort
Darwin im Faktencheck
Moderne Evolutionskritik auf dem Prüfstand
Kreationismus – kein Platz für Argumente
Lücken in der Evolutionstheorie? – Ein aktueller Angriffspunkt
Darwin – ein Leben für die Naturwissenschaft
Darwins Weltreise – zentrale Anstöße zur Entwicklung der Evolutionstheorie
Entwicklung einer Theorie
Publikation mit Verzögerung – Wallace sei Dank!
Teil I: Die Anti-Darwin-Komplotteure
Schweres Geschütz - droht ein Weltbild zu zerplatzen?
Wie alles begann – Leben aus dem Nichts?
Adaptive Entwicklung – warum?
Der blinde Zufall – das missverstandene Reizthema Nr. 1
Höherentwicklung – was ist das?
Übergangsformen als Belege der Makroevolution – Wunschdenken oder Realität?
Übergangsformen als Vertreter schnellen evolutionären Wandels
Das Problem mit der Ordnung – „Ball paradox“?
Vom Gen zum Phän – aber wie?
98% identische DNA - warum ist Cheetah kein Mensch?
Konstruktion ohne Bauplan?
Nur ein verkappter Schöpfungsmythos?
Neodarwinismus oder der Lamarckist in Darwin
Von der Macht hilfloser Gene
Hohe Erwartungen an die Epigenetik
Fitness, Konkurrenz und Krieg
Und immer wieder die Giraffe
Natürliche versus sexuelle Evolution?
Lebende Fossilien – Selektion außer Kraft?
Seidenspinner im roten Meer?
Artbildung live! – Zuschauer unerwünscht?
Verstaubter Darwinismus: ein Modell für Zurückgebliebene?
Selektion als Kriegstreiber? Mit Darwin kein Naturidyll?
Göttliche Gewalt und Bibelhorror
Kindstötung und Kannibalismus - Mord im Tierreich?
Die ominöse „höhere Ordnung“ oder die Suche nach dem „wahren Gott“
Des Starken Spiel ist des Schwachen Tod – wirklich kein Platz für Schwächere?
Problemkind „Homo“
Was ist Wissenschaft?
Rhetorisches Geplänkel
Streiten um des Kaisers Bart – Wie gut, dass Darwin englisch schrieb
Geistige Mittäterschaft – auch Malthus war schuld
Ein barfüßiger Schuster?
Darwin’sche Erfolgsgeheimnisse – wie die Kritiker es sehen
Magischer Zeitgeist
Die Kunst, ein Populist zu sein
Der berühmte Tropfen zuviel
Bedeutungswandel
Faule Konzilianz
Sensible Grenzverletzung
Maus bleibt Maus – wirklich?
Vollkommen unvollkommen
Perfektionismus Fehlanzeige
Selektion ist relativ oder: Wie gut ist gut genug?
Elitäres Optimum – Fitness nicht für alle?
Survival of the survivors: Fitness ist nichts für Hellseher
Lamarck’sche Störungen oder die Sache mit der Anpassung
Alles auf null – eine Welt ohne Menschen oder: der Präadaptationsirrtum
Do it yourself – gestalten statt anpassen?
Zahlenlotto oder: das Spiel mit dem Zufall
Selektion – Himmelfahrtskommando oder unbestechlicher Bewertungsfilter?
Was du meinst, entscheiden wir!
Wald? - Ich sehe nur Bäume! Evolution? - Ich sehe nur Entwicklung!
Auf verschlungenen Pfaden: Nicht Existentes funktioniert anders!
Arterhaltung und Artwandel – paradoxes Tauziehen oder logische Konsequenz?
Das Ende der biologischen Rassentrennung – menschliche Realität
Materialistische Gene – kein Platz für soziales Verhalten?
Die Kunst, ein Egoist zu sein
Aber wo bleibt die Selektion …?
Ein allzu kruder Darwinismus – warum Rohheit nicht siegt
Auf einem Auge blind?
Getarnter Gott statt Laisser-faire – ein wahrer Circulus vitiosus
Oder liegt’s am Da … – Dawkins egoistische Gene
Konkurrierende Kooperation oder kooperierende Konkurrenz
Sorgenkind „Homo sapiens“
Science und Fiktion – Neugier und Ängste
Selbstfindung
Homo Scientificus – warum wir die schlechtesten Wissenschaftler sind
Der Blick in den Spiegel – haben wir wirklich nichts gelernt?
Was heißt hier sozial?
Wie wird es weitergehen – evolutionäre Eintracht oder Kontraproduktivität?
Der Mensch – ein überschätztes Wesen?
Mitgefangen, mitgehangen!
Nur Vergangenes ist gewiss – warum Mark Twain recht hat
Mut zur Lücke – kein Platz für Größenwahn
Das Prinzip Ordnung und die Grenzen der Erkenntnis
Grenzziehung
In aller Bescheidenheit
Das Problem der Einmaligkeit
Die Komplexitätsgrenze
Von Dichtern und Denkern, Theoretikern und Machern
Die Grenz-Bilanz
Doch noch eine Alternative?
Und wenn der Zufall das Göttliche wäre?
Teleologie versus Planlosigkeit
Dem Meister auf dem Mund geschaut
Schmückendes Beiwerk – schön aber nutzlos?
Teil II: Attacke der „Synchronisten“
Deine Spuren im Sand
Eine große Gemeinde
Junge Dinosaurier oder alte Menschen
Edles Werkzeug – „man-made“ oder außerirdisch?
Massengräber und Evolution – passt das zusammen?
Sintflut und Schöpfung – wann, wo und durch wen?
Ablauf der Sintflut
Mit dem Dunkel kam die Kälte und auch der Zyklop?
Der anämische Mensch im Wirrwarr der Synchronisten?
Evolution versus Schöpfung
Wir sind nicht nur von dieser Welt
Wer brachte das hoch entwickelte Leben auf die Erde?
Synchronisten zwischen Komplotteuren und Kreationisten
Widerspruch erlaubt – aber begründet, bitte!
Audiatur et altera pars – Hinterfragung erwünscht
Kritik konstruktiv – wirkliche Lücken im System
Keine Wissenschaft ohne Glauben
Kompromissbereitschaft
Finale: keine akute Gefahr, aber es bleibt spannend
Schuster, bleib bei deinen Leisten!
Ein Komplott – warum?
Für und Wider
Epilog
Die (nicht bös gemeinte) Prognose
Danksagung
Der Autor
Literatur<
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
(Lat. für: Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.)
Meinem Bruder Gert.
Leider aus den Augen,
aber niemals aus dem Sinn.
Danke für alles.
1. Anmerkungen
Darwinist/Darwinismus
Der Begriff „Darwinismus“ ist insbesondere durch den sog. Sozialdarwinismus – vereinfacht gesagt das „Recht des Stärkeren in der Ellenbogengesellschaft“ – heute bisweilen mit einem negativen Beigeschmack behaftet. Zudem assoziiert man mit allen „Ismen“ oftmals etwas dogmatisch Verpflichtendes. In diesem Buch wird „Darwinismus“ ausschließlich in der wertneutralen und ursprünglich rein wissenschaftlichen Bedeutung verstanden. Der von dem britischen Biologen Thomas Henry Huxley 1860 im Rahmen einer Buchbesprechung von Darwins „On the origin of species ...“ geprägte Begriff dient im Rahmen des vorliegenden Buches der Unterscheidung zwischen Befürwortern (Darwinisten) und Anfechtern (Anti-Darwinisten) der naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie – ohne die oben erwähnte sozial entfremdete Komponente in der menschlichen Gesellschaft. Darwinismus steht somit einzig für das Bekenntnis zu den von Darwin formulierten und durch moderne Forschung erweiterten Gesetzmäßigkeiten des Formenwandels in der Natur – ohne jegliche wertende oder dogmatisierende Absichten.
Wenn auf den folgenden Seiten gelegentlich eine direkte Ansprache an Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, gestellt ist, wurde aus Gründen eines ästhetischen Schriftbildes auf die unschönen Kombinationen „Leser/in“ bzw. „Leser/innen“ sowie „man/frau“ verzichtet. Es wurde hier auf die konservative männliche Variante zurückgegriffen, doch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Damen hier herzlichst mit eingeschlossen sind. Frauen haben zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte Hervorragendes geleistet – in allen Lebensbereichen einschließlich der Naturwissenschaft. Dies findet die höchste Anerkennung des Autors. Die männliche Wortwahl hat ausschließlich schriftbildbedingte Gründe und keinerlei diskriminierenden Hintergrund. Den Damen sei ausdrücklich für ihr Verständnis gedankt.
Der Autor
2. Vorwort
Der französische Biochemiker Jaques Lucien Monod (1910–1976), Nobelpreisträger und durch seinen Bestseller „Zufall und Notwendigkeit“ als einer der kompetentesten Befürworter der Evolutionstheorie bekannt geworden, sagte einmal sinngemäß: „Ein großes Problem des Darwinismus besteht darin, dass jeder ihn zu verstehen meint.“ Das Verzwickte ist seine scheinbare Einfachheit. Variation, Auslese und über allem thronend „der Zufall“ – hiermit glauben viele Darwins Lebenswerk genügend charakterisiert. Bei keiner anderen heute allgemein akzeptierten Wissenschaftstheorie scheint eine derart prägnante Vereinfachung möglich. Warum? – Weil die meisten von uns die komplizierten mathematischen Artefakte, die viele andere Modelle kennzeichnen, nicht einmal ansatzweise verstehen. In der Folge brauchen sich diese Theorien keiner nur annähernd so heftigen Kritik zu erwehren, wie es der Darwinismus leisten muss. Ganz im Gegenteil – in Respekt vor dem Intellekt der Begründer förmlich erstarrend, wagt kaum jemand, derartige Modelle zum Ziel seiner wissenschaftlichen Angriffslust zu machen. Zu groß scheint hier die Gefahr der Blamage, zum bestenfalls mit laienhaftem Halbwissen ausgestatteten „Nörgler“ degradiert zu werden. Seien wir doch einmal ehrlich – wer von uns versteht wirklich en détail, was Albert Einstein in seiner Theorie der allgemeinen und speziellen Relativität zum Ausdruck bringt? Wer kann erklären, warum Isaac Newtons Apfel auf den Boden fiel – warum sich Massen anziehen? Um sich nicht dem Risiko auszusetzen, in Erklärungsnöte zu geraten, die möglicherweise zu Zweifeln an der eigenen intellektuellen Potenz führen könnten, wendet man sich lieber dem als einfach Erachteten zu. In der Evolutionstheorie glauben viele das „Freiwild“ gefunden zu haben, das bei all seiner scheinbar so leichten Verständlichkeit jede Menge Angriffsfläche bietet und zudem über ausreichend schlagzeilenträchtige Prominenz verfügt, um die eigene Profilierungssucht zu befriedigen.
Wenn Evolution aber wirklich ein so simpler Mechanismus ist, warum musste es dann einige Jahrtausende dauern, bis zwei Engländer – Charles Robert Darwin und Alfred Russel Wallace – sich entschlossen, den Rest der Welt darüber zu informieren? Kluge Köpfe gab es schließlich zu allen Zeiten menschlichen Daseins, und die Idee der Veränderlichkeit der Arten wurde schon in der Antike geboren. Eine mechanistische Erklärung aber konnten erst die beiden viktorianischen Naturforscher liefern. Offensichtlich bedarf das Verständnis des Evolutionsprozesses doch etwas umfangreicherer Hintergrundkenntnisse, als es gerade in der so oft missverstandenen und dadurch zur Zielscheibe einer Kritiklawine gewordenen „Zufallskomponente“ zum Ausdruck kommt.
Warum aber ist der Darwinismus für den Menschen weit schwerer zu verstehen, als es bei oberflächlicher Betrachtung scheint? Die Antwort liegt in unserer alltäglichen Lebenserfahrung. Jegliche Komplexität oder besser noch vielschichtige Funktionalität, die uns während unseres irdischen Daseins begegnet, ist ein Produkt zweckgebundener Vorausplanung und auf ein konkretes Ziel hin ausgerichteter Fertigung. Vom Wasserkocher bis zur Armbanduhr, vom Fahrrad bis zum Jumbojet oder vom Abakus zum Hochleistungscomputer. Alles, was in unserem Alltag ein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken verschiedener Komponenten offenbart, wurde durch geplante Konstruktion intelligenter Wesen geschaffen. Die Erfahrung, dass geniale Komplexität ohne Plan und gezielt arbeitenden Konstrukteur entsteht, ist in unseren Gehirnen nicht gespeichert. Es fehlen uns entsprechende Lebenssituationen. Daher ist es für uns nicht vorstellbar, dass der Gipfel der Komplexität – ein lebender Organismus – allein aus dem Wechselspiel von Zufall (Mutation) und Auslese (Selektion) entstehen konnte. Das große Verdienst von Darwin und Wallace liegt in der Erkenntnis, dass Komplexität und intelligentes Design nicht zwingend miteinander verbandelt sind.
Das vorliegende Buch versucht eine unvoreingenommene Beurteilung der von heutigen Darwinkritikern vorgebrachten Argumente vor dem Hintergrund der das Evolutionsmodell stützenden Faktoren. Es soll über einige entscheidende Fehlinterpretationen und Missverständnisse aufklären, die zum Anlass einer Gegenbewegung wurden, die gegenwärtig durch die entscheidend verfeinerten Methoden der molekularen Naturwissenschaften neue Nahrung zu erhalten glaubt. Tatsächlich aber offenbaren die Hauptargumente dieser Darwingegner fundamentale Lücken und Irrtümer in der Kenntnis der Darwin’schen Postulate.
Als Autor kann und möchte ich nicht verhehlen, dass ich ein überzeugter Befürworter der Evolutionstheorie bin, dem nach eigener Auffassung am besten belegten Wissenschaftsmodell überhaupt. Dies mag die Gefahr einer allzu subjektiven Sicht und Vorverurteilung der Darwinkritiker bergen. Ich kann darauf nur erwidern, dass ich schon deshalb um eine neutrale Diskussion bemüht bin, um die gezogenen Schlussfolgerungen und Ergebnisse jeglichen Makels der Parteilichkeit und Voreingenommenheit zu berauben. Ich werde quasi die durchaus gewagte Aufgabe einer Doppelfunktion übernehmen, also auch den „Advocatus Diaboli“ für die Anti-Darwinisten spielen. Ein kritisches Hinterfragen aller Argumente beider Seiten, ein neutrales Abwägen des Für und Wider ist somit oberstes Gebot. Den Abschluss bildet die persönliche Prognose, welcher weitere „Karriereverlauf“ dem Darwin’schen Erbe wohl beschienen sein wird.
Dass Sie, verehrte Leserinnen und Leser, bei aller Neutralität eine durchaus emotional geführte Diskussion erwartet, ist vollauf beabsichtigt. Lauert doch gerade im Wissenschaftsbereich bei allzu nüchterner Schreibweise stets die Gefahr der Langatmigkeit und des Verzettelns in Haarspaltereien. Davor braucht sich bei der nachfolgenden Lektüre niemand zu fürchten. Ein insgesamt lockerer Schreibstil – bewusst mit sachlichem Humor gewürzt – möge jedem interessierten Leser kurzweilige Einblicke in die entwicklungsbiologische Gedankenwelt liefern. Es ist kein Fachbuch für hochgraduierte Evolutionsbiologen, sondern populärwissenschaftliche Lektüre für jedermann.
Dr. Stefan Graf, im Mai 2013
3. Darwin im Faktencheck
Moderne Evolutionskritik auf dem Prüfstand
Als der englische Naturforscher Charles Robert Darwin mit dem legendären Werk „On the origin of species by means of natural selection“ („Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“) im Jahre 1859 seine auf umfassenden Studien beruhende Evolutionstheorie veröffentlichte, sah er sich mit erheblicher Kritik aus verschiedensten wissenschaftlichen und kirchlichen Kreisen konfrontiert. Besondere Reizpunkte waren dabei:
• die postulierte Veränderlichkeit aller Lebensformen ohne direkten göttlichen Eingriff,
• die evolutive Abstammung hoch entwickelter, nach damals fest verankerter Ansicht einzig von Gott erschaffbarer Lebewesen von einfachen Daseinsformen,
• die nicht prädestinierte Eingliederung des Menschen – der „Krone der Schöpfung“ – in das Abstammungssystem und damit seine prinzipielle biologische Gleichwertigkeit mit der Tier- und Pflanzenwelt.
Gerade die oft missverstandene Vorstellung eines genealogischen Zusammenhanges zwischen Mensch und affenartigen Vorfahren pikierte Wissenschaft und Kirche zu Darwins Zeit gleichermaßen. Nichtsdestoweniger sollte die Abstammungslehre mit der Fortentwicklung biologischer und biochemischer Arbeitsmethoden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch eine Vielzahl von Versuchsergebnissen, Beobachtungen und archäologischen Funden Unterstützung erhalten, die sie zu einer der am besten untermauerten Wissenschaftsmodelle überhaupt reifen ließ. Heute liefern praktisch alle naturwissenschaftlichen Disziplinen von der klassischen und molekularen Biologie über Physik, Astronomie, Chemie, Geologie, Paläontologie und Archäologie starke Argumente für den Ablauf einer biologischen Evolution nach den Grundzügen des von Charles Darwin begründeten Abstammungsprinzips.
Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass die anfängliche Gegenbewegung im Laufe des 20. Jahrhunderts stark an Gewicht verlor – abgesehen von der vollauf berechtigten Entrüstung über die verlogene Fehlauslegung Darwin’scher Thesen zum Zwecke des verbrecherischen Machtmissbrauchs in der schlimmsten Zeit deutscher Geschichte. Aber das beängstigende Gefühl, das uns bei der Nennung von Begriffen wie Rassenhygiene und Eugenik befällt, dürfen wir keinesfalls in irgendeiner Weise mit dem Wirken Darwins in Verbindung bringen. Das wäre im Prinzip so, als würde man einen Alfred Nobel, den Erfinder des Dynamits, für jeden unter Einsatz dieses Sprengstoffes ausgeführten Einbruch oder gar das Wirken von Selbstmordattentätern verantwortlich machen. Wobei all dies natürlich nicht mit den schrecklichen, in ihren Ausmaßen einzigartig mörderischen Verbrechen der Hitler-Zeit vergleichbar ist. Die Verantwortung dafür trägt einzig jenes zum Zwecke der Machterweiterung und Eigenrechtfertigung keine Grausamkeit scheuende Regime, deren leider immer wieder aufkeimende Triebe es ohne Wenn und Aber im Keime zu ersticken gilt.
Was den wirklichen, also im Sinne Darwins geprägten Evolutionsgedanken betrifft, lieferten zur Mitte des 20. Jahrhunderts die aufblühenden, sich ständig verfeinernden experimentellen Möglichkeiten entscheidende Ergebnisse. Spätestens seit den 1950er Jahren sollte sich die Evolutionstheorie, über vier Jahrzehnte hinweg kaum angefochten und ständig durch neue Fakten gestützt, als hoch anerkannte Naturtheorie etablieren. Einzig die auf einer allzu wörtlichen Bibelauslegung beharrende Kritik der sogenannten Kreationisten verstummte nie, fiel jedoch kaum ins Gewicht. Als zu erdrückend erwiesen sich all die Belege und Funde, die für eine Verwandtschaft aller Lebewesen im Darwin’schen Sinne sprechen.
Kreationismus – kein Platz für Argumente
Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht keineswegs darum, den Gottesglauben in irgendeiner Weise zu diskreditieren oder gar ins Lächerliche zu ziehen – ganz im Gegenteil. Aber die Theorie eines einmaligen Schöpfungsaktes aller rezenten und ausgestorbenen Lebensformen ist nicht mehr zu halten, wenn man sich den modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht völlig verschließt. Eine biologische Entwicklung von einfachen zu komplexen Formen ohne direkten göttlichen Eingriff zu negieren, bedeutet die Augen völlig vor der Natur und den Beobachtungen von Generationen zu verschließen. Das erfordert keinesfalls, die Existenz eines allmächtigen Gottes abzulehnen. Gerade das Funktionieren eines so beeindruckenden Wechselspiels zwischen zufälliger Varietätenproduktion und richtender Auslese macht die Existenz einer dahinter stehenden, wie auch immer gearteten (göttlichen?) Kraft sehr wahrscheinlich. Der Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth (1921–1989), Professor für Psychiatrie und Neurologie, hat in seinem 1981 erschienen Buch „Wir sind nicht nur von dieser Welt“ gezeigt, wie sich Evolution und Schöpfungsglaube widerspruchsfrei vereinen lassen, wenn nicht gar einander bedingen. Das nach unserem Zeitempfinden so endlos langsam vonstattengehende Evolutionsgeschehen sei demnach als Moment der Schöpfung zu begreifen.
Auch das vorliegende Buch wurde in der tiefen Überzeugung des Autors geschrieben, dass sich ein naturwissenschaftliches und ein religiöses Weltbild keinesfalls gegenseitig ausschließen. Gottesglauben und Darwinismus sind keine Gegensätze, sondern in Harmonie vereinbar. Aber das bedeutet keineswegs, glauben zu müssen, jeder Einzelschritt, der in der Natur zu Veränderung oder Entwicklung führt, sei einzig durch direkten göttlichen Eingriff erklärbar. Sich mit solcher Einstellung jeglicher wissenschaftlicher Diskussion von vornherein zu verschließen, bedeutet letztlich, dem Gottesbild ein dogmatisches, verzerrendes Attribut zu verleihen, das es gerade auch im Darwin’schen Sinne nicht verdient hat. Es geht hier um die Theodizee, also die Antwort auf die Frage, wie ein gütiger Gott all die Leiden in der Welt zulassen kann. Wer seinen Gott in die Rolle des jede Bewegung, jede Veränderung und jede Neuerung vollführenden „Marionettenspielers“ drängt, bürdet ihm damit unweigerlich auch die Schuld an Fehlern, Gewalt und Grausamkeit auf. Diese Rolle hat Gott nicht verdient. Zudem ist das, was heute auf der Erde kreucht und fleucht, alles andere als perfekt. Dieses Phänomen wird in einem späteren Kapitel noch ausführlich diskutiert. Aber wie ist das mit dem Bild eines allmächtigen Schöpfers zu vereinen – würdigt man ihn damit nicht zum unvollkommenen Experimentator herab? All dies passt weder zu dem biblischen Bild des gütigen Weltenlenkers noch zum evolutionären Bild einer im Hintergrund wirkenden Kraft. Die kreationistische Einstellung, die schöpferische Allmacht Gottes ließe keinen Platz für selbstorganisatorische und Naturgesetzen folgende Entwicklungsprozesse, ist eine reine Glaubenssache, die jedoch keine fassbaren Argumente gegen das Evolutionsgeschehen liefert. Selbstredend lassen sich gegenüber Glaubenseinstellung keine Widerworte finden – gerade das macht ja den „Glauben“ in seiner Bedeutung aus. Der renommierte britisch-amerikanische Anthropologe Ashley Montagu (1905–1999) hat das sehr treffend in Worte gefasst: „Die Wissenschaft hat Beweise ohne Sicherheit, der Kreationismus hat Sicherheit ohne Beweise.“
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dem Autor überhaupt nicht um eine Verurteilung kreationistischer Glaubensgrundsätze geht. Da sich diese jedoch a priori jeglicher wissenschaftlicher Argumentation entziehen, soll in dem vorliegenden Buch nicht näher auf diese besondere Form eines göttlichen Weltbildes eingegangen werden.
Eines sei jedoch abschließend nochmals herausgestellt. Die prinzipielle Zustimmung zum Darwin’schen Modell bedingt keineswegs die Ablehnung göttlicher Wirkungskraft. Ganz im Gegenteil scheint es kaum vorstellbar, dass das evolutionäre Geschehen ohne eine dahinterstehende, allumfassende Kraft möglich wäre. Entwicklung braucht einen Antrieb, bedarf aber nicht des ständigen direkten Eingriffs. „Gott macht, dass die Dinge geschehen“ – vielleicht beschreibt dieser einfache Satz am besten das komplexe Naturgeschehen.
Jedweder Konflikt zwischen Glauben und Naturwissenschaft ist unsinnig und kontraproduktiv. Glauben ist wissenschaftlich nicht überprüfbar. Die Existenz Gottes ist ebenso wenig beweisbar wie seine Nicht-Existenz.
Lücken in der Evolutionstheorie? – Ein aktueller Angriffspunkt
Als Charles Darwin 1859 seine geradezu revolutionäre Abstammungstheorie in dem legendären Werk „Von der Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ veröffentlichte, fehlten ihm natürlich etliche der heute erforschten Hintergrundinformationen. Ganze Wissenschaftsbereiche – allen voran die heute hoch spezialisierte Molekularbiologie mit ihren feinsten Analyseverfahren – waren damals noch gar nicht geboren. Darwins Theorie war ein rein empirisch ausgearbeitetes Modell. Es fußte auf eigenen umfangreichen Naturbeobachtungen und beinhaltete Gedanken, die schon frühere Generationen, bis hin zu den vorchristlichen griechischen Philosophen (Lukrez, Herodot) zurückreichend, entwickelten. Aus Mangel an Belegen fanden sie jedoch nie entscheidende Anerkennung. Darwin konnte nach seiner fünfjährigen Forschungsreise auf der „Beagle“, die ihn auch auf die Galapagosinseln führte, endlich eine Vielzahl fassbarer fossiler und rezenter Indizien liefern, die seine Theorie zur Artentstehung und -entwicklung stützten. Dass seine Arbeit dennoch auf erheblichen Widerstand stoßen sollte, hatte unterschiedlichste Gründe. Dabei spielten bei Weitem nicht allein wissenschaftliche Argumente eine Rolle. Tiefverwurzelte religiöse Vorgaben, die Angst, die Allmacht Gottes infrage zu stellen, veranlassten zahlreiche Zeitgenossen, die Darwin’schen Postulate von vornerein abzulehnen und damit sämtliche empirischen Befunde zu ignorieren.
Von der erwähnten, heute vor allem in den USA aktiven Kreationismusbewegung abgesehen, haben diese religiösen Dogmen sicher an Bedeutung verloren. Nichtsdestoweniger hat sich seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Kritikwelle an Darwins Deszendenztheorie aufgebaut, die man nach der rund fünf Jahrzehnte währenden erfolgreichen Etablierung kaum erwarten konnte. Die heutigen Kritiker glauben die Ergebnisse moderner Forschungsmethoden, angewendet auf rezente und fossile Lebensformen, nicht mit den Grundsätzen der Darwin’schen Abstammungslehre in Einklang bringen zu können. Lücken im ursprünglichen Modell, die zweifelsohne auch auf den seinerzeit beschränkten Forschungsmöglichkeiten beruhen, werden nun mit Details gefüllt, die nach Meinung der Darwingegner dessen Theorie ins Wanken, ja sogar zum völligen Einsturz bringen. Buchtitel wie „Das Darwin-Komplott“ (Reinhard Eichelbeck, 1999) oder „Darwins Irrtum“ (Hans-Joachim Zillmer, 2001) bringen das zum Ausdruck.
Was aber ist wirklich dran an diesen Gegenbewegungen? Halten sie einer kritisch-neutralen Prüfung stand? Im vorliegenden Buch wird versucht, detailliert auf die vehementesten Argumente und Belege der „Anti-Darwinisten“ einzugehen und sie einer unvoreingenommenen Beurteilung zu unterziehen. Einem solchen Vorhaben, nämlich sich mit einer Thematik zu befassen, deren Begründer uns leider nur noch in Form schriftlicher Überlieferung präsent ist, wohnt zweifelsohne eine gewisse Unsicherheit inne. Da der Protagonist keine Chance mehr zur direkten Stellungnahme hat, wird die Beantwortung diffiziler Fragen an verschiedenen Stellen auch zur individuellen Auslegungssache. Dennoch sollte anhand des überlieferten Materials in Kombination mit dem heutigen Kenntnisstand eine aussagekräftige Beurteilung möglich sein, welchen Stellenwert man den Grundzügen des von Darwin proklamierten Lebensbildes aus heutiger Sicht beimessen darf.
Darwin – ein Leben für die Naturwissenschaft
Charles Robert Darwin wurde 1809 auf dem Anwesen The Mount im englischen Shrewsbury, als fünfter Spross einer recht wohlhabenden Landarztfamilie geboren. Vater Robert und Großvater Erasmus waren erfolgreich als Mediziner tätig. Erasmus machte sich darüber hinaus als bedeutender Naturforscher einen Namen. Besonders der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Lebewesen galt sein Interesse. So formulierte er bereits die Idee einer Abstammung aller rezenten Lebensformen von gemeinsamen Vorfahren. Ihm fehlten aber ausreichend fossile und wissenschaftlich anerkannte Belege, um seiner These in der Fachwelt die nötige Anerkennung zu verschaffen. Sein berühmter Enkel Charles sollte später diese Vorstellungen des Großvaters zur Grundlage seiner Evolutionstheorie machen. Leider hatten beide nie die Gelegenheit, sich direkt auszutauschen, da Erasmus bereits 1802, sieben Jahre vor Charles’ Geburt, starb.
Vor diesem familiären Hintergrund war der Ausbildungsgang des jungen Charles mehr oder weniger vorgezeichnet. Zunächst galt es, die „normale“ Schule zu absolvieren. Dies tat Darwin mit eher mäßigem Erfolg, zumal die klassisch-humanistische Ausbildung nicht seinem wirklichen Interesse entsprach. Viel lieber beschäftigte er sich mit der Tier- und Pflanzenwelt, entwickelte hier eine wahre Sammelleidenschaft und interessierte sich sehr für naturwissenschaftliche Fragen. Gerade die wurden aber in der Schule äußerst stiefmütterlich behandelt. Der Vater hatte ein Einsehen und nahm den 17-jährigen Filius 1825 von der Schule. Der Familientradition entsprechend, begann Charles Darwin ein Medizinstudium in Edinburgh, was damals auch ohne Schulexamen möglich war. Begeistern konnte er sich aber nicht dafür. Sein Naturinteresse fand hier kaum Nahrung und die Sezierübungen sowie insbesondere die Brutalität von damals ohne Narkose durchgeführten Operationen überstiegen die seelische Belastbarkeit des eher zart besaiteten Studenten. Nach nicht einmal zwei Jahren war Charles’ medizinische „Laufbahn“ beendet. Er brach das Studium in Edinburgh ab. Der um die Zukunft des Sohnes besorgte Vater schrieb ihn daraufhin (1827) an der theologischen Fakultät in Cambridge ein – in der Hoffnung, er würde es zum Pfarrer bringen. Das recht umfassende Studienfach Theologie war zur damaligen Zeit durchaus kein unüblicher Studiengang für naturbegeisterte junge Leute. Bedeutende Naturforscher wie Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876) oder der legendäre Genetik-Begründer und Augustinerpater Johann Gregor Mendel (1822–1884) füllten zumindest einen Teil ihrer Hochschulausbildung mit dem Studium der Religionswissenschaften. Neben seinen durchaus gewissenhaft absolvierten theologischen Pflichten fand Charles Darwin genügend Gelegenheit, sich der geliebten naturwissenschaftlichen Materie zu widmen. Er kam mit renommierten Kapazitäten wie dem Geologieprofessor Adam Sedgwick (1785–1873), vor allem aber mit John Stevens Henslow (1796–1861) in Kontakt. Selbst Theologe, hielt Henslow als Botanik-Professor naturwissenschaftliche Vorlesungen in Cambridge, die Darwin mit Begeisterung besuchte. Zwischen beiden baute sich ein persönlicher Kontakt, bald sogar eine echte Freundschaft auf. Henslows umfassende Kenntnisse in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen beeindruckten den jungen Charles enorm und waren wegweisend für seinen weiteren Werdegang. Dank Henslows Vermittlung bot sich Darwin die Möglichkeit, an einer fünfjährigen Forschungsreise nach Südamerika auf dem Dreimaster „HMS Beagle“ (Her Majesty’s Ship) teilzunehmen. Zuvor hatte er im Januar 1831 sein Theologiestudium regulär mit Examen abgeschlossen. An eine berufliche Tätigkeit als Geistlicher der anglikanischen Kirche dachte er wohl nie. Vielmehr intensivierte er seine naturwissenschaftlichen Aktivitäten, nahm an Exkursionen teil und vertiefte sich in die Literatur.
Noch im Jahr seines Examens (1831) suchte die britische Regierung dann einen jungen Naturforscher für die Beteiligung an einer Forschungsfahrt, die der Kartierung des südlichen Teils Südamerikas – Feuerlands und Patagoniens – diente. Die Empfehlung Henslows bescherte Darwin ein Angebot, als persönlicher Begleiter von Kapitän Robert FitzRoy auf der Beagle „anzuheuern“, wenngleich die Heuer lediglich in Kost und Logis und nicht in barer Münze bestand. Die anfänglichen Einwände seines Vaters, der wenig Positives an dieser nicht vergüteten Fernreise finden konnte, hätten Charles` Traum beinahe platzen lassen. „Wenn Du auch nur einen Mann mit gesundem Menschenverstand findest, der Dir rät mitzufahren, dann will ich meine Zustimmung geben“, wetterte der Herr Papa wohl etwas leichtfertig in dem Glauben, sein größeren Aufwand scheuender Filius werde kaum einen kompetenten Fürsprecher für sich gewinnen können. Doch Charles wurde fündig – sogar im eigenen Familienkreis. Das flammende Plädoyer seines Onkels Josiah Wedgwood, der meinte, seinem Neffen käme nach dem eher leger absolvierten Studium ein prägendes Erlebnis für den weiteren Werdegang zugute, besänftigte Vater Darwin. Für Charles folgte die nach eigenem Bekunden wichtigste seinen Lebensweg bestimmende Zeit – die fünf Jahre auf der „Beagle“.
Die HMS Beagle an der Einfahrt zum Beagle-Kanal (Murray Narrows) in Feuerland.
Darstellung von Conrad Martens (1801-1878), von 1833 bis 1834 offizieller Schiffsmaler der HMS Beagle.
http://de.wikipedia.org
„Die Reise mit der ‚Beagle‘ ist bei weitem das wichtigste Ereignis in meinem Leben und hat meine ganze Laufbahn bestimmt.“1
Darwins Weltreise – zentrale Anstöße zur Entwicklung der Evolutionstheorie
Vom englischen Devonport im Dezember 1831 startend, führte die Route der Beagle quer über den Atlantik. Dabei wurden zunächst die Inselgruppen der Azoren und Kap Verden angelaufen. Weiter ging es nach Südamerika, dessen gesamte Küstenlinie vermessen wurde. Im Osten segelte man hinunter bis zu den Falklandinseln und nach Feuerland, ums Kap Hoorn herum und an der Westküste hinauf nach Norden zu den Galapagosinseln – für Darwin sicher ein Höhepunkt angesichts der unvergleichlichen Flora und Fauna dieses Archipels. Über den Pazifik segelte die Beagle dann über Neuseeland, Australien und Tasmanien über den Indischen Ozean nach Mauritius und die südafrikanische Küste entlang. Von dort führte die Route noch einmal nach Südamerika, um letztlich mit Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln im Herbst 1936 im heimischen England ihr Ende zu finden.
Galapagos Inseln © Alexander - fotolia.de
Seine Aufgaben als Crewmitglied boten Darwin Gelegenheit, geologische Formationen der verschiedenen Kontinente und Archipele umfassend zu studieren sowie ausführlich die Tier- und Pflanzenwelt samt deren fossiler Vorkommen zu untersuchen. Die Analyse der zahlreichen geologischen Fundstücke sowie die Erkenntnisse zu Morphologie und Verhalten der Tier- und Pflanzenwelt an verschiedenen Punkten der Welt sollte zur Grundlage eines Lehrmodells werden, das bis heute unser Verständnis von der Vielfalt der biologischen Varietäten und deren Rückführung auf gemeinsame Ausgangsformen prägt. Besonders die Beobachtungen auf den Galapagosinseln und die Fossilien aus Patagonien lieferten Darwin entscheidende Belege für die Entwicklung seiner Deszendenztheorie.
Durch die Herausgabe seines chronologisch geführten Reisetagebuches („Journal of Researches“) mit einer genauen Dokumentation seiner Eindrücke nur wenige Monate nach der Rückkehr machte Darwin seine Beobachtungen publik. Später folgten mehrere Bücher, in denen er seine geologischen Studien und biologischen Beobachtungen beschrieb. Bis zur Ausarbeitung und Veröffentlichung seines Lebenswerkes, der Veröffentlichung seiner Abstammungslehre, war es jedoch noch ein langer Weg.
Zu Darwins Zeit steckten analytische Labormethoden noch sehr in den Kinderschuhen. Naturwissenschaft war damit in erster Linie Beobachtungsforschung, die sicher auch einen großen Anteil philosophischer Interpretation beinhaltete. Umso größer darf die Bedeutung fassbarer fossiler und rezenter Belege für das Untermauern wissenschaftlicher Thesen und Postulate eingeschätzt werden. Davon stand Darwin durch die Reise um die Erde nun ein Füllhorn zur Verfügung, das es sorgfältig und deduktiv auszuwerten galt. Das sollte Darwin während der nächsten Jahre beschäftigen.
Entwicklung einer Theorie
Der Gedanke einer veränderlichen Welt, also der eigenständigen Entwicklung variabler, komplexer (Lebens)Formen aus einfachen Urformen, reicht bis in die Antike zurück. Verschiedene Philosophen (Lukrez, Herodot) veröffentlichten bereits Thesen, welche dem damals vorherrschenden Glauben an die Konstanz der von Gott geschaffenen Welt samt all ihrer existenten Lebewesen widersprachen. Natürlich beruhten diese frühen Theorien noch nicht auf exploratorischen Studien im heutigen Sinne. Naturbeobachtung und Lebenserfahrung gepaart mit philosophischer Kreativität brachten jedoch bemerkenswerte Denkansätze hervor – angesichts der praktisch fehlenden Analysemöglichkeiten eine beachtliche Leistung.
Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Ansätze, die das Dogma der Unveränderlichkeit alles Gottgeschaffenen angriffen und eine Weiterentwicklung vorhandener Formen ohne direkten göttlichen Eingriff postulierten. Die einflussreiche oft von der Kirche getragene Gegenbewegung verhinderte die Etablierung solch revolutionären Gedankengutes, indem sie die Protagonisten solcher Ideen mit aus heutiger Sicht martialischen Bestrafungen belegte. Die Allmacht Gottes, sein alleiniges schöpferisches Monopol stärkte die Position der Kirchenoberen. Zugeständnisse an eine allein von Naturgesetzen getragene eigenständige Entwicklung des gottgeschaffenen Lebens hätten diese Führungsposition nur schwächen können. Demzufolge wurden „gefährliche“ ideologische Tendenzen sofort im Keime erstickt.
Im Jahre 1798 veröffentlichte der britische Ökonom und Geistliche Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) eine Arbeit über das den Naturgesetzen folgende Wachstum menschlicher Populationen. Darin wird einem exponentiellen Bevölkerungswachstum eine nur linear ansteigende Nahrungsmittelproduktion gegenübergestellt, mit den negativen Folgen von Überbevölkerung, Hungersnot und Armut. In Darwins Theorie sollte diese Arbeit in seine Postulate von der Überproduktion von Nachkommen und der Selektion im Kampf um Nahrungsmittel einfließen.
Das Privileg, als Begründer einer ersten, detailliert ausgearbeiteten Evolutionstheorie in die Geschichte einzugehen, gebührt dem französischen Biologen und Mediziner Jean-Baptiste de Lamarck (1744 – 1829). Seine 1809, genau fünfzig Jahre vor Darwins Hauptwerk erscheinende „Philosophie zoologique“ beschreibt erstmals den Ablauf eines sich über längere Zeiträume vollziehenden Artenwandels. Zwar sollten sich die von Lamarck postulierten Mechanismen später als weitgehend unzutreffend erweisen, doch wurde das vor 1800 unumstößliche Dogma der Konstanz aller gottgeschaffenen Lebensformen nun endlich durchbrochen. Somit gebührt Lamarck die Ehre, die Tatsache der Veränderlichkeit der Arten erkannt und erstmals begründet formuliert zu haben, wenngleich er bezüglich der zugrunde liegenden Mechanismen irrte. Auf die Frage „Was geschieht?“ hat Lamarck somit wohl die korrekte Antwort gefunden. Doch beim „Wie?“ lag er größtenteils falsch.
Die Lamarck’sche Theorie zur Entwicklung komplexer aus einfachen Lebensformen fußt auf zwei Kernaussagen:
1. Aktive Umweltanpassung durch Gebrauch und Nicht-Gebrauch von Organen: Lamarck glaubte, Organismen würden sich durch gezielten Einsatz von Organen aktiv an die gegebenen Umweltbedingungen anpassen. Viel – allen voran zur Optimierung der Nahrungsversorgung – „trainierte“ Organe würden dadurch besonders stark entwickelt, wenig benutzte zurückgebildet. Als Paradebeispiel führt Lamarck unter anderem den Giraffenhals an, dessen Länge aus der gezielten Streckung zur besseren Erreichbarkeit von Nahrung resultiere.
2. Vererbung der durch Organgebrauch erworbenen Eigenschaften: Lamarck ging davon aus, dass die individuell im Laufe des Lebens durch aktive Umweltanpassung erzielten Veränderungen an die Nachkommen weitergegeben würden. Den Kindern eines Giraffenpaares, das es durch jahrelange Streckung zur „Langhälsigkeit“ gebracht hätte, würde diese von den Eltern antrainierte Eigenschaft gleich in die Wiege gelegt.
Lamarcks erstes Postulat erscheint aus heutiger Sicht noch bedingt plausibel. Die adaptive Wirkung des Gebrauchs unserer Muskeln etwa kann jeder Fitnesssportler bis hin zum Extrem des Bodybuilders am eigenen Körper nachvollziehen. Auch die gute Trainierbarkeit des Herzmuskels durch Ausdauerleistungen ist einwandfrei nachgewiesen. Dagegen ist Anpassungsfähigkeit anderer Körperorgane und strukturen deutlich beschränkt. Das beginnt schon bei den muskulären Hilfsstrukturen, den Bändern und Sehnen, die aufgrund ihrer nur geringen Trainierbarkeit zum verletzungsanfälligen Schwachpunkt eines übersteigerten Muskelwachstums werden. So hält auch die Lamarck’sche „Giraffenhalstheorie“ heute keiner ernsthaften Gegenargumentation mehr stand. Der aktiven Umweltanpassung individueller Organismen sind durch naturgegebene (nach heutiger Kenntnis genetisch determinierte) Beschränkungen enge Grenzen gesetzt.
Die zweite Forderung Lamarcks wurde zumindest bis vor wenigen Jahren als völlige Fehleinschätzung angesehen. Der Bodybuilder zeugt nicht automatisch ein besonders muskulöses Baby, und wenngleich die genetische Ausstattung dem Agassi/Graf’schen Nachwuchs wohlmöglich gute Voraussetzungen für koordinatives Geschick und sportliche Leistungsfähigkeit beschert, eine gute Vorhand, ökonomische Beinarbeit und taktische Finesse wird sich jeder der Sprosse im Falle einer Tenniskarriere durch eigenes Training neu aneignen müssen. Der noch junge Forschungszweig der Epigenetik, der sich die Aufdeckung der Regulationsmechanismen von Genaktivitäten zur Aufgabe gemacht hat, konnte jüngst einige vielleicht bahnbrechende Ergebnisse liefern. Demnach sind neben der reinen genetischen Ausstattung spezielle, durch chemische Modifikationen des Erbmaterials bewirkte Aktivierungsmuster der Genaktivitäten von nicht minderer Bedeutung für die individuelle Merkmalsausprägung. Besonders bemerkenswert ist dabei die Erkenntnis, dass diese Aktivierungsmuster nicht nur durch die persönliche Lebensführung (z. B. Ernährung, „Genussmittel“konsum, Bewegung, Stress) beeinflussbar sind, sondern auch entscheidenden Einfluss auf die Nachfolgegenerationen haben (z. B. hinsichtlich bestimmter Krankheitsrisiken). Offensichtlich gibt es also Eigenschaften, die durch den individuellen Lebensstil beeinflussbar sind und reproduzierbare Auswirkungen auf den Nachwuchs haben, obwohl sie nicht in unseren Genen festgeschrieben sind – sozusagen eine nicht genetische (sondern epigenetische) Merkmalsübertragung. Vor dem Hintergrund dieser brandneuen Einsichten erscheint die Lamarck’sche Theorie der Vererbung von individuell erworbenen Eigenschaften in einem ganz neuen Licht, und das überlegene Lächeln, das uns beim Lesen der Lamarck’schen Thesen überkam, ist aus unseren Gesichtern gewichen. Natürlich hatte Lamarck selbst noch keine Vorstellung von molekulargenetischen, geschweige denn epigenetischen Mechanismen. Angesichts des Wissensstandes der damaligen Zeit verdient seine Arbeit aber uneingeschränkte Anerkennung. Lamarcks Verdienst ist sicher, dass endlich mit dem bis dato absolutistisch herrschenden Dogma der Unveränderlichkeit aller Lebensformen gebrochen und erstmalig eine wissenschaftliche Erklärung für das Faktum der Artenvielfalt geliefert wurde. Nur mit einem so umfassend begründeten, sorgfältig ausgearbeiteten Modell konnte derartiges gelingen und die Evolutionsbiologie quasi aus der Taufe gehoben werden.
Festzuhalten bleibt: Lamarck hat die Tatsache der Veränderlichkeit der Arten in Abhängigkeit von den herrschenden Umweltbedingungen ganz richtig erkannt. „Nur“ bei den Mechanismen lag er zumindest nicht ganz richtig. Aktiv erworbene Eigenschaften haben auf die genetische Ausstattung eines Organismus keine Auswirkung und werden daher nicht per se in die nächste Generation getragen. Aber es gibt offensichtlich übergeordnete Steuerungsmechanismen, die ohne genetische Determinierung individuell beeinflussbar sind und Wirkung auf Nachfolgegenerationen entfalten. In einem späteren Kapitel werden Sie, verehrter Leser, noch etwas mehr über epigenetische Wirkungen erfahren.
Wenn die heutzutage einzig akzeptierte Deszendenztheorie Darwins bisweilen dem Larmarck’schen Vorläufermodel quasi diametral gegenübergestellt wird, ist dies nicht ganz korrekt. Im Grunde war Charles Darwin zu fünfzig Prozent Lamarckist. Das Postulat des Artenwandels und der Anpassung an gegebene Umweltbedingungen wurde von Darwin voll befürwortet. Auch dass durch Gebrauch oder Nicht-Gebrauch von Organen erworbene Wirkungen vererbt würden, erschien Darwin plausibel. Doch beim „Wie“, also bei der Frage nach den Funktionsabläufen von Anpassungsvorgängen, vertrat er eine gänzlich andere Auffassung als sein französischer Vorgänger. Eine aktive Umweltanpassung von Organismen durch den zielgerichteten Einsatz von Organen lehnte Darwin ab. Vielmehr proklamierte er eine primär ungerichtete Produktion von „Varietäten“ (heute sprechen wir von Mutationen). Erst die Selektion, also die Auslese günstiger Spielformen in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen des belebten und unbelebten Milieus, bringt eine Richtung in das Evolutionsgeschehen.
Auf eine ausführliche Behandlung von Darwins Arbeit soll an dieser Stelle verzichtet werden. Der interessierte Leser sei hier auf die zahlreich verfügbare Literatur verwiesen. Im weiteren Verlauf des vorliegenden Buches wird noch häufiger auf Detailfragen eingegangen. Somit seien hier lediglich die prägnanten Punkte des Darwin’schen Modells zusammengefasst.
Darwins Abstammungstheorie definiert die natürliche Auslese, also das selektive Überleben der am besten an die herrschenden Umweltbedingungen angepassten Individuen einer Art bzw. ganzer genealogischer Einheiten (Arten, Gattungen, Familien), als Triebfeder der Evolution. Dies gewährleistet eine ständige Prüfung und Optimierung der Adaptationsqualität an die wandelbaren Milieufaktoren und langfristig eine Entwicklung/Veränderung bis hin zur Entstehung neuer Arten oder höherer Einheiten. Evolution ist somit beileibe kein reiner Zufallsprozess, sondern resultiert aus dem permanenten Abgleich der Lebenspotenz individueller Organismen mit den aktuell herrschenden Umweltbedingungen. Dabei ist Evolution aber nicht vorhersehbar, kein teleologisch auf Höherentwicklung ausgerichteter Prozess.
Darwins Werk fußt auf seinen Untersuchungen zur Domestikation und vor allem auf seinen während der fünfjährigen Forschungsreise mit der Beagle dokumentierten Erkenntnissen.
Folgende Befunde bilden das Fundament, auf dem Darwin sein Modell errichtete:
1. Nachkommensüberschuss: Die Lebewesen „produzieren“ mehr Nachkommen, als zur Erhaltung ihrer jeweiligen Art nötig wären.
2. Ressourcenbeschränkung: Trotz Überproduktion an Nachkommen bleiben die Größen der Populationen (= Arten in geografisch begrenzten Räumen) abgesehen von saisonalen Schwankungen annähernd konstant.
3. Individualvariation: Individuen einer Art stimmen in ihren Merkmalen nicht vollkommen überein, sondern zeigen eine gewisse Variationsbreite.
Aus diesen Beobachtungen leitete Darwin folgendes Funktionsgefüge ab: Die Überproduktion von Nachkommen führt infolge des begrenzten Reservoirs an lebensnotwendigen Ressourcen zu einer Konkurrenz der Individuen einer Art bzw. Population um Nahrung, Wohnraum, Fortpflanzungspartner usw. Darwin nennt das „struggle for life“ („Kampf ums Dasein“). In diesem Wettbewerb werden nur diejenigen Artgenossen erfolgreich, d. h. überlebensfähig, sein, die aufgrund ihrer Merkmalsausprägung gut genug an die aktuell herrschenden Umweltbedingungen angepasst sind. Dieses von Darwin „survival of the fittest“ genannte „Angepasstsein“ ist somit kein aktiver Prozess – wie Lamarck es postulierte –, sondern resultiert aus der vererbten Kombination das Leben determinierender Merkmale. Über diese kompetitiven „struggle“-Mechanismen werden ständig die günstigen Merkmalskombinationen herausgefiltert. Weniger konkurrenzfähige Muster fallen aus Mangel an Potenz zur ausreichenden Nahrungsversorgung und Fortpflanzungsaktivität durch das von der Umwelt vorgegebene Raster. Sie werden aufgrund nur geringer Überlebens- und Fortpflanzungschancen ausgedünnt bzw. gehen im Laufe der Generationen ganz verloren. Dieser Prozess der natürlichen Selektion führt langfristig unter dem permanent auf die Individuen wirkenden „Bewährungsdruck“ zu einer Veränderung der Arten, zu einem vererbbaren Wandel ihrer Merkmalszusammensetzung. Es findet Evolution statt.
An dieser Stelle ist es angebracht, kurz auf eine weit verbreitete Fehlinterpretation des Darwin’schen Modells einzugehen, welche die vermeintliche „Zufälligkeit“ der Evolution zum Hauptkritikpunkt werden lässt. Aussagen wie „Gott würfelt nicht“ (ursprünglich von Albert Einstein nicht im Darwin’schen Kontext, sondern im Zusammenhang mit der Quantenmechanik geäußerte Erkenntnis) oder „Der Mensch – die Krone der Schöpfung – ein Produkt des Zufalls?“ ignorieren Darwins strikte Beschränkung des Zufallsmomentes auf die primäre Bildung neuer Merkmalskombinationen. Einzig die vererbbaren individuellen Merkmalskombinationen – wie wir heute wissen, durch Mutations- und Rekombinationsprozesse des genetischen Materials gebildet – sind bei ihrer Entstehung ungerichtet und zufällig. Aber die an jedem dieser Muster angreifende Selektion, der milieubezogene „Bewährungsdruck“, gibt dem Evolutionsprozess über den Mechanismus der natürlichen Auslese eine klare Richtung, die immer von den aktuell herrschenden Umweltbedingungen vorgegeben wird. Da diese Milieufaktoren ihrerseits wandelbar sind (z. B. Klimaveränderungen, Nahrungsverknappungen, Umweltkatastrophen etc.), ist Evolution kein starrer, unidirektionaler, sondern ein höchst dynamischer, aber keinesfalls zufälliger Prozess.
Somit belegen jegliche Einwände, eine Aneinanderreihung von Zufällen hätte niemals hoch entwickelte Lebensformen hervorbringen können, einzig die fehlende Detailkenntnis der Abstammungstheorie. Evolution als Produkt eines Würfelspiels zu simplifizieren, hieße die streng richtungweisende Kraft der natürlichem Selektion – also den Kernpunkt des Modells – völlig zu ignorieren. „Erwürfelt“ sind allenfalls die entstehenden Merkmalskonstellationen – quasi die Augenzahlen auf den Würfeln oder das Blatt auf der Hand des Skatspielers.
Doch wenn die Karten dann auf den Tisch gelegt werden, gibt es nur noch eine Richtung, einen Selektionsdruck, möglichst viele Stiche zu ergattern, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wer zufällig schlechte Karten erhalten hat, fällt der Selektion zum Opfer. Gleichzeitig zeigt diese Metapher, wie gewandelte Umweltbedingungen den Selektionsdruck verändern können. Ist eine „Ramschrunde“ (für NichtSkatspieler: hier gilt es, möglichst wenig Stiche zu machen) angesagt, wird der zuvor so erfolgreiche „Grand mit Vieren“ zum Versager und wird von der neuen Selektionsrichtung „ausgemerzt“.
Natürlich kann dieser Ausflug in die Spielwelt kein in allen Punkten analoges Abbild der Evolution des Lebendigen liefern. So wird etwa ein erfolgreiches Blatt nicht auf die nächste Spielrunde „weitervererbt“, sondern das Zusammenspiel von Zufall (Mischen und Geben) und Auslese (erfolgreiches Spiel) beginnt jedes Mal von Neuem. Außerdem sind beim Skat auch andere Faktoren (z. B. Spielerfahrung, Nervenkostüm) ausschlaggebend. Doch um das reine Zufallsmoment von den richtungweisenden Selektionsvorgaben abzugrenzen, ist das Beispiel doch recht anschaulich.
Publikation mit Verzögerung – Wallace sei Dank!
Erst die Befürchtung Darwins, der in engem Kontakt mit ihm stehende Alfred Russel Wallace (1823–1913) könnte durch Publikation seiner eigenen Arbeit als Erster die Evolutionstheorie der Öffentlichkeit zugänglich machen, gab ihm den entscheidenden Anstoß, nun endlich sein Hauptwerk „On the origin of species“ auf den Markt zu bringen – mehr als zwanzig (!) Jahre nach Abschluss der Beagle-Reise.
Im Gegensatz zu dem finanziell praktisch unabhängigen Darwin stammte Wallace aus weit weniger wohlhabenden Verhältnissen. Als zweitjüngster Spross einer elfköpfigen Familie in der Grafschaft Monmouthshire – dem heutigen walisischen Gwent – geboren, musste er seine spätere Karriere als Naturforscher durch harte Arbeit in verschiedenen Metiers, etwa als Uhrmacher, Landvermesser und Lehrer, finanzieren. Auch hatte er nicht das Glück, als Crewmitglied kostenlos an einer staatlich subventionierten Forschungsreise teilnehmen zu dürfen. Dennoch unternahm Wallace zwei große Überseereisen, die er freilich selbst organisieren und bezahlen musste. Die erste Fahrt führte ihn 1848 in Begleitung des Zoologen H. W. Bates nach Südamerika ins Amazonasgebiet, wo er vier Jahre verweilte. Tragischerweise ging das dort umfangreich gesammelte Material auf der Heimreise 1852 bei einem Schiffbruch komplett verloren, sodass Wallace sich geradezu verpflichtet sah, möglichst bald noch einmal auf große Fahrt zu gehen. So brach er bereits zwei Jahre später (1854) erneut auf, diesmal allein. Über Singapur verschlug es ihn auf den Malaiischen Archipel, wo er acht (!) Jahre mit ausgiebiger sammlerischer Aktivität verbrachte. Die überwältigende tierische wie pflanzliche Formenvielfalt ließ hier in Wallace völlig unabhängig von seinem prominenten Landsmann seine schon früher gereifte Idee des Artwandels und der Wirkung der natürlichen Auslese im Kampf ums Dasein geradezu aufblühen. Glücklicherweise verlief die Heimreise diesmal weniger verlustreich. Ähnlich wie bei Darwin waren es die auf diesen Auslandreisen gemachten Naturbeobachtungen, die in Wallace den Gedanken der Veränderlichkeit der Arten und die Idee des Selektionsprinzips auf Grundlage eines Kampfes ums Dasein aufkeimen ließen. In zwei Aufsätzen (1856 und 1858) formulierte Wallace die Grundzüge seiner Theorie.
Es ist erstaunlich, wie das von Wallace entwickelte Evolutionsmodell dem Darwins selbst in Detailfragen ähnelt. Zwar verwendet Wallace nicht explizit den Begriff „natural selection“, doch ist seine Umschreibung derart unmissverständlich, dass das Ausleseprinzip, das Überleben der bestangepassten im Kampf ums Dasein (diesen Ausdruck gebraucht auch Wallace), klar zutage tritt.
Im Nachhinein mag es als schicksalhaft erscheinen, dass der wahrlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsene Wallace das Manuskript seiner Theorie zur Begutachtung ausgerechnet an seinen vermeintlichen Konkurrenten Darwin sendete. Von ihm glaubte Wallace sich verstanden. Darwin muss überaus beeindruckt gewesen sein, als er die eigenen Modellvorstellungen in nahezu identischer Weise äußerst klar und präzise formuliert vor Augen geführt bekam. Sein langes Zögern, sich nicht zur Publikation seines eigenen Werkes entschließen zu können, mag Darwin in diesen Augenblicken Anlass zu einigen Selbstvorwürfen gegeben haben. Wie konnte er jetzt noch die Ehre des alleinigen „Begründers“ des Evolutionsmodells für sich beanspruchen, ohne dadurch das Gesicht zu verlieren, wenn er die Arbeit von Wallace zurückhielt. Auf Anraten seines Mentors Charles Lyell (1797-1875) reichte Darwin daher einen Auszug seines eigenen Manuskriptes gemeinsam mit dem Elaborat Wallaces beim „Journal of the Proceedings of the Linnean Society“ zum Abdruck ein. Auf diese Weise wahrte Darwin seine moralische Integrität, und beide Autoren erfuhren die ihnen gebührende Gerechtigkeit. Ein Prioritätsstreit war somit vermieden. Freilich beeilte sich Darwin, nun endlich sein nach zwei Jahrzehnten geradezu überreifes Werk „On the origin of species by means of natural selection“ auf den Markt zu bringen, was ihm zumindest heutzutage den ungeteilten Ruhm des Begründers der Deszendenztheorie einbringen sollte. Es ist wirklich bewundernswert, wie der „Underdog“ Wallace das Vorpreschen Darwins neidlos und vorwurfsfrei tolerierte und auf die ihm gleichermaßen gebührende Ehrzuweisung verzichtete. Ganz im Gegenteil hörte Wallace zeitlebens nicht auf, Darwins Lebenswerk frei von jeglichem Groll zu würdigen. In seinem 1891 erschienenen Werk „Der Darwinismus“ beschreibt er die eigene Auslese-Theorie in einer Weise, die die Leistung Darwins aufs Höchste würdigt. Darwin seinerseits war vom fairen und selbstlosen Verhalten seines „Konkurrenten“ aufs Tiefste berührt und hat ihm das mehrfach in persönlichen Korrespondenzen übermittelt.
Kehren wir nun zum eigentlichen Thema des vorliegenden Buches zurück, so mag es Wallace zum Trost gereichen, dass er sich posthum nicht der Angriffe moderner Kritiker erwehren muss, die allein gegen Charles Darwin gerichtet sind.
1 Nora Barlow (Hrsg.): The Autobiography of Charles Darwin 1809–1882. With the Original Omissions Restored. Edited and with Appendix and Notes by his Grand-daughter Nora Barlow. 1958 deutsch zuletzt Insel Verlag, Frankfurt, S. 76.
2 Aufgrund der nur minimalen genetischen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Völkergruppen ist man heute von dieser Rasseneinteilung weitgehend abgekommen.
Teil I: Die Anti-Darwin-Komplotteure
Schweres Geschütz - droht ein Weltbild zu zerplatzen?
„Das Darwin-Komplott“ (Eichelbeck, 1999), „Darwins Irrtum“ (Zillmer, 2001) – so oder ähnlich lauten Titel gegenwärtiger Autoren, die in teils schon vernichtender Weise das Lebenswerk Darwins zu zerstören versuchen – und das, obwohl es als das bislang am besten belegte naturwissenschaftliche Modell unser Verständnis der Formenvielfalt auf der Erde prägt. Von einem Komplott wird in den Büchern gesprochen, von einer unrechtmäßigen Fürsprache unbelehrbarer Darwinisten, die wider besseren Wissens und in Ignoranz augenscheinlicher Fakten einem Modell die Treue halten, das nach Kritikermeinung nicht haltbar sei. Von einem Irrtum ist die Rede, der sich durch neue archäologische Funde, besondere fossile Fußspuren in Gesteinsschichten, belegen ließe. Was eigentlich schon voll akzeptiert schien und im Verständnis des überwältigenden Gros der Vertreter aller naturwissenschaftlichen Disziplinen weiterhin auf stabilen Füßen steht, erfährt im noch jungen 21. Jahrhundert das laute Aufbegehren einer hartnäckigen Fraktion wissenschaftlichen Anspruch erhebender Kritiker. Über deren Motive soll aus Gründen der Neutralität kein Urteil gefällt werden, bevor ihre Argumente auf „Herz und Nieren geprüft“ sind. Ebendieses Ziel hat sich das vorliegende Buch gesetzt.
Wie alles begann – Leben aus dem Nichts?
Eine Kernaussage der Evolutionstheorie besagt, dass alle rezenten und ausgestorbenen Lebensformen letztlich auf einen gemeinsamen Urahnen, eine primäre einfache Lebensform zurückzuführen sind. Wie diese aus unbelebter Materie entstehen konnte und wie sie beschaffen war, darüber gibt es mittlerweile Theorien, die interdisziplinär, unter Einbeziehung modernster Verfahren der Molekularbiologie, Biochemie, theoretischen Physik bis hin zu den Astrowissenschaften entwickelt wurden. Gegenstand des von Darwin entwickelten Abstammungsmodells ist diese Übergangsfrage von „unbelebt“ zu „belebt“ aber nie gewesen. Klar gesagt: Darwins Deszendenzmodell hat nicht die Entstehung von Leben zum Inhalt und sagt nichts über Aussehen und Morphologie des postulierten Urahnen. Es beschreibt lediglich den Mechanismus des Artwandels in Abhängigkeit von den veränderlichen Milieufaktoren (belebte und unbelebte Umwelt, Klima, Nahrung usw.). Dennoch ebben die Einwände der Kritiker nicht ab, die Lebensentstehung sei mit Darwins Theorie nicht erklärbar. Einige halten einen Gott dafür erforderlich, der dann auch für jeden weiteren Einzelschritt im Weltgeschehen schöpferisch tätig sein soll. Andere beschränken sich auf die Kritik an Darwin und lassen alle offenen Fragen unbeantwortet im Raume stehen. Egal wie, die Diskussion um die Lebensentstehung gehört nicht in eine Debatte um die Glaubwürdigkeit des Evolutionsmodells, da sie gar kein Teil davon ist. Auf die Logik und das fossile wie rezente Fundament der Deszendenztheorie hat die Unkenntnis der primären Lebensentstehung somit überhaupt keinen Einfluss. Ob das Leben auf der Erde entstanden ist oder an einem anderen Ort im Universum und von dort aus zu uns kam – auch diese Vorstellung ist denkbar, ohne unbedingt ein Anhänger Erich von Dänikens zu sein –, ist bis heute ungeklärt. Von einer Abstammungstheorie dürfen wir die Lösung aber nicht erwarten. Die fehlende Erklärbarkeit der Lebensentstehung auf die Evolutionstheorie zu fokussieren ist ein „Schuss auf die falsche Zielscheibe“. Der Vorwurf, Darwin habe nicht erklären können, wie das Leben entstand, entspräche der Schmähung eines Arztes, der Leiden durch wirkungsvolle Therapiekonzepte zu lindern vermag, aber über die genauen Ursachen der Entstehung von Krankheiten keine Aussage machen kann. Und derartige Krankheiten gibt es wahrlich genug. Kritik ist jederzeit erlaubt und prinzipiell produktiv – vorausgesetzt, sie betrifft die wirklichen Inhalte des beurteilten Objektes. Jedes bis heute entwickelte wissenschaftliche Modell beschreibt nur einen Teilaspekt des Phänomens „Leben“ – auch das der Abstammung. Dass es noch sehr viele Lücken gibt, will anscheinend so mancher nicht wahrhaben. Was Darwin geleistet hat, ist enorm – warum erwartet man gerade von seinem Modell noch so viel mehr?
Gegenstand des Evolutionsmodells ist nicht die Frage der Neuschöpfung, sondern einzig der Mechanismus von Veränderung und Formenwandel.
Adaptive Entwicklung – warum?
Eine gängige Kritik bezieht sich auf die Kausalität der adaptiven Veränderung eines Organismus bzw. eines Organs. Weder Darwin noch einem der heutigen Darwinisten sei es je gelungen, eine ursächliche Erklärung für evolutive Anpassungsprozesse zu liefern. Es geht also um das „Warum?“. Diese Frage ist in solch einem Zusammenhang ebenso (wenig) sinnvoll wie die Frage nach dem Sinn des Lebens überhaupt. Es ist richtig, dass niemand erklären kann, warum sich Leben auf unserem Planeten überhaupt entwickelt hat und warum es unzweifelhaft Veränderung erfährt. Dass es Mutationen gibt, die Wandel – positiv wie negativ (Krankheiten) – bewirken, ist unstrittig bewiesen. Dass Krankheiten zum Tod führen können, müssen wir schmerzlich erleben. Aber warum das alles so erfolgt, werden wir nie erfahren, zumal wir als denkende Wesen alles stets vor dem Hintergrund des uns selbst gegebenen Wertemaßstabs beurteilen. „Gut“ und „schlecht“, „sinnvoll“ und „unsinnig“ beziehen wir immer auf unsere eigenen humanen Motive und Vorstellungen. Dass in unserer Anschauung „Gutes“ nicht per se einen Bonus für den Rest der Welt darstellen muss, ist eine Realität, der wir uns zu stellen haben. Doch um nun nicht zu sehr ins Philosophische abzugleiten, zurück zur Ausgangsfrage: Warum muss es Veränderung geben? Niemand kann eine Antwort darauf finden. Es ist ein Fakt, den der Mensch zu akzeptieren hat – auch wenn sein unruhiger Forschergeist es nicht wahrhaben will. Nach den Ursachen des adaptiven Wandels zu fragen ist zwar menschlich verständlich, ihn jedoch abzulehnen, nur weil die Kausalität uns nicht zugänglich ist, kommt der Ablehnung des Naturgesetzes der Massenanziehung gleich, nur weil wir nicht erklären können, warum der Apfel zu Boden fällt anstatt nach oben zu schweben. Der Vorteil beim Apfel ist, dass wir seinen Fall jederzeit überprüfen können. Die kausale Frage – warum sich Massen anziehen müssen – ist aber ebenso wenig geklärt wie die Frage nach dem Sinn bzw. den Ursachen des adaptiven Wandels von Organismen. Aber käme jemals jemand auf die Idee, die Theorie der Massenanziehung, uns allen in Form der Erdanziehungskraft tagtäglich gegenwärtig, infrage zu stellen und Isaac Newton einen „Ketzer“ zu schimpfen? Es gibt sicher mehr Dinge in der Welt, die sich unserem (überschätzten) Intellekt entziehen, als wir es bisweilen wahrhaben möchten.
Der blinde Zufall – das missverstandene Reizthema Nr. 1
Echauffierten sich die zeitgenössischen Kritiker Darwins – von der angeblichen Minderwertschätzung Gottes abgesehen – vor allem über die Zumutung einer „äffischen“ Vergangenheit der (selbst ernannten) „Krone der Schöpfung“, geben sich die aktuellen Angreifer über diesen die Menschenehre verletzenden Affront erhaben – zumindest in ihrer öffentlich geäußerten Meinung. Nichtsdestoweniger ist ihre Kritik vielfach ebenso monopunktuell fokussiert. Schon die Möglichkeit, dass ihre Beanstandungen auf Missverständnissen oder fehlender Detailkenntnis der Darwin’schen Prinzipien beruhen könnten, wird offenbar ausgeschlossen. Auf Lernbereitschaft hofft man hier wohl vergeblich. Worum geht es? Die Entrüstung richtet sich gegen Darwins „Zufallskomponente“. Dass ungerichtete Variationen (heute als Mutationen und Rekombinationen des Erbgutes identifiziert) für geringfügige phänotypische, also im Erscheinungsbild wirksame, Merkmalsänderungen verantwortlich sein sollen, die dann zum Angriffspunkt einer Selektion werden, erregt den Unmut zahlreicher Kritiker. „Blinder Zufall“ als Produzent hochorganisierter biologischer Organismen? Im Grunde sind wir hier gar nicht so weit weg von der früheren Entrüstung über unsere möglicherweise „affigen“ Urahnen. Schon 1952 verglich der englische Embryologe und Genetiker C. H. Waddington die Entwicklung komplexer biologischer Mechanismen durch Selektion zufälliger Variationen, die „durch blinde Glückstreffer“ entstanden seien, mit der Wahrscheinlichkeit einer Gebäudeerrichtung durch wahlloses Aufeinanderwerfen von Ziegelsteinen. In dieser und ähnlichen Metaphern stecken zwei Kardinalfehler, die Missachtung zweier ganz wesentlicher Punkte des Evolutionsmodells.
1. Das Geringfügigkeitspostulat: Darwin hat aufgrund seiner umfangreichen Beobachtungen gefolgert: Evolution verläuft nicht in großen umwälzenden Sprüngen, sondern als unregelmäßige Aufeinanderfolge minimaler Veränderungen, von denen jede seinen Trägern einen kleinen Vorteil bringt – die „fitness“ um ein Quäntchen steigert. Erst die Aneinanderreihung vieler Kleinstveränderungen über sehr lange Zeiträume bringt die augenscheinliche Adaptation, die entscheidende Optimierung und Weiterentwicklung. Die Darwin’sche Evolution ist also eine akkumulierende Evolution der kleinen Schritte und keine sprunghafte Megaentwicklung. „Natura non facit saltus!“3
2. Der Faktor „Zeit“: Die Zeiträume, die der biologischen Evolution bis heute zur Verfügung standen, sprengen die von uns Menschen fassbaren Dimensionen bei Weitem. Für uns sind lediglich Zeitintervalle vorstellbar, die unser individuelles Dasein bestimmen. Mit Sekunden und Minuten können wir umgehen, und mit zunehmendem Lebensalter bekommen wir ein Gefühl für Jahre und vielleicht Jahrzehnte. Aber mehr als ein Jahrhundert irdischen Daseins – wenn überhaupt – ist kaum einem von uns vergönnt. Und damit sind die Grenzen unserer Begrifflichkeit vorgegeben. Schon eine Zehntelsekunde oder in anderer Richtung der gern von uns verwendete Milleniumsbegriff sind streng genommen für den Menschen rein intellektuelle Vokabeln, denen der gefühlsmäßige Hintergrund fehlt. Aus evolutionärer Sicht hingegen sind solche Zeiträume so vernachlässigbar klein, dass die sichtbare Neubildung abgrenzbarer taxonomischer (systematischer) Einheiten innerhalb derartiger Perioden einer Sensation gleichkäme, die den Lotto-Sechser zum überaus wahrscheinlichen Ereignis erheben würde. Der Begriff der Endlichkeit, der all unser Denken, Handeln und Dasein beschränkt, hat im Evolutionsgeschehen keine restriktive Funktion bzw. ist womöglich gar nicht existent.
Von der menschlichen Vorstellung von Anfang und Ende müssen wir uns vielleicht frei machen, wenn wir über Evolution nachdenken. Das Erdalter liegt nach heutigen Erkenntnissen bei etwa 4,6 Milliarden Jahren. Das Auftreten der ersten Zelle wird auf drei Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung datiert. Was über einen derartig langen Zeitraum in einem „experimentierfreudigen“ Milieu in punkto Variantenproduktion erfolgen kann, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Es gab fast unbegrenzte Testmöglichkeiten, Zeit spielte keine Rolle. Der „Evolutionsbaum“ ist ein in alle Richtungen ausufernd gewachsenes Gebilde mit mannigfachen Verästelungen. Und jeder Seitenast musste und muss sich dem Druck der Selektion stellen. Hier wird über sein weiteres Schicksal entschieden – blindes Ende, toleriertes „Durchwurschteln“ oder blühender Erfolg. Ganz sicher gab es unzählige Sackgassen und Fehlversuche – womöglich weit mehr als sinnvolle (bzw. uns Menschen sinnvoll erscheinende) Veränderungen. Aber es gab eben auch die erfolgreichen, die sich vielleicht über eine längere Periode, ein paar Hunderttausend, andere gar einige Millionen Jahre durchgesetzt haben. Dabei kam es immer und immer wieder zu Aufspaltungen und Verästelungen, die Formen hervorbrachten, welche längere Phasen nebeneinander im gleichen Lebensraum existieren konnten. Die einzelnen Veränderungen waren minimal, große Umwälzungen wären vom wandelbaren Milieu womöglich gar nicht toleriert worden. Aber über den unvorstellbar großen Zeitraum – und nur über diesen – hat es zur Entwicklung derart komplex agierender biologischer „Gebilde“, wie wir sie im gegenwärtigen Tier-, Pflanzen- und Mikroorganismenreich vorfinden, kommen können. Nichtsdestotrotz ist keine Linie, selbst nach Millionen von Jahren währendem Erfolg, gegenüber zukünftigem Aussterben immun – man denke nur an die Saurier. Und hinsichtlich unseres eigenen Schicksals mag man kaum Vermutungen anstellen – erscheinen einige Entwicklungen gar zu bedrohlich. Die fehlende Produktion geeigneter Varianten, die einen hohen Anpassungsgrad an veränderte Milieubedingungen aufweisen, kann im Falle einschneidender Umweltprozesse vergleichsweise schnell zum limitierenden Faktor werden. Die Diskussion um den zumindest teilweise anthropogenen (vom Menschen verursachten) Klimawandel ist hochaktuell. Unsere Lebensweise könnte zum Selbstmordkommando werden. Angesichts der im Vergleich zu anderen rezenten Lebensformen wahrlich sehr kurzen Zeitspanne von gerade einmal 200 000 Jahren, die „Homo sapiens“ bislang auf der Erde verbringen durfte, werden wir im Falle unseres „baldigen“ Abganges sicher als Fehlversuch oder unbedeutender Seitenast in die Evolutionsgeschichte eingehen.
Vor dem Hintergrund dieser Kernpunkte der Evolutionstheorie verliert die Aussage all jener Kritiker, die die biologische Evolution für ebenso wahrscheinlich halten wie die Konstruktion eines Jumbojets durch blindes Wüten eines Orkans über einem Schrottplatz, jegliche Sinnhaftigkeit.4 Sie berücksichtigt weder Darwins Postulat der akkumulativen Minimalveränderungen noch das Postulat der unvorstellbar langen Zeiträume, die schier unendliche viele experimentelle Chancen bieten. Wenn man über 140 Millionen Lottoscheine mit allen denkbaren Zahlenkombinationen ausfüllt, dann wird der 6er mit Zusatzzahl ganz sicher dabei sein. Keine Kombination ist wahrscheinlicher als irgendeine andere. In der Realität fehlt für solch einen 100 %-Tipp sicher das Geld und auch die Zeit. Der Evolution aber stand beides – Zeit und Material – in ausreichendem Maße zur Verfügung. Zu erwarten, mit einer einmaligen wahllosen Steinwurfserie ein Haus zu errichten, käme der Aussage gleich, die Evolution von der Ursprungszelle bis zur heutigen biologischen Komplexität sei geradlinig durch zufällig immer optimale Makroveränderungen erfolgt. Ein solches Gerücht hat weder Darwin noch irgendeiner seiner Anhänger jemals in Umlauf gebracht.
An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs erlaubt, der ein wenig zum Nachdenken über unser humanes Selbstverständnis beitragen möchte und einen oft von uns verwendeten Begriff hinterfragt, als dessen Vorzeigeobjekt wir uns nur allzu gern (aber auch zu Recht?) präsentieren: „Höherentwicklung“. Was hat das mit der Plausibilitätsfrage von Darwins Arbeit zu tun? Wer bereit ist, ein wenig hinter die humane Fassade zu schauen, wird es erraten.
Höherentwicklung – was ist das?
Ob nun als „Krone der Schöpfung“ oder als gegenwärtiger Gipfel der Evolution, ob Kreationist oder Darwinist, der Mensch sieht sich als Maß aller Dinge. Die humane Lebensform scheint uns die komplexeste und derzeit höchstentwickelte zu sein, die es je auf dieser Erde gegeben hat. Gegenteiliges zu behaupten, konnte noch vor (selbst in menschlichen Dimensionen) gar nicht allzu langer Zeit als ketzerisch gelten und somit höchst bedrohlich für das persönliche Dasein. Heutzutage ist dieses Risiko zumindest in zivilisierten Breiten minimiert. Nichtsdestoweniger macht sich kaum jemand über den menschlichen Egozentrismus und noch weniger über die evolutive Fehldeutung menschlicher Existenz Gedanken. Keine Angst! Dies wird keine philosophische Spinnerei. Doch ist es wohl eine Tatsache, dass wir das Funktionieren unseres Organismus oder, etwas weiter gefasst, der Organismen aller heute existierenden „höheren“ Tier- und Pflanzenarten, als die filigransten und perfektesten „Lebensmaschinerien“ verstehen, die unseren Planeten je bevölkerten. Mögen ihre Anfänge nun Milliarden von Jahren oder der kreationistischen Vorstellung gemäß nur wenige Tausend Jahre zurück liegen. Ein komplexes Lebenssystem wie das unsere mit der Leistungsfähigkeit der zellulären Maschinerie eines Mikroorganismus, etwa einer Bakterie oder eines Hefepilzes, zu vergleichen, kommt uns kaum in den Sinn. Zu gravierend scheint die Distanz im entwicklungsgeschichtlichen Raster. Doch machen wir uns eigentlich klar, dass die kleinste Mikrobe alle wesentlichen Lebensäußerungen, für die wir heute rund 100 Billionen Zellen benötigen, in einer einziger Zelle zu vereinen vermag? Dass sie es außerdem geschafft hat, Lebensräume zu erobern, die mit dem, was wir „höheres Leben“ nennen, absolut nicht vereinbar sind? Man denke etwa an ein Bakterium namens Mikrococcus radiodurans, das im Kühlwasser von Kernreaktoren unter „strahlenden“ Bedingungen, die ein Vielfaches der menschlichen Letaldosis bieten, bestens gedeiht. Ein anderes Bespiel unter Tausenden ist Streptococcus thermophilus, ein Bakterium, das sich im Wasser von Geysiren erst so richtig „wohlfühlt“, bei Temperaturen, die den Großteil humaner Proteine denaturieren ließen. Viele anaerobe (nicht auf Sauerstoff angewiesene) Bakterien überleben in sauerstoffarmen Biotopen, die dauerhaftem „höherem“ Leben immer verschlossen sein werden – und zwar auch als Zufluchtsorte in Katastrophenzeiten.